Kirchen
Leyendecker bekräftigt Nein zur AfD auf Kirchentags-Podien

epd-West/Hoeffchen
Bielefeld (epd). Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hat die Entscheidung verteidigt, keine AfD-Vertreter zur aktiven Teilnahme am Deutschen Evangelischen Kirchentag im Juni in Dortmund zuzulassen. "Wir laden keine Hetzer und keine Rassisten ein", sagte er am 20. November in Bielefeld. Allerdings solle es Foren geben, in denen Menschen zu Wort kommen, die die AfD wählen oder mit der Partei sympathisieren. Auch Präses Annette Kurschus, leitende Theologin der gastgebenden westfälischen Kirche, stellte sich hinter den Beschluss des Kirchentagspräsidiums. AfD-Politikern dürfe "kein Podium für ihre populistische Propaganda" geboten werden.
"Wir wollen nicht, dass diese Parolen, die teilweise menschenverachtend, menschenverhetzend und voller Hass sind, durch unsere Veranstaltung verstärkt verbreitet werden", sagte Kurschus, die auch stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist, dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Natürlich müssen wir auch mit führenden AfD-Vertretern im Gespräch bleiben, ich möchte ihnen aber keine öffentliche Bühne bieten." Wichtig sei das Gespräch mit Menschen, die mit Positionen der AfD sympathisieren: "Nicht alle sind überzeugte Populisten und Menschenverächter."
Leyendecker sagte dem epd, die AfD habe sich seit 2017 noch weiter nach rechts entwickelt und es gebe eine "offene Hinwendung zum Nationalsozialismus". Deshalb setze der Kirchentag ein Zeichen, indem er keine AfD-Funktionäre auf Podien und in Diskussionen mitwirken lasse: "Ich glaube, dass die Zeit der Alibis, der Taktiererei, der ewigen Frage, ob man die Partei zum Märtyrer macht, vorbei ist." AfD-Politiker könnten "an Gottesdiensten teilnehmen oder bei einer Bibelarbeit dabei sein, wo immer sie wollen, sie kommen aber nicht auf Podien".
Sorgen um den Arbeitsplatz
Anders sei es mit Anhängern und Wählern: Sie sollten in Foren zu Wort kommen und über ihre Situation und ihre Probleme sprechen. Viele Menschen hätten heute das Gefühl, sie seien mit ihren Sorgen um den Arbeitsplatz, die Rente oder die Wohnung allein, ihnen höre niemand zu und sie würden nicht verstanden. "Die sozialen Verwerfungen in unserem Land müssen deutlich zur Sprache kommen", betonte Leyendecker.
"Wir wollen das Gespräch mit allen suchen, die an wirklichen Gesprächen interessiert sind." Daher sollten sich alle ausdrücklich eingeladen fühlen, "denen die Versprechen und Positionen der AfD als gute Antworten auf die aktuellen politischen Herausforderungen erscheinen".
Leyendecker erinnerte daran, dass der Kirchentag auch gegründet worden sei, weil die Kirche während der NS-Herrschaft versagt habe. "Die vor uns waren, haben bei verschiedenen Gelegenheiten Flagge gezeigt, und wir tun das jetzt auch", betonte der Kirchentagspräsident vor der Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen, die auf seine Worte mit kräftigem Applaus reagierte.
"Roter Faden Migration"
Insgesamt soll der Dortmunder Kirchentag nach den Worten seines Präsidenten theologisch, politisch und unbequem sein. Er wünsche sich einen "Kirchentag der klaren Worte", der die Vielfalt der gesellschaftlichen Positionen in einen Dialog bringe, sagte Leyendecker. Aber nicht nur Probleme und Krisen würden thematisiert, sondern an einem "Ort der guten Nachrichten" würden auch Erfolge und Hoffnung ins Blickfeld gerückt. Ein "Roter Faden Migration" soll sämtliche Programminhalte durchziehen und das interreligiöse Programm soll "trialogische Veranstaltungen" von Juden, Christen und Muslimen anbieten.
Das komplette Programm des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages vom 19. bis 23. Juni mit mehr als 2.000 Veranstaltungen wird im März vorgestellt. Unter anderem soll es 400 Gottesdienste und 800 Konzerte geben. Zu den drei Eröffnungsgottesdiensten werden 80.000 Menschen erwartet, zum anschließenden Abend der Begegnung rund 250.000. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 100.000 Dauerteilnehmern. Das Treffen steht unter der Losung "Was für ein Vertrauen".
Kirchentag soll Gräben in der Gesellschaft überwinden helfen

epd-bild/Friedrich Stark
Bielefeld (epd). Kirchentagspräsident Hans Leyendecker sieht keine Alternative zur Entscheidung, AfD-Funktionäre von Podien und Diskussionen auf dem kommenden Kirchentag in Dortmund auszuschließen. "Es wäre doch auch niemand auf die Idee gekommen, NPD-Leute oder Republikaner einzuladen", sagte Leyendecker dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Bielefeld. "Ich glaube, dass die Zeit der Alibis, der Taktiererei, der ewigen Frage, ob man die Partei zum Märtyrer macht, vorbei ist. Hier muss man Zeichen setzen." Die Opferrolle nutze sich ab.
Die AfD habe sich seit 2017 noch weiter nach rechts entwickelt und es gebe eine "offene Hinwendung zum Nationalsozialismus", sagte der Journalist Leyendecker. "Da sind nicht nur die Bilder aus Chemnitz, wo rechtes Gesindel Seite an Seite mit AfD-Funktionären marschiert." Es gebe auch eine Verpflichtung gegenüber der Kirchentagsbewegung: "Der Kirchentag ist gegründet worden, weil die Kirchen im Kampf gegen die Nazis versagt hatten." Der Kirchentag habe zu allen Zeiten Zeichen gesetzt, etwa als es in den 80er Jahren um den Nato-Nachrüstungsbeschluss ging. Nun sei ein Zeichen gegenüber der AfD nötig.
Funktionäre der Partei könnten beim 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 19. bis 23. Juni "an Gottesdiensten teilnehmen oder bei einer Bibelarbeit dabei sein, wo immer sie wollen, sie kommen aber nicht auf Podien", betonte Leyendecker. Anders sei es mit Anhängern und Wählern: Sie sollten in Foren zu Wort kommen und über ihre Situation und ihre Probleme sprechen. Viele Menschen hätten heute das Gefühl, sie seien mit ihren Sorgen um den Arbeitsplatz, die Rente oder die Wohnung allein, ihnen höre niemand zu und sie würden nicht verstanden.
"Wir haben tiefe Gräben in der Gesellschaft, über die wir hinwegkommen müssen", unterstrich der Kirchentagspräsident. Von dem Protestantentreffen in Dortmund erhoffe er sich Impulse, "dass wir einander wieder zuhören". In unterschiedlichen Bereichen seien Menschen heute "in ihrer Filterblase und ihrer Echokammer oder bleiben sich selbst genug".
In Dortmund spürt Leyendecker bereits jetzt ein großes Interesse und Engagement für den Kirchentag. Das gelte beispielsweise für die Suche nach Privatquartieren, die offiziell erst im Januar anlaufen soll. Nicht nur im Blick auf die Gastfreundschaft finde der Kirchentag in Dortmund "Hilfe, die ungewöhnlich ist", sagte der Präsident des Kirchentages und nannte unter anderem die Stadtverwaltung und den Fußballverein Borussia Dortmund.
Die Stadt habe viele Wandlungen erlebt und sei mit großen Schwierigkeiten wie dem Verlust von Kohle und Stahl fertig geworden, erklärte Leyendecker. Heute sei Dortmund eine ganz andere Stadt als vor zehn Jahren. "Ich glaube, Dortmund wird den Kirchentag verändern und der Kirchentag Dortmund."
Landessuperintendent besorgt über Rechtspopulismus

epd-bild/Lippische Landeskirche
Detmold (epd). Kirche muss nach Worten des lippischen Landessuperintendenten Dietmar Arends klar gegen Rechtspopulismus und Ausgrenzung Stellung beziehen. Die Kirche müsse die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen und Räume für das Gespräch bieten, sagte Arends am 26. November in Detmold zu Beginn der zweitägigen Lippischen Landessynode. "Aber rassistische, menschenverachtende, nationalistische Äußerungen dürfen keinen Platz haben, in der Kirche nicht und in der Gesellschaft auch nicht", sagte der oberste Repräsentant der Lippischen Landeskirche in seinem Bericht. Aufgabe als Kirche müsse es sein, hier sehr klar zu sein.
Arends: Mit AfD hat sich Ton in Länderparlamenten verschärft
Arends kritisierte, dass sich mit dem Einzug der Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) in den Bundestag und in alle Länderparlamente der Ton in der gesellschaftlichen Debatte "dramatisch verschärft" habe. "Was heute in unseren Parlamenten manchmal gesagt wird, wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen", sagte der oberste Repräsentant der Lippischen Landeskirche. Es seien tiefe Brüche entstanden, die nicht nur in Parlamenten sichtbar würden, sondern zum Teil auch bis hinein in die Familien gingen.
Als eine der Ursachen nannte der Theologe eine unterschiedlichen Haltung zu einer Weltoffenheit und größeren Vielfalt im eigenen Land. Einige Menschen stünden einer solchen Offenheit eher positiv gegenüber, andere reagierten hingegen mit Unbehagen oder Abwehr und Ausgrenzung. Erschreckend sei dabei, wie fließend inzwischen manchmal die Grenze zu Rassismus und nationalistischen Tendenzen sei, sagte Arends: "Als Landeskirche sehen wir diese Entwicklungen mit großer Sorge." Die Kirche versuche hier, eine klare Haltung aus der Nächstenliebe heraus mit einem Werben für Demokratie und Toleranz zu verbinden.
Der Landessuperintendent verteidigte die Willkommenskultur in Deutschland, als im Jahr 2015 innerhalb kurzer Zeit die Zahl der Flüchtlinge stark anstieg. "Bei allen Fehlern, die damals vielleicht auch gemacht wurden, hat unsere Gesellschaft dort ein ausgesprochen menschliches Gesicht gezeigt", sagte Arends. Vieles davon sei Gott sei Dank geblieben, sagte Arends. Er danke allen, "die für dieses menschliche Gesicht stehen, auch bei uns in Lippe und auch in unserer Kirche". Die Lippische Landeskirche engagiere sich weiterhin stark in der Arbeit mit Flüchtlingen.
Kurschus: Vertrauensverlust in Politik gefährdet Demokratie
Bielefeld (epd). Die westfälische Präses Annette Kurschus warnt vor Politik als Selbstzweck. "Viele Menschen fühlen sich von den gewählten Volksvertretern nicht mehr vertreten und haben den Eindruck, dass die Politiker ihr eigenes Süppchen kochen und in erster Linie für sich selbst sorgen", sagte die Theologin dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Bielefeld. "Dieser Vertrauensverlust bewirkt eine Krise der Demokratie." Bei der AfD sei es sehr offensichtlich: "Sie wollen in den Parlamenten vertreten sein und Macht ausüben."
Die rechtspopulistische Partei gewinne unter anderem dadurch Anhänger, dass sie behaupte, das "deutsche Vaterland" sei in Gefahr, weil zugewanderten Armen besser und schneller geholfen werde als "unseren" Armen, sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen. Das nehme vorhandene Ängste in einem Teil der Bevölkerung auf. "Wir müssen deshalb aufpassen, dass nicht eine negative Konkurrenz zwischen verschiedenen Gruppen von Benachteiligten entsteht", warnte Kurschus.
Als Aufgabe der Kirche sieht Kurschus an, für eine offene, demokratische Gesellschaft zu werben. "Der christliche Glaube kann eine Art Grundnahrung und Grundvertrauen für das Funktionieren der Gesellschaft geben", sagte die 55-jährige Theologin, die auch stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.
Plädoyer für humane Flüchtlingspolitik

Bielefeld (epd). Mit politischen Forderungen nach einer menschlichen Flüchtlingspolitik, mehr Umweltschutz und einer stärker Bekämpfung des Antisemitismus ist am 21. November die diesjährige Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen zu Ende gegangen. Das Kirchenparlament der gut 2,2 Millionen westfälischen Protestanten verabschiedete zudem den Haushalt für 2019. Die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der viertgrößten deutschen Landeskirche soll zügig angegangen werden. Auf allen Ebenen will sich die Kirche bis zur nächsten Landessynode in einem Jahr mit dem Thema Kirche und Migration befassen und dann Konsequenzen aus den Ergebnissen dieses Prozesses ziehen.
Kritik an Verschärfung des Kirchenasyls
Das Phänomen der Migration kennzeichne zunehmend die Gesellschaft und die Kirche, sagte die leitende Theologin der westfälischen Kirche, Präses Annette Kurschus. Die Kirche werde immer mehr "durchmischt von Menschen, die dazugekommen sind". Sie müsse offene Türen haben und sich am Bedarf der Menschen orientieren, zugleich müsse sie mit weniger Geld auskommen und sich kleiner setzen, ohne sich marginalisiert vorzukommen. Der Kreis der Menschen in der Kirche werde bunter werden und hoffentlich auch jünger.
Zum Abschluss ihrer viertägigen Beratungen kritisierte die Synode die jüngsten Verschärfungen beim Kirchenasyl und forderte die Innenminister auf, die Einstufung von Flüchtlingen im Kirchenasyl als "flüchtig" zurückzunehmen. "Flüchtlingspolitik muss sich an Menschenrechten und Menschenwürde orientieren", sagte der Stellvertreter von Kurschus, Vizepräsident Ulf Schlüter. Das Kirchenparlament verlangte zudem, Flüchtlingsbürgen von unangemessenen, existenzbedrohenden Forderungen freizustellen.
Extremismus-Bekämpfung
Die Landeskirche rief in einem weiteren Beschluss dazu auf, sich Übergriffen gegen Juden und Muslime entgegenzustellen und die Opfer von rechtsradikaler Gewalt stärker in den Blick zu nehmen. Zur Energie- und Umweltpolitik hieß es, nötig sei ein zügiger Ausstieg aus der Kohleverstromung. Der damit verbundene Strukturwandel müsse jedoch sozialverträglich gestaltet werden. Die Verhinderung eines katastrophalen Klimawandels sei eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Zur Linderung der Wohnungsnot will die westfälische Kirchen prüfen, wie sie mit ihren eigenen Immobilien zu einer Entspannung beitragen kann.
Aus Kirchensteuern erwartet die westfälische Kirche dieses Jahr schätzungsweise Einnahmen in Höhe von 550 Millionen Euro. Dank eines stabilen Arbeitsmarkts habe es in den letzten Jahren "unglaubliche Steigerungsraten" gegeben, sagte Finanzdezernent Arne Kupke. Durch den Bevölkerungsrückgang und das Ausscheiden der Babyboomer-Generation aus dem Arbeitsleben werde aber mit einem deutlichen Rückgang der Einnahmen in den kommenden Jahren gerechnet.
Große Vorfreude herrscht nach Schlüters Worten auf den 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag, der vom 19. bis 23. Juni in Dortmund stattfindet. Die Landessynode signalisierte am 20. November mit großem Applaus für Kirchentagspräsident Hans Leyendecker, dass sie die Entscheidung unterstützt, keine AfD-Vertreter zur aktiven Teilnahme am Kirchentag zuzulassen. "Wir laden keine Hetzer und keine Rassisten ein", sagte Leyendecker. Allerdings solle es Foren geben, in denen Menschen zu Wort kommen, die die AfD wählen oder mit der Partei sympathisieren.
Auch Präses Kurschus stellte sich hinter den Beschluss des Kirchentagspräsidiums. AfD-Politikern dürfe "kein Podium für ihre populistische Propaganda" geboten werden. Die Veranstalter des Kirchentages rechnen mit bis zu 100.000 Dauerteilnehmern. Das Treffen steht unter der Losung "Was für ein Vertrauen".
Umweltbewusste Synode: Digital arbeiten und vegetarisch essen

epd-bild /Lutz Bahmüller
Bielefeld (epd). Die Evangelische Kirche von Westfalen hat bei ihrer in Bielefeld tagenden Landessynode noch konsequenter auf Klimaverträglichkeit als in den Vorjahren gesetzt. Der Papierverbrauch wurde gegenüber der Synode 2017 um über 90 Prozent verringert, wie der Theologische Vizepräsident Ulf Schlüter dem Evangelischen Pressedienst (epd) erläuterte: Statt 235.000 Blatt Papier wurden in diesem Jahr höchstens 23.000 verbraucht. Die 202 Mitglieder des Kirchenparlaments arbeiteten stattdessen mit Laptops und Tablets. In allen Arbeitsräumen gab es ausreichend starkes W-LAN und genügend Steckdosen.
Die umfangreichen Unterlagen wurden nach Schlüters Worten erstmals nicht per Post verschickt, sondern stattdessen auf einer eigenen Internet-Plattform eingestellt. Anträge während der Debatte konnten per E-Mail gestellt werden. Lediglich acht Synodale hätten die Vorlagen und Dokumente auf Papier erhalten, weil sie mit elektronischen Geräten nicht arbeiten könnten oder wollten, sagte Schlüter. Weiteren 15 Abgeordneten wurden mobile Geräte geliehen, weil sie selbst keins haben. Vor der Synode waren Schulungen und Videotutorials angeboten worden, während der Synode halfen notfalls Techniker weiter.
Eine weitere Neuerung gab es bei der Verpflegung: Wer mittags Fleisch essen wollte, musste dies vorab anmelden. Das hätten 50 von rund 250 Synodalen, Gästen und kirchlichen Mitarbeitern getan, die mittags versorgt werden, sagte Schlüter. Demnach erhielten vier von fünf Synodalen vegetarisches Essen.
"Wir nehmen unsere eigene Haltung und unsere Beschlüsse zur Bewahrung der Schöpfung ernst und versuchen deshalb, die Landessynode so tierfreundlich und so klimafreundlich wie möglich zu gestalten", betonte Schlüter. Das sei eine Frage von Glaubwürdigkeit und Konsequenz. "Wir können nicht jahrelang über die industrielle Massentierhaltung und Fleischproduktion reden und in unserem eigenen Handeln alles beim Alten lassen", unterstrich der Theologe. "Es sollte der Grundsatz gelten: So wenig Fleisch wie möglich."
Seit 2011 wird die westfälische Landessynode möglichst klimaneutral organisiert. Das geschieht zum Großteil dadurch, dass klimaschädliche Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Noch besser sei es, so wenige Ressourcen zu verbrauchen wie möglich, sagte Schlüter. "Hier gilt es, nach dem besten Weg zu suchen." Auch digitales Arbeiten sei nicht unumstritten, weil die Herstellung und der Betrieb der elektronischen Geräte ebenfalls Energie verbrauchten. Die Synodalen hätten ihre Geräte aber in der Regel ohnehin dabei: "Niemand hat sich nur für die Synode ein Tablet gekauft."
Die Ergebnisse der westfälischen Landessynode
Bielefeld (epd). Die Auswirkungen der Migration, aktuelle politische Themen und der Kirchentag im kommenden Jahr haben die diesjährige westfälische Landessynode beschäftigt, die am 21. November in Bielefeld zu Ende ging. Die 202 Mitglieder des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche von Westfalen diskutierten seit Sonntag über zahlreiche Vorlagen und Kirchengesetze. Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse der Beratungen:
* MIGRATION: Das Thema "Kirche und Migration" ist jetzt ein Jahr lang Thema in den 490 Kirchengemeinden und 28 Kirchenkreisen. Grundlage ist eine umfangreiche interaktive Online-Vorlage. Auf der Synode 2019 werden die Ergebnisse erörtert und konkrete Beschlüsse gefasst.
* FLÜCHTLINGE: Die Landeskirche verlangt die Rückkehr zu einer liberaleren Regelung des Kirchenasyls. Flüchtlingsbürgen sollen von existenzbedrohend hohen Forderungen freigestellt werden.
* EXTREMISMUS: Die Synode ruft dazu auf, sich Antisemitismus und Rechtsextremismus entgegenzustellen sowie Opfer mehr in den Blick zu nehmen. Kritisiert wird eine Verrohung der politischen Debatte.
* FINANZEN: Aus Kirchensteuern erwartet die westfälische Kirche mit ihren 28 Gemeinden und 490 Kirchenkreisen kommendes Jahr Einnahmen von 550 Millionen Euro. Größter Ausgabeposten im Gesamthaushalt der Landeskirche ist die Pfarrbesoldung mit 239,7 Millionen Euro. Der Gesamt-Etat hat ein Volumen von 346,5 Millionen Euro, der landeskirchliche Haushalt beläuft sich auf 53,4 Millionen Euro.
* FORDERUNGEN: Das Kirchenparlament fordert einen zügigen Ausstieg aus der Kohleverstromung und mehr Maßnahmen gegen die Wohnungsnot.
* MISSBRAUCH: Die Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der Landeskirche soll zügig angegangen werden. Für die Erfassung der Fälle sexualisierter Gewalt auf den verschiedenen Ebenen der Kirche soll ein gemeinsamer Rahmen geschaffen werden.
* KIRCHENTAG: Der Beschluss, AfD-Politikern beim evangelischen Kirchentag im Juni in Dortmund keine Bühne zu bieten, trifft auf Zustimmung. Alle 28 Dortmunder Kirchengemeinden werden von jeweils einem der 28 westfälischen Kirchenkreise unterstützt.
Bedford-Strohm: "Buß- und Bettag ruft zum Handeln auf"

epd-bild/Norbert Neetz
Frankfurt a.M. (epd). Der Buß- und Bettag hat in diesem Jahr ganz im Zeichen von Frieden und Versöhnung gestanden: In seiner Bußtagspredigt rief der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, die Menschen zu einer friedlichen Überwindung von Konflikten auf. In Politik und Gesellschaft, aber auch im persönlichen Leben vieler Menschen gebe es Unfrieden, Zerwürfnisse und Missverständnisse, sagte er am 21. November in der Münchner Matthäuskirche.
Beispiele dafür seien das gereizte Klima in der Politik sowie Präsidenten, die per Twitter "Vernichtungsdrohungen" aussprechen könnten, Medien, die statt Fairness auf Schärfe setzten, aber auch Probleme mit dem Ehepartner oder schwierigen Kollegen. Hier rufe der Buß- und Bettag, der in diesem Jahr unter dem Motto "Heute einen Krieg beenden" stand, zum Handeln auf, sagte der Ratsvorsitzende. Das Motto bezieht sich auch auf das Gedenken zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren.
Opfer sollen Gehör finden
Auch die Kirche müsse Versöhnungsarbeit leisten, machte Bedford-Strohm deutlich. Mit Blick auf sexualisierte Gewalt in der Kirche müsse noch konsequenter gehandelt werden. "Die Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, sollen wissen und spüren, dass sie bei uns Gehör finden", sagte er.
Beim Empfang nach dem Bußtagsgottesdienst sagte der Münchner Kardinal Reinhard Marx, Christen hätten die Aufgabe, Ängste zwischen Menschen zu überwinden. Auch Wissenschaft und Forschung müssten umdenken. An die Stelle der Forschung, wie man Kriege effektiv führen könne, sollten wissenschaftliche Überlegungen treten, wie sich militärische Konflikte beenden lassen.
Frieden stiften
Der EKD-Friedensbeauftragte Renke Brahms appellierte an die Gläubigen, Frieden zu stiften. Der Leitende Geistliche der Bremischen Evangelischen Kirche sagte, es sei notwendig, gegen alle Vereinfachungen und gegen ein Schwarz-Weiß-Denken die Kunst der Differenzierung zu setzen: "die einen nicht einfach in die Nazi-Ecke stellen und die anderen nicht als naive Gutmenschen verhöhnen". Im übertragenen Sinne könne jeder noch heute einen Krieg beenden, wenn er sich ein wenig zurücknehme und in den anderen Menschen hineinversetze. "Das gilt für jede Ehe und Beziehung - und es gilt für das große politische Geschäft", sagte Brahms.
Der Vizepräsident des EKD-Kirchenamts in Hannover, Thies Gundlach, sagte, der Buß- und Bettag drohe in Vergessenheit zu geraten. Viele Menschen nähmen ihn nicht mehr wahr, da er kein gesetzlicher Feiertag mehr ist, sagte Gundlach am Mittwoch im Bistumssender Domradio. Der protestantische Buß- und Bettag wurde 1995 in allen Bundesländern mit Ausnahme Sachsens zur Finanzierung der Pflegeversicherung als gesetzlicher Feiertag abgeschafft. Die meisten evangelischen Kirchengemeinden böten Gottesdienste und Andachten an, oft auch abends, damit Arbeitnehmer teilnehmen könnten, sagte Gundlach.
Rheinischer Präses für Veränderungen in kleinen Schritten

epd-bild / Norbert Neetz
Trier (epd). Der rheinische Präses Manfred Rekowski wirbt für ein Umdenken in Kirche und Gesellschaft. "Jeder kleine Schritt der Umkehr ist besser als große Gedanken, die nicht zum Tun führen", sagte der oberste Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland laut Predigttext am 21. November im ökumenischen Gottesdienst am Buß- und Bettag im Trierer Dom. Ohne Umkehr sei in vielen Handlungsfeldern der Politik und in der eigenen Lebensführung keine Zukunft zu gewinnen.
Umkehr zur Solidarität angemahnt
Es gehe um eine Umkehr zur Solidarität, forderte Rekowski. Wer mehr habe, als er brauche, solle mit anderen teilen. Wer Geld kassiere, solle sich nicht unrechtmäßig bereichern. Wer Machtmittel zur Verfügung habe, solle sie nicht gewalttätig gegen die Schwachen einsetzen. "Das sind Basisforderungen eines funktionierenden Gemeinwesens, das die Schwachen schützt und den Starken im Interesse des Gemeinwohls sinnvolle Grenzen setzt", betonte der rheinische Präses.
Der Lebensstil des grenzenlosen Wachstums beute die Erde aus und nehme den zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage, betonte der leitende Geistliche der zweitgrößten Landeskirche. Ein freier Markt entfalte nicht nur positive Kräfte, sondern lasse auch die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergehen. "Wir in unserem Land mit einer der stärksten Volkswirtschaften können uns die Freiheit leisten, dem Klimaschutz hohe Priorität einzuräumen", sagte Rekowski. "Wir können dazu übergehen, Handelsverträge abzuschließen, die nicht in erster Linie unsere Privilegien sichern, sondern auf Gerechtigkeit basieren."
"Umkehrbereitschaft ist immer auch innerhalb der Kirchen gefragt", betonte der rheinische Präses und verwies auf die Opfer sexualisierter Gewalt. "Das, was in unseren Kirchen, was in diakonisch-karitativen Einrichtungen geschah, ist unabhängig von den Zahlen alles andere als ein Randproblem." Kirche müsse gegen diese Gewalt einschreiten.
Fürbitte für Initiatoren der Regenschirm-Bewegung
Düsseldorf (epd). Die Evangelische Kirche im Rheinland ruft zum Gebet für die Initiatoren der sogenannten Regenschirm-Bewegung in Hongkong auf. Damit folgten sie einer Bitte aus Hongkong, die den Kirchenkreis Köln-Mitte aus Hongkong von der Chinese Rhenish Church erreichte, schreibt die rheinische Oberkirchenräten Barbara Rudolph am 20. November im Präsesblog des Düsseldorfer Landeskirchenamtes. Vier Jahre nach dem Ende der Bewegung in Hongkong stünden nun neun führende Mitglieder der prodemokratischen Bewegung vor Gericht. Ihnen werde unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Sie müssten mit langjährigen Gefängnisstrafen rechnen.
Der baptistische Pastor Chu Yin Ming und der Sozialwissenschaftler Kin Man Chan gehörten zu den Initiatoren der Bewegung, die mit friedlichen Mitteln für den Erhalt der Demokratie in Hongkong gekämpft hätten, schreibt Rudolph. Amnesty International rufe zu einer Dringlichkeitsaktion auf. Noch im Jahr 2016 sei Pastor Chu Yin Ming die Georg-Fritze-Gedächtnisgabe des Kirchenkreises Köln-Mitte verliehen worden. Der Kölner Kirchenkreis ist mit der Chinese Rhenish Church in Hongkong partnerschaftlich verbunden.
Seit der Rückgabe an China 1997 wird Hongkong als chinesische Sonderverwaltungsregion in ihrem eigenen Territorium autonom regiert. Peking verstärkt jedoch den Zugriff auf die Region. Bei den Protesten im Jahr 2014, die Teile der asiatischen Finanz- und Wirtschaftsmetropole wochenlang lahmlegten, forderten die Demonstranten freies Wahlrecht für die sieben Millionen Hongkonger. Die Bewegung erhielt ihren Namen von den Regenschirmen, mit denen sich die Demonstranten gegen Sonne, Regen und gegen den Einsatz von Tränengas durch die Polizei schützten.
VEM: Kirchen müssen auf multikulturelle Gesellschaften reagieren
Bielefeld (epd). Die Kirchen müssen sich nach Einschätzung der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) auf die neue Realität multikultureller Gesellschaften einstellen. Es reiche nicht aus, international interessiert zu sein, sagte der Moderator der VEM, Willem Simarmata, am 19. November vor der westfälischen Landessynode in Bielefeld. "Die Kirche ist keine Kirche, wenn sie nicht vielfältig ist, wenn sie die Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen aus den verschiedensten Regionen der Welt nicht aktiv als gleichwertige Mitglieder auf allen Ebenen mit einbezieht", mahnte der indonesische Theologe. Ausdrücklich begrüßte er, dass die westfälische Landessynode zu dem Thema "Kirche und Migration" einen Diskussionsprozess in Gang setzen will.
Simarmata berichtete, dass er einige Jahre als Pastor auf der indonesischen Insel Batam gearbeitet hat, auf der viele Migranten leben. "In diesen Gemeinden dort auf Batam, mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Regionen zu leben, war keine Verpflichtung, es war eine Bereicherung", unterstrich der VEM-Moderator. Nach Batam zogen nach Angaben des Theologen viele Migranten, um in der Elektronikindustrie zu arbeiten.
25. Jubiläum im Jahr 2021
Simarmata kündigte an, dass der internationale Kirchenbund VEM im Jahr 2021 in Bielefeld das 25. Jubiläum der Internationalisierung feiern werde. Seit diesen Anfängen seien die VEM-Mitgliedskirchen und die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zu einer "anbetenden, lernenden und dienenden" Gemeinschaft zusammengewachsen. In dem Kirchenbund sei die international gleichberechtigte Zusammenarbeit selbstverständlich geworden. Der Theologe hob hervor, dass viele Freiwillige aus dem Kongo, von den Philippinen und aus Indonesien in diesem Jahr in der Evangelischen Kirche von Westfalen im Einsatz sind.
Durch die regelmäßige Unterstützung der westfälischen Kirche für Projekte und Programme in den Regionen der VEM sei zudem eine große Zahl an Kooperationen auf der Ebene von Gemeinden und Einrichtungen der Kirchen ermöglicht worden, erklärte Simarmata. Als Beispiel nannte er Bildungsprogramme, Wasserprojekte sowie soziale und diakonische Arbeit in den Städten. Mitglieder der VEM sind mehrheitlich protestantische Kirchen in Afrika, Asien und Deutschland.
ZdK fordert schnelle Konsequenzen aus Missbrauchsskandal

epd-bild / Friedrich Stark
Bonn, Köln (epd). Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) fordert von den 27 deutschen Bistümern schnelle Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal. Die Aufarbeitung sei eine "Nagelprobe", die zeige, ob die Institution Kirche diese moralische Krise bewältigen könne, heißt es in einer am 23. November bei der Vollversammlung in Bonn beschlossenen Erklärung. Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, der Trierer Bischof Stephan Ackermann, sprach sich unterdessen für eine offenen Diskurs innerhalb der katholischen Kirche auch zu Sexualmoral und Zölibat aus.
In der Erklärung wendet sich die katholische Laienorganisation gegen einen Generalverdacht gegenüber Seelsorgern. Aber nur ein Aufbrechen von Machtstrukturen werde zu einer notwendigen und grundlegenden innerkirchlichen Reform führen, hieß es. Diejenigen, die Täter gedeckt und Taten vertuscht hätten, müssten zudem persönliche Konsequenzen ziehen.
"Strukturen verändern"
ZdK-Präsident Thomas Sternberg betonte, dass nun ein entschiedenes und einheitliches Vorgehen notwendig sei, um die Glaubwürdigkeit der Kirche wiederherzustellen. "Ich glaube, wenn jetzt nicht Veränderungen kommen, dann ist der Vertrauensverlust nicht mehr aufzuhalten", sagte er. So forderte er unter anderem eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Zudem müssten Strukturen innerhalb der Kirche verändert werden, die Missbrauch Vorschub leisteten, verlangte Sternberg.
Ein wichtiger Punkt sei auch die konsequente Verfolgung von Straftaten innerhalb der Kirche, sagte Sternberg. Das Zentralkomitee setze sich seit langem für eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit ein. "Judikative und Legislative in der Kirche müssen endlich getrennt werden", betonte der Präsident. Fälle von Missbrauch müssten künftig ausnahmslos der Staatsanwaltschaft gemeldet werden. In der Vergangenheit sei zu oft der Schutz der Institution über die Aufklärung und den Opferschutz gestellt worden.
Die katholische Kirche müsse auch ihre Sexualmoral neu definieren, sagte der Präsident der katholischen Laienorganisation. Zu den notwendigen Veränderungen gehöre auch eine Abkehr vom Klerikalismus in der Kirche. "Wir wollen eine wirkliche Beteiligung von Männern und Frauen in allen Ebenen der Kirche und auch in den Ämtern." In ihrer Erklärung fordert die Laienorganisation auch eine Abschaffung des Pflichtzölibats für katholische Priester. Der Zölibat verpflichtet katholische Priester zur Ehelosigkeit.
"Blick von außen"
Der Trierer Bischof Ackermann erklärte bei einer Fachtagung zur Prävention von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche in Köln, dass mehr Offenheit und Diskurs innerhalb der katholischen Kirche nötig seien. "Wir wollen in einen offenen, transparenten Gesprächsprozess eintreten", sagte der Theologe. Das gelte auch bei den Themen Zölibat und Sexualmoral.
Ackermann betonte, das man sich mit den Präventionsmaßnahmen auf einen stetigen und dauerhaften Prozess begeben habe. Er sei dankbar für einen "Blick von außen", da die Kirche in der Gefahr stehe, sich auf die "Binnenperspektive" zu beschränken. "Wir brauchen die Hilfe von Experten. Alleine schaffen wir das nicht", betonte der Bischof.
Ende September hatten Wissenschaftler auf der Herbstvollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Fulda eine Studie zum sexuellen Missbrauch durch katholische Amtsträger zwischen 1946 und 2014 veröffentlicht. Demnach wurden 3.677 Minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs, 1.670 Kleriker sind der Taten beschuldigt.
Landesbischöfin Junkermann wechselt zur Uni Leipzig

epd-bild/Peter Endig
Magdeburg (epd). Die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, wechselt nach Ablauf ihrer Amtszeit an die Universität Leipzig. Ab 1. September 2019 werde die 61-Jährige dort die Forschungsstelle "Kirchliche Praxis in der DDR. Kirche (sein) in Diktatur und Minderheit" leiten, teilte die mitteldeutsche Kirche am 19. November in Magdeburg mit.
Im November 2017 war die Landessynode von einer Entscheidung des Landeskirchenrates überrascht worden, Junkermanns Amtszeit nicht zu verlängern. Die Landesbischöfin wollte ihr Amt ursprünglich um knapp vier weitere Jahre bis zum Erreichen der Pensionsgrenze ausüben, fand aber in der Kirchenleitung dafür nicht die nötige Unterstützung. Ein Nachfolger für das Bischofsamt wird gegenwärtig gesucht. Er soll auf der Frühjahrstagung der Synode im Mai 2019 gewählt werden.
Als Landesbischöfin habe sie die Rolle der evangelischen Kirche zur Zeit der DDR intensiv reflektiert, sagte Junkermann zu ihrer neuen Tätigkeit. Dabei sei ihr aufgefallen, wie wenig davon im gesamtdeutschen Leben der Kirchen und im wissenschaftlichen Diskurs präsent sei. Wie die Kirchen in der DDR, angefeindet vom Staat und unter erschwerten Bedingungen, ihr christliches Profil noch geschärft haben, sei kaum erforscht. "Diese Forschungsarbeit lässt sich sehr gut an die Erfahrungen als Landesbischöfin anschließen", sagte die Theologin.
Oldenburgische Kirche beschließt "Trauung für alle"
Oldenburg (epd). Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg ermöglicht die kirchliche Trauung für homosexuelle Paare. Die Synode, das Kirchenparlament, beschloss am 22. November zum Auftakt ihrer Herbsttagung in Rastede bei Oldenburg einstimmig bei drei Enthaltungen, dass gleichgeschlechtliche Paare genauso behandelt werden wie Paare von Frau und Mann. Bischof Thomas Adomeit bat homosexuelle Paare um Entschuldigung für Verletzungen, die sie in der Vergangenheit erlitten hätten, weil sie nicht getraut werden konnten. "Das dadurch entstandene Leid, die durchlebte Enttäuschung und die erlittene Diskriminierung begleiten manche Beziehung bis heute", sagte er.
In dem Beschluss zur "Trauung für alle" begrüßte die Synode ausdrücklich die Entscheidung des Bundestages vom 20. Juni 2017 zur "Ehe für alle". Der Beschluss hält fest, dass die gültige Eheschließung nach staatlichem Recht die Voraussetzung für die kirchliche Trauung sei. Die Trauung wird als Amtshandlung in das Kirchenbuch der Gemeinde eingetragen. Bisher durften in der oldenburgischen Kirche gleichgeschlechtliche Paare nur in besonderen Gottesdiensten gesegnet werden - diese Regelung galt seit 2003.
"Großartig"
Bischof Adomeit nannte den Beschluss "großartig". Die neue Regelung werde der Kirche Handlungssicherheit geben. Adomeit bat auch die Theologinnen und Theologen um Verzeihung, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung in der Vergangenheit nicht in den Dienst der oldenburgischen Kirche übernommen werden konnten. "Auch hier hat die Kirche Leid und Enttäuschung verursacht."
Die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ist unter den 20 Mitgliedskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unterschiedlich geregelt. In vielen gilt bereits die "Trauung für alle". In anderen ist weiter von Segnungen die Rede. In einzelnen Kirchen sind Segnungen nur in nichtöffentlichen Gottesdiensten möglich.
Gudrun Mawick wird Oberkirchenrätin in Oldenburg
Unna/Rastede (epd). Pfarrerin Gudrun Mawick aus Unna wird Oberkirchenrätin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Die in Rastede tagende Synode wählte am 23. November die 54-jährige evangelische Theologin im zweiten Wahlgang mit 35 von 60 Stimmen. Amtsinhaberin Annette-Christine Lenk (58) erhielt 25 Stimmen. Ihre reguläre Amtszeit läuft am 31. März 2019 aus. Der dritte Kandidat, Kreispfarrer Michael Braun (49) aus Cloppenburg, zog seine Kandidatur nach dem ersten Wahlgang zurück.
Mawick wird künftig unter anderem für die Pfarrstellen in der oldenburgischen Kirche zuständig sein. Die Kirche im Nordwesten Niedersachsens beschäftigt rund 240 Pfarrerinnen und Pfarrer. Mawick arbeitet zurzeit für die Geschäftsstelle des Deutschen Evangelischen Kirchentages und ist verantwortlich für die Gottesdienste und das geistliche Programm des Kirchentages 2019 in Dortmund.
Seit 2011 ist sie Dozentin im Fachbereich für Gottesdienst und Kirchenmusik im Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen. Zuvor war die Kommunikationswirtin und Theologin Leiterin der Abteilung "Kommunikation" des Kirchenkreises Unna sowie Pressesprecherin, Referentin der Superintendentin und Beauftragte für den Reformprozess der westfälischen Kirche.
Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin studierte Mawick Theologie in Marburg, Hamburg und Berlin. Sie lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Zur oldenburgischen Kirche zählen 116 Gemeinden zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und den Dammer Bergen. Ihr gehören knapp 411.600 Mitglieder an.
Initiative evangelischer Kirchen zu Friedhöfen als Hoffnungsorte

epd-bild / Rainer Oettel
Düsseldorf, Bielefeld (epd). Die evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen haben am 25. November die Initiative "Evangelischer Friedhof - Ort der Hoffnung" gestartet. Die Initiative rücke ins Bewusstsein, dass evangelische Friedhöfe Orte gelebten Glaubens seien, sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, am 23. November in Düsseldorf. "Wie wir Friedhöfe gestalten, drückt aus, wie wir als Gemeinde mit dem Tod umgehen."
Die Initiative von rheinischer, westfälischer und lippischer Kirche zum Ewigkeitssonntag unterstützt den Angaben zufolge Gemeinden, die sich in Trauerbegleitung engagieren und das Thema Friedhöfe etwa durch Andachten und Besuch von Gemeindegruppen ins Gemeindeleben einbeziehen. Gemeinden, die sich beteiligten, legten Wert auf eine besondere Friedhofsgestaltung und einen sorgfältigen Umgang mit Beerdigungen. Wenn Verstorbene keine Angehörigen hätten, gingen Gemeindemitglieder zur Beerdigung, hieß es.
Die christliche Hoffnung gründet der Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Anette Kurschus, zufolge im Vertrauen auf ein Leben nach dem Tod. "Ein Friedhof ist ein Ort der Erinnerung, wo neben Trauer und Schmerz auch die Zuversicht ihren Raum hat, dass die Verstorbenen bei Gott geborgen sind", sagte sie.
Der Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, Dietmar Arends, betonte, dass es an den "Orten der Hoffnung" keine anonymen Grabstätten gebe. "Niemand ist ohne Namen - zu jedem Menschen gehören Erinnerungen, Würde, Identität und Einzigartigkeit", sagte er. Oft tue es den Hinterbliebenen gut, einen bestimmten Ort zu haben, wo sie ihren Schmerz und ihre Trauer zulassen könnten.
Kirchen und Wirtschaft würdigen Religionsunterricht an Berufskollegs
Bielefeld, Düsseldorf (epd). Kirchen und Wirtschaftsvertreter in Nordrhein-Westfalen haben die Bedeutung des Religionsunterrichts an Berufskollegs betont. Seine Inhalte und Ziele würden "unverzichtbar zur Wahrnehmung der öffentlichen Bildungsverantwortung im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Bereich" beitragen, heißt es in einer am 22. November in Düsseldorf veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von evangelischen Landeskirchen, Bistümern, Unternehmensverbänden und Gewerkschaften in Nordrhein-Westfalen. Der Religionsunterricht vermittle wichtige Inhalte der Sozialethik der Kirchen als Grundlage der sozialen Markwirtschaft. Er unterstütze zudem Schüler dabei, in beruflichen, privaten und gesellschaftlichen Lebenssituationen ethisch verantwortlich zu handeln.
Der Religionsunterricht trete für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein, heißt es in der Erklärung mit dem Titel "Berufsbildung in Nordrhein-Westfalen. Bildung und Kompetenz mit Religionsunterricht". Getragen durch ein christliches Menschenbild ermutige er zum Engagement für eine zunehmend inklusive Gesellschaft. Zudem wirke der Religionsunterricht fundamentalistischen Entwicklungen durch religiöse Bildung entgegen.
Unterzeichner sind von evangelischer Seite der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, und der Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, Dietmar Arends. Als Vertreter der katholischen Kirche haben der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki, der Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker, der Münsteraner Bischof Felix Genn sowie der Aachener Bischof Helmut Dieser und der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck unterschrieben. Unterzeichner sind zudem der Präsident Handwerk.NRW, Andreas Ehlert, der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalens, Arndt Günter Kirchhoff, und die Vorsitzende des DGB Nordrhein-Westfalen, Anja Weber.
Katholikentag kommt 2022 nach Stuttgart
Bonn, Stuttgart (epd). Der 102. Deutsche Katholikentag kommt nach Stuttgart. Dafür stimmte die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) am 25. November in Bonn. Die Mitglieder nahmen damit die Einladung des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, einstimmig an. Der Katholikentag wird den Angaben nach vom 25. bis 29. Mai 2022 gefeiert.
"Wir freuen uns darauf, in Stuttgart, einer modernen, interessanten Stadt mit großer Tradition zu Gast zu sein und danken der Stadt für ihre Unterstützungsbereitschaft", erklärte der Präsident der katholischen Laienorganisation, Thomas Sternberg. Nach 1925 und 1964 ist es der dritte Katholikentag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.
Der 101. Katholikentag hatte im Mai im westfälischen Münster stattgefunden. Im Mai 2021 wird es den 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main geben. Für den 103. Deutschen Katholikentag im Jahr 2024 besteht eine Einladung des Bistums Erfurt. Der Katholikentag ist ein Treffen von überwiegend katholischen Laien und das Pendant zum evangelischen Kirchentag.
Sündiger Pfarrer: "Mein Verstand hat ausgesetzt"
Berlin (epd). Der katholische Geistliche aus dem Bistum Magdeburg, der rund 120.000 Euro aus einer Pfarreikasse unterschlagen hat, ist nach eigenen Angaben über einen Lottogewinn getäuscht worden und in der Folge auf die schiefe Bahn geraten. Der "Bild"-Zeitung (20. November) schilderte der Pfarrer aus Ballenstedt am Rande des Harzes, dass er im Frühjahr 2017 per Mail die Nachricht erhalten habe, bei einer spanischen Lotterie 935.000 Euro gewonnen zu haben. In der Folge habe auf weitere Mails einer angeblichen Anwaltskanzlei mehrfach Geld für vermeintlich fällige Gebühren gezahlt, um den Gewinn ausgezahlt zu bekommen.
Nach eigenen Angaben hatte sich der Geistliche überhaupt nicht an der Lotterie beteiligt, wie die "Bild" berichtet. Dennoch sei er schließlich an die Gemeindekasse gegangen, um immer weitere Geldforderungen zu erfüllen. "Mein Verstand hat ausgesetzt", zitiert ihn die Zeitung.
Vor wenigen Tagen hatte sich der Pfarrer selbst angezeigt und den Magdeburger Bischof Gerhard Feige informiert. Der Bischof entband den Mann vom Vorsitz des Kirchenvorstandes. Weitere disziplinarische Schritte behalte er sich vor, hieß es.
Das Bistum teilte am 21. November mit, dass der Geistliche zum 30. November von seinen Aufgaben als Pfarrer entpflichtet. Bischof Feige habe seinen Verzicht auf die Pfarrei St. Elisabeth in Ballenstedt angenommen.
Kirchenkreise
Kölner Superintendent warnt vor wachsendem Rassismus

epd-bild/Friedrich Stark
Köln (epd). Die Erosion der über lange Zeit die demokratische Gesellschaft bestimmenden und stabilisierenden Systeme - wie Volksparteien oder Kirchen - habe "längst begonnen", mahnte Zimmermann auf der Herbstsynode des Kirchenkreises. Das Erstarken rechtslastiger Parteien wie der AfD stelle "grundlegende Werte des Zusammenlebens und der Humanität infrage und fordert unseren klaren Widerspruch und Protest als Christinnen und Christen heraus", erklärte der Theologe in seinem Jahresberichte.
Zimmermann beklagte zudem, dass der Dialogprozess mit den muslimischen Verbänden ins Stocken geraten sei. Das habe man nicht zuletzt vor einigen Wochen bei der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee durch den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan festgestellt, bei der die Stadtgesellschaft nicht vertreten gewesen war. Gleichwohl gebe es zum Dialog keine Alternative, betonte der Superintendent.
Zimmermann lobte das vielfältige Gemeindeleben im Kirchenkreis. Das Feiern von Gottesdiensten sei die wichtigste Aufgabe für die Gemeinden, betonte ern. "Es bleibt wichtig und notwendig, dem Glauben auf vielfältige Weise Raum zu geben und das Leben als Gottesdienst zu feiern und zu begreifen, Stärkung zu erfahren und dankbar zu sein für das, was uns Gott alles schenkt. Dazu machen unsere Kirchengemeinden immer wieder und durch das Jahr hindurch viele gute Angebote."
Dem Kirchenkreis Köln-Nord gehören 18 Gemeinden mit rund 75.000 Gemeindegliedern an. Sie liegen im Kölner Norden sowie im nördlichen Rhein-Erft-Kreis. Die Interessen aller Gemeinden werden im "Parlament" des Kirchenkreises, der Kreissynode, von derzeit 101 Synodalen vertreten.
Beer: Kirche soll die Menschenwürde verteidigen
Meschede (epd). Die Grünen-Landtagsabgeordnete Sigrid Beer hat die evangelische Kirche zur Verteidigung der Menschenwürde aufgerufen. Es müsse Stopp gesagt werden, wenn Menschen ihre Würde mit Worten oder Taten abgesprochen werden, sagte Beer am 24. November auf der letzten Synode des Kirchenkreises Arnsberg in Meschede. Christen sollten sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen und Mitgefühl und Respekt fördern, so die Politikerin, die auch der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen angehört.
Letzte Synodaltagung des Kirchenkreises Arnsberg
Beer unterstützte außerdem den Ausschluss von AfD-Politikern von Podien des Deutschen Evangelischen Kirchentages im kommenden Juni in Dortmund, wie es weiter hieß. Die Abgeordnete kritisierte laut der Mitteilung des Kirchenkreises eine Rhetorik, die alle Missverhältnisse mit der Migration begründe, falsche Behauptungen aufstelle und Menschen die Würde aberkenne. Solche Redner wolle sie nicht auf dem Podium sitzen haben, erklärte die Grünen-Politikerin.
Die Landtagsabgeordnete sprach bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der letzten Tagung der Arnsberger Kreissynode. Zu Beginn des Treffens hatten die Synodalen demnach in Anwesenheit zahlreicher Repräsentanten von Städten, Verbänden und Institutionen sowie der katholischen Kirche im Sauerland einen Abendmahlsgottesdienst gefeiert, in dem die Oberkirchenrätin Doris Damke aus dem westfälischen Landeskirchenamt in Bielefeld predigte. Der Kirchenkreis Arnsberg fusioniert nach 55-jährigem Bestehen am 1. Januar 2019 mit dem Kirchenkreis Soest zum neuen Evangelischen Kirchenkreis Soest-Arnsberg.
Leyendecker zu Gast beim Jahresempfang des Solinger Kirchenkreises
Solingen (epd). Der Journalist und Präsident des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages, Hans Leyendecker, spricht am 30. November beim Jahresempfang des Solinger Kirchenkreises. Vor rund 150 Gästen aus Politik, Verwaltung, Ökumene, Wirtschaft und Medien wird Leyendecker einen Vortrag zum Thema "Welches Vertrauen? Frage nach dem gesellschaftlichen und christlichen Auftrag unserer Zeit" halten, wie der Kirchenkreis am Freitag mitteilte. Das Kirchenjahr beginnt in der evangelischen Kirche traditionell mit dem ersten Advent. Zu dem Empfang lädt neben dem Kirchenkreis auch sein Diakonisches Werk ein.
Der Vortragstitel spielt auf den Kirchentag an, der im kommenden Jahr unter dem biblischen Leitwort "Was für ein Vertrauen" (2. Könige 18,19) in Dortmund stattfinden wird. Der Kirchentag ist das größte evangelische Treffen in Deutschland und bringt alle zwei Jahre rund 130.000 Teilnehmer zusammen.
Hans Leyendecker gehört zu den bekanntesten investigativen Journalisten Deutschlands. Für den "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" recherchierte er zahlreiche Affären - unter anderem zu Parteispendenaffären oder deutsche Verstrickungen in den Waffenhandel in Nahen Osten. Für seine Arbeiten erhielt er unter anderem den Gustav-Heinemann-Bürgerpreis, den Erich-Fromm-Preis und den Henri-Nannen-Preis.
Seit 1975 war Leyendecker bei allen Evangelischen Kirchentagen vertreten. Auf etlichen hat er in Bibelarbeiten, Vorträgen und Diskussionen mitgewirkt. Seit 2011 arbeitet er in Gremien des Kirchentages mit. In einem Rundfunkinterview hat er einmal betont, dass der christliche Glaube für ihn Kompass seines Lebens sei.
Superintendentin Federschmidt: Schutz vor Missbrauch bleibt ein Thema
Wuppertal (epd). Die Prävention sexualisierter Gewalt spielt nach Ansicht der Superintendentin des Kirchenkreises Wuppertal, Ilka Federschmidt, weiterhin eine große Rolle in den Gemeinden und in den Aufgabengebieten des Kirchenkreises. "Es ist wichtig, diese Arbeit als einen ständigen Prozess zu verstehen, der immer wieder aktualisiert werden will und mit dem wir nie fertig sind", sagte die Superintendentin in ihrem Bericht auf der jüngsten Herbstsynode des Kirchenkreises. Nachdem alle Gemeinden bereits ihre Schutz- und Präventionskonzepte erstellt hätten, und der Kirchenkreis die Vereinbarungen zur Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes auch an die Stadt Wuppertal gegeben habe, sei man jetzt dabei, für die jeweiligen Aufgabengebiete ein differenziertes Schutzkonzept zu erstellen. Die aktuelle Debatte über die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und die Befassung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) "sollten uns in der teilweise sehr guten schon laufenden Präventionsarbeit bestärken", betonte Federschmidt.
Die Herbstsynode befasste sich zudem unter anderem mit der Umwandlung des Friedhofsverbandes in einen Gemeinde- und Kreiskirchenverband. Auch widmeten sich die Synodalen neben Personal- und Finanzfragen dem Thema "Seelsorge". "In der personalen Begegnung verhalten sich Seelsorgerinnen und Seelsorger so, dass die Würde und Integrität ihres Gegenübers geachtet wird", erklärte Federschmidt. Zu den Voraussetzungen für eine angemessene Seelsorgepraxis gehöre "eine ethische Grundhaltung, die auf die Befriedigung eigener Bedürfnisse, einschließlich der sexuellen, in der Seelsorgebeziehung verzichtet". Die neue "Richtlinie zur Ethik in der Seelsorgearbeit" der Evangelischen Kirche im Rheinland verankere die Achtung vor den sensiblen persönlichen Grenzen eines Gegenübers auch in der Grundhaltung der Seelsorge, unterstrich die Superintendentin.
Superintendent Weyer wirbt für neue Formen von Kirche
Völklingen (epd). Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Saar-West, Christian Weyer, hat sich für eine Reform der Kirche ausgesprochen. "Wenn wir kein sektiererisches Grüppchen werden wollen, müssen wir den Menschen nachgehen und sie dort aufsuchen und begleiten, wo sich ihr Leben abspielt", sagte er bei der Kreissynode in Völklingen. "Ich bin überzeugt, dass wir die evangelische Kirche neu denken müssen." Das bedeute weg von starren gemeindlichen Grenzen und hin zu einer übergreifenden Struktur für die Gemeindeglieder, betonte Weyer.
"Die Volkskirche steht hier am Scheidweg", sagte der Superintendent. Es gehe um die Frage, ob Kirche weiterhin mitten im Volk und für das Volk da sein wolle oder ob sie es vorziehe, einen anderen Lebensentwurf am Rande oder neben der Gesellschaft zu leben. Weyer sprach sich aus diesem Grund für den Ausbau der Zusammenarbeit der Gemeinden in den Kooperationsräumen aus. Dies könnte etwa zu verlässlicher Seelsorge sowie besseren Gottesdienstangeboten führen.
Kirche dürfe allerdings auch nicht nur um sich selbst kreisen, sagte Weyer. So wandte er sich beim Thema Flucht und Migration gegen rechtsradikale Parolen und sicherte Gemeinden, die Kirchenasyl anbieten, Unterstützung zu: "Sie verdienen unser aller Unterstützung und wenn es nötig ist, auch unseren Schutz", sagte er. Kirchenasyl werde nicht leichtfertig gewährt. Finde es Anwendung, gelte es damit drohende Verletzungen von elementaren Menschenrechten abzuwenden.
Kirchenkreis An der Agger plant neue Stelle für Austausch
Gummersbach (epd). Der Evangelische Kirchenkreis An der Agger will eine neue Stelle "Kirche auf dem Markt" einrichten. Der diakonisch-missionarische Charakter der Kirche solle neue Kraft bekommen, erklärte der Kirchenkreis nach der Herbstsynode in Gummersbach. Die Einrichtung der Stelle für Inspiration, Mission und Kooperation werde bis zur nächsten Herbstsynode vorbereitet und diene dem Austausch über Verkündigung, Diakonie und Bildung mit den Sozialpartnern und Kommunen. Zudem beschloss das Kirchenparlament die Hauptamtlichkeit der Position des Superintendenten. Die Stelle werde künftig bundesweit ausgeschrieben.
Neben der Haushaltsplanberatung standen den Angaben zufolge auch Ausschusswahlen auf der Tagesordnung. Kreiskantor Hans-Peter Fischer sei in den Ruhestand verabschiedet worden. Die rund 100 Vertreter der 25 Kirchengemeinden zwischen Wipperfürth und Rosenbach begrüßten seine Nachfolgerin, Annemarie Sirrenberg, wie es hieß.
Superintendent Jürgen Knabe plädierte in seinem 18. Superintendentenbericht angesichts der aktuellen politischen Verwerfungen für eine Stellungnahme der Kirche. Die Kirche habe den Auftrag, Menschen auf ihren Lebenswegen zu begleiten und Grunderfahrungen des Glaubens zu bieten. Angesichts loserer Verbindungen der Menschen zur Kirche seien neue Formen der Gemeindearbeit und eine Weiterentwicklung der Sonntagsgottesdienste nötig, erklärte er.
Kirchengemeinden an Sieg und Rhein sollen stärker kooperieren
Sankt Augustin (epd). Die Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises an Sieg und Rhein, Almut van Niekerk, hat Gemeinden zu mehr gemeinsamen Projekten und Kooperationen aufgerufen. Dadurch sollten sich die Kirchengemeinden in der Region frühzeitig auf die zukünftige Situation mit geringeren finanziellen und personellen Ressourcen vorbereiten, sagte die leitende Theologin des Kirchenkreises auf der Herbstsynode in Sankt Augustin. Die veränderte Rolle der Kirche in der Gesellschaft und der immer stärker spürbare Traditionsabbruch vieler Menschen machten Veränderungen notwendig.
Zugleich betonte van Niekerk in ihrem Jahresbericht vor den rund 130 Abgeordneten des Kirchenparlaments: "Die Kirche muss mit ihrer Botschaft hörbar bleiben - gerade in gesellschaftlich so schwierigen Zeiten wie jetzt." So müssten beispielsweise den oft wenig sachlichen Kommentaren auf evangelische Positionen in den sozialen Netzwerken positive Botschaften entgegengesetzt werden.
Mit Blick auf den Haushalt für das Jahr 2019 erklärte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Dietmar Flösch, die verfügbare Kirchensteuer habe sich aktuell bei rund 35 Millionen Euro eingependelt. "In den kommenden Jahren ist mit sinkenden Einnahmen zu rechnen", erklärte Flösch. 2019 stehen dem Kirchenkreis demnach nach Abzug aller Umlagen an Landeskirche und Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) etwa 21,2 Millionen Euro zur Verfügung, die unter anderem in die Arbeit des Diakonischen Werkes und die Kinder- und Jugendarbeit fließen. Die Synode beschloss zudem, im kommenden Jahr die kreiskirchliche Pfarrstelle für Behindertenarbeit wieder im Umfang einer vollen Stelle zu besetzen.
"Ablasshandel" zum Erhalt der Ludwigskirche
Saarbrücken (epd). Die evangelische Kirchengemeinde Alt-Saarbrücken verkauft Ablässe zum Erhalt der Ludwigskirche. "Natürlich verkaufen wir nicht etwa Seelenheil gegen Geld", sagte Gemeindepfarrer Thomas Bergholz am 21. November in Saarbrücken. "Der Spender oder die Spenderin erwirbt mit ihrer Spende einen ganz irdischen, bodenständigen Vorteil: Der 'Ablass' ist nämlich ein Nachlass vom Eintrittspreis beim nächsten Konzert in der Ludwigskirche." Ab Samstag sind die Urkunden den Angaben zufolge für 50 Euro erhältlich.
Die Ludwigskirche brauche Förderer und Unterstützer, da die Kirchengemeinde langfristig die finanziellen Lasten nicht alleine tragen könne, betonte Bergholz. Die Päpste hatten im 16. Jahrhundert den Ablasshandel ausgebaut, um damit etwa den Neubau des Petersdomes in Rom zu finanzieren. Anstoß habe dabei nicht nur bei Martin Luther (1483-1546) der Grundgedanke, Seelenheil gegen Geld erwerbbar zu machen, erregt, hieß es. Deswegen gehe es bei dem Saarbrücker "Ablasshandel" auch "mit einem deutlichen Augenzwinkern" um den Erhalt der Kirche.
Evangelisches Jugendprojekt gewinnt Filmpreis
Bornheim (epd). Das evangelische Jugendprojekt Kulturraum in Bornheim-Sechtem hat den ersten Preis des "2880 Grand Prix du Film"-Festivals gewonnen. Zehn Jugendliche drehten den Siegerfilm "Meine furchtbare Schwester" in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und Regisseurin Mareike Osenau, wie der Evangelische Kirchenkreis an Sieg und Rhein am 20. November in Siegburg mitteilte.
Beim Preis des 2880-Filmfestivals geht es darum, innerhalb von 48 Stunden einen höchstens fünfminütigen Kurzfilm zu drehen. Per Losverfahren wird den Teilnehmern ein Genre und der Titel des Filmes zugeteilt. Der Bornheimer "Kulturraum" zog das Genre "Heimatfilm" und den Titel "Meine furchtbare Schwester". Bei einer Vorführung wählt ein Publikum elf Finalisten, aus denen eine Jury dann auf einer Gala die Gewinner kürt.
epd-West ksg max
Gesellschaft
Das "C" wird katholischer

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn - bei Regionalkonferenzen versuchen die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz derzeit vor allem, ihre Unterschiede herauszustellen. Eines aber haben alle drei gemeinsam: Sie sind katholisch. Dass nach der Pfarrerstochter Angela Merkel künftig aller Voraussicht nach jemand mit katholischer Kirchenzugehörigkeit die Christlich-Demokratische Union (CDU) führen wird, setzt einen Trend fort: Das "C" scheint wieder katholischer zu werden.
Bereits bei der Kabinettsbildung blieb von der protestantischen Dominanz der vergangenen Jahre nicht mehr viel übrig. Neben Merkel gibt es nur noch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als evangelische CDU-Vertreterin in der Ministerriege. An der Fraktionsspitze hat der Katholik Ralph Brinkhaus den Protestanten Volker Kauder abgelöst. Neben dem evangelischen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble hat sich ein deutliches katholisches Übergewicht gebildet.
"Ökumenisches Projekt"
In der Partei sieht man das erst einmal gelassen. Der Konfessions-Mix variiere von Wahlperiode zu Wahlperiode, sagt Heribert Hirte. Der CDU-Politiker ist Vorsitzender des Stephanuskreis, der sich für verfolgte Christen einsetzt - und Katholik. Auch Protestanten zucken zunächst mit der Schulter. "Die CDU ist eines der erfolgreichsten ökumenischen Projekte der vergangenen Jahrzehnte. Was für die Politik von christlicher Seite relevant ist, macht nicht an konfessionellen Grenzen halt", sagt der kirchenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Hermann Gröhe. Er ist evangelisch und Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Mitglied im EKD-Rat und Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU (EAK) ist Thomas Rachel, der sogar von einer Rückkehr in eine Art Normalzustand spricht. Ein Drittel der Mitglieder der CDU sei evangelisch, die Mehrheit also katholisch. "Dass die CDU in ihren Partei-Führungsgremien, im Kabinett und in der Fraktionsspitze in der vergangenen Wahlperiode evangelische Spitzenvertreter in Fülle hatte, war ein Novum in der Geschichte der Union", sagt er. Dennoch will Rachel nicht, dass die CDU nur mit Katholiken verbunden wird. "Ohne die Evangelischen wäre die CDU als Volkspartei nicht denkbar", sagte er. Darauf werde man auch künftig achten müssen.
Protestantische Grundorientierung
Merkel, die Anfang der 90er Jahre auch EAK-Vorsitzende war, habe in der Art und Weise, wie sie die CDU programmatisch weiterentwickelt und als Kanzlerin gewirkt hat, eine protestantische Grundorientierung erkennen lassen, ist Rachel überzeugt. "Typisch ist etwa ihr nüchtern-protestantischer Politikstil, an dem sich manche auch gestoßen haben", sagt der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium.
"Problemorientierte, nüchterne Pflichterfüllung" ist auch das Etikett, das Merkel-Biograf Volker Resing Merkel anheftet. Das liege ihr mehr als sinnstiftende, emotionale Symbolpolitik. "Die Partei ist weniger emotional aufgestellt, das ist das protestantische Merkel-Erbe", sagt der Chefredakteur der katholischen Zeitschrift "Herder Korrespondenz", dessen Buch "Angela Merkel - Die Protestantin" 2009 erschien, und ergänzt: "Möglicherweise wird sich da was im Stil ändern."
Von Kirche geprägt
Den drei maßgeblichen Kandidaten für den Parteivorsitz schreiben viele eine Prägung durch ihre Kirche zu. "Annegret Kramp-Karrenbauer ist sehr stark durch die katholische Soziallehre geprägt. Friedrich Merz und Jens Spahn benennen bei Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt stets die christliche Orientierung unseres Landes", sagt Gröhe. Auch Resing sagt, alle drei hätten etwas "Katholisches". "AKK" wie die CDU-Generalsekretärin wegen der Anfangsbuchstaben ihres Namens genannt wird, sei als einzige aber "kirchlich-katholisch". "Sie ist am meisten verbunden mit dem, was heute tatsächlich katholische Kirche ausmacht", sagt er. Merz bezeichnet er als "konservativ-katholisch", Spahn als "biografisch-katholisch".
Für den evangelischen Bevollmächtigten Martin Dutzmann, der sich im politischen Betrieb für die Positionen seiner Kirche einsetzt, macht es am Ende keinen Unterschied, welche Konfession ihm gegenübersitzt. "Wichtig ist für mich, wie sie oder er die Rolle der Kirchen beurteilt", sagt Dutzmann. "Ich habe nicht das Gefühl weniger Gehör zu finden, weil jetzt mehr Menschen katholischen Glaubens Verantwortung tragen", zeigt sich der EKD-Bevollmächtigte gelassen.
UN-Migrationspakt: EKD-Ratsvize Kurschus rügt Widerstand

epd-bild/Stefan Arend
Bielefeld (epd). Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, kritisiert den Widerstand in Deutschland gegen den Migrationspakt der Vereinten Nationen. "Wenn der UN-Migrationspakt scheitern würde, wäre das ein Armutszeugnis für die Menschheit", sagte Kurschus am 20. November dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Bielefeld. Dieser Vertrag für eine sichere und geordnete Migration sei der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich verständigen könne: "Die Regelungen kann eigentlich jeder unterzeichnen. Ein Boykott wäre ein verheerendes Signal."
Der völkerrechtlich nicht bindende "Vertrag für sichere, geordnete und geregelte Migration" der UN hat zum Ziel, Migration besser zu organisieren. Er gibt 23 Ziele vor, enthalten sind auch Maßnahmen zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Deutschland ist einer der mehr als 180 Staaten, die das Abkommen annehmen wollen. Massive Kritik vor allem von der AfD, die eine wachsende Zahl von Migranten befürchtet, hatte eine Debatte über das Abkommen entfacht. Inzwischen ist der Vertrag auch in den Unionsparteien umstritten.
Kurschus kritisierte das "Störfeuer in der deutschen Flüchtlingspolitik" als selbstbezogen. Es gehe nicht um die Sachthemen oder eine politische Grundorientierung, sondern darum, auf sich selbst aufmerksam zu machen, sagte die leitende Geistliche der westfälischen Landeskirche: "Die Leute werben dafür, dass sie gewählt werden."
Kritik an neuer Abschiebe-Diskussion
Als "selbstorientiert" bewertet die 55-jährige Theologin auch die politische Debatte über Abschiebungen: "Es geht weniger um den Schutz der Bürger als darum, eigene Macht zu demonstrieren." Die aktuelle Abschiebepolitik habe "die Flüchtlinge als Menschen nicht im Blick", sagte Kurschus. Das Bundesinnenministerium erwägt Medienberichten zufolge, Abschiebungen zu erleichtern.
Die seit August geltende Verschärfung des Kirchenasyls sollte nach Ansicht der westfälischen Präses zurückgenommen werden. Es sei "unzumutbar, dass beispielsweise die Entscheidungsfrist derartig verlängert wird". Damit würden die Menschen in einem sehr langen Zustand der Ungewissheit gelassen. Das sei "ein Versuch, Kirchenasyl einzuschränken".
Beim Kirchenasyl stelle die Kirche nicht ein eigenes Gesetz gegen Recht und Gesetz, betonte die EKD-Ratsvize: "Wir sind es von unserem kirchlichen Auftrag her den Menschen schuldig, dass wir alles versuchen, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen." Die meisten Kirchenasyle endeten mit einem Bleiberecht. "Das zeigt, dass eine erneute Prüfung durchaus berechtigt war".
Nach einem Beschluss der Innenministerkonferenz kann seit August die oftmals maßgebliche Frist von 6 auf 18 Monate erhöht werden, wenn Kirchengemeinden nach Ansicht des Bundesamts Verfahrensabsprachen nicht einhalten. Das betrifft sogenannte Dublin-Fälle, in denen ein anderer EU-Staat zuständig ist. Die Frist von sechs Monaten wird durch das Kirchenasyl oftmals überschritten. Eine Frist von 18 Monaten würde vielen Gemeinden die Versorgung Schutzsuchender erheblich erschweren.
Zwei Pakte für eine bessere Welt

epd-bild/Christian Ditsch
Genf, Berlin (epd). Die Vereinten Nationen haben Großes vor. Die Weltorganisation will mit zwei Pakten das Los von vielen Millionen Menschen verbessern: Es sind der Globale Migrationspakt und der Globale Flüchtlingspakt. "Diese Vereinbarungen zeigen, wie gut die internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten kann", wirbt UN-Generalsekretär António Guterres. Die beiden Abkommen, die für die Mitgliedsländer nicht bindend sind, werden vermutlich im Dezember von einer großen Mehrheit angenommen werden, doch der Gegenwind nimmt zu.
Die Vereinten Nationen spüren Handlungsbedarf. Mindestens 60.000 Migranten kamen seit 2000 auf dem Weg in ihre Zielländer ums Leben, viele ertranken im Mittelmeer oder verdursteten in der Sahara. Hunderttausende Kinder, Frauen und Männer geraten jedes Jahr in die Fänge krimineller Schleuser und Menschenhändler. Die Karawanen, die derzeit durch Mittelamerika ziehen, symbolisieren das Chaos. In den Zielländern leben rund 260 Millionen Migranten, oft unter erbärmlichen Bedingungen. Niemals zuvor waren es mehr.
"Sicherheit und ökonomischer Fortschritt"
Der "Globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration" soll nun dafür sorgen, dass Menschen legal und gefahrlos in aufnahmebereite Staaten gelangen. Dort sollen sie nicht ausgebeutet und besser integriert werden. "Die Umsetzung des Migrationspaktes wird Sicherheit, Ordnung und ökonomischen Fortschritt für alle Beteiligten bringen", verspricht Louise Arbour, die UN-Sonderbeauftragte für Migration.
Die 23 vorgegebenen Ziele reichen von der Ausstellung gültiger Papiere über Grundleistungen wie medizinische Nothilfe bis zum koordinierten Management der Grenzen durch die Staaten. "Der Migrationspakt ist wie ein Katalog, aus dem sich die Staaten dasjenige aussuchen werden, was sie umsetzen können und wollen", erläutert der Politikdirektor der Internationalen Katholischen Kommission für Migration in Genf, Stephane Jaquemet. Jeder Staat werde selbst bestimmen, wie und ob er die Vorgaben implementiert.
Obwohl der Pakt auch laut dem Auswärtigen Amt "in der nationalen Rechtsordnung keine Rechtswirkung" entfaltet, mehren sich international die Gegner. Die USA, Österreich, Ungarn und weitere Staaten lehnen das Abkommen ab. Die Neinsager befürchten, dass der Pakt die nationale Souveränität aushöhlen könnte.
In Deutschland prägten zunächst Rechtspopulisten die Debatte. Sie behaupten, dass der Pakt Millionen von Menschen aus Krisenregionen anstiften würde, sich auf den Weg zu machen. Sie schüren Ängste vor einer "Einwanderung in die Sozialsysteme" und davor, dass das Abkommen durch die Hintertür doch völkerrechtlich verbindlich werden könnte - zum Beispiel durch Gerichtsurteile.
Auch aus der CDU kommen skeptische Töne. Gesundheitsminister Jens Spahn, der den Vorsitz der Partei anstrebt, sprach sich für eine genaue Prüfung aus. Die Bundesregierung muss ebenso Kritik einstecken: Oppositionspolitiker werfen ihr vor, nicht ausreichend über das Abkommen aufgeklärt zu haben.
Zustimmung bröckelt
Der "Globale Pakt für Flüchtlinge" wird in Deutschland nicht so heftig angefeindet wie der Migrationspakt. International aber bröckelt die Zustimmung auch zum Flüchtlingspakt. Bei einer Abstimmung über das Abkommen in einem UN-Ausschuss blieben 13 Länder fern, drei enthielten sich und die USA stimmen dagegen. Zwar votierten 176 Länder mit Ja, darunter die EU-Staaten. Bis vor wenigen Wochen aber waren noch alle UN-Mitgliedsländer an Bord.
Angesichts der immer schlimmer werdenden globalen Flüchtlingskrise sehen die UN zu dem Pakt keine Alternative. Mittlerweile befinden sich 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht, ein neuer Höchststand. "Die Lasten werden oft durch die Länder getragen, die am wenigsten dafür ausgestattet sind", erklärt der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Arme Aufnahmeländer sollen nun mehr Hilfen erhalten. Mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge leben derzeit in den Ländern des Südens.
Die Flüchtlinge sollen laut dem Pakt einen besseren Zugang zu Schulen und zum Gesundheitswesen erhalten. Zudem soll die Jobsuche erleichtert werden. Beide Abkommen, der Flüchtlingspakt und Migrationspakt, zeigen Wege hin zu einem besseren Leben für Millionen Menschen auf. Ab Dezember wird es an den Staaten liegen, ob der Weg auch beschritten wird.
Seehofer schließt Abschiebungen nach Syrien aus

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat Abschiebungen nach Syrien zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Auch straffällig gewordene Flüchtlinge könnten nicht in das Bürgerkriegsland zurückgeschickt werden, sagte er dem "Spiegel" laut Vorabmeldung vom 23. November. Der neue Lagebericht des Auswärtigen Amtes zu Syrien sei "plausibel", erklärte der Minister: "Im Moment kann in keine Region Syriens abgeschoben werden, das gilt auch für Kriminelle." Pro Asyl begrüßte die Äußerungen Seehofers. Zugleich verlangte die Flüchtlingsorganisation, auch Abschiebungen nach Afghanistan und in den Irak zu stoppen.
Lagebericht des Auswärtigen Amtes
Im Wahlkampf um den CDU-Vorsitz hatte kürzlich die Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert, im Zweifelsfall müsse man straffällig gewordene Syrer trotz des nicht beendeten Bürgerkriegs in ihr Heimatland zurückschicken. Der derzeitige Stopp von Abschiebungen nach Syrien läuft im Dezember aus. Auf Grundlage des Lageberichts des Auswärtigen Amtes will die Innenministerkonferenz in der kommenden Woche in Magdeburg über Abschiebungen beraten.
Medienberichten zufolge warnt das Außenministerium in seinem Lagereport deutlich vor Abschiebungen in das Bürgerkriegsland. Rückkehrern drohe Gefahr für Leib und Leben, heißt es dem Papier, über das "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR Anfang der Woche berichtet hatten. "In keinem Teil Syriens besteht ein umfassender, langfristiger und verlässlicher Schutz für verfolgte Personen", zitieren die Medien aus dem Papier, das auf den 13. November datiert ist.
Pro Asyl: "Menschen müssen ankommen dürfen"
Pro Asyl rief die Innenminister auf, in der kommenden Woche auch für Afghanen und Iraker einen Abschiebstopp zu verfügen. Zudem äußerte sich die Organisation besorgt über Medienberichte, wonach die Frist für Widerrufsverfahren für zwischen 2015 und 2016 eingereiste Flüchtlinge von drei auf fünf Jahre zu verlängert werden soll. Damit würden vor allem Menschen aus Syrien, Irak und Afghanistan getroffen, die die Hauptherkunftsländer in den Jahren 2015 und 2016 ausmachten, kritisierte Pro Asyl.
"Menschen müssen ankommen dürfen. So wird Unsicherheit geschaffen, die Integration und das Hineinwachsen in unsere Gesellschaft verhindert", erklärte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Befristete Abschiebestopps nach Syrien, die Debatte um forcierte Abschiebungen in Krisengebiete wie Afghanistan sowie die Verlängerung der Widerrufsfrist auf fünf Jahre führten zu einem "Leben im Schwebezustand".
Gericht hebt Abschiebeverbot für Sami A. auf
Gelsenkirchen (epd). Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat das selbst verfügte Abschiebeverbot für Sami A. nach Tunesien aufgehoben. Auf Antrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sowie aufgrund "neuer Umstände" wurde der vom Bundesamt im Juni angeordnete Widerruf des Abschiebeverbotes bestätigt, wie das Gericht am 21. November in Gelsenkirchen mitteilte. Damit bestehe vorerst bis zur abschließenden Entscheidung im Hauptsacheverfahren kein wirksames Abschiebungsverbot für Sami A. nach Tunesien. (AZ: 7a L 1947/18.A)
Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier war im Juli auf Anweisung der nordrhein-westfälischen Landesregierung ausgeflogen worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen kurz zuvor in einem Eilbeschluss die Abschiebung verboten hatte. Das Oberverwaltungsgericht Münster entschied anschließend, dass Sami A. aus Tunesien, wo er sich noch aufhält, nach Deutschland zurückgeholt werden müsse.
Diplomatische Zusicherung Tunesiens
Grundlage der jetzigen Entscheidung ist den Angaben nach die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angeforderte Zusage der tunesischen Behörden, wonach Sami A. keine Folter oder unmenschliche Behandlung durch seinen Heimatstaat drohe. Das Bundesamt hatte dem Gericht die sogenannte Verbalnote der tunesischen Botschaft in Berlin vom 29. Oktober 2018 vorgelegt und beantragt, eine Abschiebung von Sami A. möglich zu machen.
Die diplomatische Zusicherung erfülle die von der Rechtsprechung an derartige Erklärungen gestellten Anforderungen und sei "ein geeignetes Instrument, die Gefahr einer der Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechenden Behandlung in hinreichendem Maß auszuräumen", heißt es in der Mitteilung. Die Zusicherung sei individuell auf den Tunesier bezogen und auch inhaltlich ausreichend bestimmt. Zudem förderten das mediale Interesse am Fall Sami A., seine Bekanntheit und die politische Brisanz des Falles in besonderem Maße die tatsächliche Einhaltung der Zusicherung durch die tunesischen Behörden, hieß es weiter.
Die Aussagen des von Sami A. über die nach seiner Abschiebung in Tunesien erlittene Folter beziehungsweise unmenschliche Behandlung bewertete das Gericht als nicht glaubhaft.
Flüchtlingsbürgen: Grüne werfen Bund und Land Untätigkeit vor
Düsseldorf, Berlin (epd). Im Konflikt um die Zahlungsaufforderungen der Behörden an Flüchtlingsbürgen haben die Grünen den Regierungen in Nordrhein-Westfalen und im Bund Untätigkeit vorgeworfen. Die für September vorgesehenen Bund-Länder-Gespräche hätten gar nicht stattgefunden, wie erst auf Nachfrage herausgekommen sei, kritisierte die flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Filiz Polat, am 20. November in Düsseldorf. Sie warf der Bundesregierung eine Hinhaltetaktik vor. Die Verpflichtungsgeber würden in ihrer "existenzbedrohenden Situation" allein gelassen.
Nach Ansicht der nordrhein-westfälischen Grünen-Abgeordneten Berivan Aymaz ist auch die NRW-Landesregierung gefordert, mit den anderen Ländern Lösungen zu erarbeiten. Der derzeitige Schwebezustand führe durch die zahlreichen Klagen von Flüchtlingsbürgen auch zu einer Belastung der Jobcenter, Sozialämter und Gerichte, sagte die integrationspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.
Moratorium gilt nach wie vor
In einer Antwort auf die Anfrage von Polat hatte das Bundesinnenministerium Ende Oktober eine Fortsetzung der Gespräche mit den Ländern Hessen und Niedersachsen für November angekündigt. Es gelte weiter das von Bund und Ländern Ende Februar vereinbarte Moratorium: Danach verschicken Behörden zwar weiter Kostenbescheide an Flüchtlingsbürgen, ziehen die Gelder aber bis auf weiteres nicht ein.
Schätzungsweise haben zwischen 2013 und 2015 rund 7.000 Menschen in Deutschland Verpflichtungserklärungen abgegeben, durch die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien auf sicherem Weg einreisen konnten. Die Bürgen waren davon ausgegangen, dass sie nur so lange für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge aufkommen müssen, bis die Asylverfahren positiv beschieden sind. Diese Position wurde damals unter anderem von den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen vertreten.
Aus Sicht der Bundesregierung galten die Erklärungen aber auch nach der Anerkennung der Flüchtlinge. Erst das Integrationsgesetz bestimmte 2016 eine Fünf-Jahres-Frist, die für "Altfälle" auf drei Jahre reduziert wurde. Seit mehr als einem Jahr verschicken Jobcenter und Sozialämter Rechnungen an die Bürgen, die teilweise eine sechsstellige Summe erreichen. Zahlreiche Betroffene ziehen gegen die Kostenbescheide vor Gericht.
Vielfach berufen sich die Gerichte auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes von 2017. Danach führt die Zuerkennung eines Flüchtlingsstatus "nicht zu einem anderen Aufenthaltszweck und verpflichtet weiterhin zur Erstattung von Sozialleistungen". Die Aufenthaltserlaubnis vor und nach der Anerkennung der Flüchtlinge diene demselben Zweck, nämlich humanitären Gründen. Auf dieses Urteil wies das Bundesinnenministerium gegenüber der Grünen-Abgeordneten ausdrücklich hin.
Grünen-Sicherheitsexperte: Afghanistan weiter unterstützen
Schwerte (epd). In Afghanistan hat sich die Sicherheitslage für die Bevölkerung nach Einschätzung des Grünen-Experten Winfried Nachtwei in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Dennoch müssten die Chancen für Frieden und Wiederaufbau gesehen werden, sagte der frühere sicherheits- und abrüstungspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion am 25. November auf der 32. Afghanistan-Tagung der Evangelischen Akademie Villigst in Schwerte. "Wir können ja nicht einfach den Deckel auf das Land machen", betonte Nachtwei.
Die Afghanen gehen den Wiederaufbau ihres Landes nach Nachtweis Worten mit Zuversicht an. Es bleibe aber abzuwarten, ob die Strategie der US-Regierung zum Erfolg führe, einerseits den militärischen Druck zu verstärken und andererseits auf Gespräche mit den radikal-islamischen Taliban zu setzen, sagte Nachtwei, der Ko-Vorsitzender des Beirats für zivile Krisenprävention beim Auswärtigen Amt ist.
Reformpolitikerin Habiba Sarabi: Junge Generation will Frieden
Die stellvertretende Vorsitzende des Hohen Friedensrates in Afghanistan, Habiba Sarabi, warb auf der Tagung um die weitere Unterstützung Deutschlands und der internationalen Gemeinschaft für das Land am Hindukusch. Es gebe in ihrem Land sehr viele junge Leute, die hochmotiviert und bereit seien, Führungsaufgaben zu übernehmen und ihr Land wieder aufzubauen, sagte die frühere Gouverneurin der Provinz Bamiyan.
Unterstützung erhofft sich Sarabi zum Beispiel beim Aufbau eines Schulsystems. Der Konflikt zwischen der vom Westen gestützten Regierung in Kabul und den aufständischen Taliban dauert inzwischen mehr als 17 Jahre.
Schuster als Präsident des Zentralrats der Juden bestätigt

epd-bild/Thomas Lohnes
Frankfurt a.M., München (epd). Josef Schuster bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der 64-jährige Mediziner wurde vom Präsidium des Zentralrats in Frankfurt am Main einstimmig im Amt bestätigt, wie eine Sprecherin am 25. November mitteilte. Die beiden großen Kirchen gratulierten Schuster zur Wiederwahl. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx würdigte Schusters klare Positionierung gegen Rechtspopulismus und Sachlichkeit in der Integrationsdebatte.
Schuster kündigte nach seiner Wiederwahl an, der Zentralrat werde sich weiterhin für eine sichere jüdische Zukunft in Deutschland einsetzen und seine Stimme gegen bedenkliche gesellschaftliche Entwicklungen erheben. "Auch in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus lassen wir uns nicht entmutigen", sagte er. "Wir werden unseren Beitrag zu einem toleranten und weltoffenen Deutschland leisten."
"Starke und kluge Stimme"
Kardinal Marx würdigte Schuster als einen geschätzten Kooperationspartner der Kirchen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz bescheinigte Schuster, mit Differenzierung und Sachlichkeit auf Integrationsprobleme hinzuweisen, ohne die Flüchtlinge oder die Muslime als Gruppe anzugreifen. Er kritisiere muslimischen Antisemitismus ebenso wie Islamfeindlichkeit und positioniere sich klar gegen Rechtspopulismus.
Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, lobte die gute Zusammenarbeit mit Schuster. "Er ist ein Glücksfall nicht nur für das Judentum in Deutschland, sondern auch für unser ganzes Land", erklärte er. "Ich freue mich darauf, seine starke und kluge Stimme in der Öffentlichkeit auch zukünftig zu hören."
Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hob Schusters Sachkenntnis und Fingerspitzengefühl hervor. In den schwierigen Zeiten, da Judenhass in Gesellschaft und Politik wieder aufflamme, sei Schusters Wiederwahl das richtige Signal, erklärte sie. Knobloch war von 2006 bis 2010 Präsidentin des Zentralrats.
Rabbiner bei der Bundeswehr
Als seine Ziele für den Zentralrat hatte Schuster vor seiner Wahl unter anderem die Einführung von Rabbinern bei der Bundeswehr, ein bundesweites Meldesystem für antisemitische Vorfälle und die Realisierung der Pläne für eine Jüdische Akademie genannt. Der Zentralrat vertritt die politischen und gesellschaftlichen Interessen von rund 98.000 Jüdinnen und Juden in Deutschland. Das oberste Gremium, die Ratsversammlung mit knapp 100 Delegierten, war am Sonntag in Frankfurt zusammengetreten.
Schuster wurde 1954 wurde im israelischen Haifa geboren. Seine Familie hat jahrhundertealte Wurzeln in Unterfranken. Sein Vater David stammt aus Bad Brückenau. 1938 zwangen die Nazis die Familie dazu, Deutschland zu verlassen, 1956 kehrten sie zurück nach Würzburg. In den 60er Jahren war David Schuster treibende Kraft für den Neubau der 1970 eingeweihten Würzburger Synagoge.
Josef Schuster studierte Medizin in Würzburg. Seit 1988 hat der verheiratete Vater von zwei Kindern eine eigene internistische Praxis. Seit vielen Jahren schon übernimmt er an christlichen Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern regelmäßig ärztliche Not- oder Bereitschaftsdienste.
Als Vizepräsidenten des Zentralrats wurden Mark Dainow (Offenbach) und Abraham Lehrer (Köln) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in das Präsidium Zentralrats gewählt wurden: Küf Kaufmann (Leipzig), Ran Ronen (Düsseldorf), Milena Rosenzweig-Winter (Berlin), Harry Schnabel (Frankfurt/Main), Vera Szackamer (München) und Barbara Traub (Stuttgart).
1.300 Beratungen gegen Rechtsextremismus in NRW
Düsseldorf (epd). Die Mobile Beratung in Nordrhein-Westfalen verzeichnet angesichts eines politisch stark polarisierten Klimas mehr Anfragen zu Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. "Durch den Rechtspopulismus gibt es eine neue Herausforderung, aber auch mehr Sensibilität", sagte Patrick Fels, Berater im Regierungsbezirk Köln, zum zehnjährigen Bestehen der Beratung in NRW am 20. November in Düsseldorf. Insgesamt unterstützten die Berater den Angaben zufolge seit 2008 Betroffene in rund 1.300 Fällen.
"Rassismus der Mitte"
Nach der Einschätzung von Lenard Suermann, Mitarbeiter der Mobilen Beratung in Düsseldorf, suchen zudem mehr Menschen Rat, die sich für Flüchtlinge engagieren. Sie sähen sich häufiger Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt. "Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ein Rassismus der Mitte", erklärte Suermann. Auch nach der Aufdeckung des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) beobachtete Fels vermehrt Anfragen. Die Menschen seien dadurch sensibilisiert worden und wollten auch kleine Beobachtungen aus der Nachbarschaft nicht unerwähnt lassen.
Fünf Teams der Mobilen Beratung unterstützen bei Problemen und Anfeindungen im Bereich des Extremismus und Rassismus. In Düsseldorf, Köln, Münster, Detmold und Arnsberg bieten sie Betroffenen, Vereinen, Verbänden oder Bildungseinrichten bei konkreten Vorfällen anonyme Hilfe, wie es hieß.
Die Stellen wollten die Menschen dazu befähigen, sich selbst gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu wehren, erklärte Suermann. Personen kontaktierten die Mobile Beratung mit unterschiedlichen Anliegen. Dazu zählten etwa rassistische Anfeindungen auf dem Pausenhof, beleidigende Posts in sozialen Netzwerken oder rechte Demonstrationen in der Heimatstadt.
Die Mobile Beratung ist ein bundesweites Projekt, das in den 90er-Jahren in den ostdeutschen Bundesländern startete, um die Zivilgesellschaft in Fragen von Extremismus, Rassismus und Antisemitismus zu unterstützen. Seit 2008 gibt es Beraterteams in Nordrhein-Westfalen, die das Bundesfamilienministerium und die Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen finanzieren.
Juden, Christen und Muslime planen Rosenmontagswagen
Düsseldorf (epd). Beim nächsten Rosenmontagszug am 4. März in Düsseldorf wollen die Religionsgemeinschaften der Landeshauptstadt auf einem gemeinsamen Wagen mitfahren. Juden, Protestanten, Katholiken und Muslime wollten einen interreligiösen Mottowagen zum närrischen Sessionsmotto "Gemeinsam jeck" gestalten, erläuterte der Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde, Michael N. Szentei-Heise, der das Projekt initiiert hatte, am 20. November. In Zeiten von zunehmendem Antisemitismus wolle man damit "auch ein Zeichen setzen, dass wir zusammen Karneval feiern und gemeinsam jeck sein können".
Crowdfundind-Projekt
Einen solchen gemeinsamen interreligiösen Wagen habe es im Karneval noch nie gegeben, sagte Szentei-Heise beim Besuch des Düsseldorfer Karnevals-Prinzenpaares in der Jüdischen Gemeinde. Auch Prinz Martin I. und Prinzessin Venetia Sabine sprachen von "einem Meilenstein in der Düsseldorfer Geschichte". Das Prinzenpaar war zum ersten Mal bei der Jüdischen Gemeinde zu Gast. Auch Vertreter des Comittees Düsseldorfer Carneval, der christlichen Kirchen und des Kreises Düsseldorfer Muslime nahmen an dem Empfang teil.
Um den geplanten interreligiösen Karnevalswagen zu finanzieren, wird demnächst ein Crowdfunding gestartet. Bei dem Empfang der Jüdischen Gemeinde für das amtierende Prinzenpaar wurden am 20. November zudem der eigens gefertigte Karnevalsorden der Jüdischen Gemeinde erstmals vergeben. Auf dem Orden in Form eines Sterns prangen neben dem Sessionsmotto "Gemeinsam Jeck" auch ein Rabbiner, ein Imam sowie ein katholischer Bischof. Alle drei tragen eine Clownsnase. Daneben sind Gotteshäuser der drei Religionsgemeinschaften zu erkennen.
Bereits im vergangenen Jahr fuhr im Rosenmontagszug erstmals ein Wagen der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf mit, mit dem sie an den "größten jüdischen Sohn" der Stadt Düsseldorf, den Dichter Heinrich Heine, erinnert hatte. Das habe über Deutschland hinaus für viel Aufmerksamkeit gesorgt, da das Thema Karneval und Juden "historisch vorbelastet sei", sagte Szentei-Heise. Er erinnerte daran, dass im Jahr 1922 im benachbarten Köln ein erster jüdischer Karnevalsverein gegründet worden war. Schon ein Jahr später, 1923 und damit zehn Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurde der Verein in der Domstadt bereits verboten. Während der NS-Zeit dann fuhren antisemitische Mottowagen und Motive mit Diffamierungen der Juden bei den Karnevalsumzügen überall in Deutschland mit.
Ewiger Blick auf Mekka

epd-bild / version/Herby Sachs
Frankfurt a.M. (epd). Ende des 18. Jahrhunderts wurde die erste muslimische Grabstätte in Berlin eingerichtet: Der Gesandte des Osmanischen Reiches, der Dichter Ali Aziz Efendi, war 1798 unerwartet gestorben. Zwar wird der überwiegende Teil der in Deutschland verstorbenen Muslime heute in ihren Heimatländern beigesetzt. Bestatter beobachten jedoch eine Trendwende: Immer mehr Muslime wünschen sich Deutschland als ihre letzte Ruhestätte.
Nach Mekka ausgerichtete Grabfelder für die Bestattung von Muslimen gibt es in deutschen Kommunen zum Teil schon seit Jahrzehnten: zum Beispiel in Frankfurt am Main, Köln, Essen, Dresden, Freiburg, Stuttgart oder München. Islamwissenschaftlern zufolge soll es schon mehr als 500 muslimische Grabfelder in Deutschland geben. Auch durch die Aufnahme von Flüchtlingen muslimischen Glaubens wird sich der Bedarf an entsprechenden Bestattungsplätzen künftig wohl erhöhen.
"Bestattungskultur ist Spiegel der Gesellschaft"
Aeternitas, die Verbraucherinitiative für Bestattungskultur in Königswinter bei Bonn, nennt in einer nicht repräsentativen Erhebung Zahlen. Danach gab es allein in Berlin im Jahr 2006 rund 170 muslimische Bestattungen, zehn Jahre später waren es etwa 330. In Hamburg wurden 1995 insgesamt 65 Menschen nach islamischem Ritus beigesetzt, im vergangenen Jahr waren dies bereits 308. In Frankfurt am Main stieg die Anzahl muslimischer Bestattungen von 104 im Jahr 2015 auf 124 im Jahr 2017. Andere Zahlen liegen nicht vor, da muslimische Bestattungen an offizieller Stelle statistisch nicht erhoben werden.
"Schon Aufgrund der demografischen Entwicklung nehmen die islamischen Bestattungen in Deutschland zu", sagt der Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Bestatter, Stephan Neuser, in Düsseldorf im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aktuell sei es jedoch immer noch so, dass der überwiegende Teil der verstorbenen Muslime in die Heimatländer, beziehungsweise in die Heimat der Eltern überführt und dort beigesetzt werde.
Es zeige sich, dass die erste Generation türkischer Mitbürger fast immer eine Rückführung in die Türkei bevorzuge, sagt Neuser: "Die Menschen haben oft eine Versicherung abgeschlossen, vom türkischen Staat subventioniert, die eine Rückführung beinhaltet." In der nächsten Generation sei das anders. Von diesen möchten zunehmend mehr in Deutschland bestattet werden. "Das ist gut so, denn die Bestattungskultur ist ein Spiegel der Gesellschaft."
Es gibt einige Besonderheiten bei einer islamischen Bestattung: Unter anderem sollte zwischen Tod und Begräbnis nicht mehr als ein Tag vergehen - in Deutschland dagegen sind in der Regel mindestens 48 Stunden vorgeschrieben. Traditionell werden Muslime in Tücher gewickelt beigesetzt. Eine Feuerbestattung ist ihnen verboten.
Mehr muslimische Bestatter
"Bestattungsrecht ist Länderrecht", unterstreicht Neuser: "Einige Bundesländer haben in den letzten Jahren die Bestattungsgesetze novelliert. Friedhofsträger vor Ort haben seither die Möglichkeit, die Sargpflicht unter bestimmten Voraussetzungen zu lockern." Eine Bestattung im Leinentuch sei zudem keine zwingend vorgegebene oder durch religiöse Vorschriften vorgeschriebene Beisetzungsart. Eine nicht unerhebliche Zahl muslimischer Verstorbener entscheide sich in Deutschland zu Lebzeiten für eine Sargbestattung.
"Meines Wissens nach wird die sarglose Bestattung vergleichsweise gering angefragt", sagt der an der Frankfurter Goethe-Uni forschende Islamwissenschaftler Erdogan Karakaya. Vielen Bürgern muslimischen Glaubens sei dieses Angebot nicht bekannt. Zudem pflegten viele Menschen einen pragmatischen Umgang mit diesem Thema und ließen sich in einem einfachen Sarg bestatten.
In den letzten Jahren sei zudem die Zahl der muslimischen Bestatter gestiegen, sagt Karakaya. Zum einen haben Islamische Verbände wie Ditib oder die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs eigene Bestattungsunternehmen. Daneben gebe es große Bestatter, die eigene islamische Abteilungen gegründet haben, in denen Muslime tätig sind. Dass immer mehr Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland bestattet werden, bilanziert der Islamwissenschaftler Karakaya, liege auch daran, "dass viele aus der ersten und zweiten Generation der Migranten verstehen, dass ihre Familien weiterhin in Deutschland leben werden".
Bund beteiligt sich an Bau von jüdischer Akademie in Frankfurt
Frankfurt a.M. (epd). Der Weg scheint frei für den Bau einer jüdischen Akademie in Frankfurt am Main. Der Deutsche Bundestag habe für das Haushaltsjahr 2019 sieben Millionen Euro als Zuschuss für das Projekt bewilligt, teilte der Frankfurter Bürgermeister und Kirchendezernent Uwe Becker (CDU) am 22. November mit. Bereits im Februar dieses Jahres hatte der Magistrat der Stadt Frankfurt entschieden, das Projekt mit einem einmaligen Investitionskostenzuschuss von insgesamt 4,5 Millionen Euro zu unterstützen. Weitere drei Millionen Euro will das Land Hessen beisteuern.
Becker begrüßte die Entscheidung des Bundes. "Die Jüdische Akademie will gerade im Zeitalter der Globalisierung ihren Beitrag dazu leisten, dass die kulturelle und religiöse Pluralität der deutschen Gesellschaft, in der die Akademie wirkt, gestärkt wird", sagte der CDU-Politiker. Sie sehe ihre Aufgabe darin, jüdische Sichtweisen in den Diskurs zur Fortentwicklung unserer Gesellschaft einzubringen und wolle damit einen eigenen Beitrag zur Zukunft des deutschen Judentums in einem europäisch geprägten Deutschland leisten.
Die Akademie soll die zentrale Bildungseinrichtung der jüdischen Gemeinden in Deutschland werden. "Unsere Stadt ist der richtige Ort für diese wichtige Institution und wir freuen uns, dass die Stadt Frankfurt, das Land Hessen und der Bund zum Gelingen dieses Projektes gemeinsam beitragen", sagte Becker.
Köln realisiert Gedenkort Deportationslager Müngersdorf
Köln (epd). In Köln wird im kommenden Jahr der Gedenkort Deportationslager Köln-Müngersdorf verwirklicht. Nach dem Rat der Stadt habe nun auch der Beirat der Unteren Denkmalbehörde seine Zustimmung zu dem Vorhaben und dem Konzept des Bürgervereins Köln-Müngersdorf erteilt, erklärte die Stadt am 21. November. Mit dem Gedenkort werde an einen zentralen Ort der Geschichte des Nationalsozialismus erinnert. Das 1941 errichtete Deportationslager im Westen der Stadt habe den Höhepunkt der Verfolgung von Juden markiert. Von dem Kölner Lager aus waren Tausende Menschen direkt in das Ghetto Theresienstadt und in die Vernichtungslager deportiert worden.
Neben dem EL-DE-Haus in der Kölner Innenstadt als Zentrale der Gestapo und dem Deutzer Messelager als Deportationsort und Außenlager des KZ Buchenwald komme dem Deportationslager Müngersdorf eine gleiche historische Bedeutung zu, erklärte die Stadt. Allerdings zähle der Standort Müngersdorf zu den im öffentlichen Bewusstsein bislang vergessenen und verdrängten Orten. Das Konzept für die Umsetzung des Gedenkortes entwickelte der Bürgerverein Köln-Müngersdorf in Kooperation mit der Kunsthistorikerin Sophia Ungers und dem NS-Dokumentationszentrum.
Das Deportationslager Müngersdorf war den Angaben nach ab Ende 1941 in Gebäuden des ehemaligen preußischen Forts V sowie in Baracken errichtet worden. Verantwortlich war die Stadt Köln in enger Abstimmung mit der Gestapo. Das Lager war für viele jüdische Bürger die letzte Station auf dem Weg in den Holocaust. Es diente dazu, die noch verbliebenen Juden in Köln und aus dem Umland auf engem Areal zusammenzubringen und zu kontrollieren. In primitiven Baracken und feuchten Kasematten mussten die Inhaftierten für Wochen und Monate auf ihre Deportation warten. Viele starben bereits dort an Krankheiten oder Erschöpfung oder begingen Selbstmord.
Anklage gegen früheren KZ-Wachmann
Berlin (epd). Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen mutmaßlichen ehemaligen KZ-Wachmann Anklage erhoben. Dem Angeschuldigten Hans H. werde Beihilfe zum Mord in mehr als 36.000 Fällen vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am 23. November mit. Der heute 95-Jährige soll zwischen Sommer 1944 und Frühjahr 1945 Angehöriger der 16. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbannes im Konzentrationslager Mauthausen gewesen sein. Das östlich von Linz (Österreich) gelegene Lager lag damals auf dem Gebiet des Deutschen Reiches.
Dort soll Hans H. laut Staatsanwaltschaft als Bewacher der Häftlinge eingesetzt worden sein, unter anderem auch bei Märschen zu Arbeitskommandos oder in dem Steinbruch "Wiener Graben". Während der Tatzeit wurden laut Staatsanwaltschaft in Mauthausen mindestens 36.223 Menschen getötet. Die Tötungen erfolgten dabei größtenteils durch Vergasung, aber auch durch "Totbade-Aktionen", Injektionen und Erschießungen sowie aufgrund der dramatischen Lebensumstände unter anderem durch Verhungern und Erfrieren.
"Tötungen gefördert"
Dem Angeschuldigten sollen sämtliche Tötungsarten und Tötungsmethoden ebenso bekannt gewesen sein wie die desaströsen Lebensumstände der inhaftierten Menschen. Er habe, so der Anklagevorwurf, "mit seiner Wachdiensttätigkeit die vieltausendfach geschehenen Tötungen der Lagerinsassen durch die Haupttäter fördern oder zumindest erleichtern wollen".
Die Anklageerhebung zu so einem späten Zeitpunkt sei möglich, weil laut der geänderten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs von 2016 auch Fälle als Beihilfe zum Mord strafrechtlich verfolgbar sind, in denen Beschuldigte zwar selbst nicht getötet, aber in den organisierten Tötungsapparat eingebunden waren, heißt es. Laut "Bild"-Zeitung wohnt der Angeklagte in einer Hochhaussiedlung in Berlin-Neukölln. Das Landgericht Berlin muss jetzt über die Zulassung der Anklage und die Verhandlungsfähigkeit des 95-Jährigen entscheiden.
Protest gegen neues NRW-Polizeigesetz hält an
Düsseldorf (epd). Ein Bündnis aus Bürgerrechtlern, Parteien und Verbänden will am 8. Dezember in Düsseldorf gegen das geplante neue Polizeigesetz auf die Straße gehen. Die von der NRW-Landesregierung vorlegten Änderungen am umstrittenen Gesetzentwurf seien nur eine "Verschleierungstaktik", erklärte die Sprecherin des Bündnisses "Polizeigesetz NRW stoppen", Michèle Winkler, am 21. November. "Die Pläne der NRW-Regierung schaffen die Voraussetzungen für polizeiliche Willkür, beschneiden wesentliche Grundrechte und zerstören das Vertrauen in die Demokratie."
Aktionswochen
Neben der zentralen Demonstration solle es lokal organisierte Aktionswochen in verschiedenen Städten geben, hieß es. Bereits im Juli waren in Düsseldorf rund 10.000 Menschen gegen das Polizeigesetz auf die Straße gegangen. Zu dem Bündnis gehören unter anderem die Landesverbände von Grünen und Linkspartei, die Datenschutzorganisation Digitalcourage, Attac und das Komitee für Grundrechte und Demokratie.
Das neue Polizeigesetz soll die Befugnisse der Polizei etwa bei der Überwachung von digitaler Kommunikation und dem Umgang mit Gefährdern deutlich ausweiten. Nach breiter Kritik von Menschenrechtlern und Datenschützern hatte die Landesregierung im Oktober Änderungen vorgelegt. So wurde der umstrittene Begriff der "drohenden Gefahr" gestrichen und die Überwachung von Messengerdiensten wie WhatsApp oder Internettelefonie wie Skype nur mit Anordnung in speziellen Fällen zugelassen.
Dem Bündnis "Polizeigesetz NRW stoppen" geht das nicht weit genug. So trete an Stelle der "drohenden terroristischen Gefahr" nun ein weit gefasster Straftatenkatalog "terroristische Straftaten", hieß es. Demnach würde künftig bereits das Beschädigen eines Polizeifahrzeuges als Terrorismus gewertet, wenn die Tat mit "terroristischem Vorsatz" geschehe, erklärte das Bündnis. Wie dieser Vorsatz nachgewiesen werden solle, sei unklar.
Ebenso kritisierte das Bündnis, dass die Polizei laut Entwurf Menschen, von denen eine Gefahr ausgeht, nach richterlichem Entscheid statt 48 Stunden maximal 14 Tage in Gewahrsam nehmen könnte. Das sei ein Bruch mit dem Prinzip der Unschuldsvermutung, beklagte das Bündnis. Im ursprünglichen Entwurf war ein vorsorglicher Gewahrsam von bis zu einem Monat vorgesehen.
Sechs Kommunen für kulturelle Bildung ausgezeichnet
Düsseldorf (epd). Sechs Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten Preise für ihre Konzepte zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Gelsenkirchen, Herne, Monheim und Neuss sowie die Städteregion Aachen und der Kreis Lippe sind die Sieger im Wettbewerb "Kommunale Gesamtkonzepte für Kulturelle Bildung", wie das NRW-Kulturministerium am 19. November in Düsseldorf mitteilte. Das Land fördert die Preisträger mit jeweils 15.000 Euro. Beworben hatten sich insgesamt 75 Kommunen und kommunale Verbünde.
Ausgezeichnet wurden den Angaben zufolge die Konzepte zur Vernetzung von Ämtern, Künstlern sowie Kultureinrichtungen und -initiativen. "Es geht darum, in einer Welt vermeintlich einfacher Antworten und Perspektiven die Möglichkeit zur Werteorientierung zu bieten", erklärte Staatssekretär Klaus Kaiser (CDU) zur Preisverleihung im Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Ziel des Wettbewerbs sei es, das Engagement der kommunalen Akteure zu bündeln, um das Interesse von jungen Menschen am kulturellen Leben zu wecken.
Die Jury wählte zudem Dortmund, Hiddenhausen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen erneut für eine auf drei Jahre angelegte Förderung aus. Die Städte waren bereits in früheren Wettbewerbsrunden ausgezeichnet worden und können ihre Arbeit nun fortsetzen, wie das Ministerium mitteilte.
Allianz für den freien Sonntag Saarland startet Adventsaktion

epd-bild/Harald Koch
Saarbrücken (epd). Die Allianz für den freien Sonntag Saarland will mit einer Adventsaktion im Internet auf die Bedeutung des Sonn- und Feiertagsschutzes hinweisen. "Wenn nicht einige mahnend den Finger heben, dann wird der Motor immer mehr überdreht", sagte der stellvertretende DGB-Vorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Eugen Roth, am 21. November in Saarbrücken. An jeweils einem Adventssonntag veröffentlichen er, der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), Staatstheater-Intendant Bodo Busse sowie der Leistungssportler Martin Schedler ein Statement. Die Allianz wirbt für den Erhalt des Status quo mit vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr.
Es sei ein Irrglaube, dass man sich beim Einkauf erholen könnte, betonte Roth, der auch SPD-Landtagsabgeordneter ist. Sonntagsöffnungen der Geschäfte seien "ökonomischer Schwachsinn" und schadeten dem kleinen Einzelhandel, der dabei nicht mithalten könne.
Sportler Schedler betonte, dass man Geld nur einmal ausgeben könne. Unter der Woche spule er oft sein Trainingsprogramm nach der Arbeit ab, um für die Ultratrailläufe fit zu sein, die länger als Marathonläufe sind. Deswegen sei der Sonntag wichtig, um runterzukommen. "Wir Menschen sind keine Maschinen", sagte der Medaillengewinner im Ultratrail und bei der Bergmarathon-WM. Jeder brauche Zeit, um Kraft zu sammeln.
Staatstheater-Intendant Busse unterstrich die Bedeutung von Ruhepunkten im Leben. Theaterschaffende müssten zwar sonntags arbeiten, damit andere sich erholten, dafür gebe es allerdings den kunstfreien Montag als Ausgleich. "Im schönen momentanen Stillstand der Zeit können wir aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus auch unsere Zukunft besser in den Blick bekommen", sagte er. Die Hektik des Arbeitsalltags führe oft zu Überforderung und Stress.
In seiner schriftlichen Stellungnahme erklärte Ministerpräsident Hans, eine weitere Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen abzulehnen. "Ich freue mich, dass es im Saarland keine nennenswerten gegenteiligen Begehrlichkeiten und Anforderungen etwa der Wirtschaft gibt", betonte der CDU-Politiker. Der Sonntag biete den Rahmen für den Zusammenhalt der Familien und das Zusammenleben in den Dörfern und Städten.
Zur Allianz für den Sonntag Saarland gehören nach eigenen Angaben 30 Mitgliedsorganisationen. In dem 2009 gestarteten Bündnis engagieren sich etwa die evangelische sowie die katholische Kirche und die Synagogengemeinde Saar. Träger sind die regionalen Vertreter der Gewerkschaften ver.di, DGB und NGG, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt sowie das Evangelische und das Katholische Büro im Saarland.
Umwelt
Weltrisikobericht: Katastrophen treffen Kinder am stärksten

epd-bild/Friedrich Stark
Berlin (epd). Erdbeben, Überschwemmungen oder Wirbelstürme sind vor allem für Kinder katastrophal. Dies ist eine zentrale Aussage des Weltrisikoberichts 2018. Kinder seien körperlich schwächer, psychisch weniger belastbar und rechtlich oft weniger geschützt. Auch bei der Prävention würden sie nicht entsprechend berücksichtigt, heißt es in dem Bericht, den "Bündnis Entwicklung Hilft" und das Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum am 19. November in Berlin vorstellten.
"Die Zahl der Kinder, die in den vergangenen Jahren aufgrund von Katastrophen fliehen mussten, die ihre Eltern verloren haben, die ausgebeutet, missbraucht, verletzt oder sogar getötet wurden, ist alarmierend", betonen die Experten. Fast jedes vierte Kind weltweit lebt demnach in einem Land, das von Katastrophen betroffen ist. Direkte und undirekte körperliche und seelische Folgen könnten die Jungen und Mädchen ein Leben lang beeinträchtigen. Zudem könnten mangelhafte Versorgung oder seelische Traumata die Entwicklung massiv und schlimmstenfalls irreversibel beeinträchtigen. Wie sehr die Kinder leiden, hänge aber auch davon ab, ob Schulbildung lange unterbrochen oder ganz abgebrochen wird.
Die Regionen mit dem höchsten Katastrophenrisiko liegen dem Index 2018 zufolge in Ozeanien, Südostasien, Mittelamerika und in West- und Zentralafrika. Das größte Risiko hat Vanuatu, gefolgt von Tonga und den Philippinen - allesamt Inselstaaten im Pazifischen Ozean. Dabei sei nicht nur die Gefährdung gegenüber extremen Naturereignissen sehr hoch, heißt es in dem Bericht. Diese Länder wiesen auch eine hohe gesellschaftliche Verwundbarkeit auf.
Gefährdete Inselstaaten
Der Index soll einen Anhaltspunkt dafür bieten, wie hoch das Risiko ist, dass ein Land von einer Katastrophe infolge eines extremen Naturereignisses betroffen sein wird. Als Grundidee steht dahinter, dass für das Risiko nicht allein das Auftreten von beispielsweise Dürren, Erdbeben oder Wirbelstürmen relevant ist, sondern dass auch gesellschaftliche Faktoren verantwortlich dafür sind, ob es zu einer Katastrophe kommt oder nicht.
Insgesamt gehören neun Inselstaaten zu den 15 Ländern mit dem höchsten Risiko. Sie sind laut Bericht Naturgefahren wie Überschwemmungen, Wirbelstürmen und dem Anstieg des Meeresspiegels besonders ausgesetzt. Unter dem Gesichtspunkt gesellschaftliche Verwundbarkeit werden unter den 15 am stärksten gefährdeten Ländern 13 afrikanische aufgezählt.
Deutschland belegt auf dem Gesamtindex Rang 155 von 172. Als Plätze mit dem niedrigsten Katastrophenrisiko werden Saudi-Arabien, Malta und Katar genannt. "Die jährliche Analyse des Katastrophenrisikos weltweit wird immer wichtiger", betonte der Geschäftsführer von "Bündnis Entwicklung Hilft", Peter Mucke. "Die extremen Wettereignisse nehmen zu, was wir diesen Sommer auch durch die langanhaltende Dürre in Europa zu spüren bekommen haben."
Der Weltrisikobericht wird seit 2011 jährlich von "Bündnis Entwicklung Hilft" veröffentlicht, einem Zusammenschluss der Hilfsorganisationen "Brot für die Welt", Christoffel-Blindenmission, Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe, Kindernothilfe, medico international, Misereor, terre des hommes und Welthungerhilfe. Assoziiert sind außerdem "German Doctors", Plan International und Oxfam.
"Klimaglocken" läuten im Dezember bundesweit
Berlin, Bonn (epd). Zum Weltklimatag und dem Start der Weltklimakonferenz am 3. Dezember im polnischen Katowice sollen überall in Deutschland Turmglockenspiele läuten. Den Auftakt macht bereits am 1. Dezember das Tiergarten-Carillon in Berlin. Anlass ist die Demonstration von Umweltschutzverbänden unter dem Motto "Kohle stoppen! Klimaschutz jetzt!" vor dem Kanzleramt, wie die Initiative "Klimaglocken 2018" am 21. November in Berlin mitteilte. Die überall gleichlautende Melodie stammt von dem 96-jährigen Berliner Komponisten Klaus Wüsthoff, dessen Idee zu den "Klimaglocken" auch im vergangenen Jahr bereits umgesetzt wurde.
Mit Beginn der Weltklimakonferenz in Katowice sollen dann Carillons in Bonn, Emmerich, Hannover, Hamburg, Chemnitz, Erfurt und weiteren deutschen Städten erklingen. Auch an mehreren Orten in der Schweiz, Dänemark und Belgien sollen die Glockenspiele aus diesem Anlass gespielt werden.
Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom langjährigen Direktor des Potsdamer Klimafolgen-Instituts, Hans Joachim Schellnhuber, dem Deutschen Musikrat und vom Deutschen Tonkünstlerverband. Ziel der "Klimaglocken"-Kampagne 2018 sei es, dass möglichst viele Carillons während der bis zum 14. Dezember angesetzten Weltklimakonferenz in Katowice die Melodie spielen. Mit ihrem weit tönenden Glockenklang solle auf die existenzielle Bedeutung des Klimaschutzes erinnert werden, hieß es weiter.
Allein in Deutschland gibt es der Initiative zufolge fast 50 Turmglockenspiele in 42 Städten. Carillons sind die am lautesten und am weitesten klingenden Musikinstrumente. Bereits im vergangenen Jahr spielten den Angaben zufolge anlässlich der Weltklimakonferenz 2017 in Bonn 19 Carillons in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und den USA die "Klimaglocken"-Melodie.
Ihr Komponist Wüsthoff hat zahlreiche Orchester- und Chorwerke sowie Werbemelodien geschrieben. Unter anderem ist er seit mehr als 40 Jahren auch "Schöpfer der ZDF-heute-Musik", wie die Initiative "Klimaglocken" weiter mitteilte.
UN: Treibhausgas-Konzentration auf neuem Höchststand
Genf (epd). In der Atmosphäre befinden sich den UN zufolge so viele Treibhausgase wie noch nie zu Lebzeiten des Menschen. Messungen von Klimaforschern hätten für 2017 Rekordwerte von Kohlenstoffdioxid, Methan und anderen klimaverändernden Gasen gezeigt, erklärte der Generalsekretär der Weltwetterorganisation (WMO), Petteri Taalas, am 22. November in Genf. Er warnte, ohne eine schnelle Verringerung von Treibhausgasen werde der Klimawandel immer verheerendere und zunehmend unumkehrbare Auswirkungen auf das Leben auf der Erde haben. Die Chance, die Entwicklung noch zu stoppen, sei beinahe vertan.
Den Messungen der Wissenschaftler zufolge hat der Strahlungsantrieb, der die Aufheizung der Erde physikalisch beschreibt, seit 1990 um 41 Prozent zugenommen. Zu vier Fünfteln sei dafür Kohlenstoffdioxid verantwortlich, das vor allem durch die Verbrennung fossiler Stoffe wie Öl, Kohle und Gas entsteht. "Eine vergleichbare Konzentration von Kohlenstoffdioxid hat die Erde zum letzten Mal vor drei bis fünf Millionen Jahren erlebt", so Taalas. "Damals lag die globale Temperatur um zwei bis drei Grad über der heutigen und der Meeresspiegel war zehn bis zwanzig Meter höher als heute."
Ozon-Killer
Eine Umkehr des Trends, der extreme Wetterereignisse, den Anstieg der Meeresspiegel und die Versauerung der Ozeane zur Folge habe, ist Taalas zufolge nicht in Sicht. Die Konzentration von Kohlenstoffdioxid, die auf Millionen Teilchen bezogen angegeben wird, lag 2017 bei 405,5. 2016 hatte sie bei 403, 3, 2015 bei 400,1 gelegen. Die Klimaforscher warnten zudem vor der Zunahme des stark wirksamen Treibhausgases Trichlorfluormethan, das nicht nur das Klima aufheizt, sondern zusätzlich die filternde Ozonschicht zerstört. Das Industriegas wird trotz eines Verbots in China zur Herstellung von Isolierstoffen verwendet.
Studie: Warmes Grubenwasser als Wärmelieferant
Essen (epd). Warmes Grubenwasser könnte nach dem Ende der letzten Steinkohlebergwerke ein wichtiger Wärmelieferant werden. Allein aus den Gruben des Ruhrgebiets könnte mit Blick auf das Jahr 2035 das warme Wasser eine Wärmemenge von rund 1.300 Gigawattstunden jährlich für die zukünftige Wärmeversorgung in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) am 21. November in Essen mit. Die entspreche ungefähr dem Wärmebedarf von 75.000 Haushalten, lautet ein Ergebnis der Potenzialstudie "Warmes Grubenwasser".
Die Studie liefere einen Baustein zu einer möglichen Nachnutzung der unterirdischen Stollen und Gruben und zeige, wie vielfältig die Möglichkeiten im Wärmesektor sind, um CO2-Emissionen zu senken, erklärte Leonhard Thien, Geothermie-Experte der Energie-Agentur NRW. Möglich sei mit Hilfe des warmen Grubenwassers eine Einsparung von bis zu 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr.
Die Untersuchung verweist auf bereits realisierte Projekte der energetischen Nutzung warmen Grubenwassers. Dazu gehören in Bochum die Zeche Robert Müser oder in Bergheim der Tagebau Hambach. Dass die Nutzung von Grubenwasser auch wirtschaftlich funktionieren könne, zeigten die niederländischen Nachbarn in der Stadt Heerlen, hieß es.
Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer setzen Bäumen zu

epd-bild / Stefan Arend
Düsseldorf (epd). Dem Wald in Nordrhein-Westfalen geht es schlecht. "Der Zustand unserer Wälder ist sehr besorgniserregend", sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am 21. November in Düsseldorf bei der Vorstellung des Waldzustandsberichtes. "Die Lage in diesem Jahr ist besonders ernst." Das Zusammenwirken von Sturm "Friederike" im Januar, der extremen Trockenheit von Frühjahr bis Herbst und des anschließenden starken Befalls mit Borkenkäfern habe zu "erheblichen" Schäden geführt.
Dass 80 Prozent aller Bäume Schäden aufwiesen, sei der schlechteste Wert seit Beginn der Erhebungen 1984, sagte Heinen-Esser weiter. Die Folgen des Klimawandels seien ganz offenkundig auch in NRW angekommen.
Waldzustandsbericht: Schäden an 80 Prozent der Baumkronen
Für den Waldzustandsbericht werden jährlich 10.000 Bäume repräsentativ erfasst. Ein wesentliches Merkmal zur Beurteilung der Bäume sind für Experten die Blattverluste der Kronen. Demnach weisen in diesem Jahr 78 Prozent der erfassten Bäume schwache bis deutliche Kronenverlichtungen auf, im Vorjahr waren erst 70 Prozent betroffen.
Die NRW-Wälder, die zu zwei Drittel in Privatbesitz sind, bestehen zu 58 Prozent aus Laubbäumen, meist Buchen und Eichen. Der Rest ist Nadelwald - überwiegend schnell wachsende Fichten, die sich zur Holzverarbeitung besonders gut eignen. Besonders die Fichte hat dem Bericht zufolge in diesem Jahr besonders stark gelitten, weil ihr als Flachwurzler die Dürre sehr früh zusetzte. Aber auch Buchen und Eichen sind inzwischen je zur Hälfte geschädigt, litten unter Raupenfraß und warfen früh ihre Blätter ab. Kulturen mit jungen Bäumen seien wegen der Dürre "schlicht vertrocknet", sagte Lutz Falkenried vom Landesbetrieb Wald und Holz.
"Task Force Borkenkäfer"
Mit einer "Task Force Borkenkäfer" will das Land jetzt dafür sorgen, dass das Totholz möglichst schnell aus dem Wald abtransportiert wird. Damit will man eine weitere Massenvermehrung der Borkenkäfer im nächsten Jahr möglichst vermeiden.
Darüber hinaus soll der Wald mit neuen Strategien langfristig widerstandsfähiger gegen den Klimawandel werden. Das neue Waldbaukonzept für NRW will die Landesregierung in Kürze präsentieren. Neue Konzepte für die Waldbewirtschaftung sollen im Dezember auf einer Fachtagung in Düsseldorf vorgestellt werden. Um den Wald als Naturerbe zu erhalten und als Produktionsstätte für den nachwachsenden Rohstoff Holz zu nutzen, brauche es "stabile Waldökosysteme", sagte Heinen-Esser.
Nabu gegen Anbau fremdländischer Baumarten
Kritik an dem geplanten Waldbaukonzept kam vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Mit dem darin empfohlenen Anbau von Douglasien und Küstentannen stelle das Land die Weichen falsch, bemängelte der nordrhein-westfälische Nabu-Landesvorsitzende Josef Tumbrinck am 21. November in Düsseldorf. "Wer glaubt, dass man den Wald für den Klimawandel vorbereitet, indem man die Fichte durch andere Nadelhölzer aus Übersee ersetzt, sucht eine zu einfache Lösung für ein vielschichtiges Problem."
Das Waldbaukonzept berücksichtige einseitig die Profitinteressen der Forstwirtschaft, kritisierte Tumbrinck weiter. Die größte Widerstandsfähigkeit gegen Einflüsse von außen und die größte Fähigkeit zur Regeneration nach Schäden hätten vielmehr intakte Ökosysteme wie naturnahe Waldgesellschaften. Der Nabu forderte, den Anbau fremdländischer Baumarten in Naturschutzgebieten zu verbieten und im Wirtschaftswald zu reduzieren.
Urbane Wälder an Rhein und Ruhr sind "Waldgebiet des Jahres 2019"
Düsseldorf, Berlin (epd). Die städtischen Wälder am Rhein und an der Ruhr sind zum "Waldgebiet des Jahres 2019" gekürt worden. Die urbanen Wälder spielten in der Metropolregion eine überaus wichtige Rolle, erklärte der Bund Deutscher Forstleute (BDF) am 22. November in Berlin. Die 130.000 Hektar Wald bieten den Angaben nach einen Erholungsraum für die Menschen in der Region, was zu einer hohen emotionalen Bindung an den Wald führe.
Die städtischen Wälder seien kein in sich geschlossenes Waldgebiet, sondern ein Kulturraum mit häufig eher kleinflächigen, vielfältigen Wäldern. Zudem sei das Gebiet der wichtigste Rückzugsraum für den Naturschutz. Die Auszeichnung gelte deswegen auch besonders der Arbeit der Forstleute und der Waldeigentümer vor Ort, die mit ihrem Schutz und ihrer Pflege die vielfältige Nutzung des Waldgebietes ermöglichten, hieß es.
Die Auszeichnung "Waldgebiet des Jahres" erhalten den Angaben nach vorbildlich und in allen Bereichen nachhaltig bewirtschaftete Ökosysteme. Im Jahr 2019 wird er zum achten Mal vergeben. Zuvor waren der Wermsdorfer Wald (2018) und der Frankenwald (2017) ausgezeichnet worden.
Zahl der Wolfrudel in Deutschland steigt auf 73

epd-bild / Nabu/ S. Zibolsky
Bonn (epd). In Deutschland sind zum 30. April dieses Jahres 73 Wolfsrudel ermittelt worden. Das geht aus Erhebungen der Bundesländer hervor, die das Bundesamt für Naturschutz in Bonn und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf am 22. November vorgelegt haben. Demnach konzentrierte sich das Wolfsvorkommen auf das Gebiet von der sächsischen Lausitz über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen bis nach Niedersachsen. Zum ersten Mal seit der Ausrottung der Wölfe in Deutschland vor mehr als 150 Jahren wurde zudem ein Rudel in Bayern bestätigt. Die meisten Tiere lebten den Angaben zufolge in Brandenburg, gefolgt von Sachsen und Niedersachsen.
Damit stieg die Zahl der in den Bundesländern bestätigten Wolfsrudel im Vergleich zum November 2017 um 13. Zum Abschluss des Monitoringjahres Ende April lebten 213 erwachsene Wölfe in Deutschland. Zusätzlich legte die Zahl der Wolfspaare von 21 auf 30 zu. Außerdem wurden drei sesshafte Einzelwölfe bestätigt.
Der Wolf ist nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU streng geschützt. "Durch das Monitoring konnte allerdings nicht nur ein Anstieg der Rudel nachgewiesen werden, auch die Zahl der Totfunde hat zugenommen", sagte die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel. Nach Verkehrsunfällen sei die illegale Tötung der Tiere die zweithäufigste Todesursache.
Zugleich forderte Jessel von Bund und Ländern, Weidetierhalter bei Maßnahmen zum Schutz ihrer Tiere vor Wölfen zu unterstützen und fördern. "Insbesondere die extensive Beweidung leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer Kulturlandschaften und ihrer biologischen Vielfalt", betonte sie. In Gebieten mit Wolfsvorkommen wie auch in Wolfserwartungsgebieten seien "hinreichende Schutzmaßnahmen für Weidetiere unverzichtbar", betonte Jessel.
Zur Unterstützung der Weidetierhalter hat die Europäische Kommission Anfang November entschieden, dass Herdenschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Übergriffen durch Wölfe auf Weidetiere zu 100 Prozent durch die Mitgliedstaaten finanziert werden können. Bislang konnten nur 80 Prozent dieser Kosten durch die Länder erstattet werden. Künftig können sowohl Schäden erstattet werden, die infolge eines Wolfsrisses auftreten, als auch indirekte Schäden, die für tierärztliche Behandlungskosten entstehen.
Soziales
"Ich gebe ja nur meine Zeit"

epd-bild/Friedrich Stark
Gütersloh, Bielefeld (epd). Timon wartet schon, als es an der Tür klingelt. Der 12-Jährige lacht und hält Evelyn Tegeler die offene Hand zum Abklatschen hin. Alle zwei Wochen ist die Bielefelderin einen Nachmittag auf dem Bauernhof der Familie Hagenlüke in Gütersloh zu Gast. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hospiz e.V. Bethel begleitet sie den schwerkranken Jungen, seine Eltern, die beiden jüngeren Schwestern und den kleinen Bruder.
Im Rollstuhl fährt Timon an den Tisch in der großen Wohnküche, Evelyn Tegeler setzt sich dazu und beide beginnen zu puzzeln. "Das macht er stundenlang, am liebsten mit anderen", erzählt Stephanie Hagenlüke, Timons Mutter. Tegeler hat - anders als oft die Eltern, die Zeit dafür. Der Junge hat Spaß und allmählich entsteht aus 150 Teilen das Bild eines Treckers.
In solchen Momenten rückt Timons lebensverkürzende Erkrankung in den Hintergrund. Er leidet an einer seltenen Form der Leukodystrophie. Bei der durch einen Gendefekt oft im Kindesalter ausgelösten, unheilbaren Krankheit wird das zentrale Nervensystem geschädigt. Die Betroffenen verlieren nach und nach ihre bereits erlernten Fähigkeiten; viele dieser Kinder sterben früh. Bei Timon würden die Ärzte von einem "eher milden" Verlauf sprechen, doch eine Prognose könne keiner stellen, sagt Vater Jörg Hagenlüke.
Held ist "Spiderman"
"Als ich Timon vor bald zwei Jahren kennenlernte, konnte er noch mit Unterstützung laufen oder mit dem Kettcar fahren", berichtet die Hospizbegleiterin. Mittlerweile sitzt der Junge im Rollstuhl. Auch spricht er nicht mehr so artikuliert und sieht schlechter. Schon lange leidet Timon unter spastischen Krämpfen. Tegeler zeigt sich beeindruckt, wie "positiv und freundlich" er dennoch ist und "wie offen er auf Menschen zugeht". Timon guckt nach der Förderschule gerne den Kinderkanal, mag Comicfiguren - welche am liebsten? "Spiderman", ruft er laut.
Vor 25 Jahren begann der aus einer Initiative von Mitarbeitern der v. Bodelschwinghschen Stiftungen entstandene Hospiz e.V. Bethel mit der Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen in ihrem Zuhause. Inzwischen übernehmen 132 Freiwillige nach einer Ausbildung solche Dienste, gehen auch in Pflegeheime, stationäre Hospize und Kliniken. Sie haben Zeit, suchen das Gespräch oder schweigen. Sie erfüllen auch kleine Wünsche im Alltag und geben durch ihre Unterstützung den Angehörigen Freiräume. Bundesweit engagieren sich nach Schätzungen über 100.000 Ehrenamtliche in der ambulanten oder stationären Hospizarbeit, allein 9.400 in Nordrhein-Westfalen.
"Und so fröhlich?"
Evelyn Tegeler ist eine von zwölf ehrenamtlichen Familienbegleiterinnen des Ambulanten Kinderhospizdienstes, den der Hospizverein 2015 neu gegründet hat. Mit dieser Arbeit kam sie eher durch Zufall in Kontakt. Als sie in Berlin ein buntes Plakat für den "Tag der offenen Tür" in einem Kinderhospiz sah, wunderte sie sich: "Ein Hospiz - und so fröhlich?" Tegeler ging hin und stellte fest, dass dort mindestens so viel gelacht wie geweint wurde.
Sie ließ sich ausbilden und begleitete in Berlin fünf schwerkranke Kinder. Vier davon seien inzwischen gestorben, erzählt die 53-jährige Erziehungswissenschaftlerin: "Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, sich mit dem Tod auseinander zu setzen, um den Wert des Lebens zu schätzen." Im stationären Hospiz "Zuversicht" in Bethel hat Tegeler auch Erwachsene begleitet. Wenn Kinder sterben, sei dies besonders schwer auszuhalten, sagt die Hospizhelferin: "Ein Lebenszyklus kann sich nicht schließen. Wenn Menschen im hohen Alter sterben, wird das Leben oft rund."
Im Rolli zum Pferdestall
Auf dem Hof der Hagenlükes tobt auch an diesem Nachmittag das Leben. Die vier Geschwister wachsen miteinander auf, spielen, streiten und vertragen sich wieder - oft kommen weitere Kinder zu Besuch. Timon zieht es nach draußen und Evelyn Tegeler schiebt ihn im "Rolli" zum Pferdestall. Stute Bärbel und Pony Paula fressen ihm aus der Hand. Der 12-jährige mag Pferde, einmal in der Woche bringt seine Mutter ihn zum therapeutischen Reiten. Auch Logopädie steht auf dem Wochenprogramm, damit Timon noch möglichst lange kommunizieren kann. Irgendwann wird er durch die Krankheit gar nicht mehr sprechen und hören können.
Einen festen Ablauf haben die Besuche der Begleiterin bei der Familie nicht. "Ich bin da und gucke, was gerade anliegt", sagt Tegeler. Mal puzzelt sie mit Timon, mal backt sie mit den Kindern Waffeln, oft aber geht es mit der "Kinderbande" hinaus in die Umgebung samt Rollstuhl, Kettcar, Fahrrad oder Roller. Wichtig ist ihr, dass sie, wenn nötig, allen Kindern ihre Aufmerksamkeit widmet, Zwischendurch ist immer mal Zeit für Gespräche mit den Eltern, "über das, was uns gerade bewegt", sagt Jörg Hagenlüke.
Selbsthilfeverein
Die Familie hat gelernt, mit der schweren Erkrankung Timons zu leben, getragen auch durch den Selbsthilfeverein ELA, der zu Treffen betroffener Familien einlädt und die Forschung zu Leukodystrophie unterstützt. Als Stephanie Hagenlüke von dem stationären Kinder- und Jugendhospiz in Bethel erfuhr, dachte sie erst: "Hospiz - das klingt so sehr nach Ende." Inzwischen ist die Skepsis überwunden und die Hagenlükes fahren zwei-, dreimal im Jahr für eine Woche nach Bethel. Hier wird Timon im Kinderhospiz pflegerisch betreut, Eltern und Geschwister können entspannen.
Die ehrenamtlichen Begleiter des Hospizvereins tauschen sich regelmäßig über ihre Erfahrungen aus. Über eventuelle Belastungen könne sie auch mit ihrem Mann sprechen, sagt Tegeler. Doch sie empfindet sich selbst nach eigenen Worten eher als Beschenkte: "Ich gebe ja nur meine Zeit", erzählt sie. Oft fahre sie nach dem Dienst mit einem Gefühl der Dankbarkeit nach Hause: "Dass sich eine Familie mir so öffnet und mir ihre Kinder anvertraut, berührt mich sehr".
Gen-Tests: Mediziner fordern mehr Beratung für Schwangere
Düsseldorf (epd). Die rheinische Ärzteschaft pocht in der Diskussion um die ethisch umstrittenen Gen-Tests bei Schwangeren auf Angebote der psychosozialen Beratung. Werdende Eltern müssten informierte Entscheidungen für oder gegen die Bluttests auf Down-Syndrom beim ungeborenen Kind treffen können, forderten die rheinischen Ärzte bei ihrer Kammerversammlung in Düsseldorf. Das Vorhandensein früher und risikoarmer Pränataltests dürfe nicht zu einem gesellschaftlichen Erwartungsdruck führen, diese Tests nutzen zu müssen, heißt es in einer Resolution der Ärztekammer Nordrhein.
Anlass für die Erklärung ist die Diskussion um die Gen-Tests an Schwangeren, die über eine Blutuntersuchung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ob das ungeborene Kind das Down-Syndrom (Trisomie 21) hat. Anders als die Fruchtwasser- und Plazenta-Untersuchung, die mit einem Fehlgeburtrisiko verbunden sind, werden die quasi risikolosen Tests bislang nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen bezahlt. Zugelassen sind sie. Für die Kosten müssen die Schwangeren bislang selbst aufkommen. Der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen (G-BA) prüft derzeit, ob die Tests Kassenleistung werden sollen.
Die rheinischen Ärztinnen und Ärzte erklärten, der ethischen und psychosozialen Beratung in der Schwangerenvorsorge müsse ausreichend Raum gegeben werden. Sie plädieren für einen ausreichenden zeitlichen Abstand zwischen einer Beratung und einer möglichen Inanspruchnahme von Tests wie jenem auf Trisomie 21. Zudem betonten die Mediziner die Notwendigkeit für eine öffentliche Debatte, in die auch Menschen mit Behinderung einbezogen werden müssten. Der Bluttest auf Trisomie 21 stehe nur am Anfang einer Reihe von neuen Untersuchungsmethoden, hieß es.
Geld für Familien kommt bei Kindern an

epd-bild / Jens Schlüter
Gütersloh (epd). Die meisten Eltern in Deutschland geben das Kindergeld einer Studie zufolge tatsächlich für ihren Nachwuchs aus. Wie eine am 21. November in Gütersloh veröffentlichte Untersuchung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ergab, investierten Mütter und Väter das Geld vor allem in größere Wohnungen, aber auch in bessere Betreuung, Bildung und die Hobbys der Kinder. Das Vorurteil, dass staatliche Zahlungen für Alkohol, Tabak oder Unterhaltungselektronik "zweckentfremdet" werden, beruhe allein auf Einzelfällen, erklärte die Stiftung. Sozialverbände sehen sich durch die Studie in ihren Forderungen bestätigt.
Untersucht wurde die Verwendung des Kindergeldes und des in einigen Bundesländern gezahlten Landeserziehungsgeldes für den Zeitraum von 1984 bis 2016. Je 100 Euro Kindergeld steige die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind eine Kita besucht, um fünf Prozentpunkte, heißt es in der Studie. Die Zahlungen führten auch dazu, dass Kinder häufiger zum Sport (plus acht Prozentpunkte) oder zum Musikunterricht (plus elf Prozentpunkte bei Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren) gingen.
"Direkte finanzielle Leistungen für Familien sind sinnvoller als aufwendig zu beantragende Sachleistungen", sagte der Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Jörg Dräger. Bei zweckgebundenen Leistungen wie dem Bildungs- und Teilhabepaket legten jüngste Untersuchungen nahe, dass rund 30 Prozent der Mittel in den Verwaltungsaufwand flössen. Zudem beantragen viele Bedürftige die Mittel erst gar nicht.
Investitionen in Kitas und Schulen
Dräger forderte eine grundlegende Reform der Familienförderung, etwa durch ein Teilhabegeld, für das die Bertelsmann Stiftung und Wohlfahrtsverbände seit Jahren werben. Darin sollen bisherige Leistungen wie das Kindergeld, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets, der Kinderzuschlag für Geringverdiener und die Grundsicherung für Kinder gebündelt werden. Das Teilhabegeld solle mit steigendem Einkommen der Eltern sinken und so gezielt Kinder aus ärmeren Familien unterstützen, erläuterte Dräger. Unerlässlich seien darüber hinaus Investitionen in Kitas und Schulen sowie Beratungsangebote für Eltern, Kinder und Jugendliche.
Auch der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Holger Hofmann, betonte: "Es bleiben keine Ausreden mehr, um Kinder finanziell so abzusichern, dass sie unabhängig von dem Einkommen ihrer Eltern gut aufwachsen können." Neben der Einführung einer Kindergrundsicherung müsse das System der Familienförderung entbürokratisiert werden. Viele Menschen verzweifelten an der Undurchsichtigkeit des Systems und beantragten Leistungen nicht, die ihnen zustünden, beklagte Hofmann.
Chancengleichheit für Kinder
Die Diakonie Deutschland erklärte, die Studie zeige, dass nicht die Eltern das Problem seien, sondern die unzureichenden Instrumente zur Bekämpfung von Kinderarmut. "Die gerade beschlossene Erhöhung des Kindergeldes kommt bei Familien, die Hartz IV beziehen, und bei vielen Alleinerziehenden erst gar nicht an, denn es wird mit dem Arbeitslosengeld II und dem Unterhaltsvorschuss verrechnet", kritisierte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie.
Der Sozialverband VdK hält sowohl Geld- als auch Sachleistungen für wichtig, um Chancengleichheit für Kinder zu schaffen. So brauche es neben materiellen Mitteln auch ausreichende und kostenlose Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebote. Der Deutsche Familienverband sieht seine Erfahrungen durch die Studie bestätigt. Fälle, in denen Eltern staatliche Transfermittel für Alkohol oder Tabak ausgäben, seien die Ausnahme und nicht die Regel. Es sei falsch, arme Familien unter Generalverdacht zu stellen, sagte Verbandsvizepräsident René Lampe.
Wegen Mordes angeklagter Ex-Pfleger entschuldigt sich bei Angehörigen

epd-bild/Mohssen Assanimoghaddam/dpa-Pool
Oldenburg (epd). Der wegen 100 Morden vor dem Oldenburger Landgericht angeklagte Ex-Krankenpfleger Niels Högel hat sich zu Beginn des dritten Verhandlungstages bei den Angehörigen seiner Opfer entschuldigt. Wenn er die Fotos derjenigen sehe, die durch ihn ihr Leben verloren hätten, löse dies bei ihm heute Traurigkeit und Leid aus. "Ich kann nichts wieder gutmachen. Ich entschuldige mich in aller Form." Er beteuerte, dass er allen Angehörigen eine Antwort auf ihre Fragen geben wolle.
Högel soll zwischen 2000 und 2005 in Oldenburg und Delmenhorst 100 Patienten getötet haben. Laut Anklage hat er ihnen Medikamente verabreicht, die zum Herzstillstand führten, um sie anschließend wiederzubeleben und damit als Retter dazustehen.
Bis zum 22. November waren die Hälfte der Vorwürfe, also 50 Fälle, verhandelt worden. An 29 Fälle konnte sich Högel gut erinnern, bei vier davon sei er sich "absolut sicher", dass er die Patienten nicht an den Rand des Todes gebracht habe. An 21 weitere Fälle konnte oder wollte er sich nicht erinnern.
Allerdings unterstrich Högel, dass er in den übrigen Fällen nicht ausschließe, für den Tod der Menschen verantwortlich zu sein: "Wer sollte das sonst getan haben?", fragte er den Richter. Wegen sechs weiterer Taten verbüßt Högel bereits eine lebenslange Haftstrafe. (AZ: 5Ks 1/18) Im Laufe der Verhandlung zeichnete sich zudem ab, dass noch viel mehr Menschen vergiftet haben könnte: Auf die Frage nach dem Verhältnis von gelungenen und erfolglosen Reanimationen, sagte Högel: "Die Mehrheit war erfolgreich."
"Nacht der Reanimation"
Wenn sich Högel erinnerte, wurde er präzise. Mal um Mal erläuterte er dem Gericht die Krankheitsgeschichten, beschrieb die Wirkungsweise von Medikamenten und erklärte medizinisch-technische Geräte. Seine Vorgehensweise sei stets ähnlich gewesen: Erst habe er geschaut wo seine Kollegen sind, dann habe er den Überwachungsmonitor unterbrochen. Anschließend injizierte er den stets tief sedierten Patienten Ajmalin, Lidocain, Kaliumchlorid oder Sotalol - alles Wirkstoffe zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen - und verließ den Raum. 30 Sekunden später habe der Alarm der Überwachungsgeräte eingesetzt und er sei zur Reanimation geeilt.
Am 22. November stand zunächst ein Wochenende auf der herzchirurgischen Intensivstation der Oldenburger Klinik im Fokus. Nach Högels Erinnerungen gab es dort fünf oder sechs Reanimationen in einer Nacht. Bührmann sagte, im polizeilichen Vernehmungsprotokoll sei die Nacht vom 14. auf den 15. September 2001 "reißerisch" als "Nacht der Reanimation" bezeichnet worden. Zu drei dieser Todesfälle befragte ihn der Richter. Högel sagte, er erinnere sich, zwei Männern Ajmalin, verabreicht zu haben. An den dritten habe er keine Erinnerung.
Er erinnere sich vor allem an die Krankengeschichten seiner Opfer, dagegen kaum bis gar nicht an ihre Gesichter, sagte Högel. Er habe mehr auf die Überwachungsmonitore als auf die Menschen geachtet. "Für mich war die Technik wichtiger als der Mensch." Als zwei Anwälte dem Angeklagten Fotos von seinen mutmaßlichen Opfern vorlegen ließen, schüttelte der nur mit dem Kopf: "Nein - keine Erinnerung."
Bei der Befragung wurde auch deutlich, dass in Oldenburg Ärzte und Kollegen misstrauisch wurden. Ein Arzt habe bei ihm in einer Pause eine aufgezogene Spritze in der Kitteltasche entdeckt und einige Tropfen ihres Inhalts auf seiner Brille verrieben. "Wäre es Kalium gewesen, hätten sich weiße Rückstände gebildet", erläuterte Högel. Doch in diesem Fall habe es sich lediglich um eine Kochsalzlösung zum Spülen der Katheterschläuche gehandelt.
Fast 140.000 Menschen in Deutschland Opfer von Partnerschaftsgewalt

epd-bild/Steffen Schellhorn
Berlin (epd). Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will langfristig einen Rechtsanspruch auf Schutz für Opfer häuslicher Gewalt schaffen. Das sagte die SPD-Politikerin bei der Vorstellung der "Kriminalstatistischen Auswertung zu Partnerschaftsgewalt 2017" des Bundeskriminalamts am 20. November in Berlin. Sie räumte zugleich ein, dass da noch "dicke Bretter zu bohren" seien. Ingesamt sind im vergangenen Jahr laut Statistik 138.893 Menschen in Deutschland Opfer von Gewalt durch Partner oder Ex-Partner geworden.
"Häufiger als jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet", sagte Giffey. 147 Frauen kamen ihren Angaben nach ums Leben - 141 durch Mord oder Totschlag, sechs weitere bei Körperverletzung mit Todesfolge. "Diese Zahlen sind schockierend, denn sie zeigen: Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort - ein Ort, an dem Angst herrscht." Es gebe auch männliche Opfer, doch Frauen seien mit mehr als 82 Prozent in einem viel größeren Maße betroffen. 32 Männer seien 2017 Opfer von "vollendetem" Mord und Totschlag geworden.
Alle sozialen Schichten
Zu den erfassten Delikten gehören auch Körperverletzung, Vergewaltigung, Bedrohung und Stalking. Neu hinzugekommen seien sexuelle Nötigung, Zuhälterei, Zwangsheirat, Freiheitsberaubung. Im Vergleich zum Vorjahr ist den Angaben nach ein Rückgang von 0,8 Prozent zu verzeichnen, wenn man die nun zusätzlich erfassten Deliktkategorien auslässt. Von 2013 bis 2016 waren noch steigende Opferzahlen festgestellt worden. Laut Erhebung hat fast die Hälfte der Opfer in einem Haushalt mit den Tatverdächtigen gelebt. Am häufigsten sei die vorsätzliche einfache Körperverletzung (61 Prozent) gewesen, gefolgt von Bedrohung, Stalking und Nötigung (23,3 Prozent). Oftmals war auch Alkohol im Spiel.
Das Problem betreffe alle ethnischen Gruppen und alle sozialen Schichten, betonte Giffey. Von den 116.00 erfassten Tatverdächtigen seien knapp 68 Prozent deutsche Staatsangehörige. Besonders gewalttätig waren den Angaben nach aber Personen im Alter von 30 bis 39 Jahren. Die Gefahr von Gewalt sei außerdem dann größer, wenn schwierige soziale Verhältnisse hinzu kämen. Die Ministerin ging davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Betroffenen wesentlich höher ist, als in der Statistik erfasst.
Die Leiterin des Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen", Petra Söchting, stellte die neue Kampagne "Aber jetzt rede ich" vor, die Frauen ermutigen soll, sich bei Gewalt Hilfe zu holen. Obwohl jede dritte Frau statistisch mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt erfährt, suchen ihren Angaben nach nur 20 Prozent der Betroffenen Unterstützung. Das Hilfetelefon ist beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben angesiedelt. In fünf Jahren seit seiner Gründung seien mehr als 140.000 Menschen per Telefon, Chat oder E-Mail beraten worden.
Besserer Opferschutz
Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, die Hilfestrukturen für Frauen und Kinder zu verbessern, die von Gewalt betroffen sind. Auch ein bedarfsgerechter Ausbau sowie die finanzielle Absicherung der Arbeit von Frauenhäusern soll erreicht werden. Giffey sagte, dass ein Runder Tisch dazu von Bund, Ländern und Kommunen im September eingerichtet worden sei. Derzeit gebe es bundesweit 350 Frauenhäuser und 600 Fachberatungsstellen, die rund 30.000 Frauen und Kinder versorgen könnten. Der Bedarf sei aber wesentlich größer. Daher wolle der Bund im Jahr 2020 für die Umsetzung des Aktionsprogramms zur Prävention und Unterstützung von Gewalt betroffenen Frauen und Kindern 35 Millionen Euro aufwenden.
Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erklärte, um den Opferschutz im Strafverfahren zu verbessern, solle es auch bei erwachsenen Opfern von Sexualdelikten ermöglicht werden, eine Videoaufzeichnung der richterlichen Vernehmung in der Hauptverhandlung zu verwenden. "Dadurch werden künftig überflüssige mehrfache Vernehmungen vermieden. Wenn Opfer angstfrei über ihre furchtbaren Erlebnisse reden können, erleichtert das auch die Strafverfolgung."
Lichtaktion macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam
Mit öffentlichen Aktionen machen Frauen- und Menschenrechtsorganisationen in NRW auf das Thema "Gewalt gegen Frauen und Mädchen" aufmerksam. Am Wochenende gab es Lichtilluminationen in Köln, Bonn und dem Düsseldorfer Landtag.Bonn (epd). Mit mehreren Aktionen habeb Frauen- und Menschenrechtsorganisationen in NRW auf das Thema "Gewalt gegen Frauen und Mädchen" aufmerksam gemacht. Die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, UN Women, in Bonn starte ihre Kampagne "Orange the World" Zum Auftakt wurden in der Nacht zum 25. November die Gebäude der Vereinten Nationen, der Deutschen Welle und des Post-Towers orange angestrahlt. Auch der NRW-Landtag in Düsseldorf machte mit. Bis zum Tag der Menschrechte am 10. Dezember seien weitere Aktionen unter dem diesjährigen Motto #HearMeToo geplant, um den Stimmen von Frauen und Mädchen, die Gewalt erfahren haben, Gehör zu verschaffen, wie das Nationale Komitee Deutschland von UN Women mitteilte.
Null-Toleranz-Grenze
Gewalt gegen Frauen und Mädchen sei eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen weltweit, hieß es. Das deutsche Nationale Komitee von UN Women forderte keine Toleranz gegenüber jeder Form von Gewalt gegen Frauen. Bestehende Strafen und Sanktionen müssten konsequent und vollständig durchgesetzt werden. UN Women ist die 2010 gegründete Behörde der Vereinten Nationen, die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen einsetzt. UN Women Nationales Komitee Deutschland ist eines von weltweit 15 Nationalen Komitees, die auf Länderebene die Arbeit von UN Women unterstützen.
Auch die Menschenrechtsorganisation Medica Mondiale beteiligt sich an den Aktionen. "Akute Konflikt- und Nachkriegssituationen und Vertreibung verschärfen Gewalt innerhalb der Familie und führen oft zu neuen Formen von Gewalt gegenüber Frauen", sagte die Gründerin der Kölner Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale, Monika Hauser. Am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, wolle man "deutlich machen, dass Kriege nach wie vor auf den Körpern von Frauen und Mädchen ausgetragen werden".
Der Aktionstag am 25. November läutet die "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" ein, mit denen bis zum 10. Dezember Veranstaltungen stattfinden, die auf die Diskriminierung von Frauen und Mädchen hinweisen und Geschlechtergerechtigkeit fordern.
Frauen in NRW bekommen wieder weniger Kinder
Düsseldorf (epd). Nach Jahren des Anstiegs der Geburtenziffer werden in Nordrhein-Westfalen wieder weniger Kinder geboren. Nordrhein-westfälische Frauen, die im vergangenen Jahr 15 bis 49 Jahre alt waren, bringen statistisch gesehen im Laufe ihres Lebens 1,59 Kinder zur Welt, wie das statistische Landesamt am 20. November in Düsseldorf mitteilte. Damit sei die sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer zum ersten Mal seit 2011 wieder niedriger als ihr Vorjahreswert. Zuletzt war sie von 2015 auf 2016 von 1,52 auf 1,62 gestiegen - der höchste Wert seit 1972.
Bei relativ konstanter Bevölkerungsentwicklung wurden im vergangenen Jahr der Statistik zufolge in NRW insgesamt 171.984 Kinder geboren. Das waren 0,7 Prozent weniger als im Jahr 2016. Der Rückgang der Geburtenzahl sei vor allem auf den Rückgang der Geburtenziffer bei Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zurückzuführen, erklärten die Statistiker. Sie sank von 2,45 Kindern im Jahr 2016 auf 2,35 im vergangenen Jahr. Bei Frauen mit deutschem Pass ging die Geburtenziffer nur leicht um 0,1 auf durchschnittlich 1,44 zurück.
Frauen im Kreis Steinfurt bekamen statistisch gesehen mit 1,83 die meisten Kinder, und Frauen im benachbarten Münster mit 1,29 die wenigsten. Am stärksten sank die Geburtenziffer 2017 in Remscheid mit einem Minus von 0,18. Den größten Anstieg verzeichnete der Kreis Olpe mit einem Plus von 0,17.
Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt nach Angaben der Statistiker die durchschnittliche Kinderzahl an, die eine Frau im Laufe ihres Lebens zur Welt bringen würde, wenn ihr Geburtenverhalten dem aller Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren entspräche. Wie viele Kinder ein Frauenjahrgang im Durchschnitt tatsächlich geboren hat, ist erst bekannt, wenn die Frauen das Ende des gebärfähigen Alters erreicht haben, das statistisch bei 49 Jahren liegt. Im vergangenen Jahr erreichten Frauen des Jahrgangs 1968 dieses Alter. Sie bekamen nach Angaben des Landesamtes durchschnittlich 1,46 Kinder.
Wenn Tattoos vom Tod eines Angehörigen erzählen

epd-bild/Peter Endig
Dresden (epd). "Trauer ist immer da", sagt Gabi Schroth. Die 54-Jährige hat ihren Sohn verloren. Er war 19 Jahre alt und schwer krank. Etwa ein Jahr nach seinem Tod ließ sie sich 2011 ein Tattoo stechen. Seitdem trägt sie das Porträt ihres Sohnes auf dem Arm - sauber eingeritzt unter der Haut.
Schroth sagt von sich, sie sei zuvor kein Typ für Tattoos gewesen. Der Tod von Martin habe das verändert. In einer Selbsthilfe-Gruppe verwaister Eltern lernte die Leipzigerin Angehörige kennen, die bereits ein Tattoo trugen. Bei ihrer persönlichen Entscheidung habe sie sich dann auf ihr Bauchgefühl verlassen. "Durch den Tod dreht sich alles", sagt Schroth, "andere Sachen sind wichtig geworden."
Es sei "nicht ohne" und auch schmerzhaft, ein Tattoo stechen zu lassen, erinnert sie sich. Etwa viereinhalb Stunden seien bei ihr dafür nötig gewesen. Als Vorlage diente ein Foto aus dem letzten gemeinsamen Urlaub mit Martin. "Er lacht darauf so schön", sagt Schroth. Auf dem Kopf trägt er eine Baseballmütze. So kennt sie ihn. Es sind auch der Name des Verstorbenen und der seines Bruders Max eingeritzt. Max habe sie nach dem Verlust "am Leben gehalten", sagt sie.
Den Oberarm hat sie sich bewusst ausgesucht. "Ich wollte, dass ich das Bild sehen und dass ich es streicheln kann", sagt Schroth. Es sei immer bei ihr - wenn sie aufsteht, duscht, den ganzen Tag über. "Ich wollte, dass er nicht vergessen wird, dass er immer dabei ist."
"Haut als Gefühlslandschaft"
Sie hat die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sehr hilflos in der Begegnung mit Trauernden sind. "Meist gehen sie einem aus dem Weg", sagt Schroth. Das Tattoo sei dann ein "Opener" - es eröffnet das Gespräch.
Trauer-Tattoos stehen auch im Fokus der Ausstellung "Unsere Haut als Gefühlslandschaft", die seit drei Jahren in Deutschland unterwegs ist. An mehr als 35 Orten war sie bisher zu Gast. Derzeit macht sie in der Dresdner Dreikönigskirche Station. Kuratorin Katrin Hartig hat für die kleine Schau gut 20 Porträts zusammengetragen. Auf ihren Aufruf mit der Frage, wer sich ein Tattoo nach dem Verlust eines geliebten Menschen habe stechen lassen hat, meldeten sich rund 200 Trauernde zwischen 16 und 70 Jahren.
Auf das Thema Tattoos ist die Fernsehjournalistin aus Magdeburg bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Trauerbegleiterin gestoßen. Für die Ausstellung habe sie aber keineswegs etwa das schönste Tattoo suchen wollen. "Es ist eine Ausstellung über Trauer, nicht über Tattoos", sagt Hartig. Sie selbst hat ihren 13-jährigen Sohn bei einem Sportunfall verloren.
Ein Tattoo stechen zu lassen sei weder Bewältigung der Trauer, noch eine Therapie, eher eine Art, seine Trauer auszudrücken, sagt Hartig. Am Ende sei es "ein bildlicher Ausdruck für einen Prozess, der schmerzt - ein Bild für die seelische Narbe".
"Die schlechten Tage kommen"
Der Neuropsychologe Erich Kasten (Travemünde) erläutert: "Es scheint für viele Trauernde der Versuch zu sein, dem starken Gefühl von Schmerz in der Trauer ein physisches Erleben als Entsprechung entgegenzustellen." Sich selbst Schmerz zuzufügen, um damit über den Verlust eines geliebten Menschen hinwegzukommen, sei ein traditionelles Verhalten. Das sei unter anderem aus afrikanischen Kulturen bekannt.
Obwohl das Tattoo die äußere Haut verändere, repräsentiere es ein Stück weit das innere Selbst einer Person. "Tattoos sind eine Art nonverbale Kommunikation", sagt er. Kasten zufolge trägt heute jeder vierte Bundesbürger ein Tattoo.
"Trauer verändert sich, Schmerz auch", sagt Gabi Schroth. Sie habe gelernt, mit dem Verlust umzugehen. Doch "die schlechten Tage kommen", da mache sie sich nichts vor: "Es gibt Situationen, da zieht es einem den Boden unter den Füßen weg." Dann seien selbst kleine Gesten der Unterstützung wichtig, etwa eine Einladung zum Kaffee, ein Gespräch.
Schroth wünscht sich, dass anders mit Trauernden umgegangen werde - offener, gesprächsbereiter, auch empathischer. Seit sie das Tattoo ihres Sohnes trägt, wird sie immer wieder mal angesprochen und gefragt, wer das auf ihrer Haut sei. Sie entscheidet dann, was und wie viel sie preisgibt. Aber meist erzählt sie von Martin. Das tut ihr gut.
Freunde fürs Leben

epd-bild / Norbert Neetz
Frankfurt a.M. (epd). Sie sind alle über 60, wollen nicht mehr alleine sein und gründen eine WG. Doch dann erleidet Uschi, 64, einen Schlaganfall, und die übrigen WG-Mitglieder sind gefordert. Was in dem Fernsehfilm "Alleine war gestern" (2015) mit Komik und einer gewissen Tragik dargestellt wird, ist gar nicht mal so unrealistisch. In der mobilen Gesellschaft, in der Familienstrukturen schwächer werden, sagt der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger, "wird es immer wichtiger, dass sich Freunde im Alter gegenseitig helfen und unterstützen."
Gerade im Alter aber sind echte Freunde mitunter rar. Die meisten engen Vertrauten gewinnt man in der Jugend: in der Schule, bei Studium oder Ausbildung. Dann, wenn die Menschen noch nicht gebunden sind, Kontakte und Abwechslung suchen. "Ab dem 23. Lebensjahr sinkt dann die Zahl der Freunde", erläutert Krüger. Er geht davon aus, "dass wir jedes Jahrzehnt einen Freund verlieren und erst mal keinen neuen dazu gewinnen."
Old Shatterhand und Winnetou
Beruf, Partnerschaft und möglicherweise Kinder - oft bleibt in der mittleren Lebensphase wenig Zeit, Freundschaften zu pflegen. Eine große Rolle spielen die Freunde hingegen für Menschen ohne festen Lebenspartner, wie der Kasseler Soziologe Janosch Schobin sagt. Er schätzt, dass bei zehn Prozent der 18- bis 55-jährigen in Deutschland die Freunde im Zentrum ihrer sozialen Kontakte stünden.
Aber was ist überhaupt ein echter Freund oder eine echte Freundin? Berühmte Freundschaftspaare gibt es zuhauf: Ernie und Bert, Asterix und Obelix, Thelma und Louise, Old Shatterhand und Winnetou. Das letzte Beispiel nimmt Schobin gerne auf. Echte Freunde vergleicht er mit "Blutsbrüdern". Das symbolische Ritual, Blut zu tauschen, stehe stellvertretend für ein enges soziales Band - eine "Art Lebenspfand".
In der modernen Gesellschaft zeichneten sich echte Freunde durch "Geheimniskommunikation" aus, wie er es nennt: "Enge Freunde wissen sehr private Dinge voneinander." Solche Vertrauten helfen sich dann auch gegenseitig: Sie sind bei Krisen, Problemen und auch Krankheiten füreinander da.
Männer mit Nachholbedarf
"Deshalb müssen wir diese Freundschaften pflegen", betont Therapeut Wolfgang Krüger. Er wirbt dafür, sich pro Woche einige Stunden Zeit für Freunde zu nehmen - so wie man feste Termine fürs Fitnessstudio einhält. Nur dann ließen sich solche verlässlichen und engen Beziehungen erhalten und weiter ausbauen. "Herzensfreundschaften" nennt er sie. Wer enge Freunde hat, das zeigen zahlreiche Studien, der ist weniger depressiv, gesünder und besser gegen Krankheiten gefeit.
Doch vielen Menschen mangelt es an solchen Beziehungen. Das stellt die Frankfurter Therapeutin Heike Kaiser-Kehl, die als Psychologin online berät, immer wieder in ihrer beruflichen Praxis fest. Gerade Menschen aus der Generation Ü-50 klagten oft über eine schwierige Lebensphase und über Einsamkeit, sagt sie. Notwendig sei es daher, frühzeitig wieder neue Netzwerke aufzubauen.
Zwischen Frauen und Männern sieht sie dabei zunächst keine großen Unterschiede. Allerdings seien Frauen meist offener, wenn es darum gehe, über intime Dinge zu sprechen. "Männer haben da sicher noch etwas Nachholbedarf", so Kaiser-Kehl.
Es ist allerdings keine leichte Aufgabe, im fortgeschrittenen Alter neue Freunde kennenzulernen. Nach einer US-Studie der Universität Kansas dauert es mehr als 50 Stunden gemeinsam verbrachte Stunden, bis aus einem Bekannten ein Freund wird. Und um einen engen Freund zu gewinnen, muss man mindestens 200 Stunden investieren. Die US-Forscher hatten Menschen befragt, die umgezogen waren und sich an einem neuen Wohnort wieder orientieren mussten.
Psychotherapeut Krüger berichtet von privaten Initiativen und Nachbarschaftshilfen: Es schließen sich Freundschaftsgruppen zusammen, deren Mitglieder sich gegenseitig unterstützen und helfen. Eine Idee sei dabei, dass sich sieben Menschen täglich abwechseln, um eine pflegebedürftige Person zu unterstützen.
Staffelpflege
"Solche Netzwerke können eine frühe Pflege auch verhindern", sagt Krüger. Es sei erweisen, dass Menschen, die im Alter noch viele Kontakte hätten und mit Freunden und Bekannten unterwegs seien, gesünder lebten und nicht so leicht dement würden.
Der Kasseler Soziologe Schobin kann sich angesichts der alternden Gesellschaft eine "Staffelpflege" vorstellen: Menschen aus mehreren Generationen leben zusammen, dort unterstützen die Jüngeren die jeweils Älteren. Für solche gegenseitige Hilfe ist immer eine soziale Nähe und Sympathie zwischen den Freunden notwendig.
Auch der Fernsehfilm "Alleine war gestern" zeigt, dass die Hilfe von Freunden im Pflegefall nicht leicht ist: Die WG-Mitglieder pflegen Uschi nach ihrem Schlaganfall, scheitern aber zunächst an dieser Aufgabe. Die 64-Jährige geht freiwillig ins Altenheim. Dort holen die Freunde sie schließlich wieder heraus - und starten einen neuen Versuch der gegenseitigen freundschaftlichen Hilfe im Alter.
Saar-Beschäftigungspakt für Langzeitarbeitslose gestartet
Saar-Arbeitsministerin Rehlinger sieht im Teilhabenchancengesetz des Bundes einen Paradigmenwechsel für Langzeitarbeitslose. Gemeinsam mit rund 30 Organisationen hat sie nun einen Pakt für mehr Teilhabe gestartet.Saarbrücken (epd). Das Saarland will mit einem Beschäftigungspakt Langzeitarbeitlose unterstützen. Es gehe darum, jedem die bestmöglichen Entwicklungschancen zu bieten, sagte Arbeitsministerin Anke Rehlinger (SPD) am 22. November bei der Unterzeichnung des Pakts in Saarbrücken. Grundlage ist das Teilhabenchancengesetz des Bundes, welches nach bisheriger Planung zum 1. Januar 2019 in Kraft treten soll. Insgesamt rund 30 Organisationen beteiligen sich an dem Memorandum. Darunter etwa auch die Regionaldirektion der Arbeitsagentur, der DGB und die Kirchen. Letztere kritisierten allerdings auch die Bundespolitik.
Paradigmenwechsel
"Ein Mehr wäre immer besser gewesen, wie auch immer ein Früher besser ist", sagte Rehlinger. Das sei aber nicht die Bewertungsgrundlage. Es gehe darum, mit Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte, nun Erfolge zu erreichen. "Insgesamt kann man feststellen, dass wir einen Paradigmenwechsel erreicht haben", erklärte die SPD-Politikerin. So bestehe nun die Chance zu beweisen, dass der sogenannte Passiv-Aktiv-Transfer zur Finanzierung eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes ein gutes Instrument sei.
Trotz positiver Entwicklungen am Arbeitsmarkt gebe es zurzeit im Saarland rund 10.400 Langzeitarbeitslose, betonte Rehlinger. Sie machten 34 Prozent aller Arbeitslosen aus. Bundesweit sind es dem Bundesarbeitsministerium zufolge 800.000 Menschen. Der Pakt sei der Beginn eines Prozesses, sagte die SPD-Politikerin. Als nächstes stehe die Erarbeitung einer konkreten Kooperationsvereinbarung an. "Wir sollten an der Stelle dringend an den Erfolg glauben", sagte sie.
Die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Leonie Gebers (SPD), erläuterte, dass es mit dem geplanten Gesetz um die Förderung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit gehe. Menschen, die über 25 Jahre alt seien und sechs Jahre Leistungen bezögen, sollten mit Lohnkostenzuschüssen gefördert werden. Bei Erwerbslosen mit Schwerbehinderung oder mit mindestens einem minderjährigen Kind reichten fünf Jahre Leistungsbezug aus.
"Ebenfalls neu ist, dass wir mit diesem Förderinstrument bei allen Arten von Arbeitgebern und für alle Tätigkeiten fördern können", sagte Gebers. Der Lohnkostenzuschuss orientiere sich am tatsächlich gezahlten Lohn und somit auch am tariflichen Arbeitsentgelt. Der einzige Wermutstropfen sei die befristete Erprobung. Eintritte seien bis zum 31. Dezember 2024 möglich, dementsprechend werde mindestens bis zum 31. Dezember 2029 gefördert.
Der stellvertretende DGB-Vorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Eugen Roth, lobte das Teilhabenchancengesetz als politischen Durchbruch. Zudem warnte der SPD-Landtagsabgeordnete davor, defizitorientiert über die Möglichkeiten zu sprechen. Es gehe jetzt darum, das Beste aus dem zu machen, was nun zur Verfügung sehe und dann zu schauen, was noch gebraucht werde.
Kirchen und Gewerkschaft begrüßen Vereinbarung
Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, begrüßte den Pakt. "Die Anzahl der Menschen, die langzeitarbeitslos sind, ist immer noch unverhältnismäßig hoch", sagte das geistliche Oberhaupt der zweitgrößten Landeskirche in Düsseldorf. Deswegen seien kreative Lösungen nötig.
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen im Saarland, Kirchenrat Frank-Matthias Hofmann, betonte bei der Paktunterzeichnung, dass die Kirchen seit Jahren die Langzeitarbeitslosigkeit beklagten. Er kritisierte, dass in früheren Jahren Maßnahmen für Langzeitarbeitslose oft nur für einen kurzen Zeitraum möglich waren und zu früh beendet wurden. "Dass sich das jetzt ändert, das ist spät, aber nicht zu spät, dafür bin ich dankbar", sagte er. Denn die Unterstützung von Langzeitarbeitlosen brauche Zeit und Energie. "Ein Leitbild einer Gesellschaft, die auf soziale Teilhabe setzt, muss sich am Schwächsten orientieren", unterstrich der Theologe.
Dem stimmte der bischöfliche Beauftragte für die Aktion Arbeit im Bistum Trier, Domvikar Hans Günther Ullrich, zu. Es sei gut, dass der Passiv-Aktiv-Transfer endlich möglich werde. Ziel der sozialen Marktwirtschaft müsse es sein, dass alle Erwerbsfähigen in den Arbeitsmarkt eintreten und darin partizipieren könnten.
Allerdings äußerte er auch Kritik am Teilhabenchancengesetz. Die Zielgruppe sei "sehr sehr eng gefasst" und betreffe nur einen kleinen Teil der Langzeitarbeitlosen. Zudem sorge die Befristung dafür, dass dies nur ein Regelinstrument in spe sei. "Wir wollen hoffen, dass es nicht dabei bleibt, denn sonst wäre es nur eine befristete Maßnahme im Gewand eines Gesetzes", sagte Ullrich.
Regine-Hildebrandt-Preis für Projekte gegen Armut ausgeschrieben
Bielefeld (epd). Die Bielefelder Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut zeichnet 2019 wieder vorbildliche Projekte mit den Regine-Hildebrandt-Preis aus. Nachahmenswerte Initiativen oder engagierte Persönlichkeiten können sich bis zum 31. Januar bewerben oder vorgeschlagen werden, wie die Stiftung am 19. November ankündigte. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird im Frühjahr vergeben. Das Preisgeld kommt gemeinnützigen Projekten zugute, die von den Preisträgern ausgewählt werden.
Der Regine-Hildebrandt-Preis wird seit 1997 vergeben. Die Stiftung Solidarität zeichnet damit Initiativen oder Personen aus, die sich für Hilfen gegen Arbeitslosigkeit und Armut engagieren. Die Auszeichnung erinnert an die erste Preisträgerin und spätere Schirmherrin der Stiftung, die SPD-Politikerin Regine Hildebrandt (1941-2001). Hildebrandt war 1990 in der ersten frei gewählten Regierung der DDR Ministerin für Arbeit und Soziales, anschließend war sie neun Jahre Ministerin des Landes Brandenburg für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Preisträger im vergangenen Jahr waren die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali sowie das Berliner Integrationsprojekt "Über den Tellerrand".
34 Projekte gegen Kinderarmut in NRW
Düsseldorf, Essen (epd). Das Land Nordrhein-Westfalen fördert 34 Projekte gegen Kinderarmut mit rund acht Millionen Euro. Bis 2020 erhielten Initiativen in Städten wie Arnsberg, Bielefeld, Duisburg, Siegen und Wuppertal diese Unterstützung, teilte das Sozialministerium mit, das am 19. November in Essen die ersten Förderbescheide aushändigte. Das Programm "Zusammen im Quartier - Kinder stärken - Zukunft richten" wolle "Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien fördern, die in Quartieren leben, in denen aktuell die Armut groß und die Perspektiven schlecht sind", erklärte Staatssekretär Edmund Heller (CDU).
Allein in Essen erhielten fünf Projekte bis 2020 jährlich 1,15 Millionen Euro, hieß es. Die Essener Initiativen bieten den Angaben nach unter anderem Schwangerenberatung und Angebote für die Gesundheit von Kleinkindern, Begleitung beim Übergang von dem Kindergarten in die Schule und Unterstützung bei Lernschwächen. Weitere geförderte Initiativen sind in Bocholt, Borken, Dinslaken, Dortmund, Eschweiler, Herten, Köln, Lünen, Niederkassel und Witten. Zusätzliche Projekte seien noch im Antragsverfahren.
Leichter Rückgang bei HIV-Infektionen
Berlin (epd). Rund 2.700 Menschen in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr mit HIV infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen ist damit gegenüber 2016 (2.900 Neuinfektionen) leicht gesunken, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am 22. November anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember in Berlin mitteilte. Danach ging bei Männern, die Sex mit Männern haben, die Zahl der geschätzten Neuinfektionen deutlich zurück: von 2.300 im Jahr 2013 auf 1.700 im vergangenen Jahr.
Trotz der Fortschritte erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der Kampf gegen HIV und Aids sei "noch lange nicht vorbei". Um die Zahl der Neuinfektionen weiter zu senken, habe die Bundesregierung den Verkauf von HIV-Selbsttests freigegeben.
Das Robert Koch-Institut schätzt die Zahl der Menschen in Deutschland, die nicht wissen, dass sie HIV-infiziert sind, auf 11.400. Freiwillige Selbsttests und niedrigschwellige Testangebote, auch für Menschen ohne Krankenversicherung, seien daher wichtig, damit Menschen mit HIV-Infektion behandelt werden könnten, sagte RKI-Präsident Lothar H. Wieler.
86.000 HIV-Infizierte
Insgesamt lebten Ende 2017 geschätzt 86.100 Menschen mit HIV in Deutschland. Die größte Betroffenengruppe sind den Angaben zufolge nach wie vor Männer, die Sex mit Männern haben (53.000 HIV-Infizierte). Außerdem seien etwa 11.000 heterosexuelle Männer und Frauen sowie 8.100 intravenös spritzende Drogenkonsumenten betroffen.
Die Deutsche Aids-Hilfe führt den Rückgang der HIV-Neuinfektionen auf eine Kombination aus konsequenter HIV-Prävention und medizinischen Fortschritten zurück. Die Möglichkeiten, noch mehr Menschen eine HIV-Infektion ersparen, seien so gut wie nie.
Umfrage: Neun von zehn Menschen in NRW fühlen sich gesund
Düsseldorf (epd). Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen fühlt sich einer Studie zufolge gesund. Jeder dritte beziehungsweise jeder zweite Einwohner fühlt sich sehr gut (33 Prozent) oder gut (54 Prozent), wie aus einer am 20. November in Düsseldorf vorgestellten repräsentativen Umfrage der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervorgeht. Das Forsa-Institut befragte dafür 1.000 Männer und Frauen in NRW.
67 Prozent der Befragten hätten am meisten Angst vor einem bösartigen Tumor, hieß es. Auf Platz zwei folgt die Angst vor Alzheimer und Demenz (50 Prozent). Große Sorgen bereitete den Befragten auch, einen Schlaganfall (48 Prozent) oder Unfall mit Verletzungen zu haben (41 Prozent). Dagegen war die Angst vor Diabetes (14 Prozent) und sexuell übertragbaren Krankheiten wie Aids eher gering (elf Prozent). "Es ist bezeichnend, dass die Furcht vor den Erkrankungen am größten ist, gegen die es keine vollständige und vorbeugende Behandlung gibt", sagte Klaus Overdiek, Leiter der DAK-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen.
Je nach Alter haben die nordrhein-westfälischen Bürger laut Studie unterschiedliche Ängste: Fast drei Viertel der unter 30-Jährigen haben demnach Angst, an Krebs zu erkranken (74 Prozent). Mit steigendem Alter nehme diese Furcht ab, aber die vor einer Alzheimer- oder Demenzerkrankung zu: Ab 60 Jahren hätten 59 Prozent der Befragten Angst davor, hieß es. Bei den 14- bis 29-Jährigen seien es nur vier von zehn Befragten.
Mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, regelmäßig Sport zu treiben, um Krankheiten vorzubeugen. Jeweils 69 Prozent trinken nach eigener Aussage wenig Alkohol und achten auf eine gesunde Ernährung.
Bethel erreicht Etappenziel für Kinderzentrum-Neubau
Bielefeld (epd). Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel haben für ihr geplantes Kinderzentrum in Bielefeld bereits die Hälfte der benötigten Spendengelder gesammelt. Das Spendenbarometer für den Neubau hat jetzt die Höhe von 17,5 Millionen Euro erreicht, wie die Stiftungen am 22. November mitteilten. Bethel-Chef Pastor Ulrich Pohl dankte den Unterstützerinnen und Unterstützern aus ganz Deutschland: "Wir sind auf einem guten Weg, gemeinsam werden wir das Ziel erreichen." Für das nach eigenen Angaben größte Spendenprojekt in der Geschichte der v. Bodelschwinghschen Stiftungen werden insgesamt 35 Millionen Euro benötigt.
Ab dem Jahr 2019 soll ein neues Kinderzentrum in Bielefeld-Bethel entstehen. Mit 146 Betten wird es zu den großen der Bundesrepublik gehören, wie es hieß. Von der Modernisierung versprechen sich die Stiftungen mehr Raum, um Diagnostik und Behandlung unter einem Dach zu bündeln und Familien stärker einzubeziehen. Außerdem soll das Leistungsspektrum um eine Kinder- und Jugendpsychiatrie ergänzt werden. Der Neubau soll 2022 fertig sein. Die Kosten betragen demnach voraussichtlich 70 Millionen Euro. Die Hälfte der Summe soll aus Spendenmitteln aufgebracht werden. In der bisherigen Kinderklinik Bethel werden jährlich rund 40.000 Kinder und Jugendliche behandelt.
Meteorologe Sven Plöger: "Man muss auch sterben dürfen"
Frankfurt a.M. (epd). Der Meteorologe Sven Plöger fürchtet sich nicht vor dem Tod. "Er gehört dazu, irgendwann ist dein Leben zu Ende", sagte der 51-Jährige dem evangelischen Magazin "chrismon". "Zellteilung geht eben nicht immer weiter." Angst habe er eher davor, "dass dieser Tod vielleicht viel zu früh kommt, dass ich eine Krankheit erleide, die mich ans Bett fesselt oder durch die ich im Wachkoma liege und alles mitbekomme".
Deswegen müsse geklärt sein, dass ein Mensch seines Vertrauens im schlimmsten Fall die Geräte abschalten lassen dürfe, sagte der Wettermoderator und Autor in einer "chrismon"-Sonderausgabe zur 60. Spendenaktion des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt": "Man muss auch sterben dürfen." Wenn in seinem Umfeld jemand einen Unfall habe oder eine schwere Krankheit bekomme, "sagen meine Frau und ich uns immer: Lass uns die wichtigen Dinge nicht verschieben!", sagte Plöger, der sich seit 2010 für "Brot für die Welt" engagiert.
"chrismon spezial" zu "Brot für die Welt"
Das 32-seitige "chrismon spezial" zu "Brot für die Welt" liegt ab dem 27. November in einer Auflage von 6,7 Millionen Exemplaren bundesweit mehr als 80 Tages- und Sonntagszeitungen bei. Weitere Exemplare werden in Kirchengemeinden verteilt. Das Heft erscheint in fünf Regionalausgaben. Die 60. Spendenaktion von "Brot für die Welt" wird am ersten Advent (2. Dezember) in Stuttgart eröffnet.
Mit seinen regulären Ausgaben liegt "chrismon" monatlich in einer Auflage von 1,6 Millionen Exemplaren großen deutschen Tages- und Wochenzeitungen bei. Verlegt wird "chrismon" vom Hansischen Druck- und Verlagshaus (HDV), einer 100-prozentigen Tochter des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP). Die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), die Rundfunkarbeit der EKD und das Onlineportal "evangelisch.de".
Medien & Kultur
Berliner East Side Gallery gerettet

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Die Zukunft der Berliner East Side Gallery ist gesichert. Weitere Bauprojekte an der weltweit längsten Open-Air-Galerie auf dem früheren Grenzstreifen zwischen Ost- und West-Berlin "schließen wir hundertprozentig aus", sagte der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, am 21. November. Das mit 1,3 Kilometer längste noch erhaltene Teilstück der Berliner Mauer zwischen den Stadtteilen Friedrichshain und Kreuzberg gehört seit November zu der Stiftung, die dazugehörigen Grundstücke wurden an die Stiftung übertragen. Die East Side Gallery selbst steht unter Denkmalschutz.
Für das Gelände am Ufer der Spree gebe es keinen Bebauungsplan und keine Bauvoranfragen mehr, sicherte Klausmeier zu. In den vergangenen Jahren waren wiederholt Teilstücke der 1990 von 118 Künstlern aus aller Welt bemalten Mauer aufgrund von Bauprojekten entfernt worden. Dies hatte zu massiven Protesten geführt, die allerdings vergeblich blieben. Unter anderem wurde ein Wohnturm mit Luxusappartements errichtet.
Ausstellung über die Historie des Ortes
Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sprach am Mittwoch von einem "Tag der Freude". Jahrelang habe die Zuständigkeit für die East Side Gallery in der Luft gehangen, jetzt sei mit der Übertragung an die Stiftung Berliner Mauer "genau die richtige Lösung gefunden worden", sagte Lederer. Für den Erhalt des Denkmals, die Pflege des Areals und die Vermittlung des Ortes stellt Berlin jährlich 250.000 Euro zur Verfügung.
Stiftungsdirektor Klausmeier kündigte an, das Areal zu einer Gedenk-, Bildungs- und Kunststätte auszubauen. Mit drei Millionen Besuchern pro Jahr sei die East Side Gallery eine der Hauptattraktionen von Berlin, ohne dass es bislang eine entsprechende touristische Infrastruktur gebe. Das werde sich ändern, sagte Klausmeier. Geplant sei unter anderem eine Ausstellung über die Historie des Ortes. Zudem wird im Frühjahr ein temporärer Servicepoint für Besucher eingerichtet und Besucher werden befragt. Bereits jetzt bietet die Stiftungen Führungen über das Areal an.
"Hinter uns liegt ein langer Kampf"
Ziel sei es, den Doppelcharakter dieses einzigartigen historischen Ortes zu veranschaulichen, sagte Klausmeier: "Einerseits als künstlerisches Zeugnis und Symbol der Freude über die friedliche Überwindung der deutschen Teilung und andererseits als Zeugnis des unmenschlichen Grenzregimes." So seien an diesem Teilstück der Berliner Mauer zwischen 1961 und 1989 mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.
Derzeit sei man zunächst dabei, den "Ort zu verstehen und in den Griff zu bekommen", sagte der Stiftungsdirektor. So wurden die Grundstücke neu vermessen und alle Mauersegmente plus zugehörige Bilder katalogisiert. Von dem bislang für das Areal zuständigen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg wurden laut Klausmeier etwa vier Meter Akten übergeben, die aufgearbeitet werden. Zudem soll es halbjährlich einen Runden Tisch mit Vertretern der Künstler, des Bezirkes, des Senats, Anrainern und anderen geben. Finanziert wird das Ganze aus Mitteln der früheren Parteien- und Massenorganisationen der ehemaligen DDR.
"Hinter uns liegt ein langer Kampf", sagte der Vorsitzende der Künstlerinitiative East Side Gallery, Kani Alavi. "Ohne diese Bilder würde es dieses Teilstück der Mauer nicht mehr geben." Er hoffe deshalb sehr, dass die permanente Existenzbedrohung der East Side Gallery nun der Vergangenheit angehöre.
Die Geschichte der Rückseite bekannter Bilder

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Pablo Picassos Bild "Gitarre und Zeitung" (1916) ist im Museum Berggruen seit dem 21. November auch von hinten zu sehen. Es ist die Perspektive der Wissenschaft: Drei Etiketten und zwei handschriftliche Verweise auf der Rückseite halfen Provenienzforschern, zu ermitteln, welchen Weg das Bild nahm, bis es 1971 beim Kunsthändler und Sammler Heinz Berggruen landete. "Jedes Werk erzählt auch die Geschichte seiner Eigentümer. An Provenienzketten lassen sich historische Ereignisse ablesen", sagt Sven Haase, Kurator der Ausstellung "Biografien der Bilder", die bis zum 19. Mai zu sehen ist und die Herkunft aller Exponate auflistet.
Mit "Biografien der Bilder. Provenienzen im Museum Berggruen. Picasso - Klee - Braque - Matisse" wird ein Forschungsprojekt in eine Ausstellung überführt. Von 2015 bis 2018 untersuchten Experten 135 Werke aus der früheren Privatsammlung Berggruens, die vor 1945 entstanden und sich heute im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befinden, auf mögliche NS-Raubkunst. Es handelt sich um Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen von Pablo Picasso, Paul Klee, Henri Matisse, Georges Braque und Henri Laurens.
"Visuell hochattraktiv"
Wichtiges Ergebnis des Projektes: Ein eindeutig NS-verfolgungsbedingter Entzug eines Kunstwerkes, das nicht bereits Bestandteil eines abgeschlossenen Restitutionsverfahrens war, konnte nicht ermittelt werden, wie der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, am 20. November sagte. Bis zum Projektende konnte bei rund zwei Dritteln (83 Werke) ein NS-verfolgungsbedingter Verlust ausgeschlossen oder als höchst unwahrscheinlich eingestuft werden. Knapp ein Drittel (48) haben Provenienzlücken, doch nur bei vier Werken könnte tatsächlich ein verfolgungsbedingter Verlust vorliegen.
Der Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann, betonte, neben dem Anliegen, Forschung transparent zu machen, sei die Ausstellung "visuell hochattraktiv". Dazu wird Wissenschaft auch mit zeitgenössischer Kunst kombiniert: So thematisiert die Installation: "La loi normale des erreurs/Projet Picasso, version Berggruen" von Raphaël Denis die Enteignung von Kunstwerken durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg im besetzten Frankreich. Denis integrierte in seine Arbeit Werke aus dem Museum Berggruen, die von den Nazis beschlagnahmt worden waren und nach dem Krieg restituiert wurden - etwa Picassos "Sitzender Akt, sich den Fuß trocknend" (1921).
Mühsame Puzzlearbeit
Provenienzforschung ist derweil mühsame Puzzlearbeit, wie Kuratorin Doris Kachel erläuterte. Da alle untersuchten Werke aus der Privatsammlung Berggruens stammten, gab es nicht wie im Museum üblich ein Inventarbuch mit einzelnen Erwerbsdokumentationen, um mögliche Vorbesitzer zu bestimmen. Die Familie Berggruen gewährte jedoch Einblick in Karteikarten des Sammlers. Demnach kaufte dieser die meisten Werke nach 1980, vor allem in internationalen Auktionshäusern, aber auch in Galerien und Kunstsammlungen. Bei der intensiven Sichtung der wichtigen Rückseiten halfen Restauratoren und Sicherheitstechnik.
Die Resultate der vergangenen drei Jahre sind nun in acht Kapitel beziehungsweise Räume aufgeteilt: Kunsthändler und Sammler, Der NS-Kunstraub in Frankreich, Was ist Provenienzforschung, Daniel-Henry Kahnweiler, Raphael Denis, Picassos Umfeld, Picasso und Klee in den USA sowie Afrikanische Werke. Alle erforschten Kunstwerke erhielten Objektschilder mit Provenienzketten.
Seit Verabschiedung der Washingtoner Erklärung vor 20 Jahren überprüfen Museen zunehmend ihre Bestände auf NS-Raubkunst. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz restituierte bereits rund 350 Kunstwerke an die rechtmäßigen Eigentümer.
Mittelalter-Ausstellung in Bonn zeigt "Europa in Bewegung"

epd-West/ LVR-Landesmuseum Bonn
Bonn (epd). Abdul-Abbas war ein treuer Begleiter Karls des Großen. Der Elefant erregte überall dort, wo er mit dem Kaiser auftauchte, großes Aufsehen. Doch wie kam das exotische Tier nach Europa? Diese und andere Geschichten erzählt die Ausstellung "Europa in Bewegung. Lebenswelten im frühen Mittelalter" im LVR-Landesmuseum in Bonn. Die Schau, die bis zum 12. Mai 2019 zu sehen ist, zeichnet ein neues, überraschendes Bild von der Epoche nach dem Zusammenbruch des römischen Reiches.
Wie der Elefant zu Karl dem Großen kam
Die Zeit um das Jahr 500 nach Christus gelte als "Dunkles Zeitalter", sei aber in Wirklichkeit eine Epoche ungeheurer kultureller Vielfalt gewesen, erklärt der stellvertretende Museumsdirektor, Lothar Altringer. Im Westen werde das Ende des römischen Reiches als Zusammenbruch betrachtet. "Aber tatsächlich sind stattdessen wieder neue Strukturen entstanden." Besonders überraschend sei der rege kulturelle Austausch, der in dieser Zeit stattgefunden habe. Pilger oder Händler reisten über Tausende Kilometer und transportierten Wissen und Waren zwischen Irland und Spanien im Westen und Ägypten und Ungarn im Osten. Davon zeugen in der Ausstellung rund 300 wertvolle Objekte aus dieser Zeit, die aus verschiedenen europäischen Sammlungen nach Bonn kamen.
So legte auch der indische Elefant Abdul-Abbas den weiten Weg von Bagdad ins Frankenreich zurück. Er war ein Geschenk des Kalifen von Bagdad, Harun-al-Raschid an Karl den Großen. Ein jüdischer Dolmetscher und Gesandter Karls holte das wertvolle Tier ab und führte es über ein Jahr lang bis nach Aachen.
Völkerwanderungen
Die Ausstellung empfängt den Besucher aber zunächst einmal mit einer animierten Landkarte, die verdeutlicht, wie sehr Europa in der Zeit zwischen 300 und 1.000 nach Christus in Bewegung war. Volksstämme wanderten und vermischten sich auf der Reise mit anderen Gruppen. Vielfältige Handelsbeziehungen ließen einen Hauch von Globalisierung über den Kontinent wehen. Die Zeit sei von der Bewegung großer Menschengruppen, Verlagerung von Märkten, dem Umbruch politischer Strukturen, religiösen Konflikten und Klimaschwankungen geprägt gewesen, sagt Kuratorin Elke Nieveler. "Das kommt uns heute seltsam vertraut vor."
Den regen Austausch zwischen den Völkern und die Beziehungen zwischen der christlichen und islamischen Welt veranschaulicht die Ausstellung am Beispiel einzelner Zeitzeugen. Sie werden mit kurzen Filmen und passenden Exponaten vorgestellt. Da ist etwa die byzantinische Prinzessin Theophanu, die 972 im Alter von nur zwölf Jahren mit Otto II., dem König des ostfränkischen Reiches, verheiratet wird. Nach dessen Tod überrascht sie ihre Widersacher, indem sie das Reich tatkräftig zusammenhält. Die Ordensfrau Egeria hingegen wurde bekannt durch ihre Reiseberichte von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land.
Europäisches Forschungsprojekt
Die Ausstellung thematisiert nicht nur die frühe Geschichte Europas. Sie entstand auch als europäisches Forschungsprojekt. So vereint sie eine Anzahl seltener Objekte aus führenden Mittelalter-Sammlungen europäischer Museen, die normalerweise nicht auf Reisen geschickt werden.
Besonders beeindruckend sind etwa gut erhaltene Textilien wie eine aus dem heutigen Ägypten stammende Kindertunika mit Blumenstickereien aus dem fünften Jahrhundert. Erstaunlich ist auch der unversehrte Zustand vergoldeter Lederschuhe aus dem vierten Jahrhundert mit den für das Mittelalter typischen Fußspitzen. Ein weiteres Highlight sind Elfenbeinschnitzereien wie etwa ein Bischofsthron aus Ravenna aus dem fünften bis sechsten Jahrhundert.
Alte Geschichte mit moderner Hologramm-Technik inszeniert
Einzelne Objekte der Ausstellung werden lebendig, indem ihre Geschichte mit digitaler Hologramm-Technik inszeniert wird. Dreidimensionale Bilder zeigen das Exponat aus der Vitrine aus unterschiedlichen Perspektiven. Zudem wird eine fiktive, aber wissenschaftlich korrekte Geschichte rund um das Objekt erzählt. Anhand einer kunstvollen goldenen Schnalle aus dem Grab einer awarischen Frau erzählt deren Tochter zum Beispiel aus dem Leben ihrer Mutter.
Am Ende der Ausstellung können die Besucher einzelne Exponate noch einmal mit 3-D-Technik von allen Seiten betrachten. Ein digitales europäisches Projekt soll die Beziehung einzelner Exponate aus unterschiedlichen Regionen veranschaulichen. Dazu erscheint die Herkunft des Exponats auf einer Landkarte, und es können weitere Objekte aufgerufen werden, die damit in Beziehung stehen. Noch ist das alles etwas unübersichtlich und die Texte sind bislang recht knapp. Aber, sagt Altringer, es handele sich um ein Projekt im Wachstum, das auf den Stationen der Ausstellung in jeweils unterschiedlichen europäischen Städten weiterentwickelt werde. Eben Europa in Bewegung. Irgendwann soll das Projekt im Internet für jedermann zugänglich sein.
Das digitale Projekt und die Ausstellung sind Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des von der Europäischen Union geförderten Projektes CEMEC (Connecting Early Medieval European Collections). Museen in Amsterdam, Athen, Bonn, Brüssel, Budapest, Dublin, Jaén und Rom sowie zahlreiche wissenschaftliche und technische Partner aus Belgien, Griechenland, Italien, Irland, den Niederlanden, Spanien, Ungarn und Deutschland haben daran mitgewirkt.
Irmgard Schwaetzer: Journalisten sollten auf Distanz gehen

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Irmgard Schwaetzer, hat Journalisten zu kritischer Distanz aufgerufen. Bei der Verabschiedung von Absolventen der Evangelischen Journalistenschule warb Schwaetzer für eine Berichterstattung, "die zugespitzte Formulierungen um ihre Hintergründe erweitert und Statistiken gegen den Strich bürstet". Informationen müssten auf Stichhaltigkeit, Quellen auf Vertrauenswürdigkeit geprüft werden, sagte die Synodenpräses am 21. November in Berlin.
"Mir scheint, dass es heute vor allem darum geht, auf Distanz zum Ereignis zu gehen, über das berichtet wird", sagte die ehemalige Bundesministerin: "Denn die Gefahr der Manipulation aus Voreingenommenheit ist gerade dort allgegenwärtig, wo ein Bericht mit Emotionen angereichert wird."
Eine funktionierende Demokratie brauche couragierten Journalismus, sagte Schwaetzer, die seit 2013 als Präses an der Spitze des EKD-Kirchenparlaments steht. Mit der Journalistenschule habe die EKD einen Ort, an dem junge Menschen eine Ausbildung erhalten, die sie zu qualitätsvoller Berichterstattung befähige. "Dies ist unauflöslich verknüpft mit der Vermittlung ethischer Standards und der Reflexion über ethische Fragen", sagte Schwaetzer.
"Herzensangelegenheit"
Jörg Bollmann, Direktor des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP), sagte bei der Feierstunde: "Für die evangelische Kirche ist Qualitätsjournalismus eine Herzensangelegenheit, auch weil ihr die evangelische Publizistik als Lebensäußerung der Kirche am Herzen liegt." Evangelische Publizistik werde ihrem Namen nur gerecht, wenn sie den Standards des Qualitätsjournalismus folge.
Arnd Brummer, Publizistischer Vorstand der Journalistenschule, sagte, guter Journalismus heute bedeute, Gemeinschaft zu ermöglichen. Er wirke Individualisierung entgegen und unterstütze gesellschaftlichen Diskurs, sagte der Geschäftsführende Herausgeber des Magazins "chrismon".
16 Volontärinnen und Volontäre haben im 12. Jahrgang eine crossmediale Ausbildung an der Journalistenschule absolviert. Die Ausbildung dauert 22 Monate. Der 13. Jahrgang der Evangelischen Journalistenschule startet im Februar 2019.
Die Evangelische Journalistenschule in Berlin ist eine Abteilung des GEP mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Das Gemeinschaftswerk ist die zentrale Medieneinrichtung der EKD, ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Zum GEP gehört unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd).
Aus für Medienforum NRW
Düsseldorf (epd). Die nordrhein-westfälische Landesregierung setzt bei ihrer Medienpolitik neue Schwerpunkte. Das Medienforum NRW wird es künftig nicht mehr geben, wie Medien-Staatssekretär und Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski am 20. November in Düsseldorf mitteilte. Stattdessen will das Land die jährlich von der Deutschen Welle ausgerichtete internationale Medienkonferenz Global Media Forum unterstützen. Sie soll pro Jahr aus dem Landeshaushalt rund 600.000 Euro erhalten. Über das Aus für das Medienforum hatte es zuletzt bereits zahlreiche Spekulationen gegeben.
Land fördert künftig Global Media Forum in Bonn
"Das Land NRW und die Deutsche Welle haben das Ziel, das Global Media Forum zu einem festen Treffpunkt der deutschen und internationalen Medienbranche zu profilieren", sagte Liminski. Der Kongress könne für Medienschaffende zu der Bedeutung kommen, die die Münchner Sicherheitskonferenz für Sicherheitspolitiker habe. Das Global Media Forum, das seit 2008 jedes Frühjahr im World Conference Center in Bonn stattfindet, ist Treffpunkt für mehr als 2.000 Medienschaffende und Vertreter aus Politik, Kultur, Bildung und Wissenschaft. Der dreitägige Kongress, der auch vom Auswärtigen Amt und der Stadt Bonn gefördert wird, findet das nächste Mal im Mai statt.
Der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, sieht in der zusätzlichen Beteiligung des Landes die Chance, die Bedeutung des Forums weiter zu stärken. NRW könne die bestehenden Netzwerke aus Medien, Wirtschaft, Bildung und anderen Institutionen einbringen, damit das Forum seine internationalen Kontakte mit deutschen Medienschaffenden verbinden könne, sagte Limbourg.
Neues breitgefächertes Angebot als Ziel
Neben der Unterstützung des Global Media Forums will sich das Land auch in andere etablierte Medienveranstaltungen wie das Film Festival Cologne und die Videospielemesse Gamescom einbringen. Mit einem breitgefächerten Angebot von bestehenden und neuen Formaten wolle die Landesregierung sicherstellen, dass es das ganze Jahr über auf jede Zielgruppe der Branche zugeschnittene Angebote gebe, sagte Liminski. "Medienforum ist in Zukunft das ganze Jahr. Wir versuchen nicht mehr, mit einer mehrtägigen Konferenz praktisch alles und jeden zu erreichen."
Das 1989 von der damaligen SPD-Landesregierung gestartete Medienforum NRW galt lange als einer der wichtigsten Medienkongresse in Europa. Die Federführung hatten seit 2006 die Landesanstalt für Medien und seit 2012 die Film- und Medienstiftung NRW. Doch in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung immer weiter geschrumpft. In diesem Jahr fiel sie ganz aus, weil die Branche kein Interesse an dem Format "alter Prägung" hatte, erklärte die Landesregierung.
Spielball der Mächtigen

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). André Pasti fürchtet um die Meinungsfreiheit in Brasilien, wenn der rechtsextreme Ex-Militär Jair Bolsonaro am 1. Januar ins Präsidentenamt kommt. Die Verflechtung von Politik, Medien, Unternehmen und Kirchen transparent zu machen, sieht der Professor an der Uni Campinas bei São Paulo als wichtige Aufgabe an. Und dem Druck entgegenzutreten. In vielen Ländern der Welt wehren sich Journalisten und Menschenrechtler gegen "das Kapern" von Medien - die Vereinnahmung für politische oder wirtschaftliche Interessen. Das machte ein Symposium des Forums Medien und Entwicklung in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung am 22. und 23. November in Berlin deutlich. Titel: "Die stille Übernahme".
Der künftige starke Mann Brasiliens drohte der kritischen Tageszeitung "Folha de São Paulo" bereits mit Anzeigenboykott. Seine Wahl wiederum verdankt er mit einem der größten Medienkonzerne. "Rede Record" gehört Bischof Edir Macedo von der "Universalkirche des Königreichs Gottes", einer der größten Pfingstkirchen in Brasilien, die sich gegen Homosexualität und Feminismus wendet. Aber auch Politiker selbst besitzen Fernsehkanäle, obwohl die Verfassung dies Mandatsträgern verbietet. Professor Pasti hat mit seiner Organisation Intervozes die Justiz informiert - und hofft, dass sie dem nachgeht.
In Sri Lanka dominiert der Staat die Medienlandschaft. Er ist nicht nur Eigentümer von Zeitungen, Fernseh- und Radiosendern, auch private Medien sind auf Regierungslinie, wie Deepanjalie Abeywardana von der Denkfabrik "Verité Research" in Colombo sagt. Die Absetzung von Ministerpräsident Ranil Wickremesinghe am 26. Oktober habe Furcht ausgelöst: "Was ist, wenn die Medien einer repressiven Regierung in die Hände fallen?"
"Züge eines Staatsstreichs"
Mehrere Journalisten hätten bereits ihre Jobs verloren. Präsident Maithripala Sirisena habe verfassungswidrig Ex-Staatschef Mahinda Rajapaksa als Regierungschef eingesetzt. "Das trägt Züge eines Staatsstreichs", sagt Abeywardana. "Wir haben Alpträume." Unterdessen wird die Webseite "Ethics Eye" weitergeführt, auf der mögliche Fake News gepostet und geprüft werden.
Ali Amar sieht seine Heimat Marokko nach dem "arabischen Frühling" in einem sehr langsamen Wandel. Es sei keine Diktatur, aber auch keine Demokratie. "Es ist etwas dazwischen", sagt der Mitgründer des Wochenmagazins "Le Hebdo", der wegen Berichten über den Westsahara-Konflikt Prozesse und Anzeigenboykott erlebte. Nach zwölf Jahren kam 2010 per Gerichtsbeschluss die Schließung. Amar ging ins Ausland. 2015 kehrte er zurück, um mit Kollegen das Online-Magazin "Le Desk" auf die Beine zu stellen. Um unabhängig zu bleiben, erarbeiten sie ein Bezahlmodell und kooperieren mit ihrem erfolgreichen französischen Vorbild "Mediapart".
Im Nachbarland Tunesien, dem arabischen Land, das die meisten demokratischen Fortschritte geschafft hat, machte Fatima El Issawi eine ernüchternde Erfahrung, als sie Journalisten befragte. "Es gibt einen Rückfall in die Selbstzensur", sagt die Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität im englischen Essex. Im Namen des Patriotismus würden Nachrichten nicht veröffentlicht, die für die Regierung unbequem seien. Denn das Land stehe im Visier des Terrorismus.
Der Südsudanese John Jak Dal lebt in der Flüchtlingssiedlung Araua in Uganda. Er weiß, wie Fake News den ethnischen Hass im Bürgerkrieg in seinem Land anfachen. So kursierten in sozialen Medien Videos und Fotos, die Zerstörungen zeigen. "Sie erzeugen sofort Ärger", sagt Dal. Mit seiner Jugendorganisation "Youth Advocacy Team" ruft er dazu auf, die Nachrichten zu prüfen und falsche zu entlarven. "Wir nutzen oft das Telefon, um herauszufinden, ob es wahr ist oder nicht." Missen möchte er die sozialen Medien indes auf keinen Fall: "Wir sind junge Leute, wir brauchen sie."
Deutsche Welle und RBB punkten bei Gleichstellung im Rundfunk
Bonn, Berlin (epd). Beim Thema Gleichstellung von Frauen im Rundfunk schneiden die Deutsche Welle und der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) einer neuen Untersuchung zufolge am besten ab. Beide Sender erfüllten die Forderung "nach der Hälfte der redaktionellen Macht für Frauen", teilte der Verein "Pro Quote Medien" anlässlich der Veröffentlichung der Untersuchung am 22. November mit. Demnach erreichte die Deutsche Welle mit Sitz in Bonn einen gewichteten Frauenmachtanteil von 51,9 Prozent und der RBB von 51 Prozent.
Als gemeinnütziger Verein untersucht "Pro Quote Medien" nach eigenen Angaben seit 2012 die Frauenanteile in den journalistischen Führungspositionen deutscher Medien. Bislang bezogen die Zählungen sich auf leitende Print- und Onlinemedien, nun sei erstmals der Rundfunk untersucht worden. Zur Ermittlung der sogenannten Frauenmachtanteile seien die Hierarchieebenen gewichtet worden, hieß es. Je höher die Position, desto größer sei die Machtfülle, erklärte "Pro Quote Medien".
Auf dem Weg zu einer ausgeglichenen Teilhabe der Geschlechter in Spitzenpositionen befände sich auch der WDR mit 44,6 Prozent, der NDR mit 40,1 Prozent und das ZDF mit 39,4 Prozent, hieß es. Die Führungsebenen kleinerer Anstalten wie Radio Bremen seien mit einem Frauenanteil von 32,2 Prozent, Saarländischer Rundfunk (25,6 Prozent) und Deutschlandradio (24,3 Prozent) dagegen noch weitgehend männlich geprägt.
Grundlage der Zählung seien die Organigramme von zwölf öffentlich-rechtlichen Sendern gewesen. Ausgewertet wurden demnach jeweils die vier obersten Hierarchieebenen.
Der private Rundfunk habe keine Organigramme zur Verfügung gestellt, so dass keine vergleichbaren Aussagen zu Frauenmachtanteilen möglich gewesen seien, erklärte "Pro Quote Medien". Das Top-Management der RTL-Gruppe bestehe aber aus einer Frau und elf Männern. Bei ProSiebenSat.1 werde in den obersten drei Führungsebenen ein Frauenanteil von 19,8 Prozent erreicht.
Zudem habe "Pro Quote Medien" unter 136 Studioleitern und Auslandskorrespondenten einen Frauenanteil von 31,6 Prozent gezählt. Bei 149 öffentlich-rechtlichen sowie privaten Programmleitungen im Hörfunk habe der Frauenanteil bei 24,8 Prozent gelegen. Vor allem im privaten Rundfunk dominierten Männer, erklärte "Pro Quote Medien".
Kölner NS-Dokumentationszentrum erhält umfangreiche Kunstschenkung
Köln (epd). Das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln bekommt 438 Kunstwerke des jüdischen Malers Otto Schloss (1184-1950). Der Rat der Stadt nahm die Schenkung der Sammlung von zwei Erbinnen des Kölner Künstlers am 22. November "mit großem Dank" an, wie die Stadt mitteilte. Die 20 Gemälde, 263 Zeichnungen, 107 Aquarelle und 48 Druckgrafiken seien ein außerordentlicher Beitrag zur Kölner Kulturgeschichte und jüdischen Geschichte, hieß es. Nach Erschließung des Nachlasses sind eine Ausstellung im EL-DE-Haus und eine Publikation geplant.
Otto Schloss wurde den Angaben zufolge 1884 in Frankfurt a.M. als Sohn einer angesehenen jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Nach dem Studium an der Frankfurter Städelschule zog er nach Köln und heiratete die jüdische Lehrerin Hedwig Cahn. Schloss sei als Illustrator für Zeitungen und Buchpublikationen tätig gewesen, hieß es. Er schuf Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken, darunter Porträts, Landschaften, religiöse und soziale Motive. Ab 1933 habe der Künstler nur noch für jüdische Zeitungen und jüdische Auftraggeber arbeiten können. 1938 flüchtete er mit seiner Frau nach Schweden, wo er 1950 starb.
Tony Cragg gestaltet Kirchenfenster für Dorfkirchen in Anhalt
Großbadegast, Wuppertal (epd). Der renommierte britische Künstler Tony Cragg gestaltet mehrere Kirchenfenster für die Dorfkirche in Großbadegast bei Köthen in Sachsen-Anhalt. Das Projekt, das am 19. November in der Kirche St. Christophori vorgestellt wurde, ist Teil des Projektes "Lichtungen - zeitgenössische Gasmalerei in Kirchen". Die Evangelische Landeskirche Anhalts leistet damit einen Beitrag zum anstehenden 100. Gründungsjubiläum des Bauhauses 2019.
Cragg erklärte, er habe sich für seine Entwürfe an 34 Gleichungen der Physik und Mathematik orientiert. Diese spiegelten sich in der Gestaltung der Fenster. Der in Wuppertal lebende Künstler bezog sich damit auf das Buch "Unser mathematisches Universum" von Max Tegmark. Der 1949 in Liverpool geborene Künstler, der bis 2013 Rektor der Kunstakademie Düsseldorf war, hat damit erstmals flächige Glasgestaltungen entworfen. Neben der Kirche in Großbadegast wird Cragg auch die Fenster für die Kirche in Garitz bei Zerbst gestalten.
Schirmherr für das Kunstprojekt "Lichtungen" ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), der das neue Vorhaben am Montag selbst in Augenschein nahm. Er betonte, dass die Kirche unabhängig von ihren Veränderungen immer für den Gottesdienst und die Gemeinschaft zur Verfügung stehen müsse. Die Kosten für das Projekt in Großbadegast werden auf insgesamt 470.000 Euro beziffert. Darin sind auch weitere Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten enthalten.
Entwicklung
"Helfen ohne Dank und Lohn"
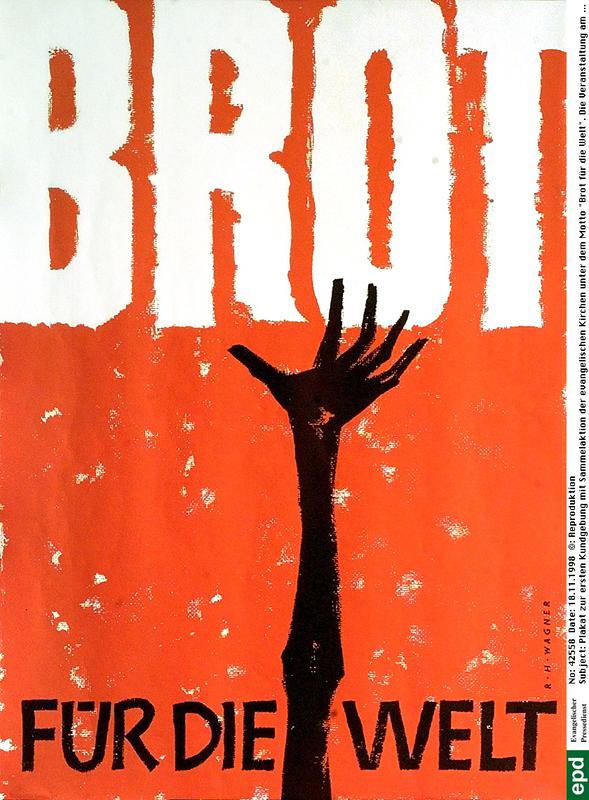
epd-bild / Reproduktion
Berlin (epd). Ein in die Luft gereckter dürrer Arm, die Hand ausgestreckt und darüber das Wort "Brot". Das Plakat mit der "Hungerhand" hängt am 12. Dezember 1959 in der Berliner Deutschlandhalle, als im Beisein von rund 12.000 Menschen die Hilfsorganisation "Brot für die Welt" gegründet wird. "Der Hunger auf der Welt ist eine ganz große Anklage, von der sich jeder mit getroffen fühlen muss. Wir wollen helfen, ohne Dank und ohne Lohn", stellt der Berliner Bischof Otto Dibelius das Projekt vor.
Es ist die Zeit von Hungerkatastrophen in Indien und Afrika - in Gebieten, aus denen sich die Kolonialherren gerade zurückgezogen haben. In China führte der "Große Sprung nach vorne", mit dem Mao Zedong das Land zu einer wirtschaftlichen Großmacht umwandeln wollte, zu einer dramatischen Not. Viele Chinesen flüchten nach Hongkong, wo sie im Elend leben.
"Menschen hungern nach Brot!"
In Deutschland erinnern sich Ende der 1950er Jahre viele noch selbst an Krieg und Armut. Der deutsche Hungerwinter, bei dem viele Tausend Menschen an Mangelernährung und Kälte starben, ist gerade erst 13 Jahre her. Die katholischen Kirchen haben das Hilfswerk Misereor gestartet. Auch evangelische Christen wollen helfen. Sie starten am 1. Advent eine Spendenaktion unter dem Motto "Brot für die Welt", um für Hungerleidende zu sammeln. "Menschen hungern nach Brot!", lautet die Überschrift des ersten Hilfsappells. Sie treffen einen Nerv. Völlig überraschend kommen 19 Millionen Mark (knapp zehn Millionen Euro) zusammen, 14,5 Millionen Mark in der Bundesrepublik, 4,8 Millionen in der DDR.
So kommt es zu dem Entschluss, aus "Brot für die Welt" eine dauerhafte Einrichtung zu machen - unter dem Dach des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland. Drei Prinzipien werden für die Arbeit formuliert: Unterstützt werden alle Menschen, ganz gleich welcher Religion sie angehören. Die Arbeit vor Ort läuft immer über einheimische Partnerorganisationen und das Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Der Mauerbau 1961 brachte die Arbeit der Organisation im Osten Deutschlands nicht zum Erliegen. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck erinnerte sich vor einem Jahr bei einem Festakt daran, wie er als Pastor in der "laizistischen" DDR, genauer noch in Rostock, einen Spendenaufruf per Brief für "Brot für die Welt" gestartet habe. Auch viele Menschen, "die wir nie in der Kirche sahen", haben seinen Aussagen nach gespendet. In DDR war die Arbeit der "Brot für die Welt"-Vertreter allerdings komplizierter als im Westen. Sie mussten unter anderem auch damit umgehen, dass ihnen nur Spenden in der nichtkonvertierbaren DDR-Währung zur Verfügung standen. Das Geld musste also entweder aufwendig mit Hilfe von Partnern getauscht werden oder es mussten direkt Sachspenden gesammelt werden.
"Hungerhand"
Heute hat die Organisation 580 hauptamtliche Mitarbeiter und fördert mehr als 2.000 Projekte in über 90 Ländern. Seit 2012, als das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst zum Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung fusionierte, verfügt "Brot für die Welt" auch über mehr Geld: Neben Spenden und Kollekten erhält das Hilfswerk staatliche und kirchliche Mittel.
Die Themenpalette ist heute deutlich breiter: Neben der Nothilfe unterstützt das Hilfswerk Menschen im Kampf gegen Landnahme, Umweltzerstörung, Kinderarbeit, Verfolgung und wirtschaftliches Unrecht. "Brot für die Welt" prangert zudem Waffenlieferungen in Krisenländer an und berät zum Thema häusliche Gewalt. Die "Hungerhand", die nach dem Brot greift, ist als zentrales Motiv seit fünf Jahrzehnten abgelöst, unter anderen durch Bilder lokaler Bauern, die selbst hart für ihre Nahrung arbeiten. Die alljährliche Spendensammlung in der Advents- und Weihnachtszeit ist aber geblieben.
Marlehn Thieme neue Präsidentin der Welthungerhilfe

epd-bild/Norbert Neetz
Bonn (epd). Die Juristin Marlehn Thieme ist neue Chefin der Deutschen Welthungerhilfe. Die Mitglieder der Hilfsorganisation wählten die 61-Jährige in Berlin zur Präsidentin, wie die Welthungerhilfe am 23. November in Bonn mitteilte. Thieme löst die frühere Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann (SPD) ab, die nach zehn Jahren ihr Amt bei der Hilfsorganisation aus privaten Gründen niedergelegt hat.
Die Welthungerhilfe ist eine der größten privaten Hilfsorganisationen in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1962 wurden mehr als 8.900 Auslandsprojekte in 70 Ländern mit 3,53 Milliarden Euro gefördert.
EKD-Ratsmitglied
Marlehn Thieme ist seit 2004 Mitglied des Rates für nachhaltige Entwicklung in Deutschland und seit 2012 dessen Vorsitzende. Die Juristin ist außerdem seit 2003 Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und leitet den ZDF-Fernsehrat. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der privaten Stiftungen, wie es hieß.
"Hunger und Armut sind kein unabwendbares Schicksal", betonte Thieme. Sie empfinde es "als Auszeichnung, mich für die Welthungerhilfe einsetzen zu können". Sie freue sich auf eine anspruchsvolle Aufgaben. Zugleich dankte Thieme ihrer Vorgängerin Dieckmann für deren "beeindruckende Leistung".
Dieckmann selbst dankte zur Verabschiedung den "2.500 Kollegen und Kolleginnen, die mit Kraft und Engagement, mit Wissen und Innovationsfähigkeit im Inland und im Ausland in momentan 38 Ländern arbeiten". Die Welthungerhilfe habe einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Hungers geleistet.
Asia Bibi darf laut Unterstützern nach Deutschland kommen
Unter dem Vorwurf der Gotteslästerung wurde sie zum Tode verurteilt, dann in einem bahnbrechenden Urteil freigesprochen. In Pakistan ist die Christin Asia Bibi aber nicht sicher. Nach Informationen von Helfern darf sie nach Deutschland kommen.Aachen (epd). Die in Pakistan vom Vorwurf der Gotteslästerung freigesprochene Christin Asia Bibi darf nach Angaben von Unterstützern nach Deutschland kommen: Die Bundesregierung habe Bibi und ihren nächsten Familienangehörigen eine Aufenthaltszusage gegeben, erklärte das katholische Hilfswerk missio am 21. November in Aachen. "Asia Bibi kann nach Deutschland einreisen, das ist geklärt", sagte missio-Sprecher Johannes Seibel dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin gab es zunächst keine direkte Bestätigung. Deutschland stehe mit der pakistanischen Regierung und den Partnern im Gespräch, verlautete am Mittwoch aus dem Ministerium. Eine Reihe europäischer Länder sei gegenüber einer Aufnahme von Asia Bibi aufgeschlossen. "Dazu gehört selbstverständlich auch Deutschland", hieß es auf epd-Anfrage.
Nach missio-Informationen liegen aus mehreren Ländern Aufenthaltszusagen vor, darunter Frankreich und Kanada. Asia Bibi war 2009 nach einem Dorfstreit um ein Glas Wasser wegen Gotteslästerung angezeigt worden, ein Gericht verurteilte sie 2010 zum Tode. In einer bahnbrechenden Entscheidung hob das Oberste Gericht dieses Todesurteil am 31. Oktober diesen Jahres auf. Nach dem Freispruch kam es zu heftigen Protesten muslimischer Hardliner. Asia Bibi und ihre nächsten Angehörigen wurden nach Angaben ihres Anwalts Saif-ul-Malook in Pakistan an einen sicheren Ort gebracht.
Gouverneur getötet
Noch am 20. November hatte Malook in einem Pressegespräch in Frankfurt am Main beklagt, dass noch kein westliches Land ein konkretes Angebot gemacht habe, Bibi, ihren Mann und ihre beiden Töchter einreisen zu lassen. Die Familie könne in Pakistan nicht aufgehalten werden, wenn das Ausland ihr den Weg öffne, erklärte Malook. Alles andere würde gegen die pakistanische Verfassung verstoßen, betonte der Jurist, der selbst jahrelang in Pakistan unter Polizeischutz stand und sich nach dem Urteil in Europa in Sicherheit brachte.
Der Fall Asia Bibi hatte in den vergangenen Jahren immer wieder zu Spannungen und auch Gewalt geführt. Ein Jahr nach dem Todesurteil wurde der Gouverneur der Punjab-Provinz, Salman Taseer, von seinem eigenen Bodyguard getötet, weil er sich für die Freilassung der Christin eingesetzt hatte. Das Oberste Gericht hatte bereits 2016 den Fall erörtern wollen, doch weil einer der Richter es wegen Befangenheit ablehnte, den Fall zu hören, musste ein neues Richtergremium eingesetzt werden.
Myanmars Militär verübt ungestraft sexuelle Gewalt
Das Militär in Myanmar setzt Vergewaltigungen als Kriegswaffe ein. Das trifft nicht nur die Rohingya-Flüchtlinge. Auch ethnische Minderheiten wie Shan, Kachin und Karen sind dem ausgeliefert.Frankfurt a.M., Cox's Bazar (epd). Manchen versagt die Stimme, andere haben Tränen in den Augen bei der Erinnerung an Schmerz und Demütigung: Wie Soldaten die Frauen und Mädchen zusammentrieben, um sie zu vergewaltigen. Wie Müttern vor den Augen ihrer Kinder die Kleider vom Leib gerissen wurden und sie ihre Töchter nicht vor der Gewalt schützen konnten. Diese und andere Gräuel schildern Rohingya-Frauen, die vor Myanmars Armee nach Bangladesch flohen, im Flüchtlingslager Cox's Bazar.
Das brutale Vorgehen gegen die weiblichen Rohingya wurde laut der UN-Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, vom Militär befohlen, organisiert und verübt. Angehörige von Grenzpolizei und Milizen seien ebenfalls an den Verbrechen in Myanmars westlichem Bundesstaat Rakhine beteiligt gewesen. Geflohene berichteten von "Gruppenvergewaltigungen durch Soldaten, erzwungene öffentliche Nacktheit, Demütigungen und sexueller Versklavung in militärischer Gefangenschaft". Patten sieht darin ein systematisch eingesetztes Instrument des Terrors.
"Liste der Schande"
Im Frühling dieses Jahres setzten die UN Myanmars Militär erstmals auf eine internationale Liste von Armeen und Milizen, die für sexuelle Gräuel in bewaffneten Konflikten berüchtigt sind. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch nennen sie "Liste der Schande". Die Entscheidung dürfte vor allem darauf beruhen, dass die Verbrechen gegen die muslimischen Rohingya im Fokus internationaler Aufmerksamkeit stehen.
Über systematische sexuelle Gewalt gegen Angehörige anderer Minderheiten in anderen Regionen Myanmars wird dagegen vergleichsweise wenig berichtet. Dabei ist die Armee des früheren Birma seit langem dafür berüchtigt, ähnlich brutal gegen Volksgruppen in Bundesstaaten wie Shan und Kachin vorzugehen. Dort kämpfen staatliche Truppen gegen bewaffnete Rebellen, während die Zivilisten die hauptsächlich Leidtragenden sind.
Schon zu Zeiten der Militärdiktatur, die formell 2011 endete, dokumentierten einheimische und internationale Menschenrechtsorganisationen, wie die Armee sexuelle Gewalt als "Kriegswaffe" einsetzte. Als eines der wichtigsten Dokumente gilt der 2002 veröffentlichte Bericht "License to Rape" (Lizenz zum Vergewaltigen). Darin listen die "Shan Menschenrechtsstiftung" und das "Aktionsnetzwerk der Shanfrauen" in 173 Fällen Vergewaltigungen und andere sexuelle Gewalttaten an 625 Frauen und Mädchen von 1996 bis 2001 auf. Diese Verbrechen dienten dazu, die lokale Bevölkerung zu terrorisieren und zu unterjochen, so Mitverfasserin und Shan-Aktivistin Charm Tong.
Kritik an Friedensnobelpreisträgerin
Auch die Burmesische Frauenliga dokumentierte 2014 mehr als 100 Vergewaltigungen an Frauen und Mädchen innerhalb von knapp vier Jahren. Manche Opfer waren acht Jahre alt. Die meisten der genannten Verbrechen ereigneten sich im nördlichen Kachin-Staat und im Norden des benachbarten Shan-Staates. Fast die Hälfte seien Gruppenvergewaltigungen gewesen, 28 der Opfer seien danach ermordet worden oder an ihren Verletzungen gestorben. Zugleich gingen die Frauenrechtlerinnen davon aus, dass diese Zahlen nur einen Bruchteil der tatsächlich begangenen Verbrechen darstellten.
Im Januar 2015 machte ein Doppelmord an zwei Lehrerinnen der überwiegend christlichen Kachin-Minderheit auch international Schlagzeilen: Damals waren Maran Lu Ra (20) und Tangbau Hkawn Nan Tsin (21), die sich als Freiwillige in einer Baptistengemeinde engagierten, nach einer Gruppenvergewaltigung ermordet worden. Ihre Leichen waren blutüberströmt und verstümmelt. Trotz aller Reden über Reformen vergewaltige, foltere und töte die Armee weiterhin und komme straffrei davon, kritisierten Menschenrechtler.
Ähnlich ernüchtert sind Aktivistinnen der Frauenorganisation der Karen, die sich mit den verfolgten Rohingya solidarisierten. Ihre Kritik zielt zugleich auf Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, deren "Nationale Liga für Demokratie" (NLD) 2015 die Wahlen gewann und die seit 2016 De-facto-Regierungschefin ist: Als frühere Oppositionsführerin habe Suu Kyi 2011 Vergewaltigungen als "Waffe der Armee" bezeichnet, die dazu benutzt werde, "die ethnischen Minderheiten einzuschüchtern und unser Land zu entzweien". Mit der NLD und Suu Kyi im Amt habe man gehofft, dass die Gewalt aufhöre. "Jetzt sehen wir, dass dies nur leere politische Worte waren."
Amnesty: Sex ohne Einwilligung gilt oft nicht als Vergewaltigung
Brüssel, London (epd). In den meisten europäischen Ländern ist Amnesty International zufolge Sex ohne Einwilligung der Frau keine Vergewaltigung. Nur in acht von 31 untersuchten Ländern, darunter Deutschland, werde Vergewaltigung über die Zustimmung definiert, erklärte die Menschenrechtsorganisation in London. Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 26. November. "Immer wieder zeigen Erhebungen, dass viele Leute es nicht für eine Vergewaltigung halten, wenn das Opfer betrunken ist, freizügige Kleidung trägt oder sich nicht körperlich wehrt", erklärte Anna Blus, Frauenrechtsexpertin der Organisation.
"Gerechtigkeit ermöglichen"
In der großen Mehrheit von Ländern gehe das Gesetz nur dann von einer Vergewaltigung aus, wenn physische Gewalt, Drohungen oder Zwang eingesetzt würden oder das Opfer sich nicht wehren könne, erläuterte Amnesty. "Gesetze haben die Macht, Gerechtigkeit zu ermöglichen und Einstellungen zu beeinflussen", sagte Blus.
Darüber hinaus sei die Gesetzgebung zu sexueller Gewalt in manchen Ländern noch mit Begriffen wie "Ehre" und "Moral" verbunden, was den Gedanken stütze, dass die Gesellschaft die Körper von Frauen kontrollieren dürfe. Als Beispiel führte Amnesty an, dass im EU-Land Malta Sexualvergehen im Gesetzbuch unter das Kapitel "Verbrechen, die die gute Ordnung der Familie betreffen" fielen.
Ein Jahr nach Mugabe: Ernüchterung in Simbabwe
Fast vier Jahrzehnte klammerte sich Robert Mugabe in Simbabwe an die Macht, wirtschaftete das einst blühende Land herunter, unterdrückte Kritiker. Sein erzwungener Rücktritt vor einem Jahr weckte große Hoffnungen - erfüllt hat sich nur wenig.Frankfurt a.M., Harare (epd). Jubel im Parlament, Feiern auf den Straßen: Als Robert Mugabe am 21. November 2017 seinen Rücktritt erklärt, scheint die Zeit in Simbabwe angehalten. Das Ende der Ära Mugabe, der sich seit der Unabhängigkeit 1980 an die Macht geklammert hatte, verheißt einen Neuanfang und ein Ende von Isolation, Misswirtschaft und Krise.
Ein Jahr später sind die Hoffnungen auf einen grundlegenden Wandel erschüttert: Die Wirtschaft liegt nach wie vor am Boden, Menschenrechtler berichten von anhaltender Angst vor Gewalt und Repressionen. Die Lage zwölf Monate nach Mugabe und der Amtsübernahme seines früheren Stellvertreters Emmerson Mnangagwa sei "nicht ermutigend", resümiert die Simbabwe-Expertin Julia Grauvogel vom Hamburger Giga-Institut für Afrika-Studien.
"Bis auf Initiativen in den Städten, bei der gut gebildeten Mittelschicht, haben sich die Simbabwer wenig öffentlichen Raum zurückerobern können", sagt sie. Manche Medien trauten sich inzwischen mehr, erreichten jedoch vor allem die gebildeten Städter. "Das heißt aber auch nicht, dass Mnangagwa nicht gegebenenfalls genauso harsch durchgreifen würde wie Mugabe."
"Altbekannte Strategien"
Mnangagwa, langjähriger Gefolgsmann und späterer Kritiker des Präsidenten, übernahm die Amtsgeschäfte wenige Tage nach dem vom Militär erzwungenen Rücktritt des damals 93 Jahre alten Mugabe. Im Juli wurde er bei der fälligen Präsidentenwahl bestätigt. Er trat mit dem Versprechen von Reformen und Versöhnung an.
Doch schon die gewaltsame Niederschlagung von Protesten nach der Wahl habe gezeigt, dass "wieder die altbekannten Strategien" angewendet worden seien, erklärt Grauvogel. "Nicht umsonst war Mnangagwa ein wichtiger Mastermind hinter dem Unterdrückungsregime Mugabes."
Viele Simbabwer erhofften sich von Mugabes Abtritt aber vor allem eins: dass es wirtschaftlich aufwärtsgeht. Mnangagwa sicherte zu, das Land aus der Krise zu führen und ökonomisch zu öffnen. Ein Jahr später ist die Arbeitslosigkeit weiter extrem hoch, Investoren halten sich zurück. Simbabwe muss importieren, um die Bevölkerung zu versorgen, das Außenhandelsdefizit steigt.
"Die Erwartungen waren sehr hoch. Viele glaubten, dass plötzlich Investitionen ins Land strömen würden und sich alles bessern würde", erklärt David Mbae, der das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Harare leitet. Erst im Oktober habe es jedoch erneut Lebensmittelengpässe gegeben. Brot und Speiseöl etwa seien zeitweise nicht verfügbar gewesen, Supermärkte hätten den Verkauf von Trinkwasser und anderen Grundnahrungsmitteln rationiert. Das habe den Menschen vor Augen geführt, dass wieder ein wirtschaftlicher Kollaps drohen könne. "Die Aufbruchsstimmung ist Ernüchterung gewichen", sagt der Politikwissenschafter.
Nahrungsmittelhilfe
Die Landesdirektorin der Welthungerhilfe in Simbabwe, Regina Feindt, meint: "Die Ernährungssituation wird sich in den kommenden Wochen und Monaten und womöglich auch darüber hinaus noch verschlechtern." Einerseits gingen die Vorräte zu Ende, andererseits verschärfe die Verknappung von Produktionsmitteln wie Saatgut und Dünger die Lage.
Hilfsorganisationen gingen davon aus, dass bald fast vier Millionen der rund 16 Millionen Simbabwer auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen sind, sagt Feindt. "Die Erwartung vor einem Jahr, dass sich die Wirtschaft schnell erholen würde, war jedoch aus meiner Sicht angesichts der tiefgreifenden, komplexen Probleme von vornherein überzogen."
Es gebe jedoch bereits Anzeichen einer wirtschaftlichen Belebung, betont der 76-jährige Mnangagwa unterdessen in der "Financial Times". Und seine Regierung sei bereit, die Herausforderungen "frontal anzugehen", versichert er in dem Beitrag von Mitte November. Unnötige Ausgaben einzuschränken gehöre dazu, die Privatisierung und Reformierung staatlicher Unternehmen sei eine Schlüsselkomponente. Auch die kürzlich eingeführte zweiprozentige Steuer auf elektronischen Zahlungsverkehr und das Eindämmen von Korruption sollten dazu beitragen, das Haushaltsdefizit einzufangen.
Die bisher einzigen sichtbaren Auswirkungen im Kampf gegen Korruption gibt es laut Simbabwe-Forscherin Grauvogel im Straßenbild: "Früher gab es viele Straßenblockaden, mit denen Polizisten niedriger Dienstgrade ihr Einkommen aufbesserten. Die sind jetzt verschwunden."
Gestrandet in Tijuana: Ein Zurück gibt es nicht

epd-bild/Wolf-Dieter Vogel
Tijuana (epd). Claudia Salgado redet sich immer mehr in Rage. Undankbare Menschen seien das, Kriminelle und Gewalttäter. Nein, sie habe nichts gegen Migranten, ruft die Mittfünfzigerin in die Menge, "aber unter denen sind Verbrecher, das wissen wir". Etwa 400 Menschen versammeln sich an diesem Morgen auf einer Kreuzung im wohlhabenden Viertel Rio der mexikanischen Millionenstadt Tijuana an der Grenze zu den USA. Einige tragen Pappschilder, auf denen in großen Lettern "Mexiko zuerst" und "Keine Karawanen mehr" geschrieben steht.
Andere schwenken die mexikanische Flagge. Immer wieder singen sie die Nationalhymne und brüllen in Sprechchören "Honduraner raus!". Wenig später steht ein Teil der Demonstranten an einer Straßenkreuzung nahe der Sportanlage Benito Juárez. Nur der Einsatz einer Polizeieinheit kann verhindern, dass die aufgebrachte Menge auf das Gelände vordringt.
In dem Sportzentrum sind derzeit etwa 2.400 Mittelamerikaner untergebracht, die vor Armut und Gewalt aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Die meisten stammen aus Honduras. Vergangene Woche sind sie mit einer Migranten-Karawane hier angekommen, um von der Grenzstadt in die USA weiterzureisen. Mindestens 3.000 weitere Menschen sind auf dem Weg.
20 Toiletten
Doch schon jetzt wird es eng in der Anlage. Zelte, Plastikplanen und Matratzen behindern den Durchgang, an allen Zäunen und Gerüsten hängt Wäsche. Auf dem Baseballplatz, gleich neben der Autobahn, stehen 20 Toiletten und ein paar Duschen, die für die tägliche Hygiene von Tausenden Menschen ausreichen müssen.
Aber warum dieser Hass? Ausgerechnet in der Grenzmetropole Tijuana, die erst durch die Migration Richtung USA ihre heutige Bedeutung erlangt hat. Schon bevor die Karawanen-Gegner am 18. November mobil machten, hatte Bürgermeister Juan Manuel Gastélum gegen die Migranten gehetzt. "Das ist ein Haufen Arbeitsscheuer und Drogenabhängiger", sagte er. Die Ruhe und Sicherheit sei gefährdet, erklärte der Rathaus-Chef einer Stadt, die unter anderem wegen Drogenhandel und Schmuggel eine sehr hohe Kriminalitätsrate hat: In diesem Jahr wurden schon 2.300 Mordopfer gezählt.
Der Honduraner Vicente Romero Pimea sitzt auf einer Tribüne der Sportanlage, von der aus er sein Ziel immer im Blick hat. Der 48-Jährige kann die Befürchtungen nicht verstehen. Wer auf dem Gelände Drogen verkaufe, fliege sofort raus. Und gerade weil er arbeiten wolle, sei er hier gelandet. In seiner Heimatstadt Santa Barbara gab es keine Jobs mehr. Er konnte seine Frau und seinen fünfjährigen Sohn nicht mehr ernähren. Nun hofft er, als Bauarbeiter in den USA genug zu verdienen, um Geld nach Hause zu schicken. Höchstens hundert Meter trennen Pimea von dem fünf Meter hohen rostigen Metallzaun, den er überwinden muss, um in die USA zu gelangen.
Bis Tijuana sind die Migranten gemeinsam gegangen. Jetzt muss jeder seinen Weg finden. Die mexikanische Regierung hat angeboten, Arbeitsplätze zu beschaffen. Und tatsächlich findet am Montag in der Nähe der Sportanlage ein "Arbeitsmarkt" statt, auf dem einige Unternehmer Beschäftigung anbieten. "Aber das mexikanische Geld ist ja auch nicht viel mehr wert als das honduranische", sagt Cruz Chicas, die sich mit ihren beiden Kindern der Karawane angeschlossen hat. Sie hat bereits im Süden Mexikos gearbeitet, aber die Behörden haben ihr nie Aufenthaltspapiere ausgestellt. Warum, weiß die 40-Jährige bis heute nicht.
Kein Zurück
Vicente Pimea überlegt, ob er Asyl beantragen soll. Unten auf dem Baseballfeld erklärt gerade eine Anwältin, was zu beachten ist, wenn man einen Asylantrag stellt. Aber dann ist er doch skeptisch. "Wenn ich Asyl beantrage, werde ich möglicherweise sechs Monate eingesperrt, bevor die Entscheidung fällt", sagt er. "Zuhause sitzen meine Frau und das Kind. Sie brauchen jetzt Geld."
Sich also doch einem "coyote" anvertrauen, wie die Leute genannt werden, die einen illegal über die Grenze bringen? "Die Schlepper kassieren viel Geld und lassen dich dann in der Wüste sitzen", wirft Ismael Gonzalez ein. Der junge Mann, braune Stoffjacke, weiße Hose, hat sich zu seinem Landsmann auf der Tribüne gesellt. Immer wieder schweigen die Männer und blicken auf den Metallzaun.
Am nächsten Morgen macht eine neue Nachricht die Runde. US-Behörden haben für mehrere Stunden den Grenzübergang geschlossen. Soldaten haben Stacheldraht auf dem Zaun montiert und Betonsperren aufgestellt. Angeblich, um zu verhindern, dass größere Gruppen durchbrechen. Aber wer hier würde die Grenze stürmen? "Wir sollten ganz friedlich dorthin laufen und fordern, dass wir einreisen dürfen", sagt Gonzalez.
Sein Mitstreiter Pimea ist noch nachdenklicher als am Vortag. Gestern wurde ihm draußen auf der Straße, wo sich Sexshops, Diskotheken und Bordelle für US-Touristen aneinanderreihen, sein Koffer gestohlen. Alle Klamotten sind weg, nur sein kleiner Rucksack ist ihm geblieben. Wie es weitergeht, weiß er nicht. Aber eines steht für ihn fest: Ein Zurück gibt es nicht.

