Kirchen
Kirchensteuereinnahmen könnten laut Studie weiter steigen
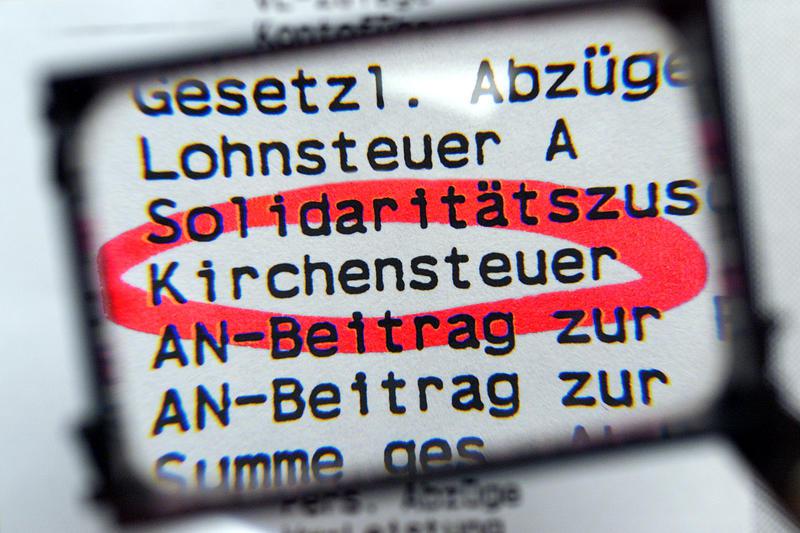
epd-bild / Norbert Neetz
Köln (epd). Trotz sinkender Mitgliedszahlen können die beiden großen Kirchen in Deutschland einer Studie zufolge weiter auf wachsende Steuereinnahmen hoffen. Der Trend zu steigenden Einnahmen dürfte anhalten, selbst wenn weiterhin jedes Jahr die Mitgliederzahl um bis zu 500.000 sinken würde, heißt es in einer am 14. Dezember vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln veröffentlichten Untersuchung.
Die Prognose stützt sich den Angaben zufolge auf die offizielle Schätzung für die Entwicklung der Lohn- und Einkommenssteuer, an die die Kirchensteuer geknüpft ist. Dabei seien Steuerrechtsänderungen wie die Erhöhung von Freibeträgen bereits berücksichtigt worden.
Aufgrund der guten Konjunktur steigen seit einigen Jahren die Kirchensteuereinnahmen, obwohl die beiden größten Religionsgemeinschaften in Deutschland jedes Jahr vor allem durch den demografischen Wandel Mitglieder verlieren. 2017 erhielt nach Angaben der Kirchen die katholische Kirche 6,43 Milliarden Euro aus der Kirchensteuer, die evangelische Kirche 5,67 Milliarden Euro. Laut IW-Studie zahlt ein Katholik in diesem Jahr im Durchschnitt 291 Euro Kirchensteuer, ein Protestant 278 Euro.
Doppelt so viel wie 2004
Das Wirtschaftsinstitut schätzt, dass die katholische Kirche bei der unterstellten guten Prognose im Jahr 2023 8,2 Milliarden Euro, die evangelische Kirche 7 Milliarden Euro an Kirchensteuern einnehmen könnte. Das entspräche einer Verdoppelung des Kirchensteueraufkommens gegenüber dem Jahr 2004.
Die Kirchen könnten mittelfristig weiter mit soliden Einnahmen zur Finanzierung ihrer Aufgaben rechnen, sagte der Ökonom Tobias Hentze vom IW dem epd. Gleichzeitig warnte er mit Blick auf den Mitgliederschwund: "Allerdings verteilt sich die Finanzierung auf immer weniger Köpfe, was zum Beispiel bei einem längeren Abschwung Risiken birgt."
Die evangelische Kirche selbst rechnet nicht so optimistisch. Auf der Jahrestagung ihrer Synode im November in Würzburg schwor Andreas Barner, Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und dort zuständig für den Haushalt, die Kirche auf Veränderungen ein. Ein Rückgang der Kirchensteuereinnahmen sei vor dem Hintergrund des Mitgliederverlusts in hohem Maße wahrscheinlich, sagte er.
EKD: Studie greift zu kurz
"Die Studie greift zu kurz", kommentierte ein EKD-Sprecher die IW-Studie. Er verwies auf eine von der EKD beauftragte Langfristprojektion des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge, die Aufschluss über die Finanzgrundlage der Kirche bis 2060 geben soll. Erste Ergebnisse daraus kündigte er für April an. Die katholische Kirche kommentierte die Studie zunächst nicht.
Katholische und evangelische Kirche haben 2017 mehr als 600.000 Mitglieder verloren. 23,3 Millionen Menschen gehören in Deutschland der katholischen Kirche an, 21,5 der evangelischen Kirche. Die Kirchensteuer wird als Zuschlag zur Einkommens-, Lohn- und Kapitalertragssteuer gezahlt und berechnet sich auf deren Grundlage. Eingezogen wird sie wie andere Steuern direkt von den Finanzämtern. Als Gegenleistung erhält der Staat rund drei Prozent der Einnahmen. Laut IW-Studie beläuft sich dieser Betrag derzeit auf rund 400 Millionen Euro.
Rheinische Kirche setzt auf mehr Jugend

epd/Vollrath
Düsseldorf (epd). Mehr Einfluss für die Jugend, neue Formen von Kirchengemeinde und eine gerechtere Verteilung der Kirchensteuereinnahmen: Mit diesen und weiteren Reformen will sich die Evangelische Kirche im Rheinland für eine Zukunft mit weniger Mitgliedern und weniger Geld fitmachen. Diskutiert werden die Änderungen bei der nächsten Landessynode der zweitgrößten deutschen Landeskirche vom 6. bis 11. Januar in Bad Neuenahr. Zuvor tagt ab dem 4. Januar erstmals eine Jugendsynode mit über hundert Delegierten.
"Das ist eine Uraufführung, auf die wir ein bisschen stolz sind", sagte der Präses der rheinischen Kirche, Manfred Rekowski, am 12. Dezember in Düsseldorf. Der partizipative Ansatz der Jugendsynode ist nach Angaben der Kirchenleitung einmalig innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die Mitglieder befassen sich unter anderem mit Jugendarmut und dem Umgang mit Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen.
Fördertopf für neue Gemeindeformen
Die Jugendsynode setzt sich aus je 50 Delegierten der Landessynode und der evangelischen Jugend zusammen. Hinzu kommen zehn Jugendliche und junge Erwachsene von Studierendengemeinden, landeskirchlichen Schulen, der ehrenamtlichen Konfirmandenarbeit und ökumenischen Gästen. Die Beschlüsse beschäftigen anschließend die Landessynode.
Das oberste Organ der über 2,5 Millionen Protestanten zwischen Niederrhein und Saar will insbesondere neue Formen kirchlicher Arbeit voranbringen. Vorgesehen ist ein Fördertopf von jährlich 500.000 Euro, aus dem in den kommenden zehn Jahren Projekte in "Erprobungsräumen" unterstützt werden. "Wir wollen Innovationen stärken und nicht etwas an den Tropf hängen, das sich überlebt hat", betonte Vizepräses Christoph Pistorius. Geplant ist auch eine Projektstelle beim Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, bis zu fünf Pfarrstellen sollen zudem für Erprobungsräume eingerichtet werden.
Änderungen bei Verteilung der Einnahmen geplant
Kontroverse Debatten werden über die Verteilung der Kirchensteuereinnahmen auf die künftig noch 37 rheinischen Kirchenkreise erwartet. Vorgeschlagen ist eine gleichmäßige Verteilung nach Zahl der Mitglieder, um finanzielle Schieflagen auszugleichen. Einige Kirchenkreise vor allem in Ballungsräumen bekämen dann künftig weniger Geld und ärmere Kirchenkreise in ländlichen Gebieten mehr. Die Landessynode soll klären, ob diese Reform mehrheitlich gewollt wird. Eine endgültige Entscheidung würde dann 2020 fallen.
Reformen werden auch für die Landessynode selbst angestrebt. Der Aufwand für die Arbeit des Kirchenparlaments müsse verringert werden, zugleich sei mehr Beteiligung gewünscht, sagte Rekowski. Erwogen wird etwa, künftig zweimal jährlich und dafür kürzer zu tagen. Bislang trifft sich die Synode einmal im Jahr eine Woche lang.
Steigende Kirchensteuer
Zeit für die Veränderungen erhält die Landeskirche durch die weiter steigende Kirchensteuer. Für 2018 wird mit einem Verteilbetrag von 737 Millionen Euro gerechnet, 22 Millionen Euro mehr als ursprünglich kalkuliert. Für kommendes Jahr kalkuliert Finanzdezernent Bernd Baucks mit einem weiteren Anstieg auf 744 Millionen Euro. Grundlage ist ein geschätztes Brutto-Kirchensteueraufkommen von knapp 930 Millionen Euro in diesem und 948 Millionen Euro im kommenden Jahr.
Baucks wertete diese Zahlen als Indikator, dass die kirchliche Finanzentwicklung immer noch mehr von Wirtschaftswachstum und steigenden Einkommen geprägt wird als vom Rückgang der Mitgliederzahlen. Längerfristig werde sich aber mit einer kleiner werdenden Kirche auch ein Rückgang der Finanzmittel ergeben.
Weitere Themen der Landessynode sind die Bezahlung der Pfarrer, die Verabschiedung des Haushalts und die Begegnung mit Kirchenvertretern aus Südafrika und Hongkong, die aus der Missionsarbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft hervorgegangen sind.
Weniger Gemeinden und Kirchenkreise wegen Fusion
Strukturveränderungen gibt es bereits zum 1. Januar: Die Evangelische Kirche im Rheinland besteht dann aus 687 Kirchengemeinden in 37 Kirchenkreisen. Durch die Fusion der Kirchenkreise Wetzlar und Braunfels zum neuen "Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill" verringert sich die Zahl der Kirchenkreise von 38 auf 37, wie es am 12. Dezember hieß. Durch Zusammenschlüsse reduziere sich auch die Zahl der Gemeinden - von 694 in 2018 auf 687 im kommenden Jahr.
Konkret schließen sich den Angaben zufolge im Kirchenkreis Aachen die Kirchengemeinden Baesweiler und Setterich-Siersdorf zur Kirchengemeinde Baesweiler-Setterich-Siersdorf zusammen. Aus den Gemeinden Bell-Leideneck-Uhler, Horn-Laubach-Bubach, Riegenroth und Gödenroth-Heyweiler-Roth im Kirchenkreis Simmern-Trarbach werde die neue Kirchengemeinde "Zehn Türme", hieß es. Im Kirchenkreis Trier bildeten die Gemeinden Rhaunen-Hausen und Sulzbach die neue Kirchengemeinde Rhaunen-Hausen-Sulzbach.
Die Kirchengemeinde Ellweiler im Kirchenkreis Obere Nahe schließt sich den Angaben zufolge der Kirchengemeinde Birkenfeld an. Die Evangelisch-reformierten Kirchengemeinden Schöller und Gruiten fusionierten im Kirchenkreis Niederberg zur Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gruiten-Schöller.
Evangelische Kirche will humanitäre Korridore nach Deutschland

epd-bild/Heiko Kantar/EKiR
Düsseldorf (epd). Die evangelische Kirche fordert humanitäre Korridore nach Deutschland für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge. Mit dem Bundesinnenministerium werde die Möglichkeit erörtert, 500 solcher Flüchtlinge auf sicherem Weg nach Deutschland zu holen, sagte der Vorsitzende der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Manfred Rekowski, am 12. Dezember in Düsseldorf. An dieser Stelle gebe es Bewegung, die Sache sei aber "noch nicht in trockenen Tüchern".
In Italien gibt es ein Programm für solche humanitären Korridore, das vom Bund der Evangelischen Kirchen in Italien (FCEI) und von der katholischen Gemeinschaft Sant' Egidio getragen und von Kirchen in Deutschland unterstützt wird. Die aktuelle Abschottungspolitik der EU könne die Kirchen nicht ruhen lassen, sagte der juristische Vizepräsident der Evangelischen Kirche im Rheinland, Johann Weusmann. Bis Mitte des Jahres seien bereits 1.500 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ertrunken.
In einer Vorlage zur "Flüchtingsproblematik an den EU-Außengrenzen" für die im Januar tagende Synode der rheinischen Kirche werden Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskirche nach Weusmanns Worten aufgefordert, das Thema wachzuhalten und "Menschen zu stützen, die sich in Notlage befinden". Viele rheinische Gemeinden und Kirchenkreise hätten Kontakte zu Kirchen an den Außengrenzen der EU.
Der rheinische Präses Rekowski hatte im Juli die Organisation Sea-Watch auf Malta besucht, die von der EKD unterstützt wird, und sich für die Einrichtung sicherer Passagen nach Europa stark gemacht. Solange Menschen aus einer Notlage heraus versuchten, mit Booten nach Europa zu gelangen, müsse dafür gesorgt werden, dass sie nicht zu Tode kommen.
Kirchen starten Menschenrechtskampagne für faire Kleidung

epd-bild / Rolf Zöllner
Wuppertal, Düsseldorf (epd). Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) haben am 11. Dezember ihre bundesweite Menschenrechtskampagne zu fairer und gerechter Kleidung gestartet. Die "menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen", unter denen Textilien im Ausland produziert würden, seien ein "dringendes und drängendes Thema" für die Kirche, sagte Bischöfin Petra Bosse-Huber, Leiterin der Hauptabteilung Ökumene und Auslandsarbeit der EKD, bei der Auftaktveranstaltung in der evangelischen City-Kirche in Wuppertal.
Mittlerweile werde 60 Prozent mehr Kleidung als noch vor 15 Jahren verkauft, betonte Bosse-Huber. Zugleich werde die Kleidung im Durchschnitt aber "nur noch halb so lang" getragen. Pro Jahr würden weltweit 8,4 Millionen Tonnen Textilabfälle "auf Deponien" entsorgt. Deshalb sei es wichtig, über dieses Thema aufzuklären und für Transparenz bei den Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dazu hat die EKD einen Prospekt unter den Titel "Mode um jeden Preis. Menschenrechte in der Textilindustrie" vorgelegt.
Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, betonte, dass sich der Bürger seiner Macht "als Konsument" bewusst sein und beim Einkauf auf fair gehandelte Textilien achten sollte. Wer sich als Christ der "Kultur der Barmherzigkeit" verpflichtet fühle, der könne die menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken nicht gutheißen.
"Extremer Produktionsdruck"
Sabine Ferenschild vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene verwies darauf, dass es bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen um "glaubwürdige Schritte" zur Anhebung des Mindestlohns in den Textilfabriken gehe, da dieser derzeit oft nicht ausreiche, eine Familie zu ernähren. Zudem sollten auch die Auftraggeber gesetzlich dazu verpflichtet werden, sich an die Sorgfaltspflicht in der Produktion zu halten und Verstöße gegen die Arbeitsrechte in den Textilfabriken zu unterbinden.
Die indonesische Aktivistin Dina Septi Utami betonte, dass die Arbeitsbedingungen in den Textilfabriken ihres Landes "sehr schlecht" seien. Die Bezahlung sei nicht existenzsichernd, es fielen viele Überstunden an und es herrsche ein "extremer Produktionsdruck". Auch Beschimpfungen und sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz seien an der Tagesordnung.
Das Motto der VEM-Kampagne lautet "Womit werden wir uns kleiden?" (Matthäus 6,31). Sie startet anlässlich des internationalen Tags der Menschenrechte, der am 10. Dezember begangen wurde. Auch die VEM stellt Hintergrundinformationen über das Thema und liturgisches Material in einer Broschüre bereit. Zudem finden Kirchengemeinden und Schulen Plakate und Bildungsmaterialien im Internet. Für den 28. Januar lädt der Kirchenbund überdies nach Wuppertal zu einem Fachseminar über Menschenrechte in der Textilindustrie ein.
EKD und Missbrauchsbeauftragter wollen Austausch vertiefen
Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und der Unabhängige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, wollen ihre Zusammenarbeit bei Prävention und Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt vertiefen. Das bekräftigten beide bei einem gemeinsamen Austausch in der Sitzung des Rates der EKD am 14. Dezember in Hannover. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte laut Mitteilung vom 15. Dezember, bei der Frage, welche Maßnahmen zur Verhinderung sexualisierter Gewalt am besten beitragen können, sei die Kirche "für den Rat des Unabhängigen Beauftagten sehr dankbar". Rörig würdigte die von der EKD-Synode im November verabschiedeten Maßnahmen als "eine gute Basis um weiter voranzuschreiten".
Insbesondere die geplanten Studien seien in dieser Hinsicht von großer Bedeutung, sagte Rörig. "Dabei ist es notwendig, dass die Kirchen mit dem Staat gemeinsam Standards für die Aufarbeitungsprozesse entwickeln." Daran müssten Betroffene beteiligt werden und ihre Rechte bei der Aufarbeitung geklärt sein.
"Übernehmen Verantwortung"
An dem Treffen, das auf Einladung Bedford-Strohms stattfand, nahm auch der "Beauftragtenrat zum Schutz vor sexualisierter Gewalt" der EKD teil. Dem fünfköpfigen Gremium, das sich dem Thema Missbrauch widmen soll, gehören die Bischöfe Kirsten Fehrs und Jochen Cornelius-Bundschuh sowie Kirchenjuristen an. Rörig bot für die Koordinierung der Aufarbeitung eine Zusammenarbeit zwischen Beauftragtenrat und der beim staatlichen Missbrauchsbeauftragten bestehenden Arbeitsgruppe an.
Bedford-Strohm bekräftigte die Entschlossenheit der evangelischen Kirche zur umfassenden Aufarbeitung: "Sexualisierte Gewalt darf nirgendwo in unserer Gesellschaft ein Tabuthema sein. Wir übernehmen Verantwortung für das, was Kindern und Jugendlichen in kirchlichen Einrichtungen oder von kirchlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angetan wurde." Fehrs betonte, eine Aufarbeitung könne nur unter Einbeziehung der Betroffenen geschehen. "Dass diese Menschen mit uns trotz traumatischer Erfahrungen und zerbrochenen Vertrauens reden, verdient Dank und Respekt."
Dunkelfeld-Studie
Die EKD-Synode hatte im November in Würzburg einen Maßnahmenplan von elf Punkten beschlossen, der unter anderem Studien zur Aufklärung des Dunkelfeldes und zu spezifischen Risikofaktoren in der evangelischen Kirche sowie die Einrichtung einer zentralen unabhängigen Ansprechstelle vorsieht. Für das kommende Jahr stellt die Synode 1,3 Millionen Euro zur Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung.
Zuvor hatten Politiker, Betroffene und auch der Missbrauchsbeauftragte Rörig mehr Engagement von der evangelischen Kirche gefordert. Eine der Forderungen war, dass die evangelische Kirche eine umfassende Studie zum Missbrauch in den eigenen Reihen initiiert, ähnlich der Studie, die von der katholischen Deutschen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben und Ende September vorgestellt worden war.
Wegen der föderalen Struktur der evangelischen Kirche ist der Stand der Aufarbeitung regional verschieden. Bekannt sind bislang 479 Fälle, in denen sich Betroffene selbst an Ansprechpartner der Kirche gewandt hatten.
Erzbistum Köln stellt Strafanzeige gegen ehemaligen Priester
Köln (epd). Ein wegen sexuellen Missbrauchs aus dem Klerikerstand entlassener Pfarrer aus Kamerun hat unter falschen Angaben als Seelsorger in katholischen Gemeinden des Erzbistums Köln gearbeitet. Gegen den 2013 in seinem Heimatland laisierten Priester sei Strafanzeige wegen Betrugs erstattet worden, teilte das Erzbistum am 16. Dezember in Köln mit. Der Mann hatte den Angaben nach falsche und ungültige Dokumente vorgelegt, um Vertretungen etwa in der französischsprachigen Seelsorgestelle Köln-Bonn übernommen zu können.
"Wir wurden vorsätzlich getäuscht"
Das Erzbistum gehe auch kirchenrechtlich gegen den Mann vor. "Wir wurden vorsätzlich getäuscht", sagte der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge-Personal, Pfarrer Mike Kolb. "Dieser Fall zeigt, dass es trotz klarer und transparenter Verfahrenswege eine Lücke gegeben hat." So seien die vatikanische Glaubens- sowie die Bischofskongregation darüber verständigt worden, dass der emeritierte Bischof von Bertoua trotz der Laisierung des Mannes Empfehlungsschreiben für ihn ausgestellt habe.
Den Hinweis auf die vorsätzliche Täuschung des Mannes gab den Angaben nach der Apostolische Nuntius. Weitere Kenntnisse über die Hintergründe, die seinerzeit zur Entlassung aus dem Klerikerstand führten, lägen dem Erzbistum nicht vor, erklärte ein Sprecher des Erzbistums. Ebenso wenig gebe es in diesem Zusammenhang Hinweise auf mögliche Missbrauchsfälle in Deutschland. Alle Gemeinden, in denen Ex-Priester aus dem Erzbistum Bertoua tätig war, seien informiert und Kontaktdaten für Ansprechpersonen zum Thema Missbrauch gegeben worden.
Theologieprofessorin Gräb-Schmidt in Ethikrat berufen

epd-bild / Norbert Neetz
Berlin (epd). Die Tübinger Theologieprofessorin Elisabeth Gräb-Schmidt ist in den Deutschen Ethikrat berufen worden. Die 62-Jährige wurde auf Vorschlag der Bundesregierung von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ernannt, wie der Ethikrat am 12. Dezember in Berlin mitteilte. Gräb-Schmidt ist Professorin für Systematische Theologie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und sitzt seit 2013 im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt auf ethischen Fragestellungen etwa in der Gentechnologie.
Gräb-Schmidt folgt auf Martin Hein, Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, der zum 12. November nach Ablauf seiner Amtszeit aus dem Deutschen Ethikrat ausgeschieden war. Der Ethikrat beschäftigt sich mit gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen, die einer besonderen ethischen Würdigung bedürfen. Darunter fielen in der Vergangenheit die Diskussion über Gen-Forschung wie das Klonen von Tieren und Stammzellenforschung, aber auch Themen wie Datenschutz, Organspende und Sterbehilfe. Dem Rat gehören 26 Mitglieder aus Wissenschaft, Gesellschaft und den Kirchen an. Der evangelische Theologe Peter Dabrock ist der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden feiert 50-jähriges Bestehen
Bonn (epd). Die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Die 31 Mitgliedsorganisationen organisieren in diesem und im kommenden Jahr 50 Veranstaltungen in Form von Vorträgen Seminaren, Tagungen und Studienfahrten, wie die AGDF am 12. Dezember in Bonn ankündigte. Dabei gehe es bis September kommenden Jahres bundesweit um aktuelle Entwicklungen in der Friedensbewegung, um Rüstungsexporte und Aufrüstung, zivile Konfliktbearbeitung und um die Historie der Aktionsgemeinschaft. Eine Übersicht aller Jubiläumsveranstaltungen steht online.
Für den 19. März lädt beispielsweise die Kölner Melanchthon-Akademie zu einem Vortrag von Karsten Grabo ein. Der Mitarbeiter der Studie der Konrad Adenauer Stiftung "Mit Haltung gegen Populismus" spricht über populistische Bewegungen und Parteien in Europa.
Christliche Friedensarbeit
Am 28. und 29. März findet die zeitgeschichtliche Tagung "Christliche Friedensarbeit hat Geschichte" in Bonn statt, bei der Friedensengagierte und Historiker über die Friedensbewegung und ökumenischer Friedensarbeit vor dem Hintergrund der Umbrüche dieser Jahrzehnte reflektieren wollen. Dabei geht es auch um die Gründung der AGDF, um ihre Rolle in der Friedensbewegung der 1980er Jahre sowie um die christliche Friedensarbeit in der DDR und nach 1989.
Am 3. und 4. Mai gibt es in Berlin in Kooperation mit der Evangelischen Akademie zu Berlin die Tagung "Miteinander aktiv! Friedensdienste in Zeiten von Populismus und Fremdenfeindlichkeit". Am 18. Mai stehen die AGDF selbst und ihre 50-jährige Geschichte im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
Die AGDF mit Sitz in Bonn ist ein Zusammenschluss von 31 Organisationen und Institutionen. Die Mitglieder des Friedensverbandes leisten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Arbeitsprogrammen im In- und Ausland Friedensarbeit.
Mit Eintrittskarte in den Heiligabend-Gottesdienst

epd-bild/Stefan Arend
Essen, Düsseldorf (epd). Ungewöhnliche Wege beschreitet die evangelische Kirchengemeinde Essen-Haarzopf dieses Jahr bei den Gottesdiensten zu Heiligabend. Weil im vergangenen Jahr einige Besucher am 24. Dezember wegen Überfüllung der Kirche oder des Gemeindezentrums abgewiesen werden mussten, vergibt die Kirchengemeinde jetzt Eintrittskarten für die Gottesdienste. Davon betroffen sind drei Gottesdienste in der Kirche Haarzopf (14.30, 16 und 18 Uhr) sowie zwei Gottesdienste im Gemeindezentrum Fulerum (14.30, 16 Uhr). Die Christmette um 23 Uhr im Gemeindezentrum ist von dieser Regelung ausgenommen, weil um diese Uhrzeit erfahrungsgemäß nicht so viele Menschen kommen.
Pastorin Anne Simon ist sich bewusst, dass die Gemeinde mit dem Prozedere Neuland betritt. Deshalb hat sie das Verfahren auch auf den Internetseiten der Gemeinde, die rund 2.900 Mitglieder zählt, noch einmal ausführlich erklärt. Es gehe nicht darum, irgendwelche Besucher "vom Gottesdienst auszuschließen", sagte sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ziel sei es, unschöne Szenen wie im Vorjahr zu vermeiden, als es am Eingang zur Kirche zu Wortgefechten und Pöbeleien kam, weil nicht mehr jeder Besucher in die Kirche kommen konnte.
Zudem könnten die Kirchgänger auch nicht in den Gängen stehen, erklärt Simon. Das verböten die Sicherheitsauflagen, die nach dem Loveparade-Unglück von Duisburg und den diversen Terroranschlägen im In- und Ausland verschärft worden seien. Rettungswege müssten frei gehalten werden. Die Kirche in Haarzopf bietet rund 330 Gläubigen Platz, das Gemeindezentrum Fulerum hat 170 Plätze. Mit der neuen Regelung wolle man "Enttäuschung, Ratlosigkeit und Ärgernis" bei den Gläubigen verhindern. Die Karten sind unter anderem im Gemeindebüro oder nach den Adventsgottesdiensten bei den Presbytern zu erhalten.
Und wer keine Karte für Heiligabend mehr bekommt, der könne ja auch am Ersten Weihnachtsfeiertag in den Gottesdienst kommen, betont Simon. Da sei dann wieder genug Platz für alle. Ob das neue Verfahren ein Erfolg wird, bleibt abzuwarten. Einige Gemeindemitglieder hatten - offenbar aus Trotz - schon angekündigt, ohne Eintrittskarte zu dem Gottesdienst kommen zu wollen.
Bei der Evangelischen Kirche im Rheinland hat man auf jeden Fall Verständnis für das Vorgehen. Das sei eine "sinnvolle und nachvollziehbare Lösung", sagt der Sprecher der Landeskirche, Jens Peter Iven. Die Gemeinden müssten nun einmal den großen Menschenandrang in den Kirchen zu Heiligabend bewältigen und zugleich die Sicherheitsauflagen berücksichtigen. Bislang sei die Gemeinde Essen-Haarzopf allerdings die einzige, die das auf diesem Wege regele. "Andere Gemeinden nehmen dafür einen Sicherheitsdienst", sagt Iven. Die müssten die Leute dann eben abweisen, wenn die Kirche voll ist.
Auf die Mitarbeit eines Sicherheitsdienstes setzt auch die evangelische Johanneskirche in Düsseldorf, die größte evangelische Kirche in der Landeshauptstadt. Dort war es am letzten Heiligabend ebenfalls dazu gekommen, dass etliche Besucher abgewiesen werden mussten. Für seine Gemeinde sei ein Vorgehen wie in Essen-Haarzopf nicht praktikabel, sagt Pfarrer Uwe Vetter. "Wir haben eine Großregion als Einzugsgebiet. Da kann man vorher keine Eintrittskarten ausgeben." Die Johanneskirche hat rund 1.200 Sitzplätze.
Vetter hat Zweifel, ob das in Essen praktizierte Kartensystem das passende Verfahren ist, um den Besucherandrang zu begrenzen. Besser sei es, den Menschen, die abgewiesen werden müssten, dies auf eine "freundliche Art und Weise" zu erklären. Ansonsten müsse der Besucher eben rechtzeitig in die Kirche kommen, um einen Platz zu ergattern. Vetter rät, etwa eine Dreiviertelstunde vorher zu erscheinen.
Bei den katholischen Bistümern der Region findet das Verfahren - zumindest soweit bekannt - bislang keine Nachahmer. Der Kölner Dom könne auch zu Heiligabend ohne Karte besucht werden, erklärt Medienreferent Markus Frädrich. Ein Gottesdienst sei öffentlich und für alle zugänglich, mitunter sei es aber aus organisatorischen Gründen nicht möglich, alle Besucher in die Kirche zu lassen, unterstreicht er. "Die Entscheidung, wie damit sinnvoll umgegangen werden kann, treffen die Gemeinden vor Ort."
Etwas lockerer sieht Ulrich Lota, Sprecher des Bistums Essen, die Sachlage. "Das ist eine Geburtstagsparty. Da können gar nicht genug kommen", sagt er. Zudem hat er Zweifel, dass eine Kirche so strenge Sicherheitsauflagen erfüllen müsse. Die Maßnahme der Essener Gemeinde sieht er deshalb durchaus kritisch. "Ich habe Respekt vor der Entscheidung, würde sie persönlich aber nicht empfehlen."
"Weihnachten soll zu Herzen gehen"

epd-bild/privat
Bonn (epd). Pastoren sollten bei einer Weihnachtspredigt, auf den moralischen Zeigefinger verzichten, findet Oliver Ploch, Pfarrer der Thomas-Kirchengemeinde in Bonn-Bad Godesberg. Zu seinen Gottesdiensten kommen selbst an normalen Sonntagen rund zehn Prozent der Gemeindemitglieder - Rekordwert in Deutschland. Mehrere Hundert Gottesdienstbesucher füllen jeden Sonntag die Bänke und Stühle in seiner Kirche. In seinen Predigten setzt er besonders auf Authentizität.
epd: Herr Ploch, was kann ein Geistlicher an Weihnachten alles falsch machen?
Ploch: An Heiligabend ist die Kirche voll. Das macht Druck und ist für viele Pfarrerinnen und Pfarrer eine Versuchung: Sie wollen dann alles und zu viel sagen. Die Kunst ist aber, das Grundlegende einfach auszudrücken. Am besten in ganz normaler Sprache, konkret und direkt. Es geht nicht darum, das Leid der Welt aufzuzählen, das jeder aus der Tagesschau kennt. Das zieht nur runter. Auch ein biblisch-theologischer Lehrvortrag ist nicht gewünscht oder zu viele gefühlvoll-poetische Worthülsen. Die Frage nach Gott beschäftigt schließlich alle, da werden Antworten erwartet. Meine größte Sorge ist, dass sich jemand langweilt. Deshalb erzähle ich gerne etwas aus dem Alltag oder von dem, was ich mit Gott erlebe.
epd: Sollte auf politische Themen also komplett verzichtet werden?
Ploch: Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Am stärksten ist eine Predigt, wenn sie persönlich ist. Wenn sich ein Pastor stark in der Arbeit mit Geflüchteten engagiert und davon in der Predigt erzählt, dann ist das eine Botschaft, die ihm alle abnehmen. Das ist etwas anderes als ein politisches Statement, das Moral predigt und selbstgerecht daher kommt. Ein wichtiges Thema in diesem Jahr ist die Spaltung unserer Gesellschaft. Einseitige Positionierungen verstärken diese Spaltung nur. Sie vereinfachen und helfen niemandem weiter. Die Predigt soll alle ansprechen, die unter der Kanzel sitzen: Den Studenten, der im Hambacher Forst demonstriert hat, aber auch die Polizistin, die sich ihm gegenüber stellen musste usw. Für jeden und jede ist Jesus Christus geboren. Das verbindet uns.
epd: Was braucht es neben einer guten Predigt noch für einen gelungenen Weihnachtsgottesdienst?
Ploch: Eine feierliche Liturgie, bekannte Weihnachtslieder und ein geschmückter Kirchraum – das reicht völlig. An diesem Abend muss das Rad nicht neu erfunden werden. Die Menschen sehnen sich an Weihnachten nach einem Ritual, das Heimat gibt. Vielen Theologen ist zum Beispiel das Lied "Stille Nacht" zu rührselig. Weihnachten darf und soll aber zu Herzen gehen. Alles andere ist lieblos und unprofessionell.
Koptenbischof Damian: Ägypten hat Heiliger Familie Asyl gewährt

epd-bild/Andreas Fischer
Höxter (epd). Der koptisch-orthodoxe Bischof Anba Damian hat in seiner Weihnachtsbotschaft das Flüchtlingsschicksal der Heiligen Familie betont. Kurz nach seiner Geburt sei Jesus von König Herodes verfolgt worden, schreibt Damian in seiner am 10. Dezember in Höxter veröffentlichten Botschaft. Seine Familie habe ihr Heimatland verlassen müssen. "Ägypten hatte als einziges Land der Heiligen Familie vorübergehendes Asylrecht gewährt", erklärte der koptische Bischof. Im Land der Pharaonen habe die Familie Jesu mehrere Jahre Schutz erhalten.
Der Bischof rief zudem für Frieden unter den Menschen auf. "Nur wenn wir in Frieden miteinander leben, können wir Freude, Hoffnung und Gottvertrauen empfinden", schreibt Damian weiter. Nur durch den Frieden und die Liebe könnten Hass und die damit verbundene Gewalt abgebaut und schließlich überwunden werden.
Die koptisch-orthodoxe Kirche existiert bereits seit dem ersten Jahrhundert nach Christus. In Deutschland zählt sie nach eigenen Angaben etwa 12.000 Mitglieder. Bischof der Diözese für Norddeutschland ist Anba Damian mit Dienstsitz in Höxter-Brenkhausen. Das Kloster feierte im Juni das 25. Gründungsjubiläum. Für Süddeutschland ist der Bischof Michael El Baramousy zuständig, der seinen Sitz im Kloster St. Antonius im hessischen Kröffelbach hat.
Michael Gerber wird Bischof von Fulda

epd-bild/Harald Oppitz/KNA-Bild
Fulda (epd). Michael Gerber (48) wird neuer Bischof des Bistums Fulda. Papst Franziskus habe Gerber nach seiner Wahl durch das Fuldaer Domkapitel zum Nachfolger von Heinz Josef Algermissen ernannt, teilte das Bistum am 13. Dezember mit. Gerber wirkte zuvor in der Erzdiözese Freiburg als Weihbischof. Ein Termin für seine Amtseinführung steht noch nicht fest. Das Bistum wird zunächst noch weiter von Diözesanadministrator Weihbischof Karlheinz Diez geleitet. Bischof Algermissen war im Sommer altersbedingt in den Ruhestand getreten.
Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, gratulierte Gerber zu seinem neuen Amt und wies auf die tief verankerte Ökumene zwischen dem Bistum Fulda und der evangelischen Landeskirche hin. "Diese Tradition gilt es mit Bischof Gerber weiterzuführen. Darauf freue ich mich sehr und spreche eine herzliche Einladung dazu aus", schrieb Hein in seinem Glückwunschbrief.
Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) begrüßte in seinem Gratulationsschreiben die schnelle Ernennung des neuen Bischofs. Kirche und Staat dürften in ihren gemeinsamen Bemühungen, den Frieden zu bewahren und die Gesellschaft zusammenzuhalten, nicht nachlassen. Es sei eine gemeinsame Aufgabe, den Menschen Halt und Orientierung zu geben.
"Leidenschaftlicher Seelsorger"
Gerbers künftiger Amtskollege aus dem benachbarten Bistum Limburg, Georg Bätzing, betonte, der neue Bischof sei ein leidenschaftlicher Seelsorger, der nahe an den Menschen und ihren Fragen sei. Er lebe aus geistlichen Quellen und suche täglich im Gebet die Verbindung zu Gott.
Gerber selbst gab sich in einem Begrüßungsschreiben an die Katholiken des Bistums Fulda überzeugt, dass in der Kirche nur das gelingen könne, was vom Gebet getragen sei. Dies habe er in den vergangenen 22 Jahren seines Priesterdienstes und den fünf Jahren als Weihbischof immer wieder auf beeindruckende Weise erfahren können.
Ökumenisches Friedensgebet lenkt Blick auf Lage im Nordosten Indiens
Aachen (epd). Die katholischen Missionswerke Missio Aachen und Missio München sowie das Evangelische Missionswerk (EMW) in Deutschland haben das ökumenischen Friedensgebet für 2019 veröffentlicht. Im kommenden Jahr steht die politische Lage und Diskriminierung der indigenen Völker im Nordosten Indiens im Mittelpunkt, wie Missio Aachen am 14. Dezember mitteilte. Autorin des Gebetes ist die evangelische Theologin Imtiwala Imchen. Sie leitet das Zentrum für Friedensforschung und Friedensaktionen (CCPRA) am Clark Theological College in Nagaland im Nordosten Indiens.
Nordostindien umfasst den Angaben nach die sieben Bundesstaaten Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland und Tripura. Dort lebten rund 45 Millionen Menschen an der Grenze zu China, Bangladesch und Myanmar in einer ethnisch und kulturell vielfältigen Region. Viele von ihnen gehörten kleinen Volksgruppen mit unterschiedlichen Sprachen und Gebräuchen an. Oft würden sie von der Zentralregierung und der indischen Mehrheitskultur schikaniert und unterdrückt, etwa durch die Ausbeutung von Bodenschätzen oder den Bau großer Staudämme. So käme es immer wieder zu Kämpfen für mehr Autonomie von Indien. Doch auch Auseinandersetzungen zwischen Stammesgruppen um die lokale Vorherrschaft sorgten für latente Spannungen, erklärte Missio.
Die Einwohner der Ebenen Assams, Tripuras und des Manipur-Tals sind demnach mehrheitlich Hindus. Daneben gibt es dort eine große muslimische Minderheit. In Nagaland, Meghalaya und Mizoram sowie der Bergregion Manipurs ist die Mehrheit der Bevölkerung christlich, wie es hieß.
Das ökumenische Friedensgebet erscheint den Angaben zufolge in einer bundesweiten Auflage von rund 200.000 Stück. Es richtet sich an Gemeinden, Religionslehrer und Betreuer von Jugendgruppen, die in Gottesdiensten, in Kirchengruppen oder im Schulunterricht das Thema Frieden behandeln wollen.
Motto der Interkulturellen Woche: "Zusammen leben, zusammen wachsen"
Frankfurt a.M./Bonn (epd). "Zusammen leben, zusammen wachsen" lautet das Motto der Interkulturellen Woche 2019, die vom 22. bis 29. September bundesweit stattfindet. Dies teilte der Ökumenische Vorbereitungsausschuss der Interkulturellen Woche am 14. Dezember in Frankfurt am Main mit. Der Slogan solle auf die gegenwärtige Situation als Einwanderungsland Bezug nehmen ("zusammen leben") und zugleich auf eine zukünftige Perspektive ("zusammen wachsen"). Deutschlandweit finden jedes Jahr im September rund 5.000 Veranstaltungen in mehr als 500 Orten statt.
Die Interkulturelle Woche ist eine bundesweite Initiative der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie der Griechisch-Orthodoxen Metropolie und besteht seit 1975. Sie wird mitgetragen von Kommunen, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Migrantenorganisationen und zivilgesellschaftlichen Institutionen. Der Veranstaltungszeitraum schließt den ökumenischen "Tag des Flüchtlings" am 27.9. sowie den katholischen Welttag des Migranten und Flüchtlings (letzter Sonntag im September) ein.
180.000 Euro in evangelischer Kirchenverwaltung veruntreut
München (epd). In einer Kirchenverwaltung in München sind 180.000 Euro veruntreut worden. Der Betrug war bereits im Juli im Kirchengemeindeamt des evangelisch-lutherischen Dekanats München aufgefallen. Das Arbeitsverhältnis mit einer beschuldigten Person wurde beendet und Strafanzeige gestellt. Derzeit denke man über noch engere Kontrollen der Mitarbeiter nach, sagte der Dekan für den Münchner Westen, Christoph Jahnel, am 10. Dezember dem Evangelischen Pressedienst (epd).
"Wir wollen keine Kultur des Misstrauens, aber wir brauchen eine Kultur der engen Kontrolle", sagte Jahnel, der die Aufsicht über das Kirchengemeindeamt führt. Überweisungen müssten künftig abteilungsübergreifend geprüft werden. Auch Führungszeugnisse für alle Mitarbeiter seien im Gespräch. Hundertprozentige Sicherheit gegen kriminelle Machenschaften könne es aber nie geben. "Wir können so etwas nicht ausschließen, aber wir wollen uns damit auch nicht abfinden", sagte er.
Kirchengemeinden nicht betroffen
Im Juli hätten die Verantwortlichen den Betrug aufgedeckt, seither liege der Fall, über den zunächst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte, bei der Staatsanwaltschaft. Jahnel betonte, dass von der Veruntreuung weder Finanzanlagen noch Rücklagen der 66 Münchner Kirchengemeinden betroffen seien. Er sei zuversichtlich, dass nach Abschluss des Verfahrens die gesamte Summe über eine Versicherung gedeckt werde.
Erst 2014 war das Kirchengemeindeamt von einem Finanzskandal erschüttert worden. Rund sechs Millionen Euro gingen damals durch riskante Anlagegeschäfte verloren, weil interne Kontrollen versagt hatten. Unter anderem wurde damals ein Sechs-Augen-Prinzip für Finanztransaktionen eingeführt. Gegen den verantwortlichen Mitarbeiter und den damaligen Geschäftsführer wurde Anzeige erstattet.
Dass die diesmal beschuldigte Person das Sechs-Augen-Prinzip unterlaufen konnte, habe mit ihrer "sehr hohen kriminellen Energie" zu tun, sagte Jahnel. Ob die Summe in wenigen großen oder vielen kleinen Beträgen veruntreut wurde, wollte er mit Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht sagen.
Umwelt
"Tausend kleine Schritte"

epd-bild / Gustavo Alabiso
Kattowitz (epd). Die Sorge der Bundesumweltministerin vor mangelnder Bewegung während der Gipfeltage verflüchtigte sich schnell. Auf ihren Wegen durch das weitläufige Konferenzareal führte Svenja Schulze an einem Tag sogar einen Schrittzähler mit. Ergebnis der Messung: Die SPD-Politikerin, die erstmals an einer UN-Klimakonferenz teilnahm, legte 5,7 Kilometer zwischen den Sitzungssälen zurück, wie sie berichtete.
Wie weit der Klimagipfel von Kattowitz die Menschheit im Kampf gegen die Erderwärmung vorangebracht hat, lässt sich wohl nicht ganz so exakt bestimmen. Der polnische Konferenzpräsident Michal Kurtaky sieht "tausend kleine Schritte nach vorne". Die Delegierten könnten stolz sein auf das beschlossene Regelbuch zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015. Mancher Klimaaktivist gab sich zum Abschluss der zweiwöchigen Konferenz jedoch skeptischer: Das Ergebnis sei "sehr weit von einer adäquaten Antwort" auf die Klimakrise entfernt, beklagte BUND-Chef Hubert Weiger.
Transparenzregeln
Immerhin wurden wichtige Voraussetzungen geschaffen, damit das Pariser Klimaabkommen auch tatsächlich greifen kann: Transparenzregeln für alle Länder. Die Berichtspflichten und gemeinsamen Standards zur Erfassung des Treibhausgasausstoßes sind eines der zentralen Elemente in der klimapolitischen Architektur, die das Abkommen entwirft.
Denn die nationalen Ziele zur CO2-Reduktionen, die die Staaten turnusgemäß vorlegen müssen, sind freiwillig. Die Idee hinter der Transparenz: Wenn alle Staaten ihren Treibhausgas-Ausstoß auf einheitliche Weise erfassen und ihre Klimaschutzpläne nach identischen Vorgaben erstellen, dann lassen sich ihre Anstrengungen klar vergleichen. Wer zurückfällt steht gleichsam am Pranger. Das Abkommen setzt also auf Selbstdisziplinierung.
Damit gelten also künftig auch für den größten CO2-Produzenten der Welt - China - die gleichen strikten Standards, die schon im 1997 verabschiedeten Kyoto-Protokoll für die Industrieländer festgeschrieben wurden. Chinas Rolle bei den Kattowitzer Gesprächen wurde in deutschen Verhandlungskreisen als konstruktiv gelobt. Es habe sich bestätigt, dass die Volksrepublik - der größte Kohlendioxid der Welt - anders als die USA am Klimapakt von Paris festhielten.
Klimakonferenzen bestehen aus einem komplexen Geflecht von Verhandlungssträngen und ihren Querverbindungen, das nur wenige Experten voll erfassen können: Wissenschaftliche, wirtschaftliche und juristische Aspekte greifen auf schwer durchschaubare Weise ineinander. Die politischen Entscheider sind vielleicht noch mehr als in anderen Handlungsfeldern von der Expertise ihrer Berater und Ministerialbeamten abhängig, die das Thema seit Jahrzehnten verfolgen.
"Fossil"
Umso wichtiger ist deshalb bei Klimagipfeln die Rolle der Konferenzpräsidentschaft. Sie soll am Ende "das große Bild" in den Blick nehmen und Beschlussvorlagen erarbeiten, in den sich alle mehr als 190 Staaten der Welt wiedererkennen können. Der diesjährige Gipfelchef, Polens Umweltstaatsekretär Michal Kurtyka, mache einen "exzellenten Job", hieß es in der Schlussphase des Gipfels aus deutschen Verhandlungskreisen. Das ist bemerkenswert, weil das Kohleland Polen in Europa als Klimaschutz-Bremser gilt. Deshalb war zunächst offen, mit wie viel Engagement sich die Konferenzleitung in die Arbeit stürzen würde.
Und die Rolle Deutschlands? Der einstige Klimaschutzvorreiter musste sich von Umweltschützern viel Kritik anhören in den vergangenen zwei Wochen: Aktivisten verliehen der Bundesregierung die Negativ-Auszeichnung "Fossil des Tages", Germanwatch stufte das Land in seinem jährlichen Klimaschutz-Index ins Mittelfeld hinab. Grund: Weiter liegt kein Plan zum Ausstieg aus der Braunkohle vor, und das Land verpasst seine selbstgesteckten CO2-Reduktionsziele für 2020.
Dafür brachte die Bundesregierung einen prall gefüllten Geldsack nach Kattowitz zur Unterstützung armer Länder mit: Zusätzliche 1,5 Milliarden Euro für den Green Climate Fund, rund 140 Millionen Euro für weitere Töpfe. "Deutschland hat sich hier in Kattowitz mit seinen Finanzzusagen stark eingebracht", lobt der der Klimaexperte der Hilfsorganisation Care, Sven Harmeling. Das dürfe trotz der mangelhaften CO2-Bilanz der Bundesregierung nicht schlechtgeredet werden.
Breyer: Klimagipfel schließt Lücke im Kampf gegen Erderhitzung

epd-bild/Norbert Neetz
Schwerte/Kattowitz (epd). Der Umweltexperte der westfälischen Kirche, Klaus Breyer, wertet das beim Weltklimagipfel in Polen beschlossene Regelwerk zum Klimaschutz als einen Erfolg. Seit dem Abkommen von Paris 2015 habe der internationale Klimaschutz Ziele, aber keine Regeln gehabt, sagte Breyer am 16. Dezember dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das damalige Übereinkommen von 195 Staaten, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, sei nicht viel mehr als eine "wolkige Absichtserklärung" gewesen, ohne konkrete Angaben, wie die Anstrengungen der einzelnen Länder gemessen und bewertet werden sollten. "Diese gravierende Lücke konnte jetzt der Weltklimagipfel in Kattowitz schließen."
Durch ein für alle geltendes Regelwerk würden nun die nationalen Anstrengungen für Klimaschutz transparent und vergleichbar, erklärte der Umweltexperte. "Nun kann beurteilt werden, mit welchem Ambitionsniveau die Staaten vorankommen und wo dringender Nachsteuerungsbedarf besteht." Wichtig sei, dass das beschlossene Regelwerk zur "Großbaustelle Klimaschutz", das auch wichtige Finanzierungsmechanismen für die Entwicklungsländer enthält, zügig und zielgerichtet umgesetzt wird, mahnte Breyer.
"Die Lage bleibt sehr ernst"
"Die Lage bleibt sehr ernst", sagte der Leiter des landeskirchlichen Instituts für Kirche und Gesellschaft in Schwerte. So seien die bisher von den Staaten vorgelegten nationalen Klimaprogramme "vollkommend unzureichend" und würden zu einer Temperaturerhöhung von bis zu drei Grad Celsius führen, wenn sie nicht umgehend nachgebessert werden. Das gelte vor allem für Deutschland. "Denn die deutschen Klimaziele werden 2020 drastisch verfehlt", sagte er.
Er forderte vom Bund den zügigen Ausstieg aus der Kohleverstrohmung, verbunden mit einem sozial verträglichen Strukturwandel, sowie eine Verkehrswende. Im Gebäudebereich müssten zudem dringend Wege gefunden werden, um Investitionen in bezahlbaren Wohnraum mit Klimaschutz zu verknüpfen. "Auf dieses Weise können die deutschen Klimaziele doch noch zeitnah erreicht werden", unterstrich der landeskirchliche Umweltexperte.
Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen hatten sich am die Staatenvertreter bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz auf ein Paket zur Umsetzung des Pariser Klimavertrages geeinigt. Unter anderem vereinbarte der Gipfel Transparenzregeln und Standards zur CO2-Erfassung, damit die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten miteinander vergleichbar sind. Arme Länder erhalten allerdings Zeit, um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
Die Beschlüsse des Klimagipfels von Kattowitz
Kattowitz (epd). Beim Klimagipfel in Kattowitz haben sich Vertreter aus mehr 190 Staaten auf ein Paket geeinigt, das die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015 voranbringen soll: das Pariser Regelbuch. Die zentralen Punkte im Überblick:
TRANSPARENZ: Ab 2024 gelten für alle Staaten einheitliche Transparenzregeln und Standards zur CO2-Erfassung. Dadurch sollen die Fortschritte der einzelnen Länder bei der Verfolgung ihrer CO2-Reduktionsziele vergleichbar sein. Die Industrieländer hatten in Kattowitz darauf gedrungen, dass Schwellenländer wie China den Treibhausgas-Aussstoß nach den gleichen Methoden wie sie selbst erfassen. Entwicklungsländern wird eine Übergangszeit eingeräumt, um die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen.
FINANZEN: Im Pariser Klimaabkommen wird das Versprechen der Industrieländer festgehalten, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für den Kampf gegen die Erderwärmung in armen Staaten bereitzustellen. Diese Summe soll bis 2025 fließen. Bereits vor 2025 soll ein neues Finanzierungsziel festgelegt werden. In Kattowitz verlangten die Entwicklungsstaaten, dass sie regelmäßig und verlässlich über die Aufstockung der Mittel informiert werden, um Planungssicherheit zu haben. Beschlossen wurde nun unter anderem, dass die Industrieländer darüber Berichte im Zwei-Jahres-Turnus abgeben. Klimaschützer kritisieren, dass etwa auch Kredite als Klimahilfen angerechnet werden können.
SCHÄDEN UND VERLUSTE: Die Entwicklungsländer beklagen seit Jahren, dass Schäden und Verluste durch den Klimawandel bei den Verhandlungen nicht ausreichend anerkannt werden. Über die bisherigen Klima-Hilfen hinaus fordern sie für die Bewältigung der Klimawandel-Folgen gesonderte Unterstützung. Laut der Übereinkunft von Kattowitz soll das Thema künftig mehr Gewicht bekommen: Bei der Bilanz der globalen Klimaschutz-Anstrengungen ("Global Stocktake"), die laut Paris-Vertrag alle fünf Jahre erfolgen soll, werden Schäden und Verluste künftig berücksichtigt. Finanzielle Unterstützung wurde in diesem Bereich jedoch nicht auf den Weg gebracht.
KÜNFTIGE KLIMAZIELE: In Paris hatten die Staaten freiwillige, selbstgesetzte Ziele zur Eindämmung ihrer CO2-Emissionen eingereicht. Damals wurde vereinbart, dass bis 2020 aktualisierte Ziele vorgelegt werden sollen. Die Kattowitzer Beschlüsse bekräftigen diese Aufforderung - eine Formulierung, dass diese Ziele deutlich verschärft werden müssen, wie es Klimaschützer gefordert hatten, findet sich in dem Text nicht. Zusätzliche Anstrengungen zur Erhöhung der Klimaziele hatte während der Konferenz allerdings eine «Koalition der Ehrgeizigen», darunter die EU mit Deutschland sowie kleine Inselstaaten, zugesichert.
BEZUG ZUM IPCC-BERICHT: Das Abschlussdokument von Kattowitz enthält auch eine Anerkennung des jüngsten Sonderberichtes des Weltklimarates (IPCC), in dem verstärkter Einsatz zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles angemahnt wird. Dieser Punkt war in den Verhandlungen besonders umstritten gewesen. Die USA, Saudi-Arabien, Kuwait und Russland hatten sich dagegen positioniert, dass der Gipfel den Report "begrüßt", sondern darauf bestanden, dass er nur "zur Kenntnis genommen" wird. Als Kompromissformel findet sich nun im Beschluss, dass die "rechtzeitige Fertigstellung des Berichtes begrüßt" wird.
EKD-Ratsvorsitzender mahnt Veränderung des Lebensstils an

epd-bild/Norbert Neetz
Kattowitz (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sieht die Kirchen beim Klimaschutz in herausgehobener Verantwortung. "Das Besondere der Kirche ist, dass sie nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen erreicht", sagte Bedford-Strohm dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Rande des Klimagipfels in Kattowitz. Deshalb könne sie sich besonders wirksam für die von Gott erschaffene Natur einsetzen.
"Unser Ziel muss eine Veränderung des Lebensstils sein", führte Bedford-Strohm aus. "Eine Vision des guten Lebens!" Dabei könne die Kirche entscheidend mitwirken.
Bedford-Strohm hob auch hervor, dass die Kirchen ein weltweites Netzwerk bildeten, das den Kampf gegen die Erderwärmung voranbringen könne. "Dieses Netzwerk ist universell und bunt und kann vitale Akteure einer globalen Zivilgesellschaft zusammenführen."
"Signal gesendet"
Bei ihrem Klimaschutz-Engagement wollten die Kirchen enger mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, kündigte der Ratsvorsitzende an. "Wir werden künftig gemeinsam auftreten und an die Politik appellieren", erklärte Bedford-Strohm mit Blick auf ein Symposium von Klima-Experten, Philosophen und Kirchenrepräsentanten, bei dem am 10. Dezember ein "Memorandum von Kattowitz" verabschiedet wurde. "Hier in Kattowitz haben wir ein Signal gesendet", betonte der Ratsvorsitzende.
Zum Stand der Verhandlungen beim Weltklimagipfel äußerte sich Bedford-Strohm beunruhigt. "Wir machen uns große Sorgen, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens hier in Kattowitz Stück für Stück wieder entwertet werden", sagte er. Der Gipfel müsse unbedingt wirksame Kontrollmechanismen für die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten verabschieden.
Kritisch bewertete der Ratsvorsitzende auch die deutsche Klimaschutzpolitik der vergangenen Jahre: "Es ist enttäuschend, dass es der Bundesregierung nicht gelingt, ihr Ziel zur CO2-Minderung für 2020 zu erreichen." Jetzt müssten die Bemühungen um einen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft verstärkt werden, forderte der bayerische Landesbischof. Diese Veränderungen müssten allerdings sozialverträglich gestaltet werden, erklärte er vor dem Hintergrund der Debatte um den Kohleausstieg.
Umfrage: Deutschland investiert zu wenig in Klimawandel-Schutz
Köln (epd). Deutschland gibt nach einer WDR-Umfrage zu wenig Geld aus, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Auf Bundes- und Länderebene seien zum Beispiel für Deichbau, Abwassermanagement, Begrünung der Städte und andere Maßnahmen zur Klimaanpassung in den vergangenen fünf Jahren rund drei Milliarden Euro aufgewendet worden, berichtete der Sender am 10. Dezember. Diese Zahl ergebe sich aus Antworten der Umweltministerien von Bund und Ländern und bedeute einen durchschnittlichen Investitionsaufwand in Höhe von etwa 600 Millionen Euro pro Jahr. Das Umweltbundesamt (UBA) habe hingegen bereits 2012 den Bedarf auf rund fünf Milliarden Euro pro Jahr eingeschätzt.
Petra Mahrenholz, Leiterin des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung beim Umweltbundesamt (UBA), sieht daher bei der Anpassung an den Klimawandel eine Finanzierungslücke. "Wenn Deutschland genug tun würde, dann gäbe es weder Schäden im Hochwasserschutz, noch hätten wir Hitzetote zu beklagen", sagte sie dem WDR.
NRW-Umweltministerin räumt Nachholbedarf ein
Auch NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) bestätigte gegenüber dem Sender einen Nachholbedarf. "Wir werden Klimaanpassungsmaßnahmen deutlich verstärken müssen, denn in diesem Jahr haben wir gesehen, dass wir tatsächlich im Klimawandel stecken", sagte die Düsseldorfer Ministerin, die zur deutschen Delegation bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz gehört.
In den vergangenen Jahren sei das klimaschädliche CO2 in der Debatte aus dem Blick geraten, sagte Heinen-Esser im WDR5-Radio. Die aktuelle Diskussion in Deutschland drehe sich vor allem um Stickoxid und Diesel-Autos und dürfe nicht dazu führen, dass Menschen sich künftig einfach Benziner kauften und damit natürlich auch keinen guten Beitrag zum Klima leisteten.
Die Umweltministerin räumte mit Blick auf NRW Nachholbedarf in Sachen erneuerbare Energien ein. Sie bekräftigte den Willen der Landesregierung, den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung "positiv zu begleiten" und sich für erneuerbare Energien einzusetzen. Aber es müsse der Kostenrahmen, der Ausgleich zwischen Beteiligten und die Diskussion mit Bürgern im Blick bleiben. Denn erneuerbare Energien bedeuteten unter anderem den Bau von Stromtrassen.
Bund sieht keine Versäumnisse
Dagegen sieht das Bundesumweltministerium in den Ergebnissen der WDR-Umfrage keine Hinweise für Versäumnisse. "Deutschland ist auf den Klimawandel gut vorbereitet", erklärte es auf Anfrage des Senders. Der Erfolg von Klimaanpassungsmaßnahmen lasse sich nicht ausschließlich an den Ausgaben bemessen.
Der Deutsche Städtetag hingegen fordert eine stärkere Unterstützung insbesondere der Kommunen. Dort seien die Folgen des Klimawandels sehr konkret zu spüren, und viele Maßnahmen zur Klimaanpassung würden auf lokaler Ebene angestoßen. Zwar gebe es für die Kommunen Hilfen aus dem Programm der "Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel". Doch dieses Programm sei deutlich unterdotiert, kritisierte Detlef Raphael vom Städtetag.
Der UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz war am 10. Dezember von einem Streit über den Umgang mit dem jüngsten Sonderbericht des Weltklimarates (IPCC) überschattet worden. In dem Report hatten die Wissenschaftler die Notwendigkeit verstärkter Klimaschutzanstrengungen betont, um die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. Die Bundesregierung war im auf dem Gipfel vorgestellten Weltklima-Index der Organisation Germanwatch von Platz 22 auf Platz 27 zurückgefallen, vor allem wegen des hohen Braunkohle-Verbrauchs. Bis Freitag beraten Vertreter von mehr als 190 Ländern in Kattowitz über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens von 2015.
Kirchen nehmen Abschied von der Kohle

Bistum Essen/Simon Wiggen
Bottrop (epd). Am 20. Dezember sieht die Heilige Barbara zum ersten Mal seit Jahren wieder Tageslicht. Zurzeit steht die Schutzpatronin der Bergleute noch in 1.200 Metern Tiefe auf der siebten Sohle des Bergwerks Prosper Haniel in Bottrop. Für den großen Abschiedsgottesdienst, mit dem sich Bergleute, Kirchenvertreter und Politiker vom Steinkohlebergbau in Deutschland verabschieden, wird die Figur ans Tageslicht geholt und feierlich in den Essener Dom getragen. Einen Tag später, am 21. Dezember, wird das letzte aktive Steinkohlebergwerk Deutschlands offiziell mit einem großen Festakt geschlossen.
Die Kirchen in Nordrhein-Westfalen begleiteten den Abschied von der Kohle mit zahlreichen Gottesdiensten und Tagungen, der Gottesdienst in Essen ist der feierliche Abschluss. Seit Jahren besteht zwischen Bergbau und Kirche eine enge Verbindung. Wie eng, das verdeutlicht eine Anekdote von Michael Schlagheck, Direktor der katholischen Akademie Wolfsburg in Mülheim an der Ruhr: Die Barbarafigur sollte schon für die Generalprobe des Abschiedsgottesdienstes nach Essen gebracht werden. "Doch die Verantwortlichen sagten: Es geht nicht, dass die Bergleute an dem Tag zur Arbeit ins Bergwerk runterfahren und die Barbara weg ist."
Traditionsreiche Verbindung
Die Landessozialpfarrerin der Evangelischen Kirche von Westfalen, Heike Hilgendiek, erklärt die Nähe vieler Bergleute zur Kirche mit der Arbeit unter Tage: "Sie hat viele Menschen nachdenklich gemacht, weil man dort besonderen Gefahren ausgesetzt ist und Orte sieht, die Menschen normalerweise nicht zu Gesicht bekommen."
Einen festen Austausch zwischen Kirche und Bergbau gibt es seit 1950 in der Gemeinsamen Sozialarbeit der Konfessionen im Bergbau, heute "Gemeinsam für eine Soziale Arbeitswelt" (GSA). Evangelische und katholische Kirche bieten Seminare für Mitarbeiter des Zechenbetreibers RAG an, in denen es um Arbeitsbedingungen, Kommunikation und das Miteinander im Betrieb geht.
Kampf um sozialverträglichen Strukturwandel
Auch im langen Kampf um die Steinkohle standen die Kirchen an der Seite der Bergleute und setzten sich für einen sozialverträglichen Strukturwandel ein. Als zeitgleich zur Gründung des Ruhrbistums 1958 auch die erste Welle des Zechensterbens im Revier einsetzte, lief der erste Ruhrbischof Franz Hengsbach bei Demonstrationen mit und besuchte Bergleute unter Tage. Das brachte ihm die Ernennung zum Ehrenbergmann ein.
Auch der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) am Niederrhein geriet nach seiner Gründung Anfang der 90er Jahre in die Auseinandersetzung um die Schließung der Zechen. "Wir haben die Bergleute zum Wohl der Region, wo die Bergwerke neben der Stahlindustrie der wichtigste Arbeitgeber waren, beim Kampf um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze unterstützt", berichtet der Duisburger Pfarrer Jürgen Widera. Vielen Menschen seien bis heute die großen Solidaritätsgottesdienste in Erinnerung. Über die Besuche in den Zechen seien aber auch persönliche Kontakte entstanden, erinnert sich Widera, der Kinder von Bergleuten getauft und Angehörige beerdigt hat.
DNA des Ruhrgebiets
Für die Arbeit des KDA bedeutet das Ende der Kohle einen tiefen Einschnitt. Die Kirche müsse für ihr künftiges Engagement in der Arbeitswelt neue Formen abseits von Großbetrieben finden, sagt Widera. Wenn die Industrie- und Sozialpfarrer früher eine Zeche besuchten, erreichten sie nach den Worten von Sozialpfarrerin Hilgendiek bis zu 2.000 Leute. "Heute gebe es eher exemplarische Kontakte zu kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie zu Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden."
Bewährte Formate der GSA seien schon auf andere Berufsgruppen übertragen worden, etwa in Seminaren für Mitarbeitende in Krankenhäusern oder sozialen Einrichtungen, erläutert Hilgendiek. Kirchliche Akademien bieten zudem Seminare für Manager des Industriekonzerns Evonik zum Thema Wirtschaftsethik an. Aber auch die klassische GSA soll in den nächsten drei Jahren in reduziertem Umfang weitergehen und sich mit den Ewigkeitsaufgaben des Bergbaus beschäftigen, zu denen die Grubenwassererhaltung und die Grundwasserreinigung gehören.
Bestand haben auch andere Traditionen, etwa der Kreuzweg auf der Halde Haniel am Karfreitag. "Wir wollen keine Traditionen aufrechterhalten, die keine Relevanz mehr haben für die Region", sagt Schlagheck. "Aber wir leben Zukunft auch ein Stück weit aus Herkunft." Und Werte des Bergbaus wie Solidarität, Toleranz und Offenheit für Fremde seien in die DNA des Ruhrgebiets übergegangen.
Auch die Heilige Barbara hat nach dem Abschiedsgottesdienst im Essener Dom nicht ausgedient: Sie kehrt zurück in die Tiefen von Prosper Haniel, wo zum Festakt am 21. Dezember die symbolischen letzten Kohlen gefördert werden. In den Wochen und Monaten danach sind schließlich noch einige Bergleute in der Zeche beschäftigt - und wollen nicht auf den Schutz der Heiligen Barbara verzichten.
Schüler demonstrieren für Klimaschutz
Frankfurt a.M., Köln (epd). In mehreren deutschen Städten sind am 14. Dezember Hunderte Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Kiel, Hamburg, München, Köln, Aachen, Göttingen und weiteren Städten demonstrierten sie unter dem Motto "Friday For Future", wie die Organisatoren auf Twitter mitteilten. Zu den Aktionen anlässlich des UN-Klimagipfels im polnischen Kattowitz hatten unter anderem die Grüne Jugend, die Jugendorganisation des BUND und Greenpeace aufgerufen.
"Uns macht der Klimawandel mehr Angst als Nachsitzen", erklärte die Grüne Jugend in München, wo rund 100 Schüler demonstrierten. In Göttingen kündigte Schülersprecher Hannes Eggers weitere Demonstrationen an. In Kiel demonstrierten 500 junge Menschen vor dem Landtag. Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) ermahnte die Jugendlichen, an ihre Schulen zurückzukehren. Sie würde es begrüßen, wenn das Thema Teil des Unterrichts werde.
Vorbild für die Streikenden sei die junge Schwedin Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigem Schulstreik internationale Medienaufmerksamkeit erlangte, erklärten die Schüler. In Australien und den USA seien bereits Tausende Schülerinnen und Schüler in den Streik gegangen, hieß es weiter. Aktionen seien auch in Großbritannien, Frankreich und Niederlande geplant.
Drei Naturparks siegen in NRW-Landeswettbewerb
Königswinter, Düsseldorf (epd). Die Naturparks in Nordrhein-Westfalen werden vom Land in den Jahren 2019 bis 2021 mit insgesamt rund einer Millionen Euro gefördert. Die Gelder werden im Rahmen des Wettbewerbs "Naturpark. 2021. Nordrhein-Westfalen" vergeben, wie Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am 10. Dezember beim Petersberger Naturpark-Gespräch in Königswinter bei Bonn mitteilte.
Der erste Preis und eine Förderung von 400.000 Euro gehen an den Naturpark Nordeifel für ein Konzept zur Bewahrung des dunklen Nachthimmels. Vermittelt würden der Wert des dunklen Nachthimmels und die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Gesundheit und Biodiversität, erklärte das Ministerium. Eine Förderung von 154.000 Euro bekommt der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge als zweiter Sieger. Er wolle vor allem Familien mit Kindern ansprechen und auf Entdeckertouren durch die nahe Region mitnehmen.
Der Naturpark Siegengebirge landete auf dem dritten Platz und bekommt rund 142.000 Euro. Er habe sich zu seinem 60-jährigen Bestehen neu aufgestellt und schaffe "neue Heimaterlebnisse", lobte die Jury. Neben den drei Gewinnern wurden auch den Naturparks Hohe Mark, Terra.vita, Arnsberger Wald und Sauerland Rothaargebirge Förderungen in Aussicht gestellt.
Die zwölf Naturparks in NRW nehmen laut Ministerium rund 40 Prozent der Landesfläche ein. Sie dienen der Erholung und Umweltbildung, setzen sich für den Erhalt des Naturerbes und der Kulturlandschaften ein und wirken auch am nachhaltigen Tourismus mit. Nach Angaben des Verbands deutscher Naturparke verstehen sie sich als Motoren einer sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Gesellschaft und Lebensweise im ländlichen Raum.
Verbraucherschützer raten von Miet-Weihnachtsbäumen ab
Düsseldorf (epd). Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen kann Weihnachtsbäume zur Miete nicht empfehlen. Die Tannen im Topf seien teuer, nur begrenzt zu genießen und schädigten die Umwelt durch die doppelten Transportwege, erklärte die Verbraucherzentrale am 13. Dezember in Düsseldorf. Zudem bezweifelten Gartenexperten, dass die Pflanzen wieder richtig anwüchsen oder sich von der kurzen Pause vom Winterschlaf in der warmen Stube erholten. Oft verletze außerdem das Eintopfen die Tannen.
Die Verbraucherschützer prüften nach eigenen Angaben die Angebote zweier bundesweit handelnder Vermieter von Weihnachtsbäumen. Eine ungefähr 1,80 Meter hohe Tanne kostete im Test mit Miete für bis zu zwei Monate, Lieferung und Abholung 81 Euro. Ein westfälischer Versender vermietete Bäume am Standort für 75, landesweit für 90 und bundesweit für 120 Euro. Hier war die Weihnachtsfreude jedoch auf einen knappen Monat begrenzt.
Die Verbraucherzentrale rät zu Tannen - auch geschnittenen - aus Baumschulen und Forstbetrieben in unmittelbarer Umgebung. Ein weiteres Kriterium sei außerdem die ökologische Aufzucht, erkennbar etwa am FSC- oder EU-Bio-, am Bioland- oder Naturland-Siegel.
Gesellschaft
EU-Studie: Juden in Deutschland am häufigsten angefeindet

epd-bild / Christian Ditsch
Brüssel, Wien (epd). In Deutschland werden Juden einer Umfrage in zwölf europäischen Ländern zufolge am häufigsten angefeindet. 41 Prozent der Befragten wurden im zurückliegenden Jahr Opfer einer Belästigung, die nach ihrem Urteil gegen sie als Juden gerichtet war, wie aus einer am 10. Dezember in Brüssel und Wien vorgestellten Studie der EU-Grundrechteagentur hervorgeht. In allen Ländern zusammen, in denen der Großteil der jüdischen EU-Bevölkerung lebt, lag der durchschnittliche Wert bei 28 Prozent.
Nimmt man die fünf zurückliegenden Jahre, so lag die Zahl für Deutschland sogar bei 52 Prozent und im Schnitt der zwölf EU-Länder bei 39 Prozent. Im europäischen Durchschnitt waren es meist Jüngere (16-29 Jahre), die von Anfeindungen berichteten, nämlich 46 Prozent aus dieser Altersgruppe in den zwölf zurückliegenden Monaten. Insgesamt stieg die Häufigkeit, wenn sie beispielsweise durch eine Kippa als Juden erkennbar waren. In Deutschland bestanden die Anfeindungen den Befragten zufolge meist aus persönlichen Beleidigungen und Drohungen, außerdem aus Gesten und Anstarren sowie bösartigen Kommentaren im Internet.
Auswanderung erwogen
Neben Anfeindungen wurde nach physischen Angriffen gefragt. Davon waren den Angaben zufolge in den fünf Jahren vor der Umfrage drei Prozent betroffen, wenn man den EU-Schnitt betrachtet. In den zwölf Monaten vor der Umfrage waren es zwei Prozent. Landesspezifische Zahlen nennt die Umfrage wegen der insgesamt geringen Prozentzahl hier nicht. Insgesamt hatten an der Studie im Mai und Juni 2018 rund 16.400 Menschen online teilgenommen, die sich selbst als Juden identifizierten, in Deutschland waren es 1.233.
Gefragt wurde auch, ob die Betroffenen sich mit ihren negativen Erfahrungen an die Polizei, an jüdische oder andere Organisationen oder die Medien gewandt hätten. Viele taten dies demnach nicht, insbesondere weil sie der Ansicht waren, dass das nichts ändere. Rund 90 Prozent der Befragten in den zwölf Ländern waren zudem der Meinung, dass Antisemitismus in ihrem Land zunehme. Vor diesem Hintergrund haben viele über Auswanderung nachgedacht: In Deutschland waren es 44 Prozent der Umfrageteilnehmer, gegenüber 25 Prozent bei einer Umfrage im Jahr 2012.
Der Direktor der Grundrechteagentur, Michael O'Flaherty, nannte es "erschütternd", dass "Antisemitismus in der EU Jahrzehnte nach dem Holocaust weiter zunimmt". "Die Mitgliedstaaten müssen diese Entwicklung zur Kenntnis nehmen und sich intensiver bemühen, der Judenfeindlichkeit vorzubeugen und sie zu bekämpfen." EU-Vizekommissionschef Frans Timmermans erklärte: "Die jüdische Gemeinschaft muss sich in Europa sicher und zu Hause fühlen. Wenn wir das nicht erreichen können, hört Europa auf, Europa zu sein."
"Erschütternde Nachricht"
In Deutschland forderte der Zentralrat der Juden, dass die EU-Staaten "sich viel stärker als bisher im Kampf gegen Antisemitismus engagieren". "Antisemitismus als Normalfall - das darf Europa als Kontinent der Aufklärung nicht hinnehmen", erklärte Zentralrats-Präsident Josef Schuster.
Die Bundesregierung zeigte sich betroffen. "Die Nachricht ist erschütternd", sagte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann. Dass in dieser Wahlperiode ein Beauftragter für jüdisches Leben bestellt wurde, sei Beweis, dass die Bundesregierung bei dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehe, ergänzte sie.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte der "Bild"-Zeitung: "Vor dem Hintergrund unserer Geschichte sind antisemitische Vorfälle in Deutschland ganz besonders schwerwiegend. Wir müssen alles daran setzen, diese traurige Spitzenreiterposition wieder loszuwerden."
578 islamfeindliche Straftaten seit Jahresbeginn

epd-bild/Udo Gottschalk
Frankfurt a.M. (epd). Zwischen Januar und September dieses Jahres sind 578 islamfeindliche Straftaten von der Polizei gezählt worden. Die meisten Täter ließen sich dem rechten Spektrum zuordnen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Neben Beleidigungen und Volksverhetzung sei es auch zu körperlichen Übergriffen gekommen. Aus Reihen der Linken wurde Kritik am Umgang mit Muslimen in Deutschland laut. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" hatte zuerst über die Anfeindungen berichtet.
Allein im dritten Quartal 2018 gab es den Angaben zufolge 190 islamfeindliche Straftaten. In 184 Fällen war die Tat rechtsextrem motiviert, in fünf Fällen ließ sich das Motiv nicht zuordnen, und ein Täter handelte aus religiöser Überzeugung.
Verfassungswidrige Symbole
Bei den meisten muslimfeindlichen Verbrechen, die zwischen Juli und September dieses Jahres von den Behörden registriert wurden, handelte es sich den Daten zufolge um Beleidigungen oder Volksverhetzung. Es sei aber auch zu Nötigungen und Körperverletzung gekommen. Die Polizei habe zudem Sachbeschädigungen und Schmierereien registriert, oftmals seien verfassungswidrige Symbole verwendet worden.
In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden den Angaben nach 40 Menschen bei muslimfeindlichen Übergriffen verletzt, davon 11 im dritten Quartal. Zwei Menschen seien zwischen Juli und September wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung festgenommen worden.
Viele Formen von Rassismus
Die Behörden vermeldeten für das dritte Quartal 16 Kundgebungen gegen eine vermeintliche "Islamisierung Deutschlands", die meist von rechtsextremen Gruppierungen gesteuert oder beeinflusst wurden. Einige dieser Bewegungen würden vom Verfassungsschutz beobachtet. Zudem habe es eine Protestaktion gegen den Bau einer Moschee in Dortmund gegeben.
Aus Sicht der innenpolitischen Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke, hat sich der Umgang mit Muslimen auch im politischen Bereich verschlechtert: "Der eine lässt zur Islamkonferenz Blutwurst servieren, der andere wirft einen Schweinskopf vor die Moschee. Die Botschaft ist die gleiche." Muslime würden gedemütigt, ausgegrenzt und der Islam als nicht zu Deutschland gehörig betrachtet. "Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Hetze gilt es in gleichem Maße entgegenzutreten wie Antisemitismus und anderen Formen von Rassismus", forderte Jelpke.
Merkel verteidigt Migrationspakt mit kämpferischer Rede
Auf einem Gipfel in Marrakesch haben 164 Staaten den UN-Migrationspakt angenommen, darunter Deutschland. Mindestens zehn Länder zogen indes ihre Unterstützung zurück, weitere könnten folgen. Hilfswerke fordern, Migranten vor Ausbeutung zu schützen.Marrakesch (epd). Mit einer kämpferischen Rede hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 10. Dezember in Marrakesch den UN-Migrationspakt verteidigt. Zum Schutz der Bürger sei es nötig, illegale Migration gemeinsam zu bekämpfen, rief Merkel den Vertretern aus 164 Staaten zu, die zuvor den Migrationspakt per Akklamation verabschiedet hatten. Nationale Alleingänge würden das Problem nicht lösen. In dieser Woche soll die UN-Vollversammlung den Pakt verabschieden. Die nötige Mehrheit gilt als sicher.
Mehrere Staaten haben den Vereinten Nationen bisher mitgeteilt, dass sie die Unterstützung für den Pakt zurückziehen, den sie selbst mitverhandelt haben. Es sind dies Australien, Chile, die Dominikanische Republik, Österreich, Lettland, Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Die USA waren bereits den Verhandlungen ferngeblieben. Weitere sechs Staaten überlegen noch, wie sie sich zum Pakt verhalten. Unter ihnen ist auch die Schweiz, die die Verhandlungen für den Pakt gemeinsam mit Mexiko geleitet hatte.
Leidenschaftlich
Die in Marokko anwesenden Befürworter des völkerrechtlich nicht verbindlichen Abkommens sprachen sich auch deshalb leidenschaftlich für den Migrationspakt aus und betonten die grundsätzliche Bedeutung des Pakts für gemeinsames Handeln der Weltgemeinschaft. Merkel erinnerte an die deutsche Geschichte und das unendliche Leid, das Deutschland durch den Nationalsozialismus über die Menschheit gebracht habe. "Die Antwort auf puren Nationalismus war die Gründung der Vereinten Nationen und das Bekenntnis zur gemeinsamen Lösung der Fragen, die uns bewegen", sagte die Kanzlerin.
Der belgische Ministerpräsident Charles Michel erklärte, das Bekenntnis zu universellen Prinzipien habe nach den Schrecken zweier Weltkriege Hoffnung genährt. Vor diesem Hintergrund habe er sich für den Pakt entschieden, obwohl darüber seine Koalition zerbrochen sei. Dafür erntete er mehrfach andauernden Applaus.
UN-Generalsekretär António Guterres äußerte am 10. Dezember die Hoffnung, dass die abwesenden Staaten sich dem Pakt in Zukunft anschließen werden. In seinem Plädoyer forderte er, Mythen zu überwinden und die Realität anzuerkennen. Dazu gehöre, dass der Großteil der Migration auf der Südhalbkugel stattfinde. Dessen ungeachtet seien viele Staaten auf der Nordhalbkugel angesichts ihrer Überalterung auf Migration angewiesen.
Umsetzung angemahnt
Vertreter der Zivilgesellschaft forderten nach der Verabschiedung schnelles Handeln. Der Pakt biete die Gelegenheit, eine gescheiterte Migrationspolitik zu reparieren, sagte Francesco Rocca, Präsident der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmongesellschaften. Derzeit gefährde die Kriminalisierung der Hilfe für Migranten im Mittelmeer die Arbeit humanitärer Akteure. Mit dem Pakt sei zwar keine völkerrechtliche, aber doch eine ethische Verpflichtung verbunden.
Auch die Präsidentin von "Brot für die Welt", Cornelia Füllkrug-Weitzel, hob die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit in der Migrationspolitik hervor. Die Verabschiedung des Migrationspakts sei ein wichtiges Signal, wichtiger sei nun jedoch die konkrete Umsetzung. So müssten Migranten und Migrantinnen besser vor Ausbeutung bei der Arbeit, vor Diskriminierung und vor organisiertem Verbrechen geschützt werden.
Der Hamburger katholische Erzbischof Stephan Heße sprach von einem Meilenstein. Der Pakt orientiere sich unmissverständlich an den Menschenrechten und wisse sich zugleich pragmatischen Lösungsstrategien verpflichtet, erklärte der Migrationsbeauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz: "An den Standards, die er festschreibt, müssen sich die Staaten künftig messen lassen."
23 Ziele
Das katholische Hilfswerk Misereor begrüßte den besonderen Platz, den Umweltmigration im Migrationspakt einnehme. Immer mehr Menschen seien genötigt, ihre Heimat zu verlassen, weil aufgrund des Klimawandels ihre Lebensgrundlagen bedroht seien, erklärte der Geschäftsführer Internationale Zusammenarbeit bei Misereor, Martin Bröckelmann-Simon. Jedes Zehntelgrad Temperaturanstieg verschärfe diese Situation.
Der UN-Migrationspakt soll lebensgefährliche und chaotische Migration durch internationale Kooperation verhindern. Nach einer Präambel und sieben Leitprinzipien werden dafür 23 Ziele aufgeführt, darunter die Beseitigung von Fluchtursachen, integriertes Grenzmanagement, die Bekämpfung von Schleusern und Menschenhandel, bessere Zusammenarbeit bei der Rückkehr von Migranten in ihre Heimatländer und auch die Eröffnung legaler Möglichkeiten zur Einwanderung. Ob und wie diese Ziele umgesetzt werden, ist alleine den Nationalstaaten überlassen.
Social Bots twitterten gegen UN-Migrationspakt
In der Online-Debatte über den UN-Migrationspakt haben einer Analyse zufolge ungewöhnlich viele Social Bots mitgemischt. Ziel war es offenbar, gegen die am Montag verabschiedete Übereinkunft der Weltgemeinschaft zu mobilisieren.Berlin (epd). Vor der Verabschiedung des UN-Migrationspakts haben Recherchen eines Berliner Startup-Unternehmens zufolge zahlreiche Social Bots im Internet Stimmung gegen die internationale Übereinkunft gemacht. Laut der Analyse der Firma botswatch sind mehr als ein Viertel aller Twitter-Nachrichten zum Migrationspakt (28 Prozent) auf Social Bots zurückzuführen, wie die Tageszeitung "Die Welt" (10. Dezember) berichtete. Den Analysten zufolge sei der Durchschnitt bei politischen Diskussionen sonst etwa um die Hälfte niedriger (10 bis 15 Prozent). Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) rief angesichts der Analyse zu einem verstärkten Kampf gegen Lügen im Internet auf.
Der jetzige Anteil von Social Bots sei so hoch wie seit der Bundestagswahl im vergangenen Jahr nicht mehr. Social Bots sind in sozialen Netzwerken agierende Computerprogramme, die sich als reale Menschen tarnen. Für ihre Studie zum Migrationspakt habe botswatch rund 800.000 Tweets untersucht, die zwischen dem 24. November und dem 2. Dezember veröffentlicht wurden, hieß es. Der Bundestag hatte sich am 29. November für den Pakt der Vereinten Nationen ausgesprochen.
"Gefahr für die Demokratie"
Gestreut worden seien zum Beispiel Behauptungen, wonach die Bundesregierung versuche, die Öffentlichkeit beim Migrationspakt bewusst zu täuschen: Das Abkommen sei rechtlich bindend, damit hole die Regierung Flüchtlinge bewusst nach Deutschland. Wichtig für die Verbreitung der Inhalte seien neben Twitter auch Plattformen wie YouTube. Auf mögliche Hintermänner der Social Bots gehe die Analyse nicht ein.
"Jemand scheint Interesse daran zu haben, dass diese Debatte geführt wird und dass gezielt Falschinformationen über den UN-Migrationspakt verbreitet werden", sagt botswatch-Geschäftsführerin Tabea Wilke der "Welt". Das Thema eigne sich sehr gut dafür, die westliche Wertegemeinschaft infrage zu stellen.
Justizministerin Barley sagte, der Fall werfe ein Schlaglicht darauf, wie organisierte Falschmeldungen die Debatte um ein Thema beeinflussen können. "Die Betreiber sozialer Netzwerke müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und entschieden gegen Fake-Accounts vorgehen", sagte Barley den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Social Bots seien eine Gefahr für die Demokratie. Sie begrüße daher den vergangene Woche vorgestellten Aktionsplan der EU-Kommission gegen Desinformation im Netz. Brüssel setzt darin unter anderem auf die Gründung eines EU-weiten Schnellwarnsystems für Versuche, die öffentliche Meinung zu manipulieren.
Transparenz gefordert
Auch die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Nadine Schön (CDU), forderte Plattformbetreiber wie Twitter angesichts der botswatch-Recherchen auf, für mehr Transparenz zu sorgen. "Den Nutzern muss eindeutig klar sein, ob ein Mensch oder ein Social Bot einen Tweet oder einen Post veröffentlicht hat", sagte Schön.
Der Autor und Blogger Schlecky Silberstein (bürgerlich Christian Maria Brandes) sieht auch die Politik gefragt. "Man kann beispielsweise ein ganz normales Gesetz anleiern, dass den Einsatz von Social-Media-Bots grundsätzlich verbietet", sagte er im Radioprogramm SWR Aktuell. Nötig seien aber auch massive Aufklärungskampagnen, um Bots von authentischen Social-Media-Profilen unterscheiden zu können: "Das ist ein Teil der Medienkompetenz, bei der wir von der Schule bis zum Altenheim ein Verständnis in der breiten Gesellschaft erreichen müssen."
Studie: Einheimische und Migranten haben ähnlichen Bürgersinn
Was die Vorstellung von einem vorbildlichen Bürger angeht, liegen Einheimische und Zugewanderte einer Studie zufolge nicht weit auseinander. Größer sind die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sowie zwischen Jung und Alt.Gütersloh (epd). In Deutschland lebende Menschen haben einer Studie zufolge sehr ähnliche Vorstellungen, was einen guten Bürger ausmacht. Dabei gebe es kaum Unterschiede zwischen Einheimischen und Migranten, erklärte die Bertelsmann Stiftung am 11. Dezember in Gütersloh. Am wichtigsten war allen Befragten "Gesetze befolgen", "Respekt vor älteren Menschen zeigen" und "eigenverantwortlich für seinen Lebensunterhalt sorgen". Diese Werte erhielten jeweils 98 Prozent Zustimmung. Eine "Bereitschaft zum Militärdienst" wurde nur von jedem zweiten als Eigenschaft eines vorbildlichen Bürgers gesehen. "Stolz auf Deutschland zu zeigen" waren rund 60 Prozent als Bürgertugenden wichtig.
Für die große Mehrheit aller in Deutschland lebenden Menschen könne jeder ein guter Bürger sein, unabhängig davon, ob er in Deutschland oder im Ausland geboren sei, erklärte die Stiftung weiter. Migranten würden Merkmale wie die Akzeptanz von Menschen mit einer anderen Religion und Einwandern helfen, deutlich höher bewerten als Einheimische, hieß es. Die hohe Zustimmung beruhe auch auf der eigenen Betroffenheit, hieß es in der Studie. Einheimische bewerteten hingegen "wählen gehen" und "sich politisch informieren" höher.
Unterschiedliche Einstellungen zwischen West- und Ostdeutschland
Unterschiedliche Einstellungen würden besonders von Alter und Wohnort, etwa zwischen West- und Ostdeutschland, abhängen. Werte wie "Gesetze befolgen" waren in Ostdeutschland fast 20 Prozent weniger "sehr wichtig" als Befragten in Westdeutschland. Auch Respekt gegenüber anderen Religionen und Hilfe für Einwanderer wurden rund zehn Prozent weniger als sehr wichtiges Merkmal gesehen. Insgesamt seien Männer, ältere Menschen und Ostdeutsche kritischer gegenüber Einwanderern und Religionen eingestellt.
Bei den Menschen mit ausländischen Wurzeln gebe es Unterschiede zwischen den im Ausland und den in Deutschland Geborenen. Beide Gruppen teilten zwar hohe Bewertung von Respekt vor Älteren und gegenüber Anhängern anderer Religionen im Vergleich zu Einheimischen. Allerdings messen im Ausland geborene Migranten Werte, wie im eigenen Umfeld auf Recht und Ordnung zu achten, stolz auf Deutschland zu zeigen und bereit zum Militärdienst zu sein, einen höheren Stellenwert zu. In Deutschland geborene Migranten bewerteten hingegen diese ähnlich wie die übrige Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
Dräger: Eindruck gesellschaftlicher Spaltung täuscht
Wichtige Orte der Vermittlung von Bürgersinn sind für die Mehrheit die Familien (93 Prozent) und Schulen (88 Prozent). Kirchen, Religionsgemeinschaften und Medien hätten dabei lediglich für jeden zweiten Befragten (jeweils rund 50 Prozent) eine große Bedeutung.
Der Eindruck großer gesellschaftlicher Spaltung täusche, erklärte der Vorstand der Bertelsmann Stiftung, Jörg Dräger. Die allermeisten Menschen in Deutschland teilten grundsätzliche Ansichten darüber, welche Haltungen und Handlungen für die Bürger wünschenswert seien.
Für die Studie "Bürgersinn in der Einwanderungsgesellschaft - Was Menschen in Deutschland unter einem guten Bürger verstehen" wurden zwischen Juli und August knapp 2.060 Menschen ab 14 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet befragt. Fast 1.170 von ihnen haben einen Migrationshintergrund.
Studie: Mehr qualifizierte Migranten verlassen Deutschland
Köln, Essen (epd). Hoch qualifizierte Migranten verlassen Deutschland einer neuen Studie zufolge häufiger als andere Zuwanderer. Akademiker wollen unter sonst gleichen Bedingungen deutlich häufiger in den nächsten fünf Jahren wieder ausreisen als beruflich qualifizierte Migranten, wie aus einer am 13. Dezember veröffentlichten Studie des Kölner Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Die Zahl der Fortzüge von Ausländern ist der Untersuchung zufolge deutlich gestiegen: Im Jahr 2017 verließen mit 708.000 Migranten doppelt so viele Deutschland wie 2012 (332.000 Ausreisen).
Fast jeder Dritte der ausreisenden Migranten lebte 2017 den Angaben nach länger als drei Jahre in Deutschland (30 Prozent). Auch die familiäre Situation spiele eine wichtige Rolle: Eltern mit mindestens zwei Kindern wollten das Land seltener verlassen, auch wenn sie keine stärkere Bindung an Deutschland hätten.
Sollten in der Zukunft weniger Menschen nach Deutschland kommen, könnten die Rück- oder Weiterwanderungen zum Problem werden, wie es in der Studie des Wissenschaftlers Wido Geis-Thöne heißt. "Die Zuwanderung von Fachkräften wird für Deutschland in Zukunft immer wichtiger, um die Folgen des demografischen Wandels am Arbeitsmarkt und bei den Sozialversicherungen abzumildern", sagte Geis-Thöne den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (13. Dezember), die zuerst über die Daten berichtet hatten.
Breite Mehrheit für neues NRW-Polizeigesetz
NRW hat ein neues Polizeigesetz. Zustimmung gab eine breite parlamentarische Mehrheit, doch die Kritik von Grünen und Menschenrechtlern reißt nicht ab.Düsseldorf (epd). Der Düsseldorfer Landtag hat am 12. Dezember den umstrittenen Entwurf des neuen Polizeigesetzes verabschiedet. Eine parlamentarische Mehrheit der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der SPD-Opposition stimmte dem Entwurf zu. Die Grünen erwägen Klage vor dem Verfassungsgericht. Kritik äußerte auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International.
Das neue Gesetz weitet die Befugnisse der Polizei bei der Terrorabwehr und Alltagskriminalität deutlich aus - insbesondere bei der Überwachung von digitaler Kommunikation und dem Umgang mit Gefährdern. Nach Kritik von Datenschützern und Menschenrechtlern wurde der ursprüngliche Entwurf aber in vielen Punkten leicht entschärft.
Überwachung von Messengerdiensten nur mit richterlicher Anordnung
So wurde der umstrittene Begriff der "drohenden Gefahr" für die Ausweitung von Polizeimaßnahmen im Vorfeld möglicher Straftaten gestrichen. Die Überwachung von Messengerdiensten wie WhatsApp oder Internettelefonie wie Skype ist nun nur mit richterlicher Anordnung in speziellen Fällen zugelassen. Träger von Berufsgeheimnissen wie Ärzte oder Rechtanwälte dürfen nicht überwacht werden.
Eine der wichtigsten Änderungen betrifft den sogenannten Unterbindungsgewahrsam mutmaßlicher Gefährder zur Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Straftat. Er sollte von derzeit 48 Stunden auf einen Monat ausgeweitet werden - jetzt sind es höchstens zwei Wochen. Darüber hinaus ist jetzt anwaltlicher Beistand verpflichtend, im ursprünglichen Entwurf war dies optional. Der Gewahrsam darf nur dann von einem Richter angeordnet werden, wenn eine schwere Straftat bevorsteht, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bewehrt ist - zum Beispiel ein Terroranschlag.
SPD-Rechtexperte Hartmut Ganzke betonte, die SPD könne den Gesetzentwurf mittragen, weil dieser in intensiven Verhandlungen mit der Landesregierung "entschärft" worden sei. "Das ist kein Gesetzentwurf, der die Freiheitsrechte in Abrede stellt. Wir werden ein verfassungskonformes Gesetz auf den Weg bringen, das auch Akzeptanz bei den 40.000 Polizisten finden wird."
Zustimmung von Polizeigewerkschaft
Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW begrüßte das neue Gesetz. Es sei wichtig, dass die Kollegen nun auch rechtssicher arbeiten könnten, erklärte Landesvorsitzender Erich Rettinghaus. Das Gesetz stehe nun im Einklang mit dem Datenschutz unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Das Gesetz habe den Charakter, als Vorlage für andere Bundesländer zu dienen.
Zustimmung äußerten auch die FDP-Politiker Gerhart Baum und Burkhard Hirsch. "Aus der Reihe der Landespolizeigesetze, die in jüngerer Vergangenheit aufgrund einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und Vorgaben der EU novelliert wurden, ist das nordrhein-westfälische Polizeigesetz das freiheitsschonendste", sagten Baum und Hirsch dem "Kölner-Stadtanzeiger" (13. Dezember). Der ursprüngliche Gesetzentwurf sei in den entscheidenden Punkten verändert und wesentlich verbessert worden. Intelligente Videoüberwachung wie am Berliner Bahnhof Südkreuz bleibe unzulässig.
Kritik von Bürgerrechtlern
Dagegen kritisierte die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Verena Schäffer, das Gesetz scharf: "Mehr polizeiliche Befugnisse schaffen nicht automatisch mehr Sicherheit, schränken aber die Grundrechte ein". Das Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und Polizei werde ausgeweitet. Ganz offenbar sei der "grottenschlechte" Gesetzentwurf vor den erfolgten Nachbesserungen verfassungswidrig gewesen.
Auch das aus Bürgerrechtlern und Verbänden bestehende Bündnis "Polizeigesetz NRW stoppen!" kündigte die Prüfung einer Verfassungsbeschwerde und weiteren Widerstand an. "Der Protest gegen Gesetzesverschärfungen wie diese wird mit der Verabschiedung nicht verstummen. Wir werden uns gegen weitere bereits geplante autoritäre Gesetzespakete wehren", hieß es in einer Presseerklärung. Die Gesetzesänderungen seien rein kosmetischer Natur. Es bleibe eine "krasse Verschärfung des Polizeigesetzes."
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sieht in dem Gesetz eine Gefährdung zentraler Rechtsstaatsprinzipien und elementarer Menschenrechte. Es sei völlig unklar, welche Tatsachen eine Annahme rechtfertigen können sollen, dass jemand innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat begehen werde, kritisierte die Menschenrechts-Expertin Maria Scharlau am 12. Dezember in Berlin. Die Anhaltspunkte, die Maßnahmen wie Fußfesseln, Aufenthaltsverbote oder Telefonüberwachung rechtfertigen sollen, seien zu vage. Das verstoße gegen die Unschuldsvermutung, weil Menschen durch die Maßnahmen de facto bestraft würden, ohne dass sie sich strafbar verhalten hätten.
Familiennachzug: Kontingent 2018 nicht ausgeschöpft
Die zunächst stockende Bearbeitung der Anträge auf Familiennachzug kommt inzwischen schneller voran. Bis Jahresende werden voraussichtlich aber lange nicht alle versprochenen Plätze ausgeschöpft. Das könnte für Diskussionen in der Koalition sorgen.Berlin (epd). Die von der Bundesregierung zugesagten 5.000 Plätze für den Familiennachzug zu subsidiär geschützten Flüchtlingen in Deutschland werden bis zum Jahresende voraussichtlich zu einem großen Teil nicht ausgeschöpft. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts am 12. Dezember in Berlin mitteilte, wurden bis Ende November 2.026 Nachzüge bewilligt und 1.562 Visa erteilt. Seit August gilt die Neuregelung für Flüchtlinge mit dem untergeordneten Schutz, die ein Kontingent von 1.000 Plätzen pro Monat vorsieht.
Weil gerade für den Anfang der komplizierten Neuregelung Verzögerungen erwartet wurden, versprach die Bundesregierung, in diesem Jahr nicht ausgeschöpfte Monatskontingente zu übertragen, so dass bis Jahresende 5.000 Menschen kommen könnten. Zwar schafften die Auslandsvertretungen inzwischen die Bearbeitung von rund 1.000 Anträgen im Monat, sagte der Außenamtssprecher. Tatsächlich wurden laut Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP im Bundestag im November 1.073 Anträge auch vom Bundesverwaltungsamt bewilligt.
Rückstand
Der Sprecher des Auswärtigen Amts räumte aber auch ein, es habe länger gedauert, die Bearbeitungskapazitäten dafür aufzubauen. Der Rückstand zu den 5.000 Plätzen werde absehbar nicht mehr aufgeholt werden können. "Insofern stellt sich die Frage einer möglichen Übertragung eines Restkontingents ins nächste Jahr", sagte er. In der Koalition war eigentlich vereinbart worden, dass die Übertragung von Plätzen ab 2019 nicht mehr möglich ist. Bis Ende Dezember nicht ausgeschöpfte Plätze würden dann auch verfallen.
Nach Auskunft des Außenamtssprechers werden zu dem Thema derzeit Gespräche in der Bundesregierung geführt. Das mit federführende Bundesinnenministerium äußerte sich zurückhaltend. Gesetzliche Änderungen seien nicht geplant, sagte eine Sprecherin.
Betroffen von der Nachzugsregelung sind vor allem syrische Bürgerkriegsflüchtlinge, die oft nicht als politisch Verfolgte anerkannt werden, sondern wegen des Bürgerkriegs in ihrer Heimat den subsidiären Status zum Schutz vor Gefahr erhalten. Seit 2016 dürfen diese Flüchtlinge ihre Angehörigen nicht mehr nachholen.
Die in der Koalition lang umstrittene Kontingent-Regelung zum Familiennachzug sieht ein kompliziertes Verfahren vor, an dem neben den Auslandsvertretungen die deutschen Ausländerbehörden und das Bundesverwaltungsamt beteiligt sind. Nach Angaben des Auswärtigen Amts liegen mehr als 44.000 sogenannte Terminanfragen von potenziellen Nachzüglern vor. Knapp 5.000 konkrete Anträge wurden demnach seit August von den Auslandsvertretungen angenommen, positiv geprüft und an die deutschen Ausländerbehörden weitergeleitet.
695 Bewilligungen
Die letzte Entscheidung im Auswahlverfahren trifft das Bundesverwaltungsamt. Im August wurden durch diesen langen Prozess gerade einmal 65 Anträgen zugestimmt, im September 196. Im Oktober waren es 692 positiv bewilligte Fälle.
Die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, Linda Teuteberg, erklärte, die Zahlen zeigten zwar, dass die Verwaltungsverfahren langsam in Schwung kämen. Angesichts zigtausender Terminanfragen seien Verfahren und Tempo aber nicht zufriedenstellend. Eine strenge Härtefallregelung sei zwar richtig, um den Zuzug zu begrenzen. "Doch damit eine Obergrenze zu verbinden und in der Folge viele Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen in echten Notlagen warten zu lassen, das ist fragwürdig", erklärte Teuteberg
Flüchtlingsbürgen: Jobcenter zieht Kostenbescheid zurück
Köln (epd). Erneut ist ein Verfahren über Bürgschaften für Flüchtlinge zugunsten einer Bürgin ausgegangen. Eine Frau aus Bonn muss keine Sozialleistungen an das Jobcenter zurückzahlen, wie eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Köln dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 12. Dezember sagte. Bei der Verhandlung habe das Jobcenter Bonn am Vortag von sich aus den Kostenbescheid in Höhe von 45.000 Euro aufgehoben, sagte die Sprecherin. Zuvor habe das Gericht den deutlichen Hinweis gegeben, dass die Leistungsfähigkeit der Klägerin bei Abgabe der Verpflichtungserklärung nicht hinreichend geprüft wurde. (Az.: 5 K 2325/18)
Die Klägerin hatte sich nach Angaben einer Bonner Initiative von Flüchtlingsbürgen verpflichtet, für den Lebensunterhalt einer fünfköpfigen Familie aus Syrien aufzukommen. Von ihrem Einkommen her hätte die Bonnerin allenfalls die Kosten für eine Person abdecken können, sagte Christian Osterhaus von der Flüchtlingshilfe Syrien der evangelischen Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg. Das Gericht habe dem Jobcenter empfohlen, vor weiteren Zahlungsbescheiden genaue Einzelfallprüfungen vorzunehmen, sagte die Gerichts-Sprecherin.
In einer zweiten am 11. Dezember verhandelten Klage von Flüchtlingsbürgen wird das Urteil nach Angaben des Gerichts schriftlich zugestellt. Hier sei es um eine Rückforderung des Jobcenters von rund 20.000 Euro Sozialleistungen für zwei Syrer gegangen, erklärte die Pressesprecherin. Der Fall sei ähnlich gelagert wie zwei Verfahren, die das Gericht Ende September zugunsten der Flüchtlingsbürgen entschieden hatte, sagte Osterhaus.
Geltungsdauer ungeklärt
Seit fast zwei Jahren verschicken Jobcenter und Sozialämter Rechnungen an Einzelpersonen, Initiativen und Kirchengemeinden, die 2014 und 2015 Verpflichtungserklärungen für den Lebensunterhalt syrischer Flüchtlinge unterschrieben hatten. Auf diese Weise konnten sich alleine in Nordrhein-Westfalen rund 2.600 Syrer vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in Sicherheit bringen. Vergleichbare Aufnahmeprogramme hatten damals fast alle Bundesländer aufgelegt.
Die Geltungsdauer solcher Bürgschaften war damals jedoch ungeklärt: Während Länder wie Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen von einer Befristung bis zur Anerkennung der Syrer als Flüchtlinge ausgingen, galt die Verpflichtung nach Ansicht der Bundesregierung auch danach fort. Erst das Integrationsgesetz bestimmte 2016 eine Fünf-Jahres-Frist, die für "Altfälle" auf drei Jahre reduziert wurde.
Zahlreiche Betroffene ziehen gegen die Kostenbescheide der Behörden vor Gericht. Beim Verwaltungsgericht Köln sind nach eigenen Angaben alleine 100 Klagen aus Bonn anhängig. An den Verwaltungsgerichten in Niedersachsen laufen derzeit 482 solcher Verfahren, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes ergab. Zuletzt hatte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) eine baldige politische Lösung zugunsten der Flüchtlingsbürgen in Aussicht gestellt. Darüber verhandeln Bund und Länder seit mehr als einem Jahr.
NRW schiebt am meisten abgelehnte Asylbewerber ab
Düsseldorf, Berlin (epd). Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr bislang mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben als alle anderen Bundesländer. Insgesamt wurden von Januar bis Ende Oktober 5.548 Menschen unter Polizeizwang zurück in ihre Heimatländer oder in Drittstaaten geschickt, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Im gesamten Jahr 2017 hatte NRW 6.308 abgelehnte Asylsuchende abgeschoben. Bundesweit wurden von Januar bis Ende Oktober demnach insgesamt 19.781 Menschen zurückgeführt, 2017 waren es 23.966.
Über die Zahlen hatten zunächst die Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (11. Dezember) berichtet. Sie verweisen darauf, dass Nordrhein-Westfalen als bevölkerungsreichstes Bundesland auch die meisten Asylbewerber und eine entsprechend hohe Zahl abgelehnter Antragsteller habe. Im ebenfalls bevölkerungsreichen Bayern schoben die Behörden dem Bericht zufolge zwischen Januar und Ende Oktober 2.758 Menschen ab. In Baden-Württemberg wurden 2.569 abgelehnte Asylbewerber abgeschoben, gefolgt von Hessen mit 1.482, Rheinland-Pfalz mit 1.305 und Niedersachsen mit 1.299 Abschiebungen.
Deutschlandweit gibt es laut Bundesinnenministerium 427 Haftplätze für Menschen, die abgeschoben werden sollen. Abgelehnte Asylsuchende dürfen für eine begrenzte Zeit und unter besonderen Auflagen inhaftiert werden. 140 Plätze stehen allein in der nordrhein-westfälischen Abschiebehaftanstalt Büren zur Verfügung, 120 in Bayern. Acht Bundesländer haben keine eigenen Abschiebungshaftplätze, kooperieren aber dem Funke-Bericht zufolge mit anderen Bundesländern, darunter das Saarland, Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Schleswig-Holstein.
Die migrationspolitische Sprecherin der FDP, Linda Teuteberg, nannte es besorgniserregend, dass acht Bundesländer keine eigenen Abschiebehaftplätze bereitstellen. "Denn dadurch steigt das Risiko, dass abgelehnte Asylbewerber untertauchen und sich dauerhaft illegal in Deutschland aufhalten", sagte sie. Abschiebungen seien Teil eines funktionierenden Asylsystems. "Wenn sich der Eindruck verfestigt, dass es egal ist, wie ein Verfahren ausgeht, weil die Antragsteller so oder so in Deutschland bleiben, wird das Vertrauen in dieses System beschädigt", warnte Teuteberg.
"Heißzeit" ist das "Wort des Jahres"

epd-bild/Anke Bingel
Wiesbaden (epd). Das "Wort des Jahres 2018" lautet "Heißzeit". Es thematisiere nicht nur einen extremen Sommer, der gefühlt von April bis November gedauert habe, erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am 14. Dezember in Wiesbaden zur Begründung. Es spiele auch auf eines der gravierendsten globalen Phänomene des frühen 21. Jahrhunderts an, den Klimawandel. Mit der lautlichen Analogie zu Eiszeit erhalte der Ausdruck eine epochale Dimension und verweise auf eine sich möglicherweise ändernde Klimaperiode.
Auf den zweiten Platz wählte die Jury das Wort "Funklochrepublik". Vor allem auf dem Land sei in Deutschland die Mobilfunkabdeckung vergleichsweise schlecht, was spätestens seit dem letzten Bundestagswahlkampf ein politisches Thema sei. Den dritten Platz belegte der Begriff "Ankerzentren". Mit deren Einführung wolle die große Koalition das Problem der unkontrollierten Migration in den Griff bekommen. Das erste Wortglied "Anker" stehe hier nicht für Fixierung oder Sicherung wie beim Anker eines Schiffs, sondern für die Anfangsbuchstaben von "Ankunft, Entscheidung, Rückführung" von Flüchtlingen und Migranten.
"Strafbelobigt"
Mit dem Satz "Wir sind mehr" (Platz vier) habe eine breite Öffentlichkeit auf fremdenfeindliche Kundgebungen in Chemnitz reagiert, erklärte die Jury. Zunächst habe es sich dabei um den Titel eines Konzerts "gegen Rechts" gehandelt, zu dem im September Zehntausende Besucher in die sächsische Stadt kamen.
Auf Platz fünf wählte die Jury den Ausdruck "strafbelobigt". Damit spielte sie auf die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geplante Beförderung von Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär an, nachdem dieser aufgrund von Äußerungen zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz als Präsident des Bundesverfassungsschutzes nicht mehr zu halten war. Nach einer öffentlich gewordenen Politiker-Schelte Maaßens sah sich der Minister gezwungen, ihn doch in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen.
"Mutter aller Probleme"
Platz sechs belegt der Ausdruck "Pflegeroboter". Das Wort stehe stellvertretend für eine Diskussion um die Zukunft der Betreuung von Pflegebedürftigen und Kranken, in der in absehbarer Zeit Roboter den Platz von Pflegekräften übernehmen könnten. Ein "Diesel-Fahrverbot" (Platz sieben) wurde in verschiedenen deutschen Städten erlassen, um die Einhaltung einer EU-Richtlinie zu Stickstoffdioxid-Grenzwerten durchzusetzen.
Auf Platz acht setzte die Jury "Handelskrieg". Dieser sei von US-Präsident Donald Trump als politisches Mittel der Wahl der EU und China mehrfach angedroht worden. Mit "Brexit-Chaos" (Platz neun) greife die Jury die schwierigen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens auf. Platz zehn belegt der Ausdruck "die Mutter aller Probleme". Bundesinnenminister Seehofer habe mit dieser Bezeichung für Migration eine intensive Debatte ausgelöst, in deren Verlauf vielerlei als Mutter aller Probleme bezeichnet worden sei, von der CSU bis zu Horst Seehofers Mutter.
Die "Wörter des Jahres" wurden 2018 zum 42. Mal in Folge bekanntgegeben. Traditionell suchen die Mitglieder des Hauptvorstandes und die wissenschaftlichen Mitarbeiter der GfdS nicht nach den am häufigsten verwendeten Ausdrücken, sondern wählen solche, die das zu Ende gehende Jahr in besonderer Weise charakterisieren.
Das erste Wort des Jahres war 1977 "Szene". Im vergangenen Jahr lautete es "Jamaika-Aus", es bezeichnete das Scheitern der Bemühungen um die Bildung einer Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen.
"Das ist Willkommenskultur"

epd-bild/Tristan Vankann
Bremen (epd). Es ist fast wie ein Langstreckenlauf. Noch steht nirgends eine Speise, da hat Bankettleiter Heico Geffken jeden der 20 Tische in der historischen Oberen Rathaushalle in Bremen schon fünf Mal umrundet. Für das traditionelle Wilhelm-Kaisen-Bürgermahl liegt auf leicht gestärkten weißen Damast-Tischdecken das Ratssilber parat. An jedem Platz wartet neben dem Besteck ein goldumrandeter Brotteller mit Stadtwappen.
Am Ende werden mehr als 200 Gäste an den Tischen Platz nehmen, die wie Inseln wirken und über denen an schweren Eisenketten große Schiffsmodelle aus der Hansezeit schweben. Viel Arbeit für das Bankettmanagement um Geffken und seine Kollegin Svenja Winkler, die heute am Ende 14 Stunden auf den Beinen sein werden. Sie sind Experten in Sachen festlicher Tafel - egal ob in der Rathaushalle oder zuhause an Heiligabend oder Silvester.
Im Rathaus, Ausbildungsbetrieb für derzeit neun junge Männer und Frauen im Restaurantservice, haben sie schon für prominente Gäste aus aller Welt den Tisch gedeckt. "Festlich, aber bescheiden", so soll es diesmal sein, beschreibt Geffken die Leitlinie. Das Essen ist ein Dank für Ehrenamtliche und Sponsoren, die sich für soziale Belange in der Stadt engagieren.
"Gebrochene" Servietten
Dabei ist Vorbereitung alles. Bevor eingedeckt wird, wurden bereits die Servietten gefaltet, "gebrochen", wie es im Fachjargon heißt. Silberbesteck und Gläser sind frisch poliert. Die Tischdecken werden so aufgelegt, dass alle Mittelbrüche im Raum parallel verlaufen. Unterbrüche - Falten, die nach unten weisen - liegen in Richtung Eingangstür, damit der Gast beim Betreten des Raumes symbolisch gesehen nicht auf einen Berg schaut. Die Blumen auf den Tischen dürfen nicht zu hoch sein, damit sich beim Essen alle gut sehen können.
"Wenn ich nicht auf Kleinigkeiten achte, dann ist die Ruhe weg", ist Geffken überzeugt. "Ein sortierter, ein gepflegter Tisch sorgt für Vertrauen. Das ist Willkommenskultur." So zeige sich auch Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Gast. Dazu gehöre auch die Bewegungsfreiheit am Platz. "60 Zentimeter sollte jeder bekommen", betont der leidenschaftliche Gastgeber. "Auch zu Hause an der Weihnachtstafel."
Der Theologe und Kulinaristiker Guido Fuchs spricht in diesem Zusammenhang von der "Achtsamkeit für den Moment". Essen sei eine Zeremonie, sagt der Experte des Hildesheimer Instituts für Liturgie- und Alltagskultur. Eine Zeremonie allerdings, die zunehmend seltener gepflegt werde. "Wer in Gemeinschaft isst, drückt das besonders Festliche des Tages aus, denn im Alltag wird es immer seltener, dass die ganze Familie zum Essen zusammensitzt. Schon gar nicht generationenübergreifend."
Weihnachten und Silvester sind in vielen Familien aber noch immer Anlässe, festlich zu decken und gemeinsam zu tafeln. Wie das die königlich-dänischen Tischeindecker auf Schloss Amalienburg für ein feierliches Silvestermenü gestalten, ist gerade in einer Ausstellung des Bremer Wilhelm-Wagenfeld-Hauses zu sehen. Die dänische Designerin Margrethe Odgaard hat dazu eine Tischdecke entworfen, auf der weiße Linien eingewebt sind, die genau vorgeben, wo was zu stehen hat: eine Vielzahl von Besteckteilen, Tellern und Gläsern.
Spiegel der Gesellschaft
"Die Tischdecke lenkt die Aufmerksamkeit auf soziale Konstellationen", erläutert Kathrin Hager, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Design-Museums. Und sie wirft Fragen auf: Wann behindern sich Ellenbogen? Wie viel Nähe unterstützt ein Gespräch? Wann fühlen sich Gäste wohl?
Die Kulturwissenschaftlerin sieht in der Tischkultur einen Spiegel der Gesellschaft. Wirkten zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch Regeln aus höfischen Traditionen, spielten in den 1920er Jahren effektivere Arbeitsabläufe durch kurze Wege und neue Materialien eine Rolle. Neben sachlicher Moderne tauchte im Nationalsozialismus aus ideologischen Gründen "Volkskunst" wie Westerwälder Steingut und Bunzlauer Keramik auf den Tischen auf, wie aus einem Beratungsheft für Bäuerinnen unter dem Titel "Heimat deckt die Tische" hervorgeht.
Im Nachkriegsdeutschland kamen vermehrt skandinavische Einflüsse und auch individuellere Noten dazu. Genau wie in der Gesellschaft sei heute Vielfalt der Trend, sagt Hager. Doch egal, ob weiß oder bunt, bescheiden oder opulent gedeckt - "Hauptsache sorgfältig", meint Geffken und betont: "Der gedeckte Tisch sollte eine Seele haben."
Das sieht der Theologe Fuchs genauso und rät, auch unabhängig von äußeren Anlässen wie den jetzt anstehenden Feiertagen öfter zum Miteinander-Essen zusammenzukommen, im Restaurant oder in der Familie: "Das ist immer ein kleines Fest im Alltag."
NRW ehrt Bethel-Chef Pohl und Otto Rehhagel
Aachen (epd). Das Land Nordrhein-Westfalen hat neun Bürgerinnen und Bürger mit seinem Verdienstorden geehrt. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) überreichte die Auszeichnungen am 15. Dezember im Historischen Rathaus Aachen. Zu Gewürdigten zählen unter anderem der Vorstandsvorsitzende der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, Ulrich Pohl, und der ehemalige Fußballtrainer Otto Rehhagel.
"Manager mit christlichem Kompass"
Laschet würdigte Bethel-Chef Ulrich Pohl als einen "Manager mit christlichem Kompass, für den immer der Mensch im Mittelpunkt steht". Seit 2001 sei er bei den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel tätig, seit zehn Jahren als deren Leiter. Dabei gelinge es ihm Vorurteile gegenüber sozial benachteiligten Menschen abzubauen und Brücken aufzubauen. Auch die Weiterentwicklung des Spendenwesens Bethels sei eng mit Pohls Namen verbunden. "Ulrich Pohl ist ein 'Menschenfischer', dem es gelingt, Menschen für die Arbeit Bethels und damit vor allem für die Menschen, die in Bethel auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind, zu gewinnen", erklärte der Ministerpräsident.
Blick und das Herz für Mitmenschen
Mit Ex-Trainer Otto Rehhagel würdige das Land "eine Persönlichkeit, die auch über das Sportliche hinaus vorbildlich ist", sagte Laschet weiter. So engagiere sich Rehhagel sozial in vielen Bereichen wie etwa als Schirmherr und Kuratoriumsmitglied der Stiftung Universitätsmedizin Essen, die sich um schwerstkranke Kinder kümmert. Auch sei er Gründungsmitglied des Vereins "Essener Chancen - Rot-Weiss Essen" zur Unterstützung sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher. In Kindergärten und Grundschulen werbe er für mehr Bewegung. "Otto Rehhagel ist ein Menschenfreund", betonte Laschet. Bei allem persönlichen Erfolg habe er den Blick und das Herz für seine Mitmenschen nicht verloren.
Verdienstorden an neun Persönlichkeiten
Einen Verdienstorden erhielt zudem die 89 Jahre alte CDU-Politikerin und ehemalige Bundesministerin Dorothee Wilms als "Vorreiterin ihrer Generation, die den Rechten der Frauen früh eine Stimme gab", wie es hieß. Weitere Ausgezeichnete sind der Gründer des Vereins "Lebenshilfe im Kreis Viersen", Horst Bessel, der Präsident des Deutschen Schaustellerbundes, Albert Ritter, und Margot Burmann aus Meschede, die sich für Menschen mit Down-Syndrom einsetzt. Auch der Mitbegründer der RAG-Stiftung Ludwig Ladzinski, der ehemalige Stadtdirektor der Stadt Nettetal, Christian Weisbrich, und der Unternehmer Michael Wirtz aus Stolberg wurden geehrt.
Der NRW-Verdienstorden ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes und wurde 1986 aus Anlass des 40. Geburtstages des Landes gestiftet. Die Würdigung wird an Bürger als Anerkennung ihrer außerordentlichen Verdienste für die Allgemeinheit und ihr Engagement für die Gesellschaft verliehen. Seit seiner Einführung sind rund 1.600 Frauen und Männer mit dem Verdienstorden ausgezeichnet worden. Die Zahl der Orden ist auf 2.500 begrenzt.
Bundesverdienstkreuz für Hannelore Kraft

epd-West/Marcus Gloger
Berlin, Düsseldorf (epd). Die ehemalige nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte ihr das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband am 13. Dezember im Schloss Bellevue in Berlin. In den sieben Jahren ihrer Regierungszeit im bevölkerungsreichsten Bundesland sei Kraft von vielen Bürgern als "große Landesmutter" und "Kümmerin" wahrgenommen worden, sagte Steinmeier. Ihr Einsatz für mehr Gerechtigkeit und ihr sozial engagiertes Wirken sei über Partei- und Landesgrenzen hinaus geschätzt worden.
Kraft war von 2010 bis 2017 Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, zunächst als Chefin einer rot-grünen Minderheitsregierung. Bei vorgezogenen Neuwahlen 2012 erreichten SPD und Grüne dann eine Mehrheit im NRW-Landtag. Nach der verlorenen Landtagswahl 2017 gab Kraft ihre Parteiämter als SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende ab und zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Sie ist nach wie vor Landtagsabgeordnete für ihre Heimatstadt Mülheim an der Ruhr.
Steinmeier verlieh die Auszeichnung zudem an den amtierenden hessischen Regierungschef Volker Bouffier (CDU) sowie die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), und Sachsen, Stanislaw Tillich (CDU). Der Bundespräsident dankte den Geehrten für ihren langjährigen politischen Einsatz. Die parlamentarische Demokratie brauche "Menschen, die bereit sind, in den demokratischen Institutionen politische Verantwortung zu übernehmen und Politik zu ihrem Beruf zu machen", unterstrich Steinmeier.
NS-Prozess in Münster wegen Verhandlungsunfähigkeit ausgesetzt
Münster (epd). Der Prozess am Landgericht Münster gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann ist wegen des schlechten Gesundheitszustandes des 95-jährigen Angeklagten vorerst abgebrochen worden. Derzeit sei der Mann aus dem Kreis Borken nicht verhandlungsfähig, sagte ein Sprecher des Gerichts am 13. Dezember dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Mann sei wegen einer schweren Herz- und Nierenerkrankung im Krankenhaus. Der medizinische Gutachter sei beauftragt worden, im Januar Bericht über den Zustand des Mannes Bericht zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft Dortmund wirft dem ehemaligen KZ-Wachmann Beihilfe zum Mord in mehreren hundert Fällen vor (AZ: 10 KLs - 45 Js 2/16 - 13/17).
Falls sich der Gesundheitszustand des Mannes im Januar wieder gebessert haben sollte, müsste der Prozess jedoch noch einmal neu beginnen, erläuterte der Sprecher. Nach der Strafprozessordnung dürfe ein solcher Prozess nicht länger als drei Wochen unterbrochen werden, zudem dürfe der Prozess nur in Anwesenheit des Angeklagten geführt werden. Eine Fortsetzung des Prozesses sei daher nicht möglich. Bei einer Neuverhandlung müssten beispielsweise auch die Zeugen noch einmal neu gehört werden.
Laut dem medizinischen Gutachter habe sich der Gesundheitszustand des Mannes, der seit Jahren chronisch herz- und nierenkrank sei, in letzter Zeit stark verschlechtert, sagte der Gerichtssprecher weiter. Der Zustand könne sich vielleicht wieder bessern. Nach Einschätzung des Gutachters sei es jedoch eher unwahrscheinlich, dass der Mann den gesundheitlichen Zustand von vor wenigen Wochen wieder erreiche.
Der Angeklagte war nach Angaben des Gerichts von Juni 1942 bis Herbst 1944 für die Bewachung des Lagers und die Beaufsichtigung von Arbeitskommandos außerhalb des Lagers zuständig. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe er von der Ermordung von Häftlingen gewusst und diese durch seine Tätigkeit im Wachdienst "willentlich gefördert". Der ehemalige SS-Mann hatte vor Gericht eine individuelle Schuld an Tötungen im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig bestritten.
Land wirbt mit Plakaten für Ausstieg aus dem Rechtsextremismus
Dortmund (epd). Das Land NRW wirbt jetzt auch in dem für seine Neonazi-Szene berüchtigten Stadtteil Dortmund-Dorstfeld für sein Rechtsextremismus-Aussteigerprogramm "Spurwechsel". "Wir kleben die Plakate ganz bewusst da, wo unsere Zielgruppe ist", sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am 14. Dezember bei der Vorstellung der Plakate im Dorstfelder Zentrum. Damit wolle das Land die Gesellschaft für die Gefahren des Extremismus sensibilisieren und zugleich Betroffenen die Möglichkeiten zum Ausstieg aus der Szene aufzeigen.
Das Aussteigerprogramm richtet sich an Menschen, die bereits fest in der rechtsextremistischen Szene verankert sind. In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Zählung des Verfassungsschutzes fast 3.400 Rechtsextremisten. Rund zwei Drittel davon gelten als gewaltorientiert. "Diese Ewiggestrigen dürfen keine Chance haben, unsere Stadtviertel zu übernehmen. Noch nicht einmal eine einzige Straße", forderte Reul. Es gelte der Grundsatz: "Kein Fußbreit den Rechtsextremisten."
Der Verfassungsschutz wirbt derzeit mit fünf verschiedenen Plakatmotiven für das "Spurwechsel"-Programm. Insgesamt umfasst die Öffentlichkeitskampagne der Verfassungsschützer, mit der auch das Aussteigerprogramm Islamismus "API" und das Salafismus-Präventionsprogramm "Wegweiser" beworben werden, sogar 15 Motive. Mit ihnen wurden in den vergangenen Wochen landesweit 680 Werbeflächen bestückt.
Gericht verurteilt Wachleute wegen Misshandlung von Flüchtlingen
Siegen (epd). In dem Verfahren wegen Misshandlungen in der Flüchtlingsunterkunft im siegerländischen Burbach hat das Landgericht Siegen am 11. Dezember drei Wachmänner zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Einer der angeklagten Wachmänner erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung, wie das Gericht mitteilte (AZ: 21 KLs 29/18). Das Gericht sah bei dem Mann sechs Fälle der Freiheitsberaubung als erwiesen an, davon zwei mit vorsätzlicher Körperverletzung. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen drei Fällen von Freiheitsberaubung zu einer Geldstrafe von 1.200 Euro verurteilt, eine Wachfrau erhielt eine Geldstrafe von 900 Euro.
Der Prozess gegen die drei geständigen Angeklagten war vom Hauptverfahren abgetrennt worden. Insgesamt müssen sich vor dem Landgericht Siegen 30 Angeklagte wegen der Misshandlung von Flüchtlingen in der Asylunterkunft verantworten. 28 Wachleuten und Mitarbeitern des Heimbetreibers European Homecare waren Körperverletzungen, Nötigungen, Diebstähle und Freiheitsberaubung vorgeworfen worden. Unter anderem sollen sie Bewohner bei Verstößen gegen die Hausordnung teilweise für mehrere Tage in sogenannte "Problemzimmer" gesperrt haben. Insgesamt geht es um 54 Fälle von Ende 2013 bis September 2014.
Soziales
Geteilte Reaktionen auf Regierungs-Kompromiss zu 219a

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Der Kompromissvorschlag der Bundesregierung zur Neuregelung des Werbeverbots für Abtreibungen stieß am 13. Dezember auf geteilte Reaktionen. Die Gießener Ärztin Kristina Hänel sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), es werde dabei bleiben, "dass wir Ärzte nicht frei informieren dürfen". Hänels Verurteilung zu einer Geldstrafe - weil sie darüber informierte, dass sie Abtreibungen durchführt - hatte die Debatte über den Paragrafen 219a ausgelöst und hat nun zu der geplanten Gesetzesnovelle geführt. Hänel sagte, sie werde den gerichtlichen Weg weitergehen.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sagte hingegen im Deutschlandfunk, er sehe die Chance, das Thema im Interesse von Frauen und Ärzten zu lösen. Die neue CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer lobte die Einigung. Aus der SPD war zunächst wenig zu hören. Die SPD-Frauenorganisation lehnte den Kompromiss klar ab, ebenso Frauenverbände und pro familia. Die FDP bezeichnete den Regierungs-Vorschlag als "nicht ausreichend". Grüne und Linke fordern weiter die Streichung des Paragrafen.
Details für Januar angekündigt
Dem am 12. Dezember veröffentlichten Einigungspapier zufolge sollen staatliche Stellen damit beauftragt werden, Informationen zur Verfügung zu stellen, welche Ärzte und medizinischen Einrichtungen Abtreibungen vornehmen. Beauftragt werden sollen die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Der Informationsauftrag soll im umstrittenen Paragraf 219a verankert werden. Details wurden für Januar angekündigt.
Kramp-Karrenbauer schrieb beim Kurznachrichtendienst Twitter, der Schutz des Lebens, ungeborenes und geborenes, habe für die CDU überragende Bedeutung. Deshalb sei es gut, dass das Werbeverbot bleibe. In einer Erklärung vom 12. Dezember betonte die CDU, wenn der Gesetzestext vorliege, werde man darauf achten, dass keine Abschaffung des Werbeverbots durch die Hintertür erfolge.
Ärztepräsident Montgomery sagte, niemand wolle für Schwangerschaftsabbrüche werben. Schwangere Frauen müssten sich aber über das Verfahren informieren können. Die FDP bemängelte hingegen, dass der Handlungsspielraum von Ärzten eingeschränkt bleibe. Der Vize-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae sagte, er verstehe den Kompromiss so, dass Ärzte auch künftig nicht selbst über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte im Magazin "Focus" in Aussicht, die Regierung werde "genau definieren, welche Informationen der Arzt geben darf."
Warten auf Konkretisierung
Grüne, Linke, SPD und zuletzt auch die FDP hatten hingegen für die vollständige Streichung des § 219a plädiert. Auf Antrag der FDP sollte darüber im Bundestag abgestimmt werden. Daran hielt die FDP-Fraktion fest.
Die Chefs der Koalitionsfraktionen hatten sich in ersten Reaktionen zurückhaltend geäußert. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) sagte, "die Koalitionsfraktionen warten nun die weitere Konkretisierung der angesprochenen Punkte ab." Es sei gut, dass es einen Kompromissvorschlag gebe, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles.
Der Gesundheitspolitiker und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Karl Lauterbach verteidigte den Kompromiss in einer Bundestagsdebatte. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF), Maria Noichl, sagte hingegen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die SPD-Frauen könnten der Einigung "niemals zustimmen."
Kirche begrüßte Ankündigung
Die Grünen-Fraktion sprach von einem "unausgegorenen Vorschlag". Der Paragraf 219a müsse aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, und es müssten klare Regelungen zur Informationsfreiheit gefunden werden, erklärten die frauenpolitische Sprecherin Ulle Schauws und Katja Keul, Sprecherin für Rechtspolitik. Für die Linksfraktion erklärte deren Frauenpolitikerin Cornelia Möhring, es werde sich nichts ändern. Der angebliche Kompromiss sei eine "Nullnummer" und offenbare nur die Schwäche der SPD in der Koalition.
In der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) stößt der Kompromiss weitgehend auf Zustimmung. Die Kirche begrüße die Ankündigung der Bundesregierung, in der Frage des Werbeverbots für Klarheit zu sorgen, erklärte der EKD-Bevollmächtigte in Berlin, Martin Dutzmann. Es sei richtig, wenn auch weiterhin nicht für den Schwangerschaftsabbruch geworben werden dürfe, die betroffenen Frauen sich aber darüber informieren könnten.
Mehr Rechtssicherheit für Ärzte
Um den Kompromiss war innerhalb der Bundesregierung lange gerungen worden. Verhandelt wurde er von Justizministerin Katarina Barley, Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD), Innenminister Horst Seehofer (CSU) Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU).
Um Ärzten Rechtssicherheit zu geben, soll "rechtlich ausformuliert" werden, dass sie, wie auch Krankenhäuser, darüber informieren können, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Unklar blieb, ob sie selbst informieren oder auf die staatlich beauftragten Informationen hinweisen können sollen.
Demenz nimmt keine Rücksicht auf Weihnachten

epd-bild/Hanna Eder
Düsseldorf (epd). Vergangenes Jahr an Heiligabend packte Michael M. seine demenzkranke Mutter ins Auto und fuhr mit ihr in den Schwarzwald. Dort, in ihrem Elternhaus, in dem noch die jüngere Schwester wohnt, wollte er mit ihr "Heiligabend so wie früher" feiern. "Wir haben da mit der Familie viele schöne Weihnachtsfeste verbracht. Ich wollte, dass meine Mutter das noch einmal erleben kann", sagt Michael M. Doch die gut gemeinte Reise geriet zum Desaster. "Ich würde es nie wieder tun", sagt der Sohn rückblickend. "Meine Mutter war unruhig, rannte nachts durchs Haus. Und gegenüber den Verwandten wurde sie richtig aggressiv."
Erlebnisse wie die von Michael M. höre sie nach den Feiertagen immer wieder, sagt Julia Richarz, Leiterin des Sozialen Dienstes im Kompetenzzentrum Demenz der Diakonie Düsseldorf. "Oft wird berichtet, dass demenzkranke Angehörige weglaufen wollten oder unwirsch zu extra von weither angereisten Angehörigen waren." Das seien Anzeichen von Überforderung.
Emotional aufgeladen
Auch beim Verein Alzheimer Forschung Initiative (AFI) melden sich vor und nach der Weihnachtszeit besonders viele Angehörige mit Fragen und Problemen. "Die Weihnachtstage sind traditionell eine emotional aufgeladene Zeit", sagt der AFI-Vorsitzende Michael Lorrain. Bei den pflegenden Angehörigen sei dann oft der Wunsch nach Ruhe und Besinnlichkeit besonders groß. "Die Demenz nimmt aber keine Rücksicht darauf."
Wenn dann Stress und andere Belastungen dazu kämen, könne auffälliges oder provokatives Verhalten des Kranken das Fass zum Überlaufen bringen, beobachtet der Neurologe. "Da kann es zu echten Eskalationen kommen." Angehörige verlören dann schon einmal die Nerven, schrien den Kranken an. Im Extremfall komme es auch zu körperlicher Gewalt.
Damit die Situation an den Feiertagen nicht eskaliert, rät Sozialpädagogin Richarz pflegenden Angehörigen, der allgemeinen Hektik der Adventszeit aus dem Weg zu gehen. So könnte die Familie überlegen, das Fest möglicherweise etwas schlichter zu feiern, um den Aufwand zu reduzieren. "Man sollte sich auf das Wesentliche besinnen. Das tut oft auch den Betreuenden gut."
"Einfache Dinge"
Auch Susanne Gittus von der Alzheimer Gesellschaft Baden-Württemberg in Stuttgart empfiehlt, die Feiertage mit dem Kranken möglichst reizarm zu gestalten. "Wenige, einfache Dinge sind oft genug." Dazu gehöre es auch, den Kranken am besten in seiner vertrauten Umgebung zu belassen. "Ortswechsel können für einen dementen Menschen ein Problem sein, auch wenn es zu Verwandten geht."
Richarz rät, mit dem Demenzkranken in kleinem Rahmen zu feiern. "Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass die Enkel nicht gemeinsam zur Großmutter kämen, sondern einzeln zu kurzen Besuchen von 30 Minuten bis zu maximal einer Stunde." Lange Besuche und viele Fragen, auch wenn sie gut gemeint seien, überforderten den Kranken, sagt auch Lorrain.
Bei der Gestaltung des Festes sei es am besten, auf Traditionen zurückzugreifen, die dem Kranken vertraut seien, sagt Gittus. "Unsere moderne Art Weihnachten zu feiern mit Popsongs wie 'Last Christmas' oder Raclette ist für Demenzkranke oft ein Problem." Gittus empfiehlt, besser gewohnte Speisen aufzutischen.
Königsweg Musik
Die Traditionen und Rituale der Advents- und Weihnachtszeit könnten für das Zusammenleben mit Demenzkranken auch positive Impulse geben, sagt Gittus. Einen sehr guten Effekt könnten alt vertraute Weihnachtslieder haben: "Musik ist ein Königsweg." Oft könnten Demenzkranke noch alle Strophen von bekannten Liedern auswendig. Das schenke ihnen ein Erfolgserlebnis. "Selbst sehr stille und verschlossene Menschen singen oft mit."
Wenn es um Geschenke für den Kranken geht, dann rät Richarz zu nützlichen Dingen, die eine unmittelbare Wirkung entfalten: "Etwa ein schöner Schal oder eine Tischdekoration." Lorrain appelliert an die Angehörigen, auch das pflegende Familienmitglied nicht zu vergessen. Das beste Geschenk sei, Zeit mit dem Demenzkranken zu verbringen und den pflegenden Angehörigen zu entlasten.
Alzheimer-Gesellschaften wollen nationalen Demenzplan
Düsseldorf (epd). Der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften NRW hat für die Versorgung von Demenzpatienten mehr speziell qualifiziertes Pflegepersonal in den Heimen und Krankenhäusern gefordert. Dafür sei eine möglichst umfassende öffentliche Finanzierung der Ausbildungskosten für angehende Pflegekräfte nötig, sagte die Landesvorsitzende der Alzheimer Gesellschaften NRW, Regina Schmidt-Zadel, am 14. Dezember in Düsseldorf. Schmidt-Zadel forderte zudem die Einführung eines nationalen Demenzplanes in Deutschland sowie Demenzbeauftragte in allen Krankenhäusern.
"Krisendienste" in Heimen und Krankenhäusern gefordert
Die Landesvorsitzende der Alzheimer Gesellschaften NRW sprach sich zudem für eine Umwandlung der derzeit geltenden Pflegeversicherung in eine Vollversicherung aus. Für die Pflege müsse es mindestens einen zeitlich befristeten Einsatz von Steuergeldern geben. Schmidt-Zadel mahnte zudem "Krisendienste" in Heimen und Krankenhäusern für Alzheimer- und Demenzpatienten an.
Der Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Deutschland, der frühere SPD-Bundesvorsitzende Franz Müntefering, kritisierte, dass zu wenig für die Belange von Alzheimer- und Demenzpatienten und für deren Versorgung getan wird. Das Symposium im Düsseldorfer Landtag stand unter dem Motto "Pflege ohne Menschen".
Die Alzheimer Gesellschaften sprachen sich für die möglichst flächendeckende Einführung von Selbsthilfeangeboten im Bereich Demenz aus. Wenn Angehörige in ihrer Umgebung nicht auf ein solches Angebot für Menschen mit Demenz zugreifen könnten, sollten sie den Verband kontaktieren, hieß es. Auch viele Heimleitungen sind laut Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW nicht ausreichend für den Umgang mit Demenzpatienten ausgebildet. In NRW leben laut Alzheimergesellschaften rund 300.000 Menschen mit der Diagnose Demenz.
Bundesgerichtshof: Konkrete Patientenverfügung ist bindend
Karlsruhe (epd). Eine Patientenverfügung muss sich auf konkrete Lebens- und Behandlungssituationen beziehen. Die Hinweise, ein "würdevolles Sterben" und "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" zu wünschen, reichten für sich genommen nicht aus, damit die Verfügung wirksam ist, entschied der Bundesgerichtshof in einem am 13. Dezember in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. Eine wirksame Patientenverfügung sei zudem für alle und damit auch gegen den Willen eines Betreuers bindend. Die Gerichtsentscheidung zeigt nach Auffassung der Deutschen Stiftung Patientenschutz, wie wichtig neben der Patientenverfügung auch eine Vorsorgevollmacht ist. (AZ: XII ZB 107/18)
Konkret ging es um eine 78-jährige Frau aus Bayern, die 2008 einen Schlaganfall erlitten hatte. Sie liegt seitdem im Wachkoma und wird über eine Magensonde künstlich ernährt. Bereits 1998 hatte sie eine Patientenverfügung verfasst, in der sie "lebensverlängernde Maßnahmen" ablehnte, wenn "keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins besteht".
Streit zwischen Angehörigen
Angehörigen gegenüber hatte sie erwähnt, dass sie im Fall eines Wachkomas nicht künstlich ernährt werden wolle. Nach ihrem Schlaganfall im Jahr 2008 hatte sie gegenüber einer Therapeutin einmalig sprechen können und gesagt: "Ich möchte sterben."
Als die Frau ins Wachkoma fiel, wurden der Ehemann und ihr Sohn zu Betreuern bestellt. Der Sohn wollte seit 2014 die künstliche Ernährung seiner Mutter beenden lassen. Es gebe keine Hoffnung, dass sich ihr Zustand bessere. Dies entspreche auch ihren in der Patientenverfügung niedergeschriebenen Willen, argumentierte er.
Der Ehemann lehnte dies ab und verwies darauf, dass seine Frau in der Patientenverfügung ebenfalls ausdrücklich eine "aktive Sterbehilfe" ablehne. Sie sei praktizierende Katholikin gewesen.
Der Bundesgerichtshof hatte in dem konkreten Fall bereits am 24. März 2017 gefordert, Patientenverfügungen ernst zu nehmen. Das Gericht hatte das Verfahren zur weiteren Prüfung an das Landgericht zurückverwiesen (AZ: XII ZB 604/15). Dieses erkannte, dass der in der Verfügung enthaltene Wille der Frau, in solch einer Situation sterben zu wollen, für alle bindend sei. Es bedürfe daher keiner gerichtlichen Genehmigung zum Abbruch der künstlichen Ernährung.
"Eigene Entscheidung akzeptieren"
Die dagegen eingelegte Beschwerde des Ehemannes wies der Bundesgerichtshof nun zurück. Zwar reiche der Wunsch, nach einem "würdevollen Sterben" und "keine lebenserhaltenden Maßnahmen durchzuführen" allein nicht für die Wirksamkeit einer Patientenverfügung aus. Hier habe die Frau aber ausreichend konkret erklärt, in welchen Lebens- und Behandlungssituationen die Verfügung gelten solle - und zwar, wenn "keine Aussicht auf Wiedererlangung des Bewusstseins" bestehe. Das führe in diesem Fall zur Wirksamkeit der Patientenverfügung. In solch einer Situation müssten Gerichte den Abbruch der künstlichen Ernährung nicht erst genehmigen. Auch der Betreuer müsse die "eigene Entscheidung der Betroffenen" akzeptieren.
Der BGH-Beschluss mache deutlich, je konkreter eine Patientenverfügung ist, umso besser, erklärte die Stiftung Patientenschutz in Dortmund. Sie empfahl, die eigene Patientenverfügung darauf zu überprüfen, ob klar beschrieben sei, bei welcher Krankheit welche ärztlichen Maßnahmen gewünscht oder abgelehnt werden. "Denn dann ist das Dokument eindeutig und muss entsprechend umgesetzt werden", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch.
Kabinett entfristet Amt des Missbrauchsbeauftragten

epd-bild / Rolf Zöllner
Berlin (epd). Das nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche von 2010 geschaffene Amt eines Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs wird zur Dauereinrichtung. Das Bundeskabinett beschloss am 12. Dezember in Berlin ein Konzept von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zum Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt. Bisher war die Amtszeit des Missbrauchsbeauftragten Johannes-Wilhelm Rörig bis März 2019 befristet.
Giffey erklärte: "Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist grausam und reißt Wunden, die oft ein ganzes Leben lang nicht verheilen." Es gehe nicht um bedauernswerte Einzelfälle, "sondern um ein großes gesamtgesellschaftliches Problem". Rörig fügte hinzu: "Kinder haben ein Recht auf unseren Schutz und unsere Hilfe. Hierfür brauchen wir Strukturen, die sich dauerhaft dafür einsetzen."
Betroffenenrat kann weiterarbeiten
Der ehrenamtlich tätige Betroffenenrat beim Missbrauchsbeauftragten soll ebenfalls weiterarbeiten können. Giffey beruft hierzu den Angaben nach 12 bis 18 Personen, die in der Kindheit oder Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben. Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland soll bis Ende 2023 abgesichert werden. Bisher war die Arbeit der Kommission unter Leitung der Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen ebenfalls bis März 2019 befristet. Das Gremium hatte seine Arbeit Anfang 2016 aufgenommen. Es sammelt die Schilderungen Betroffener, veranstaltet öffentliche Hearings und treibt in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern die unabhängige Aufarbeitung voran.
Die erste Missbrauchsbeauftragte war die frühere Bundesfamilienministerin Christine Bergmann (SPD). Rörig wurde 2011 ihr Nachfolger. Dem Juristen gelang es in den vergangenen Jahren, das Thema in der Öffentlichkeit zu halten und mit zahlreichen Dachverbänden und Institutionen Selbstverpflichtungen zur Prävention von Missbrauch etwa in Schulen, Sportvereinen und Kirchengemeinden abzuschließen.
Rörig fordert eine unabhängige Aufarbeitung der kirchlichen Missbrauchsfälle und größere Anstrengungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Gewaltbildern im Internet sowie mehr Möglichkeiten für Ermittler im Darknet. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vorigen Jahr 13.500 Kinder und Jugendliche Opfer von sexualisierter Gewalt und Ausbeutung. Das Dunkelfeld ist weit größer. Die Weltgesundheitsorganisation geht für Deutschland von einer Million betroffener Jungen und Mädchen aus. Rechnerisch sind das zwei Kinder pro Schulklasse.
Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe deutlich gestiegen
Düsseldorf (epd). Die Ausgaben für Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen sind 2017 deutlich gestiegen. Insgesamt flossen 10,3 Milliarden Euro in Einrichtungen, Einzel- und Gruppenhilfen, neun Prozent mehr als im Vorjahr, wie das statistische Landesamt am 12. Dezember in Düsseldorf mitteilte. Die Einnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe durch Gebühren, Teilnehmerbeiträge und Ähnliches beliefen sich auf 658 Millionen Euro.
Mehr als die Hälfte der Summe wurde für Kindertageseinrichtungen aufgewendet. Die Ausgaben hierfür stiegen gegenüber 2016 um 13,1 Prozent von fünf auf 5,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für weitere Einrichtungen der Jugendarbeit lagen nach Angaben der Statistiker bei rund 500 Millionen Euro. 4,3 Milliarden Euro flossen in Einzel- und Gruppenhilfen. Dazu gehören etwa Erziehungsberatung, sozialpädagogische Einzelbetreuungen, Heimunterbringungen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche oder Schutzmaßnahmen für gefährdete Kinder.
Bald drittes Geschlecht im Geburtenregister
Berlin (epd). Im Geburtenregister wird es künftig neben dem männlichen und weiblichen Geschlecht auch eine dritte Option geben. Nach dem Beschluss des Bundestags stimmte auch der Bundesrat am 14. Dezember in Berlin einem Gesetz zu, das intersexuellen Menschen die Möglichkeit gibt, als Geschlecht "divers" eintragen zu lassen. Bislang gab es lediglich die Möglichkeit, dass Standesbeamte die Geburt ohne eine Geschlechtsangabe eintragen.
Der Gesetz geht auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Jahr zurück, das im Personenstandsrecht einen Verstoß gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Diskriminierungsverbot feststellte. Die Richter verlangten, dass auch ein "positiver Geschlechtseintrag" ermöglicht werden muss.
Für die Eintragung zum Zeitpunkt der Geburt eröffnet das Gesetz nun die vier Eintragungsmöglichkeiten "männlich", "weiblich, "divers" oder keine Geschlechtsangabe. Älteren Betroffenen gibt das Gesetz die Möglichkeit, die bisher registrierte Geschlechtsangabe und auch die Vornamen durch eine Erklärung gegenüber dem Standesamt ändern zu lassen.
Kita-Gesetz von Bundestag und Bundesrat beschlossen

epd West / Bertold Fernkorn
Berlin, Münster (epd). Der Bund will in den kommenden vier Jahren 5,5 Milliarden Euro zusätzlich an die Länder überweisen, um die Qualität der Kleinkindbetreuung zu verbessern. Das sogenannte Gute-Kita-Gesetz passierte am 14. Dezemberin Berlin den Bundestag und den Bundesrat. Es kann damit Anfang 2019 in Kraft treten. Der Bund will mit jedem einzelnen Bundesland eine Vereinbarung abschließen, wie das Geld eingesetzt wird. Kritik kam von der Opposition und von Sozialverbänden.
5,5 Milliarden Euro für bessere Kleinkindbetreuung
Der Bundestag beschloss das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung" mit den Stimmen der Koalition aus Union und SPD. Die Opposition lehnte das Gesetz geschlossen ab. Die Grünen, die Linksfraktion und die FDP warfen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) vor, deutlich hinter den eigenen Zielen zurückzubleiben.
Giffey verteidigte das Gesetz als wichtigen Schritt "für mehr Qualität und weniger Gebühren". Jedes Kind müsse die gleichen Startchancen erhalten. Für einheitliche, bundesweit verbindliche Vorschriften über Qualitätsstandards sei die Zeit aber noch nicht reif, sagte sie.
Die Länder können die Bundesmitttel in die Einstellung zusätzlicher Erzieherinnen und Erzieher investieren, in bessere Ausstattung, längere Öffnungszeiten, Sprachförderung oder besseres Essen - aber auch, um die Eltern teilweise oder vollständig von den Gebühren zu befreien. Über die Kriterien für die soziale Staffelung der Beiträge entscheiden die Länder in Eigenregie.
Das sorgte bei Grünen, Linken und FDP gleichermaßen für Kritik. Das Gesetz werde kaum für eine wirklich bessere Betreuung sorgen, kritisierte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Über die Qualität einer Kita entscheide in allererster Linie, wie viele Fachkräfte für die Kinder da seien. Dafür seien bundesweit verbindliche Betreuungsschlüssel unverzichtbar. Grüne und Linke stellten dazu einen eigenen Antrag, den die Koalition zurückwies.
Caritas: Zusagen nur befristet
Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband kritisierte das "Gute-Kita-Gesetz". "Es ist deprimierend zu sehen, wie ein sinnvolles Vorhaben so zerfleddert wurde", sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Die Caritas im Bistum Münster bezweifelte, ob das Gesetzt zu Qualitätsverbesserungen in den Kindertagesstätten führen werde. Problematisch sei vor allem, dass der Bund den Ländern nur bis 2022 befristet zusätzliches Geld für die Kleinkindbetreuung geben will, sagte der Caritasdirektor des Bistums, Heinz-Josef Kessmann.
Giffey verteidigte ihr Gesetz als einen Kompromiss mit den Bundesländern. Die Verhältnisse in den Ländern seien immer noch sehr unterschiedlich, sagte Giffey. Gebührenfreiheit sei richtig, wenn sich Familien den Kita-Besuch ihrer Kinder nicht leisten könnten, weil sie dafür mehrere hundert Euro im Monat bezahlen müssten.
Geringverdiener künftig von Kita-Gebühren befreit
Vorgeschrieben ist im "Gute-Kita-Gesetz", dass bundesweit Geringverdiener, die Wohngeld oder den Kinderzuschlag beziehen, von den Kita-Gebühren befreit werden müssen. Giffey sagte, das helfe den Familien von 1,2 Millionen Kita-Kindern. Insgesamt werden 3,1 Millionen Kleinkinder in Kitas betreut, das ist jedes dritte Kind unter drei Jahren.
Dass die Mittel des Bundes nur bis 2022 fließen sollen, kritisierten alle Oppositionsfraktionen im Bundestag. Aus Sicht der FDP wird die Befristung dazu führen, dass kaum neue Fachkräfte eingestellt werden, weil die Länder fürchten müssen, langfristig auf den Ausgaben sitzenzubleiben. Giffey versicherte, ihr Ziel bleibe, dass sich der Bund dauerhaft in der Kita-Finanzierung engagiere.
Im Bundesrat, der das Gesetz nach dem Bundestagsbeschluss beriet, stand die Befristung der Bundesmittel im Zentrum der Kritik. Am Ende der Debatte stimmte die Länderkammer dem Gesetz gleichwohl zu und forderte in einer Entschließung, die zeitliche Befristung der Bundesmittel spätestens im Jahr 2020 aufzuheben.
Zuspruch für Aktion zur "Rettung" des Offenen Ganztags
Düsseldorf (epd). Die "Kampagne Offener Ganztag" (OGS) hat am 12. Dezember 55.800 Unterschriften für bessere Bildung und Erziehung an NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer und ihren Kabinettskollegen, Familienminister Joachim Stamp (beide FDP), überreicht. Die Aktion hatte die Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege nach den vergangenen Sommerferien bis Ende November durchgeführt, um weitere Verbesserungen für den Offenen Ganztag zu erreichen. Unter der Überschrift "Wir bleiben dran!" fordern sie ein "Rettungspaket" für das nachmittägliche Betreuungs- und Bildungsprogramm an Grundschulen.
Knapp 56.000 Unterschriften an Minister Gebauer und Stamp überreicht
Die Vorsitzende des Arbeitsausschusses Familie, Jugend und Frauen der Arbeitsgemeinschaft, Helga Siemens-Weibring, begrüßte die Aktion und die Mobilisierung mittels Online-Petition, Unterschriftenlisten und Postkarten. Die Träger aus den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in NRW verantworten in über 2.000 Offenen Ganztagsschulen rund 80 Prozent aller Angebote im Offenen Ganztag (OGS) im Bundesland. Erreicht werden dadurch insgesamt rund 200.000 Schülerinnen und Schüler.
"Gute OGS darf keine Glückssache sein. Überall im Bundesland brauchen wir hochwertige pädagogische Angebote. Familie und Beruf müssen vereinbar sein. Hier kommt dem Offenen Ganztag eine Schlüsselrolle zu", erklärte Siemens-Weibring bei der Übergabe der Unterschriften im Düsseldorfer Landtag. "Zentral ist der Dreiklang aus Bildung, Erziehung und Betreuung", betonte der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, Christian Heine-Göttelmann, und forderte eine gesetzliche Verankerung des Offenen Ganztags. "Letztlich brauchen wir eine gesetzliche Grundlage für den Offenen Ganztag, damit nicht der Wohnort der Kinder über die pädagogische Qualität entscheidet."
Wohlfahrtspflege: Zusagen vom Land reichen nicht
Für den Landeshaushalt 2019 sind bisher leichte Erhöhungen für den Ganztag angekündigt, hieß es bei der Aktion am 12. Dezember. Aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege reicht das allerdings bei weitem nicht. Pro Kind und Jahr würden 3.250 Euro gebraucht. Bislang steuere das Land circa 1.100 Euro pro Kind bei, die Kommunen würden mindestens einen Pflichtbeitrag von 460 Euro einbringen. "Nun sind vonseiten des Landes Zusagen gemacht, pro Platz und Schuljahr etwa 170 Euro mehr zu geben", erklärte die Landesarbeitgemeinschaft. Die sei ein gutes Zeichen, "aber nicht nachhaltig und nicht ausreichend". In der Arbeitsgemeinschaft haben sich 16 Spitzenverbände auf Landesebene - darunter Diakonie, Caritas, AWO und DRK - zusammengeschlossen.
Es hänge weiter von der Kassenlage und der Bereitschaft der einzelnen Kommunen ab, ob sie freiwillig mehr Geld für die Angebote der OGS geben, kritisierten die Verantwortlichen der Landesarbeitsgemeinschaft. "Je ärmer die Kommune, desto höher die Elternbeiträge." So sei zumindest die Tendenz, die dazu beitrage, Lebensverhältnisse ungleicher zu machen. Zudem sei auch noch die Finanzierung der Plätze von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von der einmaligen Erhöhung der Förderung ausgenommen.
Sozial engagierte Lieblingskönigin: Schwedens Silvia wird 75

epd-bild / Sebastian Willnow
Heidelberg (epd). Sie habe "ein brasilianisches Herz, einen deutschen Kopf und eine schwedische Seele", sagt die schwedische Königin Silvia einmal über sich selbst. Sie wurde 1943 in Heidelberg als Tochter von Walther Sommerlath und seiner brasilianischen Frau Alice geboren. Am 23. Dezember feiert sie ihren 75. Geburtstag mit Kindern und sieben Enkeln in Schweden. Neben Tochter und Kronprinzessin Victoria und Sohn Carl Philip wird auch ihre Tochter Madeleine erwartet, die seit diesem Sommer in Florida wohnt.
Es ist nicht nur ihr Lächeln, sondern auch ihr großes soziales Engagement, dass die Monarchin zur Lieblingskönigin vieler Deutscher macht: Sie ist Schirmherrin von mehr als 60 karitativen Organisationen, die sich um Kinder, Menschen mit Demenz, behinderte und drogensüchtige Menschen kümmern.
Als sie drei war, zog die Familie für zehn Jahre nach Brasilien. Abitur machte Silvia Renate Sommerlath 1963 in Düsseldorf, danach wurde sie in München zur Dolmetscherin ausgebildet und arbeitete im argentinischen Konsulat. Sie spricht sechs Sprachen: Neben Deutsch, Portugiesisch und Schwedisch auch Englisch, Französisch und Spanisch. Außerdem beherrscht sie die Gebärdensprache, um besser mit gehörlosen Menschen kommunizieren zu können.
Bodenständig
Ihren späteren Mann, den schwedischen König Carl Gustaf XVI, traf sie das erste Mal 1972 bei den Olympischen Spielen in München, wo Silvia Sommerlath Chef-Hostess war. Sie heirateten am 19. Juni 1976. Bei der Hochzeit spielte die schwedische Popgruppe Abba den Song "Dancing Queen".
Trotz ihres großen ehrenamtlichen Engagements ist die siebenfache Großmutter bodenständig geblieben und geht auch mal mit den Enkeln Hühner füttern. Sie liebt das Theater und die Oper und genießt gemeinsam mit ihrem Mann die Natur. Lange galten die beiden als royales Traumpaar - bis 2010 außereheliche Affären ihres Mannes bekanntwurden. Silvia hat sich nie öffentlich dazu geäußert.
Im gleichen Jahr tauchten auch Nazi-Vorwürfe gegen ihren 1990 verstorbenen Vater auf, die von Historikern untersucht wurden. So wurde festgestellt, dass Walther Sommerlath 1934 Mitglied der NSDAP in Brasilien war, was er es immer geleugnet hatte.
Außerdem hatte ihr Vater - im Rahmen der NS-Arisierung - eine Berliner Fabrik von dem jüdischen Besitzer Efim Wechsler übernommen, im Austausch mit einer Kaffeeplantage und Land in Brasilien. Dorthin floh Wechsler kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dadurch habe ihr Vater "de facto, bewusst und aktiv einem staatenlosen jüdischen Mann geholfen, Deutschland zu verlassen", so schrieb Silvia und stützte sich dabei auf einen schwedischen Untersuchungsbericht von 2012. Kritiker warfen ihr daraufhin Schönfärberei vor.
Christlicher Glaube
In Krisen biete ihr der christliche Glaube Halt, sagt sie. Er sei für sie "inneres Gespräch mit einer Macht, in der ich mich zu Hause fühle", erklärte die zierliche Monarchin mit braunem, gewellten Haar einmal in der Talksendung "Beckmann". Das Gebet gebe ihr Halt, Stütze und auch eine Sprache.
Die royale Familie ist Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Schweden. Daher überrascht es nicht, dass sie für die Hochzeit ihrer Tochter Victoria 2010 gemeinsam mit dem damaligen Oberhofprediger Lars-Göran Lönnermark ein Buch mit Gebeten zusammenstellte, "Königin Silvias Gebetbuch". Schon mehrfach traf die Protestantin in offizieller Funktion Papst Franziskus.
1999 gründete sie die "World Childhood Foundation" für die Rechte von Kindern. Aktuell unterstützt die Stiftung mehr als 100 Projekte in 17 Ländern. Ende September eröffnete die Monarchin in Leipzig Deutschlands erstes sogenanntes "Childhood-Haus", in dem Kinder, die von Gewalt und Missbrauch betroffen sind, medizinisch, juristisch und therapeutisch betreut werden.
"Kinder, die in das Childhood-Haus kommen, brauchen unseren Schutz und unsere Hilfe, sie brauchen verantwortungsvolle Erwachsene, die dem Kind zuhören und es ernst nehmen", erklärte Silvia in Leipzig und ergänzte: "Kinder möchten, dass wir uns in ehrlicher Weise um sie kümmern."
Kinderrechte
Die Themen Kinderrechte und kinderfreundliche Justiz liegen ihr sehr am Herzen, erklärte sie auch vor dem Deutschen Juristentag in Leipzig. Die Juristen leisteten einen wichtigen Beitrag dazu, ein Kind zu informieren und ihm mit Würde, Verständnis sowie Respekt zu begegnen. Das Bemühen um das Wohl des Kindes diene immer auch einer besseren Wahrheitsfindung.
1996 schließlich gründete Silvia eine Stiftung unter dem Namen Silviahemmet (Silvias Haus) zur Betreuung von Demenzkranken und ihrer Angehörigen. Sie kannte die Situation sehr gut: Auch ihre Mutter war an Demenz erkrankt, sie starb 1997.
Als Silvia im vergangenen Jahr mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet wurde, würdigte sie der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) als "hochengagierte Monarchin, mutige Frau mit festen Überzeugungen und großartigen Menschen". Zur Verleihung reiste sie nach München, wo sie selbst lange gelebt hat - und die sie früher schon ihre "Lieblingsstadt" genannt hatte.
Die Mietshäuser des Syndikats

epd-bild/Rudolf Stumberger
München (epd). "Mir gefällt besonders das Miteinander auf Augenhöhe", sagt Markus Hirt. Der 56-jährige Sozialpädagoge ist einer der neun Mitstreiter, die sich im oberbayerischen Utting am Ammersee für ein alternatives Wohnprojekt einsetzen. Interessiert sind sie an einem 5.000 Quadratmeter großen Grundstück am Ortsrand. Dort will die Initiative Wohnungen für 30 Personen sowie einige Gewerberäume bauen. Funktionieren soll das Ganze nach dem Modell der Freiburger Mietshäuser Syndikat GmbH. Dabei geht es um "Gemeineigentum an Haus und Grund", finanziert durch Kredite von Privatpersonen, die an sozialen Projekten interessiert sind.
Aufbauhilfe erhält die Uttinger Initiative vom Münchner Syndikat-Haus "Ligsalzstraße 8", das bereits seit elf Jahren existiert. Unter der Adresse befindet sich im ehemaligen Arbeiterviertel Westend ein mehrstöckiges Mietshaus, das schon von außen das Anderssein signalisiert. Pflanzen ranken sich an der Hauswand empor, die Fassade ist himmelblau gestrichen und mit Figuren und Szenen bemalt.
Idee aus Freiburg
Aus den Fenstern im zweiten Stock hängt ein Transparent mit der Aufschrift "Keine Abschiebung nach Afghanistan". Unten, im Erdgeschoss, geht gerade ein Sonntagsbrunch über die Bühne, eine Weißwurst kostet einen Euro, der Kaffee 1,50 Euro. Mittendrin steht Sabine, Gründungsmitglied des Projekts, die zu den zwölf Bewohnern des Hauses zählt. Die 53-jährige Informatikerin erklärt, wie ein Syndikathaus funktioniert und lacht, wenn man sie fragt, ob es Zuschüsse von der Stadt gebe. "Nein", sagt sie, der Stadtrat bekomme ja Angst, wenn er das Wort Syndikat nur höre. In der Tat sind die Wohnprojekte nach diesem Modell größtenteils eigenfinanziert. Staatliche Hilfen gibt es keine.
Die Grundidee eines Mietshäusersyndikats stammt aus Freiburg. Dabei geht es um den Ankauf von Mietshäusern durch private Initiativen, deren Mitglieder dann zu Hausbewohnern werden. Das Mietshaus soll so auf Dauer Spekulanten entzogen werden. Ziel ist, bezahlbaren Wohnraum ohne Gewinnabsicht zu schaffen - nach dem Motto "Wohnen soll keine Ware sein".
Konkret und juristisch funktioniert das so: Die Initiative gründet einen Hausverein. Dieser Verein ist einer der Gesellschafter der Haus-GmbH, in die das Mietshaus und das Grundstück eingebracht wird. Weitere Gesellschafterin ist die Mietshäuser Syndikat GmbH – eine Art Kontroll- und Wächtergremium. Sie verhindert mit ihrem Stimmrecht, dass das Haus wieder verkauft werden kann. So ist der gemeinschaftliche Charakter des Projekts garantiert.
Gemeinschaftlich meint auch, dass die Mieter nicht unbedingt zu den Besitzern gehören müssen. Ein Mieterwechsel ist möglich. Mittlerweile haben sich 136 Projekte und 17 Initiativen quer durch die ganze Bundesrepublik unter dem Dach des Syndikats nach diesem Modell zusammengeschlossen.
Direktkredite
Da ist neben dem Projekt in München zum Beispiel die "Betriebsküche" in Dresden. Dort haben seit 2014 zwölf Personen die ehemalige Küche der Deutschen Bahn gekauft und verwandeln sie in ein Wohnprojekt. Oder die "Meuterei" in Leipzig, hier wohnen seit 2011 auf 535 Quadratmeter elf Menschen. Syndikat-Häuser gibt es auch in Hamburg ("Arnoldstraße 16"), Bremen ("Freies Haus 3d"), Hannover ("Stadtteilleben") oder Regensburg ("Danz").
Und wie sieht die Finanzierung konkret aus? "Wir müssen jeden Monat 4.200 Euro für die Kredite aufbringen", erläutert Sabine von der Ligsalzstraße 8. Das entspricht einer Monatsmiete von rund 350 Euro pro Zimmer. Das Haus hat mit den Renovierungskosten 865.000 Euro gekostet. "Das war noch vor dem Immobilienboom", erklärt Sabine. Diese Summe wurde hauptsächlich über 40 Direktkredite aufgebracht, ein kleinerer Teil stammt aus einem Bankkredit.
Die Direktkredite funktionieren nach dem Prinzip "Lieber 1.000 Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken". Das heißt, sympathisierende Privatpersonen leihen den Projekten Geld. In Utting wirbt man um die Direktkredite mit Transparenz: "Die Verwendung der Mittel ist jederzeit klar. Bei uns können Sie überdies jederzeit vorbeischauen um zu sehen, was Ihr Geld gerade macht", wird potenziellen Geldgebern erklärt.
Bethel bittet um Briefmarken der Weihnachtspost
Bielefeld (epd). Zur Adventszeit bitten die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel um abgestempelte Briefmarken der Weihnachts- und Neujahrspost. Die gespendeten Postwertzeichen sichern in der Briefmarkenstelle Bethel Arbeits- und Beschäftigungsplätze für rund 125 Menschen mit Behinderung, wie die Stiftungen am 11. Dezember in Bielefeld erklärten. Die Mitarbeiter sortieren die Briefmarken und bereiten sie für den Verkauf an Sammler vor. Der Erlös fließt in die diakonische Arbeit von Bethel.
Die Briefmarkenstelle Bethel, die 130 Jahre alt ist, ist eine der ältesten Einrichtungen ihrer Art in Deutschland. Sie geht zurück auf die Idee des langjährigen Bethel-Leiters Friedrich von Bodelschwingh (1877-1946). Mit dem Sammeln der entwerteten Briefmarken sollte eine sinnvolle Beschäftigung für behinderte Menschen geboten werden, die ihren oft stark eingeschränkten Fertigkeiten entspricht. Jährlich werden an dem Bielefelder Bethel-Standort rund 130 Millionen Briefmarken gesammelt und für den Wiederverkauf bearbeitet.
Diakonie Saar unterstützt italienische Flüchtlingshilfe
Saarbrücken (epd). Die Diakonie Saar versendet in diesem Jahr erneut keine Weihnachtskarten und unterstützt stattdessen die italienische Flüchtlingshilfe "Mediterranean Hope" mit 2.000 Euro. Die Föderation der evangelischen Kirchen in Italien helfe darüber mit zahlreichen Maßnahmen Flüchtlingen etwa auch auf der Insel Lampedusa, teilte die Diakonie am 12. Dezember in Saarbrücken mit. So gebe es dort das Projekt "corridoi umanitari" (humanitäre Korridore), welches Flüchtlingen sichere Fluchtwege ermöglichen wolle. Ein "Haus der Kulturen" in Sizilien biete wiederum etwa unbegleiteten Jugendlichen und allein reisenden Frauen Unterkunft.
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in NRW gestiegen
Düsseldorf (epd). Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Sie erhöhte sich im Vergleich zu 2016 um 2,4 Prozent, wie das statistische Landesamt am 10. Dezember in Düsseldorf mitteilte. Im Jahr 2017 hatten demnach 6,44 Millionen Erwerbstätige in NRW einen sozialversicherungspflichtigen Job. Sie waren in rund 767.500 Betrieben tätig.
Die Zahl der Betriebe stieg der Statistik zufolge im Jahresvergleich um 0,2 Prozent. Jeder dritte Arbeitnehmer war in einem Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern beschäftigt. Die meisten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gab es mit 1,36 Millionen in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes. Den größten Zuwachs der Beschäftigungszahl ermittelten die Statistiker mit 4,4 Prozent für den Kreis Unna, dahinter folgen die Städte Krefeld und Dortmund mit einem Anstieg um jeweils vier Prozent.
Haushaltseinkommen in NRW seit 2007 gestiegen
Düsseldorf (epd). Das durchschnittliche Bruttoeinkommen der Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen ist in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Fünftel gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am 14. Dezember in Düsseldorf mitteilte, stieg das Einkommen zwischen 2007 und 2017 um 21,3 Prozent oder 785 Euro auf 4.479 Euro pro Monat. Zugleich stieg die Zahl der Einkommen, die aus selbstständiger oder abhängiger Erwerbstätigkeit erwirtschaftet wurde, um 2,3 Punkte auf 61,8 Prozent. Im selben Zeitraum verringerte sich der Anteil öffentlicher Transferzahlungen am Durchschnittseinkommen um 1,7 Punkte auf 23,9 Prozent.
Bei den Daten handelt es sich den Angaben zufolge um Ergebnisse der laufenden Wirtschaftsrechnungen privater Haushalte in NRW aus dem Jahr 2017. Die Ergebnisse basieren auf den Haushaltsbuch-Aufzeichnungen von 1.639 Haushalten, die auf die Grundgesamtheit der rund 8,1 Millionen Haushalte in Nordrhein-Westfalen hochgerechnet wurden.
Nordrhein-Westfalen wächst weiter bis 2032
Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen wächst neuen Berechnungen zufolge weiter bis 2032. In den nächsten fünf Jahren steigt die Einwohnerzahl um 1,3 Prozent auf rund 18,1 Millionen, wie das Wirtschaftsministerium am 11. Dezember in Düsseldorf mitteilte. Ein überarbeiteter Landesentwicklungsplan soll nach den Worten von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) Kommunen und Regionen größere Entscheidungsspielräume geben, um dem Wandel besser Rechnung zu tragen.
Gerade in Städten der Rheinschiene fehle bezahlbarer Wohnraum, hieß es. Der am 11. Dezember im Kabinett beschlossene Bericht soll die Ausweisung von neuem Wohnbauland erleichtern. Zudem würden die kleinen Ortsteile im ländlichen Raum gestärkt und bessere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.
Nach 2032 rechnen die Statistiker mit einer rückläufigen Bevölkerungsentwicklung: Demnach verliert Nordrhein-Westfalen bis 2060 rund zwei Prozent gegenüber 2018. Dann sollen noch rund 17,5 Millionen Einwohner im Land leben. Die Anzahl älterer Nordrhein-Westfalen wird laut Prognose insgesamt weiter steigen. Jedoch werden etwas mehr jüngere Einwohner erwartet als noch in der letzten Vorausberechnung.
Regional wird diese Entwicklung unterschiedlich verlaufen, wie es hieß. Die kreisfreien Städte und Kreise zwischen Düsseldorf und Bonn verzeichnen bis 2040 weiter steigende Einwohnerzahlen. Auch Wuppertal, Dortmund und Bielefeld und ländlich geprägten Kreise wie der Kreis Steinfurt und der Kreis Paderborn werden wachsen. Die größten Bevölkerungsrückgänge erwarten die Statistiker für Remscheid und Bottrop sowie die Kreise Recklinghausen, Lippe, Höxter, den Hochsauerlandkreis und den Märkischen Kreis.
Medien & Kultur
Medienbischof lobt Arte-Pfarrerserie

epd-bild / Thomas Lohnes
Darmstadt (epd). Sie löse Probleme nicht in irgendwelchen Formen einer vermeintlichen Berufsidylle auf, sagte Jung dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das unterscheide sie deutlich von den meisten bisherigen deutschen Pfarrerserien. Im Mittelpunkt der recht düsteren Filmreihe steht der charismatische und engagierte Pfarrer Johannes Krogh, der angesichts von Schicksalsschlägen und Misserfolgen mit seinem Gott hadert und an ihm zweifelt.
Ein Typus wie Krogh dürfte in dieser Zuspitzung in der Realität eher selten vorkommen, sagte Jung. Dennoch vereine er manches in sich, das bestimmt auch in der Wirklichkeit zu finden sei. "Bei ihm stehen eine eher konservativ geprägte Theologie, eine persönliche Gottesunmittelbarkeit und dann wieder liberale Züge ziemlich unvermittelt nebeneinander", sagte der Medienbischof der Evangelische Kirche in Deutschland (EKD). Im Kontrast dazu stehe Kroghs Versagen als Ehemann und Familienvater. "Dazu kommt, dass er Alkoholprobleme hat und fremdgeht. Das ist schon ziemlich viel auf einmal."
"Problematische Klischees"
Lars Mikkelsen, ein hervorragender Schauspieler, fülle diese Rolle mit all ihren Facetten sehr überzeugend, lobte Jung. Überhaupt sei die Serie unterhaltsam und interessant gemacht. "Neben der Handlung gefällt mir vor allem die Bildsprache sehr gut."
Als "eher problematisch" bezeichnete der Theologe, der auch Kirchenpräsident der hessen-nassauischen Landeskirche ist, die im Film aufgezeigten Alternativen zur Zukunft der Kirche. Sie seien "auf gar keinen Fall" zutreffend beschrieben. Krogh will auf Kirchenaustritte kämpferisch reagieren. Bischöfin Monica, der er im Rennen um das Bischofsamt unterliegt, setzt auf zeitgemäße Angebote und ist im Übrigen entschlossen, zu wenig genutzte Kirchen zu schließen.
Schwierig sei hier auch die Zuordnung der Geschlechter, sagte Jung: "Der bekenntnisstarke Mann, der vermeintlich Traditionelles mit kämpferischer und zugleich innerlicher Frömmigkeit vertritt, und ihm gegenüber eine eher kühle, klug taktierende, modernistische und an der Ökonomie orientierte Frau. Das sind nun wirklich sehr problematische Klischees."
Der Film über Tragödien im Pfarrhaus stammt von Adam Price (Buch), dem Hauptautor der dänischen Erfolgsserie "Borgen" (2010-13), und Kaspar Munk (Regie). Sein Titel - im Original "Herrens Veje" - lehnt sich an ein Bibelwort an: "Die Wege des Herrn sind unergründlich" (Römer 11,33). Alle zehn Episoden sind noch bis zum 29. Dezember in der Mediathek zu sehen.
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Correctiv-Chefredakteur
Er gehört zu den Journalisten, die den Milliarden-Steuerbetrug um Cum-Ex-Deals aufdeckte. Jetzt ermittelt die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen Oliver Schröm. Sind Geschäftsgeheimnisse wichtiger als Pressefreiheit?Berlin, Hamburg (epd). Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt gegen Correctiv-Chefredakteur Oliver Schröm. Der Investigativjournalist ist wegen seiner Enthüllungen zum Cum-Ex-Steuerskandal in den Fokus der Behörde geraten, wie das Recherchebüro am 11. Dezember in Berlin bekanntgab. Hintergrund sind Berichte Schröms aus dem Jahr 2014 und ein Schweizer Verfahren gegen den Journalisten. Die Strafverfolgungsbehörde bestätigte auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) die Ermittlungen wegen des Verdachts der Anstiftung zum Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen und unbefugter Verwertung.
Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei bereits am 30. Mai aus der Schweiz übernommen worden. Dort ermittelte die Staatsanwaltschaft Zürich gegen Schröm wegen des Vorwurfs der Wirtschaftsspionage und der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses.
"Ein Spion"
Der Investigativjournalist beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit den Steuerdeals. Ende 2017 wechselte er zu dem gemeinnützigen Recherchebüro. Die Ermittlungen beziehen sich auf frühere Recherchen Schröms. Er hatte 2014 für den "Stern" über die Cum-Ex-Geschäfte unter anderem der Schweizer Privatbank Sarasin berichtet. Aufgrund einer Anzeige der Bank ermittelte die Züricher Staatsanwaltschaft gegen Schröm und bat nach Correctiv-Angaben vier Jahre nach Beginn der Untersuchungen die Hamburger Staatsanwaltschaft um die Übernahme des Verfahrens.
"Aus Sicht der Schweizer Justiz sitzt vor Ihnen ein Spion", sagte Schröm. Es sei nicht verwunderlich, dass die Schweiz gegen Journalisten vorgehe, aber nicht gegen Banken. Allerdings bringe es ihn zum Grübeln, dass die Staatsanwaltschaft Hamburg nun das Verfahren übernommen habe. "Es ist eine Kriminalisierung von investigativem Journalismus", betonte er. Grundlage für das deutsche Verfahren ist der Paragraf 17 im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Laut Correctiv ist es das erste Mal, dass dieser Paragraf gegen Journalisten angewendet werde. Schröm droht demnach im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.
In einem offenen Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesjustizministerin Katarina Barley (beide SPD) fordert Correctiv nun, die Strafverfolgung gegen Journalisten umgehend zu beenden, die Pressefreiheit zu schützen und die wahren Schuldigen vor Gericht zu bringen. "Steuerraub ist ein Verbrechen. Journalismus nicht", heißt es darin.
"Angriff auf Pressefreiheit"
Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, äußerte sich "entsetzt" über das Ermittlungsverfahren. Dies sei ein "Angriff auf die Pressefreiheit". Im Cum-Ex-Fall, bei dem es um Milliardenbetrug zulasten der deutschen Steuerzahler gehe, liege ein besonderes öffentliches Interesse vor, fügte er hinzu.
Zugleich verwies Überall auf den Gesetzentwurf zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, der am 12. Dezember im Rechtsausschuss des Bundestags beraten werden sollte. In Deutschland müsse sichergestellt werden, dass das Grundrecht auf Pressefreiheit und die Anstiftung zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen nicht gegeneinandergestellt würden. Es sei wichtig, dass Journalisten von Informanten angesprochen werden könnten, betonte er. Bei dem im Parlament behandelten Gesetz handelt es sich um die Umsetzung einer EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.
Correctiv hatte im Oktober gemeinsam mit 18 Medienhäusern aus zwölf europäischen Ländern investigative Enthüllungen zu Cum-Ex-Geschäften veröffentlicht. Den von Schröm geleiteten Recherchen zufolge sind dem Fiskus in diesen Ländern mit Cum-Ex- und ähnlichen Aktiengeschäften mindestens 55 Milliarden Euro entgangen.
Bei Cum-Ex-Geschäften ließen sich Anleger unter Ausnutzung einer Gesetzeslücke und mithilfe von Banken eine nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuer mindestens zwei Mal erstatten. Ob es sich dabei um strafbares Verhalten handelte, ist noch nicht höchstrichterlich geklärt.
"Time"-Magazin kürt vier Journalisten zur "Person des Jahres"
Washington (epd). Das US-Magazin "Time" hat am 11. Dezember vier Journalisten und die Zeitung "Capital Gazette" zur "Person des Jahres" 2018 gekürt. Namentlich geehrt wurden der ermordete saudische Regimekritiker Jamal Khashoggi, die philippinische Journalistin Maria Ressa und die Reuters-Reporter Wa Lone und Kyaw Soe Oo aus Myanmar. Die Geehrten stünden stellvertretend für Anstrengungen von Journalisten, sich als "Wächter der Wahrheit" einzusetzen. Die Demokratie erlebe gegenwärtig weltweit "ihre größte Krise seit Jahrzehnten", erklärte "Time"-Chefredakteur Edward Felsenthal.
Khashoggi sei der "sichtbarste Repräsentant" dieses "entsetzlichen Jahres für die Wahrheit". Der Journalist, der im Exil in den USA lebte, war am 2. Oktober in das Istanbuler Konsulat seines Heimatlandes gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Saudi-Arabien räumte später auf internationalen Druck hin ein, dass Khashoggi dort getötet wurde.
Ressa sei wegen ihrer "furchtlosen Berichterstattung" über die Propagandamaschine und die Untaten des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte schweren Anfeindungen ausgesetzt. Die Journalistin betreibt die regierungskritische Nachrichtenseite "Rappler". Ihr drohen wegen angeblicher Steuervergehen bis zu zehn Jahren Haft.
Rohingya-Recherchen
Die Reuters-Journalisten Wa Lone und Kyaw Soe Oo waren am 12. Dezember 2017 in Myanmar verhaftet worden. Sie hatten für die Nachrichtenagentur zu Morden an einer Gruppe muslimischer Rohingya im westlichen Rakhine-Staat recherchiert. Anfang September wurden die Journalisten wegen Verrats von Staatsgeheimnissen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Sie haben dagegen Berufung eingelegt.
In der Redaktion der "Capital Gazette" in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland hatte im Juni ein Schwerbewaffneter um sich geschossen. Redakteur Rob Hiaasen, Reporterin Wendi Winters, Redakteur Gerald Fischman, Reporter John McNamara und Mitarbeiterin Rebecca Smith kamen ums Leben. Der Täter lag offenbar in einem lang andauernden Streit mit der Redaktion.
"Time" verleiht die Auszeichnung "Person des Jahres" seit 1927. Vergangenes Jahr wurden Frauen gekürt, die im Rahmen der #MeToo-Bewegung ihr Schweigen über sexuelle Belästigung gebrochen haben. Die "Person des Jahres" hat nach Ansicht der "Time"-Redaktion das Weltgeschehen besonders stark geprägt, im Guten oder im Schlechten.
Büchnerpreisträger Wilhelm Genazino gestorben
Frankfurt a.M. (epd). Der Schriftsteller Wilhelm Genazino ist tot. Der Träger des Büchnerpreises, der bedeutendsten Literaturauszeichnung in Deutschland, starb am 12. Dezember nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren in Frankfurt am Main, wie der Karl-Hanser-Verlag am 14. Dezember in München mitteilte.
Wilhelm Genazino wurde Ende der 70er Jahre mit seiner Angestellten-Romantrilogie "Abschaffel" (1977), "Die Vernichtung der Sorgen" (1978) und "Falsche Jahre" (1979) bekannt. Seine Werke - darunter Romane wie "Liebesblödigkeit" (2005) über einen Intellektuellen, der sein Geld mit Vorträgen zur Apokalypse verdient - wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Sein letzter Roman "Kein Geld, keine Uhr, keine Mütze" erschien im Frühjahr dieses Jahres.
Der gebürtige Mannheimer hatte nach dem Abitur und einem Volontariat bei der "Rhein-Neckar-Zeitung" Germanistik, Philosophie und Soziologie an der Frankfurter Goethe-Universität studiert. Danach arbeitete er als Journalist, unter anderem bei der Satire-Zeitschrift "Pardon", und schrieb Hörspiele.
Wilhelm Genazino erhielt neben dem von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vergebenen Büchnerpreis (2004) weitere renommierte Auszeichnungen, darunter den Hans-Fallada-Preis (2004), den Kleist-Preis (2007) und den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2013).
Iris Berben erhält Ophüls-Ehrenpreis

epd-bild / Rolf Zöllner
Saarbrücken (epd). Die Schauspielerin Iris Berben erhält den Ehrenpreis des Filmfestivals Max Ophüls Preis. "Als Vorbild für persönliches Engagement lebt sie seit vielen Jahren aktiv vor, für eine lebendige Kinokultur und die Pflege eines diversen Filmnachwuchses ebenso stark einzustehen wie für soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft", sagte Festivalchefin Svenja Böttger am 12. Dezember in Saarbrücken. Berben erhält die undotierte Auszeichnung bei der Festivaleröffnung am 14. Januar.
Die 68-Jährige begann den Angaben zufolge ihre Karriere mit Kurzfilmen an der Hamburger Kunsthochschule und stand für den Film "Detektive" (1968) von Rudolf Thomes das erste Mal für einen abendfüllenden Kinofilm vor der Kamera. Berben hat unter anderem den Adolf-Grimme-Preis, die Goldene Kamera, den Bambi, die Romy und den Bayerischen Fernsehpreis bekommen. Seit 2010 vertrete sie auch als Präsidentin der Deutschen Filmakademie die Interessen von über 1.800 Mitgliedern der Filmbranche, hieß es.
"Grande Dame mit Ecken und Kanten"
Berben war es den Festivalmachern zufolge immer auch ein Anliegen, in der Öffentlichkeit Haltung zu zeigen und für Toleranz und Mitmenschlichkeit sowie gegen das Vergessen der Nazi-Diktatur und gegen Antisemitismus einzutreten. So zeichnete etwa der Zentralrat der Juden in Deutschland sie für ihr Engagement mit dem Leo-Baeck-Preis aus. Ihr Leben als politische Person und populäre Künstlerin habe die Schauspielerin nie als Widerspruch begriffen, sondern dazu genutzt, Themen in die öffentliche Debatte zu bringen, hieß es. Berben sei eine "Grande Dame mit Ecken und Kanten, die bis heute die gesamte Klaviatur der Schauspielkunst beherrscht, von eindringlich ernst bis brüllend komisch".
Der Max Ophüls Preis gilt als eines der bedeutendsten Filmfestivals für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Benannt ist es nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957). Dieses Mal werden mit dem neuen Publikumspreis Dokumentarfilm erstmals 16 Preise in den Kategorien Spiel-, Dokumentar-, Kurz- sowie mittellanger Film mit einem Gesamtwert von über 100.000 Euro vergeben. Die nächste Ausgabe des Treffens junger deutschsprachiger Filmemacher findet vom 14. bis 20. Januar 2019 in Saarbrücken statt.
40. Festival Max Ophüls Preis präsentiert über 150 Filme
Rund 3.500 Filme in 40 Jahren: Das Filmfestival Max Ophüls Preis feiert im Januar ein Jubiläum. 62 Filme treten in den Wettbewerben an. Thematisch reicht das Spektrum von Missbrauch über Entwicklungspolitik bis zur Einsamkeit.Saarbrücken (epd). Die 40. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis widmet sich ab 14. Januar unter anderem den Themen Missbrauch, Einsamkeit, Entwicklungspolitik und Gesellschaftskritik. Für den Wettbewerb hätten sie 900 Filme gesichtet und 62 aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg ausgewählt, sagte Programmleiter Oliver Baumgarten am 14. Dezember in Saarbrücken. Diese Filme konkurrieren in den Kategorien Kurzfilm, mittelanger Film, Dokumentarfilm und Spielfilm um insgesamt 17 Preise mit einem Gesamtwert von 118.500 Euro. Bis zum 20. Januar sind insgesamt 153 Filme zu sehen.
Filmreihe zur Geschichte des Wettbewerbs
Eine spezielle Filmreihe zeigt laut Baumgarten 14 Filme aus der 40-jährigen Geschichte des Festivals. Seit dem Start hätte das Festival für den deutschsprachigen Filmnachwuchs rund 3.500 Filme präsentiert. Die ausgewählten Beiträge ermöglichten eine Reise durch die Festivalgeschichte. So setze sich etwa der Ophüls-Preisträger von 1980 "Taxi zum Klo" von Frank Ripploh mit der schwulen Szene in Berlin auseinander. Der Film stehe für eine Ausrichtung, die Festivalgründer Albrecht Stuby wichtig gewesen sei: der queeren Kunst und Kultur einen Raum zu geben.
Für die besten Nachwuchsschauspieler gebe es wieder zwei Preise, betonte Baumgarten. Allerdings sei die Jury nicht festgelegt, wie sie diese vergebe. So schlage ihr das Festivalteam acht Nominierte vor und die Jury könne selbst entscheiden, ob sie die Preise nach Haupt- und Nebenrolle, nach Schauspielerin und Schauspieler oder nach anderen Kategorien vergebe. Ziel sei es vor allem, eine spannende, darstellerische Leistung auszuzeichnen.
Gesellschaftskritik
In der Kategorie Dokumentarfilm treten den Angaben zufolge zwölf Filme an. Der Dokumentarfilm blühe und sei beim Nachwuchs sehr beliebt, erklärte Baumgarten. Die konkurrierenden Filme zeigten politisch und gesellschaftlich stark engagierte Positionen. So gehe es etwa bei "Congo Calling" von Stephan Hilbert um die Szene der westlichen Entwicklungsarbeit im Kongo. Weitere Filme blickten auf den Bundestagswahlkampf, künstliche Intelligenz und den österreichischen Schauspieler Helmut Berger.
In der Kategorie Spielfilm treten laut Festivalchefin Svenja Böttger insgesamt 16 Filme an. "Wir sehen auch beim Spielfilm eine tolle, aber auch extreme Bandbreite", betonte sie. Es gebe weiterhin einen Trend zum Genrefilm, der Themen wie Migration, Isolation und Kritik am Kapitalismus noch einmal eine andere Bedeutungsebene gebe. Als Beispiele nannte sie dafür den Science-Fiction-Film "Das letzte Land" von Marcel Barion und den Zombiefilm "Endzeit" von Carolina Hellsgård.
Thementag
Zu den weiteren Festivalveranstaltungen gehören den Angaben zufolge ein Thementag "Dauerkolonie deutscher Film" über die Diversität in der deutschsprachigen Filmlandschaft und ein Symposium zu Video on Demand und der Rolle des Kinos in der Zukunft. Zum Jubiläum erscheint außerdem ein Festband mit persönlichen Geschichten von 78 Personen - darunter der Linken-Politiker und frühere Ministerpräsident Oskar Lafontaine und der Filmproduzent Nico Hofmann.
Saarbrückens Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD), betonte, dass die Stadt dem Festival zum 40-jährigen Bestehen 70.000 Euro zusätzlich zur Verfügung stelle. Das Budget wachse damit auf 400.000 Euro. Ihr Wunsch wäre es, wenn dieses "Geburtstagsgeschenk" keine einmalige Sache bleibe, sondern dem Festival dauerhaft zur Verfügung stände. Schließlich habe sich das Filmfestival bewährt, sagte Britz.
Der Max Ophüls Preis gilt als eines der bedeutendsten Filmfestivals für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Benannt ist es nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957). Dieses Mal kommt erstmals der neue Publikumspreis Dokumentarfilm hinzu. Den undotierten Ehrenpreis erhält Schauspielerin Iris Berben.
"In den Gängen" ist Film des Jahres 2018
Frankfurt a.M., Berlin (epd). Als Film des Jahres 2018 hat die Evangelische Filmjury die deutsche Tragikomödie "In den Gängen" ausgezeichnet. Der Film von Regisseur Thomas Stuber erzählt von der Gemeinschaft zwischen den Menschen, die in einem Großmarkt in einer ostdeutschen Kleinstadt arbeiten. Der undotierte Preis wurde am 15. Dezeber im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main verliehen.
Mit "In den Gängen" sei das Soziale auf höchst zeitgemäße Weise ins deutsche Kino zurückgekehrt, würdigte die Jury nach Angaben des Filmkulturellen Zentrums im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP). Der Film schildere die Lebenswirklichkeit von Menschen, die selten öffentliche Aufmerksamkeit erhielten und mache dabei auch die Auswirkungen der Transformation in Ostdeutschland sichtbar. "Ein lakonischer Film, der seine Protagonisten und deren routinemäßigen Arbeitsalltag so aufmerksam und bei aller Ernsthaftigkeit mit einem Funken Humor schildert, dass man inspiriert wird, genauer hinzuschauen", so die Juroren.
Clemens-Meyer-Verfilmung
In dem im Mai in den deutschen Kinos gestarteten Film sind unter anderen Sandra Hüller, Peter Kurth und Franz Rogowski zu sehen. Das Drehbuch beruht auf einer Kurzgeschichte aus dem Band "Die Nacht, die Lichter" von Clemens Meyer. "In den Gängen" erhielt bei der diesjährigen Berlinale bereits den Gilde-Filmpreis deutscher Filmkunsttheater wie auch den Preis der Ökumenischen Jury.
Die Jury der Evangelischen Filmarbeit vergibt seit mehr als 60 Jahren das Prädikat "Film des Monats" an einen aktuell im Kino gestarteten Film. Aus diesen Produktionen sucht sie den jeweiligen "Film des Jahres" aus. "In den Gängen" war Film des Monats Mai.
Ai Weiwei kommt nach Düsseldorf

epd-bild/Jürgen Blume
Düsseldorf (epd). Unter dem Motto "Alles ist Kunst, alles ist Politik" wird der chinesische Künstler Ai Weiwei im Mai 2019 in den beiden Düsseldorfer Museen K20 und K21 mehrere raumfüllende Installationen präsentieren. Das kündigte die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gaensheimer, am 13. Dezember in Düsseldorf an. Die Schau gebe einen Überblick über Ai Weiweis gesamtes Schaffen. Der Chinese plane die Ausstellung als seine bisher größte in Deutschland und wolle sie selbst einrichten und eröffnen. Als weiteren Höhepunkt des Kunstjahres 2019 kündigte Gaensheimer für den Herbst eine Ausstellung von zum Teil bislang unbekannten Bildern des norwegischen Malers Edvard Munch an. Die Bilder hat der Schriftsteller Karl Ove Knausgard zusammengestellt, dessen autobiografische Romane Weltbestseller sind.
Politik vseit Beginn Bestandteil seiner Kunst
Susanne Gaensheimer arbeitet seit Jahren mit Ai Weiwei zusammen. "Ai Weiwei ist einer der aktivsten und kritischsten politischen Künstler", sagte sie. Sie wies darauf hin, dass schon bei seiner Geburt sein Vater im Exil gelebt habe. "Dadurch ist Politik von Anfang an Bestandteil seiner Kunst." Die Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen schätzt Ai Weiwei aber nicht nur als politischen Aktivisten, sondern vor allem als Künstler. "Er ist ein hervorragender Bildhauer", betonte Gaensheimer.
Die keramisch hergestellten und bemalten Sonnenblumenkerne, die Ai Weiwei bereits unter dem Titel "Seeds" in der Londoner Tate Modern ausstellte, werden zum ersten Mal auf dem europäischen Festland gezeigt. Die fast transparente, 17 Meter lange Skulptur aus Bambus von Ai Weiwei, "Life Cycle" (Lebenskreis) ist ab 18. Mai 2019 auch zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Sie stellt Menschen in einem Schlauchboot dar, wie es viele Flüchtlinge bei ihrer lebensgefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer benutzen. Ai Weiwei verbindet dabei die aktuelle Flüchtlingsfrage mit archaischen Bildern der chinesischen Kultur. Er wolle bei der Ausstellung auch seine Zeit im Gefängnis thematisieren, erklärte Gaensheimer.
Munch-Ausstellung geplant
Die Munch-Ausstellung beginnt im Oktober, während Norwegen Gastland der Frankfurter Buchmesse ist. Karl Ove Knausgard gilt als der derzeit am meisten beachtete norwegische Schriftsteller. Mit seiner Autobiografie eröffnete er nach Gaensheimers Worten ein neues Feld der Literatur. "Er ist ein sehr tiefgründiger Mensch." Knausgard sei selbst Kunsthistoriker und präsentiere in seiner Ausstellung Munch als Menschen und Künstler, wie man ihn noch nie gesehen habe. "Es werden Werke zu sehen sein, die einen neuen Eindruck von Edvard Munch bieten", erklärte sie.
Digitale Kunst von Ed Atkins wird im Museum für die Kunst des 21. Jahrhunderts K21 gezeigt. Der Engländer Ed Atkins gilt weltweit als Pionier digitaler Kunst. "Der 36-Jährige ist für mich einer der besten, einflussreichsten und faszinierendsten Künstler seiner Generation", unterstrich Gaensheimer. Eines seiner jüngeren Werke, einen Film, der sich um die Existenz dreier künstlicher Menschen darstelle, habe die Kunstsammlung gekauft.
Mit Kunst gegen Ausgrenzung und Gewalt

epd-West/Marta-Museum
Herford (epd). Das bunte Wesen an der Wand sieht aus wie ein großer Geist. Der "Sorgen-Fresser", gestaltet von einer Frau mit Behinderungen, soll negative Gedanken vertreiben und Mut machen. Auf der gegenüberliegenden Wand zeigt ein mehrere Meter hohes Tattoo zwei Punkte, die durch einen Strich wie durch eine Mauer getrennt sind. Die Tätowierung, gemalt von einem Gefangenen, symbolisiert Abschottung im Gefängnis. Für die Ausstellung, die bis 19. Januar im Forum des Herforder Marta-Museums zu sehen ist, haben sich behinderte Menschen und junge Häftlinge über Gewalt und Ausgrenzung kreativ ausgetauscht.
Rund 50 behinderte und inhaftierte Menschen haben sich bei dem Projekt "Als wären wir zum Spaß hier - Grenzen und Gewalt" in mehreren Workshops mit dem Thema beschäftigt. Begleitet wurden sie dabei von den Künstlern und Designern Ingrid Hora aus Berlin und Matthias Megyeri aus Stuttgart.
US-Präsident Trump im Käfig
Andrea Herse legt kurz vor Ausstellungsbeginn noch letzte Hand an die Gefängnisse aus Kaninchendraht an. In einer Art Vogelkäfig ist eine dunkle Vogelgestalt mit einem hellen Haarschopf als Gefangener zu sehen - US-Präsident Donald Trump. Mit ihrem Werk stellt die behinderte Frau ihre persönlichen Ausgrenzungserfahrungen in einen globalen Zusammenhang. "Es ist einfach nicht richtig, dass in der USA Menschen durch einen Grenzzaun von einander getrennt werden sollen", findet sie. Wenn der Präsident einmal selbst erlebe, wie es sei, eingesperrt zu sein, würde er vielleicht seine Einstellung ändern.
Ein paar Meter weiter zeigen auf Tafeln angeordnete Schlüssel eine Biografie eines Strafgefangenen: Mal herrscht Ordnung unter den Schlüsseln, dann wieder stecken kaputte Schlüssel hinter einem Zaun fest. Das Schlüssel-Chaos stehe für eine Situation, in der etwas passiert sei, das einen aus der Bahn wirft, erzählt der junge Häftling. Bei ihm selbst das sei der Tod seines jüngeren Bruders gewesen, berichtet er: "Danach ging es bei mir bergab." Mehrere kleinere Delikte hätten zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe geführt. Bei dem Ausstellungsprojekt habe er sich mit seiner Situation auseinandergesetzt. Auf dem letzten Objekt der Reihe zeigen die Schlüssel eine offene Zukunft.
Marta-Direktor lobt "eigenwillige und herausragende Kooperation"
Marta-Direktor Roland Nachtigäller nannte das Projekt eine "eigenwillige und herausragende Kooperation". Ausgangspunkt für die Kooperation war eine im Jahr 2016 im Marta gezeigte Ausstellung "Brutal schön - Gewalt und Gegenwartsdesign". Der Projekttitel "Als wären wir zum Spaß hier - Grenzen und Gewalt" bezieht sich auf die wissenschaftliche Publikation zur Wittekindshofer Geschichte mit dem Titel "Als wären wir zur Strafe hier", in der Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung in den 1950er und 1960er Jahren aufgearbeitet wird.
Viele der Inhaftierten, die bei ihren Delikten selbst Gewalt ausgeübt haben, hätten auch selbst Gewalt erfahren, sagt der Leiter der JVA Herford, Friedrich Waldmann. Damit seien die jungen Strafexperten so etwas wie "Experten" beim Thema Gewalt. Statt schneller Vorurteile verdienten die unterschiedlichen Biografien eine sorgfältige Betrachtung. Er sei beeindruckt, wie gut die beiden Gruppen, die oft mit Vorurteilen konfrontiert würden, zusammengearbeitet hätten.
Aufarbeitung der Vergangenheit
Die Diakonische Stiftung Wittekindshof befasse sich seit Jahren mit der Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, erzählt Vorstandssprecher Dierk Starnitzke über die Anfänge des Projekts. Das betreffe die Zeit des Nationalsozialismus, in der etwa 1.000 behinderte Menschen aus den Einrichtungen abtransportiert wurden. Aufgearbeitet werde aber auch die Nachkriegszeit, in der es durch eine mangelhafte Betreuungssituation zu Gewalt und Misshandlungen gekommen sei. Aber auch heute machten behinderte Menschen Erfahrungen von Ausgrenzung, sagte Starnitzke.
Zumindest in dem Kunstprojekt hat sich das geändert: Die gemeinsame Arbeit mit behinderten Menschen, sagt der junge Häftling, habe seine Perspektive verändert. "Die behinderten Menschen sind alle sehr nett, einige brauchen Hilfe", erzählt er. Daher unterstütze man sich hier ganz selbstverständlich gegenseitig.
Dürener Museum ersetzt Erben Wert für in der NS-Zeit gekauftes Bild
Düren, Berlin (epd). Das Leopold-Hoesch-Museum und Papiermuseum Düren hat den Erben von in der NS-Zeit verfolgten Juden ein entzogenes Gemälde zurückgegeben. Zugleich vereinbarte das Museum den Rückkauf des expressionistischen Ölgemäldes "Ostsee (Schiffe am Stand)" von Karl Schmidt-Rottluff, wie die Kulturstiftung der Länder am 11. Dezember in Berlin mitteilte. Das Museum nehme die Verantwortung der eigenen Sammlungsgeschichte an, erklärte der Generalsekretär der Kulturstiftung, Markus Hilgert. Das Leopold-Hoesch-Museum erforscht den Angaben nach seit 2015, woher die Bilder der Sammlung stammen.
Das Ölgemälde von 1922 gehörte ursprünglich den Berliner Juden Hugo und Toni Benario. Zu sehen ist ein Seestück im hinterpommischen Fischerdorf Jershöft, das der Familie gehörte. Während der NS-Zeit verloren sie ihre Kunstsammlung. Das Gemälde "Ostsee" gelangte 1952 in das Dürener Museum. Zuvor hatte es den Recherchen zufolge dem Kunstsammler Paul Wiegmann und später seiner Erbin, Annie Marnitz, gehört.
Die Kulturstiftung der Länder unterstützte den Rückkauf mit 267.000 Euro. Weitere Förderer sind das nordrhein-westfälische Kulturministerium, die Bezirksregierung Köln, die Ernst von Siemens Kunststiftung, die Stadt Düren sowie die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Landtag zeigt ausgezeichnete NRW-Pressefotos

epd-West/Fassbender
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Landtag hat in diesem Jahr erstmals das "NRW-Pressefoto" ausgezeichnet und Preisgelder von insgesamt 12.000 Euro vergeben. Das Siegerfoto von Ina Fassbender für die Deutsche Presseagentur (dpa) zeigt den Bergmann Marcel Pawlenka in der Waschkaue der Zeche Prosper Haniel in Bottrop, die im Dezember geschlossen wird. Die Jury überzeugte die Symbolkraft des Bildes, das das Ende des Bergbaus, aber auch den Blick in Zukunft illustriere.
Auf den zweiten Platz gewählt wurde ein Foto vom Empfang des türkischen Staatspräsidenten Erdogan durch NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Fotograf Rolf Vennenbernd, ebenfalls von der Nachrichtenagentur dpa, machte die Aufnahme am 29. September und hielt die Begegnung der beiden Politiker in räumlicher Enge am Flughafen Köln-Bonn fest. Dritter wurde Wolfgang Rattay von der Nachrichtenagentur Reuters, der am 5. November Polizisten unter einem riesigen Braunkohlebagger während einer Demonstration am Hambacher Forst fotografierte.
Die Jury hat auch zwei Nachwuchspreise vergeben. Marius Becker gewann mit einem Bild der Gedenkfeier 25 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen. Marcel Kusch erhielt den Preis für seine Aufnahme einer Szene mit Polizisten, RWE-Mitarbeitern und einem festgenommenen Demonstranten während der Proteste am Hambacher Forst. Beide Nachwuchsfotografen sind für die dpa tätig.
Landtagspräsident André Kuper (CDU) hatte den Wettbewerb ins Leben gerufen. 35 Fotografen reichten 147 Bilder ein. Am Nachwuchswettbewerb nahmen sechs Fotografen mit 25 Bildern teil. Bis zum 11. Januar präsentiert der Landtag die fünf Siegerfotos sowie weitere 25 Bilder in einer Ausstellung. Kuper kündigte an, den Wettbewerb im kommenden Jahr fortzusetzen.
Kunstpalast Düsseldorf erhält Fotosammlung der Galerie Kicken
Düsseldorf (epd). Der Kunstpalast in Düsseldorf erhält mehr als 3.000 Fotografien aus der Sammlung der Galerie Kicken. Der Rat der Stadt Düsseldorf habe den Erwerb der Bestandssammlung der Berliner Fotogalerie beschlossen, teilte das Museum am 14. Dezember mit. Von den insgesamt 3.039 Bildern würden 1.823 angekauft, 1.216 Aufnahmen schenke Galerie-Inhaberin Annette Kicken der Landeshauptstadt. Damit könne die städtische Kunstsammlung "eine wesentliche Lücke in ihren Beständen schließen", erklärte Kunstpalast-Generaldirektor Felix Krämer.
Wichtigsten Beiträge der europäischen Fotokunst des 20. Jahrhunderts
Die Sammlung bildet den Angaben nach die wichtigsten Tendenzen der europäischen Fotokunst des 19. und 20. Jahrhunderts ab. Sie enthalte Ikonen der Fotografiegeschichte, darunter Werke von Bernd und Hilla Becher, Robert Capa, Lotte Jacobi, Lázsló Moholy-Nagy, Helmut Newton, Man Ray, Albert Renger-Patzsch und August Sander. Neben Originalabzügen umfasse das Konvolut auch von den Fotografen selbst angefertigte, autorisierte spätere Abzüge sowie Portfolios und Alben.
Zusätzlich zu der Teilschenkung der Sammlung habe sich Annette Kicken bereiterklärt, über die nächsten fünf Jahre eine Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zu finanzieren, der die Fotosammlung fachlich betreut, teilte das Museum weiter mit. Für Anfang 2020 sei eine Ausstellung angedacht. Mit der Neueröffnung der Sammlungspräsentation des Kunstpalastes sollten die Fotografien in den Rundgang integriert und Seite an Seite mit Malerei, Skulptur, Graphik und Angewandter Kunst gezeigt werden.
Der 2014 verstorbene Rudolf Kicken zählte den Angaben zufolge zu den Pionieren der Fotogaleristen. Er hatte seine Fotogalerie 1974 in seiner Heimatstadt Aachen gegründet und später nach Köln verlegt. Seit 2000 leitete er die Galerie gemeinsam mit seiner Frau Annette in Berlin.
"Bonn Voice" ist der "Beste Chor im Westen"
Köln (epd). Die 39 Sängerinnen und Sänger von "Bonn Voice" sind zum "Besten Chor im Westen" gekürt worden. Der Chor setzte sich im Finale des WDR-Wettbewerbs am 14. Dezember gegen vier weitere Finalisten durch, wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilte. "Bonn Voice" erhielt für die Interpretation von "Ein neues Weihnachtslied" des Künstlers Maybebop die meisten Zuschauerstimmen (48,3 Prozent). Auf Platz zwei folgte "Flow" aus Aachen (39,1 Prozent). Den dritten Platz belegten "Die Erben" aus Köln mit knapp 11,6 Prozent der Stimmen, wie es hieß.
"Bonn Voice" gewann ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie einen gemeinsamen Auftritt mit dem WDR-Rundfunkchor in ihrer Heimatstadt. Außerdem wird das Bonner Ensemble 2019 nach Göteborg zum Wettbewerb "European Choir of the Year" reisen.
Der live im Fernsehen übertragene Wettbewerb für Chöre aus ganz Nordrhein-Westfalen fand zum dritten Mal statt. Im Vorfeld hatten sich in diesem Jahr rund 630 Sängerinnen und Sänger am Casting-Wettbewerb des WDR beteiligt, wie es hieß. 2017 war der Frauenchor "Young Voices" aus dem münsterländischen Ahaus-Alstätte zum "Besten Chor im Westen" gewählt worden.
Entwicklung
Unangepasst, konsequent und wortgewaltig

epd-bild / Anja Kessler
São Paulo (epd). Leonardo Boff ist der erste Prominente, der den inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva im Gefängnis besucht. Den Befreiungstheologen und den Politiker verbindet eine mehr als 30-jährige Freundschaft, trotz ihres sehr ungleichen Lebenswegs. Immer wieder reist Boff, seit Lula seine Gefängnisstrafe wegen Korruption im April angetreten hat, in das südliche Curitiba. "Ich komme mit der Botschaft der Hoffnung auf Gerechtigkeit", sagte er nach einem Besuch im November. Diese Haftstrafe beruhe nur auf Lügen, keinem einzigen Beweis.
Noch nie ließ sich Boff das Wort verbieten - weder vom Vatikan noch von einer brasilianischen Regierung. Der Ex-Priester mit seinem dichten, weißen Bart ist bis heute nicht nur in Brasilien eine wichtige Stimme für linke und soziale Bewegungen. Am 14. Dezember ist er 80 Jahre alt geworden.
60 Bücher
Doch es ist keineswegs ruhig um den umtriebigen Katholiken geworden. Er publiziert so viel wie kaum ein anderer Theologe: 60 Bücher und unzählige Artikel hat er veröffentlicht. Sein Thema bleibt dabei die Befreiung der Armen und der Kampf gegen einen entfesselten Kapitalismus, wie er es nennt. "In den vergangenen 40 Jahren hat die Zahl der Armen und Unterdrückten zugenommen. Somit hat die Befreiungstheologie nicht an Bedeutung verloren." Seit etwa 20 Jahren widmet er sich zunehmend der Ökologie, verbunden mit philosophisch-spirituellen Fragestellungen, und spricht von einer "Theologie des Lebens".
1938 im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina als Sohn italienischer Einwanderer geboren, tritt Boff 1958 in den Franziskanerorden ein. Ende der 60er Jahre schloss er sich einer Gruppe von Priestern an, die Armut und Unterdrückung nicht mehr als gottgegeben hinnehmen wollte. Sie wollten eine neue Bewegung schaffen, eine Kirche von unten. Boff und andere Befreiungstheologen begehrten gegen die Dogmen der Kirche auf und gründeten zahlreiche Basisgemeinden - mehr als 100.000 gibt es bis heute in Brasilien.
Die ärgsten Gegenspieler der Befreiungstheologen waren der konservative, aus Polen stammende Papst Johannes Paul II. und Kardinal Joseph Ratzinger, später Papst Benedikt. Als Konsequenz der zermürbenden Auseinandersetzung mit dem Vatikan trat Boff 1992 aus dem Franziskanerorden aus und ließ sich in den Laienstand versetzen. Er habe die Schützengräben gewechselt, aber nicht die Schlacht, sagte er kämpferisch in einem Interview.
Erst Freundschaft, dann Konflikt
Das Verhältnis von Boff und Ratzinger ist ambivalent. Sie kennen sich seit mehr als 40 Jahren, als Boff in Deutschland studierte und zahlreiche Vorlesungen von Ratzinger besuchte. Als Theologe habe er ihn immer sehr geschätzt, sagt Boff. "Wir waren tatsächlich befreundet." Ratzinger habe ihm sogar die Veröffentlichung seiner Promotion finanziert, weil er keinen Verlag gefunden habe.
Jahre später folgt Phase zwei seines Verhältnisses zu Kardinal Ratzinger, wie Boff es nennt. Ratzinger ist inzwischen Chef der Glaubenskongregation im Vatikan und steht in tiefem Konflikt mit den Befreiungstheologen, die er alle für Marxisten hält. Mehrfach zitiert er seinen alten Freund Boff nach Rom. 1985 wird Boff mit einem einjährigen Lehrverbot ("Bußschweigen") belegt. Als er sich 1991 in mehreren Artikeln kritisch mit dem Zölibat sowie der Hierarchie und der Machtausübung der katholischen Kirche auseinandersetzt, wird er zum fünften Mal gemaßregelt und bekommt eine Disziplinarstrafe auferlegt. Danach zieht Boff die Konsequenzen.
Doch Boff bleibt seinen Prinzipien treu und nimmt einen Lehrauftrag für Ethik, Religion und Ökologie an der staatlichen Universität von Rio de Janeiro an. 2001 erhält er den Alternativen Nobelpreis.
Lob für Franziskus
Für Benedikts Nachfolger, den aus Argentinien stammenden Franziskus, hat Boff nur lobende Worte. Und das, obwohl der Papst keineswegs mit den Befreiungstheologen sympathisiert. "Franziskus hat angefangen mit der Reform des Papsttums", lobt er. "Das bedeutet für uns eine Art Frühling, nachdem wir einen sehr scharfen Winter hatten."
Boff lebt in einem ökologischen Reservat in den Bergen nahe der Stadt Petrópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro mit seiner Frau, der Menschenrechtsaktivistin Marcia Maria Monteiro de Miranda. "Ich bin in einem Alter, in dem ich oft an den Tod denke. Aber nicht als etwas Dramatisches", sagt er. "Ich möchte wie andere Theologen bei der Arbeit sterben: während einer Vorlesung, während ich einen Text schreibe, dass man bis zum Ende etwas schafft."
Amoklauf in brasilianischer Kathedrale mit fünf Toten
São Paulo/Campinas (epd). In der Kathedrale der Millionenstadt Campinas in Brasilien hat ein Mann vier Menschen erschossen und zahlreiche weitere verletzt. Der 49-Jährige nahm am 11. Dezember an der katholischen Messe teil und schoss danach wild um sich, wie die Tageszeitung "Folha de São Paulo" berichtete. Nach Polizeiangaben erschoss sich der Täter danach selbst. Das Motiv des Verbrechens ist unklar.
Der Amoklauf hat die Debatte um die vom zukünftigen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro angekündigte Liberalisierung der Waffengesetze angeheizt. Der rechtsextreme Politiker hatte angekündigt, dass jeder, der wolle, eine Waffe tragen solle. "Waffen sind die Garantie unserer Freiheit", sagte er im Wahlkampf. Die schon jetzt einfachen Anforderungen für eine Waffenlizenz will Bolsonaro ganz abschaffen.
Immer mehr Waffen
Die Waffenverkäufe an Zivilisten hätten in den vergangenen Jahren konstant zugenommen, berichtete die "Folha de São Paulo". Aktuell würden pro Stunde sechs Waffen an Privatpersonen verkauft. Nach Angaben der Bundespolizei sind aktuell fast 620.000 Waffen im Besitz von Privatpersonen.
Der Direktor des auf öffentliche Sicherheit spezialisierten Institutes "Sou da Paz", Ivan Marques, sieht Ähnlichkeiten mit den Amokläufen der vergangenen Monate in den USA. Selbstverständlich handele es sich um Menschen mit einer psychischen Störung. "Aber dies kombiniert mit dem einfachen Zugang zu Waffen hat zu den Tragödien geführt", sagte Marquez.
Philippinen verlängern Kriegsrecht auf Mindanao
Frankfurt a.M., Manila (epd). Auf den Philippinen hat das Parlament das Kriegsrecht für die südliche Inselgruppe Mindanao bis Ende 2019 verlängert. Insgesamt 235 Abgeordnete beider Kammern stimmten dafür, 28 dagegen, wie das Nachrichtenportal "Phil Star" am 12. Dezember berichtete. Die Abstimmung erfolgte auf Initiative von Präsident Rodrigo Duterte. Eigentlich hätte das Kriegsrecht Ende Dezember 2018 auslaufen sollen. Die Regierung begründete die Verlängerung mit Sicherheitsrisiken: Sowohl Islamisten als auch kommunistische Rebellen stellen aus ihrer Sicht weiter eine Bedrohung für die Region dar.
Das Kriegsrecht auf Mindanao war erstmals im Mai 2017 verhängt worden, nachdem muslimische Extremisten in die Stadt Marawi eingefallen waren. Sie hatten Geiseln genommen, Gebäude niedergebrannt und Flaggen der Terrormiliz "Islamischer Staat" gehisst. Im Oktober 2017 hatte die Armee das Ende der Kämpfe verkündet. Nach offiziellen Angaben waren etwa 1.200 Menschen getötet worden.
Kritik an Duterte
Kritiker monieren, es gebe derzeit weder eine akute Rebellion noch einen bewaffneten Aufstand auf Mindanao. Die erneute Verlängerung des Kriegsrechts sei nicht nur verfassungswidrig, sondern könne außerdem als Vorwand dienen, den Ausnahmezustand auf das gesamte Land auszuweiten, wie es Duterte schon mehrfach angedroht hatte. Der seit Mitte 2016 amtierende Präsident ist wegen seines autoritären Führungsstils berüchtigt. Insbesondere steht der 73-Jährige wegen seines blutigen "Anti-Drogen-Kriegs" in der Kritik, in dem bereits Tausende Menschen ermordet wurden. Duterte rief zur Tötung von mutmaßlichen Drogenhändlern und Drogenkonsumenten auf.
In dem katholisch geprägten südostasiatischen Land mit mehr als 100 Millionen Einwohnern weckt das Kriegsrecht düstere Erinnerungen. Der frühere Machthaber Ferdinand Marcos hatte es genutzt, um seine Diktatur (1965-1986) zu festigen. Unter Marcos waren Zehntausende Kritiker und Oppositionelle verhaftet, gefoltert und ermordet worden.
Aufbruch mit Risiken und Nebenwirkungen in Äthiopien

epd-bild/Thomas Lohnes
Addis Abeba (epd). In Addis Abeba gehört der Wandel zum Alltag: Dutzende Wolkenkratzer glitzern in der äthiopischen Hauptstadt um die Wette, immer neue Hochhäuser wachsen in die Höhe. Dazwischen schlängelt sich die vor drei Jahren eröffnete Stadtbahn, die täglich 150.000 Passagiere ins Zentrum bringt. "Wer nur alle paar Jahre nach Addis kommt, erkennt die Stadt kaum wieder", sagt Constantin Grund, der das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung leitet. Doch das ist nichts im Vergleich zum politischen Wandel, der das Land seit April erfasst hat.
Seither regiert ein neuer Ministerpräsident das Land am Horn von Afrika: Abiy Ahmed. Der 42-Jährige ist ein Gewächs der Einheitspartei EPRDF, die Äthiopien seit dem Sturz des Mengistu-Regimes 1991 regiert. Er machte erst im Militär und dann im Geheimdienst Karriere. Jetzt beginnt er das Land nach Jahrzehnten autoritärer Herrschaft zu öffnen.
Abiy hat Tausende politische Gefangene frei- und verbotene Parteien wieder zugelassen. Er hat Frieden mit Eritrea geschlossen, die Hälfte der Kabinettsposten und das Präsidentenamt an Frauen vergeben und verspricht für 2020 freie Wahlen. Als Chefin der Wahlkommission kürte er eine prominente Oppositionelle.
"Euphorie"
"Es herrscht große Euphorie um Abiy Ahmed als Person, aber auch um den politischen Stil, den er eingeführt hat", beobachtet Grund. Die Atmosphäre im politischen Betrieb habe sich vollkommen geändert, nicht nur in Addis, sondern landesweit. Die Menschen redeten offen über Politik, während früher die Angst herrschte, überall und permanent abgehört zu werden. Allerdings: "So ein Reformkurs erzeugt natürlich auch ein Stück weit Verlierer", warnt Grund. Seit April hat Abiy bereits einen Anschlag und einen Putschversuch überstanden.
Vor allem im Militär, dessen korrupte Geschäfte durch Ermittlungen mehr und mehr ans Licht kommen, gibt es Widerstand gegen Abiy. Viele Generäle stammen aus Tigray, einer Provinz im Norden, die von Abiys autoritären Vorgängern bevorzugt wurden. Abiy dagegen ist Oromo, Vertreter der größten Ethnie im Land. Das dürfte einer der Gründe sein, warum er sich in der EPRDF gegen die Konkurrenz durchsetzte. Die Partei hofft, dass Abiy die Jugend in Oromia besänftigen kann, nachdem diese zweieinhalb Jahre lang auf die Straßen gegangen ist. Bei den Unruhen gab es Tote und Verletzte.
Die Gründe für die Revolte liegen für Berhanu Negussie auf der Hand, der vor mehr als 35 Jahren an der Seite von Karl-Heinz Böhm die Hilfsorganisation "Menschen für Menschen" aufgebaut hat und heute deren Landesrepräsentant ist. Zwei Drittel der 105 Millionen Äthiopier sind unter 25, die Jobs reichen nicht. Selbst Uniabsolventen bleiben arbeitslos. "Es ist eine hoffnungslose, verzweifelte Generation entstanden", sagt Negussie.
Wachsende Ungeduld
Banden von jungen Männern, Queroo genannt, seien deshalb auf die Straße gegangen, bewaffnet mit Steinen oder Stöcken. "Die Jugendlichen sagten: 'Kommt her, erschießt uns doch. Was haben wir schon zu verlieren?'", erinnert sich Negussie. "Das war der Anfang vom Ende der sogenannten starken Regierung mit ihrer Ideologie, das alles brach in sich zusammen." Auf der Fahrt durch Oromia sieht man heute überall auf Bussen und Tuktuks das Bild Abiys, mal vor der Flagge Äthiopiens, mal umrankt von einem Herz aus Blumen. Doch es gibt noch ein Symbol: die rot-grün-rote Fahne mit einem Baum in der Mitte, Symbol der Oromo-Befreiungsbewegung OLF.
Wie andere Oppositionsgruppen ist sie seit Abiys Amtsantritt wieder erlaubt, die Führung aus Eritrea zurückgekehrt. Sie will die OLF zur Partei umbauen, um 2020 an den Wahlen teilzunehmen. Aber nicht alle Mitglieder sind dazu bereit. Mancherorts haben sich Bewaffnete abgespalten. Eine Horde von Queroo überfiel im September Angehörige anderer Volksgruppen am Stadtrand von Addis Abeba. Sie brüllten "Haut ab aus unserem Land" und töteten 23 Menschen. Abiy reagierte mit Härte, so wie seine Vorgänger. Mehrere junge Männer wurden erschossen, 3.000 vorübergehend verhaftet.
Die wachsende Ungeduld der jungen Äthiopier könnte das größte Problem für Abiy werden, glaubt der emeritierte Domprediger Joachim Hempel, der derzeit Pfarrer der deutschen lutherischen Gemeinde in Addis Abeba ist. "Es werden gerade Erwartungen geschürt, dass morgen alles anders ist als es gestern war." Das aber hält er für ungerechtfertigt. Trotz allen Fortschritts sieht er fußläufig von seiner Kirche Szenen, wie er sie noch von seinem ersten Aufenthalt vor 45 Jahren kennt. Damals erlebte er, wie Putschisten den Kaiser absetzten. "Wenn man die Gunst des Augenblicks nicht nutzt, dann könnte es sein, dass die Soldaten wieder aufmarschieren", fürchtet er.
#metoo in Indien: Schweigen ist keine Option mehr

epd-bild/Iris Völlnagel
Neu-Delhi (epd). Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag in Neu-Delhi. In den Lodi-Gärten, einer der grünen Lungen der indischen Hauptstadt, tummeln sich die Menschen. Junge Pärchen genießen im Schutz der Bäume ihre Zweisamkeit. Großfamilien verbringen den freien Tag hier mit einem Picknick. In einer Ecke des Parks sitzen rund 30 Frauen allen Alters in einem großen Kreis. Sie kennen sich bislang kaum, doch sie alle verbindet eines: #metoo.
Jede der Frauen hat eine Geschichte zu erzählen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, frauenverachtenden Äußerungen von Kollegen oder Vorgesetzten, Grapschereien bis hin zu Vergewaltigungen. Rund zwei Stunden lang tauschen sich die Frauen aus. Tränen fließen. Dennoch sind sich am Ende alle einig: Es hat gut getan über sexuelle Grenzüberschreitungen im Alltag zu reden, auch, wenn manche der Erlebnisse Jahre her sind.
Konsequenzen von Verfehlungen bleiben meist aus
Zu dem Treffen aufgerufen hatte Anoo Bhuyan. Die Journalistin bezeichnet sich selbst als "eine laute Stimme der #metoo-Bewegung" in Indiens Hauptstadt. Auch sie hat erst vor kurzem zum ersten Mal öffentlich darüber gesprochen, wie ein Chefredakteur sie vor Jahren nach Sex gefragt hatte.
Noch vor kurzem wäre sie nicht gehört worden, glaubt die junge Journalistin. Denn während in den USA und anderen Ländern zahlreiche Männer ihre Posten in Folge der #metoo-Enthüllungen räumen mussten, war das in Indien bislang kein Thema.
Dabei hatte die ehemalige Miss Indien und Bollywood-Schauspielerin Tanushree Dutta schon vor zehn Jahren in einem Interview berichtet, dass ihr Schauspielkollege Nana Patekar sie bei einem Dreh bedrängt habe. Als Dutta damals aus Protest das Set verließ, demolierte ein Mob ihr Auto. Die Schauspielerin zog in die USA. Im September wiederholte sie ihre Aussage, zunächst ohne viel Widerhall in der Öffentlichkeit. Das änderte sich Anfang Oktober nahezu schlagartig, als auch andere Schauspielerinnen, Künstlerinnen und Journalistinnen ihr Schweigen brachen.
Inzwischen haben auch in Indien rund 40 Männer ihre Posten geräumt und wurden freigestellt. Die "Times of India", eine der größten Zeitungen des Landes, veröffentlicht und aktualisiert im Internet die Liste. Darunter sind etliche Filmdirektoren, Journalisten, Autoren sowie Schauspieler.
Prominentestes Beispiel ist bislang der Politiker M.J. Akbar, bis Oktober Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten und Mitglied der hindunationalistischen Partei BJP. Vor seiner Politikerkarriere war der 67-Jährige ein einflussreicher Journalist, Buchautor und Herausgeber mehrerer Zeitungen. Nachdem mehrere Frauen Anschuldigungen gegen ihn erhoben hatten, trat Akbar von seinem Amt zurück.
Prominenter Minister im Fokus
Die Frauen werfen ihm vor, sie mit anzüglichen Mails, Textnachrichten oder Anrufen belästigt zu haben, sie begrapscht und unpassende Komplimente verteilt zu haben. Zudem soll er Journalistinnen spät in der Nacht zu Sitzungen befohlen und zu Vorstellungsgesprächen in Hotelzimmer eingeladen haben. Akbars Anwälte wollen nun vor Gericht eine Bestätigung der Unschuld ihres Mandanten erstreiten.
Die laufende Bewegung sei in Indien der zweite Anlauf dieser Art, erklärt Anoo Bhuyan. Nach der Gruppenvergewaltigung der damals 23-jährigen Medizinstudentin Jyoti Singh Pandey am 16. Dezember 2012 habe das Land erstmals über sexuelle Gewalt und Belästigungen debattiert, sagt die Journalistin. Die Studentin starb kurz später an den schrecklichen Verletzungen.
Danach sei das Sexualstrafrecht verschärft worden, resümiert Bhuyan. Auch würden heute wesentlich mehr Vergewaltigungen angezeigt. "Doch das ist längst nicht genug", betont die junge Frau. Die aktuelle Entwicklung zeige, Indien habe zwar jetzt Vorschriften wie etwa das 2013 verabschiedete Gesetz gegen sexuelle Belästigung von Frauen am Arbeitsplatz. "Aber es fehlt an der Umsetzung und am Bewusstsein."
Das sei die Chance der jetzigen Bewegung. "Wenn es gelingt, dies zu ändern, dann hat #metoo schon viel erreicht", glaubt Bhuyan. Sie selbst will weiterkämpfen - das sei sie den anderen Frauen schuldig.
Ausland
Von der "nationalen Schande" zum Weltkulturerbe
Filmemacher lieben die archaische Kulisse: Einst galt das bitterarme Matera als Schandfleck Italiens, nun wird die Stadt mit den Höhlensiedlungen Kulturhauptstadt. Die Bewohner leben längst am Stadtrand, ihre Höhlen sind schicke Touristenunterkünfte.Matera (epd). Ein Spaziergang durch das italienische Matera ist wie eine Reise in eine vergangene Zeit. Malerisch thront die Höhlenstadt auf einem Hügel über einer Schlucht, umweht von Thymianduft. Das "Bethlehem Italiens" wird sie auch genannt, dabei könnte sie auch das biblische Jerusalem sein: Mel Gibson drehte hier 2004 die "Die Passion Christi", Pier Paolo Pasolini nutzte die Höhlensiedlung in Matera 1964 als Kulisse für seinen Film "Das 1. Evangelium - Matthäus". Damals lebten in Matera noch Bauern und Schafhirten, die er als Komparsen einsetzte.
Materas Geschichte reicht bis in die Jungsteinzeit zurück. 1993 wurden die einstigen Wohnhöhlen im Fels und die knapp 160 Höhlenkirchen - viele mit Fresken bemalt - Unesco-Weltkulturerbe. 2019 nun ist Matera neben dem bulgarischen Plowdiw Europäische Kulturhauptstadt. Am 19. Januar wird das Kulturhauptstadtjahr eröffnet, mit mehr als 2.000 Musikern, die durch die Straßen ziehen.
"Christus kam nur bis Eboli"
Dabei galt die Stadt in der Region Basilikata in Italien lange als Schandfleck, rund 15.000 Menschen lebten unter ärmlichsten Bedingungen in den Höhlen. Das faschistische Regime unter Benito Mussolini verbannte Oppositionelle wie Carlo Levi in das abgelegene Bergstädtchen im damals wie heute unterentwickelten Süditalien. Der Schriftsteller und Arzt entdeckte dort 1936/37 bittere Armut - aber auch eine "wunderschöne, malerische und beeindruckende Stadt".
In "Christus kam nur bis Eboli" - 1945 erschienen und in den 70er Jahren verfilmt - beschreibt Levi das karge Leben von Schafhirten, die mit ihren Tieren in den Kalksteinhöhlen von Matera lebten. Die "Sassi" (Steine) genannten Stadtviertel erinnerten ihn an die Bilder, mit denen Dantes Inferno in seiner Schulzeit illustriert wurde. "Auf dem engen Raum zwischen den Fassaden und dem Abhang verlaufen die Straßen, die gleichzeitig für diejenigen, die oben aus den Wohnungen treten, den Boden bilden, und das Dach für die darunter."
Palmiro Togliatti, einst Chef der Kommunistischen Partei Italiens, hatte bei einem Besuch 1948 keinen romantischen Eindruck. Ihn empörte das Elend der Bewohner: Matera sei "eine nationale Schande". Wenige Jahre später begann die Zwangsumsiedlung der 20.000 Bewohner in Neubauten am Stadtrand.
Mittlerweile können Touristen in Höhlen, die zu Luxusherbergen umgebaut wurden, den Charme der in den Stein gehauenen Behausungen genießen. Noch heute sind Teile des ausgeklügelten Systems zur Gewinnung von Frischwasser mit Zisternen und Klärbecken zu sehen, in denen sich aus dem Erdreich angespülte Erde absetzte. Das Ökosystem zur Wassergewinnung für die unterirdischen Behausungen soll im Kulturhauptstadtjahr als zukunftsweisendes Modell präsentiert werden.
"Wer Arbeit sucht, muss weg"
Bis zur Industrialisierung habe das System gut funktioniert, sagt Pietro Laureano. Der Architekt der Universität Florenz erkannte Anfang der 90er Jahre als einer der ersten die Bedeutung Materas als Beispiel für intelligentes Wassermanagement. Heute untersucht er Möglichkeiten der Wasserversorgung in arabischen und afrikanischen Wüstenregionen.
In den 90ern habe man ihn zunächst ausgelacht, als er sich um eine Anerkennung Materas als Weltkulturerbe bemühte, erinnert sich der Professor. Mit seiner Familie hat er zweitweise selbst in einer Höhlenwohnung gelebt - und erzählt mit schelmischer Freude, wie überrascht die Erzieherinnen waren, als sein Sohn im Kindergarten sein Zuhause malen sollte und eine Höhle zu Papier brachte.
"Ich war froh, umzuziehen", erinnert sich dagegen die Rentnerin Nunzia Adorisio, die 1959 eine Wohnung im Neubauviertel Spine Bianche zugewiesen bekam. "Als ich gerade einen Sohn bekommen hatte, musste mein Mann eines Tages eine Schlange erschlagen, die sich bei uns eingenistet hatte", erzählt die 83-Jährige über den Alltag in einer der Höhlen.
Ihre Enkel können sich kaum vorstellen, dass sie einst ohne fließendes Wasser und mit einer Schüssel anstatt einer Toilette aufwuchs. Weltkulturerbe hin, Europäische Kulturhauptstadt her: "Wer Arbeit sucht, muss weg aus Matera, auch heute noch", sagt die ehemalige Schneiderin.

