Kirchen
Kirchlicher Kompass für Zeitalter der Digitalisierung

epd-bild / Heike Lyding
Hannover/Bochum (epd). Hassrede, Fake-News, Pflegeroboter, Dating-Apps und Cybersex: Für diese Phänomene der digitalen Lebenswelt gibt nun ein neuer Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eine ethische Orientierung. Der Text gebe Antworten auf die Frage, wie freiheitliches und verantwortungsvolles Handeln in der digitalen Gesellschaft aussehen könne, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am 22. April bei der Vorstellung der Denkschrift "Freiheit digital. Die Zehn Gebote in Zeiten des digitalen Wandels" während einer Online-Pressekonferenz.
"Weil sich die Technologien in den vergangenen zehn Jahren so rasant weiterentwickelt haben, hinken die gesellschaftlichen Normen für ihre Nutzung zwangsläufig hinterher", sagte Bedford-Strohm. Umso dringlicher sei es, die ethischen Folgen der Digitalisierung stärker in den Blick zu nehmen. Er sehe es als Aufgabe der Kirchen und Religionsgemeinschaften, ethische Orientierungen für gesellschaftliche Fragestellungen zu geben. Keiner anderen Institution sei die ethische Reflexion in die DNA geschrieben.
Orientierung an Zehn Geboten
Aufgebaut ist der Text anhand der biblischen Zehn Gebote, aus denen die Autorinnen und Autoren zehn Leitsätze ableiten. Verfasst wurde die Denkschrift, die einzige der noch bis November andauernden sechsjährigen Ratsperiode, von der Kammer für soziale Ordnung, herausgegeben wurde sie vom Rat der EKD. Der Rat verbinde damit die Hoffnung, dass der 250-Seiten-umfassende Text Anschluss an öffentliche, wissenschaftliche und innerkirchliche Diskurse finde, sagte der Ratsvorsitzende.
Bedford-Strohm verwies auf die Aktualität der Zehn Gebote. So erinnere das neunte Gebot "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten" an die Debatte über Fake News und Hassrede im Netz. Er warnte davor, dass sich die Kommunikation im Internet zunehmend nicht mehr an der Wahrheit, sondern am Kommerz orientierte. Algorithmen bevorzugten jene Beiträge auf sozialen Plattformen, die besonders häufig angesehen oder geteilt würden. Damit lasse sich dann auch besonders viel Geld über Werbung generieren. Auch das Gebot zum Ehebruch verdeutliche ein modernes Problem, Beziehungen verbindlich und verlässlich zu gestalten. Über allem stehe aber das erste Gebot ("Du sollst keine anderen Götter haben neben mir"), das menschlichen Allmachtsfantasien in Bezug auf die Möglichkeiten des technologischen Fortschritts entgegenwirke.
Der stellvertretende Vorsitzende der Kammer für soziale Ordnung, der evangelische Theologe und Sozialethiker Traugott Jähnichen, betonte, dass mit der Denkschrift weder "eine überschäumende Technik-Begeisterung noch eine Technik-Kritik" transportiert werde. Er erinnerte an die Freiheiten, die die Digitalisierung in der Arbeitswelt schaffe, die gleichzeitig aber auch zu einer Ausbeutung von Arbeitnehmern führen könne. Das erlebten derzeit viele Menschen täglich in der Corona-Pandemie. Auch schier unendliche Konsummöglichkeiten würden im Internet angeboten, deren Maß es zu bedenken gelte.
Die EKD will aber nicht nur über die Digitalisierung reflektieren, sondern sie versteht sich auch selbst als Akteurin. So fördert sie etwa durch einen Innovationsfonds Ideen, die die kirchliche Arbeit im Digitalen ermöglichen. Zuletzt sei der Auftrag erteilt worden, ein Haus für digitale Seelsorge und Beratung zu "bauen", sagte Pfarrerin Stefanie Hoffmann aus der EKD-Stabsstelle Digitalisierung. Das Projekt solle im Netz auch Angebote für Menschen schaffen, die sich nicht einer Kirchengemeinde zugehörig fühlten.
Frauenarbeit in evangelischer Kirche vor Umbruch
Für die Frauen in der evangelischen Kirche mit ihren traditionsreichen Verbänden steht viel auf dem Spiel: Ihre EKD-weite Schaltstelle, das "Zentrum", soll nach jüngsten Plänen fast komplett aufgelöst werden.Hannover (epd). Seit sich die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im vergangenen November mit Einsparmodellen befasst hat, muss die Frauenarbeit der EKD damit rechnen, dass ihr bis zum Jahr 2030 drei Viertel der Mittel gestrichen werden. Noch ist nichts beschlossen, aber es sieht nicht gut aus für das Evangelische Zentrum Frauen und Männer, indem die Frauen EKD-weit verortet sind. Wird die Frauenarbeit mit ihren teils traditionsreichen Verbänden noch gebraucht? Manche meinen, auf EKD-Ebene kaum.
"Was wollen die eigentlich machen ohne die ehrenamtlichen älteren Frauen?", fragt die Vorsitzende der Frauenarbeit, Susanne Kahl-Passoth. Sie und die Geschäftsführerin des Zentrums, Eske Wollrad, machen aus ihrem Ärger keinen Hehl und verweisen darauf, dass es Frauen sind, die das ehrenamtliche Engagement der Kirche tragen - vor Ort vom Besuchsdienst über den Kirchenchor bis hin zum Obdachlosencafé.
Das Zentrum, das dieses Jahr fast eine Million Euro von der EKD erhält, hat mit der Alltagsrealität in den Gemeinden indes nur wenig zu tun. Die Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD) - Dach von 40 Verbänden mit rund drei Millionen Christinnen - arbeiten vor allem politisch: als Stimme der Protestantinnen in Kirche und Gesellschaft, als Teil des politischen Feminismus, als Mitglied im Deutschen Frauenrat. Zu Themen wie Prostitutionsgesetz, Abtreibung und Single-Dasein nahm die Frauenarbeit schon Stellung. Zudem beschäftigen sich die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Genderfragen.
Verweis auf Doppelstrukturen
Aus EKD-Sicht ist die Frauenarbeit dennoch künftig in den Landeskirchen und Gemeinden gut aufgehoben, jedenfalls größtenteils. Bei allen Einsparvorschlägen sei es darum gegangen, Parallelarbeit und Doppelstrukturen zwischen Landeskirchen und EKD abzubauen, sagt der theologische Vizepräsident des Kirchenamts, Thies Gundlach. "Was die Frauenarbeit an ehrenamtlicher Arbeit vor Ort leistet, ist imposant. Gerade dies spricht dafür, die Gewichte stärker auf die Landeskirchen zu verschieben."
Dagegen regt sich unter den Frauen Widerstand. "Wir haben sehr große Unterstützung bekommen, viele Briefe und Mails, in allen Landeskirchen. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird", sagt Eske Wollrad. Zwei Synodenmitglieder hatten im Dezember "Prüfanträge" gestellt, um die Kriterien für die Sparmaßnahme zu hinterfragen. Nach einer Neubewertung in zwei EKD-Ausschüssen, zuletzt Mitte März im Haushaltsausschuss, blieb im Wesentlichen alles beim Alten. Nun muss das Kirchenparlament im Herbst entscheiden.
Abgesehen vom Blick auf Sparmöglichkeiten polarisiert die Frauenarbeit. Theologisch-konservative Kirchenmitglieder stört der starke Fokus auf Genderthemen. Im Zusammenhang mit den Sparplänen habe dies aber keine Rolle gespielt, sagt der EKD-Theologe Gundlach. "Geschlechtergerechtigkeit wird in der EKD sehr wichtig genommen." Das EKD-Studienzentrum für Genderfragen muss daher keine Sparzwänge fürchten. Doch nicht alle Aufgaben des Zentrums für Frauen und Männer lassen sich künftig dorthin übertragen.
Die EKD müsse "anschlussfähig" bleiben in Sachen Genderpolitik, sagt Wollrad, beispielsweise beim Transsexuellen-Gesetz, an dessen Entwurf Grüne und FDP gerade arbeiten, oder in der Debatte über Identitätspolitik: "Wer macht das, wenn das Zentrum nicht mehr da ist?" Das Gender-Studienzentrum, das sich vorrangig um Gleichstellung in der Kirche kümmert, könne dies nicht leisten. Und eine Vertretung im Deutschen Frauenrat sei dieser EKD-Abteilung juristisch gar nicht möglich. Die Frage der Verbandsvertretung soll nun allerdings noch weiter beraten werden.
EKD erwartet Vorschläge
Dass gespart werden müsse, sei "kummervoll", räumt der EKD-Vizepräsident Gundlach ein. Doch nun würden Frauen- und Männerarbeit selbst überlegen, wie ihre Zukunft im Rahmen des finanziell Möglichen gestaltet werden kann. Nach schrittweisen Kürzungen soll das Zentrum im Jahr 2030 noch rund 290.000 Euro erhalten. "Die Frauenarbeit braucht eine neue Struktur", sagt Gundlach. Die EKD sei für gute Vorschläge dankbar.
Aber die Frauen geben noch nicht ganz auf. "Noch ist Holland nicht verloren", sagt Kahl-Passoth. Angelika Weigt-Blätgen, Mitglied des EFiD-Präsidiums und des EKD-Haushaltsauschusses, hält die Frauenarbeit als "große Playerin" für unterschätzt. Sie unterstreicht, dass - auch bei starken Sparvorgaben - die kirchliche, politische und zivilgesellschaftliche Vertretung der Verbände bundesweit möglich sein muss. Dies den Landeskirchen überlassen zu wollen, sei "Unfug". Aber das Zentrum, da ist Weigt-Blätgen realistisch, werde wohl nicht überdauern.
Theologieprofessorin Wendebourg: EKD-Frauenarbeit ist verzichtbar
Berlin (epd). Die evangelische Frauenarbeit ist nach Ansicht der Theologieprofessorin Dorothea Wendebourg auf EKD-Ebene nicht länger notwendig. "Sie ist entbehrlich", sagte Wendebourg im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Wenn es darum geht, Frauen noch stärker zur Geltung zu bringen, brauchen wir die Frauenarbeit nicht mehr. Da haben wir eigentlich schon alles erobert." In der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) soll das Evangelische Zentrum für Frauen und Männer in Hannover, in dem die Frauenarbeit verortet ist, demnächst fast komplett eingespart werden.
Bei Gleichberechtigung viel erreicht
"Es gab Zeiten, da war die Frauenarbeit wichtig. Frauen hatten keinen Zugang zu Ämtern, waren mit Rollenklischees konfrontiert", sagte Wendebourg. "Das ist heute nicht mehr der Fall." Dass für die Gleichberechtigung viel erreicht worden sei, zeige sich etwa in der großen Zahl der Theologiestudentinnen, wogegen die der männlichen Studenten zurückgehe, so die Kirchenhistorikerin, die bis 2017 einen Lehrstuhl an der Berliner Humboldt-Universität innehatte. Es bräuchte eher eine Forcierung der Männerarbeit. Zumal auch Kirchengänger schon immer mehrheitlich Frauen und weniger Männer seien.
Kritisch sieht Wendebourg, dass sich der Fokus der Frauenarbeit auf die Genderfrage verengt habe. Das Gender-Programm müsse sich die Frauenarbeit nicht zu eigen machen, es mache die Frauenfrage letztlich bedeutungslos, sagte die Kirchenhistorikerin. Sie bezog sich damit auf die den Gender-Maßnahmen zugrunde liegende Theorie der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler, die Geschlechter durch sozial-kulturelle Zuschreibungen definiert sieht und letztlich die Auflösung der Zweigeschlechtlichkeit anstrebt.
"Funktioniert an der Basis"
"Gender und Gendersprache sind Anliegen einer kleinen Gruppe, die das pusht", sagte Wendebourg. "Die große Zahl der Frauen in der Kirche interessiert das überhaupt nicht." Hinzu komme, dass Themen wie das Single-Sein oder ein künftiges Transgender-Gesetz, denen sich die Frauenarbeit widmet, "nicht frauenspezifisch" seien. "Hier hört die Frauenarbeit auf, Frauenarbeit zu sein", sagte die Theologin: "Ich verstehe nicht, dass ein Feminismus, der eigentlich unterbewerteten Frauen helfen will, das alles Huckepack nimmt." Es sei eine Illusion zu glauben, dass die Gesellschaft durch Gendersprache und -Programme verändert werden könnte.
Ort klassischer Frauenarbeit seien eher Diakonie und Gemeinde, sagte Theologin, die auch zeitweilig lutherische Vorsitzende der Theologischen Kammer der EKD war: "Frauenhilfe an der Basis, das funktioniert. Vor Ort kann die Frauenarbeit ad hoc besser reagieren - sich etwa um Einsame kümmern und bei Überforderung helfen."
Das Zentrum Frauen und Männer wird von den Evangelischen Frauen in Deutschland e.V. (EFiD) und der Männerarbeit der EKD getragen. Es wird fast vollständig von der EKD finanziert. Dem Frauen-Dachverband gehören 40 Verbände mit rund drei Millionen Protestantinnen an.
Bedford-Strohm wünscht sich "Sea-Watch 4" ohne Antifa-Fahne

epd-bild / Thomas Lohnes
Hannover (epd). Aus Sicht des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, verdeckt die Debatte um eine Antifa-Fahne auf dem kirchlich unterstützten Flüchtlings-Rettungsschiff "Sea-Watch 4" die Ziele der Hilfsorganisation. "Ich würde es ausdrücklich begrüßen, wenn die Flagge alsbald eingeholt wird, da die Diskussion darum das eigentliche Anliegen der Seenotretter zunehmend unsichtbar macht", sagte Bedford-Strohm am 21. April dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Organisation Sea-Watch reagierte ausweichend auf die Äußerung. Kritik an der Fahne war in den vergangenen Tagen lauter geworden.
Vor knapp zwei Wochen hatte Sea-Watch die Flagge bewusst noch prominenter als zuvor am Schiff platziert: "Aufgrund der Stimmungsmache von AfD und anderen Rechten gegen eine Flagge der Antifaschistischen Aktion an unserem Bug haben wir uns entschieden, diese zu entfernen. Sie hängt jetzt etwas sichtbarer weiter oben. Gern geschehen", heißt es in einem Tweet bei Twitter vom 8. April. Auf einem dazugehörigen Foto ist die Fahne wehend an einem Mast zu sehen.
Kritik aus Reihen der CDU
In den vergangenen Tagen hatten unter anderen mehrere CDU-Bundestagsabgeordnete die Flagge kritisiert. Das Antifa-Symbol sei zwar nicht strafbar, aber es werde "insbesondere im gewaltorientierten Linksextremismus breit verwendet", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU), der Tageszeitung "Die Welt". Die EKD sei "daher gut beraten, sich davon sehr klar zu distanzieren".
Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß erklärte, die Kirche könne nicht "mit linken Gewalttätern in einem Boot sitzen". "Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm muss jetzt ein Machtwort sprechen", forderte er.
Bedford-Strohm sagte dem epd: "Als EKD haben wir eine glasklare Position für den Schutz von Menschenleben und für Gewaltfreiheit. Wo Menschen unter dem Label des Antifaschismus Gewalt anwenden oder dazu aufrufen, macht mich das zornig. Mit wirklichem Antifaschismus hat das für mich nichts zu tun." Die "Sea-Watch 4" und ihre Besatzung retteten Menschenleben. Damit seien sie erkennbar im Dienste der Nächstenliebe und der Menschenrechte unterwegs.
Sea-Watch will "Retten statt Reden"
Sea-Watch-Sprecher Oliver Kulikowski sagte dem epd auf Anfrage, die Hilfsorganisation habe ihre Position zur Antifa-Fahne bereits deutlich gemacht. Anders als Politikerinnen und Politiker, "die dem massenhaften Sterbenlassen im Mittelmeer tatenlos, schweigend oder hetzend zusehen, haben wir keine Zeit, uns zwei Wochen über eine Fahne an Bord eines Schiffs auszulassen", sagte Kulikowski und fügte hinzu: "Unserem Motto 'Retten statt Reden' folgend haben wir eine Rettungsmission vorzubereiten."
Die "Sea-Watch 4" wurde im vergangenen Jahr mit Hilfe von kirchlichen Spenden zur Rettung von Flüchtlingen ins Mittelmeer geschickt. Betreiber ist der 2015 gegründete Berliner Verein Sea-Watch.
Das kirchlich initiierte Spendenbündnis United4Rescue erklärte, es lehne jede Form von Gewalt ab, "unter anderem auch linksextreme Gruppierungen, die gewaltbereit oder antidemokratisch sind". Das Hochziehen einer Antifa-Flagge und das daraus resultierende Bekenntnis zur einer antifaschistischen Grundhaltung sei keineswegs identisch mit der Zustimmung zu Gewalt und Linksextremismus. Insofern sehe United4Rescue keinerlei Anlass, die Partnerschaft mit Sea-Watch infrage zu stellen.
EKD-Synode regelt Schwaetzer-Nachfolge

epd-bild/Jonathan Haase/EKN
Hannover (epd). Die obersten Parlamente der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) konstituieren sich zu Beginn einer sechsjährigen Amtszeit neu. Im Mittelpunkt der digitalen Tagung vom 6. bis 8. Mai steht die Neuwahl des Präsidiums der EKD-Synode. Nach fast acht Jahren im Amt stellt sich die 79-jährige Synodenpräses Irmgard Schwaetzer nicht noch einmal zur Wahl.
Bei der Tagung berät nicht nur die EKD-Synode in veränderter Zusammensetzung. Auch die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen (UEK) kommen erstmals mit neu bestimmten Vertreterinnen und Vertretern zusammen.
Die 128 EKD-Synodalen werden das Präsidium am Samstag, dem letzten Tag der Sitzung, neu wählen, wie die EKD am 21. April in Hannover mitteilte. Neben Präses Schwaetzer gehören ihm bislang zwei Vizepräsides und vier Beisitzerinnen und Beisitzer an.
Bereits die Vorgängersynode hatte im November vergangenen Jahres ihre letzte Sitzung wegen der Corona-Pandemie nur digital abhalten können. Sie billigte vor dem Hintergrund zurückgehender Steuereinnahmen und Kirchenmitgliedszahlen ein Sparkonzept, das einen Zeitraum bis 2030 umfasst.
Die neue Synode soll im November zum zweiten Mal tagen, um unter anderem den 15 Mitglieder umfassenden Rat der EKD neu zu wählen. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm scheidet dann als oberster Repräsentant der rund 20,7 Millionen deutschen Protestanten aus dem Amt.
Kurschus: Kirche soll in Corona-Krise Raum für Fragen geben

epd-bild//Gerd-Matthias Hoeffchen
Bielefeld (epd). Die Kirche sollte in der Corona-Krise nach Worten der westfälischen Präses Annette Kurschus keine vorschnellen Antworten geben. "Dass wir im Moment viele Fragen haben, ist kein Ausdruck von Hilflosigkeit", sagte Kurschus am 20. April in einer Online-Diskussion mit Theologenprofessorinnen und -professoren.
"Die Zeit hat mich gelehrt, dass wir aus gutem Grund nicht vollmundig unterwegs sind", erklärte die leitende Theologin, die auch stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Als Kirche bei den Menschen gehe es darum, die Fragen auszuhalten und sich sicher zu sein, dass Gott zuhöre. Christen wüssten, dass sie einen guten Hirten hätten, auf den sie vertrauen könnten. "Davon etwas in die Welt zu geben, ist unser Auftrag", unterstrich Kurschus.
"Kultur des Verstehens, des Verzeihens und der Vergebung"
Corona mache wie unter Vergrößerungsglas deutlich, was funktioniere und was nicht funktioniere, sagte der Bochumer Theologieprofessor Traugott Jähnichen. In der Pandemie sei die Endlichkeit des Lebens deutlich geworden. Aufgabe der Kirche sei es, Trost im Leben und im Sterben auszusprechen. Kirche könne zudem zu einer "Kultur des Verstehens, des Verzeihens und der Vergebung" beitragen, erklärte der Professor für Systematische Theologie der Ruhr-Universität Bochum.
Die Kirche sollte nach Worten der Münsteraner Neutestamentlerin Eve-Marie Becker die Botschaft der Hoffnung betonen. Kirche müsse auf den Feldern, wo sie Kompetenz habe, vorangehen und Lösungsmöglichkeiten vorstellen. Gesamtaufgabe der Theologie sei es, Hoffnung und den Trost durch die Gemeinschaft mit Christus zu verkünden, sagte die Professorin der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
"Die Ressource ist das Evangelium"
Die Theologieprofessorin der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, Konstanze Kemnitzer, nannte es als Herausforderung der Kirche, in der Pandemie zu Vernunft und Liebe beizutragen. Die Kirche sollte für eine Gesellschaft einstehen, in der um Vernunft gerungen werde. "Die Ressource, die wir dafür haben, ist das Evangelium".
Ziel des digitalen "Lern- und Lehrgesprächs", zu dem die Präses Kurschus eingeladen hatte, war es, über die Pandemie aus theologischer Perspektive ins Gespräch zu kommen. Teilnehmer waren neben Vertretern der Landeskirche neun evangelische Theologieprofessorinnen und -professoren von Universitäten und Hochschulen in Münster, Bochum, Wuppertal, Siegen und Paderborn.
Berliner Bischof Stäblein ruft zu Corona-Tests auf

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, hat die Menschen zu regelmäßigen Corona-Tests aufgerufen. Testen sei auch ein Akt der Nächstenliebe, weil man damit andere Personen vor einer Corona-Infektion schützen könne, sagte der Bischof am 20. April beim Besuch des Covid-19-Testzentrums "Test4Culture" in der Villa Elisabeth neben der St. Elisabeth-Kirche in Berlin-Mitte. Tests würden zudem gegen "das schleichende Misstrauen in der Gesellschaft" und gegen die Angst helfen, "dass jeder Mensch, dem man begegnet, potenziell ein Risiko sein könne".
Zu einer möglichen Testpflicht für Gottesdienste äußerte sich Stäblein zurückhaltend und verwies darauf, dass in den Kirchen bereits jetzt alle Hygienevorschriften streng eingehalten würden. "Es geht aber jetzt darum, die Menschen zu ermuntern, sich vor dem Gottesdienst testen zu lassen", betonte der Bischof.
Zugleich würdigte er das Engagement des Kultur Büros Elisabeth. In der Villa Elisabeth finden coronabedingt seit etwa einem Jahr keine Kulturveranstaltungen statt. Seit 1. April wird das großzügige Gebäude neben der St. Elisabeth-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde am Weinberg als Corona-Testzentrum genutzt.
Seit dem Start seien hier bereits rund 9.000 Tests durchgeführt worden, hieß es. Durchschnittlich ein bis drei Menschen würden hier täglich positiv getestet. Unter den Mitarbeitern des Testzentrums sind Künstler, Journalisten, Medizin- und Pharmaziestudenten sowie Mitglieder der Kirchengemeinde.
Bischöfin Fehrs: Mütter in der Corona-Krise mehr würdigen
Hamburg (epd). Die große Belastung von Müttern in der Corona-Pandemie muss nach den Worten der Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs mehr gewürdigt werden. Die Krise verlange vor allem alleinerziehenden Müttern und Vätern viel ab, sagte sie am 25. April in der Hauptkirche St. Jacobi in Hamburg. Mit dem Gottesdienst wurde das 70-jährige Bestehen des Müttergenesungswerks gefeiert. Die Müttergenesung sei eine Erfolgsgeschichte, die Millionen Frauen die Lebensfreude zurückgebracht habe, erklärte Fehrs.
Elke Büdenbender, Schirmherrin des Müttergenesungswerks und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sagte, Mütter seien "Alltagsengel". Mütter - und zunehmend auch Väter - seien die "Seele der Familie": Sie seien immer da, hörten zu, trösteten und organisierten. Oft suchten sie sich zu spät Hilfe und Unterstützung. Zu groß sei das Gefühl der Verpflichtung, dass es ohne sie nicht gehe, sagte Büdenbender. Die Gesellschaft habe daher eine Verpflichtung, Mütter und Väter zu ermutigen, sich auffangen zu lassen.
Das Müttergenesungswerk wurde 1950 von Elly Heuss-Knapp, Ehefrau von Bundespräsident Theodor Heuss, gegründet. Das eigentliche Jubiläum war 2020, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.
Fehrs erklärte, die Müttergenesung sei ein Segen, weil bei ihr die Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehe. Wer über Jahre für andere sorge und Verantwortung trage, brauche auch Kraft für sich selbst. Trotz des altertümlichen Begriffs sei Müttergenesung aktuell wie nie, betonte die Bischöfin. Seit Generationen verlasse sich die Gesellschaft allzu sehr darauf, dass die Frauen die entscheidende Sorge-Arbeit leisten. Es sei eine Arbeit, die nicht entlohnt und nicht einmal als Arbeit anerkannt werde, weil man sage, sie werde doch aus Liebe getan.
"Kirche in Not": Verletzung der Religionsfreiheit in vielen Ländern
Rom (epd). Das katholische Hilfswerk "Kirche in Not" hat eine wachsende Diskriminierung und Verfolgung von Gläubigen beklagt. In knapp einem Drittel aller Länder mit knapp zwei Dritteln der Weltbevölkerung werde die Religionsfreiheit verletzt, beklagte die Einrichtung in einem am 20. April in Rom vorgestellten Bericht. "Am meisten leiden die Christen", erklärte der Geschäftsführer von "Kirche in Not" Deutschland, Florian Ripka, anlässlich der Veröffentlichung.
Dem Bericht zufolge verzeichnen China, Indien, Pakistan, Bangladesch und Nigeria besonders gravierende Einschränkungen der Religionsfreiheit. In zwanzig von 196 Staaten verschlechtere sich die Lage der religiös Gläubigen, heißt es in dem Bericht "Religionsfreiheit weltweit". Allein in China und Myanmar litten rund dreißig Millionen Muslime unter Verfolgung.
Sexuelle Gewalt als Waffe
In China, Niger, der Türkei, Ägypten und Pakistan würden religiöse Minderheiten seit Ausbruch der Corona-Pandemie in noch größerem Ausmaß als zuvor diskriminiert. Diesen würden aufgrund ihrer religiösen Ausrichtung Lebensmittelhilfen verweigert und Zugang zum Gesundheitswesen erschwert.
In einer wachsenden Zahl von Ländern wird demnach sexuelle Gewalt als Waffe gegen Angehörige religiöser Minderheiten eingesetzt. Die Autoren des Berichts weisen auf Entführungen und Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen hin, die gezwungen würden, ihren Glauben zu wechseln.
Westlichen Ländern warf der Präsident von "Kirche in Not", Kardinal Mauro Piacenza, bei der Vorstellung des Dokuments vor, durch die Anerkennung neuer Menschenrechte die Religionsfreiheit einzuschränken. "Diese neuen Normen sorgen dafür, dass die Rechte auf Gewissens- und Religionsfreiheit in einen scharfen Konflikt zur Verpflichtung treten, diese Normen zu respektieren", heißt es in dem Bericht zur Religionsfreiheit von 2021.
Landessuperintendent: Christen sollen von ihrem Glauben erzählen

epd-bild/Lippische Landeskirche
Attendorn, Detmold (epd). Der lippische Landessuperintendent Dietmar Arends hat Christinnen und Christen ermutigt, von ihrem Glauben zu erzählen. Über die Bedeutung des Christseins zu sprechen, sei "eine Aufgabe, die uns als Kirchen heute erneut immer stärker herausfordert", sagte der leitende Theologe der Lippischen Landeskirche am 25. April im Ökumenischen Vespergottesdienst in Attendorn. "Wir können uns immer weniger darauf verlassen, dass die Menschen schon irgendwie wissen, um was es geht."
"Wir brauchen als Kirchen und als einzelne Christenmenschen Sprachfähigkeit, Dialogfähigkeit", sagte Arends laut Predigttext weiter. Das gelte auch für den Dialog mit anderen Konfessionen und Religionen, der immer im Respekt vor den anderen erfolgen müsse. "Wo wir einander begegnen in aller Unterschiedlichkeit, werden wir einander gerade darin achten", betonte der Landessuperintendent.
Ökumenischer Vespergottesdienst
Arends sprach im traditionellen Ökumenischen Vespergottesdienst der christlichen Konfessionen in Westfalen und Lippe. Präses Annette Kurschus und Oberkirchenrat Ulrich Möller von der Evangelischen Kirche von Westfalen sowie der katholische Paderborner Erzbischof Hans-Josef Becker gestalteten die Liturgie. Zu den weiteren Mitwirkenden zählten unter anderem der syrisch-orthodoxe Erzbischof Mor Philoxenos Matthias Nayis, der koptische Bischof Anban Damian und der griechisch-orthodoxe Erzpriester Panagiotis Tiriakidis. Wegen der Corona-Pandemie war keine Gemeinde in der Kirche, der Gottesdienst wurde online über YouTube übertragen.
Bereits seit 1999 feiern die christlichen Konfessionen in Ostwestfalen-Lippe alljährlich einen ökumenischen Gottesdienst. Die leitenden Theologen predigen dabei im Wechsel.
Reformierte wollen ihre Gottesdienste modernisieren
Hannover, Detmold (epd). Die evangelisch-reformierten Kirchen wollen ihre Gottesdienstordnungen modernisieren. Ziel sei es, nach mehr als 20 Jahren die bisherige Liturgie zeitgemäßer und verständlicher zu gestalten, sagte die Projektleiterin Pastorin Judith Filitz aus der Lippischen Landeskirche am 20. April. Koordiniert werde das Projekt vom Reformierten Bund mit Sitz in Hannover.
Die aktuelle Liturgie stamme aus dem Jahr 1999 und sei bereits "ein wenig angestaubt", erläuterte Filitz. "Damals wurden beispielsweise gleichgeschlechtliche Trauungen überhaupt nicht berücksichtigt." Die neue Liturgie solle darum auch in den Gebeten offener formuliert werden, so dass sich niemand ausgeschlossen fühlen müsse. Zudem sollen für digitale Gottesdienstformate Vorschläge erarbeitet werden. So seien beispielsweise zweisprachige Ordnungen für digitale Partnerschaftsgottesdienste etwa mit Gemeinden in Südafrika oder Korea geplant. An dem Projekt sind Filitz zufolge mehr als 30 Menschen aus den reformierte Gemeinden in Deutschland und der Schweiz sowie aus der Evangelisch-altreformierten Kirche beteiligt.
Der Reformierte Bund ist der Dachverband der evangelisch-reformierten Christen in Deutschland. Dem als Verein organisierten Bund gehören Einzelpersonen sowie die Evangelisch-reformierte Kirche mit Sitz in Leer und die Lippische Landeskirche an. Dazu kommen zahlreiche Kirchengemeinden vor allem aus den unierten Kirchen im Rheinland, in Westfalen, in Bremen und in Hessen-Nassau. Die Wurzeln der reformierten Kirche liegen in der Schweizer Reformation des 16. Jahrhunderts. Zu ihren Vätern zählen die Reformatoren Ulrich Zwingli (1484-1531) aus Zürich und Johannes Calvin (1509-1564) aus Genf.
Sternberg tritt nicht für dritte Amtszeit als ZdK-Präsident an

epd-bild/Heike Lyding
Bonn (epd). Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, tritt nicht für eine dritte Amtszeit an. Er werde, wie bereits beim Amtsantritt verkündet, nicht für eine neue Kandidatur bereitstehen, teilte das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) am 23. April während seiner Vollversammlung auf Twitter mit. Das sei kein Rückzug, betonte Sternberg: "Im kommenden Jahr werde ich 70, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören."
Präsidium und Hauptausschuss des ZdK wollen nun eine Findungskommission einsetzen, die neue Kandidaten sucht. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin würde dann im November auf der nächsten Vollversammlung gewählt. Sternberg hatte 2015 die Nachfolge von Alois Glück angetreten, der sechs Jahre lang an der Spitze des ZdK stand. Er war zunächst für zwei Jahre gewählt worden und war dann 2017 für eine volle Amtsperiode wiedergewählt worden.
Der aus Grevenbrück im Sauerland stammende Sternberg studierte nach einer Bäckerlehre Germanistik, Kunstgeschichte und Theologie in Münster, Rom und Bonn. 1983 promovierte er in Germanistik und 1988 in Alter Kirchengeschichte. 1988 wurde er Direktor des Franz-Hitze-Hauses, 2001 Honorarprofessor für Kunst und Liturgie an der Universität Münster. Bereits seit 1997 war er Sprecher für kulturpolitische Grundfragen im ZdK. Von 2005 bis 2017 gehörte er als CDU-Abgeordneter dem nordrhein-westfälischen Landtag an. Sternberg ist verwitwet und Vater von fünf erwachsenen Kindern.
Bätzing: Vatikan hat Angst vor Auseinanderbrechen der Kirche

epd-bild/Sascha Steinbach/EPA--Pool
Frankfurt a.M. (epd). Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, beharrt auf einem eigenständigen Kurs der Katholiken in Deutschland. "Die Kirche kann nicht zentral gesteuert werden", sagte der Limburger Bischof zu den Konflikten mit dem Vatikan. Bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sagte Bätzing am 22. April in Frankfurt am Main, die Kirche müsse im Rahmen der katholischen Glaubenslehre und des Kirchenrechts dezentral leben und entscheiden können.
Bätzing erklärte die teils scharfen Töne aus dem Vatikan zum Reformprozess Synodaler Weg und Plänen für konfessionsübergreifende wechselseitige Einladungen zum Abendmahl mit der Sorge um die Einheit der Kirche. "Ich glaube, es herrscht Angst", sagte der oberste Repräsentant der deutschen Katholiken. Aus dieser Angst heraus greife der Vatikan bisweilen zu falschen Instrumenten.
Die Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen blickten drei Wochen vor Beginn auf den 3. Ökumenischen Kirchentag voraus. Ursprünglich hatte das Christentreffen vom 12. bis 16. Mai Zehntausende Menschen in Frankfurt zusammenbringen sollen zu Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops, Gottesdiensten und Konzerten. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Programm deutlich verkleinert, die Angebote sind weitgehend digital. Statt der ursprünglich geplanten mehr als 2.000 Veranstaltungen wird es nun etwa 80 geben, beginnend an Christi Himmelfahrt bis zum darauffolgenden Sonntag.
Mahlfeiern beim Kirchentag
Ein wesentlicher theologisch begründeter Dissens im Verhältnis zwischen Katholiken und Protestanten ist seit vielen Jahren nicht ausgeräumt: die wechselseitige Teilnahme am Abendmahl. Bei den Gottesdiensten mit Abendmahl oder Eucharistie am letzten Abend des Kirchentags sollen Christinnen und Christen gleich welcher Konfession an allen Mahlfeiern teilnehmen können, wenn sie dies mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Damit riskieren vor allem die katholischen Organisatoren, neben dem Zentralkomitee auch das Bistum Limburg mit Bischof Bätzing an der Spitze, einen Konflikt mit dem Vatikan.
Bedford-Strohm, der einen orthodoxen Gottesdienst besuchen will, sprach von einem "Netz von Gastfreundschaften", das mit den vier Gottesdiensten gespannt werden soll. Im Zentrum dessen stehe Jesus Christus.
Der bayerische Landesbischof betonte angesichts sinkender Kirchenmitgliedszahlen, die Zeit einer Kirche als "gesetzte Institution" sei vorbei. Heute gehe es darum, unter den Bedingungen des Pluralismus und der Individualisierung die Kraft der christlichen Botschaft deutlich zu machen. Kirchenmitgliedszahlen seien heute "viel ehrlicher" als früher, als Menschen nach einem Austritt sozial ausgegrenzt worden seien. "Die Menschen, die jetzt in der Kirche sind, wissen auch warum", sagte Bedford Strohm. Daher sei er zuversichtlich, dass auch eine Kirche mit weniger Mitgliedern ausstrahlungsstark sein könne.
Grundlage für die wechselseitige Einladung zu Abendmahl und Eucharistie beim Kirchentag ist ein Votum des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen "Gemeinsam am Tisch des Herrn", das 2019 veröffentlicht wurde. Darin sprachen sich führende Theologinnen und Theologen beider Konfessionen, unter ihnen auch Bischof Bätzing, für die Möglichkeit der wechselseitigen Teilnahme an Eucharistie und Abendmahl aus, da nach ihrer Auffassung nicht die Kirche, sondern Jesus Christus zum Abendmahl einlädt. Grundlegend dafür ist die Taufe. Der Vatikan, der in Fragen der katholischen Lehre maßgeblich ist, hatte das Votum des Arbeitskreises abgelehnt.
Bislang können evangelische und katholische Christen nicht gemeinsam Abendmahl feiern, das würde eine kirchliche Einheit voraussetzen. In Ausnahmefällen ist eine Teilnahme etwa von Ehepartnern evangelischer Konfession an der katholischen Eucharistie möglich.
Papst ruft zu Gebetsmarathon für Ende der Corona-Pandemie auf
Rom (epd). Papst Franziskus hat zum Gebet für ein Ende der Corona-Pandemie aufgerufen. Er werde am 1. Mai einen einmonatigen "Gebetsmarathon" eröffnen, zu dem Gläubige weltweit aufgerufen seien, teilte das offizielle Internet-Portal "Vaticannews" am 22. April mit. An der Initiative sind demnach dreißig repräsentative Heiligtümer an Wallfahrtsorten in aller Welt beteiligt, in denen täglich aus diesem Anlass der Rosenkranz gebetet werde.
Der Gebetsmarathon steht unter dem Motto "Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott" aus der Apostelgeschichte. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Papst zu einem weltweiten Gebet für die an der Pandemie leidenden Menschen aufgerufen. Am Vorabend des Pfingstsonntags betete er unter Einbeziehung der größten Wallfahrtsorte weltweit in den Vatikanischen Gärten den Rosenkranz.
Frauenhilfe Rheinland lädt zu digitalen Frauenkonferenzen ein
Bonn (epd). Die Evangelische Frauenhilfe im Rheinland lädt am 28. Mai und 25. Juni ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen aus Gemeinden und Kirchenkreisen zu digitalen Frauenkonferenzen ein. Unter dem Motto "Kirche anders leben" soll es um Ideen für eine "Kirche von Frauen für Frauen an Alltagsorten" gehen, wie die rheinische Frauenhilfe in Bonn ankündigte. Von 16 bis 20 Uhr stehen jeweils Gesprächsrunden, Impulsvorträge und Andachten auf dem Programm.
Anmeldung: bildung@frauenhilfe-rheinland.de
Infos: www.frauenhilfe-rheinland.de
Standortentscheidung für Kirchenmusik-Hochschule vertagt

epd-West /Ralf Bittner
Bielefeld, Bochum (epd). Die westfälische Landeskirche hat die Entscheidung über den künftigen Standort ihrer Hochschule für Kirchenmusik vertagt. Die Kirchenleitung sei "zu der Frage gelangt", ob angesichts der aktuellen Pandemie-Entwicklung ein "Investitionsrisiko der geplanten Größenordnung" überhaupt getragen werden könne, teilte das Landeskirchenamt am 22. April in Bielefeld mit. Zuletzt hatte die westfälische Kirche einen Zusammenlegung der bisher örtlich getrennten Fachbereiche Klassik und Pop in einem Neubau in Bochum ins Auge gefasst - ostwestfälische Kirchenkreise hatten sich für eine Fusion am Traditionsstandort Herford starkgemacht.
Die Landeskirche arbeite daran, die Ausbildung von Kirchenmusikern "mit hoher Qualität zukunftssicher aufzustellen", hieß es in der Mitteilung weiter. Die westfälische Präses Annette Kurschus würdigte die Kirchenmusik in einer Stellungnahme als "Seele unseres kirchlichen Lebens". Man brauche gut ausgebildete Kirchenmusiker, die sich auf mehrere Sprachen der Musik verstünden. Hier wolle die westfälische Kirche "ein deutliches und starkes Zeichen setzen".
Kurschus erwartet "starkes Zeichen" für eine gute Ausbildung
Die Kirchenleitung hatte den Angaben zufolge verschiedene Alternativen der Kirchenmusikausbildung diskutiert. Darunter sei der mögliche Umzug der beiden Standorte Herford (Klassik) und Witten (Pop) nach Bochum gewesen, ebenso die Beibehaltung und Sanierung der bisherigen Standorte. Angesichts der "zukunftsweisenden Bedeutung" der Entscheidung wolle man sich zusätzliche Zeit nehmen, um die Chancen der verschiedenen Optionen und die finanziellen Risiken weiter zu prüfen. Die Kosten eines Neubaus auf dem Gelände der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum hatte die Landeskirche mit rund 16,5 Millionen Euro veranschlagt - die Sanierungskosten in Herford sollen nicht viel niedriger liegen.
Der Bochumer Superintendent Gerald Hagmann sprach sich für ein "mutiges Engagement der Landeskirche" für die kirchenmusikalische Ausbildung aus, insbesondere im Bereich der klassischen Musik. Dabei gehe es auch um die Zukunft des evangelischen Gottesdienstes und die "zentrale Rolle" der Kirchenmusik im gesamten kirchlichen Leben, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dennoch sei klar, dass alle Investitionen "gerade in der gegenwärtigen Zeit" gut überlegt und mit Augenmaß erfolgen müssten.
Der Herforder Superintendent Olaf Reinmuth wertete die Entscheidung als eine "Vorsichtsmaßnahme", die "gerade in unkalkulierbaren Pandemiezeiten" nötig sei. Mit einer Entscheidung für Bochum oder Herford wäre "ein hervorstechendes Bekenntnis zur kirchenmusikalischen Ausbildung verbunden gewesen", sagte Reinmuth dem epd. Man werde sehen müssen, wie groß die Bereitschaft zum finanziellen und organisatorischen Engagement in die Zukunft der Ausbildung sei. Offen ist nach Ansicht des Superintendenten auch, ob mit dem Aufschub "der mögliche Standort Herford wieder Boden in der Diskussion gewonnen hat".
Die Hochschule für Kirchenmusik bietet seit 1948 in Herford eine klassische Kirchenmusik-Ausbildung an. 2016 wurde ergänzend in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Pop-Akademie in Witten der neue Studiengang "Kirchenmusik Popular" in Witten eingeführt. Mit den beiden Studiengängen bietet die Hochschule nach eigenen Angaben bundesweit das derzeit größte Studienangebot der evangelischen Kirchenmusik an. Rund 60 Studierende sind aktuell eingeschrieben.
Theologiestudierende fordern Studienreform
Hannover (epd). Evangelische Theologiestudierende fordern in einer Petition eine umfangreiche Reform ihrer Hochschulausbildung. Es gebe erhebliche Nachteile im Vergleich zu einem Bachelor- oder Master-Studiengang, erklärte am 20. April die Initiatorin und Vikarin Juliane Borth aus der hannoverschen Landeskirche: "Das Studium und das Examen haben sehr wenig miteinander zu tun." Der Studiengang evangelische Theologie mit Abschluss Examen müsse verändert werden.
Die Petition habe innerhalb von wenigen Tagen rund 1.000 Unterschriften erhalten, fügte Borth hinzu: "Sie wurde über 15.000 Mal aufgerufen und über 500 Mal geteilt." So viel Resonanz in einem so kleinen Studiengang sei immens. Es zeige, wie "groß der Leidensdruck" der betroffenen Nachwuchspastorinnen und -pastoren sei. Mit Blick auf den zu erwartenden Pastorenmangel sei vor allem eine Reform des Examens mit seinen zurzeit sehr hohen Anforderungen und nicht mehr zeitgemäßen Prüfungsformen dringend erforderlich.
"Ich frage mich deshalb schon lange, weshalb diese absolut hierarchische, oft patriarchale und in weiten Teilen drangsalierende Prüfungsform nach wie vor so praktiziert wird", erklärte Borth. Verschiedene Initiativen, am Examen zu arbeiten führten leider immer nur "ins Nichts oder zu Verschlimmbesserungen".
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes belegten im Sommersemester 2020 rund 13.000 Studierende das Fach Evangelische Theologie. Allerdings streben davon bei weitem nicht alle ein Examen an, das in den Pfarrberuf führen kann.
Holger Gemba erneut Landesvorsitzender der westfälischen Männerarbeit
Schwerte (epd). Landesvorsitzender der westfälischen Männerarbeit bleibt der Dozent für Slawistik an der Ruhr-Universität Bochum, Holger Gemba. Die Landesvertretertagung der Männerarbeit wählte in einer Videokonferenz den Landesvorstand der westfälischen Männerarbeit, wie das Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Kirche in Schwerte mitteilte. Gemba wurde in seinem Amt wiedergewählt. Der neue Vorstand nehme im Mai seine Arbeit auf und werde im Sommer bei einer Klausur Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre entwickeln.
Gemba, der Mitglied der westfälischen und der EKD-Synode ist, unterstrich nach seiner Wiederwahl die Bedeutung der Männerarbeit. In einer Zeit, in der viele Männer der Kirche den Rücken kehrten, brauche es engagierte Ehrenamtliche und ein starkes Team aus Hauptamtlichen, damit es attraktive Angebote und ansprechende Formate für Männer geben könne, sagte er. Zugleich unterstütze die Männerarbeit alle Bemühungen, zusammen mit dem Frauenreferat die Arbeit noch stärker um die Gender-Perspektive zu erweitern."
Herner Altsuperintendent Röber gestorben
Herne (epd). Der frühere Superintendent des Kirchenkreises Herne, Klaus-Peter Röber, ist tot. Röber, der von 1985 bis 2004 an der Spitze des Kirchenkreises stand, am 10. April im Alter von 81 Jahren, wie die westfälische Landeskirche am 22. April mitteilte. Der Theologe kam 1968 in die Kirchengemeinde Rauxel und wurde 1972 zudem Synodalassessors im Kirchenkreis. 1985 wählte ihn die Kreissynode zum Superintendenten. Dieses Amt übte er zusammen mit dem Pfarramt in Rauxel bis zu seiner Pensionierung Ende 2004 nebenamtlich aus.
www.kk-herne.de
Lüdenscheid: Kirchengemeinde sieht weitere Menschen für Missbrauch verantwortlich
Lüdenscheid (epd). Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Brügge in Lüdenscheid geht nach den im vergangenen Jahr bekanntgewordenen Missbrauchsvorwürfen von weiteren Verantwortlichen aus. Die Arbeit des Interventionsteams habe deutlich gemacht, dass es zwar nur einen Beschuldigten gegeben habe, der sich der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung schuldig gemacht habe, erklärte das Presbyterium in einer Gemeindeversammlung am 21. April laut einer Mitteilung des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg. "Es gab aber weitere Verantwortliche, die nach derzeitigen Erkenntnissen eine Pflichtverletzung begangen haben", hieß es.
Im Sommer des vergangenen Jahres wurden Anschuldigungen des Missbrauchs gegen einen ehrenamtlichen Mitarbeiter öffentlich, der in einer Jugendgruppe der evangelischen Kirchengemeinde Brügge und zuvor im CVJM Lüdenscheid-West tätig war. Der angeschuldigte Mann beging Suizid. Zuvor war der Mann von allen ehrenamtlichen Tätigkeiten entbunden und ihm ein Hausverbot erteilt worden. Bislang haben sich nach Angaben der Gemeinde mehr als 20 Männer gemeldet, die Beschuldungen gegen den ehrenamtlichen Mitarbeiter erhoben haben.
Disziplinarverfahren gegen Pfarrer eröffnet
Die gewonnenen Indizien und Beweise des Interventionsteams seien zusammengestellt und an die beschlussfassenden Gremien weitergereicht worden, erklärte das Presbyterium. Die vorgelegten Ergebnisse seien bewertet worden. Zudem habe es Beschlüsse mit Konsequenzen für Menschen geben, die einer Pflichtverletzung beschuldigt würden. Auf der Ebene der Landeskirche seien Disziplinarverfahren gegen Pfarrer eröffnet worden.
Die Opfer hätten ein Recht auf Aufklärung, damit das Geschehene aufgearbeitet werden könne, erklärte das Presbyterium. Die Betroffenen hätten auch Namen von möglichen Mitwissenden genannt. Nun müssten hierzu Schuld, Versäumnisse oder Pflichtverletzungen festgestellt werden. Das würden in diesem Fall kirchliche Gerichte tun. Für die staatlichen Behörden gelte mit dem Suizid des Beschuldigten, dass es keinen Täter mehr gebe. Damit seien Ermittlungen und Aufklärung von staatlicher Seite beendet worden.
Die Kirche wolle jedoch weiter Aufklärung und Aufarbeitung, bekräftigte das Presbyterium. Klar sei, dass eine Wiedergutmachung der schrecklichen Vorkommnisse unmöglich sei. Aber es gebe das Recht, die sexuelle Gewalt, die Menschen erfahren haben, aufzuklären und aufzuarbeiten. Wann diese Aufklärungsarbeit beendet sein werde, sei derzeit noch nicht absehbar. Alle Betroffenen hätten die Möglichkeit, sich bei der Landeskirchlichen Beauftragten für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung, Kirchenrätin Daniela Fricke, zu melden. Das Leitungsgremium der Gemeinde hatte im Februar eine Mitschuld eingeräumt und die Betroffenen um Verzeihung gebeten.
Axel Wermke als badischer Synodalpräsident wiedergewählt
Karlsruhe (epd). Die badische Landessynode hat den bisherigen Synodalpräsidenten Axel Wermke in seinem Amt bestätigt. Zu seinen Stellvertretern sind bei der digitalen Frühjahrstagung die Synodalen Karl Kreß und Ilse Lohmann gewählt worden, wie die badische evangelische Landeskirche am 21. April in Karlsruhe mitteilte. Der 71-jährige Wermke gehört seit 1990 der Landessynode an, im Oktober 2014 wurde er zum Präsidenten gewählt.
Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh gratulierte Wermke zur Wiederwahl und würdigte dessen "klare und freundlich-verbindliche Art". Er setze immer wieder geistliche Impulse und strahle eine heitere Gelassenheit aus.
Die Synode ist eines von vier kirchenleitenden Gremien neben dem Landesbischof, dem Landeskirchenrat und dem Oberkirchenrat. Das Kirchenparlament vertritt rund 1,12 Millionen Protestanten von Wertheim im Norden bis zum Bodensee im Süden.
Seehofer ernennt neuen evangelischen Bundespolizei-Dekan
Hannover (epd). Frank Waterstraat wird neuer Dekan für die evangelische Seelsorge in der Bundespolizei. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ernannte den 58-jährigen Polizeipfarrer aus Hannover zum Nachfolger des bisherigen Bundespolizei-Dekans Helmut Blanke, der das Amt acht Jahre lang ausgeübt hatte, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am 23. April mitteilte. Die Ernennung des langjährigen verantwortlichen Pastors für die Polizeiarbeit in Niedersachsen erfolgte auf Vorschlag des EKD-Beauftragten für die Seelsorge in der Bundespolizei, Landesbischof Karl-Hinrich Manzke aus Bückeburg. Waterstraat soll sein Amt zum 1. Mai antreten.
Der Dekan hat die Dienstaufsicht über die 17 haupt- und nebenamtlichen Geistlichen. Zudem ist er verantwortlich für die Leitung und Koordination der Seelsorgearbeit in den Dienststellen der Bundespolizei. Dienstsitz ist das Bundespolizeipräsidium Potsdam.
Neuer Pfarrer tritt Amt an Dresdner Frauenkirche an
Dresden (epd). Der Freiburger evangelische Pfarrer und Stadtdekan Markus Engelhardt (59) tritt am 1. Mai sein neues Amt in der Dresdner Frauenkirche an. Er folgt auf Pfarrer Sebastian Feydt, der seit Herbst 2020 Superintendent des Kirchenbezirkes Leipzig ist. Die feierliche Einführung ist für den 9. Mai geplant, wie die Stiftung Frauenkirche Dresden am 19. April mitteilte. Geplant sei ein Präsenzgottesdienst in kleinem Rahmen, der per Livestream übertragen werden soll.
Engelhardt war seit 2007 Stadtdekan in Freiburg. Zu seinen neuen Aufgaben gehört, die Frauenkirche weiter als Ort gesellschaftspolitischer Diskurse und der Friedens- und Versöhnungsarbeit zu schärfen. Engelhardt wuchs in Heidelberg auf, studierte Theologie in Bern, Erlangen und Tübingen.
Die Frauenkirche hat keine eigene Gemeinde im klassischen Sinne, sondern verbindet mit Gottesdiensten und anderen Angeboten Einheimische und Touristen. Jährlich besuchen die in den 1990er Jahren nach barockem Vorbild wiederaufgebaute und 2005 geweihte Kirche etwa zwei Millionen Menschen. Die zweite Pfarrstelle hat Pfarrerin Angelika Behnke inne.
Gesellschaft
Publizist Brumlik für neue Definition von Antisemitismus

epd-bild/Thomas Lohnes
Berlin (epd). Der Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik wirbt für eine neue Definition von Antisemitismus. Die bisher vielfach genutzte Arbeitsdefinition der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken (IHRA) von 2016 könne dazu führen, "jegliche Kritik an der israelischen Siedlungs- und Besatzungspolitik als antisemitisch zu brandmarken", sagte Brumlik dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Ein neuer Vorschlag, die "Jerusalemer Erklärung", korrigiere diese Gefahr einer "missbräuchlichen und falschen Verwendung". Er unterscheide deutlich zwischen politischer Kritik an der israelischen Regierung und Judenfeindlichkeit im Allgemeinen.
Die vierseitige "Jerusalemer Erklärung" war Ende März von mehr als 200 internationalen Holocaustforscherinnen und -forschern, darunter Brumlik, veröffentlicht worden. Antisemitismus wird darin bestimmt als "Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden (oder jüdische Institutionen als jüdische)" und in 15 Leitlinien genauer beschrieben. Die Definition der IHRA stammt aus dem Jahr 2016, die Bundesregierung schloss sich ihr 2017 an. Sie besagt unter anderem, dass Erscheinungsformen von Antisemitismus sich auch gegen den Staat Israel richten können, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird.
Der neuen Erklärung zufolge schlägt Israel-Kritik dann in Antisemitismus um, "wenn etwa behauptet wird, was Israel mit den Palästinensern mache, sei genauso schlimm wie das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben", wie Brumlik, Seniorprofessor am Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg, erklärte. "Oder wenn gesagt wird, dass dieser Staat von der Landkarte verschwinden müsse - das sind typische Fälle von wirklichem israelbezogenen Antisemitismus." Hingegen sei faktenbasierte Kritik wie die Forderung nach einem Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlandes in diesem Sinne nicht antisemitisch.
Felix Klein lobt Bemühen
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete auf epd-Anfrage das Bemühen um eine neue Antisemitismus-Definition als Belebung des Diskurses und als Beitrag, die Aufmerksamkeit für das Problem der Judenfeindlichkeit zu erhöhen. Er betonte jedoch zugleich, dass die IHRA-Definition international auf breiter Basis anerkannt sei und eine "einzigartige Form der Legitimation" genieße.
Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland würdigte, dass die Unterzeichner der "Jerusalemer Erklärung" die Debatte fortführten. Leitlinie sei und bleibe aber die IHRA-Arbeitsdefinition, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster dem epd. Sie mache es möglich, "Antisemitismus in all seinen Erscheinungsformen effizient zu bekämpfen", und sei in der Praxis sehr gut anzuwenden.
Mit Blick auf die umstrittene BDS-Kampagne sagte Brumlik, Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) seien gängige und gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten und im Falle Israels nicht per se antisemitisch. "Das gilt unabhängig davon, ob man die Ansicht gutheißt oder nicht", betonte der 73-jährige emeritierte Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er hoffe darauf, dass eine künftige Bundesregierung oder Parlamentsmehrheit die Bundestagsresolution zu BDS von 2019 zurückziehen werde. Der Bundestag hatte im Mai 2019 den Israel-Boykott der BDS-Bewegung verurteilt und deren Argumentationsmuster und Methoden als antisemitisch gewertet.
Projekt gegen Antisemitismus im Sport gestartet
Frankfurt a.M. (epd). Der jüdische Sportverein Makkabi Deutschland will Antisemitismus im Sport stärker bekämpfen. Die Makkabi-Mitglieder verschiedener nationaler und religiöser Herkunft erlebten wegen des Davidsterns auf dem Trikot immer mehr Feindseligkeiten, sagte der Präsident Alon Meyer am 19. April in Frankfurt am Main. "Wir alle müssen aufstehen gegen das, was auf deutschen Fußballplätzen geschieht." Makkabi Deutschland habe daher zusammen mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland und der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf das Projekt "Zusammen1 - Für das, was uns verbindet" gestartet. "Mit dem Sport müssen wir lauter für die Demokratie und gegen Antisemitismus werden", forderte Meyer. Das Bundesfamilienministerium hat das Projekt in das Förderprogramm "Demokratie Leben!" aufgenommen.
39 Prozent der Mitglieder von Makkabi haben nach Angaben des Vereins mindestens einen antisemitischen Vorfall erlebt, im Fußball sogar 68 Prozent. Dazu gehörten Beschimpfungen, das Zeigen des Hitlergrußes, die Absage eines anderen Vereins für ein Testspiel mit der Begründung: "Wir spielen nicht gegen Juden", sogar Tritte und Schläge. Die überwiegende Anzahl der Anfeindungen komme von Menschen arabisch-muslimischer Herkunft, sagte Meyer. Es gebe aber auch Antisemitismus von Personen ohne Migrationshintergrund.
"Rote Karte" für Antisemitismus
"Wer ausgrenzt und diffamiert, tritt die Werte des Fußballs mit den Füßen", betonte Günter Distelrath, Vizepräsident für Qualifizierung und Integration des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Für antisemitische Äußerungen darf es keine Toleranz geben, nur die Rote Karte!", sagte er. In allen DFB-Bezirken gebe es Ansprechpartner gegen Diskriminierung. Die U18-Fußballmannschaft spiele regelmäßig in Israel und besuche dort die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Distelrath versicherte dem Projekt "Zusammen1" die Unterstützung des DFB.
"Uns geht es um einen fairen, offenen und respektvollen Sport für alle", sagte der Projektleiter Luis Engelhardt. Das Projekt mit fünf Mitarbeitern solle das Feld des Antisemitismus im Sport genauer erfassen, politische Bildung gegen Antisemitismus vermitteln und Veränderung herbeiführen. So sollten antisemitische Vorfälle in den Spielberichten der Schiedsrichter genauer erfasst werden.
Das Projekt organisiert nach den Worten von Engelhardt Online-Seminare und Workshops für Sportler, Schiedsrichter, Verbandsvertreter und Fanprojekte. "Wir wollen wirksamere Strukturen gegen Antisemitismus schaffen", sagte er. Makkabi Deutschland hat nach eigenen Angaben mehr als 5.500 Mitglieder und 39 Ortsvereine in Deutschland. Die Vereine sind für Sportler jeder Konfession und Nationalität geöffnet und bieten eine Vielzahl von Sport- und Spielarten an.
Peter Fischer und Makkabi erhalten Buber-Rosenzweig-Medaille
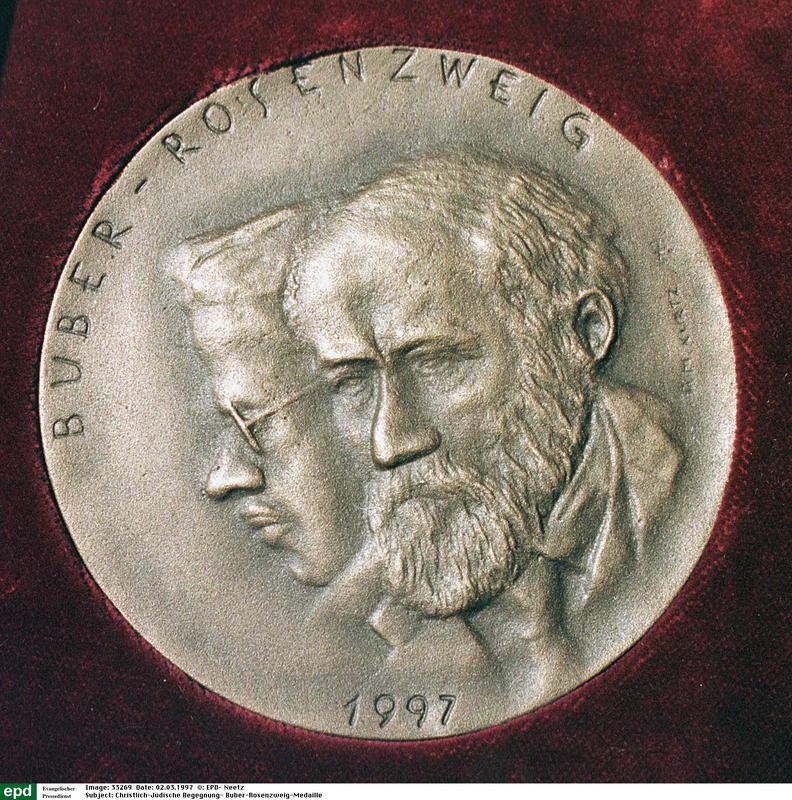
epd-bild / Norbert Neetz
Bad Nauheim, Frankfurt a.M. (epd). Peter Fischer, Präsident des Sportclubs Eintracht Frankfurt, und der jüdische Sportverband Makkabi Deutschland werden für ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille 2022 ausgezeichnet. Die Preisverleihung finde am 6. März 2022 zur Eröffnung der "Woche der Brüderlichkeit" in Osnabrück statt, teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit am 22. April in Bad Nauheim mit. Die "Woche der Brüderlichkeit" steht im kommenden Jahr unter dem Motto "Fair Play - Jeder Mensch zählt". Die Medaille ist nach den jüdischen Philosophen Martin Buber (1878-1965) und Franz Rosenzweig (1886-1929) benannt.
Der Sport sei in vielen Aspekten ein Spiegelbild der Gesellschaft, erklärte der Koordinierungsrat. Insbesondere Antisemitismus und Rassismus, aber auch andere Formen der Benachteiligung forderten den Sport wie die Gesellschaft heraus. "Hier gilt es Gesicht zu zeigen und aktiv zu werden, um sich für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einzusetzen."
Ein Vorbild dafür sei der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer. Er habe sich mit seiner "klaren Haltung gegen rechts, gegen Antisemitismus und Rassismus im Sport wie in der Gesellschaft" einen Namen gemacht. Fischer habe die intensive Aufarbeitung der NS-Geschichte der Frankfurter Eintracht mit angestoßen und dafür gesorgt, dass der Verein die Arbeitsdefinition Antisemitismus der Internationalen Allianz zum Holocaustgedenken (IHRA) übernommen habe. Anlässlich des ersten Jahrestages des rassistischen Anschlags in Hanau hätten die Eintracht-Fußballer beim Aufwärmen zum Spiel gegen Bayern München Trikots mit den Namen der Ermordeten getragen.
"Sport als Brücke zwischen Menschen"
Der Sportverband Makkabi Deutschland stehe in besonderer Weise dafür ein, "Sport als Brücke zwischen Menschen zu sehen", lobte der Koordinierungsrat. Der Verband bringe Menschen unabhängig von Religion, Herkunft oder Hautfarbe im Sport zusammen. So schaffe er "eine Plattform für das Kennenlernen der verschiedenen Kulturen und Lebenswelten". Makkabi verstehe Sport als Ort der Vermittlung von demokratischen Werten wie Integration, Inklusion und des Kampfes gegen Antisemitismus und Rassismus. "Makkabi steht mit seinem ganzen Wirken für eine Gesellschaft ein, in der die Würde jedes Menschen geachtet wird."
Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich von den deutschen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Bisherige Preisträger waren unter anderen der Erziehungswissenschaftler und Publizist Micha Brumlik, der Schriftsteller Navid Kermani, der Architekt Daniel Libeskind, der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, und der Musiker Peter Maffay. Die Medaille für 2021 erhielt der Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl.
Der Deutsche Koordinierungsrat vertritt als bundesweiter Dachverband die mehr als 80 Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Deutschland auf nationaler und internationaler Ebene.
Lamya Kaddor fordert neue Debatte über deutsche Identität

epd-bild/Dominik Asbach
Dortmund (epd). Die Religionspädagogin und Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor sieht Deutschland auf dem Weg zu einer demokratischen Minderheitengesellschaft. Diesen Prozess gelte es so zu gestalten, dass dabei keine soziale Gruppe verdrängt oder ausgegrenzt werde, sagte Kaddor am 21. April bei einer Online-Veranstaltung. "Alle müssen an einem Tisch sitzen und über das diskutieren, was uns hier zusammenhält", forderte die Wissenschaftlerin, die auf Einladung des Evangelischen Bildungswerks sprach.
Eine intensive Debatte über deutsche Identität sei "gerade jetzt bitter nötig", mahnte Kaddor. Die dazu nach dem Zweiten Weltkrieg definierten Vorstellungen seien längst von der Wirklichkeit überholt. Allen Versuche, eine "deutsche Leitkultur" festzulegen, erteilte sie dabei eine Absage. Sie würden schnell zu Klischees führen wie "Bier, Sauerkraut, Volksmusik" oder auch "Pünktlichkeit und Fleiß", erklärte die Wissenschaftlerin. Auch das Christentum sei keine verbindende gesellschaftliche Klammer, denn es weiche immer stärker einem säkularen Humanismus, sagte die Religionspädagogin. Zugleich bleibe es aber ein wichtiger Teil Deutschlands: "Jeder hier Lebende sollte es kennen."
"Der nationalistische Glaube ist Selbstbetrug"
Der nationalistische Glaube an die "Reinheit" eines Volkes nach dem Prinzip "deutsch ist, wer deutsche Eltern hat" ist ihrer Ansicht nach dagegen Selbstbetrug, weil zahlreiche Deutsche nichtdeutsche Vorfahren haben: "Das menschliche Genom ist keine Grundlage für soziales Zusammenleben." Schon heute, so Kaddor, sei Deutschland ein ethnisches Mosaik. Gebraucht werde deshalb ein Einwanderungs- und Integrationsministerium. Sie betonte, dass zugewanderte Menschen sich an die Grundrechte halten müssen, die das deutsche Grundgesetz definiert.
Lamya Kaddor, die als Kind syrischer Eltern in Deutschland 1978 im westfälischen Ahlen geboren wurde, engagiert sich sowohl gegen Islamismus als auch gegen Islamfeindlichkeit. Als Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes wird sie von militanten Muslimen gleichermaßen angefeindet und bedroht wie von Rechtsradikalen. Die Muslimin will sich davon nicht einschüchtern lassen. "Hassprediger aller Art sind eine Minderheit", sagte sie. Rassismus komme außerdem in allen Gesellschaften vor. Aufgabe sei es, die Extrempositionen an den Rand zurückzudrängen, betonte Kaddor, die bei der Bundestagswahl im September für die Grünen kandidiert.
"Notbremse": Merkel bittet Bevölkerung um Unterstützung
Berlin (epd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die neue Corona-"Notbremse" als dringend notwendig verteidigt. Die vorgesehenen Maßnahmen seien zwar hart, sagte sie am 24. April in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Es gebe aber keine weniger belastenden Wege, um die dritte Corona-Welle zu brechen und umzukehren. Merkel appellierte an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. "Wenn es uns jetzt gelingt, die Infektionen deutlich und schnell zu senken, sind in absehbarer Zeit Lockerungen Schritt für Schritt möglich", erklärte sie. "Lassen Sie uns jetzt noch einmal das Notwendige tun und alle zusammen Rücksicht und Verantwortung zeigen."
Deutschland sei mitten in der dritten Welle, betonte die Kanzlerin. Die ansteckendere Virusvariante habe sich auch hierzulande durchgesetzt, das Robert Koch-Institut melde jeden Tag so hohe Zahlen von Neuinfektionen und Intensivpatienten wie in den angespanntesten Tagen des Winters. "Und was wir von Ärzten und dem Pflegepersonal hören, das sind wahre Hilferufe", sagte sie. "Wir - der Staat, die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger - wir alle müssen helfen."
Das neue Infektionsschutzgesetz ist seit dem Wochenende in Kraft. Es sieht unter anderem eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr in Landkreisen und kreisfreien Städten vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an drei Tagen hintereinander überschreitet.
Diskriminierung von Migranten hat in Pandemie zugenommen
Erlangen (epd). Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen auf Einwanderer und Flüchtlinge. Die Ergebnisse einer Studie des Forschungsbereichs Migration, Flucht und Integration am Institut für Politische Wissenschaft der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen zeigen, dass sie in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Gesundheit und Bildung mehr benachteiligt sind. Außerdem hätten Diskriminierungen zugenommen, sagte die Leiterin des Projekts, Professorin Petra Bendel, am 20. April.
Zugewanderte Menschen sind der Studie zufolge an ihrem Arbeitsplatz häufig stärker gefährdet, sind seltener fest angestellt sind und können seltener zu Hause arbeiten. Zugleich arbeiteten Migranten und geflüchtete Menschen häufig in systemrelevanten Berufen, zum Beispiel in Supermärkten, in der Landwirtschaft oder in Reinigungsfirmen, hieß es.
Beim Thema Infektionsschutz habe sich in der Pandemie gezeigt, dass in Sammelunterkünften der Infektionsschutz und Hygiene schwieriger zu realisieren seien. Masken und Impfstoffe müssten für besonders Gefährdete, unter denen auch Geflüchtete seien, besser zugänglich sein.
Suche nach "Sündenböcken"
Die Suche nach "Sündenböcken" für die Ausbreitung des Virus oder eine verschlechterte wirtschaftliche Lage hätten Nachkommen von Eingewanderten, Migranten und Geflüchteten zur Zielscheibe gemacht, heißt es in der Untersuchung. Bendel forderte daher präventive, rassismuskritische Bildungsarbeit, nicht nur in Schulen, sondern auch in Betrieben und Behörden.
Geschlossene Grenzen führten zu prekären Lebensbedingungen besonders für gestrandete Flüchtlinge, sagte Bendel. Humanitäre Aufnahmeprogramme und Familienzusammenführungen sollten schnell wieder aufgenommen werden. Nicht genutzte Kontingente des Resettlementprogramms müssten auf 2021 übertragen werden, sagte sie.
Zahl der dokumentierten Hinrichtungen weiter gesunken
London, Berlin (epd). Die Zahl der weltweit dokumentierten Hinrichtungen ist laut Amnesty International im vergangenen Jahr erneut gesunken. Damit habe sich der jährliche Rückgang seit 2015 fortgesetzt, erklärt die Menschenrechtsorganisation in ihrem am 21. April veröffentlichten Todesstrafen-Bericht. Registriert wurden demnach mindestens 483 Hinrichtungen in 18 Ländern, im Jahr zuvor waren es 657 Exekutionen in 20 Ländern.
Nicht in die Zahlen eingeflossen sei aber erneut die Entwicklung in China, betont Amnesty International. Dort sei auch für 2020 von Tausenden Hinrichtungen auszugehen - mehr als im Rest der Welt zusammen. China behandele die Daten allerdings als Staatsgeheimnis, so dass sie auch diesmal wie in den Vorjahren nicht in dem Bericht berücksichtigt worden seien. Auch in Nordkorea, Vietnam und Syrien gebe es nur sehr eingeschränkten Zugang zu Informationen.
Bei den dokumentierten Fällen waren die Länder mit den meisten Hinrichtungen der Iran (mindestens 246), Ägypten (mindestens 107), der Irak (mindestens 45), Saudi-Arabien (27) und die USA (17). Der deutliche Rückgang der Gesamtzahl um 26 Prozent liege vor allem an weniger Hinrichtungen im Irak und in Saudi-Arabien, in denen 2019 mindestens 100 beziehungsweise 184 Vollstreckungen der Todesstrafe gemeldet worden waren. Gleichzeitig habe es 2020 eine "alarmierende Zunahme" in einigen Ländern gegeben. So hätten sich die Zahlen in Ägypten mehr als verdreifacht (2019: mindestens 32).
Aufschub wegen Corona-Pandemie
In einigen Ländern habe die Corona-Pandemie für den Aufschub von Hinrichtungen gesorgt, heißt es in dem Bericht. So seien etwa in den USA mehrere Vollstreckungen der Todesstrafe mit Verweis auf die Pandemie aufgeschoben worden - zugleich habe die Regierung unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aber im Juli begonnen, nach 17 Jahren Pause wieder Exekutionen auf Bundesebene zu vollziehen. Auch in Singapur seien Exekutionen zunächst gestoppt worden.
Verzögerungen bei den Strafverfahren und Einschränkungen wegen Corona trugen laut Amnesty International indes zum deutlichen Rückgang bei den neu verhängten Todesstrafen bei. Für 2020 verzeichneten die Menschenrechtler mindestens 1.477 neue Todesurteile aus rund 50 Ländern, 36 Prozent weniger als 2019. Damals waren es 2.307 gewesen.
Corona habe die Grausamkeit der Todesstrafe noch einmal unterstrichen, erklärt die Menschenrechtsorganisation in dem Bericht: Viele Gefangene in Todeszellen hätten über lange Zeit keine sozialen Kontakte und nur eingeschränkten Zugang zu ihren Rechtsvertretern gehabt.
Dennoch habe 2020 gezeigt, dass die Welt insgesamt einen Schritt weiter gekommen sei weg von der Todesstrafe. Im Mai habe der Tschad die Todesstrafe abgeschafft, im Herbst habe Kasachstan sich dazu entschieden. Saudi-Arabien habe angekündigt, außer in Terrorismusfällen keine Todesstrafen mehr für Personen zu verhängen, die zur Tatzeit unter 18 waren. In den Ländern Bahrain, Belarus, Japan, Pakistan, Singapur und dem Sudan, aus denen 2019 Hinrichtungen gemeldet worden waren, seien 2020 keine Vollstreckungen der Todesstrafe registriert worden. Weltweit haben nach Angaben von Amnesty International 144 Länder die Todesstrafe per Gesetz oder in der Praxis abgeschafft.
Die Faust des Genossen

epd-bild / Rolf Zöllner
Saarbrücken, Potsdam (epd). Ausgerechnet Erich Honecker hatte offenbar wenig gegen eine Wiedervereinigung. Freilich nicht in der Art, wie sie sich letztlich vollzog. Ihm habe so etwas vorgeschwebt wie das Modell "Ein Land, zwei Systeme". So erinnert sich Oskar Lafontaine. "Die DDR wäre dann erst einmal DDR geblieben und die BRD die BRD", sagt der Vorsitzende der Fraktion der Linken im saarländischen Landtag und ehemalige Bundesvorsitzende der Linkspartei, "aber die DDR hätte sich dann Schritt für Schritt transformiert."
Honecker, der vor 50 Jahren an die Spitze von SED und DDR trat, gilt heute als der Mann, der die DDR taten- und ideenlos untergehen ließ. Aber der Honecker-Biograf Martin Sabrow, Historiker am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, glaubt das nicht. Honecker habe "noch eine Karte im Spiel" geglaubt, erklärt Sabrow: ein Wahlsieg das damaligen SPD-Manns Lafontaine über den CDU-Kanzler Helmut Kohl - wonach es in den Umfragen lange aussah. Mit dem neuen Kanzler, so Honeckers vage Hoffnung, hätte er dann eine Föderation von BRD und DDR anstreben können.
Der Kontakt zum Saarland
Schon seit Mitte der 1980er Jahre waren Honecker und Lafontaine, damals SPD-Ministerpräsident des Saarlands, im Gespräch gewesen. "Er war ja auch Saarländer, das hat vieles erleichtert", erzählt Lafontaine. Zunächst sei es darum gegangen, dass die DDR Stahl und Wein von der Saar kaufte, später um Städtepartnerschaften, Kultur-, Sport- und Jugendaustausch sowie um Familienzusammenführungen. Das habe auch gut geklappt. Später sei es darum gegangen, wie es nach der Bundestagswahl 1990 hätte weitergehen können. Allzu konkret seien die Gespräche aber nicht gewesen, sagt Lafontaine: "Es gab da keinen Vertrag zwischen uns oder so etwas." Insbesondere die Frage, wie die DDR gestützt werden könne, bis sie sich transformiert habe, sei kein Thema gewesen.
Am 3. Mai 1971 hatte das Zentralkomitee der SED Walter Ulbricht von seinem Amt als Erster Sekretär entbunden. Honecker wurde der neue starke Mann der DDR - und das weckte bei den Menschen dort Hoffnungen. "Honecker verkörperte so etwas wie jugendliche Begeisterung", sagt der Historiker Sabrow. Nicht nur deshalb, weil er als Gründungsvorsitzender die staatliche Jugendorganisation "Freie deutsche Jugend" (FDJ) geleitet hatte. Der neue Mann versprach soziale Wohltaten und mehr Wohnungen. Er sorgte dafür, dass die jungen DDR-Bürger Jeans kaufen konnten. Ein bisschen Liberalisierung leuchtete schwach am Horizont. Ulbricht hatte zum Beispiel Westfernsehen strikt abgelehnt. Honecker hingegen bemerkte achselzuckend: "Das kann bei uns jeder ein- und ausschalten."
Aber ebenso wenig wie Honecker am Ende seiner Amtszeit ein untätiger Greis war, war er zu Beginn ein Hoffnungsträger. Ulbricht hatte schon erfahren, dass Honecker nicht der liebe Genosse Erich war, sondern eine eiserne Faust besaß. Denn der Kreml hatte Ulbricht auch auf Betreiben Honeckers fallengelassen. Ulbricht habe die DDR für den Geschmack Moskaus zu eigenständig machen wollen, vor allem der Außen- und Deutschlandpolitik, erläutert Ilko-Sascha Kowalzcuk, Historiker beim Stasi-Unterlagen-Archiv in Berlin. Honecker habe also gar nicht für Aufbruch gestanden, sondern für Starre, sagt er: "Ulbricht war der Reformer, Ziehsohn Honecker der Ausbremser und Reaktionär."
Auf Protest folgt Repression
So zerstoben die Hoffnungen bald. "Die Symbole des Aufbruchs zerbröckeln 1976 und 1977", sagt Sabrow. Bei mehreren Gelegenheiten wurde klar, dass die Liberalisierung für Honecker enge Grenzen hatte. Im August 1976 verbrannte sich der Pfarrer Oskar Brüsewitz auf offener Straße in Zeitz. Im November desselben Jahres ließ die DDR den Liedermacher Wolf Biermann nach einer Konzertreise in die Bundesrepublik nicht mehr ins Land. Und im September 1977 veröffentlichte ein bislang wenig bekannter SED-Funktionär namens Rudolf Bahro ein Buch namens "Die Alternative", in der er mit dem praktizierten Sozialismus abrechnete.
In allen Fällen berichteten Westmedien breit, und insbesondere für Biermann machten sich viele Intellektuelle der DDR öffentlich stark. In der Folge verschärften die Sicherheitsbehörden die Repression - aber nicht so brachial wie noch unter Ulbricht. "Die Verfolgung wurde verborgener, ausgefeilter", beschreibt Sabrow die Situation.
"Die Realität Honeckers war die einer 'gated community'"
Honecker lebte abgeschottet in der Siedlung Wandlitz bei Berlin. Die allgegenwärtige Knappheit, unter der seine Untertanen zu leiden hatten, schien er gar nicht wahrzunehmen. "Die Realität Honeckers war natürlich die einer 'gated community'", sagt Sabrow. Der Historiker glaubt aber nicht, dass Honecker - wie mitunter behauptet - in seiner Parallelwelt nichts von der dramatischen Lage mitbekommen habe: "Die Politikerkaste war sehr gut informiert." Honecker hatte Vorschläge vom Chef der Staatlichen Plankommission vorliegen, wonach die DDR den Lebensstandard um 30 Prozent senken müsse, um nicht auf längere Frist zahlungsunfähig zu werden. Solche Pläne fegte er aber vom Tisch und sagte, er wolle so etwas nie wieder hören.
Die Idee einer Föderation von BRD und DDR erledigte sich, weil dem ostdeutschen Staat viel weniger Zeit blieb, als Honecker - oder die allermeisten anderen Menschen damals - sich vorstellen konnten. Wie aussichtsreich diese Idee gewesen sein mag, hätte die DDR länger bestanden, ist dem Forscher Sabrow zufolge schwer zu bewerten: "Rückblickend scheint sie absurd, für Honecker mochte sie eine ernsthafte Zukunftsoption dargestellt haben." Auch Oskar Lafontaine hält sich mit einem Urteil über die Verwirklichungschancen lieber zurück, gibt aber zu bedenken, dass sie die Fortsetzung einer Politik gewesen wäre, die bereits funktionierte: "Das war nicht nur eine spinnerte Utopie."
Friedensforscher: Globale Rüstungsausgaben auf Höchststand
Die globalen Militärausgaben haben im vergangenen Jahr einen Rekordwert erreicht. Die USA bleiben mit Abstand das Land mit dem größten Rüstungsetat. Deutschland belegt Vergleich Rang sieben - hinter Saudi-Arabien und vor Frankreich.Frankfurt a.M., Stockholm (epd). Die globalen Rüstungsausgaben haben Friedensforschern zufolge einen neuen Höchststand erreicht. Die Staaten weltweit investierten im vergangenen Jahr insgesamt 1.981 Milliarden US-Dollar (etwa 1.644 Milliarden Euro) in ihre Streitkräfte, wie das schwedische Sipri-Institut in Stockholm mitteilte. Das sei ein Anstieg von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2019. Damit sind die Ausgaben das sechste Jahr in Folge gewachsen. Am stärksten haben die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien aufgerüstet. Zusammen stehen die fünf Länder für 62 Prozent der globalen Militärinvestitionen. Deutschland belegt Platz sieben hinter Saudi-Arabien.
Der Anstieg erneute erfolgte zur gleichen Zeit, in der das weltweite Bruttoinlandsprodukt insbesondere wegen der Covid-19-Pandemie um 4,4 Prozent sank. Laut Sipri entsprach die Gesamtsumme der Militärausgaben im vergangenen Jahr einem Anteil von 2,4 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Verglichen mit 2019 war das ein Plus von 0,2 Prozent und zugleich der größte Anstieg binnen eines Jahres seit der weltweiten Finanzkrise 2009.
USA mit größtem Budget
Die USA haben erneut mit deutlichem Abstand das größten Budget für Rüstungsgüter. Demnach wuchsen die US-Ausgaben im vergangenen Jahr auf 778 Milliarden Dollar. Das war ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber 2019 und entspricht einem Weltanteil von 39 Prozent. Die Gelder flossen vor allem in die militärische Forschung sowie in Langzeit-Projekte zur Modernisierung von Atomwaffenarsenalen und groß angelegten Waffenkäufen. Ein Grund sei wachsende Besorgnis über empfundene Bedrohungen durch strategische Konkurrenten wie China und Russland, erklärte Sipri-Forscherin Alexandra Marksteiner.
Auf Platz zwei liegt China, das vergangenes Jahr geschätzte 252 Milliarden US-Dollar für Rüstungsgüter ausgab. Gegenüber 2019 war das ein Plus von 1,9 Prozent. Im Vergleich zu 2011 bedeute dies ein Anstieg von 76 Prozent. Damit wuchsen Pekings Militärausgaben das 26. Jahr in Folge. Laut Sipri-Forscher Nan Tian spiegelt diese Entwicklung Chinas langfristige Pläne zur militärischen Modernisierung und Erweiterung wider.
Dahinter folgt Indien, das seine Rüstungsinvestitionen um 2,1 Prozent auf knapp 73 Milliarden US-Dollar steigerte. Die Ausgaben Russlands (Platz vier) wuchsen um 2,5 Prozent auf 61,7 Milliarden Dollar. Großbritannien (Platz fünf) investierte im vergangenen Jahr 59,2 Milliarden Dollar. Das waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr, aber 4,2 Prozent weniger als 2011. Deutschland (Rang sieben) gab 52,8 Milliarden Dollar (ungefähr 44 Milliarden Euro) für Rüstung aus, ein Plus von 5,2 Prozent. Gegenüber 2011 war das ein Zuwachs von 28 Prozent.
Laut den Autorinnen und Autoren des Berichts beliefen sich die Rüstungsinvestitionen jener Staaten, die im globalen Ranking die Plätze 1 bis 15 einnehmen, im vergangenen Jahr auf insgesamt 1.603 Milliarden US-Dollar. Darunter sind sechs Nato-Mitglieder: USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada. Mit einer Gesamtsumme von 995 Milliarden US-Dollar stehen diese sechs Länder 50 Prozent der weltweiten Militärausgaben. Insgesamt investierten die 29 Nato-Mitglieder 1.103 Milliarden US-Dollar in ihre Streitkräfte.
Mit insgesamt 18,5 Milliarden US-Dollar fielen die Rüstungsetats der afrikanischen Länder südlich der Sahara vergleichsweise gering aus. Das war ein Zuwachs von 3,4 Prozent gegenüber 2019. Der Tschad steigerte seine Investitionen in Militär und Rüstung um 31 Prozent, Mali um 22 Prozent, Mauretanien um 23 Prozent, Nigeria um 29 Prozent und Uganda gar um 46 Prozent. Derweil sanken die Ausgaben in elf Ländern des Nahen Ostens, zu denen Sipri Daten vorliegen, um insgesamt 6,5 Prozent auf 143 Milliarden US-Dollar.
Kirchlicher Aktionstag gegen Atomwaffen in hybrider Form in Büchel
Bonn, Büchel (epd). Der vierte kirchliche Aktionstag gegen Atomwaffen am Fliegerhorst Büchel in der Eifel setzt coronabedingt am 3. Juli auf Angebote in Präsenz und digital. Um 11.58 Uhr soll es einen ökumenischen Gottesdienst in der Nähe des Haupttores geben, wie der Verein für Friedensarbeit am 20. April in Bonn mitteilte. Die Predigt werde der Präsident von Pax Christi Deutschland, Bischof Peter Kohlgraf, halten. Auch die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und westfälische Präses, Annette Kurschus, werde mitwirken. Am Fliegerhorst Büchel sollen die letzten US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland lagern.
Der Präsenzgottesdienst richtet sich den Angaben zufolge vor allem an Menschen aus der Region, um die Teilnehmerzahl pandemiebedingt begrenzt zu halten. Ein Livestream sei wiederum für Interessierte außerhalb der Eifel vorgesehen - ebenso sollen die geplanten Kultur- und Redebeiträge als Videos im Netz verfügbar sein, hieß es.
Livestream
Im vergangenen Jahr musste der kirchliche Aktionstag komplett virtuell stattfinden. Kurschus und Kohlgraf hielten Grußworte, ein Film zeigte die bisherigen Aktionstage am Fliegerhorst Büchel. Beim Start der kirchlichen Aktionstage 2018 war der damalige EKD-Friedensbeauftragte Renke Brahms vor rund 500 Menschen zu Gast, 2019 hielt die frühere EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann einen Gottesdienst vor mehr als 1.000 Teilnehmern.
Die verantwortliche Projektgruppe "Kirchen gegen Atomwaffen" hat sich im Dezember 2017 auf Initiative des badischen Forums Friedensethik gebildet. Ihr gehören den Angaben zufolge derzeit Christinnen und Christen aus den evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck, der Pfalz, Westfalen, dem Rheinland und Württemberg sowie Mitglieder der katholischen Friedensbewegung Pax Christi an.
Bamf-Affäre: Prozess gegen Ex-Behördenchefin eingestellt
Bremen (epd). Das Verfahren gegen die frühere Chefin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vor dem Landgericht Bremen ist am 20. April wegen Geringfügigkeit ohne einen Schuldspruch eingestellt worden. Allerdings muss die Angeklagte eine Geldauflage von 10.000 Euro zahlen. "Das bedeutet, man geht schon von einer Schuld aus, sonst wäre das Verfahren ja durch einen Freispruch zu beenden gewesen", sagte der Sprecher des Landgerichts, Thorsten Prange. Alle Verfahrensbeteiligten hätten der Vereinbarung zugestimmt. (AZ: 2 KLs 311 Js 71761/17)
Der heute 60-jährigen Frau wurde 2018 vorgeworfen, für rund 1.200 Flüchtlinge unrechtmäßig positive Asylbescheide ausgestellt zu haben. Von diesen Vorwürfen blieben nach den Ermittlungen letztlich 14 Fälle von Verstößen gegen das Dienstgeheimnis, Dokumentenfälschung und Vorteilsnahme übrig, bestätigte Prange.
Neben der ehemaligen Behördenchefin ist auch ein Rechtsanwalt angeklagt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in zwei Fällen Ausländer zur missbräuchlichen Asylantragstellung verleitet zu haben. Außerdem soll er in vier Fällen Ausländer eingeschleust haben. Auch sein Verfahren hätte nach Ansicht des Gerichts gegen eine Geldauflage von 5.000 Euro eingestellt werden können. Allerdings habe der Angeklagte die Auflage abgelehnt, berichtete Prange. Zudem wolle die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Juristen fortsetzen.
Die 2018 begonnenen Ermittlungen gegen die ehemalige Bremer Bamf-Chefin hatten auch deshalb für großes Aufsehen gesorgt, weil sie vor dem Hintergrund des Streits um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geführt wurden. In der Folge entließ Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Präsidentin des Bamf, Jutta Cordt.
Letzter Flug mit Flüchtlingen aus Griechenland angekommen
Der vorerst letzte Flug mit Flüchtlingen aus den Lagern auf den griechischen Inseln ist in Deutschland angekommen. Niedersachsen fordert Bundesinnenminister Seehofer auf, humanitäre Verantwortung zu übernehmen und weitere Flüchtlinge zu holen.Hannover, Berlin (epd). Gut ein Jahr nach der Zusage der großen Koalition zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Griechenland ist am 22. April der letzte Flug mit Schutzbedürftigen in Deutschland angekommen. An Bord des Flugzeugs nach Hannover waren 103 Flüchtlinge, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Seit April 2020 habe Deutschland damit insgesamt 2.765 Personen aus Griechenland aufgenommen und so seine Aufnahmezusagen erfüllt. Bei der zuletzt eingereisten Gruppe handelte es sich dem Ministerium zufolge um 21 Familien mit 48 Erwachsenen und 55 Minderjährigen.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf, die Flüge fortzusetzen: "Solange in Griechenland keine akzeptablen Zustände herrschten, "müssen wir weiterhin humanitäre Verantwortung übernehmen". Auch die Organisation Pro Asyl forderte die Bundesregierung auf, weiterhin Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. "Weder das Dauerfesthalten auf griechischen Inseln noch Abschiebungen zurück in die Türkei sind eine menschenrechtskonforme Lösung", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. Die griechischen Inseln würden zu "Zonen der Perspektivlosigkeit".
7.000 Menschen in provisorischem Lager
Wegen der verheerenden Bedingungen in vielen griechischen Flüchtlingslagern hatte die Bundesregierung in mehreren Schritten Aufnahmen zugesagt: Am 8. März 2020 hatte der Koalitionsausschuss die Aufnahme von Kindern von den griechischen Inseln beschlossen. Im April startete die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger, im Sommer wurde das Programm erweitert um Familien mit Kindern, die dringend eine medizinische Behandlung brauchen.
Nach dem Brand des Camps Moria auf Lesbos wurden weitere Aufnahmezusagen gemacht, zuletzt für rund 1.500 bereits in Griechenland anerkannte Flüchtlinge. Niedersachsen hat insgesamt 329 Menschen aus Griechenland aufgenommen. Weitere Aufnahmen aus dem Land sind derzeit nicht geplant.
Pistorius hatte im Herbst 2019 noch vor dem Brand das Flüchtlingslager besucht und setzt sich seitdem für die Aufnahme besonders schutzbedürftiger Kinder ein. Die Lage auf der griechischen Insel sei für die Flüchtlinge jedoch nach wie vor prekär. So sei das neue Camp, das europäischen Standards genügen soll, immer noch nicht fertigstellt. Berichten zufolge harren dort noch knapp 7.000 Menschen in einem provisorischen Zeltlager aus.
Stipendienprogramm startet mit rund 50 Studenten aus Afrika
Bonn (epd). Das Stipendienprogramm "Leadership for Africa" startet mit den ersten 51 Stipendiaten aus Afrika. Das Programm ermöglicht jungen Talenten aus afrikanischen Ländern mit hohen Flüchtlingszahlen ein Masterstudium in Deutschland, wie der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) am 19. April in Bonn mitteilte. Die Auswahl der Stipendiaten fand in Kooperation mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) statt. Das Programm des DAAD richtet sich an anerkannte Flüchtlinge, die ihren Lebensmittelpunkt in Äthiopien, Kenia, Uganda und dem Sudan haben, sowie an Bachelorabsolventen dieser Länder. Das Auswärtige Amt fördert das Programm mit rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr.
Ab dem kommenden Wintersemester starten den Angaben zufolge 19 Flüchtlinge und 32 weitere Bachelorabsolventen aus Äthiopien, Kenia, Uganda und dem Sudan an einer deutschen Hochschule. Die Stipendiaten erhalten ein Stipendium zur Finanzierung ihres Masterstudiums an einer deutschen Hochschule. Der DAAD unterstützt sie bei der Suche nach dem passenden Studiengang und beim Einschreibeprozess. Zudem gebe es ein Begleitprogramm mit Kursen zu Demokratieverständnis, Rechtsstaatlichkeit sowie nachhaltiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung. Beworben hatten sich den Angaben zufolge 510 interessierte junge Menschen, davon 109 anerkannte Flüchtlinge.
Ein Studium in Deutschland biete mehr als einen reinen Bildungsabschluss, sagte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee. Es verschaffe vielen Menschen die Chance eines beruflichen und gesellschaftlichen Aufstiegs.
Bildung sei für viele junge Flüchtlinge der Schlüssel zu einer besseren Zukunft, erklärte Katharina Lumpp, UNHCR-Vertreterin in Deutschland. Programme, die diesen jungen Talenten Chancen eröffnen, seien angesichts vieler unterbrochener Bildungswege wegen der Corona-Pandemie wichtiger denn je. Deutschland sei sich der schwierigen Situation vieler Flüchtlinge bewusst und gehe gemeinsam mit seinen Partnern neue und nachhaltige Wege zur Unterstützung dieser Menschen, sagte die Staatsministerin für internationale Kultur- und Bildungspolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering (SPD).
Weniger Zuzug nach NRW
Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr einen vergleichsweise schwächeren Zuzug von Neubürgern erlebt. Aus benachbarten Bundesländern und aus dem Ausland zogen im vergangenen Jahr 364.000 Männer und Frauen nach NRW, wie das Statistische Landesamt am 19. April in Düsseldorf mitteilte. Das waren 80.100 (18 Prozent) weniger Zuzüge als im Vorjahr. 2019 waren 444.025 Menschen nach NRW gezogen. Die Zahl der Fortzüge lag im vergangenen Jahr mit 343.500 um 53.300 beziehungsweise 13 Prozent unter dem Ergebnis von 2019. Damals hatten 396.769 Menschen das Bundesland verlassen.
Auch wenn im Jahr 2020 noch 20.500 Personen mehr nach Nordrhein-Westfalen zogen als das Land verließen, so fiel der sogenannte Wanderungsüberschuss weniger als halb so hoch aus wie im Vorjahr. Der Saldo aus Zu- und Fortzügen lag 2019 bei 47.300. Die Zahlen für 2020 basieren auf vorläufigen Ergebnissen der Wanderungsstatistik.
Die Statistiker verweisen darauf, dass die Wanderungsbewegungen im vergangenen Jahr durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Einreisebeschränkungen und Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr maßgeblich beeinflusst wurden. Vor allem Zu- und Fortzüge ins oder aus dem Ausland, aber auch Umzüge innerhalb Deutschlands unterblieben oder wurden aufgeschoben.
US-Umfrage: Impfbereitschaft hängt von Religion ab
Washington (epd). In den USA bestehen laut einer Studie bei der Impfbereitschaft Unterschiede zwischen den Religionsgemeinschaften. Jüdische Bürger und weiße Katholiken erklärten am ehesten, sie würden sich gegen Covid-19 impfen lassen oder seien bereits geimpft, heißt es in einem am 22. April veröffentlichten Bericht des Meinungsforschungsinstituts "Public Religion Research Institute" (PRRI). Bei der Erhebung vom März zeigten sich weiße Evangelikale am meisten zögerlich.
58 Prozent von 5.625 befragten US-Amerikanern sagten, sie wollten sich schnellstmöglich impfen lassen oder sie seien bereits geimpft. 19 Prozent wollten warten, um zu sehen, wie der Impfstoff bei anderen Menschen wirkt. Neun Prozent wollten nur im Fall einer Impfpflicht auf der Arbeit oder für andere Aktivitäten mitmachen. 14 Prozent gaben an, sie würden sich definitiv nicht impfen lassen.
Menschen mit höherer Bildung und der Demokratischen Partei nahestehende Befragte sind laut Studie impfbereiter als Republikaner und als Bürger mit geringerer Bildung.
85 Prozent der jüdischen Befragten gaben an, sie seien geimpft oder würden sich so bald wie möglich impfen lassen. Bei weißen Katholiken waren es 68 Prozent, bei weißen sogenannten Mainline Protestanten 63 Prozent, bei Menschen ohne religiöse Bindung 60 Prozent, bei schwarzen Protestanten 49 Prozent, bei weißen Evangelikalen 45 Prozent und bei Latino-Protestanten 43 Prozent. Den größten Anteil der Impfverweigerer gab es bei den weißen Evangelikalen mit 26 Prozent.
PRRI-Gründer Robert Jones erklärte, die Einstellung zur Religion werde bei der Haltung zum Impfen häufig vernachlässigt. Bei schwarzen Protestanten sei die Impfbereitschaft größer, wenn die Gläubigen Gottesdienste besuchten. Bei weißen evangelikalen Gottesdienstbesuchern hingegen sei die Impfbereitschaft geringerer. Zahlreiche schwarze Pastoren haben sich demonstrativ impfen lassen. Weiße evangelikale Pastoren seien "zurückhaltender" beim Impfthema.
Parlamentarisches Begleitgremium zur Corona-Pandemie nimmt Arbeit auf
Düsseldorf (epd). Im nordrhein-westfälischen Landtag wird sich künftig ein Unterausschuss mit Themen rund um die Corona-Pandemie befassen. In seiner ersten Sitzung konstituiert sich am 20. April in Düsseldorf das Parlamentarische Begleitgremium Covid-19-Pandemie, das als Unterausschuss des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales fungiert. Der Unterausschuss, der auf fraktionsübergreifenden Antrag von CDU, SPD, FDP und Grünen eingerichtet wurde, versteht sich als interdisziplinär ausgerichtetes Gremium und soll gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Fragen der Bewältigung und Eindämmung der Corona-Pandemie behandeln, wie die Grünen-Fraktion erklärte. Das Begleitgremium soll auch Gutachten vergeben, wissenschaftliche Expertise von Fachleuten einholen sowie zu Anhörungen einladen können.
Umwelt
Holz statt Stahlbeton für Klimaschutz

epd-bild/Annette Zoepf
Berlin, Wuppertal (epd). Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich führende Experten für eine radikale Wende beim Gebäudebau ausgesprochen. Der Baussektor sei ein Schlüsselsektor zur Erreichung der weltweiten Klimaziele, sagte der Gründer und Direktor Emeritus des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Hans Joachim Schellnhuber, am 21. April in Berlin. Das Bauen, Betreiben und Abreißen von Gebäuden trage zu etwa 40 Prozent der globalen Treibhausgas-Emissionen bei.
Diese Dimension sei in der Klimadebatte und von Entscheidungsträgern bislang zu wenig berücksichtigt worden. "Wenn wir die gebaute Umwelt nicht in die Klimagleichung einbeziehen, dann haben wir keine Chance, die Zwei-Grad-Linie von Paris zu halten", betonte Schellnhuber.
Bauressort für die Themen ländlicher Raum und Baukultur
Der Klimaforscher forderte von einer neuen Bundesregierung zudem die Schaffung eines eigenen Bauressorts: "Bislang fristet der Baubereich in der deutschen Politik ein Stiefkinddasein." Künftig müsse es ein zentrales Ressort geben, das auf die Themen ländlicher Raum und Baukultur ausgerichtet ist: "Das ist ein absolutes Zukunftsthema und sollte genauso auch gewichtet werden in einer neuen Bundesregierung."
Gemeinsam mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, und der Architektur-Professorin der Universität Wuppertal, Annette Hillebrandt, stellte Schellnhuber eine neue Initiative mit dem Titel "Bauhaus der Erde" vor. Aufgerufen wird darin zu einer "grünen Bauhaus-Bewegung des 21. Jahrhunderts".
Die Initiative fordert unter anderem die Substitution von Stahlbeton durch organische Baustoffe wie Holz oder Bambus. Damit könnten erhebliche Mengen an klimaschädlichen Emissionen vermieden werden. Zudem würden organische Baustoffe klimaschädliches Kohlendioxid speichern. "Mit regenerativer Architektur könnten wir uns quasi aus der Klimakrise herausbauen", sagte Schellnhuber.
Plädoyer für nachhaltige Forstwirtschaft
"Der Gebäudebereich hinkt beim Klimaschutz in Deutschland noch hinterher", sagte Messner. Es sei offensichtlich, dass hinsichtlich Primärenergiebedarf und Treibhausgaspotenzial grundsätzlich die Holzbauweise besser abschneidet als die Massivbauweise. Die ungenutzten Potenziale des Holzbaus müssten gehoben werden.
Mit einer Bauwende verbunden werden müsse zudem eine nachhaltige Forstwirtschaft, betonten die Experten. Grundvoraussetzung für das nachhaltige Bauen mit Holz sei zudem der Einsatz von international einheitlich zertifiziertem Holz, welches durch funktionierende Lieferketten-Trackingsysteme die Herkunft aus Schutzgebieten eindeutig ausschließe.
Hillebrandt unterstrich, dass zur Senkung der CO2-Emissionen und des immensen Abfallaufkommens aus dem Bausektor auch Baubestand erhalten werden müsse. Für eine Weiternutzung von Gebäuden sollten nachwachsende Baustoffe rückbau- und recyclingfreundlich eingesetzt werden. Mit jedem Haus müsse der Welt etwas zurück gegeben werden. "Müll - damit meine ich auch CO2 - ist ein Designfehler!", erklärte die Architektur-Professorin.
UN: Klimawandel schreitet trotz Corona-Krise voran
Die stark verminderten wirtschaftlichen Aktivitäten sowie der Einbruch beim globalen Verkehr hätten nicht zu einer Entspannung beim Klimawandel geführt, erklären die Vereinten Nationen.New York, Genf (epd). Der Klimawandel schreitet laut den Vereinten Nationen trotz der Corona-Krise unablässig voran. Die stark verminderten weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten sowie der Einbruch beim globalen Verkehr hätten nicht zu einer Entspannung beim Klimawandel geführt, teilten die UN am 19. April in New York bei der Veröffentlichung des Weltklimaberichts 2020 mit.
Die Industrie sowie Fahrzeuge und andere Transportmittel sind durch den Ausstoß von Treibhausgasen Haupttreiber der Erderwärmung. UN-Generalsekretär António Guterres und der Generalsekretär der Weltwetterorganisation, Petteri Taalas, sollten den Report präsentieren. Laut der Studie war 2020 eines der drei wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen.
Auch die Abkühlung 2020 in einigen Regionen durch das Wetterphänomen La Niña habe die weitere Erwärmung nicht stoppen können. Das Phänomen La Niña tritt etwa in Südamerika auf. Die globale Durchschnittstemperatur 2020 habe 1,2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Zeitalter (1850 bis 1900) gelegen.
Mehr extreme Wettersituationen
Der Klimawandel habe im vergangenen Jahr zu einem vermehrten Auftreten sogenannter extremer Wettersituationen wie Stürmen, massiven Niederschlägen und Dürren geführt. Diese extremen Wettersituationen hätten schwere Schäden angerichtet, wie etwa die sintflutartigen Regenfälle und Überschwemmungen in der afrikanischen Sahelzone. Auch habe die Trockenheit in den südamerikanischen Ländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay große wirtschaftliche Verluste verursacht.
Den Angaben zufolge wurden ab 2015 die sechs wärmsten Jahre gemessen. Ebenso handele es sich bei dem Jahrzehnt von 2011 bis 2020 um die Dekade mit den höchsten jemals erfassten Temperaturen. Die UN betonten, dass 2020 die Grenzabriegelungen, Betriebsschließungen und Ausgangssperren im Zuge der Corona-Krise die Effekte des Klimawandels wie Ernteausfall noch verschlimmert hätten. Der Hunger habe sich stärker ausgebreitet und humanitäre Hilfe habe die Bedürftigen nicht erreichen können.
Einigung auf neues EU-Klimaziel für 2030
Die Verhandler der verschiedenen EU-Institutionen haben einen Deal besiegelt, der den Treibhausgasausstoß der Union in den nächsten Jahren stark senken soll.Brüssel (epd). Die EU setzt sich für 2030 ein neues Klimaziel von mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgasen als 1990. Nach einer Nachtsitzung einigten sich Unterhändler von Europaparlament und Ministerrat am frühen 21. April auf das entsprechende Gesetz, das noch von Parlamentsplenum und Rat bestätigt werden muss. Umweltschützern geht die Marke nicht weit genug.
Bei dem neuen Ziel hat sich der Ministerrat als Vertretung der Regierungen in wichtigen Punkten durchgesetzt. Er wollte minus mindestens 55 Prozent Emissionen, wie es auch die Kommission vorgeschlagen hatte, während das Europaparlament auf minus 60 Prozent aus war. Außerdem handelt es sich nun, wie vom Rat gewollt, um ein Netto-Ziel. Damit kann die Aufnahme von Treibhausgasen durch sogenannte Senken wie zum Beispiel Wälder bis zu einer bestimmten Höhe angerechnet werden. Der reine Ausstoß muss deswegen nicht um 55 Prozent zurückgehen.
Die Einigung beinhaltet auch das weniger umstrittene langfristige Ziel der Klimaneutralität für 2050. Ab der Jahrhundertmitte dürften dann nicht mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, als durch Senken aufgenommen werden.
EU-Ratspräsidentschaft erfreut
Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft zeigte sich erfreut. Man könne stolz auf ein ehrgeiziges Klimaziel sein, erklärte Umweltminister João Pedro Matos Fernandes. Auch Kommissionschefin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung, ebenso wie der CDU-Klimaexperte und Europaabgeordnete Peter Liese, der sie "historisch" nannte.
In Berlin lobten sowohl Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) die Einigung. Altmaier erklärte: "Wir haben mit klaren langfristigen Zielsetzungen jetzt die einmalige Chance, Klimaschutz und Wirtschaft gemeinsam voranzubringen und zu versöhnen." Schulze forderte: "Für Deutschland bedeutet der Beschluss, dass auch wir unser Tempo beim Klimaschutz deutlich erhöhen werden. Der Ausbau von Sonnen- und Windkraft muss beschleunigt werden, der Kohleausstieg wird schneller kommen als bisher geplant."
Kritik kam von den Grünen, der Europaabgeordnete Michael Bloss äußerte: "Das Europäische Klimagesetz reicht nicht, um die Pariser Klimaziele zu erreichen." Auch Umweltschützer zeigten sich unzufrieden. "Am Ende steht leider nur ein weichgespülter Kompromiss", erklärte der WWF Deutschland. Laut Greenpeace ist die Einigung "nicht viel besser als business as usual".
Das Klimagesetz mit den Marken für 2030 und 2050 wird den Rahmen für die EU-Klimapolitik setzen. Ausgefüllt werden muss es durch konkrete Maßnahmen. Hierzu will die EU-Kommission im Juni oder Anfang Juli ein Gesetzespaket vorlegen. Dabei dürfte es unter anderem um eine Ausweitung des Emissionshandels gehen. Mit Blick auf die konkreten Maßnahmen machte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) bereits geltend, Industrie und Energiewirtschaft hätten bereits "überproportional zur Emissionsminderung beigetragen. Auch die anderen Sektoren müssen jetzt ihren fairen Beitrag leisten".
Umwelt-Forderungskatalog zur Bundestagswahl vorgestellt
Berlin/Moers (epd). Natur- und Tierschutzorganisationen fordern von der künftigen Bundesregierung eine deutliche Anhebung des deutschen Klimaziels auf mindestens 70 Prozent Treibhausgas-Minderung bis 2030. Dazu gehöre ein Kohleausstieg bis 2030 ohne weitere Kompensationen an die Energierkonzerne, heißt es in einem am 22. April in Berlin vorgestellten Forderungskatalog von 35 deutschen Organisationen zur Bundestagswahl im September. Bislang ist der Kohleausstieg bis spätestens 2038 geplant.
Zu den weiteren Forderungen gehören ein Ende der Neuzulassungen für Pkw mit Verbrennungsmotoren vor 2030 sowie eine Anhebung des Ausbaupfades für erneuerbare Energien auf 80 Prozent bis 2030. Bis 2035 müsse der Strombedarf in Deutschland vollständig aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.
Umbau der Agrarpolitik im Einklang mit Tier- und Naturschutz
Notwendig sei auch ein konsequenter Umbau der Agrarpolitik im Einklang mit dem Tier-, Natur- und Klimaschutz. So müssten die Bäuerinnen und Bauern für ihre Gemeinwohlleistungen entsprechend bezahlt werden und Agrarflächen der öffentlichen Hand dürften nicht mehr privatisiert werden. Finanziert werden soll das Ganze durch einen konsequenten Umbau der 52 Milliarden Euro umweltschädlicher Subventionen.
Hinter dem Forderungskatalog stehen den Angaben zufolge etwa elf Millionen Mitglieder. Zu den Organisationen gehören unter anderem der Deutsche Naturschutzring (DNR), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (Nabu), Greenpeace, WWF, Germanwatch oder der Bundesverband Tierschutz mit Sitz in Moers.
Aktuelles Ziel der amtierenden Bundesregierung ist, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Die Treibhausgasneutralität soll in Deutschland bis 2050 erreicht werden. Das ist den Organisationen zu wenig.
Der politische Kompass müssten die internationalen Klimaziele sein, sagte die Vorstandsvorsitzende von Germanwatch, Silvie Kreibiehl: "Wir brauchen ganz klare politische Eingriffe, eine neue Art des Politikmachens." Die nächsten vier Jahre würden maßgeblich darüber entscheiden, ob es gelingen werde, die globale Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad Celsius zu begrenzen und das Artensterben zu beenden.
"Egal in welcher Konstellation: Die nächste Bundesregierung hat den klaren Auftrag, das Land aus der Coronakrise, der Biodiversitätskrise und der Klimakrise zu führen", sagte DNR-Präsident Kai Niebert. Mit ihrem Forderungspapier legten die Organisationen ein Programm vor, um ökologische Industriepolitik konsequent mit einem neuen Gesellschaftsvertrag zu verknüpfen. "Die beste Zeit, die Krisen anzupacken, war gestern, die zweitbeste Zeit ist heute", betonte Niebert.
Bündnis: Kennzeichnungspflicht auch für neue Gentechnik
Schwerte (epd). Ein Bündnis aus den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft und Kirchen warnt vor einer Aufweichung der Definition von Gentechnik. Alle derzeitigen wie künftigen Gentechnikmethoden sowie die daraus entstehenden gentechnisch veränderten Organismen müssten weiterhin unter dem bestehenden EU-Gentechnikrecht reguliert und gekennzeichnet werden, heißt es in einem am 21. April in Schwerte veröffentlichten Positionspapier. Unterzeichnet ist das Papier von insgesamt 94 Organisationen wie "Brot für die Welt", Misereor, Bioland, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace und Foodwatch.
Positionspapier von 94 Organisationen
Seit Jahren lobbyierten Industrie und Gentechnik-Befürworter dafür, neue Gentechnikverfahren von der Gentechnik-Gesetzgebung auszunehmen, erklärte das Bündnis. Sie wollten damit die derzeitige Definition von Gentechnik aufweichen. Das gefährde die Wahlfreiheit und die Sicherheit von Mensch und Umwelt, warnte das Bündnis. Auch für neue Gentechnik müsse das Vorsorgeprinzip weiterhin gelten. Die Wahl- und Gentechnikfreiheit müsse durch Kennzeichnung und Transparenz, Zulassung und Rückverfolgbarkeit gesichert bleiben.
"Wir haben noch keine langjährige Erfahrung mit den neuen Gentechnikmethoden", erklärte Gudrun Kordecki vom Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Kirche. Aus dem Vorsorgegedanken heraus sollten die gentechnisch veränderten Organismen nach dem Gentechnikrecht zugelassen werden, damit etwaige schädlichen Nebenwirkungen rechtzeitig erkannt würden. "Die Menschen haben ein Recht darauf, zu wissen, was sie essen", unterstrich Kordecki, die auch Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist.
Mehr als die Hälfte der Neubauten heizt mit erneuerbaren Energien
Düsseldorf (epd). Mehr als die Hälfte der im Jahr 2020 genehmigten Wohngebäude in Nordrhein-Westfalen soll überwiegend oder ausschließlich mit erneuerbaren Energien beheizt werden. 10.611 der insgesamt 18.367 neu geplanten Wohnhäuser verwendeten Biomasse, Biogas, Holz, Solaranlagen oder Wärmepumpen als primäre Heizenergie, teilte das Landesstatistikamt am 23. April in Düsseldorf mit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil der Bauvorhaben mit umweltschonenden Heizenergien damit von 50,6 auf 57,8 Prozent.
Den landesweit höchsten Anteil wies nach Angaben der Statistiker der Kreis Heinsberg auf: Dort setzten Bauherren bei den Neubauten in 79 Prozent der Fälle auf erneuerbare Energien. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Kreis Olpe (78,8 Prozent) und Bottrop (76,5 Prozent). In Düsseldorf (19,6 Prozent), Münster (31,8 Prozent) und Köln (33,3 Prozent) kamen im Jahr 2020 dagegen mehrheitlich konventionelle Heizenergien bei Neubauten zum Einsatz.
Stadt Bonn erhält vom Bund Förderscheck für Klimaprojekte in Kitas
Berlin/Bonn (epd). Pflegeheime, Krankenhäuser und Kindertagesstätten werden ab sofort vom Bund bei der Vorsorge gegen die Folgen der Erderwärmung finanziell unterstützt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) stellte am 22. April bei einer virtuellen Veranstaltung soziale Einrichtungen und Kommunen vor, die die ersten Förderschecks erhielten. Empfänger ist unter anderem die Stadt Bonn, die Klimakonzepte für Umbau und Sanierung von drei Kitas entwickeln will. Weitere 20 Kindertagesstätten der Kommune erhalten Beratung zu möglichen Maßnahmen der Klimaanpassung, vor allem Hitzeschutz.
Schulze betonte, die heißen Sommer der vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass der Klimawandel in Deutschland angekommen sei. Gerade für Pflegeheime und Krankenhäuser stellten sich besondere Herausforderungen, wenn Städte sich aufheizten und die Menschen unter Schlafmangel und Kreislauferkrankungen litten. Für wirkungsvolle Maßnahmen fehle es aber oft an Wissen, Zeit und Geld. Bis 2023 stehen daher für die "Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen" 150 Millionen Euro bereit, die Kommunen, gemeinnützige Vereinigungen und andere Träger im Gesundheits- und Sozialwesen abrufen können.
Neben der Stadt Bonn werden auch Einrichtungen aus Brandenburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen unterstützt. Mit den Mitteln können sie Vorsorgemaßnahmen finanzieren wie Dach- und Fassadenbegrünung, den Einbau von Fenstern mit Sonnen- und Wärmeschutzverglasung oder die Anschaffung von Schattenspendern wie Pavillons und Sonnensegel, aber auch Beratungen über passende Konzepte sowie die Weiterbildung ihrer Beschäftigten in Klimafragen.
Soziales
Bundestag debattiert über Sterbehilfe

epd-bild / Werner Krüper
Berlin (epd). Die Politik beschäftigt einmal mehr eine grundsätzliche Frage. Es geht um eine Form der Sterbehilfe, die Hilfe beim Suizid. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat den Gesetzgeber zum neuen Nachdenken gezwungen darüber, ob er im Sinne der Selbstbestimmung für den Zugang zu tödlich wirkenden Mitteln sorgen muss, im Sinne der Menschenwürde eher davor schützen muss - oder wie er beides in Einklang bringt. Am 21. April diskutierte das Parlament zwei Stunden in einer sogenannten Orientierungsdebatte darüber - offen, ernst, teils emotional und an keiner Parteilinie entlang.
Drei Vorschläge liegen dem Parlament bislang vor, nur einer ist formell als Entwurf in den Bundestag eingebracht. Hinter den Vorschlägen verbergen sich zwei Richtungen: Zwei Gruppen werben für eine Liberalisierung der derzeitigen Regelungen, indem sie Ärzten ausdrücklich erlauben wollen, tödlich wirkende Mittel auch zum Zweck der Selbsttötung zu verschreiben. Eine andere will mit einem Gesetz eher dafür sorgen, dass Suizide verhindert werden.
"Wir sollten uns als Gesetzgeber an die Seite der Menschen stellen, die selbstbestimmt sterben wollen", sagte die FDP-Gesundheitspolitikerin Katrin Helling-Plahr, die gemeinsam mit anderen, darunter Karl Lauterbach (SPD), einen entsprechenden Entwurf eingebracht hat. Einen ähnlichen Vorschlag haben Renate Künast und Katja Keul (Grüne) vorgelegt. Für diese Richtung sprach sich im Parlament neben anderem auch der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Edgar Franke (SPD), aus.
Eine andere Gruppe, von deren Vorschlag bislang nur Eckpunkte vorliegen, will im Gegensatz dazu bei der Strafbarkeit der geschäftsmäßigen, also organisierten, Hilfe beim Suizid bleiben und diese nur unter Bedingungen erlauben. "Hier muss der Gesetzgeber seinem Schutzauftrag nachkommen", sagte der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling. Die Gruppe befürchtet, dass mit einer Liberalisierung der Sterbehilfe eine Normalisierung eintritt, die Menschen zumindest subtil unter Druck setzt, die Möglichkeit auch anzunehmen. "Niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen", sagte Lars Castellucci (SPD), der die Eckpunkte mit ausgearbeitet hat.
Spahn will keine Werbung für Suizidassistenz
Diese Gruppe hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf ihrer Seite. Auch er fürchtet diesen Druck. "Eine solche Entwicklung wäre für unsere Gesellschaft fatal", sagte er und sprach sich für eine Regelung aus, die Suizidassistenz nur erlaubt, wenn Ärzte vorher aufklären, gemeinnützige Beratungsorganisationen mit eingebunden sind und Wartefristen eingehalten werden. Zudem soll die Werbung für Suizidassistenz verboten werden. So sehen es auch die Eckpunkte der Gruppe vor, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegen.
38 Abgeordnete kamen am 21. April mit jeweils dreiminütigen Reden zu Wort. Dabei äußerten sich mehr Abgeordnete für eine Regelung im Sinne der Gruppe um Heveling und Castellucci, ein repräsentatives Meinungsbild ist das aber nicht. Die Debatte wurde bewusst offen gestaltet, formelle Vorlagen gab es nicht. In jeder Fraktion gab es Befürworter der einen oder anderen Richtung.
Im Bundestag gibt es außerdem noch Unentschiedene. Claudia Moll (SPD) sagte in ihrer Rede, sie sei noch auf der Suche nach der richtigen Lösung. Als frühere Altenpflegerin habe sie Schmerz, Angst und Verzweiflung Sterbender hautnah miterlebt. Man müsse am Lebensende "nicht alles über sich ergehen lassen". Zugleich wolle sie keine Regelung, die Suizidhilfe "zu einer neuen Normalität des Sterbens macht".
Hintergrund der Debatte ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Februar vergangenen Jahres. Die Richter hatten das Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe bei der Selbsttötung gekippt. Sie urteilten, dass das Recht auf Selbstbestimmung auch das Recht umfasse, sich das Leben zu nehmen und dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Suizidassistenz leistet, wer einem Sterbewilligen ein todbringendes Medikament überlässt, aber nicht verabreicht.
Ob es noch in dieser Wahlperiode zu einer Neuregelung kommt, ist offen. "Es gibt zu viele offene Fragen, als dass ein komplettes Gesetzgebungsverfahren in den verbleibenden fünfeinhalb Sitzungswochen verantwortungsvoll machbar wäre", sagte der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser dem epd. Die Suizidassistenz könnte auch ein Thema für den neuen Bundestag werden.
Schwaetzer gegen Suizidbeihilfe in kirchlichen Heimen
Berlin/Bochum (epd). Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Irmgard Schwaetzer, bleibt bei ihrer Ablehnung von Hilfe bei der Selbsttötung in kirchlichen Einrichtungen. Man müsse sich fragen, "was bedeutet das für den Charakter eines diakonischen Heims, wenn da ein Sterbezimmer eingerichtet wird", sagte sie am 20. April in einem Streitgespräch der Evangelischen Akademie zu Berlin mit der Bochumer Theologie-Professorin Isolde Karle. Auch eine neutrale Beratung über Suizidassistenz könne es in kirchlichen Einrichtungen nicht geben. "Christliche Einrichtungen haben immer eine Beratung zum Leben", sagte die frühere FDP-Bundesministerin, die selbst ehrenamtliche Sterbebegleiterin ist.
Aus der Praxis wisse sie, "dass Sterbewünsche nicht aus heiterem Himmel fallen". Gründe seien unter anderem Einsamkeit oder Depression. Erste Aufgabe sei es, zu schauen, ob anders geholfen werden könne. Dafür könnten Lösungen gefunden werden. Bleibe jemand beim Wunsch nach Suizidassistenz, müssten Lösungen andernorts gesucht werden, etwa in einer "häuslichen Situation", sagte Schwaetzer.
Widerspruch von Theologin Karle
Karle widersprach. Sie finde es schwierig, wenn kirchliche Einrichtungen etwa an Sterbehilfeorganisationen verweisen würden. Die Theologin entfachte Anfang des Jahres gemeinsam mit anderen Vertretern aus Kirche und Diakonie die Debatte um Suizidassistenz mit einem öffentlichen Plädoyer, diese Form der Sterbehilfe für kirchliche Einrichtungen nicht gänzlich auszuschließen.
"Suizide kommen in der Diakonie vor", sagte Karle. Man könne nicht so tun, als sei das nicht so. Nach ihrem Vorschlag hätten sich Diakonie-Beschäftigte bei ihr gemeldet, die von Suizidversuchen mit Tabletten oder Stürzen aus dem Fenster in Heimen berichtet hätten. Das belaste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und müsse deshalb offen diskutiert werden, sagte sie.
Karle betonte zugleich, es müsse ein Schutzkonzept geben, um etwa vor Druck von außen zu schützen. Ihren Vorschlag beziehe sie ausschließlich auf todkranke Menschen, auch wenn das Bundesverfassungsgericht das Recht auf Hilfe beim Suizid nicht an Bedingungen wie Alter und Krankheit festmacht.
Das Bundesverfassungsgericht hatte im Februar 2020 das Verbot der organisierten - sogenannten geschäftsmäßigen - Hilfe bei der Selbsttötung gekippt. Die Richter urteilten, dass das Recht auf Selbstbestimmung auch das Recht umfasst, sich das Leben zu nehmen und dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Suizidassistenz leistet, wer einem Sterbewilligen ein todbringendes Medikament überlässt, aber nicht verabreicht.
EKD: Wohnen muss bezahlbar bleiben

epd-bild/Philipp Reiss
Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mehr Gerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt angemahnt. "Wohnen ist ein Grundbedürfnis", erklärte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm anlässlich der am 21. April veröffentlichten EKD-Schrift "Bezahlbar wohnen". Jeder Mensch "sollte sich eine Wohnung leisten können." Es sei an der Zeit, die Wohnungs- und Baupolitik neu in den Fokus zu rücken.
"Als Kirche und Diakonie nehmen wir die Nöte wahr, wenn der Verlust der Wohnung droht, Wohnungslosigkeit eingetreten ist oder wenn Kindern unter prekären Bedingungen der Entfaltungsraum fehlt - erst recht, wenn, wie jüngst unter Bedingungen der Corona-Pandemie, Kinder und Jugendliche keinen geschützten Raum für Homeschooling haben", fügte Bedford-Strohm hinzu.
Der EKD-Text richtet sich den Angaben zufolge an alle Akteure des Wohnungsmarktes. Verfasst wurde er von der EKD-Kammer für soziale Ordnung unter Vorsitz von Edeltraud Glänzer. "In den deutschen Ballungsgebieten und zunehmend auch in mittelgroßen Städten finden selbst Menschen mit mittlerem Einkommen kaum noch bezahlbaren Wohnraum", so Glänzer. Zu den Gründen zählten unter anderem der sich zuspitzende Bedarf an Wohnraum in Ballungsgebieten, zu langsames Bauen und vor allem die "Finanzialisierung des Immobilienmarktes", wobei vor allem die Knappheit des Bodens preistreibend wirke.
"Preisanstieg dämpfen"
Das wohnungspolitisch zu lösende Grundproblem bestehe darin, den "Preisanstieg zu dämpfen und für besonders bedürftige Teile der Bevölkerung Senkungen der Wohnkosten zu erreichen, auch wenn gleichzeitig die Marktkräfte stark in die Gegenrichtung wirken", erläutert Glänzer. Dabei müssten ökologische und ökonomische Aspekte des Wohnens zusammengedacht und nach Möglichkeit in Balance gebracht werden.
In dem Text geht es auch um Infrastruktur, Eigentum an Boden, Finanzierung, Mobilität, Bildung und Kultur. Reflektiert wird laut EKD auch die zivilgesellschaftliche Rolle von Kirche und Diakonie sowie deren eigenes Handeln auf dem Wohnungsmarkt.
Telefonseelsorge Saar: Einsamkeit und Angst am häufigsten genannt

epd-bild / Werner Krüper
Saarbrücken (epd). Die evangelisch-katholische Telefonseelsorge Saar hat im vergangenen Jahr die meisten Anrufe wegen Einsamkeit (27 Prozent) und Angst (15,2 Prozent) erhalten. Corona nannten zwar nur rund zwölf Prozent der Anrufenden, jedoch war es häufig Hintergrund der Anrufe oder verschärfte bestehende Probleme, wie es im am 26. April in Saarbrücken veröffentlichten Jahresbericht 2020 heißt. Insgesamt habe das Telefon 13.330 mal geklingelt (2019: 13.468), 11.488 Seelsorge- oder Beratungsgespräche habe es gegeben - etwa 2.500 mehr als 2019.
Angst scheint mit Blick auf die Corona-Pandemie "eine nur zu verständliche Reaktion" zu sein, hieß es. "Während die einen Angst vor Erkrankung und Tod haben, haben die anderen Angst vor finanziellen Katastrophen oder vor Einsamkeit und Einschränkungen ihrer Freiheit." Manche Ängste erschienen von außen verständlich und nachvollziehbar, ander könnten irrational oder übersteigert wirken. Gegen die Angst als "diffuses Köpererleben" könne es oft helfen, darüber zu sprechen und zu merken, nicht allein zu sein.
Spannungsabbau ermöglichen
"Das Aussprechen von bedrückenden Ängsten kann Spannungen abbauen", hieß es. "Gemeinsam ist es möglich, nach Ressourcen zu schauen, die wieder Struktur geben und Spannungsabbau ermöglichen."
Unter den Anrufenden machten Frauen einen Anteil von rund 59 Prozent aus, hieß es. 2019 waren es noch 76 Prozent. Vor allem jüngere Menschen hätten das Thema Angst als Anrufgrund genannt. Demnach lag der Anteil bei den unter 30-Jährigen bei rund 20,8 Prozent, bei den 30- bis 50-Jährigen bei 17,7 und bei den über 50-Jährigen bei rund 13,5 Prozent. Rund 59 Prozent der Anruferinnen und Anrufern lebten allein, etwa zwölf Prozent in einer Familie.
Bei der persönlichen Beratung gab es im vergangenen Jahr den Angaben zufolge 590 Kontakte. Der häufigste Anlass waren demnach Ängste mit 33,1 Prozent, gefolgt von familiären Beziehungen (20,7 Prozent) sowie Stress und Erschöpfung (20,5 Prozent). Außerdem schrieben die Seelsorgerinnen und Seelsorger 568 E-Mails und führten 379 Chats.
Die ökumenische Telefonseelsorge Saar weist zudem darauf hin, dass sie wieder Ehrenamtliche für Beratung am Telefon und online sucht. Nach den Sommerferien starte eine neue Ausbildungsgruppe, für die sich Interessierte bereits bewerben könnten.
Erste positive Bilanz zu Männer-Hilfetelefon in NRW und Bayern
Düsseldorf (epd). Das vor einem Jahr in Nordrhein-Westfalen und Bayern gestartete Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Männer hat sich nach Ansicht der zuständigen Ministerien bewährt: "Das neue Angebot wurde sehr schnell angenommen - entgegen den Befürchtungen und Vorurteilen, dass Männer keine Hilfe suchen würden", bilanzierte NRW-Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach (CDU) am 19. April in Düsseldorf.
1.825 Kontaktaufnahmen in zwölf Monaten
In den ersten zwölf Monaten zählte die Anlaufstelle, die auch per E-Mail erreicht werden kann, insgesamt 1.825 Kontaktaufnahmen. Von den anrufenden Männern waren demnach 70 Prozent in einer akuten Gewaltsituation. Überwiegend (40 Prozent) sahen sich die Betroffenen von ihrer gegenwärtigen oder früheren Partnerin oder auch von Familienangehörigen bedroht.
In der Mehrzahl der Fälle ging es um körperliche und psychische Gewalt. Sexualisierte Gewalt habe ein Sechstel der Anrufer erlitten. Aber auch aus dem Freundeskreis oder im Beruf hätten einige anrufende Männer Gewalt erfahren. Die Mehrzahl der Anrufenden war mit einem Anteil von 53 Prozent 30 bis 50 Jahre alt, zehn Prozent über 60, weitere zwölf Prozent junge Männer unter 25.
Schutzraum
Beide Bundesländer stellen im Rahmen des gemeinsam entwickelten Projekts auch Wohnungen bereit, in denen von Gewalt betroffene Männer Schutz finden - in NRW acht, in Bayern vier Wohnungen. Bis zu drei Monate können die Betroffenen dort bleiben. Ab diesen Sommer soll es auch eine Online-Beratung mit Chat-Funktion geben. Außerdem will eine diese Woche startende Social-Media-Kampagne das Projekt bekannter machen. Darüber hinaus soll das Hilfetelefon personell verstärkt und die Sprechzeiten erweitert werden.
Das Hilfetelefon für Männer wird nicht nur in NRW und Bayern, sondern bundesweit genutzt, wie die Auswertung des ersten Jahres ergab: 35 Prozent der Anrufe kamen demnach aus NRW, 18 Prozent aus Bayern, der Rest aus den anderen Bundesländern. Baden-Württemberg will nun ein vergleichbares Projekt starten. Sinnvoll sei es, das Angebot langfristig auf alle Bundesländer auszudehnen, betonten Scharrenbach und Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner (CSU): "Bayern und NRW haben ein echtes Vorbildprojekt geschaffen."
Betrieben wird das Angebot des Hilfetelefons in NRW über die Beratungsstelle man-o-mann Männerberatung in Bielefeld und in Bayern über die AWO in Augsburg. Bayern und NRW fördern das Projekt durch Zuschüsse. In NRW sind dazu im laufenden Haushalt rund 600.000 Euro eingeplant, Bayern gibt rund zwei Millionen Euro. Zukünftig wird das Projekt verstärkt durch zwei Träger aus Baden-Württemberg, die Sozialberatung Stuttgart e.V. und die Pfundskerle aus Tübingen.
Unicef: Corona gefährdet Wohlergehen von Kindern
Die Corona-Krise gefährdet laut Unicef das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Schon vor der Pandemie sei die Bundesrepublik bei der Zufriedenheit junger Menschen im Vergleich mit anderen Industriestaaten nur Mittelmaß gewesen.Köln (epd). Rund ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland warnt das UN-Kinderhilfswerk Unicef vor den Folgen für Kinder und Jugendliche. "Der Sicherung der Kinderrechte muss jetzt höchste Priorität eingeräumt werden", sagte der Vorstandsvorsitzende von Unicef Deutschland, Georg Graf Waldersee, am 20. April bei der Online-Präsentation des Unicef-Berichts zur Lage der Kinder in Deutschland 2021. Es mehrten sich die Hinweise, dass derzeit viele Familien an ihre Grenzen stießen, heißt es darin. Unicef fordert deshalb die Einberufung eines Gipfels zur Bewältigung der Folgen von Corona für Kinder, Jugendliche und Familien in Deutschland, wie Waldersee sagte.
"Je länger die Krise dauert, umso größer wird die Belastung gerade für die jungen Menschen und umso stärker kommen sie an ihre Grenzen", warnte sagte Unicef-Schirmherrin Elke Büdenbender. Bei einer aktuellen Befragung gaben laut dem Bericht mehr als die Hälfte von 1.000 Eltern in Deutschland an, dass die Kontaktbeschränkungen sowie die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten den Stress in ihren Familien deutlich erhöht haben. Ein Teil berichtete zudem von einem gestiegenen aggressiven Verhalten gegenüber den Kindern.
Folgen von Schulschließungen und Distanzunterricht
Gerade jüngere Kinder litten stark unter Schulschließungen und Distanzunterricht, sagte der Autor des Berichts, Hans Bertram. "Gerade für Grundschulkinder ist der Präsenzunterricht eine zwingende Voraussetzung, um eine Gleichheit der Entwicklungschancen zu schaffen." Schulschließungen sollten deshalb, wenn irgendwie möglich, vermieden werden.
Schon vor der Pandemie sei die psychische Gesundheit und Zufriedenheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland schlechter gewesen als in vielen anderen Industrieländern, betonte Waldersee. Das belege der Unicef-Bericht, der sich im Wesentlichen auf Daten vor der Corona-Krise stützt. Danach waren vor der Pandemie 21 Prozent der Mädchen und nahezu 13 Prozent der Jungen im Alter von 15 Jahren unzufrieden mit ihrem Leben. Damit belegten die deutschen Jugendlichen im Vergleich zu 26 Industrieländern den 16. Platz. "Dass ein signifikanter Teil der Jungen und Mädchen ohne Zuversicht in die Zukunft geht, ist richtig schlimm", betonte Waldersee.
Auffällig sei vor allem die relativ hohe Unzufriedenheit von Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren, sagte Bertram. 16 Prozent von ihnen schätzten sich als depressiv ein. Das seien doppelt so viele wie bei den Jungen. 13 Prozent erhielten verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel. "Damit weicht Deutschland signifikant von anderen Ländern ab," betonte der Soziologe. Positiv bewertet der Bericht das Verhältnis von Kindern und Eltern. Danach fühlen sich mehr als 90 Prozent der Kinder von ihren Eltern unterstützt.
Lob für soziale Sicherung
Einen Fortschritt sieht der Bericht auch bei der Entwicklung der relativen Armut von Kindern und Jugendlichen. Sie sei zwischen 2014 und 2019 um 2,6 Prozentpunkte gesunken. 2019 seien mit 1,48 Millionen rund zwölf Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren von Armut betroffen gewesen. Dabei habe die Bevölkerung zwischen 2015 und 2018 durch Zuwanderung um 2,5 Millionen zugenommen. "Das heißt, die Leistungsfähigkeit des sozialen Sicherungssystems in der Bundesrepublik ist im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern sehr gut," stellte Bertram fest.
Dennoch seien die Jahre des starken wirtschaftlichen Wachstums seit 2010 nicht ausreichend genutzt worden, um die Kinderarmut zu senken, kritisiert der Bericht. Kinder aus Einwandererfamilien und vor allem aus Haushalten mit alleinerziehenden Eltern seien weitaus stärker gefährdet. Durch die Pandemie drohten nun sozioökonomische Verwerfungen, denen mit enormen finanziellen und sozialpolitischen Kraftanstrengungen begegnet werden müsse. Notwendig sei vor allem ein umfassender strategischer Ansatz zur Überwindung der Kinderarmut wie etwa eine Kindergrundsicherung, forderte Waldersee.
Giffey: Zwei Milliarden Euro für "Aufholprogramm" für Kinder

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will zwei Milliarden Euro für ein "Aufholprogramm" für Kinder und Jugendliche bereitstellen, das negative Folgen der Corona-Krise ausgleichen soll. Damit werde versucht, entstandene Bildungslücken, Lernrückstände, ausgefallene Sprachschulungen oder psychologische Probleme zu kompensieren, sagte die Ministerin am 20. April bei einer Online-Infoveranstaltung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter. Die angedachten Projekte sollten sich nicht nur auf schulischen Nachhilfeunterricht beschränken, sondern auch die frühkindliche Bildung fördern und spezielle Sportangebote oder Kinderfreizeiten unterstützen.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter will das Vorhaben unterstützen, sieht aber einen erheblich höheren Finanzbedarf. Deren Vorsitzender Lorenz Bahr forderte einen "Post-Corona-Fonds Kinder- und Jugendhilfe" in Höhe von jährlich 5,6 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027. Der lasse sich decken, wenn sich nicht der Bund alleine, sondern auch die Länder und Kommunen finanziell engagierten. Bahr sprach von einer gemeinschaftlichen Aufgabe. Er sei "relativ optimistisch, dass uns das auch gelingt."
Zugleich soll laut Giffey auch die Präsenz der Schulsozialarbeit ausgebaut werden. "Beteiligt an den Planungen sei auch das Bundesbildungsministerium: "Zwei Milliarden Euro, das ist viel, viel Geld."
Zugleich verwies die Ministerin auf den weiteren Ausbau finanzieller Unterstützungen für Familien in der Pandemie und darauf, dass hier bereits verschiedene gesetzliche Hilfen erweitert beziehungsweise verlängert wurden. Sie nannte beispielhaft die Erhöhung des Kinderzuschlages, mehr Gelder im Teilhabepaket und eine zusätzliche Milliarde Euro für den Kita-Ausbau. Auch verwies Giffey auf das aktuelle Vorhaben ihres Ministeriums, den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter noch bis zum Ende der Legislaturperiode durchzusetzen. Der Referentenentwurf dazu sei soeben zur Anhörung an die Verbände gegangen, so Giffey.
Umfrage unter Jugendämtern
Bahr stellte die neue Kampagne "Das Jugendamt - Unterstützung, die ankommt" vor, die vor allem über die Arbeit der Behörden informieren soll. Bei den kommenden Aktionswochen wolle man deutlich machen, dass "das Jugendamt immer da ist, gerade auch jetzt, in der Krise". Durch die Betreuung und Begleitung durch die Behörden bekämen Kinder eine "wichtige Starthilfe". Die Ämter hätten sich "kreativ, flexibel und pragmatisch der Situation in der Corona-Pandemie angepasst", sagte Bahr.
Der Vorsitzende stellte zugleich die Resultate einer Umfrage bei den 559 Jugendämterm vor, in der die Folgen der Pandemie für die Arbeit der Behörden ermittelt wurden. Man habe enorme Defizite in der Entwicklung junger Menschen festgestellt, sagte Bahr. Er sprach von "verlorenen Chancen in der Pandemie und nachhaltigen Schäden".
Die Folgen der Pandemie in der Bildung seien längst zu einem Mittelschicht-Problem geworden, sagte Bahr. "Viele junge Menschen, insbesondere im Alter von 14 bis 18 Jahren, sind unter dem Radar des Jugendamtes durchgegangen", erläuterte Birgit Zeller, Sprecherin der AG Öffentlichkeitsarbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft und Leiterin des Landesjugendamtes Rheinland-Pfalz in Mainz. Auch Familien in prekären Lebenslagen, psychisch erkrankte Eltern sowie Alleinerziehende seien deutlich schwerer für das Jugendamt erreichbar gewesen.
Corona: Frauen in NRW leiden öfter unter psychischen Erkrankungen
Düsseldorf (epd). Frauen sind im ersten Jahr der Corona-Pandemie laut einer Untersuchung der Krankenkasse KKH deutlich häufiger wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben worden als Männer. 2020 hätten fast doppelt so viele Arbeitnehmerinnen ein Attest wegen einer psychischen Erkrankung vorgelegt wie Arbeitnehmer, erklärte die KKH Kaufmännische Krankenkasse am 20. April in Düsseldorf auf Basis aktueller Daten. Von Frauen seien rund 6.000 Atteste vorgelegt worden, von Männern 3.300.
Auf Platz eins der häufigsten seelischen Leiden lagen der Krankenkasse zufolge 2020 in NRW depressive Episoden mit insgesamt rund 93.500 attestierten Fehltagen bei Frauen und 60.500 Krankheitstagen bei Männern. Es folgten Anpassungsstörungen und Reaktionen auf schwere Belastungen (Frauen 75.500 Tage, Männer 35.000 Tage), wiederkehrende Depressionen (Frauen 43.000 Tage, Männer 23.500 Tage) sowie chronische Erschöpfung und Burn-out (Frauen 30.500 Tage, Männer 15.500 Tage).
Laut KKH fehlten die bei ihr versicherten Frauen in NRW 2020 im Schnitt 52 Tage wegen psychischer Erkrankungen. Das seien 3,4 Tage mehr als 2019. Männer hätten im Schnitt 54,6 Tage gefehlt, das seien sogar 9,8 Tage mehr als 2019. Die durchschnittlich längste Fehlzeit pro Arbeitnehmer registrierte die KKH in NRW aufgrund von Depressionen: bei den Frauen im Schnitt 109,5 Tage, bei den Männern rund 108 Tage. Das ist etwa die Hälfte der jährlichen Arbeitszeit.
Laut der KKH-Wirtschaftspsychologin Antje Judick werden Frauen durch die Corona-Krise stärker belastet, weil vor allem sie den Spagat zwischen Arbeit sowie der Betreuung von Kindern und pflegebedürftiger Angehöriger schaffen müssen. Ein weiterer Faktor sei, dass mehr Frauen in sozialen Berufen etwa als Kranken- und Altenpflegerinnen sowie in Branchen mit viel Menschenkontakt beschäftigt sind. "In diesen Bereichen ist die Belastung durch Corona besonders hoch", sagte Judick.
Seniorin klagt erfolgreich gegen Isolierung im Pflegeheim

epd-bild/Klaus Honigschnabel
Münster/Altenberge (epd). Eine bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Bewohnerin eines Altenpflegeheim hat sich vor Gericht erfolgreich gegen eine Isolierungsmaßnahme von über zwei Wochen gewehrt. Die Ordnungsverfügung der Gemeinde Altenberge vom 12. April sei aufgrund von Ermessungsfehlern rechtswidrig, heißt es in dem am 20. April veröffentlichten Beschluss des Verwaltungsgerichts Münster (AZ.: 5 L 255/21). Die Deutsche Stiftung Patientenschutz forderte, dass Pflegeheimbewohner mit Öffnungskonzepten aus dem Lockdown geholt werden.
Nach Ansicht der Richter wurden bei der verordneten isolierten Versorgung im Pflegeheim die individuellen Belange der Seniorin nicht berücksichtigt. Die Gemeinde Altenberge hatte für die über 80-jährige Seniorin die Maßnahme angeordnet, nachdem sie am 8. April Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person gehabt hatte. Bis einschließlich 26. April sollte es ihr demnach untersagt sein, ihre Räume ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes zu verlassen. Auch sollte sie keinen Besuch von Menschen erhalten, die nicht ihrem Haushalt angehören.
Gericht bemängelt Ermessungsfehler der Behörde
Die Frau empfand die vollständige Isolierung in ihrer kleinen Heim-Wohnung für die Dauer von zweieinhalb Wochen als unverhältnismäßig. Aus gesundheitlichen Gründen sei sie dringend auf Bewegung angewiesen, erklärte sie. Sie argumentierte zudem, bereits vollständig geimpft zu sein. Ein am 9. April durchgeführter PCR-Test auf das Coronavirus sei bei ihr negativ ausgefallen.
Die Verwaltungsrichter gaben dem Eilantrag der Frau, die vor Gericht von ihrem Sohn vertreten wurde, gegen die Verfügung statt. In Bezug auf die Antragstellerin lasse sich zwar eine wahrscheinliche Aufnahme von Krankheitserregern infolge eines Kontakts mit einer infizierten Person auch nach zwei bereits erfolgter Impfungen nicht verlässlich ausschließen, heißt es in dem Beschluss. Doch habe das Gesundheitsamt nicht einmal erwogen, der Antragstellerin Ausnahmen von der grundsätzlichen Absonderungspflicht zu ermöglichen.
Patientenschützer kritisieren Kontaktbeschränkungen
Dies wäre aber ohne weiteres möglich gewesen, erklärte die Richter. So hätte die ältere Frau mit FFP2-Masken oder Schutzkleidung ausgestattet werden können, wie sie das Pflegepersonal bei Corona-Fällen trägt. Mögliche Zusammentreffen mit anderen Bewohnern hätten zudem verhindert werden können, indem sie in nur zu einer bestimmten Zeit ihre Zimmer für ihr Sportprogramm verlässt. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt werden.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte, dass trotz Zweitimpfung in den 12.000 Pflegeeinrichtungen oft strengste Kontaktbeschränkungen herrschten. Das Risikos, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben könnten rechtfertige nicht die andauernden massiven Eingriffe, erklärte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, am Dienstag in Dortmund. "Deshalb ist überfällig, dass alle Länder die Pflegeheimbewohner mit verbindlichen Öffnungskonzepten endlich aus dem Lockdown holen", mahnte er. Das schaffe auch Handlungssicherheit für die Gesundheitsämter und Heimbetreiber. Es könne nicht sein, dass allein Gerichte Grundrechtseinschränkungen beendeten. "Die Politik muss endlich Verantwortung übernehmen", forderte Brysch.
Heil wirbt für neuen Anlauf für höhere Löhne in der Altenpflege

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat für einen weiteren Anlauf für höhere Löhne in der Altenpflege geworben. Er sagte am 21. April in Berlin, die Ablehnung eines allgemeingültigen Tarifs durch die Arbeitgeber der Caritas vor wenigen Wochen "kann und darf nicht das letzte Wort sein". Ein Weg, der jetzt noch offenstehe, sei, die Refinanzierung von Pflege- und Reha-Einrichtungen durch die Pflege- und Krankenkassen sowie die Vergabe staatlicher Aufträge konsequent an das Vorhandensein von Tarifverträgen zu knüpfen, erklärte Heil.
Er wolle dazu noch in dieser Legislaturperiode einen weiteren Anlauf unternehmen, kündigte der SPD-Politiker an und appellierte an die Union, dabei mitzuziehen. Eine große Pflegereform wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sie angekündigt habe, sei bis zur Bundestagswahl im September kaum noch zu erwarten, sagte Heil. Aber es müsse etwas getan werden, um die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege zu verbessern, sagte Heil. Das müsse eine der Lehren aus der Pandemie sein.
"Nicht alle"
Mit Blick auf die Gemengelage in der Diakonie Deutschland sagte Heil, er wisse, dass viele in dem evangelischen Verband für einen allgemeinen Tarif gekämpft hätten, "aber nicht alle". Die Diakonie sei nach dem abschlägigen Beschluss der Caritas "um ein Votum herumgekommen", bilanzierte er. Beide kirchlichen Verbände hätten dem Verfahren zu einem allgemeinverbindlichen Tarif in der Altenpflege zustimmen müssen. Nach dem Beschluss der Caritas hatten die Gremien der Diakonie nicht mehr abgestimmt.
Heil sprach beim jährlichen Wichern-Empfang der Diakonie Deutschland, der 2020 abgesagt worden war und in diesem Jahr digital stattfand. Thematisch standen die Folgen der Digitalisierung und der Corona-Pandemie für den Sozialstaat im Mittelpunkt.
Maria Loheide vom Vorstand der Diakonie Deutschland unterstützte Heils Vorschlag. Die Bezahlung sei nicht alles, aber sie sei ein wesentlicher Aspekt bei der Wahl eines Berufes, sagte sie. Loheide zeigte sich besorgt über die Folgen der Pandemie. Die sich verschärfende soziale Ungleichheit verbunden mit den hohen coronabedingten Ausgaben stellten den Sozialstaat vor enorme Herausforderungen. Förderprogramme für die Wirtschaft reichten nicht aus, sagte Loheide. Der Staat müsse auch stärker in das Sozialwesen investieren.
Neue berufsbegleitende Studiengänge an der Fliedner Fachhochschule
Düsseldorf (epd). Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf der Kaiserswerther Diakonie nimmt zum kommenden Wintersemester 2021/22 zwei neue berufsbegleitende Studiengänge in ihr Programm auf. Der fünfsemestrige Studiengang "MBA im Sozial- und Gesundheitswesen" soll auf Leitungs- und Management-Positionen im Sozial- oder Gesundheitssektor vorbereiten, wie die Fachhochschule ankündigte. Schwerpunkte sind Betriebswirtschaft, Recht, Ethik, Führen und Leiten sowie Organisationsentwicklung. Das Studium richtet sich an Interessierte mit Hochschulabschluss im Gesundheits-, pflegewissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Bereich mit erster Berufserfahrung.
Der zweijährige Bachelorstudiengang "Angewandte Pflegewissenschaft" bietet den Angaben zufolge berufserfahrenen und weitergebildeten Pflegefachkräften die Möglichkeit, berufsbegleitend einen akademischen Abschluss zu erwerben. Ausführliche Informationen über die neuen Studiengänge erhalten Studieninteressierte bei zwei digitalen Infoabenden am 28. und 29. April. Bis Anfang Mai informiert die Fliedner Fachhochschule darüber hinaus in insgesamt 15 Online-Meetings über ihr gesamtes Studienangebot. Alle Termine und Anmeldung unter: www.fliedner-fachhochschule.de/veranstaltungen.
AWO fordert Reform der Bezahlung in Werkstätten für Behinderte
Dortmund (epd). Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Nordhrein-Westfalen fordert ein besseres Entlohnungssystem in Werkstätten für behinderte Menschen. "Die Bezahlung darf nicht mehr von der Auftragslage abhängen", erklärte der Geschäftsführer der AWO NRW, Uwe Hildebrandt, am 19. April in Dortmund. Nötig sei "ein krisensicheres Entgeltsystem, damit die Werkstätten bestehen bleiben und den Menschen weiterhin Teilhabe an Arbeit ermöglichen". Die Corona-Pandemie habe die Instabilität des bestehenden Bezahlungssystem noch einmal verschärft.
Viele Beschäftigte müssten neben dem Entgelt Grundsicherungsanträge stellen, da das Geld nicht ausreiche, um den Lebensunterhalt sicherzustellen, kritisiert die AWO. Seit Jahrzehnten forderten die Beschäftigten der Werkstätten ein Einkommen, das es ihnen ermögliche, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Im aktuellen System würde die Bezahlung aus dem Arbeitsergebnis beziehungsweise den Ertragsschwankungsrücklagen finanziert. So hätten Schwankungen der Auftragslage direkten Einfluss auf das Entgelt der Beschäftigten.
"Wir sehen dringenden Handlungsbedarf und fordern die Politiker der Gemeinden, des Landes und des Bundes dazu auf, sich dafür einzusetzen, die Forderungen nach einem neuen, zukunftsfähigen Entgeltsystem der Werkstätten voranzubringen und schnellstmöglich umzusetzen", erklärte Hildebrandt. Nordrhein-Westfalen ermögliche als einziges Bundesland auch Menschen mit Schwerst‐Mehrfachbehinderungen ein sinnvolles Teilhabeangebot innerhalb der Werkstätten. Sie erhielten ebenfalls ein Entgelt, unabhängig von der individuellen Leistungsfähigkeit.
Der Deutsche Bundestag habe die Bundesregierung aufgefordert, bis Mitte 2023 eine "Studie zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt" zu erheben.
Pfarrer Kossen fordert Impfung von Arbeitsmigranten

epd-bild / Uwe Lewandowski
Lengerich, Münster (epd). Der katholische Theologe und Menschenrechtler Peter Kossen fordert eine schnellstmögliche Impfung gegen Corona für ost- und südosteuropäische Arbeitsmigranten. Aufgrund "vielfach unmenschlich harter Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, in Ausstallkolonnen oder als Paketzusteller" gebe es bei diesen Arbeitern eine Vielzahl von Infektionen sowie schweren und tödlichen Verläufen der Corona-Erkrankung, erklärte Kossen am 22. April in Lengerich. Er verwies dabei auf die hohen Infektionszahlen in der Fleischindustrie. "Die Totalerschöpfung dieser Menschen ist die Normalität", kritisierte der Theologe: "Als Wegwerfmenschen werden sie verschlissen und in großer Zahl infiziert."
Es dürfe nicht sein, dass gerade die Menschen in großer Zahl durch das Netz fielen, die besonders gefährdet seien, erklärte der Theologe, der sich seit Jahren für Arbeitsmigranten einsetzt und immer wieder auf den Missbrauch von Werkvertrags- und Leiharbeit zum Zweck von Lohn- und Sozialdumping hingewiesen hat. In den Schrottimmobilien, die häufig als Unterkunft dienten, und ihren oft viel zu kleinen, schlecht belüfteten und mehrfach belegten Zimmern gebe es oft Schimmelbeläge an den Wänden, erklärte Kossen. Zunehmend würden ganze Familien von Arbeitsmigranten mit ihren Kindern in gesundheitsgefährdenden Unterkünften hausen.
Mangelnde Sprachkenntnisse
Zwar sehe ein Erlass des Bundesarbeitsministeriums vom vergangenen Jahr die Unterbringung in kleinen festen Teams oder eine Einzelbelegung von Schlafräumen vor. "Ich kann nicht erkennen, dass die Umsetzung dieser wichtigen Vorschrift irgendwo kontrolliert wird", kritisierte der katholische Theologe des Bistums Münster.
Verschärft würden Probleme durch mangelnde Sprachkenntnisse, erklärte Kossen. Viele würden wenig oder gar nicht Deutsch sprechen. "Da kommen Informationen, Warnungen und Sicherheitsvorschriften nur bruchstückhaft oder überhaupt nicht bei den Adressaten an", beklagte der Theologe. Notwendige Informationen zur Pandemie und zur Impfung erreichten die Arbeitsmigranten vielfach nicht.
Mehr als 750.000 Arbeitslose länger als vier Jahre ohne Job
Je länger jemand arbeitslos ist, desto schwerer findet er eine neue Stelle. Mehr als 750.000 Menschen in Deutschland sind schon über vier Jahre auf Jobsuche. Die Linke wirft der Bundesregierung vor, nicht genug gegen Langzeitarbeitslosigkeit zu tun.Berlin, Essen (epd). Fast 762.000 Langzeitarbeitslose in Deutschland haben bereits seit vier Jahren oder länger keine Arbeit mehr. Das ist nahezu die Hälfte aller arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger, wie aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Demnach waren im Juni 2020 rund 1,69 Millionen Menschen als erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger gemeldet, davon "45 Prozent seit mindestens vier Jahren im Regelleistungsbezug". Die Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (25. April) hatten zuerst über das Thema berichtet.
Dabei seien die ostdeutschen Bundesländer stärker betroffen als die westdeutschen, hieß es weiter. In Westdeutschland waren demnach 43 Prozent der arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger seit mindestens vier Jahren auf Jobsuche, in Ostdeutschland 51 Prozent. Die Landkreise mit dem höchsten Anteil an Arbeitslosen, die seit mehr als vier Jahren eine Stelle suchen, sind den Angaben zufolge die Region Spree-Neiße (64,7 Prozent) und Görlitz (64,4). Die Regionen mit dem geringsten Anteil finden sich allesamt in Bayern, angeführt von Pfaffenhofen an der Ilm (16,7 Prozent).
Die Sozialexpertin der Linken, Sabine Zimmermann, warf der Bundesregierung vor, vor allem in Ostdeutschland zu wenig gegen die Verfestigung der Langzeitarbeitslosigkeit getan zu haben. Dort gebe es "abgehängte Regionen, in denen sich am Arbeitsmarkt nur wenig bewegt", erklärte sie. Seit der Abwicklung etlicher Betriebe hätten viele Beschäftigte dort keinen dauerhaften ordentlichen Arbeitsplatz mehr gefunden. Die Corona-Pandemie habe die Situation weiter verschlechtert. Zimmermann forderte einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor mit ausreichend existenzsichernden Stellen und eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro.
Medien & Kultur
Pfeifenorgel in der Kiste

epd-bild/ Jaeger + Brommer, Waldkircher Orgelbau
Karlsruhe, Waldkirch (epd). Die Orgel gilt als "Königin der Instrumente". Um mehr Menschen für das Instrument zu begeistern, hat die badische evangelische Landeskirche gemeinsam mit Waldkircher Orgelbauern eine ungewöhnliche Orgel als Do-it-yourself-Bausatz entwickelt. Die beiden ersten "Al:legrO - Orgeln" seien bereits im Einsatz, sagte der Orgelexperte und Musikwissenschaftler Martin Kares dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er leitet das Orgel- und Glockenprüfungsamt der Evangelischen Landeskirche in Baden.
Um das beeindruckende Instrument auch denjenigen "klanghaft" zu machen, die nicht in die Kirche gehen, entwickelten die Orgelbauer eine "kleine Königin". Das "Instrument des Jahres 2021" wird dabei als hölzerner Bausatz in einer Kiste geliefert. Die rund 100 Teile wie etwa Pfeifen, Tasten, Magazinbalg, Schöpfbalg, Windlade und Windrohr können in 60 Minuten auf einem Tisch zusammengesteckt und dann gespielt werden.
Keineswegs nur Spielerei
Das sei keineswegs nur eine Spielerei, erklärt Kares. Vielmehr handle es sich aber um "eine echte Pfeifenorgel im Miniaturformat". Vom Klang sei das etwa 60 mal 80 mal 90 Zentimeter große Instrument mit einem kleinem Orgelpositiv vergleichbar. Anders als bei großen Instrumenten würden jedoch die großen Basspfeifen fehlen. Die Bezeichnung "Allegro" steht dabei nicht nur für die musikalische Tempoangabe für "fröhlich, heiter, lebhaft", sondern enthält auch das Wort Orgel - von hinten gelesen.
Orgelbaumeister Wolfgang Brommer aus dem Schwarzwaldort Waldkirch war von dem Auftrag begeistert. Normalerweise baut er Orgeln in Kirchen ein, die schon mal so groß wie ein zweistöckiges Haus sein können. Dieses kleine Klanginstrument könne aber zu den Menschen kommen. Mit 24 Tasten und 2 Pfeifenreihen sei dies keineswegs eine Art Ikea-Bausatz, sondern eine hochwertige Orgel für Jung und Alt, erklärt der Experte.
Eine ausführliche Bauanleitung erläutert den einfachen Aufbau. Da müsse kein Experte dabei sein, versichert Kares. Der zerlegbare Orgelbausatz sei speziell für Schüler und junge Menschen konzipiert worden und kann etwa von Religions- und Musiklehrern für den Unterricht ausgeliehen werden.
Idee aus den Niederlanden
Die Idee einer Orgel zum Zusammenstecken stammt ursprünglich aus den Niederlanden. Dort wollte die Grundschullehrerin und Amateurorganistin Lydia Vroegindeweij ihr Wissen über das Instrument mit Kindern teilen. Mittlerweile besteht ihr Projekt "Orgelkids" seit Juli 2009. Es hat sich nach eigenen Angaben zu einem weltweiten Angebot mit mehr als 75 Orgeln und einem Netzwerk von Projektleitern in mehr als 15 Ländern entwickelt.
Dieses Konzept hat die badische Landeskirche gemeinsam mit den Schwarzwälder Orgelbaumeistern weiterentwickelt. Auch didaktisches Material gibt es zu dem Instrument. Beides soll mehr Kinder und Jugendliche für die Orgel interessieren und so auch der Nachwuchsgewinnung dienen.
Das Instrument kann bei der Landeskirche und der Waldkircher Orgelstiftung gemietet oder bei der Orgelbaumeisterwerkstatt Jäger & Brommer für 5.500 Euro gekauft werden. Bisher stehen zwei Exemplare in der Landeskirche zum Mieten bereit, in der Heidelberger Akademie für Kirchenmusik und dem Religionspädagogischen Institut in Karlsruhe.
Malen angesichts der Giganten
Gehstock, große Ringe, Einstecktuch - Markus Lüpertz tritt auf mit Stil. Der Maler, der nun seinen 80. Geburtstag feierte, setzt sich nicht zur Ruhe. Der Künstler und ehemalige Düsseldorfer Akademiedirektor arbeitet weiter in seinen Ateliers.Düsseldorf (epd). Ein Bild malen, eine Skulptur schaffen ist für Markus Lüpertz auch nach Jahrzehnten immer noch ein aufregender Prozess. Denn jedes Mal versuche er, dem Vergleich mit den größten Künstlern der Geschichte standzuhalten, sagt er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Düsseldorf kurz vor seinem 80. Geburtstag. "Es gibt nichts Einsameres, als vor dieser weißen Leinwand zu stehen und sich mit 2.000 Jahren Kultur und Malerkultur zu konfrontieren." Ob es die Ninas des spanischen Malers Diego Velazquez seien oder das großformatige Ölgemälde "Guernica" von Pablo Picasso, "man hat ja Giganten vor sich".
Lüpertz geht als Maler seinen eigenen Weg und verbindet gegenständliche Malerei mit Abstraktion. Das zeichnet auch Kirchenfenster aus, die er etwa für Sankt Andreas in Köln gemacht hat, oder den Totentanz für die Kirche Sankt Franziskus in Mönchengladbach. Seine Skulpturen, vor allem die der Musiker Ludwig van Beethoven in Bonn und Wolfgang Amadeus Mozart in Salzburg, sind umstritten.
Malerfürst und Gentleman
Auch sein eigenes Erscheinungsbild - er gibt sich als Malerfürst mit schweren Ringen an jedem Finger, eigens für ihn angefertigten Anzügen und Stock mit Silberknauf - wird von manchen belächelt. "Der darf das. Er ist ein echter Gentleman," sagt dagegen einer seiner engsten Freunde, der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Am 25. April ist Markus Lüpertz 80 Jahre alt geworden.
In die Wiege gelegt ist Lüpertz der Aufstieg zu einem der wichtigen deutschen Maler der Nachkriegszeit und Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie (1988 bis 2009) nicht. In Liberec in der Tschechoslowakei wird Markus Lüpertz am 25. April 1941 geboren. 1948 zieht er mit der Familie ins Rheinland, nach Rheydt bei Mönchengladbach. Als seine Eltern sich das Gymnasium für ihn nicht mehr leisten können, geht er eigene Wege, geleitet von dem Wunsch, Maler zu werden. Das Arbeitsamt schickt ihn zunächst zu einem Anstreicher in die Lehre, dann zu einem Gestalter von Flaschenetiketten. Beides misslingt.
Von der Zeche über Fremdenlegion zur Kunst
Geld verdient er eine Zeit lang unter Tage. "Ich hatte eine romantische Vorstellung von der Arbeit im Bergwerk", sagt Lüpertz. Nach einem Jahr zieht er aber weiter, nach Südfrankreich zur Fremdenlegion. Als aber ein Einsatz im Algerienkrieg droht, kann er sich aus dem Staub machen. Zurück in Deutschland beginnt er dann auf der Werkkunstschule in Krefeld mit dem Kunststudium.
Ein Glasmaler bringt ihn in die Benediktinerabtei nach Maria Laach. Da entdeckt Lüpertz die Welt der Bücher, in die er sich Zeit seines Lebens versenken wird. "Er ist hochgebildet, und es macht Spaß, mit ihm nicht nur über Kunst, sondern auch über Gesellschaftspolitik und vor allem Geschichte zu reden", sagt Gerhard Schröder. Die Herkunft aus einfachen Verhältnissen und ein Aufstieg aus eigener Kraft verbindet beide. "Ich hätte es aber nie geschafft, mich aus diesem Hintergrund der Kunst zuzuwenden", sagt Schröder. Er habe Freunde gebraucht, nicht zuletzt Lüpertz, die ihn lehrten "Kunst von Kitsch" zu unterscheiden.
Karriere über Umwege
Markus Lüpertz' Laufbahn führt, wenn auch mit Umwegen, nach oben: "Mit 15 verließ ich mein Elternhaus, flog von allen Schulen, selbst meiner geliebten Düsseldorfer Kunstakademie, und mit 30 war ich Professor!" Er bildet seinen Stil, malt große Formate, stark in den Farben, immer rhythmisch und, anders als die meisten Künstlerinnen und Künstler der Nachkriegszeit, nicht abstrakt.
Der Kunsthistoriker Armin Zweite, der Museen wie das Lenbachhaus in München und die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen leitete, schätzt diesen eigenen Stil, der das Figurative mit dem Abstrakten verbindet. "Es zeichnet Markus Lüpertz aus, dass er die Geschichte der Malerei sehr genau reflektiert, sie weiter entwickelt, mal persifliert, mal zerstört oder sie neu formuliert", sagt Zweite.
Wucht der Bilder
Für die Beschäftigung mit Krieg und Nationalsozialismus sucht er auch seinen eigenen Ausdruck, setzt dabei aber vor allem auf die Wirkung, manchmal Wucht der Bilder. Ein 14 Meter langes Bild heißt "Westwall" und macht aus den Panzersperren ästhetische Gebilde. Auch Soldatenhelme malt er wie Objekte. Lüpertz, der auch Gedichte schreibt, sieht es als Aufgabe des Künstlers an, den Protest gegen die Unmenschlichkeit so zu gestalten, dass auch spätere Generationen davon berührt werden. "Er muss seine gebrochenen Flügel, seinen Hass auf diese Hölle, verbinden mit der Verpflichtung auf Ewigkeit," schreibt Lüpertz.
Seine größte Statue hat er für Gelsenkirchen geschaffen, einen 18 Meter hohen Herkules. Mit Gestalten der Antike beschäftigt sich Lüpertz immer wieder, weil die Kunst vorchristlicher Zeit "unseren Sinn für Schönheit" entwickelt habe. Zudem habe sich ein Gespür für Verletzlichkeit entwickelt angesichts der nur unvollständig erhaltenen Skulpturen, "die wir nur als Torso" kennen. Auch daran erinnert Lüpertz' Beethoven-Statue im Hofgarten in Bonn. Ihr fehlen die Arme, ein Bein ist amputiert. Zu ihren Füßen liegt ein Kopf, der an den Komponisten Beethoven erinnert, der seine eigene Musik im späteren Lebensverlauf nicht mehr hören konnte. Lüpertz ist überzeugt: "Das Genie muss über seine Gebrechen siegen."
Er selbst arbeitet in einem seiner vier Ateliers in Düsseldorf, bei Berlin, in der Toskana und in Karlsruhe, seinem Hauptwohnsitz, auch mit 80 Jahren noch weiter. Jedes Bild trage schon das nächste in sich, jede Skulptur fordere eine neue, eine bessere, sagt der Künstler. Ob seine Werke wirklich gut seien, "das wird die Kunstgeschichte erst in 200 Jahren erkennen".
Kritik an Protestaktion #allesdichtmachen ebbt nicht ab
Die Kampagne Dutzender Film- und Fernsehstars gegen die Corona-Politik stößt weiter auf Empörung und Unverständnis. Auf der Website des Projekts wird betont, man lasse sich nicht mit Rechten in eine Ecke stellen.Frankfurt a.M. (epd). Die Kritik an der umstrittenen Schauspieler-Kampagne #allesdichtmachen reißt nicht ab. Wer sich über die Corona-Schutzmaßnahmen lustig mache, "zeigt kein Mitgefühl für 80.000 Corona-Tote, ihre Angehörigen und die sorgenden Menschen", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der "Bild am Sonntag". Schriftsteller Thomas Brussig erklärte im Berliner "Tagesspiegel" vom 25. April, die "Tonalität der Selbstgerechtigkeit" der Teilnehmer sei schwer auszuhalten gewesen. Im Internet starteten Ärzte und Pfleger einer Gegenkampagne unter dem Hashtag #allemalneschichtmachen. Schauspieler Jan Josef Liefers, der sich an der ursprünglichen Aktion beteiligt hatte, verteidigte diese indes. Fernsehmoderator Günther Jauch nahm die Beteiligten in Schutz.
Die Protestaktion hatte am 23. April vielfach Empörung ausgelöst. Den Teilnehmern wurden unter anderem fehlende Empathie und Zynismus vorgeworfen. An der Kampagne hatten sich mehr als 50 Schauspieler und Schauspielerinnen beteiligt, darunter Ulrich Tukur, Heike Makatsch und Meret Becker. Zuspruch erhielt die Aktion aus dem rechten Lager, von AfD-Politikern und aus der "Querdenker"-Szene. Einige Künstlerinnen und Künstler distanzierten sich inzwischen von der Aktion und löschten ihre Beiträge.
Teil der Clips gelöscht
Am Nachmittag des 25. April waren von ursprünglich 53 noch 34 Clips zu sehen. In einem Statement auf der Website hieß es, die Kampagne übe "mit Mitteln von Satire und Ironie" Kritik. "Wenn man uns dafür auf massivste Art und Weise beschimpft und bedroht, ist das ein Zeichen, dass hier etwas ins Ungleichgewicht geraten ist." Man leugne nicht Corona und lasse sich "nicht in eine Ecke stellen mit Rechten, Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern". Es sei kein offizielles Statement von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projekts, hieß es.
Brysch erklärte, die Teilnehmer hätten sich wenig einfühlsam gezeigt, und die Aktion sei nach hinten losgegangen. Filmproduzent Nico Hofmann sprach von einem schmalen satirischen Grat. "Und wer darauf ausrutscht, landet rasch im Abgrund, genauer gesagt im sehr rechten, antidemokratischen Milieu", sagte er der "Bild am Sonntag". Für ihn sei die Balance bei #allesdichtmachen "absolut danebengegangen".
Brussig sagte zu Anmerkungen, die Aktion sei Satire gewesen, es sei "immer besser, die Komödie erst dann zu machen, wenn die Tragödie hinter einem liegt". Der Präsident der Deutschen Filmakademie und Schauspieler Ulrich Matthes sagte, er sei nach Bekanntwerden der Kampagne "einigermaßen fassungslos" gewesen: "Ich empfinde sie nur als zynisch." Manche der Beiträge seien "absoluter Querdenker-Szene-Jargon", sagte Matthes am 23. April dem NDR.
Liefers verteidigt sich
Liefers erklärte in der Talkshow "3nach9" von Radio Bremen am 23. Apirl, er habe Menschen vertreten wollen, die unter den Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung leiden. Jedoch sei dafür Ironie vielleicht das falsche Mittel gewesen. Die Aktion habe keinesfalls "rechte Schwurbler und Wirrköpfe" munitionieren sollen.
Jauch sagte am 23. April der "Jüdischen Allgemeinen", er kenne einige der beteiligten Künstler seit langem persönlich: "Die sind jetzt todunglücklich über die Instrumentalisierung durch Coronaleugner und die AfD."
Schutzkodex soll Medienschaffende besser schützen
Mit neuen Standards sollen Journalistinnen und Journalisten in Deutschland besser vor verbalen oder körperlichen Angriffen geschützt werden. Medienhäuser, Verlage und Rundfunkanstalten wurden aufgerufen, sich einem Schutzkodex anzuschließen.Berlin (epd). Journalisten sollen mit einem neuen Regelwerk besser vor Gewalt und Bedrohungen geschützt werden. Dazu haben mehrere Organisationen am 22. April in Berlin einen "Kodex für Medienhäuser" vorgestellt. Von verbalen oder körperlichen Angriffen betroffene Medienschaffende sollen so frühzeitig Unterstützung etwa von ihren Arbeitgebern erhalten.
Vorgesehen sind laut dem Kodex die Benennung fester Ansprechpersonen bei den Arbeitgebern sowie eine externe, psychologische und juristische Unterstützung von Journalisten, wenn sie aufgrund ihrer Berichterstattung zum Ziel von rechten, rassistischen, antisemitischen, frauenverachtenden oder anderweitig politisch motivierten Bedrohungen, Angriffen oder Gewalttaten geworden sind. Ebenfalls geplant sind die Kostenübernahme von Personenschutz, die Begleitung von Sicherheitspersonal bei Dreharbeiten sowie Hilfe und Kostenübernahme bei etwaigen Wohnungswechsel infolge der Veröffentlichung einer Privatadresse, wie Monique Hofmann von der Deutschen Journalistinnen und Journalisten Union (dju) sagte.
Zu den Initiatoren des Kodex zählen neben der dju auch die Neuen deutschen Medienmacher, "Reporter ohne Grenzen", der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV).
Dem Kodex haben sich den Angaben zufolge bereits die Deutsche Presseagentur (dpa), die "Frankfurter Rundschau", die "tageszeitung", der "Spiegel", "Die Zeit" sowie "Zeit Online" angeschlossen. Die vereinbarten Maßnahmen sollen für fest angestellte und freie Kollegen gelten. Weitere Medienhäuser seien aufgerufen, sich anzuschließen.
"Was wir unbedingt vermeiden müssen ist, dass sich Redaktionen und Journalisten in ihrer Arbeit eingeschüchtert fühlen und sich nicht mehr trauen, ihren Job auszuführen", sagte der stellvertretende Chefredakteur von "Zeit Online", Sebastian Horn. Für betroffene Kollegen seien Bedrohungen etwa per E-mail oder in sozialen Medien "auf jeden Fall zermürbend".
Bundesweit 65 Angriffe auf Medienschaffende
Zuletzt hatte "Reporter ohne Grenzen" für 2020 bundesweit 65 Angriffe auf Medienschaffende und damit eine Verfünffachung gegenüber 2019 registriert. Deutschland wurde in der "Rangliste der Pressefreiheit" von der Kategorie "gut" auf "zufriedenstellend" herabgestuft.
Gehäuft Angriffe auf Medienschaffende habe es in den vergangenen Monaten bei der Berichterstattung über die Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen gegeben, hieß es. Besonders freie Journalisten, die oft wichtige Hintergrundrecherche im Feld Rechtsextremismus machen, seien seit Jahre von rechten Gewalttaten betroffen.
Einzelne Journalisten seien akut gefährdet gewesen, erklärte das Bündnis für den Schutzkodex. Medienschaffende, die über Themen wie Flucht und Migration, Rechtsextremismus, Feminismus oder die Corona-Pandemie berichten, "laufen besonders Gefahr, Ziel von Anfeindungen zu werden, die darauf abzielen, ihre Berichterstattung einzuschränken", hieß es.
SR-Intendant Kleist: Kooperationen statt Fusionen
Saarbrücken, Frankfurt a.M. (epd). Der scheidende Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR), Thomas Kleist, hat Forderungen nach Zusammenlegungen von ARD-Sendern eine Absage erteilt. "Kooperationen hören dort auf, wo Fusionen beginnen", sagte der 65-Jährige dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Da die Regionalität unsere Stärke ist, sollten wir nicht einer schleichenden Zentralisierung das Wort reden, sonst stellen wir unser eigenes System infrage." Den Vorschlag von SWR-Intendant Kai Gniffke, dass SR und SWR gemeinsame Direktionen bilden sollten, habe er daher zurückweisen müssen. Innerhalb der ARD sei der SR aber bereits "Kooperationsmeister" und habe gemeinsam mit dem SWR Standards gesetzt.
Im föderalen Miteinander sei es schwierig, "die notwendigen Kooperationen gegenüber standortpolitischen Interessen durchzusetzen", sagte Kleist. Das gelte gleichermaßen für die Politik und die ARD-Anstalten. Ein Schlüsselprojekt für die Sender sei aktuell die ARD-weite Einführung von SAP-Software. "Dann könnte man beispielsweise die Reisekostenabrechnungen für alle Sender in Berlin oder Magdeburg, die Gehaltsabrechnungen in München, Düsseldorf oder Hamburg abwickeln und die Cybersicherheit für alle von Saarbrücken aus steuern", sagte der SR-Intendant.
Streit um Beitragserhöhung: "Doppelweck mit nix druff"
In Karlsruhe rechnet Kleist mit einem Erfolg der öffentlich-rechtlichen Sender, die gegen die ausbleibende Beitragserhöhung infolge einer Blockade des sachsen-anhaltischen Landtags geklagt haben. "Ich glaube an unseren Rechtsstaat und setze große Hoffnung in die Kontinuität der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts", sagte er. Selbst die Gegner von Beitragserhöhungen müssten anerkennen, dass eine Erhöhung um 86 Cent maßvoll sei, nachdem die Beiträge rund zehn Jahre nicht mehr angepasst wurden. Rund 18 Euro im Monat bedeuteten 60 Cent am Tag. In saarländischer Währung sei das ein "Doppelweck mit nix druff", betonte Kleist.
Keine Chancen mehr sieht Kleist für die Idee eines europäischen Gegenentwurfs zu Google. "Da ist meines Erachtens der Zug abgefahren", sagte er. "Es wäre für den Einsatz von öffentlichen Geldern zu risikoreich und nicht erfolgversprechend, weil man gegen bereits fest etablierte Plattformen antreten müsste." Dem Plattform-Gedanken zur Förderung eines gemeinsamen Kommunikationsraums könne man aber auch auf andere Weise Rechnung tragen: "Da wäre der nächste Schritt eine europaweite Mediathek als technische Plattform, auf der öffentlich-rechtliche Inhalte unterschiedlicher Provenienz vorgehalten werden."
Der Jurist Kleist ist seit 2011 Intendant des SR und geht Ende April in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist der bisherige SR-Hörfunkdirektor und stellvertretende Programmdirektor Martin Grasmück (50).
Lübcke-Schreibtisch kommt ins Bonner Haus der Geschichte
Kassel, Bonn (epd). Das Regierungspräsidium Kassel überlässt dem Bonner Haus der Geschichte Einrichtungsgegenstände aus dem Büro des im Amt ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Hierzu zählt vor allem der Schreibtisch, an dem der CDU-Politiker von seinem Amtsantritt 2009 bis zu seinem gewaltsamen Tod im Juni 2019 gearbeitet hat, wie das Regierungspräsidium am 22. April mitteilte. An diesem Schreibtisch sei auch die Power-Point-Präsentation zu Lübckes Vortrag in Lohfelden am 14. Oktober 2015 entstanden.
Der frühere Regierungspräsident hatte in Lohfelden bei einer Bürgerversammlung Pläne zur Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft vorgestellt und als Reaktion auf Schmähungen von rechtsradikalen Störern im Publikum die Sätze gesprochen: "Es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten, und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen." Bei der Bürgerversammlung war auch der Rechtsextremist Stephan Ernst anwesend, der im Januar dieses Jahres wegen des Mordes an Walter Lübcke zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.
Sammlung zur Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber (CDU) dankte dem Haus der Geschichte für die dauerhafte Bewahrung des Schreibtisches, des Vortrags und weiterer Utensilien seines Amtsvorgängers. Ungezählte Male habe er selbst mit ihm an seinem Schreibtisch gesessen und gearbeitet. Lübckes "aufrechte Haltung, sein Einsatz für die Demokratie und seine Wertschätzung gegenüber dem Grundgesetz" hätten ihn und alle Kolleginnen und Kollegen im Regierungspräsidium stets beeindruckt.
Das Haus der Geschichte ergänzt laut dem Kasseler Regierungspräsidium mit den Objekten aus dem Lübcke-Nachlass seine Sammlungen zur Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus in Deutschland. In der Dauerausstellung des Museums für Zeitgeschichte sind unter anderem Exponate zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992, dem Brandanschlag auf ein von türkischen Familien bewohntes Haus in Mölln im November 1992 und von Enver Simsek, einem Opfer des sogenannten "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU), zu sehen.
Finale für Kabarettpreis "Das Schwarze Schaf" wird online gezeigt
Essen, Duisburg (epd). Das Finale des niederrheinischen Kabarettpreises "Das Schwarze Schaf" geht am 1. Mai online über die Bühne. Die Veranstaltung wird ab 19.30 Uhr über die Plattform "FeedBeat" live gezeigt, wie die Organisatoren am 22. April in Essen mitteilten. Als Finalistinnen und Finalisten haben sich Florian Hacke aus Kiel, Martin Valenske und Henning Ruwe aus Berlin, Peter Fischer aus Mannheim, Beier und Hang aus München sowie die Goldfarb-Zwillinge aus Berlin qualifiziert. Sie treten mit jeweils 15-minütigen Beiträgen in der Duisburger Mercatorhalle auf. Das Publikum kann die Auftritte im Internet verfolgen, eine Jury kürt den Sieger. Vergeben wird ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.
Das Finale des Wettbewerbs wird demnach erstmals online ausgetragen, pandemiebedingt fanden bereits die Vorrunden im März digital statt. Damit erfinde sich das "Schwarze Schaf" neu, bleibe sich aber dennoch treu, sagte die Projektleiterin des Wettbewerbs, Bea Fröchte. Über das Online-Format hätten zudem auch Kabarett-Freunde aus anderen Regionen eine Gelegenheit, das Finale zu verfolgen.
Das Kabarettpreis wird alle zwei Jahre in Erinnerung an Hanns Dieter Hüsch (1925-2005) vergeben, der sich selbst als das "Schwarze Schaf vom Niederrhein" bezeichnet hatte. 1999 hatte Hüsch, der als "Poet unter den Kabarettisten" gilt, den Nachwuchswettbewerb ins Leben gerufen. Eigentlich hätte der Preis bereits im vergangenen Jahr vergeben werden sollen, wegen der Corona-Pandemie war dies jedoch nicht möglich.
Neues Studio und App zum 20. Geburtstag von "Wissen macht Ah!"
Köln (epd). Das Magazin "Wissen macht Ah!" feiert in diesem Jahr 20. Geburtstag. Nachdem die Wissenssendung für Kinder am 21. April 2001 erstmals an den Start ging, sind seitdem rund 500 Ausgaben gelaufen, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln mitteilte. Noch vor den Sommerferien werde eine App zur Sendung veröffentlicht. Zudem sollen sich die Moderatoren Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers im Laufe des Jahres erstmals aus einem neuen Studio melden.
Seit 20. April sind den Angaben zufolge auf der Internetseite wissenmachtah.de die 20 besten Sendungen, die 20 witzigsten Verkleidungen und ein Geburtstagsquiz zu finden. Zudem würden Requisiten verlost.
Ab 2022 Start der Regelförderung für junge Kunstformen im Ruhrgebiet
Düsseldorf (epd). Digitale Künste, Urban Art, zeitgenössischer Zirkus und die Clubszene der elektronischen Musik im Ruhrgebiet erhalten ab 2022 eine jährliche Förderung von vier Millionen Euro. "Bei der Förderung der Neuen Künste geht es darum, zukunftsweisende Kunstformen fest im Ruhrgebiet zu verankern", sagte NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos). "Räume für innovative künstlerische Experimente und neuartige Kooperationen sollen das schon jetzt besondere Kulturangebot bereichern." Mit dem Geld sollen den Angaben zufolge Projektvorhaben, Stipendien sowie Veranstaltungsformate gefördert werden.
Die ersten Förderaufrufe in den vier Programmlinien im Projekt "Metropole der Künste Ruhr" sollen demnach voraussichtlich im Sommer 2021 erfolgen. Zudem seien strukturelle Ankerprojekte wie etwa neue Ausbildungs- und Produktionszentren etwa im Bereich Artistik oder Urban Arts geplant, hieß es. Erstmals starte in diesem Sommer das digitale Kunstfestival "The New Now" auf Zeche Zollverein. Mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Akademien in der Region sollten zudem weitere Studiengänge für die Neuen Künste entwickelt werden.
Das nordrhein-westfälische Landeskabinett hatte die "Metropole der Künste Ruhr" im August 2020 als eines der Projekte der Ruhr-Konferenz beschlossen. Vor der Regelförderung ab 2022 habe es bereits erste vorläufige Förderungen gegeben. Ein 16-köpfiger Beirat, mit je drei Vertreterinnen und Vertretern der vier Sparten, begleitet das Projekt.
Zehnter Georg-Dehio-Kulturpreis wird im Oktober verliehen
Potsdam (epd). Der Georg-Dehio-Kulturpreis 2021 geht an die Kulturgemeinschaft Borussia im polnischen Allenstein-Olsztyn und an das Institut für angewandte Geschichte in Frankfurt an der Oder. Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung des Deutschen Kulturforums östliches Europa soll am 7. Oktober in Berlin verliehen werden, teilte das Kulturforum am 20. April in Potsdam mit. Der Georg-Dehio-Kulturpreis wird zum zehnten Mal verliehen.
Der mit 7.000 Euro dotierte Hauptpreis sei der Kulturgemeinschaft Borussia für ihr über drei Jahrzehnte währendes Engagement zur Bewahrung und Vermittlung des kulturellen Erbes in der Woiwodschaft Ermland-Masuren zugesprochen worden, hieß es. Das zivilgesellschaftliche Engagement sei besonders nachhaltig, weil Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für ihre unmittelbare Umgebung und ihre Region wahrnähmen.
Das generationsübergreifende Projekt trage dazu bei, "Ermland und Masuren neu zu denken und dabei den Widerspruch zwischen deutschen und polnischen Zeitschichten zu überwinden", hieß es weiter. Diese Arbeit von unten habe Vorbildcharakter weit über das historische Ostpreußen hinaus und sei besonders in einer Zeit erneut angespannter Beziehungen zwischen Deutschland und Polen wichtig.
Der mit 3.000 Euro dotierte Förderpreis geht an das Institut für angewandte Geschichte, das vor 20 Jahren aus dem Engagement von Studierenden der Europa-Universität Viadrina entstanden sei, hieß es weiter. Das Institut greife Themen auf, die sich auf die schwierigen Verflechtungen von Deutschen, Polen, Juden und Ukrainern im gesamteuropäischen Kontext bezögen.
Entwicklung
Scharfe Kritik an Lieferkettengesetz

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Das geplante Lieferkettengesetz stößt auf breite Kritik. Bei der ersten Lesung des Entwurfs am 22. April im Bundestag in Berlin verlangten Abgeordnete von Grünen und Linken schärfere Regeln. Linken-Politikerin Eva-Maria Schreiber beklagte, dass ein anfangs guter Entwurf verwässert worden sei. Grünen-Parlamentarier Uwe Kekeritz sagte, es sei inakzeptabel, dass die Unternehmensverantwortung für die Umwelt nur halbherzig berücksichtigt werde.
Der FDP-Abgeordnete Carl-Julius Cronenberg kritisierte wiederum die Bürokratie, die wegen des vorgesehenen Risikomanagements und der Dokumentationspflichten auf Unternehmen zukomme. Deutsche Firmen, die in armen Ländern investierten, dort faire Löhne zahlten und für Weiterbildung sorgten, seien nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung, argumentierte er. Der AfD-Politiker Markus Frohnmaier kritisierte das Vorhaben als "Gutmenschentum in Reinkultur": Es sei "absurd", deutsche Unternehmen dazu zu verpflichten, überall auf der Welt als "Lieferkettenpolizei" zu agieren.
Hohe Bußgelder
Für große deutsche Firmen könnte es künftig teuer werden, wenn ihre ausländischen Zulieferer Kinder arbeiten lassen oder Armutslöhne zahlen. Das geplante Gesetz verpflichtet Unternehmen, bei ihren internationalen Partnern auf die Einhaltung von Menschenrechten und auf Umweltschutzkriterien zu achten. Tun sie das nicht, drohen hohe Zwangs- und Bußgelder. Unternehmen, die Ausbeutung billigend in Kauf nehmen, können laut Entwurf zudem bis zu drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. In Kraft treten soll das Gesetz in zwei Schritten: ab 2023 soll es für die etwa 600 großen Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten, ab 2024 für insgesamt knapp 3.000 Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) verteidigten den Entwurf. "Wer global wirtschaftet und global Gewinne macht, muss auch global Verantwortung übernehmen", sagte Heil. Müller fügte hinzu, im Zeitalter der Digitalisierung sei es für große wie für kleine Unternehmen machbar, ihre Lieferketten zu verfolgen. Über den Entwurf war in der Regierung massiv gerungen worden. Heil und Müller wollten unter anderem bereits Betriebe ab 500 Beschäftigten verpflichten, was Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) aber verhinderte.
"Initiative Lieferkettengesetz" fordert Änderungen
Das aus mehr als hundert Organisationen bestehende Bündnis "Initiative Lieferkettengesetz" forderte ebenfalls Nachbesserungen. Kritisiert wurde vor allem, dass mittelbare Zulieferer, die ein Unternehmen nicht direkt beliefern, nicht vorausschauend handeln müssen, sondern erst dann, wenn sie laut Entwurf "substantiierte Kenntnis" von möglichen Menschenrechtsverletzungen haben. DGB-Chef Reiner Hoffmann erklärte, dabei herrschten gerade am Beginn globaler Lieferketten oft katastrophale Arbeitsbedingungen. Die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt", Dagmar Pruin, rief die Abgeordneten auf, dafür zu sorgen, "dass das Gesetz mehr Unternehmen erfasst und durch eine zivilrechtliche Haftungsregelung die Rechte von Betroffenen stärkt".
Kinderrechtsorganisationen richteten ebenfalls einen gemeinsamen Appell an den Bundestag und riefen zu "dringenden Nachbesserungen" auf, um Mädchen und Jungen weltweit wirksam vor Ausbeutung und Gesundheitsschäden zu schützen. Der Anwendungsbereich des Gesetzes müsse auf Unternehmen ab 250 Beschäftigte und auf besonders risikobehaftete Branchen wie den Textilsektor ausgeweitet werden.
Der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV), Franz-Josef Holzenkamp, äußerte derweil die Sorge vor "neuen und unverhältnismäßigen Haftungsrisiken". Anstelle eines deutschen Sonderweges solle auf eine europäische oder globale Lösung gesetzt werden. Der DRV vertritt die genossenschaftlich organisierten Firmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Initiative fordert mehr Schutz für Beschäftigte der Textilbranche

epd-bild / Gordon Welters / Medico International
Dortmund, Berlin (epd). Die "Kampagne für Saubere Kleidung" fordert zum achten Jahrestag des Einsturzes der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ein international rechtsverbindliches Abkommen zum Arbeitsschutz. Das derzeit gültige und nach dem Unglück mit mehr als 1.100 Toten geschlossene Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit ("Bangladesh Accord") laufe Ende Mai dieses Jahres ab, erklärte die Organisation am 20. April in Dortmund. "Der Accord ist sehr wichtig, da er unabhängig und neutral arbeitet und sich sowohl im Ausland als auch bei den Arbeiterinnen und Arbeitern einen guten Ruf und Glaubwürdigkeit erworben hat", erklärte der Vertreter der bangladeschischen Textilgewerkschafter BGIWF, Babul Akhter. Die Vereinbarung stelle sicher, dass Modemarken rechtlich dafür zur Verantwortung gezogen werden, ihre Fabriken sicherzumachen.
Die Koordinatorin der deutschen Kampagne, Artemisa Ljarja, sagte: "Ein internationales verbindliches Abkommen muss unterzeichnet werden, um die effektivsten Elemente des Accords beizubehalten." Die Vereinbarung habe eine echte Veränderung für die Sicherheit von über zwei Millionen Bekleidungsarbeiter und -arbeiterinnen in Bangladesch erreicht.
Mehr als 1.100 Tote
Zum Jahrestages des Unglücks findet eine Gedenkwoche unter anderem mit Online-Diskussionen, -Vorträgen und -Filmvorführungen statt. Der Einsturz des Gebäudes Rana Plaza vom 24. April 2013 gilt als das größte Fabrikunglück in der Geschichte der Textilindustrie. Über 1.100 Menschen starben, mehr als 1.800 wurden verletzt. In dem Gebäude ließen fünf Textilfabriken produzieren.
Das "Bündnis für nachhaltige Textilien" forderte unterdessen, die internationale Textilbranche müsse sich zu fairen Einkaufspraktiken verpflichten. Dann könnten endlich existenzsichernde Löhne, aber auch die soziale Sicherung von Arbeiterinnen und Arbeiter erreicht werden, erklärte Berndt Hinzmann vom Inkota-Netzwerk, das zum Bündnis gehört.
Zudem habe die Corona-Krise die Situation der Beschäftigten verschärft, erklärte das Bündnis. "Rücksichtslose Einkaufpraktiken" von Textil-Marken und Einzelhandelsunternehmen setzten den Textilfirmen zu und verschlechterten die Arbeitsbedingungen in den Fabriken.
Gerd Müller: Menschen in Afghanistan brauchen Perspektive

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) kündigt weitere Hilfen für Afghanistan auch nach Abzug der Bundeswehr an. "Die Menschen brauchen eine Perspektive vor Ort, wenn wir Flüchtlingsströmen vorbeugen wollen", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (23. April). Für die weitere Unterstützung des zivilen Aufbaus wolle die Bundesregierung künftig noch stärker als bisher Nichtregierungsorganisationen einbinden, die besonders eng mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeiten.
Aus Sicht von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sind wichtige Kriegsziele in Afghanistan erreicht worden. Man habe Entwicklungen möglich gemacht, die mit den Taliban an der Macht unvorstellbar gewesen wären, sagte Kramp-Karrenbauer in einem Interview des Deutschlandfunks. Wenn die Taliban weiter regiert hätten, "hätten wir wahrscheinlich bis heute keine Schule für Mädchen, keine Frauen auch in höchsten Ämtern bei Gerichten oder anderen Funktionen".
"Die Vorstellung, dass man aus Afghanistan einen modernen Staat im Sinne des europäischen Levels macht, hat sich allerdings nicht realisiert", schränkte die Minister ein und fügte hinzu: "Das waren auch Ziele, die von Anfang an nicht realistisch waren."
Die Nato hat nach einer entsprechenden Entscheidung der USA beschlossen, am 1. Mai mit dem Truppenabzug aus Afghanistan zu beginnen. Er soll am 11. September abgeschlossen sein. Derzeit sind noch etwa 10.000 Soldaten und Soldatinnen in Afghanistan stationiert, darunter bis zu 1.300 deutsche.
Syrien-Prozess: Nebenklage zieht positive Zwischenbilanz
Koblenz (epd). Ein Jahr nach Beginn des weltweit ersten Prozesses wegen Staatsfolter in Syrien vor dem Oberlandesgericht Koblenz hat die Nebenklage eine positive Zwischenbilanz gezogen. "Die Beweise, die gehört wurden, sind sehr aussagekräftig", sagte der Vertreter der Nebenkläger, Patrick Kroker von der Berliner Menschenrechtsorganisation "European Center for Constitutional and Human Rights" (ECCHR), dem Evangelischen Pressedienst (epd). Anhand von Dokumenten, Fotos und Zeugenaussagen habe das Foltersystem in Syrien als Ganzes aufgedeckt werden können.
"Es ergibt sich ein sehr starkes Bild von der Gesamttat, dem Angriff gegen die Zivilbevölkerung und der Staatsfolter in Syrien", betonte er. Wenn der Prozess weiterhin so zügig verlaufe wie bisher, sei noch in diesem Jahr mit seinem Abschluss zu rechnen.
In dem weltweit bislang einmaligen Koblenzer Prozess mussten sich seit dem 23. April 2020 zwei frühere syrische Geheimdienst-Mitarbeiter wegen Staatsfolter vor einem Gericht verantworten. Ende Februar verurteilte das Gericht bereits einen der Angeklagten, Eyad A., zu viereinhalb Jahren Haft. Der Prozess gegen den Hauptangeklagten Anwar R. wird fortgesetzt.
Er sei bislang sehr zufrieden mit dem Verlauf des Prozesses, sagte Kroker. Positiv sei auch, dass das Gericht dem Antrag stattgegeben habe, sexualisierte Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit in die Anklage aufzunehmen. "Das war für uns ein ganz großer, wichtiger Schritt," sagte der Rechtsanwalt, der neun Nebenkläger in dem Verfahren vertritt.
Prozess für arabische Öffentlichkeit kaum zugänglich
Kritik äußerte Kroker an der aus seiner Sicht mangelnden Zugänglichkeit des Prozesses für die arabische Öffentlichkeit. Das Koblenzer Gericht hatte zwar aufgrund einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht die vom ECCHR geforderte arabische Übersetzung des Prozesses eingerichtet. Allerdings sei sie nur für eine begrenzte Zahl akkreditierter Journalisten zugänglich. "Aus unserer Sicht spräche nichts dagegen, diesen Kreis zu erweitern." Zudem kritisierte Kroker, dass das Gericht eine Audiodokumentation des Prozesses ablehne, die später für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden könnte. "Das Verfahren hat einen historischen Wert. Da vergibt man eine Chance."
Nach der Verurteilung von Eyad A. müsse nun noch die Rolle des Hauptangeklagten Anwar R. herausgearbeitet werden, sagte Kroker. Ihm legt die Bundesanwaltschaft zur Last, zwischen April 2011 und September 2012 für die Folter von mindestens 4000 Menschen und die Tötung von 58 Menschen verantwortlich gewesen zu sein.
Die beiden in Koblenz angeklagten Ex-Geheimdienstler hatten Syrien laut Bundesanwaltschaft vor rund sieben Jahren verlassen und waren 2014 beziehungsweise 2018 nach Deutschland gekommen. Sie wurden im Februar 2019 festgenommen. Nach dem Weltrechtsprinzip können Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall geahndet werden, ganz gleich, wo die Taten verübt wurden.
Kabinett bringt Verlängerung der Mali-Einsätze auf den Weg

epd-bild/Bettina Ruehl
Berlin (epd). Im westafrikanischen Krisenland Mali sollen künftig deutlich mehr Bundeswehrsoldaten eingesetzt werden können. Das Bundeskabinett brachte am 21. April in Berlin eine Verlängerung der beiden Mandate auf den Weg. Dabei ist vorgesehen, die deutsche Beteiligung an der EU-Ausbildungsmission (EUTM) von bisher maximal 450 auf 600 Streitkräfte zu erhöhen. Deutschland übernimmt im Sommer zudem die Führung dieses Einsatzes.
Die Ausbildungsmission wurde schon im vergangenen Jahr intensiviert, um die malischen Soldaten besser gegen Terrorangriffe zu rüsten. In Zentralmali soll nun ein neuer Ausbildungsstützpunkt entstehen. Die Ausbildung von Sicherheits- und Spezialkräften der anderen "G5-Sahel-Staaten" Burkina Faso, Mauretanien, Niger und Tschad ist in dem Mandat ebenfalls erfasst. Im Zuge von EUTM wurden bisher mehr als 13.000 malische Soldaten ausgebildet.
Darüber hinaus ist die Bundeswehr in Mali noch am UN-Blauhelmeinsatz Minusma beteiligt. Hierfür ist im Mandat keine Veränderung vorgesehen, die Obergrenze bleibt bei 1.100 Bundeswehrsoldaten. Mehr als Zehntausend Blauhelm-Soldaten aus über 20 Ländern sind vor Ort, um das Land zu stabilisieren, islamistische Terroristen zu bekämpfen sowie den Friedensvertrag von 2015 zu unterstützen.
Die Mandate für die beiden Einsätze sollen bis Ende Mai 2022 gelten. Der Bundestag muss noch zustimmen.
Weitere Bundeswehreinsätze im Mittelmeer und am Horn von Afrika
Berlin (epd). Der Bundestag hat die Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Mittelmeer und am Horn von Afrika beschlossen. Die Abgeordneten stimmten am 21. April mehrheitlich für die weitere Beteiligung deutscher Streitkräfte an den EU-Marinemissionen "Irini" und "Atalanta" bis Ende April 2022.
Bei der nach einer griechischen Friedensgöttin benannte Mission "Irini" geht es vor allem darum, mit Schiffen, Fluggerät und Satelliten das Waffenembargo gegen Libyen zu überwachen. An der EU-Operation nehmen für ein weiteres Jahr bis zu 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten teil.
Am Horn von Afrika können sich künftig maximal 300 Soldaten an der EU-Mission "Atalanta" beteiligen - bisher waren es 400. Der Einsatz soll die Transporte des Welternährungsprogramms, Seeleute und Handelsschiffe vor Piraten schützen. Durch den Golf von Aden verläuft die wichtigste Handelsroute zwischen Europa, der Arabischen Halbinsel und Asien. Neu hinzu kommen unter anderem die Aufgaben, das Waffenembargo gegen Somalia zu überwachen und den illegalen Drogenhandel zu bekämpfen.
Covid-19: WHO ruft reiche Länder zur Impf-Hilfe für arme Länder auf
Genf, Brazzaville (epd). Die Weltgesundheitsorganisation hat die reichen Länder zur Lieferung überschüssiger Covid-19-Impfdosen an arme Länder aufgefordert. Die reichen Länder könnten so zu einer gerechten Verteilung der Vakzine gegen die Krankheit beitragen, betonte WHO-Regionaldirektorin für Afrika, Matshidiso Moeti, am 22. April während einer Videopressekonferenz in Brazzaville.
Weltweit seien bislang mehr als 600 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. Davon seien nur zwei Prozent in Afrika verimpft worden, kritisierte Moeti. Zwar hätten die meisten Länder Afrikas bereits Vakzine erhalten, aber nur in geringen Mengen. Zehn Staaten Afrikas hätten bereits zwei Drittel ihrer Bestände an Impfstoffen verbraucht.
Moeti lobte die Gesundheitsbehörden und das medizinische Personal in Ghana, Ruanda und Angola. Die Verantwortlichen hätten ihre Vakzin-Bestände zügig verimpft. Die Länder Afrikas beziehen die meisten Impfdosen kostenlos durch das Programm Covax, in dem die Weltgesundheitsorganisation eine führende Rolle spielt.
Fehlende Impfung gegen Masern
Die WHO-Regionaldirektorin wies auch auf den Mangel an Impfstoffen gegen andere Krankheiten hin. Fast 17 Millionen Kinder hätten zwischen Januar 2020 und April 2021 keine Impfung gegen die Masern erhalten. Die Grenzsperren, Transportbeschränkungen und Betriebsschließungen im Zuge der Corona-Pandemie verursachten den Mangel.
In Afrika leben rund 1,3 Milliarden Menschen. Auf dem Kontinent wurden laut WHO bislang 4,5 Millionen Covid-19-Fälle erfasst. Rund 118.000 Menschen seien an oder mit der Krankheit gestorben.
Im Covax-Programm haben sich mehrere internationale Organisationen wie die WHO, das Kinderhilfswerk Unicef und die Impfallianz Gavi zusammengeschlossen, um eine gleichmäßigere Verteilung von Corona-Impfstoffen zu gewährleisten. Fast alle Länder beteiligen sich an dem Programm.
Insgesamt will Covax in diesem Jahr rund zwei Milliarden Impfdosen gegen Covid-19 ausliefern, die meisten davon sind für Entwicklungsländer bestimmt. Allerdings händigte Covax bislang erst 40,5 Millionen Dosen aus. Covax braucht dringend weitere Gelder und seine Verantwortlichen klagen über Lieferengpässe in der Pharmaindustrie. Das WHO-Regionalbüro Afrika hat seinen Sitz in Brazzaville.
200 Hilfsorganisationen fordern mehr Geld für Hungernde
Frankfurt a.M. (epd). Millionen Menschen droht Hilfsorganisationen zufolge der Hungertod, wenn die internationale Hilfe nicht sofort aufgestockt wird. Die von den UN vor einem Jahr veranschlagten 7,8 Milliarden US-Dollar (6,5 Milliarden Euro) für die Unterstützung Hungernder für dieses Jahr sei lediglich zu fünf Prozent gedeckt, kritisierten mehr als 200 Organisationen am 20. April bei der Veröffentlichung eines offenen Briefes an Regierungen und Politiker. Die Zahl der Hungernden steige dramatisch. Konflikte, der Klimawandel, Ungleichheit und zusätzlich die Corona-Krise führten ohne entschiedenes Einschreiten zu zahlreichen Hungersnöten weltweit.
34 Millionen Mädchen, Jungen, Frauen und Männer seien derzeit kurz davor zu verhungern, erklärten die Organisationen. 174 Millionen Menschen in 58 Ländern hätten nicht genug zu essen, eine Zahl, die im Laufe des Jahres nach UN-Berechnungen auf 270 Millionen steigen könnte.
In Ländern wie Jemen, Afghanistan, Äthiopien, Südsudan, Burkina Faso, dem Kongo, Honduras, Venezuela, Nigeria und Haiti arbeiteten Hilfsorganisationen unermüdlich daran, Menschen über jeden einzelnen Tag zu retten. "Diese Menschen verhungern nicht, sie werden verhungert", hieß es in dem Brief. Ihnen werde durch Gewalt, Ungleichheit, Folgen des Klimawandels und des Kampfes gegen die Corona-Pandemie die Möglichkeit genommen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Frauen und Mädchen litten dabei am meisten.
Im Februar hatten UN-Organisationen um zusätzliche Mittel in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar für die Versorgung der Bedürftigsten gebeten. "Diese Summe entspricht in etwa den weltweiten Militärausgaben eines Tages", erklärten die Hilfswerke in ihrem Appell. 2019 hätten die globalen Ausgaben für das Militär bei 1,9 Billionen Dollar gelegen. Dabei seien bewaffnete Konflikte die Hauptursache für den weltweiten Hunger. Die Organisationen riefen alle Beteiligten in Konflikten auf, die Gewalt einzustellen, wie UN-Generalsekretär António Guterres es bereits zu Beginn der Pandemie getan hatte.
Welthungerhilfe ruft wieder zu Benefizlauf gegen Hunger auf
Bonn (epd). Vom 5. bis 9. Mai ruft die Welthungerhilfe wieder zum #ZeroHungerRun auf. Wie im vergangenen Jahr finden die Spendenläufe gegen Hunger wegen der Corona-Pandemie erneut nicht als Großveranstaltungen, sondern als virtuelle Herausforderung statt, wie die Welthungerhilfe in Bonn mitteilte. Sportbegeisterte könnten sich individuell mit einem 30- oder 60-minütigen Lauf um den Häuserblock, durch den Park oder Wald beteiligen und Spenden sammeln. Der Erlös soll Ernährungsprojekten der Welthungerhilfe zugutekommen.
Prominente Läuferinnen und Läufer wie der äthiopische Athlet Haile Gebrselassie, Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen und die Schauspielerinnen Ann-Kathrin Kramer und Liz Baffoe unterstützten den virtuellen Benefizlauf, hieß es. Da die Teilnehmer in diesem Jahr auf das gemeinschaftliche Lauferlebnis verzichten müssten, könnten sie ihre Ergebnisse über die Social-Media-Kanäle der Welthungerhilfe miteinander teilen und mit Fotos dokumentieren.

