Kirchen
Westfälische Kirche bestätigt Präses Kurschus im Amt

epd-bild/Gerd-Matthias Hoeffchen
Bielefeld (epd). Die Theologin Annette Kurschus bleibt für weitere acht Jahre Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die Landessynode bestätigte die 56-Jährige am 20. November in Bielefeld mit über 93 Prozent der Stimmen als leitende Geistliche. Die Synode verabschiedete auch den Haushalt für 2020 und beschloss die völlige Gleichstellung von Trauungen homosexueller Paare mit der Ehe zwischen Mann und Frau. Ein Maßnahmenbündel soll bewirken, dass die viertgrößte deutsche Landeskirche in 20 Jahren klimaneutral ist.
Kurschus erhielt bei ihrer Wiederwahl 149 von 160 Stimmen, sie war die einzige Kandidatin. Als erste Frau war Kurschus 2011 zur Präses der viertgrößten deutschen Landeskirche mit knapp 2,2 Millionen Mitgliedern gewählt worden. Seit 2015 ist die 56-Jährige auch stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm beglückwünschte Kurschus zu ihrer Wahl und erklärte, für die gewinnende und überzeugende Art und Weise, mit der sie ihre Landeskirche, aber auch die gesamte evangelische Kirche repräsentiere, bedeute das gute Wahlergebnis einen kräftigen Rückenwind. "Unsere evangelische Kirche braucht Frauen wie Annette Kurschus in ihrer Leitungsebene." Der rheinische Präses Manfred Rekowski würdigte ihre theologische Kompetenz, die christliche Botschaft in der säkularen Gesellschaft situationsgerecht und verständlich darzulegen.
Anstrengungen beim Klimaschutz
Zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare wurde die Kirchenordnung geändert. Ab Januar wird die Trauung homosexueller Partner eine offizielle Amtshandlung, die auch in die Kirchenbücher eingetragen wird. Die Begriffe Ehemann und Ehefrau werden durch Ehepartner ersetzt. Pfarrer, die Bedenken gegen einen solchen Traugottesdienst haben, sollen nicht gegen ihren Willen dazu verpflichtet werden.
Nach dem Haushaltsbeschluss wird die viertgrößte EKD-Kirche im kommenden Jahr mit einem Gesamt-Etat von 340,3 Millionen Euro wirtschaften, das sind knapp sechs Millionen Euro weniger als in diesem Jahr. Aus Kirchensteuern erwartet die westfälische Kirche kommendes Jahr offiziell Einnahmen in Höhe von 520 Millionen Euro.
Um klimafreundlicher zu werden, sollen kirchliche Umwelt- und Energiemanagementsysteme weiterentwickelt und die Gewinnung erneuerbarer Energien etwa auf Kirchengebäuden und Kirchenland verstärkt werden. "Wir wollen als Kirche unseren konsequenten Beitrag dazu leisten, dass das 1,5 Grad-Ziel noch erreicht wird", erklärte die Landessynode.
Nach einem weiteren Beschluss des Kirchenparlaments sollen Migranten in der Kirche stärker beteiligt werden: Die Anstellung von Theologen aus anderen Ländern soll erleichtert werden, Christen aus anderen Ländern sollen zudem stärker an der Leitung von Gemeinden beteiligt werden. Auf politischer Ebene wandte sich das Kirchenparlament gegen eine Kriminalisierung der Seenotrettung.
Wiedergewählte Präses Kurschus wünscht sich Kirche mit Ausstrahlung

epd-bild//Bernd Tiggemann
Bielefeld (epd). Eine Kirche mit Strahlkraft in die Gesellschaft und Engagement beim Klimaschutz: Dieses Bild hat Annette Kurschus, wiedergewählte Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, für ihre zweite Amtszeit von acht Jahren vor Augen. Die evangelische Kirche werde mit ihrer besonderen Botschaft in den kommenden Jahren eine "noch stärker gefragte Größe in unserer Gesellschaft sein", sagte die 56-jährige Theologin dem Evangelischen Pressedienst (epd).
epd: Sie sind jetzt seit acht Jahren Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Wie haben Sie Ihre erste Amtszeit erlebt?
Annette Kurschus: Als ich vor acht Jahren gewählt wurde, kam ich als reformierte Theologin und Superintendentin aus dem Siegerland vom geographischen Rande unserer Landeskirche. Mit dem neuen Amt habe ich gespannt und mit hohem Interesse die Weite unserer Landeskirche entdeckt mit ihren verschiedenen Mentalitäten und Frömmigkeitsformen. Dabei habe ich unsere Landeskirche regelrecht liebgewonnen. Es ist eine schöne Erfahrung und Aufgabe, unsere westfälische Kirche in dieser Weite zu repräsentieren mit einer klaren und erkennbaren theologischen Haltung. Das Präses-Amt habe ich von Anfang an geistlich akzentuiert, was meine Landeskirche nachdrücklich unterstützt. Dafür bin ich sehr dankbar.
Präses zu sein ist ein schönes Amt, das auch seine Tücken hat. Ich habe eine dreifache Vorsitzfunktion: als Vorsitzende der Landessynode, der Kirchenleitung und des Landeskirchenamts. Das ist eine Herausforderung und hat seine Chancen und Gestaltungsmöglichkeit, die ich gern ausschöpfe. Leiten – und damit Atmosphäre zu prägen – bereiten mir Freude.
epd: Ihre bisherige Amtszeit hat Sie offenbar nicht abgeschreckt. Wie viel Privatleben ist denn neben den Präses-Verpflichtungen möglich?
Kurschus: Die zeitliche Belastung ist hoch. Ich achte darauf, mir gezielt Zeit für Familie, für Freunde und die Musik zu nehmen. Das ist gerade bei diesem hohen Pensum enorm wichtig und ein unverzichtbarer Ausgleich.
epd: Ihr weiteres Amt als stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende mindert die Belastung nicht gerade.
Kurschus: Das stimmt. Allerdings ist die Bereicherung ungleich größer als die Belastung. Deshalb empfinde ich dieses Ehrenamt als Privileg. Beispielsweise lassen die Besuche und Begegnungen in den östlichen Landeskirchen das eigene Tun in neuem Licht erscheinen und machen mir bewusst, wie reich wir beschenkt sind in unserer Kirche. Durch meine Arbeit im Rat kann ich unsere westfälische Kirche stärker sichtbar machen und an Entscheidungsprozessen beteiligen.
epd: Was haben Sie sich für Ihre zweite Amtszeit vorgenommen?
Kurschus: Mein theologisch-geistlicher Akzent wird ein Schwerpunkt bleiben. Eine besondere Herausforderung für meine zweite Amtszeit sehe ich im Bereich der Führung und Leitung, weil das Personal weniger wird und die Strukturen straffer werden. Mein Amtsvorgänger Alfred Buß hat das Bild gebraucht, das Kleid der Kirche müsse enger genäht werden. Dabei ist mir wichtig, dass wir Menschen nicht den Strukturen dienen, sondern die Strukturen den Menschen. Die Herausforderung ist deutlich: Ich möchte, dass unsere westfälische Kirche weiterhin ihre Ausstrahlung als geistliche Orientierungsgemeinschaft behält.
epd: Sie haben angekündigt, auch neue Akzente zu setzen. Wo zum Beispiel?
Kurschus: Wichtig wird sein, die neuen Kommunikationswege unserer Gesellschaft weiter zu entdecken, die insbesondere junge Generation nutzt. Hier wollen wir geeignete Formen finden und Menschen, die sie authentisch pflegen. Dabei gilt es, immer auch kritisch zu fragen, welche Grenzen es dabei für die Kommunikation des Evangeliums gibt. Ich denke da, um nur ein Beispiel zu nennen, an virtuelle Taufen.
Im Klimabereich muss sich einiges zu tun. Und hier denken wir insbesondere an die Verantwortung im eigenen Bereich. Wir werden zunächst vor der eigenen Haustür kehren und dafür Geld in die Hand nehmen. Dabei geht es etwa um alternative Formen dienstlicher Mobilität oder die umweltgerechte Sanierung von Pfarrhäusern und Kreiskirchenämtern.
Auch im Bereich der Migration werden wir unsere Akzente setzen. Ich bin gespannt, wie sich dadurch unsere Kirche und unsere Gemeinden verändern werden. Viele Gemeinden auch in den eher ländlich geprägten Räumen investieren schon seit Jahren viel Kraft und Phantasie, um mit geflüchteten Menschen Gemeinschaft zu leben. Diesen Weg werden wir weitergehen.
epd: Wie wollen Sie das Kirchenvolk bei den anstehenden Veränderungen mitnehmen?
Kurschus: Ich bin überzeugt davon, dass wir eine Durchmischung von Formen kirchlichen Lebens brauchen, bei dem manches Traditionelle neben dem Neuen bestehen bleibt. Gutes und Bewährtes zu erhalten, verstehe ich als kostbare Tugend. Es ist unser Auftrag, die Traditionen unserer Kirche und unseres Glaubens zu pflegen und zugleich mutig Schritte nach vorn gehen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen unsere Kirche dafür gerade in diesen Zeiten des schnellen Wandels schätzen und brauchen. Das Bleiben steht dabei nach meiner Überzeugung für die Treue Gottes – und nicht für eine bestimmte Organisationsform.
epd: Sie wollen "selbstgemachten Regelsystemen" weniger Aufmerksamkeit schenken. Meint das weniger Bürokratie oder den Anfang vom Ende der Amtskirche?
Kurschus: Die Institution Kirche hilft uns in Vielem, weil sie ein organisatorisches Gerüst bereitstellt, innerhalb dessen wir unser kirchliches Leben gestalten können. Manche Vorgänge sind aber so starr geregelt und manche Abläufe so überorganisiert, dass man dafür sehr viel Energie braucht und die Inhalte in den Hintergrund geraten. Das schreit nach einer strikten Vereinfachung. Es braucht mehr Transparenz und Klarheit sowie kürzere und effizientere Wege.
epd: Wie wird die evangelische Kirche am Ende Ihrer zweiten Amtszeit im Jahr 2028 aussehen?
Kurschus: Unsere evangelische Kirche wird in den nächsten Jahren eine noch stärker gefragte Größe in unserer Gesellschaft sein. Unser Glaube lebt von einer Kraft, die nichts und niemand sonst bietet. Wir sind als Kirche dafür da, die Hoffnung lebendig zu halten in der Welt. Wir sind nicht diejenigen, die alles besser wissen, aber die, die der Verheißung trauen, dass Gott Gutes mit uns vorhat. Solches Vertrauen setzt Kraft frei und diese Kraft braucht die Welt nötiger denn je. Vermutlich in acht Jahren mindestens ebenso nötig wie heute.
Recklinghäuser Superintendentin in Kirchenleitung gewählt

epd-West/Gerd-Matthias Hoeffchen
Bielefeld (epd). Die Recklinghäuser Superintendentin Katrin Göckenjan-Wessel wird neues hauptamtliches Mitglied der Kirchenleitung der westfälischen Kirche. Die 57-jährige Theologin setzte sich am 20. November in Bielefeld auf der westfälischen Landessynode mit 114 zu 44 Stimmen gegen den aus Oldenburg stammenden Pfarrer Urs-Ullrich Muther (51) durch. Göckenjan-Wessel tritt die Nachfolge der Personaldezernentin und Oberkirchenrätin Petra Wallmann an, die im April 2020 in den Ruhestand geht.
Rheinischer Präses gratuliert
Der rheinische Präses Manfred Rekowski gratulierte Göckenjan-Wessel und wünschte der Theologin für ihr neues Amt Gottes Segen. Das neue Amt werde ihr Herausforderungen abverlangen, aber auch Gestaltungsmöglichkeiten in einer immer stärker säkularisierten Gesellschaft geben, erklärte Rekowski in seiner Gratulation. Er sei zuversichtlich, "dass es uns gut gelingen wird, die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren Landeskirchen in Ihrem neuen Zuständigkeitsbereich fortzusetzen", fügte Rekowski hinzu.
Göckenjan-Wessel wurde in Münster geboren und war nach dem Theologiestudium in Bielefeld-Bethel und Hamburg Vikarin und Pfarrerin in Gelsenkirchen. Seit 2013 ist sie Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen.
Die Kirchenleitung ist in der Evangelischen Kirche von Westfalen das wichtigste Gremium nach der Landessynode. Die Kirchenleitung führt die Beschlüsse der Synode aus, beaufsichtigt Gemeinden und Kirchenkreise und beruft Menschen in landeskirchliche Ämter. Außerdem hat sie die finanzielle Aufsicht über die landeskirchlichen Einrichtungen.
Die Ergebnisse der westfälische Landessynode
Bielefeld (epd). Die Wiederwahl von Präses Annette Kurschus, die Gleichstellung homosexueller Ehen und das Thema Migration haben die diesjährige westfälische Landessynode beschäftigt, die am 20. November nach viertägigen Beratungen in Bielefeld zu Ende ging. Die wichtigsten Ergebnisse:
* WAHLEN: Präses Kurschus (56) wird mit 149 von 160 Stimmen für weitere acht Jahre als leitende Theologin im Amt bestätigt. Neues Mitglied der Kirchenleitung wird die Recklinghäuser Superintendentin Katrin Göckenjan-Wessel (57). Sie tritt an die Stelle von Personaldezernentin Petra Wallmann (63).
* TRAUUNGEN: Die Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren wird der von Männern und Frauen komplett gleichgestellt. Ehepaare können sich kirchlich trauen lassen, wenn mindestens ein Ehepartner Mitglied der evangelischen Kirche ist. Die Amtshandlung wird in die Kirchenbücher eingetragen.
* MIGRATION: Die westfälische Kirche öffnet sich stärker für Migranten: Die Anstellung von Theologen aus anderen Ländern wird erleichtert, zugewanderte Christen sollen stärker an der Leitung von Gemeinden und an ehrenamtlicher Arbeit beteiligt werden.
* KLIMASCHUTZ: Die Landeskirche will bis zum Jahr 2040 klimaneutral werden. Dazu sollen kirchliche Umwelt- und Energiemangementsysteme eingeführt und weiterentwickelt sowie die Gewinnung erneuerbarer Energien etwa auf Kirchengebäuden verstärkt werden.
* ABENDMAHL: Alle getauften Kinder können künftig am Abendmahl teilnehmen. Noch geklärt werden soll, ob und unter welchen Bedingungen künftig auch nicht getaufte Menschen zum Abendmahl zugelassen werden könnten.
* FINANZEN: Aus Kirchensteuern erwartet die westfälische Kirche mit ihren 27 Kirchenkreisen und 490 Gemeinden kommendes Jahr Einnahmen von 520 Millionen Euro. Größter Ausgabeposten im Gesamthaushalt der Landeskirche ist die Pfarrbesoldung mit 229,3 Millionen Euro. Der Gesamt-Etat hat ein Volumen von 340,3 Millionen Euro, der landeskirchliche Haushalt beläuft sich auf 54,2 Millionen Euro.
* MISSBRAUCH: Opfer von sexualisierter Gewalt sollen gestärkt und die Prävention ausgebaut werden. Demnächst sollen rund 30 hauptamtliche Ansprechpartner und Multiplikatoren zur Verfügung stehen.
* KOMMUNALWAHL 2020: Gemeinden und Kirchenkreise sollen im Wahlkampf lokale Bündnisse für Fairness, Respekt und Toleranz zu bilden, in denen sich Ratsfraktionen, Parteien und andere Akteure zu einem respektvollen Umgang verpflichten.
* WEITERE FORDERUNGEN: Das Kirchenparlament kritisiert eine Kriminalisierung der Seenotrettung und fordert ein weitreichendes Einwanderungsgesetz.
Landeskirchen regeln Trauungen homosexueller Paare unterschiedlich
Bielefeld (epd). Die westfälische Landeskirche will homosexuelle Paare künftig vor dem Traualtar genauso behandeln wie Beziehungen zwischen Frau und Mann. Beide Formen der Trauung wären dann in der Evangelischen Kirche von Westfalen damit völlig gleichgestellt. Jede der 20 evangelischen Landeskirchen, die sich in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zusammenschlossen haben, hat den Umgang mit homosexuellen Paaren für sich geregelt. So kommt es, dass je nach Region unterschiedliche Regeln gelten.
Die Segnung ist mittlerweile fast überall möglich. Lediglich bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe als eine der kleinsten Landeskirchen darf eine Segnung bislang nicht in einem Gottesdienst geschehen. Fast jede Landeskirche sieht aber auch vor, dass Gemeinden und Pfarrer nicht dazu gezwungen werden können, gleichgeschlechtlichen Paaren ihren Segen zu geben.
Bislang entspricht in 13 Landeskirchen die Segnung nun einer kirchlichen Trauung und ist damit auch eine Amtshandlung, die in einem Gottesdienst passiert. Dazu zählen: Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Lippische Landeskirche, die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, die Evangelische Kirche der Pfalz, die Evangelische Landeskirche Baden, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, die Bremische Evangelische Kirche, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, die Evangelisch-reformierte Kirche und die Nordkirche. Hinzu kommt jetzt auch die westfälische Landeskirche.
Segnung in Gottesdiensten
In fünf Landeskirchen sind Segnungen in Gottesdiensten möglich. Sie sind keine Trauungen, werden teilweise aber in eigenen Verzeichnissen festgehalten. Segnungen sind in der Evangelischen Landeskirche Anhalts, in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, in der Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens möglich.
Einen Sonderfall stellt die Evangelische Landeskirche in Württemberg dar. Dort war die Diskussion über die Möglichkeit einer Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in einem Gottesdienst kompliziert, da es in der Landeskirche zwei komplett konträre Auffassungen gibt. Die Synode hat dort im März 2019 aber beschlossen, dass ab 2020 in bis zu einem Viertel der Gemeinden Segnungsgottesdienste nach einer zivilen Eheschließung angeboten werden können. Es gibt also keine gemeinsame Regel.
In der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe sind nur nichtöffentliche Segnungen möglich.
Lippischer Landessuperintendent: Kirche muss Gesicht zeigen

epd-bild/Lippische Landeskirche
Detmold (epd). Der Lippische Landessuperintendent Dietmar Arends hat dazu aufgerufen, als Kirche "Gesicht zu zeigen". Das bedeute, mit der christlichen Botschaft von der freien Gnade Gottes nicht hinter dem Berg zu halten, sagte Arends in seinem Bericht vor der Synode am 25. November in Detmold. Auch angesichts einer geringer werdenden Mitgliederzahl könne nicht darauf verzichtet werden, "missionarisch Kirche zu sein". Das 57-köpfige Kirchenparlament befasste sich zudem mit Reformprojekten in den sogenannten Gestaltungsräumen und dem Haushalt für das kommende Jahr.
Sorge vor zunehmendem Rassismus
Arends äußerte sich besorgt angesichts eines zunehmenden Rassismus. Es sei zutiefst erschreckend, was heute 70 Jahre nach dem Beschluss des Grundgesetzes wieder an menschenverachtenden, fremdenfeindlichen, rassistischen oder antisemitischen Äußerungen bis hinein in die Parlamente möglich sei. Irgendwann würden den Worten Taten folgen, warnte Arends mit Blick auf den rechtsextremistischen Anschlag in Halle.
Der leitende Theologe würdigte zudem das Engagement gegen den Klimawandel, welches etwa die Bewegung "Fridays for Future" zeige. Die Lippische Landeskirche unterstütze die Ziele und werde die Umsetzung des landeskirchlichen Klimaschutzkonzeptes konsequent verfolgen.
Arends kritisierte auch die erschwerten Bedingungen für Kirchenasyle. Seit August 2018 spreche das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Kirchenasylen, bei denen eine Abschiebung in ein anderes europäisches Land drohe, eine Fristverlängerung um ein ganzes Jahr aus. Das bedeute, dass die Kirchenasyle entsprechend länger dauern müssten.
Finanzdezernent mahnt zum sparsamen Wirtschaften
Die Lippische Landeskirche erwartet nach Worten des Juristischen Kirchenrates Arno Schilberg im kommenden Jahr Kirchensteuereinnahmen von rund 35 Millionen Euro. Damit würden die voraussichtlichen Einnahmen etwa auf dem Niveau der Schätzungen für das laufende Jahr liegen. Schilberg mahnte weiterhin zu einem sparsamen Wirtschaften. "Mittel- und langfristig müssen wir uns auf ein Sinken der Mitgliederzahlen und damit auch der Einnahmen einstellen", warnte der Juristische Kirchenrat. Nach Prognosen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) könnte die Zahl der Mitglieder bis 2030 um ein Drittel zurückgehen. Der Haushaltsplan soll am Dienstag verabschiedet werden.
Zudem sollen im nächsten Jahr die ersten Projekte starten, die zukunftsweisende Konzepte ausprobieren, wie Arends ankündigte. Von insgesamt 21 Projektideen für die sogenannten Erprobungsräume wurden zehn vom Landeskirchenamt genehmigt, wie die Projektverantwortliche Dagmar Begemann erläuterte. Bis Ende Februar können weitere Projekte vorgeschlagen werden. Die Landeskirche stellt für die "Erprobungsräume" für die Dauer von fünf Jahren insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.
Diskussion über Auslandseinsätze der Bundeswehr
Das Kirchenparlament befasste sich außerdem mit dem Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr. Aus christlicher Sicht müsse die Gewaltfreiheit im Vordergrund stehen, hieß es in einem der Synode vorliegenden Papier. So sollten gewaltfreie Konfliktlösungen und zivile Konfliktbearbeitung im Umgang mit Krisen im Ausland Vorrang haben. Militärisches Eingreifen wie auch ein Nichteingreifen könne zu Schuld führen, sagte der Landespfarrer Dieter Bökemeier. Das Papier beziehe nicht Stellung für oder gegen militärische Einsätze, sondern benenne christlich verantwortete Kriterien für Einzelfälle.
Oldenburger Bischof wirft AfD Spaltung der Gesellschaft vor

epd-bild/ELKiO/Jörg Hemmen
Rastede (epd). Der oldenburgische Bischof Thomas Adomeit hat der AfD vorgeworfen, die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. "Es scheint, als sollte vorsätzlich ein Keil in unseren gesellschaftlichen Grundkonsens getrieben werden", sagte er am 21. November in seinem Bischofsbericht vor der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. "Es sind rechtsextremistische Kräfte, die an der Spitze dieser Bewegung stehen, es ist eine rechtsextreme Partei, die sich zum politischen Arm dieser Bewegung gemacht hat." Die im ammerländischen Rastede tagende Synode endet am Freitag.
Adomeit mahnte einen überlegten Umgang mit der Sprache in den sozialen Medien an: "Mit Worten lassen sich Liebeserklärungen machen - und auch Kriege beginnen." Niemand dürfe davor Angst haben, aus Furcht vor einem Shit-Storm in den sozialen Medien seine Meinung zu äußern, sagte er unter langanhaltendem Applaus.
Beteiligung an Rettungschiff
Unterstützung erhielt Adomeit vom Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme. Kühme, der auch Mitglied der Synode ist, wird derzeit selbst in den sozialen Medien von Rechtsextremen scharf angegriffen. Die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und das Attentat von Halle zeigten, dass aus Worten Taten folgen könnten, mahnte er. Worte, wie die des AfD-Chefs Alexander Gauland, der die Nazi-Terrorherrschaft als "Vogelschiss der deutschen Geschichte" bezeichnete, förderten solches Verhalten.
Bischof Adomeit kündigte weiter an, dass sich die oldenburgische Kirche mit zunächst 20.000 Euro an der Finanzierung eines Rettungsschiffes der Evangelischen Kirche in Deutschland beteiligen werde. "Es kann nicht sein, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und wir zuschauen." Dass sich die Menschen für die gefährliche Flucht über das Meer entschieden, sei auch der europäischen Wirtschaftspolitik geschuldet, unterstrich der Bischof. "Wir haben unseren Wohlstand in Europa in Teilen auch auf Kosten der ärmeren Länder dieser Welt aufgebaut."
Für eine Kirche an der Küste sei klar: "Menschen in Seenot müssen gerettet werden. Basta." Der Bischof appellierte an die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen sich dem Bündnis für ein Rettungsschiff anzuschließen.
Sächsische Synode ruft nach Bischofsrücktritt zu Einheit auf
Dresden (epd). Nach dem Rücktritt des sächsischen Landesbischofs Carsten Rentzing hat die Landessynode an die evangelisch-lutherischen Christen im Freistaat appelliert, die Einheit der Landeskirche zu wahren. In einer Erklärung betonten die Synodalen am 18. November in Dresden die "wichtige Aufgabe, weiter an einer von Respekt und Wertschätzung getragenen Debattenkultur zu arbeiten". Zur Klärung von Sachfragen seien öffentliche Petitionen gegen Personen und Amtsträger kein geeignetes Mittel.
Rentzing hatte am 11. Oktober sein Amt zur Verfügung gestellt. Wenig später wurde bekannt, dass er als Student antidemokratische Texte verfasst hatte. Das Landeskirchenamt stufte diese als "elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich" ein. Rentzing hat sich von den Texten distanziert. Zuvor war er als Bischof in einer Online-Petitionen aufgefordert worden, sich "von allen nationalen, antidemokratischen und menschenfeindlichen Ideologien" klar abzugrenzen.
Um den Wortlaut der Erklärung vom Montag hatte die Synode in stundenlanger Diskussion gerungen. Strittig war unter anderem, ob in dem Text auf Petitionen überhaupt eingegangen werden soll.
"Beichte, Gnade und Vergebung"
Ferner heißt es in der Erklärung, als ein Weg zum Neuanfang seien "Beichte, Gnade und Vergebung" zu sehen: "Wir haben gelernt, dass der Wille zur Gemeinschaft auch mit Schmerzen und Mühen verbunden ist. Wichtig ist, dass wir einander trotz unterschiedlicher Positionen nicht verurteilen."
Als eine Reaktion auf die Causa Rentzing wird die Kirchenleitung eine Arbeitsgruppe einrichten, die gesellschaftspolitische Begrifflichkeiten klären und einen Gesprächsprozess anstoßen soll. Im Kern soll sie sich mit der "Unterscheidung von wertkonservativem Christsein und Rechtsextremismus" beschäftigen. Ergebnisse sollen der 28. Landessynode, die sich im Sommer 2020 konstituiert, vorgelegt werden.
Die Synode tagt in der Regel zweimal im Jahr in Dresden. Sie ist das gesetzgebende Organ und vertritt in Sachsen 677.000 evangelisch-lutherische Christen. Am 29. Februar und 1. März wählen die 80 Synodalen einen neuen Bischöfin oder einen neuen Bischof.
Berlin: Bischofskreuze kurz vor Amtswechsel gestohlen

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Kurz vor dem Bischofswechsel in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) haben unbekannte Täter zwei wertvolle Bischofskreuze gestohlen. Am 15. November sei der Wagen des zu dieser Zeit noch amtierenden Bischofs Markus Dröge in Berlin-Kreuzberg aufgebrochen worden. Dabei seien zwei versilberte Kreuze und persönliche Gegenstände verschwunden, bestätigte die Sprecherin der Landeskirche, Heike Krohn-Bräuer, am 21. November dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Es habe sich um zwei Bischofskreuze aus der Kaiserzeit gehandelt, mit einer Größe von etwa sieben mal sieben Zentimetern. Dröge hatte beide Kreuze zu unterschiedlichen Anlässen genutzt.
Für Amtsübergabe Kreuz aus Tresor
Der frühere Bischof und sein Chauffeur erstatteten unmittelbar nach dem Diebstahl Anzeige bei der Polizei.
Bei einem Festgottesdienst war Dröge am 16. November aus seinem Amt verabschiedet worden. Zugleich wurde Christian Stäblein als neuer Bischof der Landeskirche ins Amt eingeführt. Für den Bischofswechsel wurde den Angaben zufolge ein weiteres Kreuz aus der Kaiserzeit verwendet, das bislang im Tresor der Landeskirche gelagert war. Dies sei "kein Ersatzkreuz, sondern das Bischofskreuz von Bischof Christian Stäblein", betonte die Sprecherin.
Religionssoziologe: Kirche muss für alle da sein

epd-bild / Norbert Neetz
Münster (epd). Der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack ist skeptisch in Bezug auf politisches Engagement der Kirche. "Kirche muss für alle da sein", sagte Pollack dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im Unterschied zu den politischen Parteien habe sie nicht die Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen, wenn sie angegriffen wird, sondern müsse den Menschen in allen ihren Lebenslagen beistehen. "Eine klare politische Positionierung der Kirche oder der Pfarrer kann sich, auch wenn man damit kurzfristig Menschen zu überzeugen vermag, langfristig nur negativ auf die Verkündigung der Botschaft auswirken", sagte Pollack.
In modernen Gesellschaften legten Menschen verstärkt Wert darauf, ihre Lebensentscheidungen autonom zu fällen, betonte Pollack. Das gelte auch für das Verhältnis vieler Menschen zur Religion: Sie wollten nicht, dass Kirchen über ihren Glauben Macht ausübten. "Der Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben gehört zum Selbstverständnis der Menschen in der Moderne, auch wenn sie sich in ihrer Praxis natürlich von vielen äußeren Umständen beeinflussen lassen, auch von der Kirche", sagte Pollack. Bei einer kürzlich veröffentlichten Umfrage der Evangelischen Kirche von Westfalen hatten zwar 70 Prozent der Befragten angegeben, dass ihnen der Glaube wichtig sei. Zugleich sagten aber 60 Prozent, sie könnten den Glauben ohne Kirche leben.
Fehlende Berührungspunkte im Alltag
Pollack sieht fehlende Berührungspunkte im Alltag als wesentlichen Grund für Gleichgültigkeit gegenüber der Kirche. Glaubensbezüge würden nicht mehr das ganze Leben durchdringen und etwa die Kindererziehung, die politischen Einstellungen oder den eigenen Lebensstil prägen. Begegnungen gebe es nur noch gelegentlich in Krisensituationen, bei der Geburt eines Kindes oder zu Weihnachten.
Kirchen können nach Einschätzung Pollacks attraktiver werden, indem sie selbst Gelegenheiten zum Kontakt schafften. Als Beispiele nannte er soziales Engagement, Diakonie, Bildungsarbeit und Präsenz im öffentlichen Raum. "Insbesondere die Kinder- und Jugendarbeit ist zentral, denn von den religiösen Erfahrungen im Kindes- und Jugendalter hängt in starkem Maße ab, ob man später als Erwachsener eine Beziehung zum Glauben und zur Kirche aufbaut", erläuterte der Forscher der Universität Münster.
Schüller: "Synodaler Weg" kirchenrechtlich ein "Nullum"
Münster, Frankfurt a.M. (epd). Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller hat den am 1. Advent beginnenden "synodalen Weg" in der katholischen Kirche als zu unverbindlich kritisiert. Vor allem gebe es zu wenig Mitspracherecht für die Laien, letztlich hätten wiederum die Bischöfe oder Rom das letzte Wort, sagte der Direktor des Instituts für Kanonisches Recht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster dem Evangelischen Pressedienst (epd). Themen des "synodalen Wegs" sind Macht und Gewaltenteilung, Sexualmoral, Pflichtzölibat sowie die Rolle der Frauen in der Kirche.
"Zunächst ist das kirchenrechtlich keine Synode. Es ist kirchenrechtlich, um es ganz deutlich zu sagen, ein Nullum", fügte der Professor für Kirchenrecht hinzu: "Man spielt Synode, aber es ist keine Synode. Das, was als Beratungs- und Beschlussergebnis am Ende steht, bleibt unverbindlich." Der Vatikan habe zudem schon signalisiert, bei umstrittenen Themen keine Zustimmung zu erteilen, etwa wenn es um die Segnung homosexueller Paare geht. Auch der Diakonat der Frau oder die gegenseitige Einladung zu Eucharistie und Abendmahl kann aus Sicht Roms kein einzelnes Land entscheiden.
Plenarsitzungen im Frankfurter Dom
"Ich habe einigen Verantwortlichen geraten, sie sollten es bitte wenigstens wieder wie in der Würzburger Synode machen, dass wenigstens das, was an Beschlüssen gefasst wird, verbindlich ist. Denn die Beschlüsse der Würzburger Synode waren bindend für die Bischöfe", unterstrich Schüller. Die Synode der westdeutschen Bistümer in Würzburg von 1971 bis 1975 gilt als wichtiges Symbol für Mitbestimmung in der katholischen Kirche. Einzigartig sei damals gewesen, dass man Papst Paul VI. davon überzeugen konnte, abweichend vom geltenden Kirchenrecht für eine Bischofssynode auf nationaler Ebene auch Laien Stimmrecht zu geben, so Schüller.
Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat im Frühjahr im niedersächsischen Lingen beschlossen, sich gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) auf einen "synodalen Weg" zu begeben. Dieser Beratungsprozess ist eine Reaktion auf die vielen Fälle sexuellen Missbrauchs durch katholische Priester.
Für den "synodalen Weg" wird mit einer Laufzeit von zwei Jahren gerechnet. Die erste Plenarversammlung soll Ende Januar 2020 im Kaiserdom in Frankfurt am Main beginnen. "Die Verbindlichkeit in der Umsetzung kommt je nach Materie dem Apostolischen Stuhl und/oder dem Ortsbischof zu", heißt es in den Informationen zum "synodalen Weg" der Bischofskonferenz.
Vatikan stoppt vorläufig Trierer Bistumsreform
Der Vatikan sagt Stopp. Das Bistum Trier kann erst einmal keine neuen Großpfarreien schaffen. Der Katholikenrat reagiert mit "Erschrecken und Unverständnis".Trier, Rom (epd). Das Bistum Trier kann vorerst die Zusammenlegung der rund 900 Pfarreien zu 35 Großpfarreien nicht fortsetzen. Nach Beschwerden stoppte der Vatikan am Donnerstag die Umsetzung des "Gesetzes zur Umsetzung der Diözesansynode 2013-2016", damit der Päpstliche Rat es überprüfen kann. Bischof Stephan Ackermann ließ am 22. November die geplanten Wahlen zum ersten Rat der Pfarrei aussetzen, weil deren Durchführung gegen die Aussetzung verstoßen würde, wie das Bistum mitteilte. Alle weiteren Konsequenzen und Maßnahmen würden nun geprüft, Informationen dazu erfolgten Anfang der kommenden Woche. Der Trierer Katholikenrat reagierte mit "Erschrecken und Unverständnis" auf die Entscheidung aus Rom.
Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hatte das "Gesetz zur Umsetzung der Diözesansynode 2013-2016" zur Schrumpfung der rund 900 Pfarreien Anfang Oktober erlassen. Noch am Mittwoch erließ er die Dekrete zur Errichtung von 15 neuen "Pfarreien der Zukunft". Zum 1. Januar 2020 sollten die Pfarreien Andernach, Betzdorf, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein, Koblenz, Maifeld-Untermosel, Mayen, Neuwied, Sinzig, Saarbrücken, St. Wendel, Tholey, Völklingen, Wadern und Wittlich entstehen. Die 20 weiteren "Pfarreien der Zukunft" sollten zum 1. Januar 2021 starten.
Trierer Katholikenrat: Aussetzung kommt zum falschen Zeitpunkt
Auslöser für die Aussetzung ist den Angaben zufolge die Beschwerde der Priestergemeinschaft Unio Apostolica. Zudem hatten einige Gläubige einen Antrag gestellt, die Übereinstimmung des Umsetzungsgesetzes mit dem universalen Kirchenrecht zu prüfen. Die geplante Reform habe erhebliche Konsequenzen für das kirchliche Leben, heißt es in dem Schreiben an das Bistum. Die Kongregation hoffe auf eine friedliche Lösung. Ackermann werde, wie von der Kongregation erbeten, Stellung zur Beschwerde der Priestergemeinschaft Unio Apostolica nehmen, teilte das Bistum mit.
"Einige wenige Menschen in unserem Bistum haben für sich entschieden, das, was synodal in unserem Bistum als Antwort auf die Fragen nach einer zukunftsfähigen Trierischen Kirche erarbeitet wurde, durch Rom überprüfen zu lassen", erklärte der Katholikenratsvorsitzende Manfred Thesing. Die von Rom verfügte Aussetzung sei per se weder positiv noch negativ, jedoch komme sie zum "absolut falschen Zeitpunkt".
Natürlich gebe es umstrittene Punkte und Korrekturen seien im Verlauf der Zeit nötig, jedoch hätten die "Pfarreien der Zukunft" etwa durch eine Synodalversammlung und durch die mandatierten Mitglieder des Rates der Pfarrei dazu die Möglichkeit, betonte Thesing. "Schade, dass wir jetzt auf die Bremse treten müssen." Der Katholikenratsvorsitzende appellierte an alle Beteiligten, die sich voller Tatendrang auf den Weg gemacht hätten, "nicht den Wagenstopp zum Anlass zu nehmen, auszusteigen". "Es wird, es muss weitergehen", erklärte er.
Ackermann hatte im Dezember 2013 eine Synode eingesetzt, um über eine Neuausrichtung des Bistums zu beraten. Im Mai 2016 hatte sie ihr Abschlussdokument "heraus gefordert - Schritte in die Zukunft wagen" verabschiedet. Damals war zunächst eine Schrumpfung auf 60 Großpfarreien vorgesehen, die aber unter anderem wegen einer bestimmten Minimalgröße auf die Zahl 35 korrigiert wurde. Die Reform gilt als umstritten. So hatte sich unter anderem die Initiative "Kirchengemeinde vor Ort" gegründet und zu Protesten aufgerufen.
Kirche: Weihnachtsmärkte sollen nicht vor Totensonntag öffnen

epd-bild/Heike Lyding
Frankfurt a.M. (epd). Die Eröffnung von Weihnachtsmärkten vor Totensonntag tut der Gesellschaft nach Einschätzung des Bonner Pfarrers Oliver Ploch nicht gut. Der Vorwurf, die Kirche sei ein "Spielverderber", sei oberflächlich. Letztlich sei eine Ausdehnung der Adventszeit "zerstörerisch" für alle, sagte der Pfarrer der Thomas-Kirchengemeinde in Bonn-Bad Godesberg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Wenige Tage vor Totensonntag hatten etwa in Bonn, Duisburg und Freiburg einige Weihnachtsmärkte bereits geöffnet.
Aus kaufmännischer Sicht mache die frühzeitige Eröffnung möglicherweise Sinn, sagte Ploch. Man dürfe sich daher nicht vom Handel leiten lassen. Eines Tages wirke sich eine verlängerte Vorweihnachtszeit auch schlecht auf die Wirtschaft auf, so der evangelische Theologe. Bei einigen Menschen herrsche schon jetzt ein "Aggro-Gefühl", wenn im September die Schokoladen-Nikoläuse in den Regalen stehen.
Laut einer Studie des Deutschen Schaustellerbunds von Ende Dezember 2018 steigt die Zahl der Weihnachtsmärkte in Deutschland. Etwa 3.000 private und öffentliche Weihnachtsmärkte gibt es demnach in Deutschland. 2012 waren es noch 2.500. Der Schaustellerbund zählte in seiner Studie 159,7 Millionen Weihnachtsmarktbesuche und nannte einen Umsatz von 2,88 Milliarden Euro auf Weihnachtsmärkten.
"Alles hat seine Zeit"
Die Vorweihnachtszeit zu verlängern, möge zwar auf den ersten Blick verlockend sein, lasse aber die gewohnten Rhythmen verschwimmen, sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dem epd und ergänzte: "Es tut gut, mit abgegrenzten Zeiten, die unser Leben gliedern, zu leben." "Alles hat seine Zeit", betonte er und verwies auf eine entsprechende Bibelstelle (Prediger 3, 1-8).
Aus Sicht des Bonner Pfarrers Ploch hat der Schutz des Totensonntags auch etwas mit Rücksicht auf andere zu tun. Auch wenn einem selbst nach Feiern zumute sei, würden andere vielleicht lieber trauern wollen. Es sei schwer, eine individualisierte und säkularisierte Gesellschaft davon zu überzeugen, sagte Ploch. Viele wollten sich nichts vorschreiben lassen. Trauer habe heutzutage ohnehin kaum noch Platz, sagte der Pfarrer. Da sollten die wenigen Tage der Besinnung wenigstens eingehalten werden.
Der Totensonntag ist ein stiller Feiertag, das heißt, er ist durch die Feiertagsgesetzgebung der Bundesländer besonders geschützt. Öffentliche Weihnachtsmärkte müssen demnach an diesem Tag geschlossen bleiben. An dem Gedenktag sollen Menschen Trost finden, wenn im vergangenen Jahr der Verlust eines Angehörigen oder eine Trennung zu beklagen war.
Notlösung mit Kuschelfaktor

epd-bild/Uta Grossmann
Gründau (epd). Ein trüber Novembertag, kurz nach neun Uhr in Mittel-Gründau. Gut ein Dutzend Gemeindemitglieder haben sich zum Gottesdienst versammelt - an einem dafür ganz und gar ungewöhnlichen Ort. Ein Reisebus wartet mit geöffneten Türen auf die Gläubigen, davor lädt ein Banner zum "Einsteigen" ein. Friedel Hammer hat den Bus an diesem Sonntag hergefahren. Auf seinem Platz ganz vorn sitzt Leon Harms, der für die Musik zuständig ist. Denn natürlich passt in den Bus keine Orgel. Die Begleitung für die Lieder kommt von einer CD.
Eine technische Panne mitten im Gebet, als plötzlich eine ungeplante Nachricht über den Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton erklingt, nimmt keiner krumm. Überhaupt ist die Stimmung locker und freundlich. Die Enge im Bus macht es "kuscheliger", findet Gottesdienst-Besucher Carsten Grau. Edmund Steinbring pflichtet ihm bei und lobt das Touristik-Unternehmen, das den Bus zur Verfügung stellt. Es sei zwar eine Notlösung, doch das Improvisierte gefällt den gut ein Dutzend Gläubigen, die sich aufgemacht haben zum gemeinsamen Beten und Singen und Predigt-Lauschen.
Einfach "gemütlicher"
Sogar ein paar Konfirmanden haben sich nicht gescheut, in aller Herrgottsfrühe aufzustehen. Jan Laubach, einer von ihnen, war schon beim ersten Gottesdienst im Bus dabei. Ende September war das, und die Kirchgänger sind damals von der alten Kapelle in den warmen Bus mit den 50 gepolsterten Sitzen umgezogen. Er und die anderen Jugendlichen haben sich heute ganz hinten Plätze gesucht. Johanna Faß hat ihr eigenes Gesangbuch mitgebracht, obwohl auch welche ausliegen. Amelie Steinborn und Luca Schöbel schätzen die "andere Atmosphäre", es sei im Bus einfach "gemütlicher".
Pfarrerin Ligaya Jardas hält zum ersten Mal einen Gottesdienst im Bus, Pfarrerinnen und Pfarrer der Kirchengemeinde wechseln sich an den Sonntagen ab. Sie steht mit Mikrofon im schwarzen Talar mit weißem Beffchen vor einem hölzernen Klappaltar. Den hat ein Schreiner aus Rothenbergen eigens für die Bus-Gottesdienste angefertigt, er kann leicht ein- und ausgebaut werden. Ein Altarbehang, eine LED-Kerze und eine Bibel können den Bus nicht in eine Kirche verwandeln, doch sie reichen aus, um den sakralen Zweck der Zusammenkunft zu symbolisieren.
Kreativer Umgang mit der Situation
Die Gemeinde honoriert den kreativen Umgang mit der Situation, seit sie ohne Kapelle dasteht. Mittel-Gründau gehört zur evangelischen Kirchengemeinde Auf dem Berg. Der Ortsteil gehört zur 14.600-Einwohner-Gemeinde Gründau im Main-Kinzig-Kreis. Mit fast 8.000 Gemeindegliedern ist die Kirchengemeinde Auf dem Berg nach eigenen Angaben die größte der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Doch berühmt wird sie erst jetzt, seit die baufällige Kapelle am Friedhof geschlossen werden musste und die Gläubigen sich alle 14 Tage im Bus auf die Reise zu Gott machen. Zwei Fernsehsender wollen demnächst mit Kameras anrücken.
"Bei der Kapelle von 1976 gab es einen Sanierungsstau", erzählt Kerstin Berk, Pfarrerin von Mittel-Gründau. Die Kirche wollte die Kosten von 600.000 bis 700.000 Euro für eine Instandsetzung nicht zahlen. Sie versuchte, die Kapelle an die Kommune zu verkaufen. Denn die Gemeinde Gründau nutzte sie auch als Trauerhalle. Nach drei Jahren ergebnisloser Verhandlungen entschloss sich die Kirchengemeinde, die Kapelle endgültig zu schließen.
Benzingeld
Danach war guter Rat teuer. Wo beten am Sonntag? Pfarrerin Berk hatte die Idee, die Sonntags-Gottesdienste in einen Bus zu verlegen. "Es gibt in Mittel-Gründau kaum geeignete Räume", begründet Berk die ungewöhnliche Ortswahl. Kirchenvorsteher Christopher Hustedt fragte den Busunternehmer Ilario Favaro aus Breitenborn, ob er einen seiner Reisebusse ausleihen könne. Der "tiefgläubige Katholik", sagt Berk, habe sofort zugesagt. Bis Ostern stellt er einen Bus samt Fahrer alle zwei Wochen für den Sonntags-Gottesdienst zur Verfügung. Die Kirchengemeinde muss lediglich fürs Benzin aufkommen.
Für die anstehenden großen Festtage hat die Kirchengemeinde schon Lösungen gefunden. Heiligabend wird in der Mehrzweckhalle in Mittel-Gründau gefeiert, an Silvester dürfen die Gläubigen ins Sportlerheim. Am 23. Februar ist ein Faschings-Gottesdienst geplant, mit Kräppeln und Umtrunk. Dann rollt der Bus tatsächlich während der Feier durch alle Ortsteile der kreativen Kirchengemeinde Auf dem Berg.
Ökumenischer Predigtpreis verliehen
Bonn (epd). Die Religionswissenschaftlerin Regina Laudage-Kleeberg aus Münster hat den diesjährigen ökumenische Predigtpreis erhalten. Die Referentin für Kinder, Jugend und junge Erwachsene beim Generalvikariat des Bistums Essen wurde am 20. November in der Bonner Schlosskirche für die beste aktuelle Predigt ausgezeichnet. Den Predigtpreis für sein Lebenswerk erhielt der Würzburger Homiletiker Erich Garhammer. Unter Homiletik versteht die Wissenschaft die Theologie der Predigtlehre. In der neuen Kategorie "Junge Predigt" wurden Magdalena Prinzler (Karlsruhe) und Daniel Steigerwald (Heidelberg) geehrt.
Der undotierte ökumenische Predigtpreis würdigt seit 20 Jahren traditionell am Buß- und Bettag die Redekunst in den Kirchen. Zu den bisherigen Trägern in der Kategorie Lebenswerk zählen unter anderen Margot Käßmann, Hanns Dieter Hüsch und Walter Jens.
Theologin Plonz erhält Preis für Frauen- und Genderforschung
Münster/Graz (epd). Die an der Universität Münster lehrende evangelische Theologin Sabine Plonz erhält den "Elisabeth-Gössmann-Preis für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung". Die Auszeichnung werde ihr für ihre 2018 erschienene Habilitationsarbeit "Wirklichkeit der Familie und protestantischer Diskurs" verliehen, teilte die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Graz (Österreich) mit. In ihrem Buch gehe sie dem Wandel der modernen Familie und der protestantischen Ethik nach.
Plonz ist den Angaben zufolge Privatdozentin für evangelisch-theologische Ethik an der Universität Münster. Zuvor war sie als Theologin in überregionalen Einrichtungen sowie als Pfarrerin in der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland tätig. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis werde ihr am 10. Dezember im Rahmen des Symposiums "Genderforschung - brauchen wir das?" der Universität Graz überreicht.
In ihrer Habilitationsschrift zeige die in Coesfeld lebende Theologin, dass Kirche und Theologie zwar immer den hohen sittlichen Wert der Familie als Keimzelle der Gesellschaft betont hätten, hieß es. Dies sei jedoch meist aus patriarchalischen, nationalistischen und antidemokratischen Motiven geschehen.
Die protestantische Ethik wie auch der deutsche Wohlfahrtsstaat haben laut Plonz lange nicht in den Blick genommen, wie Familien wirklich leben und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Dies ändere sich erst in jüngster Zeit. Christliche Ethik und Kirchen sollten sich aus Sicht der Wissenschaftlerin für eine Sozialpolitik einsetzen, die Verantwortung und Fürsorge zwischen den Generationen stärke, unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Familienform.
Der seit 2001 verliehene Elisabeth-Gössmann-Preis dient nach Angaben der Grazer Fakultät der Nachwuchsförderung. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Fakultätsschwerpunktes "Theologische Frauen- und Genderforschung" sei er 2019 international ausgeschrieben worden.
Eva Röthig wird Leiterin der "Schule für Circuskinder in NRW"
Düsseldorf (epd). Die "Schule für Circuskinder in Nordrhein-Westfalen" bekommt eine neue Leiterin. Die Pädagogin Eva Röthig übernimmt zum 1. August kommenden Jahres die Leitung der Schule, wie die Evangelische Kirche im Rheinland als Trägerin der Einrichtung am 22. November in Düsseldorf mitteilte. Die 52-Jährige tritt die Nachfolge von Annette Schwer an, die in den Ruhestand geht.
Eva Röthig ist bereits seit der Gründung der Schule im August 1994 dort als Lehrerin im Einsatz. Seit 2004 ist sie auch Mitglied der erweiterten Schulleitung. Hier koordiniert sie den Angaben zufolge vor allem die Organisation des Schulalltags für das Kollegium, plant Fortbildungen und entwickelt neue Lernkonzepte im Hinblick auf individualisiertes Lernen im digitalen Zeitalter. "Als neue Schulleiterin will ich das Ziel der Bildungsgerechtigkeit für Kinder beruflich Reisender weiter verfolgen und dabei besonders neue Wege des Lernens und Lehrens im digitalen Zeitalter beschreiten", sagte Röthig.
Die Pädagogin wurde 1967 in Iserlohn-Letmathe geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. Röthig hat Biologie und Mathematik für das Lehramt der Sekundarstufe I an der Universität Dortmund studiert.
In der "Schule für Circuskinder in NRW" kommen die Lehrkräfte zu ihren Schülerinnen und Schülern an die Gastspielorte der Zirkusse. Der Unterricht findet in rollenden Klassenzimmern – umgebauten Wohnmobilen und -anhängern – und übers Internet statt. 30 Lehrkräfte unterrichten die Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von fünf bis 21 Jahren in Kleingruppen.
Rekowski und Woelki laden zu ökumenischer Vesper
Köln, Düsseldorf (epd). Der rheinische Präses Manfred Rekowski und der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki laden zu einer ökumenischen Vesper am 30. November in die Kölner Basilika St. Aposteln ein. Die gemeinsame Vesper am Beginn eines jeden neuen Kirchenjahres folge einer langjährigen Tradition, teilte die Evangelische Kirche im Rheinland am 21. November mit. Während die Adventsvesper traditionell in Köln stattfinde, sei die ökumenische Feier zu Beginn der Passionszeit in der evangelischen Johanneskirche in Düsseldorf. Es predige jeweils der Gast.
Missbrauchsfälle im Bistum Münster: Bischof Genn entschuldigt sich
Münster/Köln (epd). Nach dem Bekanntwerden weiterer Fälle von sexuellem Missbrauch im katholischen Bistum Münster hat sich Bischof Felix Genn für entstandenes Unrecht entschuldigt. "In meiner Verantwortung als Bischof von Münster muss ich in diesem Fall deutlich sagen: Ich habe Fehler gemacht!", schreibt Genn in einem am 22. November verbreiteten Offenen Brief an die Gemeindemitglieder. So habe ihm die Einsicht gefehlt, dass ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Priester grundsätzlich nicht mehr seelsorgerlich eingesetzt werden dürfe.
Genn versicherte in dem Brief, dass verurteilten Missbrauchstätern künftig alle priesterlichen Dienste im Bistum untersagt werden. Auch werde er prüfen lassen, in welchem Umfang weitergehende Strafen wie Gehaltskürzungen oder andere Auflagen möglich seien: "Das ist die Leitschnur, für die ich stehe und die ich umsetzen werde."
Genn bezieht sich in dem Brief konkret auf zwei Fälle: So war ein Priester des Erzbistums Köln trotz zweimaliger Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs jahrzehntelang weiter seelsorgerisch tätig gewesen, darunter auch in Münster. Nach einer Bewährungsstrafe arbeitete der heute 85-Jährige den Angaben nach von 1989 bis 2002 als Altenheimseelsorger in Köln und in seinem Ruhestand bis 2015 als Ruhestandsgeistlicher.
Gegen Auflagen verstoßen
Anfang November war zudem ein Missbrauchsfall in einer katholischen Gemeinde in Kevelaer öffentlich gemacht worden. Einem heutigen Pfarrer im Ruhestand wird vorgeworfen, in seiner Zeit als Kaplan Mitte der 80er Jahr ein Mädchen über längere Zeit sexuell missbraucht zu haben. Seit 2010 ist das Bistum über den Fall informiert, auf Wunsch der Betroffenen war aber die Staatsanwaltschaft nicht informiert worden. Der Priester verstieß danach mehrfach gegen die Auflage des Bistums, keine großen öffentlichen Gottesdienste mehr zu halten. Inzwischen hat sich laut Bischof Genn eine weitere betroffene Frau gemeldet.
Das Bistum lässt derzeit den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch katholische Priester im Zeitraum von 1945 bis 2018 von Historikern der Universität Münster wissenschaftlich aufarbeiten.
Sexueller Missbrauch im Bistum Limburg wurde vertuscht
Limburg (epd). Im katholischen Bistum Limburg wurde sexueller Missbrauch vertuscht. Das geht aus einer Untersuchung des früheren Limburger Landgerichtspräsidenten Ralph Gatzka hervor, wie das Bistum am 20. November mitteilte. Im Auftrag von Bischof Georg Bätzing habe Gatzka den Vorwurf der Vertuschung eines Betroffenen geprüft, der sich im vergangenen Jahr an das Erzbistum Bamberg gewandt und den Missbrauch durch einen Priester des Bistums Limburg öffentlich gemacht hatte.
Nach den Erkenntnissen des Juristen offenbarte sich das Opfer 1997 erstmals einer Vertrauensperson, die den beschuldigten Priester aufforderte, seine Taten einzugestehen, sich aus der Pfarrseelsorge zurückzuziehen und sich seinen Vorgesetzten gegenüber zu erklären. Dies habe zu zwei Besuchen des damaligen Limburger Personaldezernenten im Haus der Vertrauensperson und zu Gesprächen mit dem Opfer geführt. Dabei sei es darum gegangen, dem Opfer einen Therapieplatz zu vermitteln und den Priester zu einer mehrmonatigen psychotherapeutischen Behandlung zu schicken.
Keine Anzeige
Außerdem habe der Personalverantwortliche versucht, ein "Absehen des Opfers von einer Strafanzeige gegen den Priester zu erreichen". Dies sei gelungen, denn das Opfer habe keine Strafanzeige gestellt. Auch habe das Bistum die staatlichen Ermittlungsbehörden nicht eingeschaltet. Laut Gatzka enthält die Personalakte des Priesters keinen Hinweis auf den erhobenen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs und die vor diesem Hintergrund geführten Gespräche. "Dass die Bistumsspitze, also Bischof und Generalvikar, informiert worden wären, lässt sich der Personalakte nicht entnehmen."
Nach der Therapie sei der Priester wieder an alter Wirkungsstätte eingesetzt worden. Er habe keinerlei Auflagen erhalten, und es habe keine Hinweise über die Missbrauchsvorfälle an seine direkten Vorgesetzten gegeben. Die Vorwürfe seien auch beim Wohnortswechsel und bei der Versetzung in eine andere Diözese unerwähnt geblieben.
"Schwerwiegende Fehler"
In einer persönlichen Erklärung bedauere der damals verantwortliche Personaldezernent Helmut Wanka seine "schwerwiegenden Fehler" und entschuldige sich beim Betroffenen, sagte Bistumssprecher Stephan Schnelle. Auch Altbischof Kamphaus (87) habe sich in einer persönlichen Erklärung zum Thema sexueller Missbrauch im Bistum geäußert. Ihn belaste seit langem der Fall des mittlerweile aus dem Klerikerstand entlassenen Wolfdieter W., der Mitte der 1980er Jahre aus dem Bistum Würzburg ins Bistum Limburg gekommen sei.
Obwohl es Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs aus der Vergangenheit gab, habe er W. eine Pfarrei im Westerwald übertragen, schreibt Kamphaus. "Der Einsatz dieses Priesters in der Seelsorge des Bistums Limburg und seine spätere Versetzung in ein anderes Bistum waren schwere Fehler. Opfern wäre Missbrauch erspart geblieben. Hier habe ich schwere Schuld auf mich geladen. Dafür bitte ich in aller Form um Verzeihung."
Initiative "Maria 2.0" erhält Unterstützung durch neue Zeitschrift
Hamm (epd). Die neue Zeitschrift "Maria 2.0" soll die gleichnamige katholische Fraueninitiative bei ihren Aktionen unterstützen. Die erste Ausgabe werde am 29. November erscheinen, kündigte die Liborius-Verlagsgruppe in Hamm an. Die Publikation solle den Handelnden bei "Maria 2.0" eine Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung bieten.
Herausgeber der Zeitschrift sind den Angaben zufolge die Mitbegründerinnen der Initiative "Maria 2.0", Andrea Voß-Frick und Lisa Kötter. Verlag und Initiative wollen sich demnach gemeinsam für die Veränderung der katholischen Kirche einsetzen. Die Zeitschrift solle die positiven Reaktionen auf die Reformbewegung ebenso spiegeln wie den Widerspruch. "Maria 2.0" ist nach Verlagsinformationen zunächst ausschließlich als Printausgabe im Abonnement erhältlich.
Die Initiative "Maria 2.0" setzt sich für mehr Beteiligung und Rechte von Frauen in der katholischen Kirche ein. Sie fordert mehr Gleichberechtigung von Frauen und ihren Zugang zu allen kirchlichen Ämtern. Im Mai hatten Frauen in vielen deutschen Bistümern in einem Kirchenstreik eine Woche lang ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Einrichtungen der katholischen Kirche eingestellt und keine Kirche betreten. Ausgangspunkt der Aktionen war Münster.
Buch über juristische Fragen im Staats-Kirchen-Verhältnis in NRW
Düsseldorf, Detmold (epd). Unter dem Titel "Staat und Religion in Nordrhein-Westfalen ist ein neues Buch über die rechtlichen Grundlagen des Verhältnisses von Staat und Kirche auf Landesebene erschienen. Herausgegeben haben es Arno Schilberg, juristischer Kirchenrat der Lippischen Landeskirche, und Burkhard Kämper, Justiziar und stellvertretender Leiter des Katholischen Büros NRW, wie die Lippische Landeskirche mitteilte. In 41 Einzelbeiträgen gehe es unter anderem um Kitas, Ladenschluss, Friedhofsordnungen, Denkmalschutz und weitere juristische Themen.
"Ein Großteil der Rechtsbeziehungen des Staates zu Religion und Kirchen ist landesrechtlich geregelt, deshalb war es Zeit für ein solches Buch", erklärte Schilberg. Als Autoren habe man ausschließlich einschlägige und namhafte Praktiker gewinnen können.
Das Buch "Staat und Religion in Nordrhein-Westfalen" ist im Aschendorff Verlag, Münster, erschienen und für 39,90 Euro im Buchhandel erhältlich.
Urban Gardening auf alten Gräbern
Berlin (epd). In Berlin sollen brachliegende Friedhofsflächen verstärkt für Erholungs- und Bauprojekte genutzt werden. Grund sei die sich verändernde Bestattungskultur, sagte der Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbandes Berlin Stadtmitte (EVFBS), Pfarrer Klaus-Ekkehard Gahlbeck, dem Evangelischen Pressedienst (epd) anlässlich des Ewigkeits- oder Totensonntag (24. November). An diesem Tag wird in der Kirche besonders an die Toten erinnert.
Die Zahl der Urnenbeisetzungen steige kontinuierlich, sagte Gahlbeck: "Früher war das Verhältnis zwischen Erdbeisetzungen und Urnenbeisetzungen etwa bei 80 zu 20. Heute ist es genau umgekehrt."
Der Friedhofsverband verwaltet in der Berliner Innenstadt 46 Friedhöfe und entwickelt Nachnutzungsmöglichkeiten für brachliegende Flächen. Das Spektrum reicht von Urban Gardening Projekten - also dem gemeinschaftlichen Gärtnern in der Großstadt - über eine Gedenkstätte für das bundesweit einzige kirchliche Zwangsarbeiterlager im Zweiten Weltkrieg bis hin zum Bau von Flüchtlingsheimen sowie sozialen Wohnungsbau. Die Projektfülle innerhalb eines Friedhofsverbandes ist Gahlbeck zufolge bundesweit einzigartig.
In Berlin müsse für Nachnutzungen von ehemaligen Grabfeldern eine Ruhefrist von mindestens 20 Jahren als Pietätsfrist eingehalten werden, erklärte der Pfarrer. Danach gebe es eine weitere zehnjährige Pietätsfrist, die nur vom Berliner Senat aufgehoben werden könne.
Hochwertige Grünflächen schaffen
Der Friedhofsverband will im Zentrum Berlins brachliegende Friedhofsflächen zu zwei Dritteln für "grüne Projekte" nutzen. So gibt es ein Urban Gardening Projekt im Stadtbezirk Neukölln. In Berlin-Kreuzberg ist ein Friedhofspark geplant, zu dem zahlreiche denkmalgeschützte Wandgräber von historischen Persönlichkeiten zählen. Ziel sei es, hochwertige Grünflächen zu schaffen und die Biodiversität zu erhöhen.
Ein Drittel der Friedhofsbrachen in der Berliner Innenstadt soll als Bauland oder für Infrastrukturprojekte zur Verfügung gestellt werden, sagte Gahlbeck. Dazu zähle der Bau von öffentlichen Schulen, Kitas und Spielplätzen. In Kreuzberg und Neukölln sollen im kommenden Jahr zwei Flüchtlingswohnheime für insgesamt rund 350 Bewohner entstehen.
Im Stadtteil Weißensee und Neukölln sind zwei soziale Bauprojekte geplant. Diese seien genossenschaftlich organisiert. "Wir wollen der Spekulation Einhalt gebieten", betonte der EVFBS-Geschäftsführer: "Gerade für die Menschen wollen wir etwas entwickeln, die in dieser Stadt so extrem schlechte Chancen haben."
Kirchenkreise
Angefeindet: Homosexueller Pfarrer verlässt Gemeinde

epd-bild / Stephan Wallocha
Vlotho/Bad Oeynhausen (epd). Seinen Entschluss habe der Theologe in einer öffentlichen Gemeindeversammlung bekanntgegeben, teilte der Kirchenkreis Vlotho am 21. November auf seiner Internetseite mit. Der Superintendent des Kirchenkreises, Andreas Huneke, äußerte demnach sein Bedauern über die Entscheidung und verurteilte die Anfeindungen gegen den Pfarrer und seinen Ehemann"aufs Schärfste", diese seien "inakzeptabel".
Der Kirchenkreis Vlotho stehe uneingeschränkt hinter dem Vlothoer Pastor, erklärte Huneke. Der Theologe ist seit drei Jahren in der lutherischen Kirchengemeinde St. Stephan tätig. Er sei ordentlich vom Presbyterium gewählt worden und das müsse respektiert werden, betonte der Superintendent. Wer nicht in einer Gemeinde mit einem homosexuellen Pfarrer leben wolle, könne selbstverständlich in eine andere Gemeinde wechseln, fügte Huneke hinzu.
Der betroffene Pfarrer betonte laut der Mitteilung, dass es in der Gemeinde viele Menschen gebe, die ihn stets unterstützt und offen aufgenommen hätten: "Die Gemeinde ist grundsätzlich aufgeschlossen und vor allem mit dem Presbyterium hatte ich immer eine gute Zusammenarbeit." Gerade für diese Menschen tue ihm die Entscheidung zum Weggang leid.
Auf der Gemeindeversammlung schilderte der Pastor laut einem Bericht des in Bielefeld erscheinenden "Westfalen-Blattes" (21. November), dass er und sein Mann, mit dem er zusammen im Pfarrhaus lebt, von Anfang an angefeindet wurden. Einzelne Menschen würden ihn sehr offen ablehnen, einer habe ihm sogar gesagt, Homosexuelle seien des Todes würdig. Andere redeten hinter seinem Rücken schlecht über ihn, gingen grußlos vorbei oder starrten ihn an. Er und sein Mann wünschten sich, wieder in Ruhe leben und arbeiten zu können, so der Zeitungsbericht.
Konflikt schon 2017
Bereits 2017 hatte es in Vlotho einen Konflikt um den Geistlichen gegeben. 13 Gemeindeglieder der Vlothoer St. Johannis-Gemeinde hatten damals die positive Haltung ihrer Gemeindeleitung zur Berufung des homosexuellen Pfarrers in der Nachbargemeinde St. Stephan öffentlich kritisiert und sich dabei auf ihr Verständnis der Bibel bezogen. Durch den Leserbrief in einer Gemeindepublikation war es auch zu Irritationen zwischen den Presbyterien beider Gemeinden gekommen, die aber geklärt werden konnten.
Die Evangelische Kirche von Westfalen stehe uneingeschränkt zur Vielfalt der sexuellen Orientierung, heißt es in der aktuellen Erklärung des Kirchenkreises Vlotho. Deshalb sei es auch möglich, dass homosexuelle Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren Ehepartnern in Pfarrhäusern leben. Auf der gerade zu Ende gegangenen Landessynode habe die westfälische Kirche zudem die Gleichstellung von homosexuellen Paaren und die "Trauung für alle" beschlossen, so der Kirchenkreis. Der Kirchenkreis, die Landeskirche und der betroffene Pfarrer respektierten andere Auffassungen zum Verständnis des biblischen Wortes - der Respekt müsse jedoch gegenseitig sein.
Kirchenkreis Vlotho sucht Nachfolge für Superintendent Huneke
Vlotho (epd). Im Evangelischen Kirchenkreis Vlotho steht im kommenden Jahr eine Superintendenten-Wahl an. Nach 16 Jahren im Amt geht Superintendent Andreas Huneke (62) im Januar 2021 in den Ruhestand, wie der Kirchenkreis mitteilte. Auf der jüngsten Kreissynode in Vlotho wurde darüber informiert, dass der Nominierungsausschuss seine Arbeit aufgenommen hat. Die Stelle soll demnach noch bis Ende diesen Jahres ausgeschrieben werden. Die Wahl solle auf der Herbstsynode 2020 erfolgen.
Im Mittelpunkt der Kreissynode stand die finanzielle Entwicklung der evangelischen Kirche in der Region. Die steigende Zahl an Kirchenaustritten beschäftige den Kirchenkreis Vlotho zunehmend, hieß es. Allein in den Jahren 2017 und 2018 seien aus der Evangelischen Kirche von Westfalen fast 40.000 Gemeindemitglieder ausgetreten. Das mache sich besonders im ländlich geprägten Raum der Landeskirche bemerkbar. Für den Kirchenkreis Vlotho bedeute es mehr als 200.000 Euro weniger finanzielle Mittel für Seelsorge, Kinder- und Jugendarbeit, den Erhalt der Kirchen, Kindergärten sowie das Gemeindeleben vor Ort und die weiteren Arbeitsfelder.
Rücklagen müssen angetastet werden
Die Gemeinden müssten entsprechend mit weniger Finanzmitteln auskommen. Laut aktueller Haushaltsplanung werden sie im Jahr 2020 voraussichtlich pro Gemeindemitglied nur noch knapp 90 Euro für das komplette Jahr erhalten, erklärte der Kirchenkreis. Ohne Zugriff auf die Rücklagen werde eine künftige Finanzplanung kaum möglich sein.
Dagegen wird im Kirchenkreis in den Kita-Bereich investiert, da kleinere Städte wie Porta Westfalica, Löhne, Bad Oeynhausen und Vlotho mit Kindergartenplätzen unterversorgt sind, wie es weiter hieß. So wurde zum 1. August ein neuer provisorischer Kindergarten in Bad Oeynhausen eröffnet, der für 45 Kinder Betreuungsplätze bis 2021 schafft. Bis dahin baut der Kirchenkreis eine neue evangelische Kindertagesstätte, die zum Kita-Jahr 2020/21 eröffnet werden soll. Auch die Städte in den vier Regionen planen den Angaben nach weitere Kita-Neubauten oder -Erweiterungen.
Alle 23 Kitas im Kirchenkreis sind mit dem Gütesiegel BETA zertifiziert. Das Gütesiegel basiert auf dem Bundesrahmenhandbuch der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (BETA). Voraussetzung ist, dass die Kita im Rahmen des Qualitätsmanagements ihre Arbeit überprüfen lässt und sich systematisch weiterentwickelt. Religionspädagogik muss in den Kita-Alltag integriert und das evangelische Profil gestärkt werden.
Kirchenkreis baut Prävention von sexualisierter Gewalt aus
Borken (epd). Der Evangelische Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken baut den Schutz gegen sexuelle Gewalt aus. "Wir tun alles in unserer Macht stehende dafür, dass in unserem Verantwortungsbereich in Zukunft Fälle von sexuellem Missbrauch nach Möglichkeit ausgeschlossen sind", erklärte Superintendent Joachim Anicker auf der Herbstsynode am 23. November in Borken. Die nun beschlossene Erweiterung Schutzkonzepts zum Umgang mit dem Verdacht auf Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und Missbrauch von 2016 solle bei möglichen Fällen Transparenz zusichern.
Das bisherige Konzept sagt bislang unter anderem vor, dass alle Mitarbeitenden im Kirchenkreis an einer Fortbildung zur Prävention von sexueller Gewalt teilnehmen müssen. Außerdem wurde für alle evangelischen Kindergärten in der Region einrichtungsbezogene Schutzkonzepte erarbeitet. Als neue Maßnahme werden zwei Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werks von der Landeskirche zu Multiplikatorinnen weitergebildet. Sie sollen in Zukunft Aufgaben im Bereich Prävention und Fortbildung. übernehmen, wie es hieß. Zudem wurde demnach ein Beratervertrag mit dem Deutschen Kinderschutzbund geschlossen, um auf professionelle Beratung zurückgreifen zu können.
Haushalt verabschiedet
Die rund 100 anwesenden Kreissynodalen verabschiedeten zudem den Haushalt für 2020. Dem Kirchenkreis stehen den Angaben nach im kommenden Jahr knapp 1,6 Millionen Euro (2019: rund 1,5 Millionen Euro) für seine gemeinsamen Dienste wie Diakonisches Werk, Schulreferat oder die kreiskirchliche Jugendarbeit zur Verfügung. Für Leitung, Verwaltung und Gebäude sind rund zwei Millionen Euro (Vorjahr: rund 1,8 Millionen Euro) eingeplant. Die 20 Kirchengemeinden des Kirchenkreises erhalten 2020 eine Kirchensteuerzuweisung in Höhe von knapp 6,8 Millionen Euro (2019: rund 6,6 Millionen Euro). Den Gemeinden wurde empfohlen, einen Teil der Zuweisungen für die Gebäudesubstanzerhaltung zu reservieren, wie es hieß.
Die Zusammenführung der drei kreiskirchlichen Verwaltungen Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg soll am 1. Januar 2020 umgesetzt sein, wie es weiter hieß. Der Einzug der Mitarbeitenden in das noch im Bau befindliche Gebäude am Coesfelder Kreuz in Münster ist in Herbst in einem Jahr vorgesehen. Dem Verband der zentralen Verwaltung der drei Kirchenkreise im Münsterland stehen den Angaben zufolge für 2020 Mittel in Höhe von rund 12,9 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Summe wird von den drei Kirchenkreisen zu je einem Drittel aufgebracht. Darin enthalten ist die einmalig für den Bau des gemeinsamen Verwaltungsgebäudes in Münster bestimmte Summe von rund 7,3 Millionen Euro.
Kirchenkreis Minden hilft Gemeinden bei Kirchensanierung
Minden/Hille (epd). Der Evangelische Kirchenkreis Minden sucht nach Möglichkeiten, seine Gemeinden bei der Sanierung von Kirchgebäuden besser zu unterstützen. Die Kreissynode beschloss am 22. November bei ihrer Tagung in Hille, alternative Finanzierungsmodelle für das Gebäudemanagement zu prüfen, wie der Kirchenkreis in Minden mitteilte. Geplant sei außerdem die Errichtung einer kreiskirchlichen Stiftung, deren Hauptzweck die Erhaltung historischer Kirchen sein soll.
Immer wieder gerieten Kirchengemeinden in Not, weil ihre Gotteshäuser saniert werden müssten und dabei hohe Kosten entstünden, hieß es weiter. So stehe etwa aktuell die St. Marien-Gemeinde vor der Aufgabe, rund 1,8 Millionen Euro für die Sanierung von Turm und Kirche aufzubringen - nur dann würde der Bund die Maßnahme mit noch einmal der gleichen Summe fördern. Nach den geltenden Regeln erhalte die Gemeinde aber für 2020 nur rund 164.000 Euro über die sogenannte Gebäude-Pauschale und sei daher "extrem auf Spenden angewiesen", erklärte der Kirchenkreis.
Kreiskirchliche Stiftung geplant
Für die geplante kreiskirchliche Stiftung wird den Angaben zufolge bis zum Sommer 2020 eine Satzung erarbeitet, über die dann die Synode abstimmt. Nachrangig zum Erhalt der alten Kirchen solle die Stiftung auch synodale Dienste fördern wie Jugendarbeit, Flüchtlingshilfe, Krankenhausseelsorge und Kirchenmusik.
Im kommenden Jahr erhält der Kirchenkreis laut der Mitteilung knapp 10,9 Millionen Euro aus Kirchensteuermitteln, rund 330.000 Euro mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung reiche allerdings wegen gestiegener Personalkosten gerade aus, um bestehende Standards zu halten. Mit gut 8,1 Millionen Euro fließen demnach rund 75 Prozent der Gelder in die Kirchengemeinden, 25 Prozent stehen für die Aufgaben des Kirchenkreises bereit.
Seit 1970 habe der Kirchenkreis rund 40 Prozent seiner Mitglieder verloren, ihre Zahl liege derzeit bei rund 73.000, sagte der Mindener Superintendent Jürgen Tiemann. Dieser Trend werde sich in Zukunft fortsetzen, daher seien auch die Zeiten, in denen die kirchlichen Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr steigen, bald vorüber, erklärte Tiemann.
Köln-Rechtsrheinisch diskutiert Gemeindeformen der Zukunft
Köln (epd). Mit neuen Formen von Gemeindeleben und Seelsorge hat sich der Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch auf seiner diesjährigen Herbstsynode befasst. Unter dem Leitthema "ErprobungRaum@Kirchenkreis-Koeln-Rechtsrheinisch - Erprobungen Raum geben im Kirchenkreis Köln-Rechtsrheinisch" diskutierten die Synodalen Gottesdienste, Diakonie, Gemeinschaft, Bildung und Seelsorge vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Gesellschaft.
Der rheinische Landespfarrer Christoph Nötzel, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), moderierte die Gespräche zwischen den Synodalen, die sich anschließend in Kleingruppen austauschten. Eine Auswertung der Ideen folgt. Einzelheiten hält die Internetseite der rheinischen Landeskirche, erprobungsraeume.de, bereit.
Erprobungsräume
„Wir sind eine kleiner werdende Kirche im Umbruch in einer hyperindividualistischen, digitalisierten und globalisierten Gesellschaft“, sagte Nötzel. Was die Zukunft bringe, könne niemand voraussagen. Wahrscheinlich werde es den Evangelischen Kirchenverband Köln und Region im Jahr 2060 nicht mehr geben. Erprobungsräume seien keine Konkurrenz zur Parochie, erklärte der Landespfarrer. Es gehe vielmehr darum, neue Formate zu finden, Glauben zu leben und zu kommunizieren. „Fusionen zum Beispiel geben keine Antworten. Sie machen den Mangel nur verwaltbar.“
„Erprobungen Raum schenken“ war auch das Thema des Berichts von Superintendentin Andrea Vogel. Laut einer Studie des Freiburger Forschungszentrums Generationenverträge (FFG) würden die Kirchen bis 2060 voraussichtlich die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren, erläuterte sie. „Wir sollten uns durch Traditionsabbruch, Mitgliederschwund, Ressourcenverknappung und auch so manche Erschöpfung nicht davon abbringen lassen, zu klären, was uns wichtig ist und was wir Neues wagen können und sollen, ohne Bewährtes aufzugeben.“
Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt verwiesen die Synodalen das beschlossene „Schutzkonzept des Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch“ zur Prävention sexualisierter Gewalt und zum Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung zur Beratung in die Gemeinden.
Einstimmig billigten die Synodalen zudem den Jahresabschluss 2018 mit Erträgen in Höhe von rund 1,12 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 0,95 Millionen Euro. 191.465 Euro werden in die allgemeine freiwillige Rücklage des Kirchenkreises eingestellt. Für 2020 rechnet der Kirchenkreis mit Erträgen in Höhe von 1,03 Millionen Euro. Denen sollen Aufwendungen in Höhe von rund einer Million Euro gegenüberstehen.
Kirchenkreis warnt vor steigenden Kosten für Friedhöfe
Wuppertal (epd). Immer mehr Urnenbestattungen und weniger Erdbegräbnisse setzen die Friedhöfe in Nordrhein-Westfalen zunehmend finanziell unter Druck. Besonders dramatisch sei die wirtschaftliche Situation der konfessionellen Friedhöfe in Wuppertal, sagte der Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Wuppertal, Ingo Schellenberg, am 19. November. Denn der laufende Betrieb der Friedhöfe finanziere sich allein über die Bestattungsgebühren. Die Hälfte der Friedhofsflächen in Wuppertal stehe nun auf dem Prüfstand.
Die Gebühren für eine Grabstelle werden unter anderem nach ihrer Größe berechnet. Da die Urnenbestattungen zunehmen, sinken die Einnahmen - denn die Urnengräber sind deutlich kleiner und günstiger als eine Bestattung im Sarg. Hinzu kommt, dass viele alte Familiengrabstätten aufgegeben und die Nutzungsrechte an langjährigen Gräbern abgegeben werden. Die so zunehmend entstehenden freien Flächen müssen aber weiterhin gepflegt werden.
"Das ist für uns eine große Herausforderung", sagte Schellenberg. Während die Fixkosten für Energie, Personal und Entsorgung immer weiter anstiegen, gingen die Einnahmen kontinuierlich zurück. Auch stünden viele Gebäude und Flächen unter Denkmalschutz und seien deshalb aufwendiger im Unterhalt.
43 Friedhöfen hat die Stadt Wuppertal
Die Wuppertaler Friedhofssituation gilt als besonders. Mit 43 Friedhöfen hat die Stadt so viele Gräberfelder wie kaum eine andere Stadt in Deutschland. Hinzu kommt, dass hier nahezu alle Friedhöfe in kirchlicher Trägerschaft sind. Während Kommunen ihre eigenen Friedhöfe aber im städtischen Haushalt querfinanzieren können, fehlt den Kirchengemeinden eine solche Möglichkeit: Die Kirchensteuer darf per Gesetz nicht zur Hilfe für die notleidenden Friedhöfe einspringen, wie Schellenberg erläuterte.
Mit der Verpachtung von Friedhofsflächen und dem Ausbau des Angebots pflegefreier Grabanlagen sowie der Anhebung der Gebührensätze versucht der Evangelische Friedhofsverband in Wuppertal dem Kostendruck zu begegnen. Zugleich werden neue Ideen für die Freiflächen entwickelt wie Trauerpfade, naturbelassene Flächen mit Bienenweiden, Lehrpfade für Schulen oder Urban Gardening. Die Superintendentin des Kirchenkreises, Ilka Federschmidt, sagte, der Kirchenkreis wolle die Themen Tod und Leben wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückholen und die Flächen stark machen.
Erstmals Jugendsynode im Kirchenkreis An Sieg und Rhein
Siegburg (epd). Der Evangelische Kirchenkreis An Sieg und Rhein hat seine Herbstsynode in diesem Jahr erstmals mit einer Jugendsynode begonnen. Insgesamt begegneten sich 80 Jugendliche und Erwachsene aus den 33 Kirchengemeinden und den kreiskirchlichen Dienststellen, wie der Kirchenkreis mitteilte. Unter der Überschrift "Frieden machen" erarbeiteten die Teilnehmer in Gruppen Thesen, Forderungen und Aktionsvorschläge zu verschiedenen Themenbereichen wie "Frieden in der Gesellschaft", "Frieden zwischen den Kulturen" oder etwa "Frieden als politische Aufgabe". Die Kreissynode beschloss, diese Vorschläge aufzugreifen.
Superintendentin Almut van Niekerk thematisierte in ihrem Bericht den Angaben zufolge Mitgliederschwund und Relevanzverlust der Kirchen sowie die Herausforderungen, die die Digitalisierung im schnelllebigen Zeitalter fordert. Diese Fakten bereiteten ernstzunehmende Sorgen und forderten zum Umdenken auf. Trotz der düsteren Aussichten warb die Theologin für Leidenschaft, Innovationskraft und Begeisterung, um dem Trend mit aller Kraft und Kompetenz entgegenzuwirken.
www.ekasur.de
Moerser Superintendent wirbt für Kooperation mit anderen Gruppen
Moers (epd). Der Superintendent des Kirchenkreises Moers, Wolfram Syben, hat für mehr Zusammenarbeit mit anderen Organisationen und Gruppen geworben. In seinem Bericht vor der Kreissynode schlug er vor, "dass wir uns viel mehr als jetzt bereits mit anderen zusammentun, die Ähnliches anstreben wie wir als evangelische Christinnen und Christen". Das gelte sowohl für punktuelle Aktionen wie für längerfristige Kooperationen, sagte Syben nach Angaben des Kirchenkreises. "Da wo Menschen sich einsetzen für eine gerechtere und friedlichere Welt, da wo Menschen sich zusammentun, um für die Bewahrung des Klimas, der Artenvielfalt, der Schöpfung einzutreten, da können wir gut als ein Teil der Bewegung das Anliegen verstärken und voranbringen."
Höhere Kirchensteuereinnahmen für den Kirchenkreis Paderborn
Paderborn (epd). Der Evangelische Kirchenkreis Paderborn geht im kommenden Jahr von einem Haushalt in Höhe von insgesamt rund 22,6 Millionen Euro aus. Der Etat wurde am 2. November auf der Kreissynode in Paderborn beschlossen, wie der Kirchenkreis mitteilte.
Wie bereits 2018 gebe es auch 2019 wieder Steigerungen beim Kirchensteuereinkommen gegenüber dem Vorjahr, sagte der Vorsitzende des kreiskirchlichen Finanzausschusses, Martin Gasse. Alle Haushalte könnten planmäßig abgewickelt werden. Für 2020 rechne die Landeskirche - die Evangelische Kirche von Westfalen - mit 520 Millionen Euro. Davon erhält der Kirchenkreis Paderborn den Angaben nach rund 11,64 Millionen Euro Kirchensteuerzuweisungen. Für die evangelischen Kirchengemeinden in der Region bedeute das für 2020 ein Plus von insgesamt 375.000 Euro an Zuweisung für ihre Haushalte im Vergleich zu 2019. Zum Evangelischen Kirchenkreis Paderborn gehören 78.937 Gemeindeglieder (Stand 31.12.2018) in 14 Kirchengemeinden in den Kreisen Höxter und Paderborn sowie im lippischen Lügde.
Die Gesamtpersonalkosten im Kirchenkreis betragen im kommenden etwa rund 19,7 Millionen Euro (etwa 700.000 Euro mehr als 2019), wie es weiter hieß. Ein Plus von 3,37 Stellen gibt es im Bereich der Mitarbeitenden in den 16 evangelischen Kindertageseinrichtungen im Kirchenkreis mit jetzt 180 Stellen. Das ist die größte Mitarbeitenden-Gruppe im Kirchenkreis, gefolgt von den Gemeinde- und Funktionspfarrstellen mit 49. Insgesamt gibt es etwa 300 Personalstellen im Evangelischen Kirchenkreis Paderborn.
epd-West kat
Kirchenkreis Jülich bildet ehrenamtliche Seelsorger aus
Jülich (epd). Der evangelische Kirchenkreis Jülich bietet ab 2020 erstmals eine professionelle Weiterbildung für ehrenamtliche Seelsorge an. Das Angebot richte sich an engagierte Christinnen und Christen aus dem Kirchenkreis, den Gemeinden und diakonischen Einrichtungen, teilte der Kirchenkreis mit. Als Einsatzbereiche seien Gemeinden und stationäre Einrichtungen, wie zum Beispiel Altenheime, Krankenhäuser und Institutionen der Behindertenhilfe denkbar.
Gute Erfahrungen mit Seelsorgenden im Ehrenamt gebe es bereits in funktionalen Seelsorgefeldern wie Telefonseelsorge oder der Notfallseelsorge sowie der gemeindlichen Besuchsdienstarbeit, hieß es. Angesichts einer unvermindert großen Nachfrage nach Seelsorge solle die Laienseelsorge nun auf Bereiche ausgedehnt werden, die bislang überwiegend hauptamtlich etwa von Pfarrerinnen und Pfarrern wahrgenommen wurden.
Die Weiterbildung umfasst rund 100 Ausbildungsstunden, verteilt auf acht Monate. Inhaltlich geht es um die Verbesserung und Professionalisierung der Gesprächsführung, weitere Themen sind Verschwiegenheit, ethische Fragen, Gebet und Rituale, Nähe und Distanz sowie Gesprächsführung in Extremsituationen.
Der Kurs findet ab März 2020 mit überwiegend wöchentlichen Abenden - jeweils am Donnerstag - im Peter-Beier-Haus, Aachener Str. 13 a, 52428 Jülich statt. Erwartet wird ein zweijähriger ehrenamtlicher Einsatz nach der Weiterbildung. Anmeldung ist ab sofort möglich und unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist der 31. Januar. Für eine erste Kontaktaufnahme steht Diakon Heinze-Tydecks gerne zur Verfügung (0171/6914290 oder christian.heinze-tydecks@ekir.de).
Präses Kurschus entzündet zum 1. Advent Wichernkranz in Attendorn
Attendorn (epd). Die westfälische Präses Annette Kurschus entzündet am 1. Dezember die erste Sonntags-Kerze auf einem großen Adventskranz vor der evangelischen Erlöserkirche in Attendorn bei Olpe. Zuvor feiert die leitende Theologin in der Kirche einen Familiengottesdienst, wie die Kirchengemeinde am 25. November ankündigte. Anlass ist die Erfindung des Adventskranzes durch den Theologen Johann Hinrich Wichern vor 180 Jahren. In der Adventszeit finden unter dem Wichernkranz jeweils montags bis freitags abendliche Kerzenandachten statt, bei denen Spenden für Schulmaterial für bedürftige Kinder gesammelt werden.
Der Theologe Wichern (1808-1881) wirkte im 19. Jahrhundert in dem Hamburger Kinderheim "Rauhes Haus". Dort wollte er mit dem Adventskranz in Form eines hölzernen Wagenrades verarmten und verwahrlosten Kindern die Wartezeit auf Weihnachten erklären und ihnen die Liebe Gottes näherbringen, wie es hieß. Wichern war Begründer der Inneren Mission der Evangelischen Kirche, der Vorläuferin der heutigen Diakonie.
Der Attendorner Wichernkranz hat den Angaben zufolge einen Durchmesser von vier Metern und ist mit vier großen Kerzen für die Adventssonntage und 24 kleinen Kerzen für Werktage bestückt. Die Spendenaktion war von dem evangelischen Pfarrer Andreas Schliebener 2008 als Beitrag zu einer Kampagne der westfälischen Landeskirche gegen Kinderarmut ins Leben gerufen worden. Laut Schliebener verwendet auch die Diakonie Österreich nach Attendorner Vorbild gebaute Wichernkränze, um auf die vielfach prekäre Situation von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen.
Deutschlandfunk sendet Adventsgottesdienst aus Siegen
Siegen (epd). Der Deutschlandfunk überträgt am ersten Advent den evangelischen Gottesdienst aus der Haardter Kirche in Siegen-Weidenau. Unter dem Leitwort "Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt" werde darin am 1. Dezember um 10.05 Uhr auf den neuen Advent eingestimmt, teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am 19 November mit. Die Predigt hält der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Siegen, Peter-Thomas Stuberg. Durch den Gottesdienst führt der Weidenauer Ortspfarrer Martin Hellweg. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Siegener Bach-Chor. Die Haardter Kirche ist die größte im Siegerland.
Lebendiger Adventskalender lädt zu besinnlichen halben Stunden ein
Düsseldorf (epd). Evangelische und katholische Kirchengemeinden in den Düsseldorfer Stadtteilen Bilk, Unterbilk und Friedrichstadt haben wieder einen ökumenischen "Lebendigen Adventskalender" gestaltet. Vom 1. bis zum 24. Dezember findet täglich um 18 Uhr an einem anderen Ort eine adventliche halbe Stunde mit offenem Singen, Geschichten, Andachten, Schattenspiel, Turmblasen oder Punsch und Plätzchen statt, wie der Kirchenkreis Düsseldorf ankündigte. Am 18. Dezember spielt beispielsweise die Marching-Band der Flora-Realschule im Landtag Adventslieder. Auch Kindergärten, einen Tagesstätte für Wohnungslose und die Düsseldorfer Feuerwehr beteiligen sich.
Die Adressen der jeweiligen Orte sind im Internet unter www.lebendiger-adventskalender-bilk.de zu finden. Außerdem werden 3.200 gedruckte Adventskalender in den betreffenden Stadtteilen verteilt, hinter deren Türchen die Treffpunkte benannt werden.
Gesellschaft
Verein zur Ausbildung von Imamen geplant

epd-bild/Jürgen Blume
Osnabrück/Köln (epd). Die Ausbildung von Imamen in Deutschland ist ein Ziel der Politik. Mit einer Vereinsgründung in Osnabrück könnte man dem nun einen Schritt näherkommen. Wie das Bundesinnenministerium und die Universität Osnabrück bestätigten, sollte dort am 21. November ein Trägerverein an den Start gebracht werden, in dem Wissenschaftler, Vertreter von Islam-Verbänden und Einzelpersonen ein Kolleg für die Ausbildung der Geistlichen organisieren. Von der Politik wird das Vorhaben gelobt. Die Vereinsgründer halten sich zum Start allerdings bedeckt und lassen viele Fragen offen.
Den Auftrag der Politik hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im März 2018 selbst vorgegeben: "Dass wir uns Jahrzehnte darauf verlassen haben, dass für die Gastarbeiter Imame aus der Türkei kamen, reicht für das 21. Jahrhundert nicht mehr aus", sagte sie damals im Bundestag. Insbesondere der Einfluss aus der Türkei wurde zunehmend kritisch gesehen. Die Islamkonferenz unter der Führung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte vor einem Jahr das Thema Imam-Ausbildung in Deutschland in den Mittelpunkt.
Bislang keine praktische Ausbildung
Islamische Theologen werden an Universitäten in Deutschland zwar bereits ausgebildet. Was bislang aber fehlt, ist die praktische Ausbildung in Gemeinden ähnlich der Pfarrer-, Priester- oder Rabbinerausbildung. Wegen der Pluralität der muslimischen Verbände und Richtungen galt dies als besonders kompliziert. In der vergangenen Woche meldete der zuständige Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Markus Kerber, einen Fortschritt. Er kündigte die Gründung des Trägervereins in Osnabrück an, der nach seinen Worten unter anderem ein Curriculum für die Ausbildung definieren soll.
"Wir können zuversichtlich sagen, dass wir beim Thema Imam-Ausbildung einen großen Schritt vorangekommen sind", sagte Kerber. Eine Ministeriumssprecherin bezeichnete das Projekt in Osnabrück als "Modellvorhaben" für die Aus- und Fortbildung religiösen Personals islamischer Gemeinden in Deutschland. Unterstützt wird das Vorhaben auch vom niedersächsischen Wissenschaftsministerium. "Der Verein plant, dort anzuschließen, wo das Studium aufhört", sagte eine Sprecherin dem epd. Er wolle Theologen auf die seelsorgerische Seite ihrer Arbeit in den Moscheen vorbereiten. Man erwarte von dem Projekt einen Impuls für die Ausbildung, die es bisher nicht gibt.
Ditib nicht beteiligt
Die Grünen-Politikerin Filiz Polat begrüßte die Pläne: "Das ist ein wichtiger Schritt für Muslime in Deutschland hin zu einer eigenständigen, vom Herkunftsland unabhängigen Imam-Ausbildung." Gleichzeitig sei es ein wichtiges Signal von der Bundesregierung, Muslime dabei zu unterstützen, sagte sie dem epd. Im Raum steht eine finanzielle Förderung vonseiten des Bundes. Die konkrete Höhe steht nach Angaben des Bundesinnenministeriums aber noch nicht fest. Im niedersächsischen Ministerium liegt nach Angaben der Sprecherin noch kein Antrag auf Förderung vor.
Die Verantwortlichen selbst wollten sich zu den Plänen vor Vereinsgründung allerdings nicht äußern. Man sei noch in der Gründungsphase und wolle erst zu einem späteren Zeitpunkt informieren, hieß es vom Lehrstuhl von Bülent Ucar. Offen blieb damit zunächst, wie der Verein konkret arbeiten wird und welche Organisationen und Personen sich ihm anschließen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, bestätigte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ), dass sein Verband beteiligt ist. Die Universität teilte mit, dass der Verein unabhängig von der Hochschule gegründet wird.
Nicht beteiligt ist nach epd-Informationen der eng mit der türkischen Religionsbehörde verbundene Verband Ditib, der die meisten Moscheen in Deutschland unterhält. Nach Angaben von Innen-Staatssekretär Kerber plant Ditib, im Dezember eine eigene Ausbildungsakademie zu eröffnen. Eine Anfrage zu Details der geplanten Einrichtung ließ Ditib zunächst unbeantwortet.
Extinction Rebellion: Mitbegründer verharmlost Holocaust

epd-bild/Christian Ditsch
Hamburg, Berlin (epd). Einer der Mitbegründer der internationalen Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, Roger Hallam, hat den Holocaust relativiert. Genozide habe es in den vergangenen 500 Jahren immer wieder gegeben, sagte der Brite der Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorabmeldung. "Um ehrlich zu sein, könnte man sagen: Das ist fast ein normales Ereignis." Auch der Holocaust sei für ihn "just another fuckery in human history", erklärte Hallam - "nur ein weiterer Scheiß in der Menschheitsgeschichte". Die Aussagen stießen auf scharfe Kritik. Hallams deutscher Verlag zog das neue Buch des Briten zurück.
Die "Zeit" hatte den 53-Jährigen in dessen Heimat Wales für einen Beitrag besucht. Hallam hatte bereits in der Vergangenheit Parallelen zwischen dem Umgang mit dem Holocaust und dem Klimawandel gezogen. Er sagte der "Zeit", er halte die deutsche Haltung zum Holocaust für schädlich. "Das Ausmaß dieses Traumas kann lähmen", sagte er. "Das verhindert, dass man daraus lernt."
"Nicht tragbar"
Die deutsche Sektion von Extinction Rebellion distanzierte sich von Hallam und dessen Äußerungen zum Holocaust. "Seine Aussage ist in Diktion wie Inhalt für XR Deutschland nicht tragbar", erklärte Extinction Rebellion Deutschland am Mittwoch in Berlin. Hallams "verharmlosende und relativierende Äußerungen zum Holocaust" seien in keiner Weise mit den deutschen Aktivisten der Klimabewegung abgesprochen: "Er ist kein Sprecher für XR Deutschland."
Als öffentliches Gesicht von XR in England habe sich Hallam "dort als polemischer und provokativer Sprecher der Bewegung einen Namen gemacht", hieß es in der Erklärung weiter. Seit einigen Monaten polarisiere er mit seinen Aussagen auch intern die Bewegung. Extinction Rebellion bezeichnet sich selbst als eine dezentrale und autonom agierende Bewegung, die mit zivilem Ungehorsam gegen die ökologische Krise vorgeht.
Außenminister Heiko Maas (SPD) reagierte auf Twitter auf die Aussage Hallams. "Der Holocaust ist mehr als Millionen Tote und grausame Foltermethoden. Jüdinnen und Juden industriell zu ermorden und ausrotten zu wollen, ist einzigartig unmenschlich. Das muss uns immer bewusst sein, damit wir sicherstellen: nie wieder!", erklärte er über den Kurznachrichtendienst.
Ullstein distanziert sich
Grünen-Chef Robert Habeck sagte der "Bild"-Zeitung, für Antisemitismus oder Relativierung des Holocaust dürfe es in keiner Bewegung einen Platz geben. Auch der ehemalige SPD-Vorsitzende Martin Schulz verurteilte Hallams Aussage. "Der industrielle Mord an Jüdinnen und Juden war das unmenschlichste Verbrechen aller Zeiten! Die Erinnerung daran lähmt uns nicht. Sie hilft uns, Faschismus zu verhindern", schrieb er auf Twitter.
Der Ullstein Verlag kündigte an, von der geplanten Veröffentlichung von Hallams Buch "Common Sense. Die gewaltfreie Rebellion gegen die Klimakatastrophe und für das Überleben der Menschheit" abzusehen. "Der Ullstein Verlag distanziert sich in aller Form von aktuellen Äußerungen Roger Hallams. Aus diesem Grund wird sein Buch 'Common Sense', ursprünglich angekündigt für den 26.11.2019, nicht erscheinen", teilte der Verlag auf Twitter mit. "Die Auslieferung des Buches wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt."
Ärztegewerkschafter mit Josef-Neuberger-Medaille geehrt
Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf verleiht seit 1991 die Josef-Neuberger-Medaille an Persönlichkeiten und Institutionen, die sich um die Förderung jüdischen Lebens verdient gemacht haben. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an einen Mediziner.Düsseldorf (epd). Der frühere Präsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery ist am 19. November mit der diesjährigen Josef-Neuberger-Medaille der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf geehrt worden. Der 1952 in Hamburg geborene Radiologe, der nach Vorstandsämtern im Marburger Bund und in der Bundesärztekammer in den Vorstand des Weltärztebundes gewählt wurde, erhielt die Auszeichnung auf einem Festakt in der Düsseldorfer Synagoge.
Ex-Minister Gröhe würdigt Preisträger als "Brückenbauer"
Der frühere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) würdigte Montgomery bei der Preisvergabe als "eindrucksvollen Brückenbauer zwischen deutschen und israelischen Medizinern". Die Auszeichnung der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf sei auch "ein eindeutiges Zeichen gegen jede Art von Antisemitismus", so Gröhe in seiner Laudatio auf Montgomery, der als erster deutscher Mediziner auch Präsident des Weltärztebundes ist.
Gröhe erinnerte daran, dass in der Zeit des Nationalsozialismus mindestens 2.000 Ärzte in Deutschland ermordet worden seien. 1933, im Jahr der Machtergreifung der Nazis, seien etwa elf Prozent aller Mediziner in Deutschland Juden gewesen. Viele von ihnen hätten maßgeblich zu den Erfolgen der Medizin beigetragen. Für die herausragende Bedeutung jüdischer Mediziner spreche zudem, dass bis heute 56 Mediziner jüdischer Abstammung mit dem Medizinnobelpreis ausgezeichnet worden seien, so der ehemalige Bundesgesundheitsminister.
Gröhe erinnerte in seiner Laudatio auf Montgomery auch daran, dass jüdische Ärzte 1934 aus den Gesundheitsberufen verbannt und vier Jahre später von den Nationalsozialisten mit Berufsverbot belegt wurden. "Bei keiner anderen Berufsgruppe war die nationalsozialistische Ideologie so erfolgreich wie bei den Medizinern", betonte der CDU-Politiker. Nach seinen Worten waren "45 Prozent der Mediziner in der NS-Zeit Mitglieder der NSDAP, neun Prozent Mitglieder der SS".
Die Ärzte hätten in Nazideutschland unter anderem an der Ermordung von rund 200.000 psychisch Kranken und Behinderten sowie an der Sterilisierung von etwa 360.000 weiteren Menschen mitgewirkt. "Ohne ethische Grenzen kann auch medizinischer Fortschritt schnell zum Fluch werden", warnte Gröhe.
Montgomery: Zu NS-Verwicklungen der Ärzte "zu lange geschwiegen"
Der Preisträger der undotierten Josef-Neuberger-Medaille, Frank Ulrich Montgomery, erklärte in seiner Dankesrede, aus dem Verhalten großer Teile der deutschen Ärzteschaft in der NS-Zeit leite sich eine starke Verantwortung ab. Montgomery kritisierte, dass die deutschen Ärztekammern zu ihren Verwicklungen im Nationalsozialismus "zu lange geschwiegen" hätten. Angesichts des heute wieder erstarkten Antisemitismus in Deutschland plädierte der Preisträger für eine starke Zivilcourage.
"Wir müssen in der Bildung und bei Informationen ansetzen. Eine Gewöhnung an Antisemitismus darf es in Deutschland nicht geben," forderte Montgomery weiter. Angesichts der verbalen Entgleisungen von Politikern der AfD im Hinblick auf die NS-Gräuel betonte der Preisträger: "Wir müssen an der roten Linie festhalten, die nicht überschritten werden darf."
Die Neuberger-Medaille ehrt Menschen oder Institutionen der nichtjüdischen Öffentlichkeit, die sich um die jüdische Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Die Auszeichnung erinnert an den früheren nordrhein-westfälischen SPD-Politiker und Justizminister Josef Neuberger (1902-1977), der sich in den Nachkriegsjahren als Jude für das jüdische Gemeindeleben in Nordrhein-Westfalen eingesetzt hatte. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, der frühere NRW-Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau (SPD) und die Düsseldorfer Rockband "Die Toten Hosen".
Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf beunruhigt
Düsseldorf (epd). Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Oded Horowitz, hat am 19. November in der Synagoge in der NRW-Landeshauptstadt mehr Zivilcourage gegen Antisemitismus sowie Empathie für die Juden in Deutschland angemahnt. Bei der Vergabe der diesjährigen Josef-Neuberger-Medaille an den Präsidenten der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sagte Horowitz, die aktuelle Entwicklung in Deutschland mache den hier lebenden Juden "sehr, sehr große Bauchschmerzen".
Als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde habe er für viele Menschen Verantwortung und müsse sich fragen, "wann wir Alarm schlagen müssen". Zugleich betonte Horowitz, er wolle auf das Problem jetzt schon hinweisen, um zu sensibilisieren. "Antisemitismus ist ein Barometer, dass die Stimmung anzeigt", warnte der Vorsitzende der mit rund 8.000 Mitgliedern drittgrößten jüdischen Gemeinde in Deutschland.
Für die Jüdische Gemeinde Düsseldorf kündigte Horowitz für das kommende Jahr an, im benachbarten Neuss eine richtige Synagoge zu erbauen. Die Synagoge in Düsseldorf müsse 60 Jahre nach ihrer Fertigstellung auch dringend saniert werden, hier seien die Planungen dafür aber noch nicht abgeschlossen.
Köln startet neues Dauerprogramm gegen Antisemitismus
Köln (epd). Die Stadt Köln hat eine neue Fachstelle gegen Antisemitismus gegründet. Mit Workshops und neuen Bildungsformaten wie "Entkomme der Verschwörung!" sollen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sensibilisiert werden, wie die Stadt am 19. November mitteilte. Die neue Fachstelle mit dem Namen "[m²]: miteinander mittendrin. Für Demokratie - Gegen Antisemitismus und Rassismus" sei kein zeitlich befristetes Projekt, sondern auf Dauer angelegt. Die Angebote sollen den Angaben zufolge kostenlos sein. Die langjährige Bildungsarbeit des NS-Dokumentationszentrums in der Innenstadt werde damit erweitert.
Ziel sei es, unterschiedliche Facetten von Antisemitismus in den Blick zu nehmen, erläuterte Nambowa Mugalu vom NS-Dokumentationszentrum dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bei vielen Menschen gebe es große Wissenslücken. Dadurch würden antisemitische Sprüche oder Verschwörungstheorien oft einfach übernommen. Hier setze das Bildungsangebot an, und zwar erst einmal mit Sachinformation: Was ist Antisemitismus? Wie tarnt er sich? In einem zweiten Schritt sollen die Teilnehmer dann den Angaben zufolge das Handwerkszeug bekommen, um Antisemitismus im Alltag oder Freundeskreis zu begegnen.
Dabei werde stets die jüdische Perspektiven mit einbezogen. Zu diesem Zweck seien für das Projekt jüdische Kölnerinnen und Kölner interviewt worden, hieß es. Ein 26-Jähriger berichte zum Beispiel, er sei einmal mit Kippa nach draußen gegangen und habe schon Probleme befürchtet. Deshalb habe er sich in der Bahn extra nach ganz hinten gesetzt. Er sei aber trotzdem auf das Übelste beschimpft worden. Andere Kölner Juden haben in den vergangenen Monaten öffentlich erklärt, sie würden sich grundsätzlich nie mit Kippa aus dem Haus wagen.
Sächsische Bürgermeisterin gibt nach Hetze Amt auf
Die Bürgermeisterin der sächsischen Gemeinde Arnsdorf, Martina Angermann, kapituliert vor dem Hass. Sie war offenbar zum Ziel massiver rechtsradikaler Hetze geworden, weil sie eine selbst ernannte Bürgerwehr kritisiert hatte.Dresden/Berlin (epd). Nach dem Rückzug der sächsischen SPD-Politikerin und Bürgermeisterin Martina Angermann warnt Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) davor, Hasskriminalität nicht ernst genug zu nehmen. "Wenn sich Menschen aufgrund von Drohungen und Hetze aus ihrem gesellschaftlichen Engagement zurückziehen, gerät unsere Demokratie in Gefahr", erklärte Lambrecht am 22. November in Berlin: "Das dürfen wir nicht hinnehmen." Sachsens SPD-Chef Martin Dulig forderte einen besseren Schutz für Kommunalpolitiker.
Wie bekannt wurde, hatte Angermann nach mutmaßlich massiver rechtsradikaler Hetze ihr Amt als Bürgermeisterin im sächsischen Arnsdorf bei Dresden aufgegeben. Einem Antrag der 61-Jährigen auf Versetzung in den Ruhestand kam das zuständige Landratsamtes Bautzen nach eigenen Angaben nach.
Psychisch Kranken an Baum gefesselt
"Unsere Bürgermeister brauchen die Wertschätzung und grundsätzliche Unterstützung der Menschen in ihren Gemeinden genauso wie den Schutz des Rechtsstaates", sagte der SPD-Landesvorsitzende und stellvertretende sächsische Ministerpräsident Dulig dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Zugleich stärkte Dulig der ehemaligen Bürgermeisterin den Rücken: "Martina Angermann ist eine starke Frau. Sie hat Haltung gezeigt und wurde in einer Weise angegriffen, die mit menschlichen Formen der politischen Auseinandersetzung längst nicht mehr zu tun hat. Diese Frau soll von ihren politischen Gegnern vernichtet werden."
Arnsdorf geriet 2016 in die Schlagzeilen, weil eine selbst ernannte Bürgerwehr einen psychisch kranken Iraker an einen Baum gefesselt hatte. Angermann hatte dies öffentlich verurteilt. Im Februar war sie zusammengebrochen und ist seither krankgeschrieben.
Dulig beklagte eine zunehmende Verrohung in der Gesellschaft. Politische Auseinandersetzungen hätten inzwischen eine "unakzeptable radikale Form angenommen", durch die "Menschen krank werden und krank gemacht werden".
Solidarität
"Meine ganze Solidarität gilt der Arnsdorfer Bürgermeisterin und allen, die sich jeden Tag für unsere Gesellschaft einsetzen", betonte Bundesjustizministerin Lambrecht. Um die Spirale von Hass und Gewalt zu stoppen, würden Hetzer künftig härter verfolgt und bestraft. Das Maßnahmenpaket der Bundesregierung gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität werde "unter Hochdruck" umgesetzt. Es diene auch dem besonderen Schutz von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern.
Bürgermeisterin Angermann wird nach Angaben der Gemeindeverwaltung Arnsdorf vorerst von ihren Stellvertretern Antje Vorwerk vom Verein Bürgerforum und Volker Winter (CDU) vertreten. Ob über eine Neuwahl noch im Dezember entschieden wird, ist derzeit offen.
Der Twitterkanal "Straßengezwitscher" hatte berichtet, dass Angermann einem AfD-Antrag zu ihrer Abwahl zuvorkommen wollte. Dazu gab es beim Landratsamt und beim Gemeindeamt keine Aussagen. Angermann war seit 2001 Bürgermeisterin von Arnsdorf.
NRW will Nachbesserung beim Bleiberecht
Solingen (epd). Nordrhein-Westfalen will die Integration von Flüchtlingen und Migranten weiter voranbringen. Als Baustein seiner im Sommer vorgestellten Teilhabe- und Integrationsstrategie 2030 will das Land über eine Bundesratsinitiative Nachbesserungen beim Bleiberecht anstoßen. Wer als Geduldeter gut integriert sei und Arbeit habe, müsse einen dauerhaften Aufenthaltsstatus und damit eine langfristige Perspektive bekommen, sagte Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) auf dem 8. Integrationskongress NRW am 18. November in Solingen.
Zu dem Kongress kamen rund 700 Fachleute von Bund, Ländern und Kommunen zusammen, um über die künftigen Herausforderungen für die Integration zu beraten. In NRW werde die Migrationsgesellschaft zwar aktiv gestaltet, betonte Stamp: "Aber dennoch müssen wir heute wieder verstärkt für eine freiheitliche und weltoffene Gesellschaft eintreten. Unsere Gesellschaft braucht ein gemeinsames Wertefundament." Jeder in NRW müsse unabhängig von seiner Herkunft die Chance auf sozialen Aufstieg haben.
Integrationskongress warnt vor Gefahr durch Rechtspopulismus
Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) warnte vor einem sich ändernden gesellschaftlichen Klima, weshalb die weiteren Herausforderungen der Integration nicht unterschätzt werden dürften: "Wir dürfen nicht zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben." Der Rechtspopulismus sei eine ernstzunehmende Bedrohung für das friedliche Zusammenleben geworden. Hinzu komme, dass sich die Gesellschaft zunehmend in Blasen aufspalte, in denen sich Menschen mit jeweils gleichen Ansichten von anderen abgrenzten.
Kurzbach rief zu einem breiten gesellschaftlichen Diskurs auf, um sich die Wichtigkeit der Werte der Demokratie zu verdeutlichen. Es gehe um nichts Geringeres, als die "Schönheit der Freiheit" zu verteidigen. Dem Rechtspopulismus müsse mit einem "Aufstand der Anständigen" begegnet werden. Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW ist traditionell stark von Integration geprägt. Von den rund 17,6 Millionen Einwohnern haben knapp 5,2 Millionen und damit rund ein Drittel einen Migrationshintergrund. Seit 2015 kamen insgesamt mehr als 384 000 Flüchtlinge in das Bundesland.
Der Integrationskongress NRW findet seit 2006 regelmäßig in Solingen statt. Er gilt als wichtiges Instrument für den Erfahrungsaustausch zwischen der Landesregierung und Vertretern aus der Integrationspraxis. Hintergrund für die Auswahl Solingens ist die Erinnerung an den Brandanschlag von 1993, bei dem fünf Menschen türkischer Abstammung getötet wurden.
Asyl: Deutschland sagt weitere 5.500 Resettlement-Plätze zu
Das vom UN-Flüchtlingshilfswerk organisierte Resettlement ist für Flüchtlinge ein Weg, legal nach Europa zu kommen. Deutschland will sich auch 2020 an der Aufnahme beteiligen. 5.500 Plätze hat die Bundesregierung nach epd-Informationen zugesagt.Berlin (epd). Deutschland will sich weiter am Resettlement-Programm zur Umsiedlung von Flüchtlingen aus perspektivlosen Umständen beteiligen. Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) hat die Bundesregierung der EU-Kommission mitgeteilt, im nächsten Jahr bis zu 5.500 Menschen über das Resettlement aufnehmen zu wollen. Das ist eine ähnliche Zahl wie bisher: Für 2018 und 2019 hatte die Bundesregierung insgesamt 10.200 Plätze zugesagt.
Das Resettlement-Programm läuft in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen und Menschen, die aufgrund von Konflikten und Krisen in Flüchtlingslagern kaum eine Perspektive haben, werden darüber in andere Staaten umgesiedelt.
3.000 humanitäre Aufnahmen von Syrern
Unter den Zusagen für 2020 sind nach epd-Informationen 3.000 für humanitäre Aufnahmen von Syrern im Rahmen der EU-Türkei-Erklärung reserviert. Das Abkommen sieht vor, dass die Türkei in Griechenland ankommende Bootsflüchtlinge zurücknimmt, im Gegenzug aber die EU in der gleichen Zahl syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aufnimmt. Sie werden ebenso wie Umsiedlungen aus Flüchtlingslagern in Niger, Libanon oder Jordanien als humanitäre Aufnahmen gewertet.
1.900 Plätze sollen für Resettlement-Verfahren des Bundes zur Verfügung stehen, weitere 200 für ein Landesaufnahmeprogramm Schleswig-Holsteins. Für das Programm "Neustart im Team", soll es 2020 400 Plätze geben. Bei dem in diesem Jahr gestarteten Pilotprogramm tragen freiwillige Mentoren einen Teil der Lebenshaltungskosten und begleiten die Umgesiedelten.
Der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Dominik Bartsch, begrüßte, dass sich Deutschland weiter am Resettlement-Programm beteiligen will. "Das ist ein wichtiges internationales Signal und ein Rettungsanker für Flüchtlinge, die in ihren Aufnahmeländern nicht geschützt sind", sagte er dem epd und ergänzte: "Wir hoffen, dass dieses Engagement in den kommenden Jahren noch ausgebaut wird."
Insgesamt 50.000 Plätze
Das EU-Resettlement-Programm umfasste für dieses und das vergangene Jahr insgesamt 50.000 Plätze. Bis Anfang September 2019 wurden laut EU-Kommission in diesem Rahmen 37.520 Personen neu in Europa angesiedelt. Nach Deutschland sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums bis 21. November gut 7.200 Personen eingereist. Knapp 3.000 Plätze sind damit noch offen. Bis Mitte Dezember sind weitere Einreisen geplant.
Nach Angaben der Caritas-Stelle im Grenzdurchgangslager Friedland, über das die meisten dieser Einreisen erfolgen, kamen zuletzt am vergangenen Donnerstag 234 Flüchtlinge aus Eritrea, Somalia, dem Sudan, Südsudan und aus Syrien dort an, die aus Ägypten nach Deutschland gebracht wurden. Durch das Resettlement soll verhindert werden, dass sich Schutzbedürftige auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa machen, um hier Asyl zu beantragen.
Die EU-Kommission hatte auf einen Aufruf der Vereinten Nationen hin 2017 ein Programm für 50.000 Flüchtlinge aufgelegt. Dazu stellte sie eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung, 10.000 Euro für jeden teilnehmenden Staat pro Neuansiedlung eines Flüchtlings. Die Hauptaufnahmeländer waren Deutschland, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Norwegen und die Niederlande
Bamf-Chef fordert mehr Sammelabschiebungen
Berlin (epd). Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, hat mehr Sammelabschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern gefordert. Es sei immer problematisch, Personen auf regulären Linienflügen abzuschieben, sagte Sommer den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Häufig weigerten sich die Piloten, der Verwaltungsaufwand sei hoch, Polizisten müssten diese Flüge begleiten. "Die Sammelabschiebungen sind hier die Lösung", sagte der Bamf-Chef.
"Es ist nicht hinnehmbar, dass im vergangenen Jahr rund 30.000 Abschiebungen gescheitert sind", sagte Sommer weiter. Vor jeder Abschiebung entstehe den deutschen Behörden ein erheblicher Aufwand. Es müssten Passersatzpapiere beschafft werden, der Flug gebucht werden. Dann müsse die Person, die abgeschoben werden solle, auch tatsächlich "den Beamten zur Verfügung stehen". Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft seien eine wichtige Unterstützung für die Polizei.
Studie zu Flüchtlingen: Hilfen nicht ausschlaggebend für Rückkehr
Das Bundesamt für Migration hat untersuchen lassen, ob Geld ein Lockmittel sein kann, um Flüchtlinge zur freiwilligen Ausreise zu bewegen. Die Antwort: eigentlich nicht. Aber die, die beschlossen haben zu gehen, sind froh über die Förderung.Berlin (epd). Die Entscheidung von Flüchtlingen, Deutschland wieder zu verlassen, hängt nicht davon ab, ob sie dafür mit Geld oder Sachleistungen unterstützt werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus dem Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die am 20. November in Berlin vorgestellt wurde. Die Förderung könne aber dazu beitragen, eine Entscheidung zur Rückkehr auch umzusetzen, stellten die Forscher fest. Außerdem zeigten sich die Rückkehrer mit der Unterstützung zufrieden, auch wenn ihre Lebenssituation nicht einfach war.
Hauptgründe für eine Ausreise sind der Studie zufolge der unsichere Aufenthalt in Deutschland (46 Prozent) und das Gefühl, hier nicht zu Hause zu sein (28 Prozent). Rund 70 Prozent waren als Asylbewerber abgelehnt worden, 30 Prozent noch im Verfahren. Nur vier Prozent erklärten, das Geld für die Rückkehr habe den Ausschlag für ihre Entscheidung gegeben. Gleichzeitig sagte mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent), die Förderung habe seine oder ihre Entscheidung dennoch beeinflusst. Den Angaben zufolge äußerten sich 84 Prozent der Befragten zufrieden mit dem Programm, aus dem sie unterstützt wurden.
Förderprogramme
Es gibt etliche Programme zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen. Sie werden vom Bundesinnenministerium finanziert mit dem Ziel, mehr freiwillige Ausreisen als Abschiebungen zu haben und die Weiterwanderung und Wiedereinwanderung zu verhindern, wie die Leiterin des Grundsatzreferats Rückkehr im Innenministerium, Ann-Marie Burbaum, erklärte.
Untersucht wurde das Förderprogramm "StarthilfePlus", das die Bundesregierung 2017 zusätzlich aufgelegt hatte, um die freiwillige Ausreise von Flüchtlingen zu fördern, die in den Jahren 2015 und 2016 nach Deutschland gekommen waren und keine Bleibeperspektive haben. Es wird in Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration (IOM) umgesetzt und soll die Reintegration im Herkunftsland erleichtern. Voraussetzung ist, dass die Geflüchteten mittellos und außerdem im Rahmen des größten Rückkehr-Förderprogramms REAG/GARP registriert sind.
Den Angaben zufolge sind in den Jahren 2017 und 2018 rund 15.000 Menschen mit einer Zusatzförderung über "StarthilfePlus" ausgereist. Sie bekommen in der Regel 1.000 bis 2.000 Euro in zwei Raten vor und etwa sechs Monate nach der Rückkehr. Befragt wurden für die nicht repräsentative Studie 1.339 Personen, die zwischen Februar 2017 und April 2018 ausgereist waren. Die meisten, etwa ein Viertel, kehrten in den Irak zurück, an zweiter und dritter Stelle standen Russland und Afghanistan.
Überbrückungshilfen
Der Fall Afghanistan zeigt, wie schwierig die Befragungen waren. Erreicht wurden nach der Rückkehr nur die Menschen, die die zweite Rate in einem IOM-Büro auch wirklich abholten. In Afghanistan war das nur jeder Zweite. Befragt nach der eigenen Lebenssituation erklärte von diesen Personen wiederum jeder Zweite, er oder sie sei zufrieden. Studienautorin Tatjana Baraulina sagte dazu, man könne nur diejenigen befragen, an die man herankomme. "Die interessanteste Gruppe wären aber die gewesen, die die zweite Rate nicht abgeholt haben."
Dennoch liefert die Studie zum ersten Mal Daten über ein Rückkehr-Förderprogramm aus der Sicht der betroffenen Menschen. Gut ein halbes Jahr nach der Rückkehr waren rund 40 Prozent zufrieden mit ihrer Lebenssituation, ein gutes Drittel hatte nach acht Monaten eine Arbeit gefunden. Aber nur 15 Prozent konnten den eigenen Angaben zufolge von ihren Einnahmen leben.
Monica Goracci, die Leiterin von IOM-Deutschland, sagte, die Überbrückungshilfen am Anfang seien wichtig. Aber entscheidend sei, ob die Menschen eine langfristige Perspektive in ihrem Herkunftsland hätten: "Wir wollen nicht, dass Menschen nach der Rückkehr in derselben Situation sind wie vorher."
16.000 Rückkehrer
Das Bundesamt für Migration ist zuständig für die Konzeption und Umsetzung von Rückkehrprogrammen. Zu den Leistungen zählen die Erstattung von Reisekosten und eine finanzielle Starthilfe. 2018 gingen nach Angaben der Behörde rund 16.000 Menschen im Rahmen von Rückkehrförderprogrammen zurück in ihre Herkunftsländer. 2017 waren es fast doppelt so viele. Auf dem Höhepunkt der jüngsten Zuwanderung hatten im Jahr 2016 rund 55.000 Menschen Deutschland freiwillig wieder verlassen.
In der Bundesrepublik leben nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 247.000 Geduldete, die eigentlich das Land verlassen müssten. Nicht jeder abgelehnte Asylbewerber kann auch abgeschoben werden, etwa weil gesundheitliche Gründe dagegen sprechen.
Peta will Grundrechte für Tiere erstreiten

epd-bild/Jörg Donecker
Karlsruhe (epd). Im Namen von Schweinen hat die Tierrechtsorganisation Peta beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde eingereicht. "Wir fordern für alle männlichen Ferkel, die ohne Betäubung kastriert werden, das Recht auf Schmerzfreiheit", sagte Peta-Rechtsanwalt Christian Arleth nach dem Einwurf der Beschwerde am 19. November in Karlsruhe. Erstmals in der deutschen Rechtsgeschichte würden Ferkel vor dem höchsten deutschen Gericht als Beschwerdeführer erscheinen. Ziel sei es, einen Präzedenzfall zu schaffen, der Tieren zu Grundrechten verhelfe. Der Staatsrechtler Ralf Müller-Terpitz hält die Aktion für einen PR-Gag, Grünen-Politikern Renate Künast hingegen für die einzige Chance, den Tierschutz zu verbessern.
Die Beschwerde der Tierschützer richtet sich gegen die Fristverlängerung bei der betäubungslosen Kastration männlicher Ferkel. "Es widerspricht dem Tierschutzgesetz, dem Staatsziel Tierschutz und es gibt wirtschaftlichere Alternativen", sagte Arleth. "Tiere müssen ihre Rechte einfordern können, auf dem Papier sind sie nichts wert", betonte er.
Juristen uneins
Der Jurist sieht gute Erfolgschancen. "Das Grundgesetz selbst sagt nicht direkt, wer Beschwerdeführer sein darf", erklärte er. Immerhin könnten auch juristische Personen, etwa Aktiengesellschaften, vor Gericht auftreten. Begleitet wurde die Aktion von zehn Aktivisten, die sich als Schwein, Hahn oder Wal verkleidet hatten. Einer der Beschwerdeführer, ein Ferkel, war nicht dabei - "Sie mitzunehmen, wäre eine weitere Form von Missbrauch gewesen", erklärte eine Aktivistin.
Der Staatsrechtler Ralf Müller-Terpitz hält das Thema nicht für rügefähig vor dem Bundesverfassungsgericht. Dies rüge die Verletzung von Grundrechten, die aber "unstreitig" nur Menschen zustünden. "Es dürfte sich hierbei um eine Marketing-Aktion von Peta handeln", sagte der Mannheimer Jura-Professor auf epd-Anfrage.
Er könne sich auch nicht vorstellen, dass das höchste deutsche Gericht die Grundrechte auf Tiere ausweiten wird, erklärte Müller-Terpitz. Aber für Peta sei es aus Gründen der Öffentlichkeitswirksamkeit interessant, es auf eine Entscheidung ankommen zu lassen, um den politischen Diskussionsprozess über "Tierrechte" in Gang zu halten.
Die Grünen-Politikerin Künast wertet die Verfassungsbeschwerde als positiv. "Tierschutz ist Staatsziel, jedoch lässt die Bundesregierung den Tierschutz vollständig hinter wirtschaftlichen Interessen zurücktreten und blockiert jeden Fortschritt", erklärte die Grünen-Sprecherin für Tierschutzpolitik. Die einzige Möglichkeit etwas zu bewegen, sei die Beschreitung neuer juristischer Pfade.
"Ebergeruch"
Männliche Ferkel werden kastriert, um den für manche Menschen unangenehmen "Ebergeruch" zu vermeiden, der bei der Zubereitung auftreten kann. Das deutsche Tierschutzgesetz schreibt vor, dass ein schmerzhafter Eingriff bei einem Wirbeltier nicht ohne Betäubung vorgenommen werden darf. Es lässt allerdings auch die Ausnahme zu, dass Ferkel bis zu ihrem siebten Lebenstag ohne Betäubung kastriert werden dürfen.
Der Bundestag hatte das Ende dieser Praxis 2013 mit einer Übergangsfrist bis Ende 2018 beschlossen. Kurz vor Ablauf der Frist verlängerte der Bundestag die Übergangsfrist um zwei weitere Jahre bis Ende 2020.
Freundschaft bis in den Tod

epd-bild/Heike Lyding
Braubach (epd). Roswitha Schupp und ihr Mann Manfred haben vorgesorgt. "Wir haben ein Freundschaftsgrab für zwei Menschen und vier Tiere reserviert", sagt Roswitha Schupp. Zwei Briard-Hündinnen gehören zurzeit zur Familie, die 14-jährige Anka und die zweijährige Luna. Das Ehepaar Schupp und seine beiden Hündinnen werden eines Tages auf dem Friedhof "Unser Hafen" in Brauchbach bestattet werden.
Auf diesem Friedhof liegen die Urnen von Mensch und Tier im gleichen Grab. Er liegt etwa 20 Kilometer südlich von Koblenz auf dem Gelände eines ehemaligen Bundeswehrdepots: Bewaldete Hügel, Wiesen und Felder und ein großes Gelände, auf dem das Familienunternehmen "Deutsche Friedhofsgesellschaft" neben dem Friedhof "Unser Hafen" bereits seit 2001 ein Krematorium betreibt.
Auf dem Friedhof seien bislang nur Hunde und Katzen gemeinsam mit Menschen bestattet. Prinzipiell könnten aber auch die Urnen von Hamstern oder Schildkröten beigesetzt werden, "eben alles, was eingeäschert werden kann", sagt Wilhelm Brandt, Sprecher der "Deutschen Friedhofsgesellschaft".
Keine Hundegräber im Garten hinterlassen
Hier stehen auch die Namen von Dieter, Angelika und Nero auf einer Grabplatte. Seit dem Tod seiner Frau komme er jeden Samstag mit Nero auf den Friedhof, erzählt Dieter Wiese. Das Grab haben er und seine Frau sich gemeinsam ausgesucht.
Roswitha Schupp erzählt, sie habe ihr ganzes Leben lang Hunde besessen und immer eine enge Bindung zu den Tieren gehabt. Auch ein Urlaub ohne die Tiere sei für sie nicht vorstellbar. "Dann würde ich immer weinen, wenn ich einen Hund sehe." Roswitha und Manfred Schupp sind 71 und 80 Jahre alt. Späteren Eigentümern ihres Hauses wollen sie keine aktuellen Hundegräber im Garten hinterlassen. "Das wäre makaber", sagt Roswitha Schupp.
Die Möglichkeit, die Urnen der Hunde im eigenen Grab zu haben, sei für sie deshalb perfekt. Sterbe etwa Anka zuerst, "bewahren wir die Urne so lange auf, bis der erste Mensch stirbt", schildert sie. Auch der Fall, dass etwa Luna erst stirbt, wenn Frauchen und Herrchen bereits tot sind, ist geregelt. Sie komme dann später in das Freundschaftsgrab.
Trends in der Bestattungskultur
Den "Hafen" gibt es seit 2015. Die Einrichtung war der Auftakt für eine ganze Reihe weiterer Friedhofsbetreiber, die die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier anbieten, etwa in Görlitz und Aschersleben, in Jena und Magdeburg, Grefrath und Bergisch Gladbach. Auch Hamburg sei als Standort im Gespräch, sagt Torsten Schmitt, Rechtsreferent der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas.
Er nennt zwei Trends in der Bestattungskultur: den zur günstigen Bestattung und den zur Individualisierung, der gemeinsame Gräber für Mensch und Tier einschließe. Früher, sagt Schmitt, habe man das geliebte Haustier unter der Hand in das Grab eines Menschen gelegt, heute werde die Beziehung zum Tier öffentlich gewürdigt.
Aeternitas hatte 2016 das Institut Emnid mit einer repräsentativen Umfrage zu Bestattungsformen beauftragt. Demnach befürwortet mit 49 Prozent knapp die Hälfte der Befragten gemeinsame Gräber für Menschen und Tiere. Der große Andrang auf die gemeinsamen Gräber sei bislang allerdings ausgeblieben, sagt Schmitt.
Haustier als Sozialpartner
Für Jutta von Zitzewitz, Kulturreferentin der "Stiftung Deutsche Bestattungskultur", sind die Mensch-Tier-Bestattungen auch Ausdruck eines "tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels". Bei zunehmender Vereinsamung im Alter werde das Haustier immer häufiger zum Sozialpartner. Gemeinsam mit dem Tier bestattet zu werden, sei dann "ein Herzenswunsch, vor dem man Respekt haben muss".
Die gemeinsamen Gräber stehen nach Meinung einiger Menschen allerdings für eine zu große Nähe zwischen Mensch und Tier. Auch Theologen sind in dieser Frage gespalten. Für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) etwa sagt deren Sprecher Volker Rahn, dass die Trauer beim Tod eines Haustieres in erster Linie eine Frage an die Seelsorge sei, die es ernst zu nehmen gelte. Dennoch seien die gemeinsamen Beisetzungen "immer Grenzüberschreitungen". Die Bibel rücke im ersten Schöpfungsbericht Mensch und Tier sehr nahe aneinander - aber unterscheide sie auch deutlich voneinander.
Die evangelische Theologin Natalie Ende vom Zentrum Verkündigung der EKHN hat mit der Beisetzung von Mensch und Tier in einem Grab kein Problem. "Eine solche Beisetzung nimmt die Beziehung, die zu dem Tier besteht, wertschätzend auf", sagt sie und ergänzt aus theologischer Sicht: "Im Geschöpfsein und in der Vergänglichkeit des Leibes sowie in der Hoffnung auf die Erlösung der ganzen Schöpfung und aller leidenden Kreatur sind Mensch und Tier verbunden."
"Friedhöfe Abbild sozialer Beziehungen"
Im Verborgenen, sagt sie, habe es die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier schon immer gegeben: "So wurde und wird nicht selten das Grab einer Försterin oder eines Jägers zufällig dann frisch bepflanzt, nachdem der Hund gestorben ist."
Auf Friedhöfe als Spiegelbild der Gesellschaft verweist der katholische Theologe Michael Rosenberger: "Friedhöfe sind Abbild sozialer Beziehungen, und wenn diese Tiere einschließen, ist es an sich naheliegend, die Tiere im Menschengrab mit zu beerdigen", sagt der Moraltheologe von der Katholischen Privatuniversität Linz dem epd. Theologisch spreche ebenfalls nichts dagegen, aber viel dafür, sagt Rosenberger.
Für Roswitha Schupp zumindest war es "wie eine Erlösung", als sie die Möglichkeit der Mensch-Tier-Bestattung entdeckt hat: "Eine große Last war weg."
NRW stellt weitere Maßnahmen gegen Lehrermangel vor
Mit Gehaltszulagen will NRW Lehrkräfte an besonders stark unterbesetzte Schulen locken. Finanzielle Anreize gibt es auch für bereits pensionierte Lehrkräfte, die in den Schuldienst zurückkehren.Düsseldorf, Dortmund (epd). Im Kampf gegen den Lehrermangel setzt die NRW-Landesregierung auf finanzielle Anreize. Schulen, die besonders große Probleme bei der Stellenbesetzung haben, könnten potenzielle zusätzliche Lehrkräfte mit monatlichen Gehaltszuschlägen von 350 Euro brutto locken, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am 21. November an. Die Maßnahme ist befristet auf zweieinhalb Jahre. Auch die Hinzuverdienstgrenze für pensionierte Lehrer soll bis 2024 weiter ausgesetzt werden, so dass sie ohne Abzüge von ihrem Ruhegehalt erneut im Schuldienst arbeiten können. Lehrerverbände und die Grünen im NRW-Landtag sehen diese Maßnahmen kritisch.
Hoher Bedarf im Ruhrgebiet
Für die Zuschläge stellt das Land von 2020 bis 2022 insgesamt 17 Millionen Euro bereit. Bis zu 1.700 Lehrkräfte sollen so für Schulen in Regionen mit hohem Bedarf wie vor allem dem Ruhrgebiet gewonnen werden. "Wir setzen damit zusätzliche Anreize", sagte die Ministerin. Insbesondere an Grund- und Förderschulen, Berufskollegs und in der Sekundarstufe I fehlen Lehrer - in den nächsten zehn Jahren geschätzt 15.000. Dagegen gibt es für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen einen deutlichen Überhang von rund 16.000 Bewerbern.
Die Zuschüsse sind Teil des sogenannten dritten Maßnahmenpakets der Landesregierung gegen den Lehrermangel. Dazu gehört auch, die Hinzuverdienstgrenze für pensionierte Lehrer bis 2024 weiter auszusetzen. "Es soll sich für Pensionäre lohnen, wieder zurückzukehren", erläuterte Gebauer. Aktuell seien bereits rund 800 wieder in den Schulen aktiv.
Rund 700 neue Studienplätze für angehende Lehrer geplant
Die Wiedereinstellung von Pensionären sowie das Angebot an stellenlose Gymnasiallehrer, übergangsweise in Grundschulen zu unterrichten, gehören zu den ersten beiden Maßnahmenpaketen der Landesregierung. Teil davon ist außerdem die Anwerbung von Seiteneinsteigern, die in Grundschulen Englisch, Sport, Musik oder Kunst unterrichten können. Mehr als 700 konnten dafür laut Gebauer bislang gewonnen werden. Knapp 400 Sekundarstufe II-Lehrer hätten das Angebot einer Dauerbeschäftigung an einer Grundschule angenommen.
Auch mit einem Ausbau der Studienplatz-Kapazitäten will das Land dem Lehrermangel begegnen. Allein in der laufenden Legislaturperiode seien mehr als 700 neue Studienplätze für angehende Lehrer geplant, kündigte Gebauer an. Für die sonderpädagogische Förderung seien 750 neue Lehramts-Studienplätze vorgesehen.
Lehrergewerkschaft wenig überzeugt
Die Lehrergewerkschaft VBE zeigte sich von dem neuen Maßnahmenpaket wenig überzeugt. Die geplanten Zulagen seien angesichts der ohnehin bestehenden ungleichen Besoldung von Lehrämtern kritisch zu sehen. "Das ist sehr heikel für den Frieden in den Kollegien", erklärte der Landesvorsitzende des VBE NRW, Stefan Behlau, in Dortmund.
Ähnlich sieht das auch die Vorsitzende von Lehrer NRW, Brigitte Balbach. "Eine solche Zulage wird zu Unfrieden in den Kollegien führen, denn dort bekommen dann andere weniger Geld, die an der gleichen Schule schon seit Jahren engagiert arbeiten." Das Kernproblem bleibe die schlechtere Bezahlung von Lehrkräften.
Auch die bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Sigrid Beer, kritisierte die angekündigten Maßnahmen. Die geplante Zulage zeige, "dass die Frage der Attraktivität von Stellen auch eine Frage der Besoldung ist". Umso enttäuschender sei es, dass die Besoldungsanpassung für Grundschul- und Sekundarstufe-I-Lehrkräfte weiter auf sich warten lasse. "Somit gehen die Lehrkräfte, die schon lange an diesen Schulen arbeiten, immer noch leer aus", kritisierte Beer.
Wirtschaft und Informatik werden Pflichtfächer an NRW-Schulen
Düsseldorf (epd). Die Fächer Wirtschaft und Informatik sollen in NRW künftig bei allen Schulformen der Sekundarstufe I unterrichtet werden. Den Entwurf für eine entsprechende Verordnung habe das Landeskabinett heute gebilligt, teilte das Bildungsministerium am 19. November in Düsseldorf mit. Bis Anfang/Mitte Januar 2020 haben nun verschiedene am Schulleben beteiligte Verbände Zeit, sich zu dem Entwurf zu äußern.
Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, vertiefte ökonomische Kompetenzen und grundlegende digitale Kenntnisse seien mittlerweile "selbstverständlich ein unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung". Ein erfolgreicher Berufseinstieg sei ohne dieses Wissen kaum noch möglich.
Die geplante Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung sieht vor, dass an allen nicht-gymnasialen Schulformen der Sekundarstufe I das Fach Wirtschaft zum Schuljahr 2020/21 eingeführt wird. An Gymnasien wurde das Schulfach Wirtschaft/Politik bereits im aktuellen Schuljahr mit der Rückkehr zu G9 eingeführt.
Informatik soll den Angaben zufolge an allen Schulformen in den Klassen 5 und 6 zum Schuljahr 2021/22 zum Pflichtfach werden. Alle Kinder sollen dabei Grundkenntnisse im Programmieren und Medienkompetenzen erlernen. Für das Vorhaben seien noch Lehrpläne zu entwickeln und Lehrkräfte zu qualifizieren. Bisher ist Informatik an vielen Schulen ein Wahlpflicht-Fach.
NRW-Wald so krank wie nie: Nur noch jeder fünfte Baum gesund
Hitze, Stürme, Trockenheit, Käfer- und Pilzbefall. "Unser Wald ist krank", sagt NRW-Umweltministerin Heinen-Esser. Nur noch jeder fünfte Baum ist laut Waldzustandserhebung gesund.Düsseldorf (epd). Nach zwei überdurchschnittlich trockenen Jahren in Folge geht es dem Wald in Nordrhein-Westfalen so schlecht wie noch nie. Nach der am 25. November in Düsseldorf vorgestellten Waldzustandserhebung 2019 ist nur noch jeder fünfte Baum gesund. Dagegen litten jetzt 42 (Vorjahr: 39) Prozent der Bäume unter einer deutlichen Ausdünnung ihrer Kronen. Es sind demnach die schlechtesten Werte seit Beginn der Erhebungen vor 35 Jahren.
"Die Waldschäden sind besorgniserregend. Unser Wald ist krank", bilanzierte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). "Uns muss dringend eine Trendumkehr gelingen." Hitze, Stürme und die außergewöhnliche Trockenheit haben dem Bericht zufolge deutliche Spuren in den Wäldern hinterlassen. Betroffen sei vor allem die Fichte, die mit 30 Prozent den größten Anteil am Wald habe. Weil sie nur flach wurzelt, macht ihr den Angaben zufolge Trockenheit schneller zu schaffen als anderen Baumarten. Zudem sei ein großer Teil der Fichtenbestände durch den massiven Befall mit Borkenkäfern als Folge der Dürre abgestorben, hieß es.
Situation der Eiche verschlechtert
Auch bei der Eiche (Anteil: 17 Prozent) hat sich die Lage weiter verschlechtert. Diese Baumart leidet demnach neben der Trockenheit unter einem Pilzbefall sowie blattfressenden Insekten, die starke Schäden in den Baumkronen angerichtet haben. Ebenso trug die Kiefer (8 Prozent Anteil) neben den Witterungsbeeinträchtigungen weitere Schäden durch Pilz- und Käferbefall davon. Nur bei der Buche (Anteil: 19 Prozent) verbesserte sich der Zustand der Baumkronen leicht. Allerdings litten hier bereits 82 Prozent des Bestands unter Kronenverlichtung.
Die Forstbehörden hofften, dass das kommende Jahr nicht ebenso trocken und warm ausfällt wie 2018 und 2019. Denn noch immer sind die Waldböden in den tieferen Schichten trotz der jüngsten größeren Regenfälle zu trocken, wie die Erhebung ergab. Und auch die Schäden durch Borkenkäfer hätten ihren Höhepunkt voraussichtlich noch nicht erreicht. Bei den Fichten wurden 2019 und 2018 knapp 19 Millionen Kubikmeter Schadholz aus den Beständen geholt.
Ziel: Klimastabiler Mischwald
Für die Schadenbewältigung hat das Land NRW den Waldbauern - knapp zwei Drittel des Waldes sind in privater Hand - kurzfristig 8,6 Millionen Euro Hilfe bereitgestellt, von denen bereits 7,5 Millionen Euro bewilligt wurden. Für die weitere Entwicklung des Waldes hin zu einem klimastabileren Mischwald sind im Rahmen des NRW-Waldbaukonzepts für die kommenden zehn Jahre 100 Millionen Euro vorgesehen. Damit soll unter anderem die Neubepflanzung mit geeigneten Baumarten wie der Douglasie oder der Roteiche unterstützt werden. "Aber dies wird nicht reichen", betonte Heinen-Esser. "Die Waldentwicklung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern."
Vor diesem Hintergrund macht sich das Land NRW für die Einführung einer bundesweiten Baumprämie stark. Sie soll mit Einnahmen aus CO2-Zertifikaten finanziert werden, über die Energieerzeuger und Industrie für den Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid zur Kasse gebeten werden. Weil der Wald in großem Umfang CO2 speichere, müssten dort auch Erlöse aus den Zertifikaten ankommen, sagte die Ministerin.
Als weiteres, regionales Instrument zur Honorierung der Klimaschutzleistungen des Waldes schlägt Heinen-Esser die Einrichtung eines NRW-Waldfonds vor: "Damit könnten wir ein regionales Angebot zur CO2-Kompensation schaffen, mit dem öffentliche Mittel und freiwillige Ausgleichsbeiträge von Unternehmen und Privatpersonen gebündelt werden." Das Ministerium prüfe derzeit die rechtlichen und organisatorischen Maßnahmen für diese Idee.
Umweltministerin kündigt Überprüfung der Klimaanpassungsstrategie an
Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen will sich besser für die Folgen des Klimawandels rüsten. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) kündigte eine Überprüfung der sogenannten Klimaanpassungsstrategie an. "Extremereignisse wie Hitze oder Starkregen werden unseren Alltag künftig noch stärker bestimmen", erklärte sie am 20. November in Düsseldorf. Zum Auftakt der Konferenz "Klimawandel in Nordrhein-Westfalen - Vorsorge durch Anpassung" mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kommunen und Verbänden verwies die Ministerin auf deutlich messbare Klimaveränderungen im Bundesland in den vergangenen Jahren.
Die Jahre 2014 und 2018 waren demnach in NRW mit einer Durchschnittstemperatur von elf Grad Celsius die wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen Ende der 1950er Jahre. 2018 war es seit 1959 zwischen Eifel und Weserbergland noch nie so trocken. Am 25. Juli wurde in diesem Jahr mit 41,2 Grad Celsius ein neuer Hitzerekord für Nordrhein-Westfalen aufgestellt.
Die vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ausgewerteten Daten im Klimafolgenmonitoring zeigten zudem eine signifikante Zunahme warmer und heißer Tage und eine Abnahme der Frost- und Eistage, betonte die Ministerin. Auch die Gewässertemperatur im Rhein steige. Klimamodelle projizierten für Nordrhein-Westfalen eine Temperaturzunahme von 2,8 bis 4,4 Grad Celsius für den Zeitraum 2071 bis 2100 im Vergleich zum Zeitraum 1971 bis 2000 - unter der Voraussetzung, dass sich der weltweite CO2-Ausstoß so weiterentwickelt wie bisher.
Nordrhein-Westfalen prüfe, für den Ausbau und eine Verstetigung der Klimaanpassungsstrategie eine eigenständige rechtliche Grundlage zu schaffen, erklärte Heinen-Esser. Grundlage bilde die 2009 entwickelte Klimaanpassungsstrategie, die 2015 im Klimaschutzplan des Landes fortgesetzt wurde. Derzeit werde im Lanuv ein Klimafolgen- und Anpassungsmonitoring erstellt, mit dem der Erfolg bisher durchgeführter Maßnahmen untersucht werden soll.
Vom Klimawandel seien insbesondere urbane Räume betroffen, erklärte Heinen-Esser. Sturm, Hagel, Starkniederschlag, aber auch Hitze führten in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr zu Sachschäden an Gebäuden und wirkten sich in Regionen mit hoher Infrastrukturdichte negativ mit einer hohen Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung aus. In den Sommermonaten würden in den Städten im Vergleich zum Umland bis zu zehn Grad Temperaturunterschied gemessen.
Mit einer Service-Stelle, die ab 2020 bei der Emschergenossenschaft eingerichtet wird, sollen im Ruhrgebiet Projekte für eine integrierte wassersensible Stadtentwicklung mit Nutzung von städtischem Grün in den Kommunen vorangetrieben werden.
Soziales
Butterkuchen bei Eva Radieschen

epd-bild/Dieter Sell
Bremen (epd). Schlicht muss es sein. Ein Butterkuchen zum Beispiel, der gerne zu allen freudigen und traurigen Anlässen des Lebens serviert wird. Oder eine warme Suppe mit Kartoffeln, Kürbis oder Gemüse, je nach Jahreszeit. "Aus dem großen Topf für alle, wie man das von Oma kennt", beschreibt Eva Radieschen die Wünsche, die Trauernde vorbringen. In ihrem "Café Radieschen" direkt neben dem Buntentor-Friedhof in der Bremer Neustadt organisiert sie nach Beerdigungen oft einen Leichenschmaus. "Da fallen Trauer und Humor zusammen", hat die 41-jährige Gastronomin und Kulturmanagerin erfahren.
Im Odenwald heißt der Leichenschmaus "Flannerts", was sich vom "flennen" oder "weinen" ableitet. Andernorts sagt man Trauercafé, Leidessen, Tränenbrot oder Tröster, im Rheinischen auch Reueessen. Manche sprechen lockerer vom "Fell versaufen". Auch wenn sich die Bezeichnungen je nach Region unterscheiden mögen - gemeint ist nach einem uralten Brauch immer das Gleiche: "Nach der Beerdigung steht das gemeinsame Trauermahl für eine Zuwendung zum Leben", sagt der Bremer Theologe und Trauerexperte Klaus Dirschauer.
"Leichenschmaus hilft"
Nach dem Abschied und der Bestattung sei die Stimmung oft emotional aufgeladen, sagt Eva Radieschen. "Der Leichenschmaus hilft, bringt Erleichterung." Sie beobachtet: "Wichtig ist die Gemeinschaft, sind die Anekdoten über den Verstorbenen, die dann erzählt werden können. Das befreit." Dann wärmen Geschichten, Kaffee und Suppen auch seelisch. Die Einrichtung ihres Cafés, eine ehemalige Friedhofsgärtnerei, trägt dazu bei: Eva Radieschen hat es liebevoll mit Sammeltassen und alten Kaffeekannen geschmückt, die Erinnerungen anregen.
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen - das gilt wohl ganz besonders für den Leichenschmaus, der zu den alten Traditionen rund um Trauerfeier und Bestattung zählt. Ein Gemeinschaftsritual, das immer noch gepflegt wird, bestätigt Christian Stubbe, Vorsitzender des Bestatterverbandes in Bremen. "Mit dem Unterschied, dass im ländlichen Raum häufig noch die ganze Trauergemeinde zusammenkommt, in der Stadt gibt es das nicht mehr so regelmäßig und konzentriert sich meist auf den erweiterten Familienkreis."
Gut angelegtes Geld
Ob es bundesweit einen rückläufigen Trend gibt, was diesen Brauch angeht, ist schwer zu sagen. "Eine Statistik wird da nicht geführt", sagt Alexander Helbach, Sprecher der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas in Königswinter bei Bonn. Er könne nur abgeleitet von der wachsenden Zahl an Discount-Beerdigungen schließen, dass die Bedeutung des Totenmahls abnehme. Denn klar ist: Auch der Leichenschmaus kostet Geld.
Geld, das aber gut angelegt ist, sagen die Experten. Denn Familien sehen sich seltener als früher in großer Runde - oft ist es dann bei einer Beerdigung. Eva Radieschen ermutigt ihre Gäste bei diesen Gelegenheiten, den Leichenschmaus mitzugestalten. Vielleicht Musik beizusteuern, die der Verstorbene geliebt hat, und alte Fotos, die dann rumgereicht werden können. "Die Trauer selbst gestalten, das hilft", betont Radieschen. Sie backe auch Waffeln nach Familienrezept und besorge Schnaps, wenn auf den Toten angestoßen werden solle: "Normalerweise gibt es bei mir keinen Alkohol."
Nach dem Tod älterer Menschen sei es schon hoch hergegangen, erzählt sie. "Nach dem Tod eines Kindes habe ich das ganz anders erlebt." Doch insgesamt sei sie gerne Gastgeberin beim Leichenschmaus, sagt Eva Radieschen: "Ich freue mich über Anfragen und koche gerne Kaffee für Trauergesellschaften. Das ist mir eine Ehre."
Ein Dokument, das über Leben und Tod entscheidet
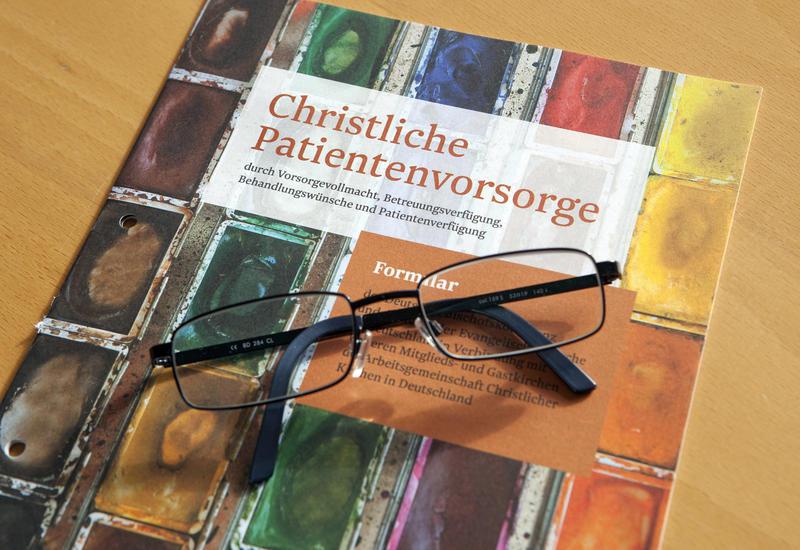
epd-bild / Guido Schiefer
Frankfurt a.M. (epd). Der Franzose Vincent Lambert lag nach einem Motorradunfall rund zehn Jahre lang im Wachkoma. Ob er sich gewünscht hätte, so lange künstlich am Leben erhalten zu werden, ist unklar. Seine Familie ist wegen dieser Ungewissheit heute zerstritten: Während seine Frau ihn "in Würde gehen lassen" wollte, beharrten die Eltern des inzwischen verstorbenen Patienten darauf, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu erhalten - es folgte ein jahrelanger Streit vor Gericht.
Das Familienzerwürfnis hätte Lambert verhindern können - wenn er seinen Willen in einer Patientenverfügung festgehalten hätte. Seit zehn Jahren können Bürger in Deutschland darin vorsorglich festlegen, ob und wie sie in bestimmten Situationen medizinisch behandelt werden möchten. Gut ein Drittel der Bevölkerung (35 Prozent) besitzt laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach eine Patientenverfügung. Weitere 43 Prozent der rund 1.300 befragten Personen gaben in der Allensbach-Umfrage an, noch eine Patientenverfügung verfassen zu wollen.
Alternative Vorsorgevollmacht
Mit der Patientenverfügung hat jeder die Möglichkeit, sich für den Fall zu wappnen, dass er sich einmal selbst nicht mehr äußern kann - etwa nach einem Unfall oder wegen einer schweren Erkrankung. "Das Dokument gibt dem Patienten ein hohes Maß an Sicherheit, dass sein Wille auch dann umgesetzt wird, wenn er ihn selbst nicht mehr artikulieren kann", sagte Benno Bolze, Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Doch bevor man eine Patientenverfügung erstellen kann, muss man wissen, welche Behandlung man wünscht und welche nicht. Möchte ich als bewegungsunfähiger Demenzkranker künstlich über eine Magensonde ernährt werden oder soll diese Maßnahme eingestellt werden? Möchte ich als Wachkoma-Patient bei einer Lungenentzündung noch ein Antibiotikum erhalten? Nicht jeder kenne eine Antwort auf solche Fragen, sagt Verena Querling von der nordrhein-westfälischen Verbraucherzentrale. "Viele Menschen haben keine Patientenverfügung, weil sie nicht entscheiden können, was sie wollen - und das ist so auch in Ordnung", findet die Referentin für Pflegerecht.
Sie rät, in diesem Fall zumindest eine Vorsorgevollmacht auszufüllen. Darin könne eine Person festlegen, wer für sie im Notfall gesundheitliche Entscheidungen übernehmen soll. Zusätzlich sollte man in regelmäßigen Abständen mit dem Menschen, der als Bevollmächtigter angegeben ist, über das Thema Tod sprechen, fügt Querling hinzu. "Es ist schwierig für jemanden, quasi über Leben und Tod zu entscheiden, wenn er nicht weiß, was der Betroffene gewollt hätte."
"Überlebenswille kann wachsen"
Die Patientenverfügung dient den Ärzten zwar als Handlungsgrundlage, sagt Bolze vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband. Trotzdem bleibe auch mit dem Dokument eine gewisse Unsicherheit. Es könne auch der Fall eintreten, dass die Situation im Krankenhaus nicht den Situationen entspreche, die die Person in der Patientenverfügung geschildert habe. "Es lässt sich nicht jedes Szenario vorhersehen", erklärt Bolze.
Zudem wies der Experte darauf hin, dass sich die Behandlungswünsche eines Menschen je nach Stadium der Krankheit verändern könnten. "Der Überlebenswille kann wachsen - auch dann, wenn sich der Mensch nicht mehr dazu äußern kann." Das müsse jeder wissen, der eine Patientenverfügung erstellt, fügt Bolze hinzu.
Der Franzose Vincent Lambert besaß keine Patientenverfügung. In seinem Fall hatte zuletzt das oberste Gericht in Frankreich entschieden: Die Richter stimmten der Entscheidung des Ärzteteams der Uniklinik in Reims zu, das die Behandlung Lamberts einstellen wollte. Der 42-Jährige starb schließlich im Juli dieses Jahres, nachdem er kein Wasser und keine Nahrung mehr über Magensonden erhielt. Lamberts Vater bezeichnete den Behandlungsstopp Medienberichten zufolge als "eine getarnte Ermordung, eine Sterbehilfe".
Studie sagt drastisch steigende Pflegekosten voraus
Gütersloh/Berlin (epd). Die Finanzierungsgrundlage der Pflegeversicherung gerät laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung angesichts einer rasant alternden Gesellschaft zunehmend unter Druck. Der Babyboom in den 1950er und 60er Jahren und eine steigende Lebenserwartung beschere Deutschland starke Rentnerjahrgänge, heißt es in der am 21. November in Gütersloh veröffentlichten Studie. Bis 2050 werden nach Schätzungen hierzulande 23,3 Millionen Menschen älter als 65 Jahre sein, etwa 30 Prozent mehr als heute. Damit wachse auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Der Pflegebeitrag von derzeit 3,05 Prozent (bzw. 3,3 Prozent für Kinderlose) könnte bis dahin auf 4,6 bis 4,9 Prozent steigen, wenn politisch nicht gegengesteuert wird, hieß es.
Das beauftragte Berliner Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos stellt in seiner Studie verschiedene Szenarien auf. Im Jahr 2050 gehen die Forscher von 5,3 Millionen Empfängern von Pflegeleistungen aus, im Vergleich zu heute wären das 1,8 Millionen mehr. Die Ausgaben der Pflegeversicherung würden nach dieser Annahme in 30 Jahren bei 181,3 Milliarden Euro liegen.
Stiftung: Jüngere Geneneration zu stark belastet
2017 betrugen die Kosten 38,5 Milliarden Euro. Für 2020 sagt das Institut Ausgaben aus der Pflegeversicherung in Höhe von 45,2 Milliarden Euro voraus, 2035 bereits 89,1 Milliarden, zehn Jahre später 145 Milliarden Euro. Mehrausgaben sind demnach auch durch eine Aufwertung des Altenpflegeberufs, etwa eine bessere Bezahlung, und eine Dynamisierung der Pflegeleistungen zu erwarten, hieß es.
Die Prognose zeige auch, dass von den finanziellen Mehrbelastungen vor allem die jüngeren Generationen betroffen wären, hieß es weiter. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter schrumpfe in den kommenden Jahren. Der Wechsel der geburtenstarken Jahrgänge von der Gruppe der Beitragszahler in die der Empfänger von Pflegeleistungen werde die Situation zusätzlich verschärfen.
Die Autoren der Studie schlagen als Lösung eine vorgezogene, moderate Anhebung des Beitragssatzes ab 2020 vor. Der solle mit einem über die Jahre steigenden Zuschuss aus Steuermitteln verbunden werden, um die zusätzlichen Kosten zu decken und zugleich die jüngere Generation zu entlasten, empfehlen sie. Dieser Bundeszuschuss läge zu Beginn bei jährlich 9,6 Milliarden Euro und würde bis 2050 auf 24,5 Milliarden Euro ansteigen. Die zunächst überschüssigen Mittel könnten dann in den bereits existierenden Pflegevorsorgefonds fließen und dazu dienen, den Beitragssatz bis 2050 stabil bei 3,5 Prozent zu halten, hieß es.
Wenn im Notfall die Klinik versperrt bleibt

epd-bild / Werner Krüper
Frankfurt a.M. (epd). Eine 30-jährige Mutter kommt in die Notaufnahme einer Klinik. Der Kreislauf rast, ihr ist schlecht. Nach einem Urintest nehmen die Ärzte an, dass die Patientin im Frühstadium schwanger sein muss. Doch im Ultraschall zeigt die Gebärmutter keine Auffälligkeit. Weil die Frau keine Papiere hat und zudem die Behandlung nicht selbst bezahlen kann, findet keine spezielle Laboruntersuchung statt. Die Patientin wird nach Hause geschickt. Vier Wochen später wird sie notoperiert. Grund: eine geplatzte Eileiterschwangerschaft.
Grundsätzlich hat jeder Mensch ein Recht auf Zugang zu medizinischer Versorgung im Notfall - unabhängig von seinem Aufenthaltsstatus. In der Praxis sehe das für die geschätzten 500.000 Menschen ohne Papiere jedoch ganz anders aus, heißt es bei der Diakonie: "Sie haben de facto keinen Zugang zum Gesundheitssystem." Eine Tatsache, die das Deutsche Institut für Menschenrechte schon im Jahr 2008 rügte.
Minimalversorgung funktioniert nicht
Mehr als zehn Jahre später ist nur wenig passiert, um die Situation zu ändern. Im August publizierte die "Bundesarbeitsgruppe Gesundheit/Illegalität" ein neues Forderungspapier. Denn: "Es ist für Menschen ohne Papiere weiterhin schwierig, ihren Rechtsanspruch auf Zugang zur Gesundheitsversorgung umzusetzen. (...) Die strukturell bedingte medizinische Unterversorgung hat weiterhin Bestand."
In Deutschland ist ihre Versorgung auf die Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sowie die Versorgung bei Schwangerschaft beschränkt, wie die Diakonie erläutert. Doch selbst diese Minimalversorgung funktioniere oft nicht.
Denn die Menschen könnten sich nicht sicher sein, dass ihre Daten nicht doch an die Behörden weitergereicht würden, wenn sie im Notfall ein Krankenhaus aufsuchten, erläutert die Bundesarbeitsgruppe. Zudem greife die Kostenübernahme bei Notfällen durch das Sozialamt nur in einem Bruchteil der Fälle - eine finanzielle Belastung der Kliniken. Deshalb verwehrten die Krankenhäuser den Betroffenen oft eine sofortige Behandlung im medizinisch notwendigen Umfang.
Zwar gebe es inzwischen etliche lokale Projekte etwa zum "Anonymen Krankenschein", zu "Humanitären Sprechstunden" oder Clearingstellen beim Streit mit Krankenkassen, "doch eine flächendeckende Versorgung ist damit noch lange nicht erreicht", betont Marie von Manteuffel, Geschäftsführerin des Katholischen Forums Leben in der Illegalität. Zudem beschränkten sich die meisten dieser Initiativen nur auf eine Grundversorgung.
"Alle Menschen gleich behandeln"
Für Menschen ohne Papiere müssten strukturelle Lösungen gefunden werden, die einen angstfreien Zugang zu einer menschenwürdigen Gesundheitsversorgung sicherstellten, sagte Peter Bobbert, Menschenrechtsbeauftragter der Bundesärztekammer, dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Für Ärztinnen und Ärzte ist es bedeutungslos, woher ein Mensch kommt. Sie behandeln alle Menschen gleich, die in den Wartezimmern von Praxen und Kliniken sitzen."
Die Bundesregierung sieht jedoch keinen Handlungsbedarf: "Die geltende Rechtslage erlaubt eine angemessene gesundheitliche Versorgung des angesprochenen Personenkreises", heißt es in der Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion vom Juli 2018. Die Versorgung sei in Not- oder Akutsituationen "über den zuständigen Träger der Sozialhilfe oder über das Asylbewerberleistungsgesetz sichergestellt". Für eine Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse bestehe kein Erfordernis.
"Es ist ein Armutszeugnis, dass diese Menschen keine bedarfsgerechte gesundheitliche Versorgung erhalten", kritisiert dagegen Harald Weinberg, der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Bei der Bundesregierung sei seine Partei stets auf taube Ohren gestoßen: "Union und SPD wollen hier nicht handeln." Die Linkspartei fordere eine anonyme Gesundheitskarte für Menschen ohne Papiere. Diese müsse, abgesehen vom Passbild, anonymisierte Daten enthalten, denn andernfalls würden die Betroffenen eine Weitermeldung an die Ausländerbehörden befürchten.
Für die Grünen sagte deren Sprecherin für Migrations- und Integrationspolitik, Filiz Polat, dem epd: "Übergeordnetes Ziel muss die Aufnahme der Betroffenen in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung sein." Die Grünen setzten sich deshalb für die Einführung des anonymisierten Krankenscheins ein.
Vermittlung von Hausarzt-Terminen stößt auf wenig Resonanz
Seit Mai vermitteln die Servicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen neben Facharztterminen auch Termine bei Haus- und Kinderärzten. Das Angebot wird allerdings nur wenig genutzt, wie eine epd-Umfrage belegt.Düsseldorf, Saarbrücken (epd). Der Service der Kassenärztlichen Vereinigungen für Haus- und Kinderarzttermine wird nur sehr verhalten in Anspruch genommen. Seit dem Start des gesetzlich vorgeschriebenen Angebotes im Mai kamen mithilfe der kassenärztlichen Servicestellen lediglich rund 3.000 Termine zustande, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes ergab. Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 100.000 Termine bei Fachärzten und Psychotherapeuten vermittelt. Insgesamt gibt es laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung rund 553 Millionen Behandlungsfälle in deutschen Praxen pro Jahr.
Im Saarland vermittelte die Kassenärztliche Vereinigung von Mai bis Ende September zwei Termine bei Kinderärzten und sieben bei Hausärzten. Zur gleichen Zeit wurden im kleinsten Flächenbundesland jedoch 1.009 Facharzttermine vergeben.
In Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, vermittelten die Servicestellen bislang 339 Termine bei Haus- und Kinderärzten, während es bei Fachärzten und Psychotherapeuten 23.370 Termine waren. Die meisten Vermittlungen wurden in Hessen (486) und Niedersachsen (480) verzeichnet. Die wenigsten Termine wurden in Schleswig-Holstein vergeben (22).
Das Angebot an Terminen überwiegt häufig die Nachfrage. So haben zum Beispiel im Juli die Berliner Hausärzte rund 1.000 freie Termine gemeldet, von denen nur neun von der Termin-Servicestelle vermittelt werden konnten.
Kritik an hohem Aufwand
Seit 2016 gibt es Termin-Servicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), die Patienten Termine bei Fachärzten vermitteln. Mit Inkrafttreten des Terminservice- und Versorgungsgesetzes im Mai sind sie auch für die Terminvermittlung bei Kinder- und Hausärzten zuständig.
Die Kassenärztlichen Vereinigungen hatten von vornherein mit einer geringen Resonanz gerechnet, wie die epd-Umfrage ergab. "Die geringe Inanspruchnahme der Terminservicestellen zeigt, dass die bewährten Wege der Terminvereinbarung bei einem Arzt - trotz anderslautender Aussagen der Politik - funktionieren", sagte der Sprecher der KV Schleswig-Holstein, Marco Dethlefsen.
Nach Darstellung der KV Westfalen Lippe lässt sich das geringe Interesse womöglich darauf zurückführen, dass sich Patienten ihren Haus- und Kinderarzt als ersten Ansprechpartner immer noch selbst aussuchen wollen. Die KV Bayern verwies auf OECD-Studien, wonach der Zugang zu niedergelassenen Haus- und Fachärzten sowie Psychotherapeuten in Deutschland niederschwellig möglich ist und die Wartenzeiten als niedrig eingestuft werden.
Für das Saarland bezeichnete die zuständige KV die ländliche Struktur als einen Grund für die bislang geringe Inanspruchnahme der Terminvermittlung. Denn im ländlichen Raum verfügten Patienten in der Regel über einen Haus- und Kinderarzt, so dass der Bedarf einer Vermittlung kleiner als beispielsweise in städtischen Strukturen sei.
Der KV-Sprecher in Niedersachsen, Detlef Haffke, kritisierte den hohen organisatorischen Aufwand, der in die Servicestellen investiert werden müsse. Insgesamt hätten die vergangenen drei Jahre gezeigt, dass zwar viele Patienten dort anriefen, es aber nur selten zu Vermittlungen komme: "Patienten wollen bei ihrem Wunscharzt an einem Wunschort einen Wunschtermin. Dies kann die Terminservicestelle nicht leisten."
Leises Leiden - Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
In Deutschland leiden laut einer Studie rund vier Prozent aller Kinder und Jugendlichen an Depressionen oder Angststörungen. Experten fordern Verbesserungen bei der Behandlung der Betroffenen.Berlin (epd). In Deutschland zeigt jedes vierte Schulkind (24 Prozent) einer Studie zufolge psychische Auffälligkeiten. Dazu zählen etwa Sprach- oder motorische Störungen sowie andere weitere Entwicklungsstörungen, wie aus dem am 21. November in Berlin veröffentlichen "Kinder- und Jugendreport 2019" der DAK Gesundheit hervorgeht.
Beispielsweise leiden zwei Prozent der Kinder zwischen zehn und 17 Jahren an einer diagnostizierten Depression und ebenso viele unter Angststörungen. Laut der repräsentativen Studie der Krankenkasse sind davon bundesweit rund 238.000 Kinder und Jugendliche betroffen, wobei Mädchen doppelt so häufig wie Jungen daran erkranken.
Chronische körperliche Krankheiten erhöhen demnach das Risiko für eine Depression im Kinder- und Jugendalter deutlich. Auch das familiäre Umfeld sei ein Faktor: "Kinder seelisch kranker oder suchtkranker Eltern sind besonders gefährdet", sagte DAK-Vorstandschef Andreas Storm.
Mehrfach im Krankenhaus
Der Krankenkassen-Chef verwies darauf, dass eine Depressionen bei vielen Mädchen und Jungen der Grund für eine Klinikeinweisung sei. Fast acht Prozent aller depressiven Schulkinder würden innerhalb eines Jahres stationär behandelt, durchschnittlich für 39 Tage.
Die Quote der Rehospitalisierung - also einer erneuten Krankenhaus-Einweisung - liege bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen bei 24 Prozent. Dieser Anteil sei "zu hoch und nicht akzeptabel", kritisierte Storm. Im Anschluss an den Klinikaufenhalt gehe die Behandlung der Betroffenen oft nicht nahtlos weiter, "obwohl das für den langfristigen Behandlungserfolg von großer Bedeutung ist". Der DAK-Chef forderte, bestehenden Versorgungslücken zu schließen.
Betroffene Kinder und Jugendliche "leiden oft leise bevor sie eine passende Diagnose bekommen", sagte Storm weiter. Er rief zu mehr Aufmerksamkeit "in der Familie, in der Schule, in der Freizeit zum Beispiel im Sportverein" auf. "Depression bei Kindern und Jugendlichen darf kein Tabu-Thema bleiben", betonte Storm.
Antriebslosigkeit, Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen könnten mögliche Symptome für eine psychische Erkrankung sein, erklärte Silke Wiegand-Grefe, Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Bei kleineren Kindern seien es oft auch Bauchschmerzen oder ständiges Unwohlsein. Das engere soziale Umfeld sollte in solchen Fällen immer versuchen, in Kontakt und im Gespräch mit dem betroffenen Kind zu bleiben.
"Spitze des Eisbergs"
Dass Mädchen doppelt so häufig wie Jungen von Depressionen und Angststörungen betroffen seien, begründete Wiegand-Grefe mit den unterschiedlichen Konfliktstrategien: "Mädchen internalisieren Probleme eher. Sie ziehen sich eher in sich zurück. Jungen externalisieren eher Probleme, was sich auch in Gewalt ausdrücken kann."
Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, bezeichnete die Studienergebnisse als "Spitze des Eisbergs". Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.
Für den "Kinder- und Jugendreport 2019" wurden Abrechnungsdaten von knapp 800.000 minderjährigen DAK-Versicherten der Jahre 2016 und 2017 herangezogen. Geleitet hat die Studie der Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner von der Universität Bielefeld.
Zwei Berliner Frauenärzte wegen Zwillingstod verurteilt
In Berlin sind zwei Gynäkologen wegen Totschlags verurteilt worden. Ein juristisch eindeutiger Fall, sagt das Gericht. Ein medizinisch komplizierter Fall, sagen andere.Berlin (epd). Das Berliner Landgericht hat zwei Frauenärzte wegen gemeinschaftlichen Totschlags an einem Zwilling zu mehrmonatigen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Strafen werden zu zwei Jahren Bewährung ausgesetzt, wie Richter Matthias Schertz am 19. November bei der Urteilsverkündung sagte. Die Gynäkologen wurden für schuldig befunden, im Juli 2010 einen lebensfähigen Zwilling mit schwerer Hirnschädigung bei der Geburt getötet zu haben.
Die Gynäkologin Babett R. wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Ihr früherer Vorgesetzter Klaus V. zu einem Jahr und neun Monaten. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden. (AZ: 532 KS 7/16)
Die Mutter hatte einer Spätabtreibung des kranken Fötus zugestimmt. Ein sogenannter selektiver Fetozid wäre in diesem Fall rechtlich zulässig gewesen. Als bei der Frau jedoch schon in der 32. Schwangerschaftswoche die Wehen einsetzen, hätten die Frauenärzte entschieden, das gesunde Kind per Kaiserschnitt auf die Welt zu holen.
Tödliche Injektion
Unmittelbar danach sei von den Medizinern die Nabelschnur des noch im Mutterleib befindlichen kranken Zwillings abgeklemmt worden, bis der Herzschlag zum Stillstand kam. Danach sei eine tödliche Kaliumchloridinjektion in die Nabelschnur gespritzt worden.
Es handele sich um einen juristisch eindeutigen Fall, sagte der Richter. Weil die Geburt bereits begonnen hatte, sei das Vorgehen der Ärzte zu diesem Zeitpunkt Totschlag gewesen und keine Spätabtreibung mehr.
Beobachter gehen davon aus, dass der Fall künftig weitere Instanzen beschäftigt und möglicherweise vor dem Bundesgerichtshof landet. Weil es sich um eine eineiige Zwillingsschwangerschaft mit einer Plazenta gehandelt hatte, wäre ein selektiver Fetozid - also die Spätabtreibung des kranken Fötus vor der Geburt - auch mit gesundheitlichen Risiken für den gesunden Zwilling verbunden gewesen.
Dieses Restrisiko räumte der Richter ein. Dennoch sei der vorliegende Fall keine Grauzone: "Das Abtöten nach Beginn der Geburt ist nicht zulässig." Die Angeklagten hätten sich bewusst über geltendes Recht hinweggesetzt.
Für die Tötung des Zwillings sei allein der Wunsch der Mutter ausschlaggebend gewesen, begründete Schertz das Urteil weiter. Zum Zeitpunkt der Tötung sei von dem kranken Kind "keinerlei Gefahr für das gesunde Kind ausgegangen". Das kranke Kind wäre lebensfähig gewesen.
Minderschwerer Fall
Das Berliner Landgericht bewertete den Totschlag dennoch als minderschweren Fall, weshalb die Strafen vergleichsweise niedrig ausfielen. Totschlag wird normalerweise mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren geahndet.
Der Richter begründete die niedrigere Strafe damit, dass die Tat schon lange zurückliege und beide Ärzte geständig seien. Der Gynäkologin Babett R. drohe zudem in Folge des Prozesses der Verlust der Approbation. Ihr früherer Chef Klaus V. ist bereits pensioniert. Zudem habe sich die Frauenärztin einsichtig gezeigt, ihr früherer Chef indes nicht.
Im Sommer 2013 waren den Angaben zufolge mehrere anonyme Anzeigen gegen die Frauenärzte eingegangen. Der Anzeigende habe sich selbst "Mitarbeiter" der Klinik genannt, der Spätabtreibungen nicht mehr hinnehmen wolle. Die Staatsanwaltschaft hatte danach Ermittlungen aufgenommen und 2016 Anklage erhoben.
"Mit uns kann man ganz normal Spaß haben"

epd-West/ Claudia Rometsch
Köln (epd). "Am Anfang hatten wir ein Problem", berichtet Florian Lintz. "Die Studierenden saßen auf der einen Seite, wir auf der anderen." Das war die Ausgangssituation, als die sieben Teilnehmer des Ausbildungslehrgangs "Inklusive Bildung" Anfang November ihren ersten Einsatz als Dozenten an der Technischen Hochschule Köln hatten. Doch das Eis zwischen den Studierenden und den sieben angehenden Inklusions-Fachkräften, die geistige und zum Teil auch körperliche Behinderungen haben, war schnell gebrochen. "Jetzt läuft es", sagt Amandj Hosenyi. Mit Lintz, Hosenyi und ihren fünf Kolleginnen und Kollegen unterrichten erstmals in Nordrhein-Westfalen Menschen mit geistiger Behinderung an einer Hochschule.
Im April begannen sie ihre dreijährige Ausbildung. Aber schon im Rahmen des Lehrgangs sind die angehenden Bildungsfachkräfte als Vermittler in Sachen Inklusion aktiv. Bereits an 15 Veranstaltungen und Seminaren mit rund 300 Studierenden haben sich die Lehrgangsteilnehmer nach Angaben des Instituts für Inklusive Bildung NRW beteiligt. Unter anderem starteten sie ihr eigenes Pilot-Seminar für Studierende des Studiengangs "Pädagogik der Kindheit und Familienbildung" an der Technischen Hochschule Köln.
Seminar "Meine Lebenswelt" gefragt
Das Seminar zum Thema "Meine Lebenswelt" sei von den Studierenden sehr gut angenommen worden, sagt Andrea Platte, Prodekanin an der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften. "In dem Seminar geht es darum, zu erklären, wie es ist, mit einer Behinderung zu leben", erklärt Florian Lintz. "Zuerst hatten die glaube ich Angst vor uns", meint Amandj Hosenyi. Doch das habe sich mittlerweile gelegt, betont Lintz. "Die Studierenden sind sehr offen und suchen das Gespräch mit uns."
Bei der Veranstaltung handelt es sich um das erste Praxis-Modul des Lehrgangs. Während der dreijährigen Ausbildung lernen die künftigen Inklusions-Experten, Studierenden und Lehrkräften an nordrhein-westfälischen Hochschulen die speziellen Bedarfe und Kompetenzen von Menschen mit Behinderungen zu vermitteln. Nach Abschluss des Lehrgangs sollen die Bildungsfachkräfte Seminare, Workshops oder Gruppenveranstaltungen an Hochschulen abhalten. Dabei werden sie von einer pädagogischen Assistenz oder einer hauptamtlichen Lehrkraft unterstützt. Themen werden zum Beispiel Barrierefreiheit oder die Anforderungen an einen inklusionsorientierten Arbeitsplatz sein.
Das Eis brechen
Florian Lintz zum Beispiel möchte bei den Studierenden Verständnis dafür wecken, wie es ist, mit einer Lernbehinderung und einer Spastik zu leben. "Woher sollen sie das auch wissen?", fragt der 29-Jährige. "Wenn wir nicht das Eis brechen, können wir das auch nicht von anderen verlangen." In den ersten Seminarsitzungen sei es vor allem darum gegangen, die Lebenswelten der sieben behinderten Lehrgangsteilnehmer mit der der Studierenden zu vergleichen.
Ein Hauptunterschied ist für Lintz: "Sie können sich Schule, Studium oder Job aussuchen. Wir nicht." Die Studierenden hätten schnell festgestellt, dass Menschen mit Behinderungen es in vieler Hinsicht schwerer hätten. "Zum Beispiel auch bei den Hobbys. Ich wollte immer gerne schwimmen, habe aber keinen Verein gefunden, in den ich passe," berichtet Lintz. Letztlich gehe es auch darum, einfach Berührungsängste abzubauen, sagt Lehrgangsteilnehmer Fabian Hesterberg. "Mit uns kann man ganz normal Spaß haben. Und das ist für mich Inklusion."
Nach Abschluss ihrer Ausbildung soll den Bildungsfachkräften eine reguläre Anstellung im ersten Arbeitsmarkt angeboten werden. Dazu ist die Gründung eines Inklusionsunternehmens vorgesehen. Außerdem soll es Kooperationen mit weiteren nordrhein-westfälischen Hochschulen geben. Neben der TH Köln sind nach Angaben des Instituts für inklusive Bildung unter anderem bereits Kontakte zur Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum, zur Technischen Universität Dortmund, zur Universität Köln und zur Universität Bielefeld geknüpft.
Gefördert wird das Projekt vom Landschaftsverband Rheinland (LVR), der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW und der Kämpgen-Stiftung. In Schleswig-Holstein wurde ein vergleichbarer Ausbildungsgang bereits erfolgreich abgeschlossen. Derzeit laufen ähnliche Lehrgänge auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg.
Eben-Ezer gedenkt Euthanasie-Opfern
Lemgo (epd). Mit einem Gottesdienst hat die evangelische Stiftung Eben-Ezer am 20. November in Lemgo der kranken und behinderten Menschen in der Region gedacht, die in der NS-Zeit Opfer der sogenannten Euthanasie-Morde geworden sind. In seiner Predigt zum Buß- und Bettag rief der Theologische Kirchenrat der Lippischen Landeskirche, Tobias Treseler, zu Widerspruch gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit auf. Christen sollten sich "energisch dafür einsetzen, dass Rassismus in Zukunft keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft einnimmt - weder am Rande noch in der Mitte", forderte der Theologe.
Kirchenrat Treseler ruft zu Widerspruch auf
Erinnerungs- und Gedenkkultur bedeute auch, stets das Bewusstsein und die Maßstäbe des Einzelnen und der Gesellschaft zu schärfen. "Denn wenn wir ernsthaft auf die Vergangenheit blicken, geht es immer auch um unsere Verantwortung für diese Zukunft", sagte Treseler laut Redetext. Deshalb sollte heute menschenverachtenden und ständig die Grenzen des Sagbaren überschreitenden Äußerungen aus der Mitte der rechtspopulistischen Partei AfD deutlich widersprochen werden. "Damit sich unser Land nicht noch einmal vergisst", betonte der Theologe.
Eine neue Biografie über den langjährigen Leiter Eben-Ezers, Herbert Müller (1906-1968), belegt die Beteiligung der diakonischen Stiftung an Zwangssterilisationen während des Nationalsozialismus. Auf der Grundlage des im Jahr 1933 verabschiedeten "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" wurden laut neuester Forschung in Eben-Ezer 94 Bewohner, die meisten von ihnen unter 20 Jahren, unfruchtbar gemacht. In den Folgejahren wurden 87 Frauen und Männer, ein Drittel der Bewohner von Eben-Ezer, verlegt. Viele von ihnen wurden in Vernichtungslagern umgebracht.
Die Stiftung Eben-Ezer hatte bereits 2017 Forschungen über ihre Einrichtungen in der NS-Zeit veröffentlicht. Eine Gedenkstele auf dem Stiftungsgelände erinnert seitdem an 36 Frauen und Männer, die Opfer der systematischen Ermordung von Menschen mit geistigen, körperlichen und seelischen Behinderungen wurden. Ihre Namen wurden am Mittwoch im Gottesdienst verlesen.
Die 1862 gegründete diakonische Stiftung betreut heute in der Region Lippe rund 3.500 hilfsbedürftige Menschen. Der Schwerpunkt liegt in der Begleitung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und psycho-sozialen Problemen.
Diakonie-Institut in Bielefeld feiert zehnten Geburtstag
Bielefeld (epd). Das Institut für Diakoniewissenschaft und -management (IDM) in Bielefeld-Bethel begeht am 29. November sein zehnjähriges Bestehen. Die Predigt im Festgottesdienst in der Bielefelder Neustädter Marienkirche hält die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, wie ein Sprecher ankündigte. Beim offiziellen Festakt spricht unter anderem der rheinische Präses Manfred Rekowski. Als weitere Gäste werden Diakonie-Präsident Ulrich Lilie, der Bethel-Vorstandsvorsitzende Ulrich Pohl und der Rektor der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, der Wirtschaftswissenschaftler Martin Büscher, erwartet.
Das Festprogramm findet im Rahmen des 16. Forums Diakoniewissenschaft statt. Mehr als 120 Fachleute aus ganz Deutschland wollen dann unter dem Thema "Gut geleitet" über die geistliche und soziale Kompetenz von Führungskräften in Diakonie und Kirche diskutieren. Neben Diakonie-Chef Lilie ist der Berliner Wissenschaftsphilosoph John Erpenbeck Hauptredner der Diakonie-Fachtagung. Außerdem steht eine Podiumsdiskussion zur Frage "Wie kommt gute Leitung in die Diakonie?" auf dem Programm.
Das IDM richtet sich an Führungskräfte aus Diakonie, Kirche, Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Der Themenschwerpunkt der Masterstudiengänge und Weiterbildungskurse liegt auf Unternehmensführung und Diakoniemanagement. Das Bielefelder Institut gehört zur KiHo Wuppertal/Bethel. Träger der Kirchlichen Hochschule sind die westfälische und die rheinische Landeskirche sowie die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Finanziert wird die Arbeit des Institutes zudem durch Mittel der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie durch Studiengebühren.
Diakonie Düsseldorf: Viele Flüchtlinge in Gesellschaft angekommen
Düsseldorf (epd). Vier Jahre nach dem verstärkten Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland hat die Diakonie in Düsseldorf eine gemischte Zwischenbilanz zur Integration gezogen. "Viele Geflüchtete sind inzwischen in der Gesellschaft angekommen", erklärte Diakoniepfarrer Thorsten Nolting am 20. November. Es brauche allerdings "einen langen Atem und den gemeinsamen Willen der Gesellschaft, um die Kräfte der Geflüchteten zu stärken, die darauf hoffen, dass hier ein besseres Leben für sie beginnt".
Es seien in den Jahren 2014 bis 2018 vor allem junge Menschen gewesen, die einen Asylantrag gestellt hatten, berichtete der Leiter der Beratung für geflüchtete Menschen in den städtischen Unterkünften, Oliver Targas. "Viele dieser jungen Menschen gehen inzwischen ihren Weg - obwohl sie oft hohe Hürden überwinden mussten und müssen." Der Spracherwerb sei immer noch "eine große Herausforderung." Viele der Geflüchteten nutzten neben den Integrationskursen zudem ehrenamtliche Kurse und Austauschtreffen, um fitter in der deutschen Sprache zu werden, sagte Targas.
Wohnungsvermittlung bleibt schwierig
Nach seinen Worten ist auch die Zahl derjenigen gestiegen, die einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben. Hier gibt es nach den Worten von Targas aber immer noch zu viele Arbeitgeber, die zögerten, Geflüchtete einzustellen. Dazu komme, dass Flüchtlinge oft zu lange auf eine Arbeits- oder Ausbildungsgenehmigung warten müssten.
Auch bei der Wohnsituation gibt es laut Diakonie noch viel zu tun. "Es gibt nach wie vor Geflüchtete, die bereits seit fünf Jahren in einer städtischen Unterkunft leben, weil nicht ausreichend Wohnungen für sie angeboten werden," erklärte Sabine Hollands von der Wohnraumvermittlung der Diakonie. Sie appellierte an Wohnungseigentümer, ungenutzten Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
"Für Integration ist es das Beste, wenn geflüchtete Menschen mitten unter uns leben", betonte Nolting. Nach seinen Worten konnten seit 2015 rund 630 geflüchtete Menschen von der Diakonie Düsseldorf in private Wohnungen vermittelt werden. Dies entspreche etwa 200 Haushalten. Immer noch lebten rund 4.500 Flüchtlinge in den städtischen Unterkünften.
Kampagne macht auf Gewalt an Frauen aufmerksam
Köln (epd). Unter dem Motto "Wir brechen das Schweigen" ruft das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" zu Solidarität mit von Gewalt betroffenen Frauen auf. Unter dem Hashtag #schweigenbrechen sind Einzelne, Verbände, Kommunen und Unternehmen eingeladen, Fotos von sich und dem Aktionsschild auf Facebook, Twitter oder Instagram zu teilen, wie das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben am 18. November in Köln mitteilte. Schirmherrin der Kampagne ist Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD). Anlass ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen (25. November).
Zugleich solle die Aktion ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und auf Unterstützungsangebote wie das Hilfetelefon aufmerksam machen, hieß es. Jede dritte Frau erlebe einmal in ihrem Leben Gewalt, doch nur jede Fünfte wende sich an eine Beratungsstelle. Betroffene sprächen oft aus Scham und Angst nicht über das Erlebte.
"Unser Ziel ist es, so vielen Frauen wie möglich den Weg aus der Gewalt in ein besseres Leben zu weisen", erklärte Edith Kürten, Präsidentin des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Der erste Schritt bestehe darin, dass die Frauen von Beratungsmöglichkeiten wie dem Hilfetelefon erfahren.
Jährlich steigen nach eigenen Angaben die Zahlen der Anruferinnen beim Hilfetelefon. Seit der Gründung im Jahr 2013 wurden 185.000 Beratungen dokumentiert. Das Hilfetelefon richtet sich an Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Außerdem bietet es Unterstützung für Menschen aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen.
Mehr als einmal pro Stunde wird Frau Opfer von Partnerschaftsgewalt
Es ist ein großes Tabu - passiert aber unentwegt: Jeden Tag werden Dutzende Frauen Opfer von Gewalt. Oft in der Partnerschaft. Familienministerin Giffey verspricht mehr Einsatz für den Ausbau von Frauenhäusern.Bonn, Düsseldorf (epd). Mehr als einmal pro Stunde wird in Deutschland statistisch gesehen eine Frau durch ihren Partner gefährlich verletzt. Das geht aus der "Kriminalstatistischen Auswertung zu Partnerschaftsgewalt 2018" des Bundeskriminalamtes hervor, wie Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) zum "Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen" am 25. November in Berlin sagte. Die Frauenrechtskommission UN Women und die Schauspielerin Carolin Kebekus mahnten mehr Einsatz für das Recht von Frauen und Kindern auf Schutz vor Gewalt an.
UN startet Petition gegen häusliche Gewalt
Zum Start einer Online-Petition verlangten sie von der Bundesregierung, Frauen und Kindern per Bundesgesetz einen Anspruch auf einen Platz im Frauenhaus zu gewährleisten. "Sieben Frauen werden täglich von ihrem Partner vergewaltigt oder sexuell genötigt. Und zwar in Deutschland", sagte die Schauspielerin und Komikerin Kebekus. UN Women Deutschland kritisierte in Köln, Gewalt gegen Frauen sei nach wie vor ein Problem, obwohl die Bundesregierung mit der Istanbul-Konvention im Oktober 2017 ein rechtlich bindendes Instrument zum Schutz von Frauen vor Gewalt ratifiziert habe.
Der Kriminalstatistik zufolge wurden im vergangenen Jahr insgesamt 140.755 Menschen Opfer versuchter und vollendeter Gewalt. Ein Jahr zuvor waren es noch 138.893 Fälle. Mehr als 81 Prozent der Betroffenen waren laut Statistik Frauen.
Erhoben wurden Mord und Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe, Bedrohung, Stalking, Nötigung, Freiheitsberaubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution. Die Ministerin nannte die Zahlen "sehr alarmierend" und verwies darauf, dass hier nur von einem "Hellfeld" gesprochen werde. Sie gehe davon aus, dass das Dunkelfeld weitaus größer sei. Denn nicht alle Taten würden zur Anzeige gebracht.
Insgesamt ist den Angaben zufolge jede dritte Frau mindestens einmal im Leben von Gewalt betroffen. 122 Frauen wurden 2018 laut Statistik durch Partnerschaftsgewalt getötet - damit an jedem dritten Tag eine. 2017 waren es 147.
Alle Gesellschaftsschichten betroffen
Gewalt gegen Frauen komme in allen sozialen Schichten und Altersgruppen und in allen ethnischen Gruppen vor, betonte Giffey. Deshalb starte sie die bundesweite Initiative "Stärker als Gewalt" mit dem Ziel, betroffene Frauen und Männer zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen, und die Hilfsangebote besser bekanntzumachen.
Mit dem Förderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen" will die Ministerin in den kommenden vier Jahren ab 2020 insgesamt 120 Millionen Euro zusätzlich für den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern bereitstellen. Derzeit gebe es in Frauenhäusern knapp 7.000 Plätze, nötig seien 20.000. Zuständig sind aber die Länder und Kommunen.
Die Staatsministerin für Integration, Annette Widmann-Mauz (CDU), plädierte angesichts der Statistik für mehr Prävention. "Damit es erst gar nicht zu solchen Gewalttaten kommt, müssen wir vorbeugen", sagte Widmann-Mauz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (26. November). Die Vorsitzende der Frauen-Union betonte, sie unterstütze etwa Projekte, in denen gezielt männliche Mediatoren für Gewaltprävention ausgebildet würden.
"Gleichzeitig müssen wir betroffene Frauen über die vorhandenen Hilfsangebote besser informieren, empowern und Lücken in den Hilfestrukturen schließen", sagte die CDU-Politikerin. "Für Gewalt gegen Frauen gibt es null Toleranz. Wer in unserem Land Gewaltverbrechen begeht, wird verfolgt und hart bestraft."
Kreis Lippe erhält einen "Ort der Kinderrechte"
Detmold (epd). Im Kreis Lippe wird ein "Ort der Kinderrechte" entstehen. Es ist eines von bundesweit neun Modellprojekten unter dem Titel "Wir gegen sexuelle Gewalt", wie Landrat Axel Lehmann am 20. November in Detmold mitteilte. Voraussichtlich in einem Park in Blomberg sollen verschiedene Stationen spielerisch über Kinderrechte aufklären. Sie sollen Kitas und Schulen als Lernort dienen und Anregungen für weiterführende für Projekte geben. An der inhaltlichen Entwicklung werden Kinder und Jugendliche beteiligt. Im Frühjahr 2020 sollen die Vorschläge umgesetzt werden. Johannes-Wilhelm Rörig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, wird die Schirmherrschaft übernehmen.
Bundesbeauftragter Rörig wird Schirmherr
Nach dem "Fall Lügde" mit massenhaftem Missbrauch an Kindern habe der Kreis Lippe umfassende vorbeugende Maßnahmen getroffen, sagte Landrat Lehmann. Kinderschutz werde zum Leitziel erhoben. Unter anderem ist der Aufbau einer Kinderschutzambulanz beim Klinikum Lippe geplant. Am 5. September waren zwei Männer zu Freiheitsstrafen von 13 und zwölf Jahren mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt worden (AZ: 23 KLs 14/19). Der 56-jährige Andreas V., der auf einem Campingplatz in Lügde lebte, und der 34-jährige Mitangeklagte Mario S. hatten sich in rund 400 Fällen des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht.
Auf einer Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in Detmold betonte der Bundesbeauftragte Rörig, dass sexuelle Gewalt für viele Tausende Mädchen und Jungen noch immer trauriger Alltag sei. Allein Nordrhein-Westfalen gebe es jährlich 2.500 Verfahren. Die meisten Übergriffe ereigneten sich in Familien, doch auch Grenzverletzungen durch Gleichaltrige und durch die Nutzung digitaler Medien häuften sich.
Rörig: Schulen zu Schutzkonzepten verpflichten
"Im Internet haben wir überhaupt keinen Kinder- und Jugendschutz", kritisierte Rörig und sprach sich gegen eine finanzielle Förderung für Computerspiele aus, solange die keine Schutzfunktion besitzen. "Kinder und Jugendliche müssen auf den Gebrauch digitaler Medien vorbereitet werden, am besten von der Kita bis zur zehnten Klasse." Der Beauftragte kritisierte, dass im milliardenschweren Bildungspakt keine Mittel für medienpädagogische Begleitung vorgesehen seien.
Rörig regte an, Schulen zu Schutzkonzepten zu verpflichten. Auch müsse über Datenschutz neu nachgedacht werden, um Pädosexuellen besser auf die Spur zu kommen. "Politik möchte über das Thema Missbrauch aber eigentlich nicht sprechen. Nur wenn spektakuläre Fälle wie in Lügde oder jetzt in Bergisch Gladbach vorgefallen sind, bewegt sich auch die Politik."
Der Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ist unabhängig und nicht weisungsgebunden. Lediglich organisatorisch ist das Amt beim Bundesfamilienministerium angesiedelt.
Hilfsaktion "Lichtblicke" startet in die Vorweihnachtszeit
Oberhausen (epd). Die Hilfsaktion "Lichtblicke" der NRW-Lokalradios startet in die Hochphase ihrer Spendenaktivitäten. So werden im "Lichtblicke"-Shop (www.lichtblicke.de) 5.000 limitierte 0-Euro-Scheine mit dem Titel "Herzschrittmacher" verkauft, die von dem Musiker Adel Tawil designt wurden, wie Radio NRW am 22. November in Oberhausen mitteilte. Von der Europäischen Zentralbank genehmigt, sei der Schein mit einigen für Banknoten typischen Sicherheitsmerkmalen auf Sicherheitspapier gedruckt, hieß es.
Zudem planen die NRW-Lokalradios bis Weihnachten weitere Aktionen, um Spendengelder zu sammeln. So startet am kommenden Montag um 10.15 Uhr die Online-Versteigerungsaktion: Auch in diesem Jahr engagieren sich neben Unternehmen aus der Region Prominente aus dem Musik-, Unterhaltungs- und Sportbereich für die Auktion. Bis zum 2. Dezember kann hier etwas für den guten Zweck ersteigert werden. Zur Wahl stehen unter anderem eine VIP-Loge bei einer Show von Atze Schröder, eine Unplugged-Session und Fragerunde mit Robbie Williams in Hamburg sowie ein Wohnzimmer-Konzert mit Nico Santos.
Ab dem 3. Dezember berichten die NRW-Lokalradios dann wieder intensiv über Familien in NRW, die das Schicksal hart getroffen hat. Darüber hinaus stellen die Radios unter dem Motto "Die Macher" Hörer in NRW in den Vordergrund, die sich in besonderer Weise für die "Aktion Lichtblicke" engagieren.
Zudem findet auch wieder die Konzertreihe "Lichtblicke on Tour" statt. Unter dem Motto "Umsonst und draußen" treten Musiker für den guten Zweck auf: Geplant sind Konzerte von Alice Merton in Leverkusen (3. Dezember), Philipp Dittberner in Dortmund (5. Dezember), Milow in Rietberg-Mastholte (7. Dezember) und Adel Tawil in Goch (11. Dezember).
Die Aktion "Lichtblicke" wurde 1998 ins Leben gerufen und ist eine gemeinsame Spendenaktion der Radio NRW GmbH, des Verbandes Lokaler Rundfunk für die 45 Lokalradios in NRW sowie der kirchlichen Hilfswerke Diakonie und Caritas. Schirmherrin der Aktion ist Susanne Laschet, Ehefrau von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).
Medien & Kultur
Zwei Europäer um 1800

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Mitten im Raum steht ein Krokodil auf einem Sockel. Das Maul ist leicht geöffnet, die Zähne sind deutlich zu erkennen. 1805 hatte Alexander von Humboldt die antike Skulptur aus Marmor in Rom gesehen, als er seinen Bruder Wilhelm, den Preußischen Gesandten dort, besuchte. Gerade war Alexander von seiner amerikanischen Expedition zurückgekehrt. Mit echten Krokodilen kannte er sich aus. Am Rio Magdalena im tropischen Regenwald Kolumbiens, aber auch auf Kuba hatte er die verschiedensten Arten studiert, sie gezeichnet und seziert.
Hier in Rom nun interessierte ihn, wie genau der Bildhauer der Antike gearbeitet hatte. "Er geht als Naturwissenschaftler daran, fängt an, die Zähne zu zählen und zu gucken, ob das Krokodil eine Zunge hat", erklärt Bénédicte Savoy. Gemeinsam mit David Blankenstein hat sie die erste umfassende Ausstellung über die Humboldt-Brüder im Deutschen Historischen Museum in Berlin kuratiert.
Kinder der Aufklärung
Ausgehend von den unterschiedlichen Lebenswegen der Brüder thematisiert die Schau in sieben Sektionen das Verhältnis von Wissen und Macht, von Reisen und Erkenntnis, von Mensch und Natur. Das Krokodil aus Marmor, das erstmals seit 1774 die Vatikanischen Museen verlassen durfte, ist eines der Highlights. Es schlägt eine Brücke zwischen Amerika und Europa, zwischen der Antike und der Zeit um 1800, aber auch zwischen den Brüdern Humboldt selbst.
Mit rund 350 Objekten aus ganz Europa, darunter zahlreiche, die erstmals präsentiert werden, bettet die Ausstellung ihr Denken und Wirken ein die Strömungen ihrer Zeit. In den vergangenen Jahren, kritisieren die Kuratoren, sei der Name Humboldt zur Formel geworden - Wilhelm als Bildungsreformer, Alexander als Weltbürger und Abenteurer. Bénédicte Savoy: "Wir wollen sie zusammen mit ihrer Epoche denken, zwei Europäer um 1800, und die historischen Tiefe wiederherstellen, die komplett fehlt."
Wilhelm (1767-1835) und Alexander (1769-1859) wuchsen im Schloss Tegel am Rande des damaligen Berlin auf. Bereits als Kinder genossen sie eine umfassende Bildung im Sinne der Aufklärung, der das Auftaktkapitel unter dem Titel "Kindheit ohne Gott" nachgeht. Die Sektion "Offene Beziehungen" schildert das Umfeld der Berliner Gesellschaft, in dem die Brüder ab 1783 lebten und wo sich neue Horizonte öffneten.
Für die Rolle der Brüder in der europäischen Politik der Zeit um 1800 wird Frankreich der zentrale Bezugspunkt. Beide erlebten im revolutionären Paris eine Gesellschaft im Wandel und wurden später selbst zu politischen Akteuren. Alexander lebte ab 1807 als preußischer Kammerherr ständig in Paris und engagierte sich in der Wissenschafts- und Kulturpolitik, Wilhelm verfasste früh staatstheoretische Schriften und setzte sich später als Diplomat mit Fragen von regionaler und lokaler Autonomie und nationalstaatlicher Politik auseinander.
Napoleons Kunstraub
Den größten Kunstraub der Zeit durch Napoleon und die konträre Rolle der Brüder darin symbolisiert ein originaler Pferdekopf der Quadriga vom Brandenburger Tor. Nach dem Einmarsch Napoleons in Berlin 1806 führte Alexander von Humboldt Napoleons Kunstkommissar in Berliner Künstlerkreise ein und machte ihn mit dem Bildhauer Johann Gottfried Schadow bekannt, dem Schöpfer der Quadriga. Kurz darauf wurde die Skulpturengruppe nach Paris abtransportiert und erst 1814 an Preußen zurückgegeben. Wilhelm war als preußischer Bevollmächtigter beim Wiener Kongress an der Neuordnung Europas nach der Niederlage Napoleons beteiligt und auch an der Rückführung der in ganz Europa beschlagnahmten Kunstwerke.
Unter dem Titel "Ausweitung der Denkzone" widmen die Kuratoren den größten Raum den wissenschaftlichen Forschungen Alexander und Wilhelm von Humboldts. Im Mittelpunkt stehen die Amerikanischen Reisetagebücher Alexanders, die während der gesamten Ausstellungsdauer gezeigt werden können, ergänzt durch Instrumente, die er benutzte und Objekte seiner Sammlungen. Zu den Überraschungen der Ausstellung gehört die Entdeckung des Reisenden Wilhelm von Humboldts. Während sein Bruder Alexander 1799 bis 1804 in den Regenwäldern Südamerikas und den Anden unterwegs war, reiste Wilhelm für anthropologische Studien 9.000 Kilometer durch Frankreich und durch das Baskenland bis an die Südküste Spaniens.
Zum Schluss kehrt die Ausstellung zurück nach Berlin, wo zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Forschungsergebnisse und Erkenntnisse der Humboldt-Brüder in der Gründung der Berliner Universität, der Sternwarte und dem ersten preußischen Museum mündeten.
Geschichtsstunde in drei Akten
Beginnend mit Max Liebermann, zeigt das Museum der bildenden Künste in Leipzig bis Juni Werke von drei Impressionisten. Vor gut 100 Jahren gab es das schon einmal - weshalb die Reihe vor allem ein Blick in die eigene Geschichte sein soll.Leipzig (epd). Das Leipziger Museum für bildende Künste präsentiert im kommenden halben Jahr drei wichtige Impressionisten - der Impressionismus, das moderne Malen selbst aber sollen nur eine Nebenrolle spielen. Wichtiger an der Reihe "Impressionismus in Leipzig 1900-1914. Liebermann, Slevogt, Corinth" ist dem Museum die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte: "Teil I: Max Liebermann" ist am 23. November eröffnet worden.
Mehrere weitgehend in Vergessenheit geratene Verkaufsausstellungen des Leipziger Kunstvereins zwischen 1904 bis 1911 sollen so rekonstruiert werden, betonen Vize-Direktorin Jeannette Stoschek und Ausstellungskurator Marcus Andrew Hurttig bei einer Vorbesichtigung. Dass diese in der boomenden Messestadt stattgefunden haben, soll zeigen, dass Leipzig aus Sicht der damals führenden Galeristen des Kaiserreichs ein wichtiger Vermittlungsort impressionistischer Kunst gewesen sei.
Zugleich, erklärt Kurator Hurttig, stehe die kurze Dauer der historischen Ausstellungen von nur je vier Wochen sinnbildlich für die Beschleunigung in jenen letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, für den Aufbruch in Urbanität und Moderne. Diesem kunst- und sozialgeschichtlichen Hintergrund also will sich die Ausstellung widmen und empfängt den Besucher in Raum Eins recht folgerichtig - und etwas verkopft - mit diversen Zahlenkolonnen: Daten und Statistiken zu Mietpreisen, Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Geburten im Leipzig um das Jahr 1900 laufen über die Wände.
Ausstellung wird ergänzt
Nebenan dann der wohl gelungene Versuch, durch Leihgaben aus Museen in Berlin, Bern, Frankfurt am Main oder Mannheim eben jene Liebermanns (1847-1935) zusammenzutragen, die dort schon vor gut 100 Jahren ausgestellt wurden. Ein Höhepunkt ist hier sicherlich die so farbenfrohe wie flüchtig-alltägliche Abbildung der "Judengasse in Amsterdam" von 1908.
Ein gutes Dutzend Werke Max Liebermanns hat das Museum für die Schau in zwei Räumen zusammengetragen. Überflüssig zu erwähnen, dass es sich hier nicht um eine Retrospektive handelt, wie Hurttig betont, sondern sich die Schau eben mit den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen und ihren sich stetig beschleunigenden Prozessen befassen will - und mit der Rolle des Leipziger Kunstvereins, der noch bis 1933 für das Programm des Museums verantwortlich war.
Und so kommen in den beiden anderen Räumen in vergleichbarer Werkanzahl unbekanntere Maler aus dem damaligen Bestand des Kunstvereins zum Zug. Liebermanns "Stillage", erklärt Hurttig, sei "nur zu verstehen durch den Kontrast". Und in der Tat wirken die Werke des Impressionisten im Vergleich zu jenen eines Friedrich Kaulbach oder eines Erich Erlers wie die kraftvoll-visionären Abbilder einer neuen Zeit. Ob sich dieser Effekt beim Besucher indes auch ohne die klärenden Worte des Kurators einstellt, werden diese nur selbst entscheiden können.
Dreimal wird die Ausstellung in den kommenden Monaten ergänzt und um neue Facetten des Impressionismus angereichert werden. Ab dem 17. Januar werden Liebermanns Werke zunächst mit jenen Max Slevogts (1868-1932) in Beziehung gesetzt, ab dem 26. Februar kommen Bilder Lovis Corinths (1858-1925) hinzu. Liebermann muss bereits zehn Tage vor dem zweiten Umbau weichen.
Sicher werden sich durch die Erweiterungen jeweils neue, spannende Bezüge ergeben. Ob dies jedoch zur Erfüllung des Wunschs von Kurator Hurttig beiträgt, jeder Interessierte möge die Ausstellung möglichst gleich dreimal besuchen, bleibt fraglich.
Proteste für Pressefreiheit und gegen NPD-Aufmarsch
7.000 Menschen demonstrierten in Hannover gegen einen NPD-Aufmarsch mit rund 120 Anhängern, der sich gegen Journalisten richtete. Auch der NRW-Journalistentag und der Presserat zeigten sich alarmiert über Druck von rechts.Hannover, Dortmund (epd). Mehr als 7.000 Menschen haben am 23. November in Hannover überwiegend friedlich für Pressefreiheit und gegen einen Aufmarsch der NPD in der Stadt demonstriert. Die Demonstration der NPD mit rund 120 Teilnehmern richtete sich gegen mehrere namentlich genannte Journalisten, die in der rechten Szene recherchieren. Die Polizei hatte die Demonstration zunächst verboten, das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hatte das Verbot jedoch wieder aufgehoben. Der Deutsche Presserat unterstrich den Verfassungsrang der Pressefreiheit und rief Politik und Sicherheitskräfte auf, Journalisten gegen Bedrohung zu schützen.
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte am Rande der Gegenveranstaltung, die Polizei habe gute Gründe für ein Verbot der NPD-Demonstration gehabt. Diese Gründe seien für die Gerichte nicht gut genug gewesen. Das müsse man akzeptieren, auch wenn es unerträglich sei, wenn Journalisten diffamiert würden.
Erinnerung an Weimar
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius warnte, wenn Journalisten aus Angst aufhörten zu recherchieren und Mandatsträger oder Engagierte in der Flüchtlingsarbeit sich deshalb zurückzögen, dann sterbe die Demokratie von unten. Die Weimarer Republik sei nicht an der Stärke ihrer Gegner zugrunde gegangen, sondern an der Schwäche ihrer Anhänger, unterstrich der SPD-Politiker: "Das darf nie wieder passieren."
Zu den Protesten gegen die NPD hatten zahlreiche Organisationen und Initiativen aufgerufen, darunter auch mehr als 450 Journalisten und die Chefredaktionen mehrerer großer Zeitungen. Nach Angaben der Polizei sei es nur in Einzelfällen zu kurzen Störungen gekommen.
Bei der Gegenveranstaltung sprach auch der neue hannoversche Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Es dürfe nicht sein, dass es heute besonderen Mut brauche, sich für einen kritischen, freien und unabhängigen Journalismus einzusetzen, sagte er. Die Stadt verurteile jede Art von Hetze und Drohungen gegenüber Journalisten auf Schärfste. Landesbischof Ralf Meister sagte am Rande der Proteste, die NPD dürfe keinerlei Möglichkeit haben, die Kultur und die Meinung von Menschen in irgendeiner Weise zu beeinflussen: "Die NPD nutzt die im Grundgesetz festgeschriebene Meinungsfreiheit, um die Meinungsfreiheit anderer einzuschränken."
Thema beim Journalistentag
Der Sprecher des Deutschen Presserats, Volker Stenner, forderte angesichts der NPD-Demonstration, Politik und Sicherheitskräfte müssten der Pressefreiheit höchste Priorität einräumen. Die Erfahrung in aller Welt zeige, dass die Pressefreiheit insgesamt bedroht sei, wenn einzelne Journalisten und Journalistinnen bedroht würden, sagte er. Diese seien gegen Drohungen und Angriffe zu schützen.
Unterstützung vom Journalistentag NRW
Auch beim Journalistentag NRW ging es am 23. November um die Pressefreiheit: Die Direktorin der Europäischen Journalisten-Förderation, Renate Schroeder, beklagte eine massive Zunahme von Angriffen und Drohungen gegen Journalisten in den vergangenen Jahren. Seitdem der Europarat vor drei Jahren eine Plattform geschaffen habe, auf der Fälle von Übergriffen und Einschüchterungen gemeldet werden können, seien dort 638 Hinweise erfolgt, sagte sie bei dem Branchentreffen in Dortmund.
Ein weiteres schwerwiegendes Problem sowohl für den Journalismus als auch für das Demokratie insgesamt sei die Verbreitung sogenannter Fake News, sagte Schroeder weiter. Solche Falschnachrichten bergen nach ihren Worten die Gefahr, ein rechtsstaatliches System, wie es in Europa etabliert sei, auszuhöhlen. Gleichzeitig würden Redaktionen personell immer weiter ausgedünnt. Vor diesem Hintergrund stehe die neue Europäische Kommission vor der besonderen Herausforderung, die Pressefreiheit entsprechend zu schützen.
Bei dem Treffen im Ruhrgebiet diskutieren mehr als 500 Journalisten in Workshops und Foren unter anderem über den Umgang mit Hass im Netz, den Einfluss von Algorithmen und das Radio der Zukunft. Mit einer spontanen Protestkundgebung wandten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gegen Einschüchterungsversuche rechter Parteien und Gruppierungen.
Mordfall Galizia: Maltesischer Geschäftsmann festgenommen
Rom, Valetta (epd). Die maltesischen Behörden haben im Zusammenhang mit Ermittlungen um den Mord an der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia einen Geschäftsmann festgenommen. Yorgen Fenech wurde am 20. November beim Versuch, mit seiner Yacht einen Hafen in der Nähe von Valletta zu verlassen, von der Polizei festgehalten, wie die Tageszeitung "Times of Malta" (Online) berichtete.
Fenech ist Mitinhaber der Offshore-Firma 17 Black, über die die Journalistin kurz vor ihrem Tod geschrieben hatte. Er ist zugleich Direktor einer Unternehmensgruppe, die im Auftrag der maltesischen Behörden ein Gaswerk errichtet und betreiben soll.
Am Vortag war bekannt geworden, dass die maltesische Regierung einem Mittelsmann Straffreiheit anbietet, sollte er die Namen der Auftraggeber für den Mord an der Journalistin preisgeben.
Autobombe
Premierminister Joseph Muscat betonte nach der Festnahme den Angaben zufolge, es gebe "zum jetzigen Zeitpunkt" keine Hinweise auf Verbindungen von Energieminister Konrad Mizzi und Stabschef Keith Schembri zu dem Mordfall. Firmen der beiden Politiker waren zuvor in Medienberichten mit 17 Black in Verbindung gebracht worden. Sie tauchten überdies in den "Panama Papers" über Offshore-Firmen auf. Die 2016 an die Öffentlichkeit gelangten Dokumente lösten in mehreren Ländern Ermittlungen und Debatten über Steuer- und Geldwäsche-Delikte aus.
Die Investigativjournalistin Galizia war am 16. Oktober 2017 durch eine Autobombe getötet worden. Sie hatte unter anderem über Korruption und Geldwäsche berichtet. Drei Männer wurden wegen Mordes vor Gericht gestellt. Die Behörden suchen weiter nach den mutmaßlichen Auftraggebern.
Bundespresseamt hat rechtswidrig G20-Akkreditierungen entzogen
Berlin (epd). Das Bundespresseamt hat während des G20-Gipfels im Juli 2017 in Hamburg zwei Journalisten unrechtmäßig die Akkreditierung entzogen. Der Entzug sei rechtswidrig gewesen, heißt es in einem am 20. November gefällten Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin. Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Widerruf hätten nicht vorgelegen. (VG 27 K 516.17, 519.17)
"Nachträglich eingetretene Tatsachen, die das Bundespresseamt berechtigten, die Akkreditierung nicht zu erlassen, seien in Bezug auf die Kläger nicht erkennbar", betonte das Gericht. Auch dass ein Widerruf zur Verhütung oder Beseitigung schwerer Nachteile für das Gemeinwohl hätte erfolgen dürfen, lasse sich nicht feststellen. Davon abgesehen sei die Widerrufsentscheidung auch nicht frei von Ermessensfehlern ergangen, insbesondere sei eine Abwägung der widerstreitenden Interessen im konkreten Einzelfall unterblieben, urteilten die Richter.
"Neubewertung der Sicherheitslage"
Den zwei Journalisten war die Presseakkreditierung entzogen worden. Zur Begründung hatte das Bundespresseamt den Angaben zufolge ausgeführt, dass die massiven Ausschreitungen während des Gipfels und neue nachrichtendienstliche Erkenntnisse zu vier anderen ebenfalls akkreditierten Journalisten eine Neubewertung der Sicherheitslage erforderlich gemacht hätten.
Während des Treffens der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer Anfang Juli 2017 in Hamburg war es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. In der Folge hatten das Bundespresseamt und Bundeskriminalamt insgesamt 32 Journalisten die bereits genehmigten Akkreditierungen wieder entzogen.
Roland Jahn zu "Berliner Zeitung": "Es geht um Aufklärung"
Berlin (epd). Nach Bekanntwerden der Stasi-Vergangenheit des Verlegers Holger Friedrich wünscht sich der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, von der "Berliner Zeitung" eine intensive Auseinandersetzung mit dem Unrecht in der DDR. "Ich hoffe, dass es dem Berliner Verlag und der Redaktion insgesamt darum geht, über die SED-Diktatur aufzuklären und nicht nur darum, schnell aus den negativen Schlagzeilen zu kommen", sagte Jahn dem Evangelischen Pressedienst (epd). Er warnte zugleich vor der Erwartung, im Fall Friedrich zu einem letztgültigen Urteil zu kommen: "Es geht um Aufklärung, nicht um Abrechnung."
Jahn sagte, die aktuelle Situation sei eine Chance, sich der Geschichte im geteilten Deutschland intensiver zu stellen. Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" hatte der neue Eigentümer des Berliner Verlags, Holger Friedrich, bestätigt, dass er Inoffizieller Mitarbeiter (IM) der Stasi war. Die Redaktion der zum Verlag gehörenden "Berliner Zeitung" hat angekündigt, den Fall journalistisch aufklären zu wollen. Bei der Sichtung der Akten sollen die frühere Leiterin der Stasi-Unterlagen-Behörde, Marianne Birthler, und der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk unterstützen.
"Nicht den Oberrichter spielen"
Jahn sagte, der Fall Friedrich habe deutlich gemacht, "dass die Vergangenheit die Gesellschaft immer wieder einholt, wenn sie nicht aufgearbeitet wird". Es reiche nicht, Konflikte von damals zuzudecken. "Es gilt, sie zu bereinigen", sagte der 66-Jährige. Dazu gehöre Transparenz und eine Auseinandersetzung über die individuelle Verantwortung, die jeder Einzelne für sein Verhalten im Unrechtsstaat DDR hatte, ergänzte Jahn, der seit 2011 Bundesbeauftragter ist.
"Wenn jemand in die Öffentlichkeit tritt oder sich zur Öffentlichkeit in Beziehung setzt - beispielsweise als Verleger - ist es schon angebracht, transparent mit der eigenen Biografie umzugehen", sagte Jahn. Das gelte besonders dann, wenn man Betrachtungen zur DDR-Vergangenheit publiziere. "Da sollte man dann auch bei sich selbst mit der Auseinandersetzung anfangen und relevante Ereignisse nicht verschweigen", sagte Jahn. Holger Friedrich und seine Frau Silke, die den Berliner Verlag im September übernommen hatten, hatten in einem Grundsatztext in einer Sonderausgabe zum 30. Jahrestag des Mauerfalls Lob für den letzten DDR-Staatsratsvorsitzenden Egon Krenz geäußert und damit für Irritationen gesorgt.
Jahn warnte dennoch vor schnellen Verurteilungen. "Keiner sollte sich anmaßen, den Oberrichter zu spielen", sagte er. "Mir geht es weniger um Schuldfragen, sondern um Verantwortung für das individuelle Verhalten in der Diktatur", ergänzte er.
Umfrage bescheinigt deutschen Medien hohe Glaubwürdigkeit
Köln (epd). In der deutschen Öffentlichkeit genießen deutsche Medien einer repräsentativen Umfrage zufolge eine hohe Glaubwürdigkeit. Vor allem Tageszeitungen und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schätzt ein Großteil der Befragten als glaubwürdig ein, wie der WDR am 20. November in Köln mitteilte. Im Auftrag des Senders hatte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap vom 14. Oktober bis 1. November insgesamt 1.000 Wahlberechtigte befragt.
Mit 61 Prozent halten die meisten der Befragten die Informationen in deutschen Medien für glaubwürdig. Im Vergleich zur Vorgängerumfrage aus dem Jahr 2018 mit 65 Prozent ist dieser Wert leicht gesunken, liegt aber über den Werten von 2015 (52 Prozent) und 2016 (57 Prozent). Ost- und Westdeutsche seien sich in dieser Frage allerdings nicht einig, hieß es. Während im Westen Deutschlands 64 Prozent die Medien-Informationen als glaubwürdig einschätzen, sind es im Osten nur 48 Prozent.
Öffentlich-rechtliche Radiosender sehr geschätzt
Die höchste Glaubwürdigkeit wird mit 78 Prozent erneut öffentlich-rechtlichen Radiosendern zugeschrieben, wie der WDR erklärte. Die Informationen in öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern schätzen 74 Prozent der Befragten als glaubwürdig ein. Damit liege die Glaubwürdigkeit dieser Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie schon in den Jahren zuvor deutlich über dem "Glaubwürdigkeitsniveau" der Medienangebote insgesamt. Ähnlich gut schneiden demnach Tageszeitungen ab (76 Prozent). Mehrheitlich als glaubwürdig eingeschätzt werden auch die Internetangebote öffentlich-rechtlicher Sender (59 Prozent) sowie die Internetangebote von Zeitungen und Zeitschriften (46 Prozent).
Die Informationen in sozialen Netzwerken schätzen die meisten als wenig glaubwürdig ein, wobei es zwischen den einzelnen Plattformen Unterschiede gibt. Während Youtube noch von 19 Prozent der Befragten als glaubwürdig beurteilt wird, fallen Twitter (acht Prozent), Facebook (sieben Prozent) und Instagram (vier Prozent) deutlich ab.
Hauptinformationsquellen zum politischen Geschehen bleiben für mehr als die Hälfte der Deutschen die öffentlich-rechtlichen Angebote: Insgesamt 52 Prozent der Befragten nennen öffentlich-rechtliches Fernsehen (32 Prozent), öffentlich-rechtliches Radio (elf Prozent) oder die Internetangebote der öffentlich-rechtlichen Sender (neun Prozent) als ihre ersten Anlaufstellen für politische Informationen. Tageszeitungen kommen auf 22 Prozent.
Bei den 18- bis 34-Jährigen zeigt sich das gleiche Bild: Insgesamt 53 Prozent nennen öffentlich-rechtliches Fernsehen (20 Prozent), die Internetangebote der öffentlich-rechtlichen Sender (19 Prozent) und öffentlich-rechtliches Radio (14 Prozent) an erster Stelle, um sich politisch zu informieren. Soziale Medien wie Youtube, Facebook, Instagram oder Twitter nennen dagegen nur neun Prozent der Jüngeren als Hauptinformationsquellen.
Evangelische Jugend sucht Nachwuchsjournalisten für Medientraining
Köln, Düsseldorf (epd). Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren können sich noch bis 20. Dezember für das Jugendmedientraining "News4U 2020" bewerben. Die Evangelische Jugend im Rheinland sucht 12 Jugendliche, wie der evangelische Kirchenverband Köln und Region mitteilte. Geplant sind von Januar bis September 2020 sieben Wochenendworkshops, die sich unter anderem Text, Online, Fotografie, Podcasts und Webvideos widmen. Auch ein Praktikum bei einem der Kooperationspartner, darunter der WDR und RTL, und die Berichterstattung vom Jugendcamp 2020 der rheinischen Jugend in Mülheim an der Ruhr gehören zum Programm.
Weitere Informationen: www.news4u.ekir.de
Entwicklung
Aus Afrika geflohen, in Mexiko gestrandet

epd-bild/Wolf-Dieter Vogel
Tapachula (epd). Wenn der Kongolese Ilson all die Länder aufzählt, die er in den vergangenen Monaten durchquert hat, kann er es selbst kaum glauben: Äthiopien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala. Seit April dieses Jahres ist er unterwegs, und nun hängt er ausgerechnet in der südmexikanischen Grenzstadt Tapachula fest. Der schlanke junge Mann wartet darauf, dass er seinen Weg Richtung Norden fortsetzen kann. Ob ihm die Behörden je die nötige Papiere ausstellen, steht jedoch in den Sternen.
So geht es auch Charly aus Ghana. "Ob in Panama oder Costa Rica, überall haben wir uns bei der Migrationspolizei gemeldet und die Dokumente bekommen", sagt er. "Warum nicht in Mexiko?" Ilson und Charly, die ihre Nachnamen nicht genannt haben möchten, wollen nach Kanada oder in die USA, um dort zu arbeiten. Doch nun fristen sie seit Monaten ihr Dasein vor dem Auffanglager "Siglo 21" in einem Außenbezirk von Tapachula, so wie viele weitere Afrikanerinnen und Afrikaner, die aus ihrer Heimat vor Verfolgung oder Armut geflüchtet und nach Lateinamerika geflogen sind.
"Sie haben uns alles abgenommen"
Sie schlafen unter provisorisch gespannten Plastikplanen, in Billigzelten oder einfach auf der Straße. "Wenn es regnet, stehen wir auf und bleiben stehen, bis der Regen aufhört", sagt Charly. Die sanitären Anlagen sind 20 Minuten entfernt. Für ein Hotel oder eine Wohnung fehlt ihm das Geld, in den Herbergen ist kein Platz. Überdies wurden Charly und seine Mitreisenden auf dem Weg von Kolumbien nach Panama überfallen. "Sie haben uns alles abgenommen", erzählt er.
Einen Monat hat er gebraucht, um den Regenwald zu durchqueren. Viele sind in dem von Kriminellen kontrollierten Dschungel gestorben, andere wurden krank. Ilson hat dort seinen Vater verloren. "Aber die gesamte Strecke in Südamerika ist sehr gefährlich", erklärt der Kongolese. Dennoch bewegen sich immer mehr Afrikaner auf diesem Weg nach Norden.
Die Grenzstadt ist Nadelöhr
Etwa 3.500 Menschen aus Ghana, Kongo, Kamerun und weiteren Staaten des Kontinents hängen derzeit in Tapachula fest. Die Stadt nahe der guatemaltekischen Grenze ist ein Nadelöhr: Hunderttausende Flüchtlinge und Migranten, mehrheitlich aus Mittelamerika, Kuba und Haiti, kommen dort an. Tendenz steigend. Die Zahl der Asylanträge sei seit 2013 von 1.900 auf 40.000 jährlich gestiegen, sagt die Leiterin des dortigen Büros der Flüchtlingsbehörde Comar, Alma Delia Cruz Márquez. Die Migrationsbehörde INM spricht von 460.000 Menschen, die im ersten Halbjahr 2019 ohne Einreisepapiere ins Land kamen - die meisten über Tapachula.
Doch seitdem der mexikanische Staatschef Andrés Manuel López Obrador sich dem Druck von US-Präsident Donald Trump beugte und einen Pakt zur Migrationsbekämpfung mit Washington vereinbarte, hat sich die Lage für die Schutzsuchenden verschlechtert. Trump hatte mit Strafzöllen gedroht, wenn Mexiko nicht dafür sorgt, dass weniger Migranten und Flüchtlinge an die US-Grenze gelangen. Nun patrouillieren an der mexikanischen Südgrenze 6.000 Nationalgardisten, um illegal Einwandernde aufzugreifen.
Einreisebestimmungen immer restriktiver
Zudem handhaben die Behörden die Einreisebestimmungen immer restriktiver. Nur wer Angehörige in Mexiko hat oder hier Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, bekommt ein "humanitäres Visum", das einen einjährigen Aufenthalt garantiert. "Die einzige Alternative dazu ist, Asyl zu beantragen", erklärt Fermina Rodríguez vom Menschenrechtszentrum Fray Matías de Córdova in Tapachula. Nach Comar-Angaben wurden in diesem Jahr 37,68 Prozent der Anträge genehmigt.
Doch Ilson, Charly und die anderen afrikanischen Migranten wollen kein Asyl in Mexiko. Sie wollen nur durchreisen. Früher war das relativ unbürokratisch möglich. Doch heute sind selbst die wenigen legalen Wege kompliziert. Falsch geschriebene Namen verzögern die Bearbeitung von Anträgen, niemand hilft. "Von was sollen wir leben, wenn wir noch sechs Monate hier festhängen?" fragt sich Charly. "Hier gibt es keine Jobs."
Ständig rassistisch beschimpft
Mitte Oktober beteiligte er sich an einem Marsch von 3.000 Migranten, die sich auf den Weg Richtung Norden gemacht hatten. Doch nur wenige Kilometer hinter Tapachula wurden sie von Nationalgardisten gestoppt. Wer Geld hat, versucht mit Hilfe von Schleppern in Transportern und auf Schleichwegen an die US-Grenze zu gelangen. Oder übers Meer: Vor wenigen Wochen kenterte ein Boot mit 20 afrikanischen Migranten vor der Pazifikküste. Der 39-jährige Emmanuel Chel Ngu ertrank.
Illegal weiterreisen? Für den Kongolesen Ilson ist das eine schlechte Option. Der große schwarze Mittzwanziger würde sofort auffallen - anders als die Menschen aus Honduras, Guatemala oder El Salvador, die sich auf den ersten Blick von vielen Mexikanern kaum unterscheiden. Dass sie aus einem anderen Kulturkreis stammen, bekommen die Afrikaner auch in Tapachula zu spüren. "Sie behandeln uns wie Tiere", sagt er, ständig werde er rassistisch beschimpft. Früher sei er ein Fan von Mexiko gewesen. Jetzt will er nur hier weg. "Irgendwo hin, wo das Leben sicher ist."
Investitionen in Afrika werden stärker gefördert
In Afrika wird sich die Bevölkerung Schätzungen zufolge bis 2050 verdoppeln. Damit die Menschen sich nicht auf dem Weg nach Europa machen, will die Bundesregierung die dortige Wirtschaft ankurbeln - mit Hilfe von Privatinvestoren.Berlin (epd). Mit Krediten, Risikoabsicherungen und dem Einsatz von Vermittlern will die Bundesregierung mehr deutsche Firmen zu Investitionen in Afrika animieren. Noch immer müssten Unternehmen zu einem solchen Schritt ermutigt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einer Ansprache vor afrikanischen Staats- und Regierungschefs am 19. November in Berlin. Ihre Regierung könne dafür aber die Rahmenbedingungen verbessern und Vertrauen schaffen.
Merkel setzt sich dafür ein, in Afrika Zukunftsperspektiven zu schaffen, damit die Menschen nicht als Flüchtlinge oder Migranten nach Europa kommen. Sie hatte dafür die zwölf afrikanischen Partnerländer der Initiative "Compact with Africa" eingeladen. Es war das dritte Treffen des Formats, das im Juni 2017 startete, als Deutschland die Präsidentschaft der G20, der führenden Industrie- und Schwellenländer, innehatte.
Als Vertreter der Afrikanischen Union trat Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi auf, der derzeit den Vorsitz innehat. Ägypten biete große Gelegenheiten für Investitionen und sei für deutsche Unternehmen ein Tor nach Afrika, betonte er. Mit Hinweis auf Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer fügte er hinzu, dass seit 2017 kein einziges Boot von der Küste Ägyptens nach Europa abgelegt habe.
Korruptionsbekämpfung
Am Vormittag kamen die Regierenden aus Afrika mit deutschen Unternehmern zusammen - darunter war auch Siemens-Chef Joe Kaeser. Am Nachmittag berieten sie gemeinsam mit Vertretern von Weltbank, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Afrikanischer Entwicklungsbank (AfDB) im Kanzleramt über das weitere Vorgehen.
Bei "Compact with Africa" geht es darum, dass afrikanische Länder sich verpflichten, Korruption zu bekämpfen. Im Gegenzug werden deutsche und europäische Firmen, die sich für Investitionen in diesen Ländern entscheiden, gefördert. Bisher machen zwölf Staaten mit: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien.
Kritik gab es daran, dass die afrikanische Zivilgesellschaft nicht zum Treffen zugelassen war. Trotz vieler Versuche sei kein Vertreter zu der Konferenz zugelassen worden, sagte der Abteilungsleiter Afrika des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt", Reinhard Palm, dem epd.
Der Direktor des kongolesischen Denkfabrik Pole Institute, Nene Morisho, hob im epd-Gespräch hervor, bei Investitionen müsse sichergestellt sein, dass die Interessen der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden. Er betonte zugleich: "Würden die ausländischen Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Steuern bezahlen - und nicht um Ausnahmen bitten, was sie häufig tun - könnten diese Gelder in wichtige Infrastrukturprojekte wie Schulen investiert werden."
Entwicklungsinvestitionsfonds
Der Deutschland-Direktor der Entwicklungsorganisation One, Stephan Exo-Kreischer, erklärte, so sehr Merkel das abstreite, "Compact with Africa" sei effektiv eine deutsche und keine G20-Initiative. Dabei bräuchte es seinen Worten nach die G20, um internationale Steuerhinterziehung und illegale Kapitalabflüsse anzugehen. "Dadurch gehen afrikanischen Ländern Milliardenbeträge verloren."
Herzstück der aktuellen "Compact"-Bemühungen ist ein Entwicklungsinvestitionsfonds, der mit einer Milliarde Euro ausgestattet wird. Die Gelder aus diesem Topf fließen über die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) in drei Programme: Europäische Firmen bekommen Kredite und Risikoabsicherungen über "AfricaConnect" (Volumen: 400 Millionen Euro), afrikanische Mittelständler werden über "AfricaGrow" (400 Millionen Euro) gefördert, das "Wirtschaftsnetzwerk Afrika" (200 Millionen Euro) stellt Ansprechpartner vor Ort.
Zu den Firmen, die gefördert werden, gehört die Initiative "Fairafric" aus München, die in Ghana Bio-Schokolade herstellt. Das Unternehmen wird nach eigenen Angaben über die DEG mit zwei Millionen Euro unterstützt und kann somit eine neue Produktionsstätte im Süden Ghanas aufbauen und 50 neue Arbeitsplätze schaffen.
Landminen verletzten und töteten Tausende Menschen

epd-bild/Benjamin Dürr
München, Genf (epd). Tausende Menschen sind laut einem Expertenbericht im vergangenen Jahr Opfer von Landminen und Blindgängern geworden. Im Jahr 2018 seien 6.897 Fälle registriert worden, bei denen die Sprengkörper Menschen verletzten oder töteten, teilte die Hilfsorganisation Handicap International am 21. November in München mit. Die Dunkelziffer sei jedoch höher.
Die Menschen seien hauptsächlich in den Konflikten in Afghanistan, Libyen, Nigeria, Syrien und anderen Ländern verstümmelt worden oder zu Tode gekommen. Damit seien im vierten Jahr in Folge ungewöhnlich hohe Opferzahlen zu verzeichnen gewesen, heißt es im Landminen Monitor 2019. Die Zahl der Opfer stieg demnach zwischen 2014 und 2018 sehr stark an. Im Jahr 2014 wurden 3.998 Tote und Verletzte verzeichnet.
Datenerfassung schwierig
Der Bericht beobachtet die Wirkung des Ottawa-Vertrags von 1997, der den Einsatz, die Herstellung, den Handel und die Lagerung von Antipersonenminen verbietet und die Räumung verminter Regionen sowie die Unterstützung der betroffenen Menschen fordert. Zahlreiche Opfer wurden dabei gar nicht erfasst, da es in einigen Gegenden Schwierigkeiten gab, die Daten zu ermitteln.
Vom 25. bis 29. November treffen sich die Ottawa-Vertragsstaaten zur Überprüfungskonferenz in Oslo. Handicap International forderte die Staaten auf, das humanitäre Völkerrecht durchzusetzen und Druck auf die Kriegsparteien auszuüben, damit sie den Einsatz der Minen beenden. Handicap unterstützt Menschen mit Behinderung und andere besonders schutzbedürftige Menschen.
Drei Jahre Geiselhaft: Zwei Professoren in Afghanistan frei
Dubai, Kabul (epd). In Afghanistan sind zwei Professoren der Amerikanischen Universität nach drei Jahren Geiselhaft freigelassen worden. Wie der afghanische TV-Sender "Tolo News" am 19. November berichtete, fand die Übergabe des US-Bürgers Kevin King und des Australiers Timothy Weeks in der Provinz Sabul im Süden des Landes, statt. Im Gegenzug hatte die afghanische Regierung am Vortag drei hochrangige Taliban-Kämpfer aus einem Gefängnis in Bagram bei Kabul freigelassen.
Der bereits vor einer Woche angekündigte Gefangenenaustausch hatte sich zunächst aus unklaren Gründen verzögert. Der spektakuläre Austausch gilt als ein erster Schritt, die im Sommer gescheiterten Friedensgespräche in Afghanistan wiederzubeleben. Der 63-jährige Amerikaner King und der 50-jährige Australier Weeks waren im August 2016 in Kabul nahe ihrer Universität verschleppt worden. Die beiden Geiseln sollen sich in einem schlechten Gesundheitszustand befinden.
Kritik an Austausch
Die Regierung hatte drei Kämpfer des mit dem Taliban verbündeten Hakkani-Netzwerks freigelassen. Unter ist Anas Hakkani, dessen älterer Bruder Siradschuddin Anführer des Terrornetzwerkes ist, das für zahlreiche blutige Anschläge in Afghanistan verantwortlich gemacht wird.
Die drei Freigelassenen sollen umgehend in das Wüstenemirat Katar ausgeflogen worden sein, wo sie weiterhin "unter Hausarrest" bleiben sollen. Katar war bereits Schauplatz monatelanger Friedensverhandlungen zwischen den USA und den Taliban. Die Taliban unterhalten in Katars Hauptstadt Doha ein Verbindungsbüro.
Die Freilassung der drei Hakkani-Häftlinge stieß in Afghanistan auf viel Kritik: Die Terrororganisation hat eine Reihe schwerer Attentate in Afghanistan verübt. Unter anderem soll sie für den Anschlag in Kabul im Januar 2018 mit über 100 Toten verantwortlich sein, bei dem ein Krankenwagen voller Sprengstoff detonierte. Das Hakkani-Netzwerk soll auch hinter dem Attentat vor der deutschen Botschaft in Kabul mit über 150 Toten im Mai 2017 stehen.
Verhandlungen abgebrochen
Verhandlungen zwischen den Taliban und der US-Regierung waren im September von US-Präsident Donald Trump abgebrochen worden. Die afghanische Regierung war an den Gesprächen nicht beteiligt. Laut den Vereinten Nationen hat die Zahl der zivilen Oper in Afghanistan in diesem Sommer einen neuen Höchststand erreicht. Zwischen Juli und September kamen 1.174 Zivilisten bei dem Konflikt ums Leben. Etwa die Hälfte des Landes wird von den Taliban kontrolliert. Ein Ende des 18 Jahre dauernden Konflikts am Hindukusch ist nicht abzusehen.
Nicaragua: UN fordern Schutz für Oppositionelle in Kirchen
Genf (epd). Die Vereinten Nationen haben Nicaragua aufgefordert, in Kirchen protestierende Oppositionelle zu schützen. Gewaltsame Angriffe auf die verschiedenen Gruppen müssten verhindert, ihre Versorgung sichergestellt werden, sagte der Sprecher des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, Rupert Colville, am 19. November in Genf. Man sei sehr besorgt über die Lage der Oppositionellen, von denen sich einige im Hungerstreik befinden. Darüber hinaus müsse die Regierung von Präsident Daniel Ortega die gewaltsame Unterdrückung und Kriminalisierung ihrer Kritiker beenden sowie willkürlich Verhaftete freilassen.
In Nicaragua begeben sich Regimekritiker immer wieder in Kirchen, um der massiven staatlichen Repression zu entgehen. 13 Personen hatten in der Vorwoche in einer Kirche in der Stadt Masaya einen Protest zur Freilassung von 130 Oppositionellen begonnen. Neun von ihnen traten in einen Hungerstreik. Die Polizei umstellte daraufhin das Gebäude, stellte Wasser und Strom ab und sperrte jeden Zugang zum Gebäude.
Vorwurf Waffenschmuggel
Als 13 Unterstützer daraufhin in der Nacht Wasser und Insulin für den an Diabetes erkrankten Pfarrer in die Kirche brachten, wurden sie verhaftet. Die Staatsanwaltschaft des autoritär regierten Landes wirft ihnen Waffenschmuggel vor. Bei den Verhafteten sind auch prominente Menschenrechtler.
Die UN verurteilten zudem die Gewalt von Regierungsanhängern, die am 18. November eine Kirche in der Hauptstadt Managua stürmten und unter Schutz der Polizei Demonstranten, den Priester und eine Nonne mit Steinen bewarfen und bedrängten. In der Kirche hatten sich acht Personen aufgehalten, die aus Solidarität mit den Verhafteten ihrerseits einen Hungerstreik begonnen hatten, außerdem ein Arzt und ein elfjähriges Kind.
Die Hungerstreiks sind Teil einer Kampagne "Weihnachten ohne politische Gefangene". Mindestens 130 Menschen befinden sich den UN zufolge nach Protesten gegen die Regierung in Haft. Nach Angaben der Interamerikanischen Menschenrechtskommission sind bei Auseinandersetzungen zwischen Polizisten, Paramilitärs und Demonstranten bislang 325 Menschen getötet worden. Zehntausende Nicaraguaner flohen ins Exil.
Ausland
Papst fordert Abbau von Atomwaffen-Arsenalen

epd-bild/Vatican Media/Romano Siciliani
Rom (epd). Bei seinem Besuch in Japan hat Papst Franziskus der Toten des ersten Atombombenabwurfs im Zweiten Weltkrieg gedacht und die Abschaffung aller Nuklearwaffen gefordert. "Aus diesem Abgrund des Schweigens hört man noch heute den lauten Schrei derer, die nicht mehr sind", sagte er am 24. November bei einem Friedenstreffen in Hiroshima. Dort waren 1945 Zehntausende Menschen durch eine US-Atombombe gestorben. Unzählige weitere erlagen den Folgen der Verstrahlung.
Der Angriff habe für immer nicht nur die Geschichte Japans sondern auch das Antlitz der Menschheit geprägt, sagte Franziskus. Daran zu erinnern sei ein moralischer Imperativ. "Nie wieder so viel Leid!", mahnte das katholische Kirchenoberhaupt.
"Unsagbares Grauen"
Der Einsatz von Atomwaffen sei ein "Verbrechen nicht nur gegen den Menschen und seine Würde, sondern auch gegen jede Zukunftsmöglichkeit", sagte der Papst. Er verurteilte auch den Besitz von Atomwaffen als unmoralisch. "Wie können wir Frieden anbieten, wenn wir beständig die Drohung eines Atomkrieges als legitimes Mittel zur Konfliktlösung einsetzen?" fragte er.
In Nagasaki hatte Franziskus zuvor an das "unsagbare Grauen" erinnert, "das die Opfer und ihre Familien am eigenen Leib erlitten haben". Die Stadt mache den Menschen noch heute bewusst, welchen Schmerz und Schrecken Menschen einander zufügen könnten, sagte er an dem Ort, auf den im August 1945 die zweite Atombombe fiel.
Der Besitz von Atomwaffen und anderer Massenvernichtungswaffen sei "unvereinbar" mit dem Wunsch nach Frieden und internationaler Stabilität, sagte Franziskus. Angst vor gegenseitiger Zerstörung, Drohungen mit gänzlicher Auslöschung sowie eine Logik der Angst und des Misstrauens vergifteten vielmehr die Beziehungen zwischen den Völkern und verhinderten jeden möglichen Dialog.
Rüstung Ressourcenverschwendung
Das Wettrüsten vergeude wertvolle Ressourcen, die zugunsten von Entwicklung und Umweltschutz verwendet werden könnten, beklagte der Papst. "In der Welt von heute, wo Millionen von Kindern und Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, ist es ein himmelschreiender Anschlag, wenn für Herstellung, Modernisierung, Erhalt und Verkauf von Waffen mit immer stärkerer Zerstörungskraft Gelder ausgegeben und damit Vermögen erzielt werden."
Der Kampf für eine atomwaffenfreie Welt erfordere Zusammenarbeit auf allen Ebenen, betonte der Papst. Dabei müsse Vertrauen aufgebaut werden, um die "Dynamik des Misstrauens" zu überwinden. Angesichts der Entwicklung neuer Waffentechnologien wiege die "Erosion des Multilateralismus" besonders schwer. In diesem Zusammenhang zeigte Franziskus sich vor dem Hintergrund der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA besorgt über das Risiko einer Demontage internationaler Kontrollsysteme von Waffenarsenalen.
Franziskus hatte am 20. November eine einwöchige Asienreise begonnen. Erste Station war Bangkok, wo er buddhistische Mönche und Vertreter anderer Kirchen und Religionen traf. Am 23. November war er nach Japan weitergeflogen.
Boliviens Parlament verabschiedet Gesetz über Neuwahlen
Die Übergangsregierung Boliviens will Ex-Präsident Evo Morales wegen Terrorismus und Anstiftung zur Aufruhr anklagen. Dieser weist alle Anschuldigungen zurück.Berlin, La Paz (epd). Das Parlament in Bolivien hat ein Gesetz für Neuwahlen verabschiedet. Nach dem Senat stimmte auch das Abgeordnetenhaus für das Vorhaben, wie die Tageszeitung "Los Tiempos" am 23. November berichtet. Gleichzeitig wird damit die umstrittene Präsidentschaftswahl am 20. Oktober annulliert. Das Gesetz sieht auch die Neubesetzung der Wahlkommission und des Obersten Wahlgerichts vor. Der zurückgetretene Staatschef Evo Morales und alle Politiker, die in den vergangenen zwei Legislaturperioden durchgehend ein Amt innehatten, dürfen nicht erneut für die gleiche Position kandidieren. Übergangspräsidentin Jeanine Áñez kündigte an, das Gesetz am Sonntag zu unterschreiben.
Auch Abgeordnete von Morales‘ Partei "Bewegung für Sozialismus" MAS stimmten für das Gesetz. Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Sergio Choque, sagte, unabhängig von der politischen Ausrichtung unter den Parlamentariern habe das Interesse für das bolivianische Volk im Vordergrund gestanden.
"Verlangen Höchststrafe"
Áñez machte zugleich deutlich, dass sie ein Gesetz, das Morales Immunität gewährt, ablehnt. Die Übergangsregierung will Morales wegen Terrorismus und Anstiftung zur Aufruhr anklagen. Morales habe Straßenblockaden organisiert, damit Lebensmittel nicht in die Städte gelangen können, sagte Innenminister Arturo Murillo. "Wir verlangen die Höchststrafe", betonte er. In einem Video soll Morales den Führer der Gewerkschaft der Kokabauern, Faustino Yucra Yarwi, entsprechend angewiesen haben.
Morales wies via Twitter die Anschuldigungen als gefälscht und manipuliert zurück. Er erklärte, die sozialen Bewegungen in Bolivien kämpften für Demokratie. 30 Menschen seien erschossen worden. Über die Täter gebe es keine Ermittlungen. Der Generalstaatsanwalt von Bolivien bat das Außenministerium, die mexikanischen Behörden über die Ermittlungen gegen Morales zu informieren und zu kooperieren.
Sei den umstrittenen Präsidentschaftswahlen befindet sich Bolivien in Aufruhr. Nachdem Morales auf Druck des Militärs zurückgetreten war, hatte sich die Oppositionspolitikerin Áñez zur Übergangspräsidentin erklärt. Daraufhin eskalierte die Gewalt zwischen Anhängern von Morales und den Sicherheitskräften. Morales befindet sich in Mexiko im Exil.

