Kirchen
Trauer um Kardinal Karl Lehmann

epd-bild/Kristina Schäfer
Mainz (epd). Der langjährige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Mainzer Bischof Kardinal Karl Lehmann ist tot. Er starb am 11. März im Alter von 81 Jahren, wie das Bistum Mainz mitteilte. Lehmann galt als einer der prägendsten Repräsentanten der katholischen Kirche und besonnener Reformer. Nach seiner Emeritierung mit 80 Jahren im Mai 2016 hatte er im vergangenen September einen Schlaganfall und eine Hirnblutung erlitten.
Kirchen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft würdigten den Verstorbenen einhellig als unermüdlichen Brückenbauer, Mann des klaren Wortes und den Menschen offen zugewandten Bischof. Kardinal Lehmann habe die Herzen vieler Menschen erreicht und sich hohen Respekt erworben, erklärte der Nachfolger im Mainzer Bischofsamt, Peter Kohlgraf. Liebevoll hätten ihn die Gläubigen der Diözese "unseren Karl" genannt. "Mit einem weiten Herzen und einem klaren Blick für die Themen der Menschen hat er sein Bischofsamt ausgeübt."
Mehr als 20 Jahre Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
Lehmann, der Philosophie und Theologie studierte, empfing 1963 die Priesterweihe. Von 1962 bis 1965 nahm er als Mitarbeiter des Theologen Karl Rahner (1904-1984) am Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) teil, dessen weitreichende Beschlüsse die Öffnung der römisch-katholischen Kirche hin zur modernen Welt und zur Ökumene einleiteten. Ab 1968 unterrichtete er als Theologieprofessor an den Universitäten Mainz und Freiburg, bis er 1983 von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Mainz ernannt wurde.
Von 1987 bis 2008 war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Im langwierigen Streit um den vom Vatikan geforderten Ausstieg der katholischen Kirche aus der Schwangerenkonfliktberatung musste Lehmann sich 1999 einem Machtwort von Johannes Paul II. beugen. 2001 verlieh der Papst dem Mainzer Bischof überraschend die Kardinalswürde, nachdem Lehmann zuvor auffallend lange nicht in den Kreis der Kardinäle aufgenommen worden war.
Beisetzung am 21. März
Kardinal Karl Lehmann wird am 21. März im Mainzer Dom beigesetzt. Zuvor soll sein Leichnam in der Mainzer Seminarkirche aufgebahrt werden. In einem Trauerzug wird der Verstorbene durch die Innenstadt in den Dom gebracht. Den Gottesdienst leitet Lehmanns Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf.
Kardinal Reinhard Marx erinnerte an den Verstorbenen als eine prägende Kirchenpersönlichkeit und einen warmherzigen und wertschätzenden Bischof. Die ökumenische Annäherung sei ihm ein Herzensanliegen gewesen, erklärte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
Bedford-Strohm: "Mitstreiter für das ökumenische Miteinander"
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, würdigte den Verstorbenen als "Mitstreiter für das ökumenische Miteinander": "Durch seine herausragende theologische Kompetenz, gepaart mit einem weiten Herzen, hat er die Ökumene entscheidend vorangebracht", betonte Bedford-Strohm.
Der Vorsitzende der Union Evangelischer Kirchen (UEK) in der EKD, der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad, betonte Hochachtung und Respekt angesichts Lehmanns Wirkens für die Kirchen. Der evangelische Ökumene-Bischof Karl-Hinrich Manzke aus Bückeburg nannte Lehmann einen "großartigen Theologen und Menschenfreund". Der Zentralrat der Juden in Deutschland erklärte, Kardinal Lehmann habe sich stets mit Sensibilität und Klugheit für ein gutes Verhältnis von Christen und Juden eingesetzt.
Merkel spricht von "begnadetem Vermittler"
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den verstorbenen Kardinal als Mann klarer Worte. Lehmann habe "bei aller Nachdenklichkeit und Konzilianz" auch die politische Kontroverse nicht gescheut, wenn es um zentrale Fragen des Zusammenlebens gegangen sei.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betonte, sie denke mit tiefer Dankbarkeit an die guten Gespräche und Begegnungen. Sie erinnerte an Lehmann als "begnadeten Vermittler" im Geist der Ökumene, aber auch zwischen Christen und den Gläubigen anderer Religionen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) betonte, Lehmann sei ein Mann des Dialogs gewesen - und damit ein ermutigendes Beispiel für ein weltoffenes, lebensbejahendes Christentum.
Würdigung auch aus NRW
Auch leitende Theologen aus Nordrhein-Westfalen würdigten Lehmann als herausragenden Theologen und Vermittler. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki nannte Lehmann einen exzellenten theologischen Denker und den Menschen zugewandten Seelsorger. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, erinnerte an das intensive ökumenische Miteinander und hob Lehmanns Humor und Bodenständigkeit, seinen Gerechtigkeitssinn und sein soziales Gewissen hervor.
Kardinal Karl Lehmann - Volkstribun und Theoretiker
Kaum ein katholischer Würdenträger in Deutschland war in den vergangenen Jahrzehnten ähnlich populär wie der langjährige Mainzer Bischof Karl Lehmann. Innerkirchlich konnte sich der Theologe aber oft nicht gegen Widerstände durchsetzen.Mainz (epd). Als junger Theologe erlebte er den Aufbruch der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) mit. Als langjähriger Mainzer Bischof und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz erwarb er sich weit über sein Bistum und die katholische Kirche hinaus höchsten Respekt. Kardinal Karl Lehmann hat die Entwicklungen innerhalb seiner Kirche in Deutschland über Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgeprägt, doch ihm fehlte die Macht, weitreichende Reformen durchzusetzen. Am frühen Morgen des 11. März starb er im Alter von 81 Jahren.
Mit Fan-Schal im Fußballstadion
In seiner Wahlheimat Mainz entwickelte Lehmann im Laufe seiner 32-jährigen Amtszeit Qualitäten eines Volkstribuns, dem auch Nichtkatholiken mit großer Sympathie begegneten: Man konnte den Bischof mit Fan-Schal im Fußballstadion treffen oder bei der Mainzer Fastnacht. Gleichzeitig blieb der 1936 in Sigmaringen geborene Sohn eines Volksschullehrers immer voller Leidenschaft der wissenschaftlichen Theologie verbunden. Seine riesige Privatbibliothek ist legendär, seine kolossale Veröffentlichungsliste umfasst über 4.200 gedruckte Texte. Wenn er alte Weggefährten aus Hochschulzeiten traf, mit denen er diskutieren konnte, wirkte Lehmann oft besonders glücklich.
Als wissenschaftlicher Assistent des Theologen Karl Rahner (1904-1984) hatte der junge Lehmann noch selbst am Konzil in Rom teilgenommen, jener historischen Versammlung, mit der sich die katholische Kirche zur modernen Welt hin öffnete. Auch nach der Priesterweihe blieb Lehmann zunächst der Wissenschaft treu. Die Jahre als Hochschulprofessor an der Universität Freiburg, so räumte er kurz vor dem Wechsel in den Ruhestand ein, gehörten zu den "schönsten in meinem Leben".
Leiden unter Zerreißproben
Als Bischof von Mainz ab 1983 und an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz ab 1987 genoss er den Ruf eines verhältnismäßig liberalen Vordenkers, der sich auch stark für die Ökumene einsetzte, ohne dabei vom Vatikan gesetzte rote Linien zu überschreiten. In all den Jahren verheimlichte er nie, dass er sich bei den großen Streitthemen wie dem Zölibat und der Rolle von Frauen größere Veränderungen wünschte, als sie in der katholischen Kirche durchsetzbar waren. Das machte ihm auch persönlich zu schaffen.
"Große Liebe gibt es auch in der Kirche nicht ohne das Leiden", formulierte er in einem seiner Bücher. "Jeder, der in der Nachfolge des Herrn steht und schmerzlich die Wirklichkeit der Kirche erfährt, kennt diese Zerreißprobe." Im Streit über den vom Vatikan geforderten Ausstieg aus der Schwangerenkonfliktberatung scheute er selbst vor einer Auseinandersetzung mit Papst Johannes Paul II. nicht zurück. "Wir haben gekämpft, und wir haben verloren", kommentierte er 1999 schließlich das Machtwort aus Rom. Auffällig lange wurde Lehmann ausgespart, wenn der polnische Papst den Kreis der Kardinäle erweiterte. Erst 2001 wurde auch dem Mainzer Bischof die Ehre zuteil.
Schlaganfall im September
Lehmanns letzte Dienstjahre waren bereits von ernsthaften gesundheitlichen Problemen überschattet, er habe "Raubbau" an seiner Gesundheit betrieben, sagte der Kardinal über sich selbst. Seinen Abschied aus dem Bischofsamt im Mai 2016 betrachtete er mit einer Mischung aus Wehmut und Erleichterung. Manche seiner Ausführungen klangen da fast resigniert: Allenfalls in langsamen Schritten werde sich die katholische Weltkirche weiterentwickeln - trotz des Schwungs von Papst Franziskus: "Die Starrköpfe sitzen an verschiedenen Stellen, und man kann nur hoffen, dass der Papst lange lebt und gesund bleibt."
Nur Wochen nach seinem letzten großen Gottesdienst, der Bischofsweihe seines Nachfolgers Peter Kohlgraf im August 2017, erlitt Lehmann im vergangenen September einen Schlaganfall. Seither konnte er keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen.
Rheinischer Präses würdigt Genossenschaftsidee

epd-bild / Stefan Arend
Mainz, Düsseldorf (epd). Mit einem Festakt im Kurfürstlichen Schloss in Mainz hat das Land Rheinland-Pfalz am 11. März an den 200. Geburtstag des Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) erinnert. In einem Festgottesdienst rief der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, dazu auf, das Auseinanderdriften der Gesellschaft nicht hinzunehmen. Die Spaltung der Welt in Arm und Reich müsse überwunden werden, forderte Rekowski laut Predigttext: "Ausgleich, nicht Sicherung des Vorsprungs, muss das Programm heißen."
Das müsse auch für die Verteilung von Entwicklungshilfegeld und den Abschluss von Handelsverträgen gelten, forderte der leitende Theologe der zweitgrößten deutschen Landeskirche. Die "himmelschreiende Ungleichheit zwischen Ländern und Kontinenten" sei derzeit eine der wichtigsten Ursachen für die weltweiten Fluchtbewegungen. Schon für Raiffeisen sei klar gewesen, dass hungernden Menschen geholfen werden müsse - "am besten durch Selbsthilfe", betonte Rekowski. Der Gründer der Genossenschaftsidee habe somit schon im 19. Jahrhundert das Gemeinwohl ins Zentrum des wirtschaftlichen Handelns gestellt.
Bei dem anschließenden Festakt betonte auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Bedeutung von Raiffeisens sozialen Reformen: "In Zeiten von Globalisierung und Individualisierung ist die Genossenschaftsidee überzeugender und moderner denn je."
In Rheinland-Pfalz sind weitere Veranstaltungen zum Geburtstag des Sozialreformers aus dem Westerwald geplant. Die rheinische Landeskirche erinnert am 18. März mit einem Festtag in Raiffeisens Geburtsort Hamm/Sieg an den Genossenschaftsgründer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die Schirmherrschaft über das Jubiläumsjahr übernommen hat, will am 20. März das Raiffeisenhaus in Flammersfeld besuchen.
Raiffeisen hatte als Bürgermeister in der Westerwald-Region aus einer christlichen Grundhaltung heraus Sozialreformen angestoßen, um die Not der örtlichen Bauern zu lindern. Mit einem "Hülfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirthe" wollte er den Landwirten Zugang zu zinsgünstigen Krediten verschaffen.
Bernhard Christ erhält Karl-Barth-Preis 2018
Hannover (epd). Der Schweizer Jurist Bernhard Christ wird mit dem evangelischen Karl-Barth-Preis 2018 ausgezeichnet. Damit werde Christs beispielhaftes Wirken in Politik und Gesellschaft sowie in Kirche und Theologie gewürdigt, teilte die Union Evangelischer Kirchen (UEK) am 6. März in Hannover mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Verleihung soll am 50. Todestag Karl Barths, am 10. Dezember, in Basel stattfinden. Bernhard Christ ist Präsident der Karl-Barth-Stiftung, die in Basel ansässig ist.
"Von zentraler Bedeutung für Bernhard Christs ehrenamtliche Arbeit in der Kirche ist die Überzeugung, dass sich Kirche und Theologie immer wieder neu mit dem in der Bibel bezeugten Wort Gottes konfrontieren müssen. Dazu ist eine Theologie vonnöten, die mit der biblischen und reformatorischen Tradition verbunden ist", heißt es in der Begründung der Jury. Christ sei überzeugt gewesen, dass die Theologie Karl Rahners dazu besonders gut geeignet sei, teilte die UEK weiter mit.
Preisträger Küng und Huber
Der Karl-Barth-Preis wird seit 1986 alle zwei Jahre von der UEK für ein herausragendes theologisch-wissenschaftliches Werk oder für ein herausragendes Wirken in Kirche und Gesellschaft im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 verliehen. Die zentrale theologische Äußerung der Bekennenden Kirche unter dem Nazi-Regime richtete sich gegen Theologie und Kirchenregime der "Deutschen Christen". Zu den bisherigen Preisträgern gehören Eberhard Jüngel, Hans Küng, Karl Lehmann, Wolfgang Huber und Michael Welker. Die UEK ist ein konfessioneller Zusammenschluss innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Buß: Inhumane Arbeitswelt widerspricht christlicher Lehre
Dortmund (epd). Mit der Arbeitswelt und Luthers Verständnis von Berufen befasst sich eine Ausstellung in Dortmund. Die interaktive Schau "Die Berufungsfabrik", die am 8. März eröffnet wurde, will nach Angaben der Ausstellungsmacher deutlich machen, welche Bedeutung Arbeit für die persönliche Lebensgestaltung hat. Das Projekt des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gastiert bis zum 13. Mai in der Dasa-Arbeitswelt-Ausstellung.
Die Ausstellung nimmt nach Angaben der Veranstalter die Besucher mit auf einen Weg durch die heutige Arbeits- und Berufswelt. Sechs Stationen thematisieren etwa Rahmenbedingungen guter Arbeit, Fragen von Mitarbeiterführung oder Arbeit in einer digitalisierten Welt. Aktivitäten und Spiele laden zum Ausprobieren und Handeln ein.
Nach Worten des Altpräses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Alfred Buß, widersprechen inhumane Arbeitsverhältnisse dem christlichen Verständnis von Beruf und Berufung. Mit einem christlichen Arbeitsethos, das den Beruf als fröhlichen Dienst an Gott und dem Nächsten verstehe, sei eine inhumane Arbeitswelt nicht zu vereinbaren, sagte der Theologe in seinem Vortrag zur Ausstellungseröffnung. Dazu gehörten sinnentleerte, monotone Tätigkeiten sowie prekäre oder ausbeuterische Verhältnisse.
Nach dem Verständnis des Reformators Martin Luther führe die Berufung eines Christen zur Freiheit auch in die Freiheit zum Beruf, erläuterte Buß. Weil hinter jeder Arbeit eine Berufung stecke, könne sie jeden Menschen zum Einsatz all seiner Kreativität motivieren. Berufung führe nach christlichem Verständnis nicht in die Weltflucht, sondern in die Gestaltung der Welt, unterstrich Buß.
Weltmissionskonferenz in Arusha mit Friedensappell eröffnet
Genf, Arusha (epd). Der Generalsekretär des Weltkirchenrates, Olav Fykse Tveit, hat am 8. März im tansanischen Arusha die Weltmissionskonferenz mit einem Aufruf zur Versöhnung der vielen internationalen Konfliktparteien eröffnet. Die Welt brauche dringend friedliche und gerechte Lösungen für die bewaffneten Auseinandersetzungen, sagte Tveit vor fast 1.000 Teilnehmern der Weltmissionskonferenz.
Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) bezeichnete die Konferenz als Meilenstein der Kirchengeschichte. An der Tagung, die bis zum 13. März dauert, nehmen Delegierte von protestantischen, orthodoxen, römisch-katholischen, evangelikalen sowie pfingstkirchlichen Kirchen und Gemeinschaften teil. Die Konferenz soll einen christlichen Beitrag für mehr globale soziale Gerechtigkeit und Frieden leisten. Unter dem Leitwort "Im Geiste voranschreiten: Zu verwandelnder Nachfolge berufen" soll in Arusha zudem über eine Neuausrichtung der Mission beraten werden.
"Einheit feiern"
Mit dem Austragungsort solle betont werden, dass der afrikanische Kontinent eine der lebendigsten Regionen des Weltchristentums ist, hieß es. Die Konferenz in Tansania solle die "Einheit aller Völker im Staunen über ihre gottgegebene Vielfalt" feiern. Sie befasst sich mit verschiedenen Aspekten missionarischer Praxis und sucht den Veranstaltern zufolge neue Möglichkeiten, "Gottes Auftrag in der Welt zu erfüllen". Die letzte Weltmissionskonferenz in Afrika fand 1958 in Ghana statt.
Weltmissionskonferenzen werden etwa alle zehn Jahre abgehalten, die erste Konferenz fand 1910 in der schottischen Hauptstadt Edinburgh statt. Diese Tagung gilt als Beginn der ökumenischen Bewegung. Teilnehmer waren damals vor allem Vertreter von Missionsgesellschaften aus dem Protestantismus und der anglikanischen Kirche.
Missionswandel
In den vergangenen 100 Jahren hat sich die christliche Missionsarbeit stark gewandelt. "Ging es bei der Missionsarbeit zunächst darum, die Menschen zum Christentum zu bekehren, haben die Kirchen in späteren Zeiten ihre Aufgabe vorwiegend in der Arbeit für Menschen in Regionen gesehen, die von Konflikten oder dem Klimawandel betroffen sind oder in Situationen leben, in denen ihr wirtschaftliches Überleben bedroht ist", merkte der Weltkirchenrat an.
Die Konferenzen für Weltmission und Evangelisation werden ausgerichtet vom Internationalen Missionsrat und der Kommission für Weltmission und Evangelisation (CWME) des ÖRK. Gastgeber in Tansania ist die Evangelisch-Lutherische Kirche des Landes.
Kirchenasyl: Evangelischer Pfarrer muss vor Gericht
Mainz, Kaiserslautern (epd). In Rheinland-Pfalz muss sich erstmals ein Pfarrer vor Gericht verantworten, weil seine Gemeinde einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt hat. Wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt in der protestantischen Kirchengemeinde im pfälzischen Hochspeyer sei ein Strafbefehl erlassen worden, teilte das Amtsgericht Kaiserslautern auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Weil der Pfarrer dagegen Einspruch eingelegt habe, sei für Ende April nun eine Hauptverhandlung angesetzt worden.
"Wir sind sehr verwundert, dass es zu diesem Verfahren gekommen ist", sagte der Sprecher der pfälzischen Landeskirche, Wolfgang Schumacher, dem epd. Die Kirchenleitung verfüge über keinerlei Hinweise darauf, dass der Pfarrer in Hochspeyer gegen die auf Bundesebene zwischen Staat und Kirche ausgehandelten Regeln zum Kirchenasyl verstoßen haben könnte. Die Landeskirche werde die Kosten für einen Verteidiger und eine mögliche Geldstrafe übernehmen.
Eskalation
Wie der Kirchasyl-Fall in der Pfalz derart eskalieren konnte und ob sich der aufgenommene Flüchtling noch in der Gemeinde befindet, blieb zunächst unklar. Weder der angeklagte Pfarrer noch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Nach epd-Informationen hatte die evangelische Kirchengemeinde in Hochspeyer einen Mann aus Zentralafrika aufgenommen, für den die Ausländerbehörde der Stadt Kaiserslautern verantwortlich war.
Das städtische Ausländeramt sei nicht für die Eröffnung von Strafverfahren zuständig, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Stadtverwaltung: "Wir teilen lediglich entsprechende Sachverhalte den zuständigen Behörden mit." Grundsätzlich handele es sich beim "sogenannten Kirchenasyl" nicht um ein gesetzlich anerkanntes Rechtsinstitut. Die Frage, ob kommunale Behördenmitarbeiter Strafanzeige gegen den Pfarrer erstattet hatten, ließ die städtische Pressestelle unbeantwortet.
Schon früher Streitfälle
Bereits im vergangenen Jahr hatte es in Rheinland-Pfalz eine Reihe aufsehenerregender Streitfälle um das Kirchenasyl gegeben. In Ludwigshafen hatte die Polizei ein Kirchenasyl aufgelöst und eine koptische Familie in den Kirchenräumen festgenommen. Zuvor waren eine katholische Kirche in Budenheim bei Mainz und weitere Räumlichkeiten der dortigen Kirchengemeinde auf Betreiben der Ingelheimer Kreisverwaltung durchsucht worden. Die Mainzer Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) bezeichnete das Vorgehen der Kommunen als "inakzeptabel".
Nach einem Krisentreffen von Landesregierung, Kommunalvertretern und Kirchen hatten sich die rheinland-pfälzischen Kommunen bereiterklärt, das Kirchenasyl auch künftig grundsätzlich zu respektieren. Allerdings waren kirchliche Vertreter auch in der Folgezeit in einer Reihe von Kirchenasyl-Fällen erheblichem behördlichen Druck ausgesetzt. Nach Angaben des Mainzer Integrationsministerium gab es Anfang März 26 Fälle von Kirchenasyl, die in die Zuständigkeit rheinland-pfälzischer Ausländerbehörden fielen.
Erzbischof gegen vorschnelle Urteile in Flüchtlingsfrage

epd-bild/Horst Wagner
Brüssel (epd). Der neue Präsident der katholischen Bischöfe in der EU, Jean-Claude Hollerich, hat vor vorschnellen Urteilen über Osteuropa in der Flüchtlingsfrage gewarnt. Man müsse einander zuhören und "die ganze Wirklichkeit" sehen, sagte Hollerich am 9. März in Brüssel. So habe Polen, das sich gegen die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU stemmt, etwa eine Million Ukrainer aufgenommen.
Der Luxemburger Erzbischof war am 8. März zum Präsidenten der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE) gewählt worden. Die COMECE dient als Schaltstelle der Bischöfe für ihren Kontakt zur EU. Sie beobachtet die für die Kirche wichtigen Entwicklungen in der Europahauptstadt und versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Wichtige Themen sind Religionsfreiheit, Ökologie, Sozialpolitik und Migration.
In der EU-Migrationspolitik gibt es starke Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Besonders die Regierungen osteuropäischer Länder wie Polen und Ungarn haben sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen positioniert. Hollerich sagte, "wir heißen Migranten immer willkommen". Zugleich müsse man einander in dieser Frage zuhören. "Und wir müssen auch über Grenzen von Migration nachdenken." Das bedeute vor allem, das Leben von Menschen zu verbessern, damit sie gar nicht nach Europa kommen müssten.
Lob für Juncker
Hollerich würdigte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Sein Landsmann und Freund habe ebenso wie der französische Präsident Emmanuel Macron "eine Vision für Europa". Darüber wolle er mit Juncker sprechen, kündigte Hollerich an. Zugleich sagte er mit Blick auf seine eigenen Lebenserfahrungen, Europa könnte etwas mehr Harmonie gebrauchen, die in Japan das Wichtigste sei.
Der 59-jährige Hollerich begann seine Priesterausbildung 1978 an der Gregorianischen Universität in Rom. Drei Jahre später trat er in den Jesuiten-Orden ein. Danach verbrachte er einige Zeit in Deutschland und 23 Jahre in Japan. Unter anderem wirkte er als Deutschlehrer sowie Oberer einer Jesuitengemeinschaft in Tokio. 1990 in Brüssel zum Priester geweiht, ist Hollerich seit 2011 Erzbischof von Luxemburg.
Die neue Amtszeit des COMECE-Präsidenten beträgt fünf Jahre. Hollerich löst den deutschen Kardinal Reinhard Marx ab, der das Amt zwei mal drei Jahre innehatte. Neuer deutscher Vertreter in der COMECE ist Franz-Josef Overbeck, der zugleich zum Vizepräsidenten gewählt wurde. Overbeck ist Ruhrbischof in Essen und Militärbischof der Bundeswehr. Weitere neue COMECE-Vizepräsidenten sind die Bischöfe Noel Treanor aus Irland, Mariano Crociata aus Italien und Jan Vokal aus Tschechien.
Papst will Paul VI. und Erzbischof Romero heiligsprechen
Rom (epd). Papst Franziskus will seinen Vorgänger Paul VI. und den während einer Messe erschossenen Erzbischof von El Salvador, Oscar Arnulfo Romero, heiligsprechen. Nach Angaben des Vatikans vom 7. März erkannte das Kirchenoberhaupt zwei medizinisch nicht erklärbare Heilungen als Wunder an, die aufgrund der Fürsprache der beiden erfolgt sein sollen.
Mit der Anerkennung dieser Wunder wurde die Voraussetzung für die Heiligsprechung geschaffen. Das Kirchenoberhaupt werde die Doppelheiligsprechung vermutlich zum Abschluss der für Oktober im Vatikan geplanten Bischofssynode zum Thema Kirche und Jugend vornehmen, meldeten italienische Medien.
Papst Paul VI. (1897-1978) gilt als der Papst des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65), das umfassende Reformen für die katholische Kirche wie die Anerkennung der Religionsfreiheit sowie die Öffnung für den Dialog mit anderen Kirchen und Religionen beschloss. Bis heute ist er als Verfasser der sogenannten Pillenenzyklika "Humanae vitae" von 1968 mit ihrem Verbot von Verhütungsmitteln und des Lehrschreibens "Populorum progressio" (1967) über Entwicklung sowie wirtschaftliche und soziale Fragen in Erinnerung. Franziskus sprach ihn im Herbst 2014 selig.
Oscar Romero (1917-80) genoss in der katholischen Kirche bereits vor seiner Seligsprechung im Jahr 2015 aufgrund seines Einsatzes für soziale Gerechtigkeit und politische Reformen während der Militärdiktatur in El Salvador hohes Ansehen. Im Vatikan gab es über Jahrzehnte Widerstand gegen seine Heiligsprechung. Der Mord an dem Erzbischof sei politisch und nicht religiös motiviert gewesen, hieß es. Der Erzbischof sei "diffamiert, verleumdet und mit Schmutz beworfen worden", sagte der Papst damals über die Entwicklungen auf dem Weg zur Seligsprechung.
Fünf Jahre Franziskus: Zwischen Tradition und Reform

epd-bild/Cristian Gennari
Rom (epd). Wenn es um das Wirken von Papst Franziskus geht, könnten die Bewertungen kaum unterschiedlicher ausfallen. "Die Kurie ist die älteste Institution der Welt, deshalb ist es utopisch zu meinen, man könnte sie innerhalb von ein paar Jahren umkrempeln", sagt zum Beispiel Walter Kasper. Der ehemalige Präsident des päpstlichen Einheitsrats verteidigt den Papst damit gegen Kritik. Seine Reformen gingen nicht schnell genug voran, lautet ein häufig geäußerter Vorwurf.
Mal ist es sein Traditionsbewusstsein, mal sein Reformbestreben, an dem sich heftige Reaktionen entzünden. Einerseits steht der Papst in Rom den progressiven Kräften vor. Aber wenn es etwa um die Unauflöslichkeit des Sakraments der Ehe geht, hängt er wiederum traditionellen Vorstellungen an.
Erster Jesuit
Bei seiner Wahl am 13. März 2013 war es vor allem sein Reformprogramm, das Franziskus Sympathien in aller Welt einbrachte. Damals kündigte er an, für mehr Effizienz und Transparenz der Kurie im Vatikan zu sorgen und den nationalen Bischofskonferenzen mehr Kompetenzen zuzugestehen. Als der erste Jesuit auf dem Papstthron dann auch noch weitgehend auf höfisches Zeremoniell verzichtete, nahm er damit selbst kirchenferne Kreise für sich ein.
In den fünf Jahren, die seither vergangen sind, überraschte der Papst immer wieder. Zum Beispiel damit, dass er im Vatikan gemeinsam mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas und dem inzwischen verstorbenen israelischen Staatspräsidenten Schimon Peres ein Gebet sprach. Damit wandelte er die Bemühungen seiner Vorgänger um Frieden in Nahost in eine konkrete politische Geste um.
Pannen bei Personalpolitik
Aus den eigenen Reihen gab es jedoch nicht nur Applaus. Scharfer Gegenwind kam auf, als er sich er sich für eine Öffnung traditioneller Kirchenstrukturen aussprach oder für eine Lockerung des Kommunionsverbots plädierte. Mit seinem Satz: "Wenn jemand schwul ist und den Herrn sucht, wer bin ich, um ihn zu verurteilen?", brachte der heute 81-jährige gebürtige Argentinier konservative Kirchenvertreter gegen sich auf. Seine Gegner beschreiben ihn als autokratischen Herrscher. Mit seinen häretischen Lehren spalte er die Kirche, lautet ihr Vorwurf.
Indem er Arme und Flüchtlinge in den Mittelpunkt seines Pontifikats stellt, überzeugt Franziskus jedoch nach wie vor viele Christen. Gleiches gilt für sein Engagement gegen Ausbeutung und Umweltzerstörung.
Symbolische Gesten wie die Wahl des Namens Franziskus, Lampedusa als Ziel seiner ersten Reise, Kleinwagen statt Limousinen und ein Leben im vatikanischen Gästehaus statt im Apostolischen Palast gerieten in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch mit der Zeit in den Hintergrund. Pannen bei der Personalpolitik im vatikanischen Wirtschaftssekretariat sorgten für einen Eklat. Zu dessen Präfekt hatte er den Australier George Pell ernannt, der wegen Vertuschung von Missbrauchsskandalen angeklagt ist.
Konservativer Widerstand
Dass er Missbrauch an Minderjährigen nicht entschieden genug bekämpfe, wurde Papst Franziskus immer wieder vorgehalten. Spätestens als sich zwei Missbrauchsopfer aus der von ihm ins Leben gerufenen Kinderschutzkommission aus Frustration über deren Machtlosigkeit zurückzogen, kamen Zweifel an der Ernsthaftigkeit seines Kampfs gegen Pädophilie in der Kirche auf.
Dass der Papst wiederverheirateten Geschiedenen die Öffnung der Kirche in Aussicht stellt, bringt ihm von konservativer Seite viel Kritik ein. Das Schreiben "Amoris laetitia", in dem er zu Barmherzigkeit gegenüber gescheiterten Ehen aufruft, stieß bei ihnen auf erheblichen Widerstand. Vier Kardinäle forderten daraufhin eine Klärung.
Weniger Widerstand erntet der Papst, wenn es um Fortschritte in der Ökumene geht. Er gewährte den nationalen Bischofskonferenzen Spielraum, wenn es um die gemeinsame Kommunion von Ehepaaren unterschiedlicher Konfession geht.
Gemeinsame Abendmahlsfeiern für Katholiken und Protestanten bleiben damit jedoch nach wie vor in weiter Ferne. Es sind kleine Schritte, mit denen die katholische Kirche unter Papst Franziskus vorangeht.
Filmhochschule entschuldigt sich für Nackt-Fotoshooting in Kirche
Berlin/Dubrovnik (epd). Die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin hat sich für Nackt-Aufnahmen während eines Fotoshootings von Studenten in einer Kirche im kroatischen Dubrovnik entschuldigt. Man wolle sich "von ganzem Herzen bei der Kirche und den Bürgern von Dubrovnik entschuldigen", teilte Direktor Ben Gibson auf der Internetseite der Hochschule mit.
Am 7. März war bekanntgeworden, dass drei Studentinnen der Berliner Hochschule eine 64-jährige Frau mit nackter Brust in einer Kirche und an anderen historischen Stätten der kroatischen Adriastadt gefilmt und fotografiert hatten.
Laut dem Nachrichtenportal "Focus Online" hatte sich der katholische Bischof Mate Uzinic entsetzt über die Aktion der jungen Filmemacherinnen gezeigt. Er sei "tieftraurig", dass diese Bilder "unter der Maske der Kunst" gemacht worden seien, schrieb der Geistliche demnach auf seiner Facebook-Seite.
Örtliche Medien zitierten die Filmemacherinnen laut "Focus Online" mit den Worten: "Wir wollten damit die Schönheit der Frau unabhängig von ihrem Alter zeigen." Ziel des Films sei "die Zerstörung von Tabus und der Grenze zwischen Vergangenheit und heutiger Zeit" gewesen.
Erstes Studienjahr
Wie eine Sprecherin der Filmakademie am 8. März auf epd-Anfrage sagte, handelt es sich bei den jungen Filmemacherinnen um drei Studentinnen aus dem ersten Studienjahr. Diese hätten für ein Dokumentarfilmprojekt in Dubrovnik geübt. Die genauen Hintergründe der umstrittenen Aufnahmen müssten zunächst hochschulintern geprüft werden.
Die Studentinnen sollen sich derzeit auf dem Heimweg nach Berlin befinden. Auch zu weiteren Konsequenzen wie etwa einer direkten Kontaktaufnahme zu der betroffenen Kirchengemeinde wollte sich die Filmhochschule vorerst nicht äußern.
Akademie-Direktor Gibson betonte, die Hochschule habe nicht gewusst, dass das Fotoshooting Nackt-Aufnahmen in einer Kirche beinhalte. "Es passiert leider manchmal, dass jungen Filmemachern, die ihre ersten Schritte unternehmen, grundsätzliche Fehler unterlaufen, die andere Menschen unbeabsichtigt verletzen oder angreifen, wie in diesem Fall." Die Hochschule, die künstlerische Freiheit sehr hoch wertschätze, sei über die Besonderheiten der zu drehenden Szene und den Drehort nicht informiert gewesen.
Westfälischer Frauen-Kirchentag in Kamen
Kamen, Schwerte (epd). Der vierte Westfälische Frauen-Kirchentag im Juni stellt die Frage nach einem guten Leben in den Mittelpunkt. Das Treffen findet unter dem Titel "Die Welt braucht uns! 1.001 Ideen für ein gutes Leben für alle" am 9. Juni in Kamen statt, wie das Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Landeskirche am 6. März in Schwerte ankündigte. Veranstalter sind die Konferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Evangelischen Kirche von Westfalen, die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen und das Amt für Mission, Ökumene und Weltverantwortung (Möwe).
Auf dem Programm stehen das Auslegen biblischer Texte (Bibliolog), ein Podiumsgespräch und Workshops, wie es weiter hieß. Darunter sind ein Training in gewaltfreier Kommunikation, Singen im Chor sowie ein Kurs für Neueinsteigerinnen in Clownerie. Außerdem soll es um Ideen für nachhaltiges Leben sowie um Fragen der Einen Welt gehen.
Unverhoffter Geldsegen für Kirchengemeinde
Amberg (epd). Die evangelische Paulanergemeinde im ostbayerischen Amberg darf sich über einen unverhofften Geldsegen freuen: Im August hatte der Pfarrer auf dem Altar sechs weiße Kuverts mit insgesamt 21.600 Euro gefunden. Sieben Monate später ist klar, dass die Gemeinde das Geld behalten darf. Niemand habe die Summe vermisst oder beim Fundamt abgeholt, sagte Pfarrer Joachim von Kölichen am 8. März dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Summe sei jetzt auf das Gemeindekonto überwiesen worden.
Am 22. August hatte er das Geld beim Absperren der Kirche gefunden. Im ersten Kuvert seien 100-Euro-Scheine gewesen, im zweiten 200er- und 500er-Scheine. "Dann bin ich leicht in Panik verfallen, weil ich dachte, eine so hohe Summe kann nur kriminelle Hintergründe haben." Von Kölichen brachte das Geld zur Polizei. Da die Ermittlungen aber ins Leere verliefen, ging das Geld ans Fundamt. Nachdem ein halbes Jahr niemand einen Verlust angezeigt hatte, wurde das Geld an die Gemeinde überwiesen. In der nächsten Sitzung des Kirchenvorstands soll entschieden werden, wofür das Geld verwendet wird.
Landeskirche lässt Taufe durch Untertauchen zu
Stuttgart (epd). Taufen können in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg künftig auch im Schwimmbad oder am Baggersee stattfinden. Die Frühjahrssynode der mehr als zwei Millionen Mitglieder zählenden Kirche hat am 10. März in Stuttgart beschlossen, dass auch durch das Untertauchen des ganzen Körpers getauft werden kann. Die sogenannte Immersionstaufe ist Praxis in einigen Freikirchen, aber auch in der orthodoxen Kirche, während sich in katholischer und evangelischer Kirche die Taufe durch Besprengen des Täuflings mit Wasser durchgesetzt hat.
Der stellvertretende Vorsitzende des Rechtsausschusses der Synode, Pfarrer Thomas Wingert, hob hervor, dass es sich beim Untertauchen um eine biblische Form der Taufe handele. In den Kirchengemeinden vor Ort sei dafür eine Änderung der Gottesdienstordnung erforderlich, die vom Oberkirchenrat genehmigt werden müsse. Der Oberkirchenrat empfiehlt, für Ganzkörpertaufen ein fließendes Gewässer aufzusuchen. "Anträge an das Baureferat zur Errichtung eines Pools bleiben also zwecklos", sagte Wingert.
Paten können dem Synodenbeschluss zufolge künftig auch einer Kirche angehören, die die Kindertaufe ablehnt. Entscheidend sei, dass die Paten persönlich die Taufe eines Kindes bejahten und das landeskirchliche Taufverständnis teilten. Die Einstellung der Paten zur Taufe sei im Taufgespräch zu erfragen, sagte Wingert.
Essener Bischof warnt vor Vorgaben für "echte Christen"
Essen (epd). Der Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck warnt vor zu engen Vorgaben, was einen "echten Christen" ausmacht. "Wir sollten mit Pflicht- und Leistungskatalogen sehr, sehr vorsichtig sein und sie schon gar nicht primär moralisch füllen", sagte Overbeck dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag). Mit Blick auf die jüngst veröffentlichte Kirchenaustrittsstudie des Bistums Essen forderte der Bischof mehr Wertschätzung für den großen Anteil der selten oder gar nicht praktizierenden Katholiken. "Wir sollten es sehr zu schätzen wissen, dass sich mehr als 90 Prozent der Essener Katholiken zur Kirche gehörig fühlen oder sie zumindest finanziell unterstützen und fördern, obwohl sie sonntags in der Regel nicht zum Gottesdienst kommen und unsere Dienstleistungen höchstens punktuell in Anspruch nehmen."
Overbeck sprach sich für mehr Vielfalt in der katholischen Kirche aus, um die Mitglieder dauerhaft zu binden. "Die Formen der Verbundenheit oder des Zugehörigkeitsgefühls zur Kirche sind unendlich viel pluraler geworden, als wir in der Kirchenleitung uns das je gedacht hätten. Darauf müssen wir uns einstellen", sagte der Essener Bischof. Als Beispiel nannte er Segnungsgottesdienste für Neugeborene, deren Eltern keine Taufe wünschen. Nur die Taufe begründe die Mitgliedschaft in der Kirche, betonte Overbeck. "Aber unser Angebot nimmt jene ernst, die unsere Nähe suchen und den Segen Gottes für ihr Kind erbitten."
Laut der im Februar erschienenen Kirchenaustrittsstudie des Bistums Essen führen vor allem Entfremdung von der Kirche oder eine fehlende Bindung zum Austritt, aber auch die Ablehnung der kirchlichen Lehre etwa zu Homosexualität oder wiederverheirateten Geschiedenen. Die Studienautoren empfehlen der katholischen Kirche, sich insbesondere den Menschen zuzuwenden, die noch Kirchenmitglieder sind, aber keine Gottesdienste besuchen. Für die Studie "Kirchenaustritt - oder nicht? Wie die Kirche sich verändern muss" hatten Wissenschaftler im Auftrag des Bistums Essen Untersuchungen über Kirchenaustritte ausgewertet und ehemalige Katholiken befragt.
Gesellschaft
Buber-Rosenzweig-Medaille für Peter Maffay

epd-bild/Stefan Arend
Recklinghausen (epd). Der Musiker Peter Maffay ist für seinen Einsatz gegen Antisemitismus und Extremismus mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden. Der Sänger werde für sein entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus und Rassismus gewürdigt, erklärte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu der Auszeichnung am 11. März in Recklinghausen.
Würdigung durch Armin Laschet
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nannte Maffay bei der zentralen Eröffnungsfeier der Woche der Brüderlichkeit einen "Botschafter der Völkerverständigung", der vor allem junge Menschen anzusprechen wisse. Maffay setze sich schon seit Jahrzehnten für das Miteinander von deutschen, israelischen und palästinensischen Jugendlichen ein.
Die katholische Präsidentin des Koordinierungsrates, Margaretha Hackermeier, sagte, Maffay habe sich mit Mut und Zivilcourage gegen menschenfeindliche Haltungen öffentlich zur Wehr gesetzt. Sein Engagement habe er "mit seiner Musik, mit seinen Texten und mit seinen Konzerten" an den Tag gelegt. Laudator Udo Dahmen, Direktor der Pop-Akademie Baden-Württemberg, betonte, Peter Maffay habe es nicht dabei belassen, seine Visionen nur in Liedern zu besingen, sondern trete offen für sie ein. Das tue der Sänger insbesondere durch seine Peter Maffay Stiftung für traumatisierte, chronisch kranke, sozial benachteiligte und vernachlässigte Kinder.
Maffay selbst hob auf der Preisverleihung die Bedeutung des demokratischen Gemeinwesens hervor. Der besondere Wert liege darin, dass man keine Angst zu haben brauche, seine Meinung frei zu äußern, sagte der Musiker. Das sei nur in wenigen Gesellschaften der Welt möglich.
"Angst überwinden - Brücken bauen"
Mit der Preisverleihung wurde die bundesweite Woche der Brüderlichkeit eröffnet, die in diesem Jahr unter dem Motto "Angst überwinden - Brücken bauen" steht. In ganz Deutschland gibt es bis zum 18. März Veranstaltungen zu dem Thema. Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit veranstaltet die Woche der Brüderlichkeit seit 1952 jeweils im März. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird traditionell zur Eröffnung verliehen. Mit der undotierten Auszeichnung ehrt der Koordinierungsrat seit 1968 Menschen, Institutionen oder Initiativen, die sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Die Medaille erinnert an die jüdischen Philosophen Martin Buber (1878-1965) und Franz Rosenzweig (1886-1929).
Knobloch hält Bekämpfung von Antisemitismus für gescheitert
Düsseldorf (epd). Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, hält die Bekämpfung des Antisemitismus in Deutschland für gescheitert. Die 85-Jährige sagte am 11. März in einem Vortrag in Düsseldorf, sie sehe "im Kampf gegen Antisemitismus nur noch Rückschläge, keine Fortschritte mehr". Knobloch verwies auf die fast 1.500 antisemitischen Straftaten im vergangenen Jahr in Deutschland, die Schändung jüdischer Friedhöfe, Angriffe auf Synagogen und jüdische Gemeindehäuser sowie Hasstiraden in sozialen Netzwerken.
Knobloch betonte in ihrem Vortrag im Rahmen der Reihe "Düsseldorfer Reden" des Schauspielhauses, Deutschland sei ihre Heimat. "Ich liebe unser Land. Bis vor kurzem hätte ich hinter diese Aussage auch ein Ausrufezeichen gemacht, doch diese Gewissheit wankt." Es sei in Deutschland "überfällig, eine kluge Form von Patriotismus zu entwickeln", der kultur- und werteorientiert sei, forderte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Dem Thema Heimat müsse Regierungsrang gegeben werden.
Knobloch konstatierte eine "braune Renaissance" in Deutschland. Die rechtspopulistische AfD toleriere und fördere Antisemitismus und "überschreite die Grenzen des Sagbaren". In Deutschland "gewöhne man sich bereits an Ungeheuerlichkeiten, die vor kurzem noch geächtet waren", kritisierte die ehemalige Zentralratspräsidentin. Die AfD werde "nichts Positives zu einer liebens- und lebenswerten Demokratie in Deutschland" beitragen.
Zugleich beklagte Knobloch auch den Antisemitismus linker Gruppen und von Muslimen. "Und auch in der Mitte der Gesellschaft ist der Schoß immer noch fruchtbar." Die politisch und gesellschaftlich Verantwortlichen, aber auch die Bürger dürften angesichts des Holocaust "nicht vergessen, wie schnell die dünne Decke der Zivilisation zerreißen kann", mahnte Knobloch.
Verwaltungsrichter halten Kopftuchverbot für rechtens
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Klage einer muslimischen Rechtsreferendarin abgewiesen. Sie war gegen eine Auflage vorgegangen, mit der ihr im Rahmen der juristischen Ausbildung das Tragen ihres Kopftuchs untersagt worden war.München (epd). In bayerischen Gerichtssälen hängt zwar häufig ein Kreuz an der Wand, doch das Tragen religiöser Symbole ist Richtern und Staatsanwälten verboten - das gilt auch für Rechtsreferendarinnen mit muslimischem Kopftuch. In zweiter Instanz hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München am 7. März die Klage einer Juristin islamischen Glaubens für unzulässig erklärt.
Die Augsburgerin hatte 2014 zu Beginn ihres juristischen Vorbereitungsdienstes eine gerichtliche Auflage erhalten. Der zufolge durfte sie "bei der Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten mit Außenwirkung" ihr Kopftuch nicht tragen. Das äußere Erscheinungsbild, hieß es vonseiten des bayerischen Justizministeriums, dürfe "keinerlei Zweifel an der Unabhängigkeit, Neutralität und ausschließlicher Gesetzesorientierung aufkommen lassen".
Keine Diskriminierung
Wesentliche Ausbildungsinhalte seien der Klägerin aufgrund der Auflage verwehrt geblieben, sagte ihr Anwalt Frederik von Harbou, etwa das Beisitzen am Richtertisch. Dadurch fehlten ihr nicht nur "prägende Eindrücke aus dem Referendariat" - die Nichtdurchführung der Sitzungsvertretung sei im Zeugnis vermerkt sowie ein Eignungsmangel in ihrer Personalakte. Diese "abschätzende" Wertung könne nach Auffassung der Klägerseite zu negativen Nachwirkungen bei einer Bewerbung für den öffentlichen Dienst führen. Gegen diese aus ihrer Sicht "ungerechtfertigte Diskriminierung" klagte Frau S. und bekam 2016 vom Augsburger Verwaltungsgericht recht. Der Freistaat Bayern legte daraufhin Berufung ein.
Der BayVGH begründete nun den Beschluss damit, dass weder eine Diskriminierung noch Ehrverletzung oder negative Auswirkungen durch die Auflage für die Klägerin zu erkennen seien. Die Frau habe ihren juristischen Vorbereitungsdienst abschließen können und sei dabei nur in der einen Situation eingeschränkt worden, in der ihr die Sitzungsleitung verwehrt worden war. Damit trägt Frau S. die Verhandlungskosten. Eine Revision ist nicht zugelassen. Die Klägerseite hat dennoch angekündigt, die Einlegung von Rechtsmitteln zu prüfen.
Neutralität der Justiz
Der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) erklärte nach der Verkündung, es werde im Freistaat auch künftig keine Rechtsreferendarinnen geben, die auf der Richterbank, beim staatsanwaltschaftlichen Sitzungsdienst oder bei sonstigen hoheitlichen Tätigkeiten ein Kopftuch tragen: "Es ist für das Vertrauen der Bürger in die Unabhängigkeit und Neutralität der Justiz unabdingbar, dass schon das äußere Erscheinungsbild nicht den geringsten Anschein von Voreingenommenheit erweckt."
Bausback verwies dabei auf das vor kurzem verabschiedete Bayerische Richter- und Staatsanwaltsgesetz, das zum 1. April in Kraft tritt. Es besagt unter anderem, dass Richter "in Verhandlungen sowie bei allen Amtshandlungen mit Außenkontakt keine sichtbaren religiös oder weltanschaulich geprägten Symbole oder Kleidungsstücke tragen" dürfen. Dies soll auch für Staatsanwälte, Rechtspfleger, Schöffen und Rechtsreferendare gelten.
Vonseiten der Klägerin hieß es nach Verhandlungsende, das Gericht habe die eigentliche Frage, ob die Auflage ohne Rechtsgrundlage rechtswidrig war, erfolgreich umgangen: "Der Verwaltungsgerichtshof sieht in der monatelangen Zurücksetzung einer muslimischen Referendarin in der juristischen Ausbildung kein nachträgliches Feststellungsinteresse - selbst dann nicht, wenn die Auflage offen diskriminierend war. Meines Erachtens ist dies mit meinem Recht auf effektiven Rechtsschutz nicht vereinbar."
"Rechtswidrig"
Ihr Anwalt bekräftigte, die erste Instanz in Augsburg habe "unmissverständlich klar gemacht, dass die Auflage rechtswidrig war". Am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof sei es aber auch darum gegangen, "dass eine Rechtsreferendarin in Bayern ihre Ausbildung 'unter dem Kreuz' im Gerichtssaal absolvieren, dafür aber ihr Kopftuch ablegen soll". Der VGH habe die Gelegenheit verpasst, diese offensichtliche Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit zu korrigieren.
Nach Angaben des Justizministeriums gab es in den vergangenen zehn Jahren einen weiteren Fall dieser Art. Auch damals, 2008, habe es sich um eine muslimische Rechtsreferendarin mit Kopftuch gehandelt. Als Antwort auf den Fall habe das Justizministerium eine Auflage eingeführt, die zu Neutralität im Erscheinungsbild verpflichtet.
Überwiegend Katholiken im neuen Kabinett

epd-bild/Friedrich Stark
Berlin (epd). Im neuen Kabinett der großen Koalition, das am 14. März vereidigt werden soll, sind Katholiken in der Mehrheit. Acht der 14 Minister sind katholisch, zwei evangelisch. Zwei Minister gehören keiner Kirche an und zwei weitere veröffentlichen dazu keine Informationen. Die sich zur Wiederwahl stellende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an der Spitze des Kabinetts erhöht die Zahl der Protestanten immerhin auf drei.
Zu den Katholiken zählen bei der CDU die designierten Minister Jens Spahn, Julia Klöckner, Peter Altmaier und Anja Karliczek. Neben Merkel ist noch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen evangelisch. Die CSU schickt ausschließlich Katholiken als Minister ins Kabinett: Gerd Müller, Andreas Scheuer und CSU-Chef Horst Seehofer.
Katholik aus dem Saarland
Bei der SPD ist Heiko Maas, der Außenminister werden soll, Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Der für den Posten des Bundesarbeitsministers vorgesehene Hubertus Heil ist evangelisch. Olaf Scholz und die neue Umweltministerin Svenja Schulze gehören keiner Kirche an. Die neue Familienministerin Franziska Giffey und Katarina Barley, die ins Justizressort wechselt, machen dazu keine Angaben.
Im Kabinett der vergangenen großen Koalition waren die Protestanten in der Mehrheit. Dort waren auch verhältnismäßig viele kirchlich engagierte Politiker vertreten. Der bisherige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) gehört dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentags an. Gesundheitsminister Hermann Gröhe ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Umweltministerin Barbara Hendricks und SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles, die in der letzten Koalition Arbeitsministerin war, sind Mitglieder der Vollversammlung des Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der Laienorganisation der katholischen Kirche.
Brahms kritisiert Verlängerung von Bundeswehr-Einsätzen

epd-bild/Sebastian Backhaus
Bremen (epd). Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Renke Brahms, hat die Beschlüsse des Bundeskabinetts zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr kritisiert. "Das zeigt einmal mehr das Problem: Nach wie vor gibt es wenig Evaluation und ausführliche Debatte über den Sinn und das Ziel der Einsätze", sagte der leitende Bremer Theologe am 8. März dem Evangelischen Pressedienst (epd). Hier scheine sich eher eine Art Ratlosigkeit und ein schieres Bündnisdenken zu zeigen. "Wieder mehr Soldaten für Afghanistan lösen nicht das grundlegende Problem", betonte Brahms.
Das Bundeskabinett hatte am Tag zuvor den weiteren Einsatz deutscher Soldaten im Irak und die Verlängerung fünf weiterer Auslandsmissionen gebilligt. Dem Mandatsentwurf zufolge ändern sich die Aufgaben deutscher Soldaten im Einsatz der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak deutlich. Dort sollen künftig irakische Streitkräfte im ganzen Land ausgebildet und die Regierung in Bagdad beraten werden. In Afghanistan sollen mehr Soldaten eingesetzt werden.
"Zivile Instrumente wichtiger"
Brahms sagte, Verlängererung und Modifizierung hätten ausführlich im Bundestag diskutiert werden müssen. Die Sicherheitslage am Hindukusch habe sich eher verschlechtert. Die Unterstützung im Aufbau einer Polizei in Afghanistan sei sicher eine sinnvolle Sache, stelle aber nur einen Aspekt der notwendigen Entwicklung dar. "Viel wichtiger sind zivile Instrumente, die es zu unterstützen gilt und die vor allem mit den Menschen vor Ort entwickelt werden müssen", sagte Brahms.
Die bisherigen Einsätze hätten gezeigt, wie begrenzt Interventionen von außen seien. Der Friedensbeauftragte bekräftigte, grundsätzlich müsse das Augenmerk auf dem zivilen Staatsaufbau und der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung liegen. Darin stimmen Brahms und der evangelische Militärbischof Sigurd Rink überein.
Rink hatte in einem Gespräch mit dem epd die geplanten Ausweitungen der Auslandseinsätze der Bundeswehr begrüßt. Mit Blick auf Mali und Afghanistan sagte der Bischof, Ziel sei es, den Aufbau eines Staatswesens wieder zu ermöglichen: "Das kann die Bundeswehr leisten."
Er habe bei seinen Besuchen in den Einsatzgebieten den Eindruck gewonnen, dass die Soldatinnen und Soldaten auf allen Dienstebenen hinter den Einsätzen stünden. Kritik übten sie laut Rink vor allem an Problemen mit der Ausrüstung. "Diese Männer und Frauen riskieren im Auftrag des Bundestags als Volksvertretung unter widrigen Umständen ihr Leben. Da muss einfach alles funktionieren."
Friedensforscher: Waffenhandel weltweit zugelegt
Die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China stehen zusammen für 74 Prozent aller internationalen Rüstungslieferungen der vergangenen fünf Jahre.Stockholm (epd). Die Geschäfte globaler Rüstungshersteller gehen glänzend: So wuchs der weltweite Waffenhandel zwischen 2013 und 2017 um zehn Prozent im Vergleich zum Zeitraum von 2008 bis 2012, wie das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri am 12. März bekanntgab. Dies sei vor allem auf mehr Waffenlieferungen nach Asien und Ozeanien sowie in den Nahen Osten zurückzuführen.
Nach Jahren des Rückgangs wachse das globale Geschäft mit Rüstungsgütern seit 2003 wieder deutlich, erklärte Sipri. Die fünf größten Exporteure waren die USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China. Zusammen stehen diese für 74 Prozent aller internationalen Rüstungslieferungen der vergangenen fünf Jahre. Die wichtigsten Abnehmer waren Indien, Saudi-Arabien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und China.
In den Nahost-Staaten stiegen die Rüstungsimporte laut Sipri in den untersuchten Zeiträumen um 103 Prozent und machten einen Anteil von 32 Prozent aller globalen Waffeneinfuhren aus. "Die weit verbreiteten Konflikte im Nahen Osten sowie Sorgen über Menschenrechtsverletzungen haben in Westeuropa und den USA zu Debatten über Beschränkungen im Waffenhandel geführt", sagte Forscher Pieter Wezeman. Dennoch blieben die USA und europäische Staaten die Hauptexporteure für diese Region und hätten beispielsweise mehr als 98 Prozent aller von Saudi-Arabien importierten Waffen geliefert.
USA bleiben Export-Spitzenreiter
Mit einem Weltmarktanteil von 34 Prozent bleiben die USA Export-Spitzenreiter. So steigerten sie ihre Waffenexporte zwischen 2013 und 2017 im Vergleich zu den fünf Jahren davor um 25 Prozent und lieferten Rüstungsgüter in 98 Staaten.
Obwohl Russlands Rüstungslieferungen zwischen 2013 und 2017 im Vergleich zu den fünf Jahren davor laut den Sipri-Daten um 7,1 Prozent zurückgingen, liegt das Land mit einem Weltmarktanteil von 22 Prozent weiterhin auf Platz zwei. Frankreichs Ausfuhren wuchsen innerhalb dieses Zeitraums um 27 Prozent, damit belegt das Land Rang drei.
Deutschlands Waffenexporte brachen den Zahlen zufolge zwar im Schnitt um 14 Prozent ein. Dennoch liegt Deutschland, das seine Rüstungslieferungen in den Nahen Osten um 109 Prozent gesteigert habe, mit einem Weltmarktanteil von 5,8 Prozent auf dem vierten Platz. Dahinter folgt China, dessen Ausfuhren insgesamt um 38 Prozent wuchsen.
Indien erhöht Einfuhren um 24 Prozent
Als weltweit größter Waffenimporteur steigerte Indien seine Einfuhren um 24 Prozent. Dahinter folgt Saudi-Arabien, dessen Importe um satte 225 Prozent wuchsen. Drittgrößter Abnehmer war Ägypten, das innerhalb dieser Zeit ein Einfuhrplus von 215 Prozent verzeichnete.
"Die Spannungen zwischen Indien auf der einen sowie Pakistan und China auf der anderen Seite heizen Indiens Nachfrage nach größeren Waffensystemen an, die es selbst nicht herstellen kann", erklärte Sipri-Forscher Siemon Wezeman. China hingegen sei zunehmend in der Lage, seine eigenen Waffen zu produzieren und verstärke dadurch seine Beziehungen zu Pakistan, Bangladesch und Myanmar.
Wohlfahrtspflege: Rechte junger Flüchtlinge stärken
Düsseldorf (epd). Bei der Betreuung und Unterbringung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen gibt es nach Ansicht der Freien Wohlfahrtspflege NRW noch Nachholbedarf. Trotz der vollständigen Anerkennung der UN-Kinderrechtskonvention durch die Bundesrepublik im Jahr 2010 würden die Rechte von geflüchteten Kindern und Jugendlichen bislang "nicht hinreichend berücksichtigt", heißt es in einem Impulspapier zur weiteren Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, das am 8. März in Düsseldorf im Landtagsausschuss für Familie, Kinder und Jugend vorgestellt wurde.
Das Kindeswohl müsse in allen Bereichen als "Leitgedanke" verankert werden, hieß in dem Papier der Wohlfahrtspflege. Unter dieser Vorgabe müsse das Aufenthalts-, Asyl- und Leistungsrecht "auf den Prüfstand" gestellt werden. Flüchtlingskinder hätten "ein Recht auf einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung, Ausbildung und Beruf".
Viele Regelungen zu Kinderrechten lägen in der Zuständigkeit des Bundes, hieß es weiter. Aber auch auf Länderebene sowie in den Landkreisen und Kommunen bleibe vieles zu tun. Vor allem Jugendhilfeausschüsse der Kommunen und der Landschaftsverbände seien gefordert, das Bewusstsein für die Rechte von minderjährigen Flüchtlingen zu stärken.
Das von der Vorsitzenden des Ausschusses Familie, Jugend, Frauen der Freien Wohlfahrtspflege NRW, Helga Siemens-Weibring, vorgestellte Impulspapier fußt auf einem bereits 2014 von der Freien Wohlfahrtspflege vorgelegten Papier. Wegen zahlreicher Gesetzesänderungen im Ausländer- und Asylrecht wurde es nun überarbeitet und aktualisiert.
Rechte "Gruppe Freital" zu langen Haftstrafen verurteilt

epd-bild/Matthias Schumann
Dresden (epd). Das Oberlandesgericht Dresden hat am 7. März die rechtsextreme "Gruppe Freital" als terroristische Vereinigung verurteilt. Der Gruppenwille und der Zweck der Vereinigung, Sprengstoffanschläge zu verüben, ließen sich klar formulieren, die Gesinnung der Gruppe sei rechtsradikal, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Fresemann zur Begründung. Die Kammer verhängte für die insgesamt acht Angeklagten im Alter von 20 bis 40 Jahren Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren.
Die beiden Rädelsführer Patrick F. und Timo S. sollen demnach für neuneinhalb beziehungsweise zehn Jahre ins Gefängnis. Der jüngste Angeklagte, Justin S., wurde nach Jugendstrafrecht zu vier Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Sein Haftbefehl wurde aber aufgehoben. Er rechne damit, dass S. Strafe auf Bewährung ausgesetzt werde, sagte Fresemann. Über die Bewährung muss ein Jugendrichter entscheiden.
Geständnis
Justin S. hatte zu Prozessbeginn ein ausführliches Geständnis abgelegt und darin auch Mitangeklagte belastet. Seine Aussagen habe er unter einem "Bedrohungsszenario abgegeben", was nicht einfach gewesen sei, sagte Fresemann. Der 20-Jährige war im April 2016 verhaftet worden.
Die sieben Männer und eine Frau hätten als terroristische Vereinigung in festen Strukturen, organisiert und konspirativ gehandelt, sagte Fresemann in der Urteilsbegründung. Grund dafür sei ihre "asyl- und fremdenfeindliche Haltung" und bei einem Teil der Gruppe eine "ausgeprägte rechtsextremistische nationalsozialistische Gesinnung". Die Gruppe habe sich 2015 in kürzester Zeit, in nur drei Monaten, radikalisiert.
Sie habe sich für versuchten Mord beziehungsweise Beihilfe zum Mord, gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen sowie Sachbeschädigung zu verantworten. Anschlagsziele waren dem Gericht zufolge Flüchtlingsunterkünfte sowie politische Gegner in Freital und Dresden. Der einjährige Prozess hatte am 7. März 2017 begonnen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, die das Verfahren im April 2016 an sich zog, hatte auf fünf bis elf Jahre Freiheitsentzug plädiert.
Tötungsvorsatz
An der Urteilsverkündung nahmen auch Angehörige und Bekannte der Täter teil. Fast alle der 152 Plätze für Besucher und Journalisten waren belegt. Fresemann zufolge haben die acht Verurteilten vor ihren Taten im Berufsleben gestanden, zum Teil in Partnerschaften gelebt und waren sozial eingebunden. Bis auf einen hatte keiner der Verurteilten eine Vorstrafe. Gleichwohl hätten sie sich zu den Taten entschlossen, die "weder spontan noch jugendtypisch" seien, sagte der Richter.
Die Taten seien aus der Überzeugung ausgeführt worden, "man könne nicht mehr abwarten, man müsse handeln". Sie seien mit Tötungsvorsatz begangen worden, sagte Fresemann. In der mehrstündigen Urteilsbegründung zitierte der Richter auch aus Chats der Gruppe. Dort hieß es unter anderem: "Wichtig ist, dass der Nazi-Terror weitergeht".
Der Prozess fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft am Stadtrand statt. Zwei Verteidiger kündigten an, gegen das Urteil in Revision zu gehen. Michael Sturm, Verteidiger des Rädelsführers Timo S., sagte, der Tatbestand einer terroristischen Vereinigung sei nicht erfüllt. Durch "lokale Aktionen war die Bundesrepublik Deutschland nicht als Ganzes geschädigt". Zudem sei der vom Senat beschriebene Tötungsvorsatz "aus seiner Sicht falsch", sagte Sturm.
Die Opferberatung RAA Sachsen begrüßte das Urteil. "Das Gericht hat heute die Taten klar als rechten Terror benannt", erklärte Geschäftsführer Robert Kusche. Er setze darauf, "dass das Urteil entsprechende Signalwirkung entfaltet".
Anschläge auf Moscheen und türkische Einrichtungen
Berlin/Meschede (epd). Nach mehreren Anschlägen auf türkische Einrichtungen am vergangenen Wochenende tauscht sich die Berliner Polizei mit Ermittlungsbehörden anderer Bundesländer aus. Zwar gebe es bislang "keine konkreten Täterhinweise" für den Brandanschlag in der Bundeshauptstadt, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 12. März. Die Berliner Ermittler stünden jedoch im Austausch mit dem Bundeskriminalamt sowie den Landeskriminalämtern der übrigen von den Anschlägen betroffenen Bundesländer.
Am Wochenende hatte es bundesweit Anschläge auf drei Moscheen und eine weitere türkischen Einrichtung gegeben. So wurde in Berlin-Reinickendorf in der Nacht zum Sonntag ein Brandanschlag auf eine Moschee verübt. Fast zeitgleich wurde an ein Gebäude eines deutsch-türkischen Freundschaftsvereins im nordrhein-westfälischen Meschede ein Brandsatz geworfen. Etwa zur selben Zeit beschädigten Unbekannte die Scheiben eines Moschee-Gebäudes in Itzhoe in Schleswig-Holstein. Bereits am Freitag hatten Unbekannte Brandsätze in eine Moschee im baden-württembergischen Lauffen am Neckar bei Heilbronn geworfen.
Der Berliner Polizeisprecher sagte, anders als in sozialen Netzwerken spekuliert, liege der Berliner Polizei kein Bekennerschreiben vor. Eine politische Motivation des Brandanschlags auf die Berliner Moschee werde weiter geprüft.
Nach dem Brandanschlag auf das Moscheegebäude in Lauffen dokumentierte die "Heilbronner Stimme" am 12. März auf ihrer Internsetseite ein Video, das vier mutmaßlich junge Männer zeigt, die Brandsätze gegen ein Gebäude werfen. Dazu gebe es im Internet bislang unbestätigte Berichte, dass sich "Jugendliche mit Verbindung zur verbotenen (kurdischen) Organisation PKK zur Tat bekannt haben sollen", berichtete die Zeitung. Video und Hinweise sind auch der Polizei bekannt, die wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung ermittelt.
Die Kurdische Gemeinde Deutschlands verurteilte die Anschläge. "Wer auch immer hinter diesen Anschlägen und Gewaltaufforderungen steht, ob PKK-nahe Kreise oder der türkische Geheimdienst MIT, diese Form der menschenverachtenden Gewalt ist mit nichts zu rechtfertigen", sagte der Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Ali Ertan Toprak, am 12. März in Gießen. Er appellierte an "alle kurdischstämmigen Menschen", sich in Deutschland von niemandem gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung instrumentalisieren zu lassen.
Bayern verzichtet auf Klage gegen "Ehe für alle"

epd-bild / Stephan Wallocha
München (epd). Bayern wird nicht gegen die "Ehe für alle" klagen. Eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht habe nach Einschätzung zweier Gutachter keine Aussicht auf Erfolg. Daher habe sich die bayerische Staatsregierung mehrheitlich gegen diesen Schritt entschieden, teilte die Staatsregierung am 6. März mit.
Das Bundesland hatte zunächst angekündigt, das im vergangen Jahr vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts ("Ehe für alle") verfassungsrechtlich überprüfen zu lassen. Nun teilte die Staatsregierung mit, "gewichtige Gründe" sprächen für die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes und somit gegen eine Klageerhebung.
Leitbild traditionelle Ehe
Dennoch halte die Staatsregierung politisch am Leitbild der traditionellen Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau fest, heißt es im Kabinettsbericht. Sie sei weiter die Grundlage für Familien, in denen Kinder bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Gleichzeitig werde aber die Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften ausdrücklich abgelehnt.
Der Bundestag hatte am 30. Juni 2017 entschieden, dass schwule und lesbische Paare heiraten dürfen. Mit der "Ehe für alle" können gleichgeschlechtliche Paare, für die bislang nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft möglich war, auch gemeinsam Kinder adoptieren.
Jens Spahn will freien Sonntag verteidigen
Essen (epd). Der designierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will sich für den Schutz des freien Sonntags starkmachen. "Wir dürfen nicht alles ökonomisieren, bewerten und auswerten wollen, gerade die Familien nicht", sagte Spahn den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (10. März). Dazu gehöre auch der freie Sonntag. "Es ist ein existenzieller Wert, dass sich Kinder und Eltern umeinander kümmern können, Zeit füreinander haben."
Spahn ergänzte: "Je schneller sich die Welt dreht, desto größer wird das Bedürfnis der Menschen nach Verbundenheit, Zusammenhalt, Familie, Übersichtlichkeit." Es gehe darum, kulturelle Sicherheit zu erhalten: "Bräuche, Traditionen, der freie Sonntag". Der CDU-Politiker rief auch dazu auf, Tugenden wie Fleiß oder Pünktlichkeit stärker wertzuschätzen. Diese Werte seien gerade für viele junge Menschen immer wichtiger. "Und sie sorgen dafür, dass wir uns auf ein paar Grundlagen im Zusammenleben verlassen können", sagte Spahn.
Studie: Deutschtürken und Russlanddeutsche gehen seltener wählen
Duisburg, Köln (epd). Deutschtürken haben bei der Bundestagswahl einer Studie zufolge tendenziell linker und Russlanddeutsche tendenziell rechter gewählt als der Durchschnitt. Wie eine am 5. März veröffentlichte Studie der Universitäten Duisburg-Essen und Köln ergab, lag zudem die Wahlbeteiligung bei den beiden Migrantengruppen deutlich unter der allgemeinen Wahlbeteiligung: Während diese 76,2 Prozent betrug, gaben laut Studie nur 64 Prozent der Deutschtürken und 58 Prozent der Russlanddeutschen ihre Stimme ab.
Politikwissenschaftler der beiden Hochschulen haben nach eigenen Angaben erstmals auf Basis von Daten aus der Bundestagswahl 2017 knapp 500 Deutsche zu ihrem Wahlverhalten befragt, die selbst oder deren Eltern aus der Türkei oder Nachfolgestaaten der Sowjetunion eingewandert sind. Demnach wählten 35 Prozent der Deutschtürken die SPD und 16 Prozent die Linkspartei. Unter den Deutschen mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion entschieden sich der Studie zufolge 27 Prozent für CDU oder CSU, 21 Prozent für die Linkspartei und 15 Prozent für die AfD.
AfD und Russlanddeutsche
"In der Tat punktete die AfD bei den Russlanddeutschen stärker als bei den Wählern ohne Migrationshintergrund", sagte der Duisburger Politikwissenschaftler Achim Goerres. Im Bevölkerungsdurchschnitt war die AfD bei der Bundestagswahl auf 12,6 Prozent gekommen. Doch bei den Russlanddeutschen sei die Partei als dritte Kraft hinter der Union und den Linken weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die medial geschürt worden seien, betonte Goerres.
Von den türkeistämmigen Deutschen wählten der Studie zufolge zwölf Prozent die Partei "Allianz Deutscher Demokraten", die der AKP des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahesteht und nur in NRW antrat. Auf einer Skala von -5 bis +5 bewerteten die befragten Deutschtürken Erdogan im Schnitt mit -2,5. Etwa 66 Prozent sprachen sich gegen eine EU-Mitgliedschaft der Türkei aus.
"Klar gegen Erdogan"
"Die Deutschen türkischer Abstammung sind klar gegen Erdogan", fasste Goerres die Ergebnisse zusammen. "Wenn sie überhaupt am türkischen Referendum teilgenommen haben, stimmten sie deutlich dagegen." Laut der Umfrage hätten nur 21 Prozent der Türken mit doppelter Staatsbürgerschaft bei dem Referendum im April 2017 für die Reform gestimmt, die die Befugnisse von Präsident Erdogan ausweitete, hieß es. An dem Referendum im April 2017 hatte knapp die Hälfte der in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türken mit ausschließlich türkischer oder doppelter Staatsbürgerschaft teilgenommen. Mehr als 60 Prozent von ihnen stimmten für die Verfassungsänderung.
Bundespräsident Steinmeier besucht NRW
Düsseldorf (epd). Bundespräsident Fank-Walter Steinmeier hat am 12. März seinen Antrittbesuch in Nordrhein-Westfalen begonnen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) empfing Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Düsseldorf. Nordrhein-Westfalen sei wirtschaftliches Schlüsselland der Bundesrepublik, das Land des sozialen Zusammenhalts und des technologischen Fortschritts, erklärte Laschet. Entsprechend gestalte sich das zweitägige Besuchsprogramm, das nach Düsseldorf auch an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, nach Duisburg-Marxloh, zum Dortmunder Polizeipräsidium und in die sauerländische Stadt Altena führt.
Ursprünglich war Steinmeiers NRW-Reise bereits für November geplant gewesen. Nach den geplatzten Sondierungen für eine Jamaika-Koalition hatte Steinmeier aber abgesagt.
Zahl der Straftaten in NRW geht zurück
Düsseldorf (epd). Die Zahl der Straftaten in Nordrhein-Westfalen ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Wie NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am 7. März in Düsseldorf mitteilte, sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf rund 1,37 Millionen Delikte. "Das ist der stärkste Rückgang seit mehr als 30 Jahren", sagte er. Die Aufklärungsquote lag bei über 52 Prozent. Das bedeute einen Anstieg von 3,2 Prozent gegenüber 2016 und sei der beste Wert seit fast 60 Jahren. Bei den Daten wurden sowohl versuchte wie vollzogene Straftaten berücksichtigt.
"Nordrhein-Westfalen ist nachweislich sicherer geworden", erklärte der Minister. Besonders deutlich seien die Zahlen in den Bereichen Taschendiebstahl und Wohnungseinbruch zurückgegangen: Sie sanken um 19,1 beziehungsweise 25,7 Prozent. Dieser starke Rückgang sei auch der Tatsache zu verdanken, dass Wohnungseinbrüche von der Polizei mittlerweile stärker in den Blick genommen würden, sagte Landeskriminaldirektor Dieter Schürmann. Auch die Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge habe vermutlich dafür gesorgt, dass weniger kriminelle Banden aus Südosteuropa nach NRW kommen konnten.
Bedenklich sei allerdings, dass der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen überdurchschnittlich hoch war, erklärte Reul. Knapp ein Drittel (32 Prozent) der Tatverdächtigen hatte keinen deutschen Pass; der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung liege jedoch nur bei etwa zwölf Prozent, sagte er. Vor allem bei Delikten wie Wohnungseinbruch und Taschendiebstahl lag der Statistik zufolge die Zahl der ausländischen Tatverdächtigen überdurchschnittlich hoch - offenbar auch deshalb, weil bei diesen Straftaten viele Banden aus dem Ausland aktiv sind.
Der Anteil der Flüchtlinge und Asylsuchenden an den Straftaten ging dagegen deutlich zurück. Er lag im vergangenen Jahr bei 8,7 Prozent und sank damit gegenüber 2016 um etwa ein Sechstel. In der öffentlichen Diskussion um die Kriminalität von Ausländern und Flüchtlingen gehe es deshalb darum, besser zu differenzieren, betonte der Minister.
Im Bereich "Mord und Totschlag" lag die Zahl mit 373 Fällen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2016. Bei der Gewaltkriminalität gab es einen Rückgang um 4,2 Prozent auf knapp 46.700 Fälle.
Schwierig zu erfassen in der Statistik war den Angaben zufolge das Thema "Clan-Kriminalität", also die Straftaten von Großfamilien zumeist ausländischer Herkunft. Hierzu werde derzeit ein Lagebild vom Landeskriminalamt NRW erstellt, erklärte Reul. Damit sollten valide Zahlen zu den Straftaten ermittelt werden, die von diesen Personengruppen begangen werden, um auf dieser Basis Strategien zur Bekämpfung der Kriminalität zu entwickeln.
Die Polizeigewerkschaften in NRW begrüßten die Entwicklung. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Erich Rettinghaus, betonte zudem, dass die Polizei zur Bewältigung ihrer Aufgaben mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung brauche. "Wir benötigen mehr operative Kräfte, sowohl in zivil als auch in Uniform. Kriminalität muss wieder vor Ort bekämpft werden, wo sie passiert, und nicht nur verwaltet werden."
Positiv bewertete die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor allem den Rückgang der Delikte bei Einbrüchen und Taschendiebstählen. "Dass wir heute in NRW 20.000 Wohnungseinbrüche weniger haben als noch vor zwei Jahren, zeigt, dass die veränderte Einsatzstrategie der Polizei, die personelle Aufstockung der Ermittlungskommissariate und die Durchführung von Schwerpunktkontrollen bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen aufgegangen sind", sagte der GdP-Landesvorsitzende Arnold Plickert.
Bildung
Lehrerverband fordert Ende der "Mangelverwaltung" an Schulen

epd-bild / Dieter Sell
Düsseldorf (epd). Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat einen gravierenden Lehrermangel an den Schulen in Deutschland kritisiert. Die Politik müsse die "Mangelverwaltung" an den Schulen zügig beenden, forderte der Bundesvorsitzende des Lehrerverbandes, Udo Beckmann, am 9. März zum offiziellen Auftakt des Deutschen Schulleiterkongresses in Düsseldorf. Angesichts der aktuellen Bedingungen an den Schulen würden vor allem die Schulleiter "demoralisiert". Nach einer vom VBE präsentierten repräsentativen Untersuchung unter Schulleitern wird als größtes Problem der Lehrermangel angesehen.
Die Verhältnisse an den Schulen seien das Ergebnis davon, dass Schulen "kontinuierlich kaputtgespart" würden, kritisierte Beckmann. Die von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 2008 auf dem Dresdner Bildungsgipfel gegebene Zusage, dass zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Bildung investiert werden, sei "bis heute nicht eingelöst". Der Bundesvorsitzende warf der Politik vor, sie sei "auf dem besten Wege, die nächste Generation Schulleitung zu ruinieren".
Nach einer vom VBE beauftragten Untersuchung hätten viele Schulleiter unter 40 Jahren angegeben, dass sie ihren Job nur gelegentlich, selten oder nie zur eigenen Zufriedenheit erfüllen könnten, sagte Beckmann. Als größtes Problem an den Schulen nannten 57 Prozent der befragten Schulleiter den Lehrermangel, gefolgt von der schlechten Ausstattung der Schulen (28 Prozent) sowie Inklusion und Integration (25 Prozent). Für die Untersuchung zum Thema "Berufszufriedenheit von Schulleitungen" hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa bundesweit 1.200 Schulleiter befragt.
Der Lehrermangel setze vor allem den Grundschulen zu, erklärte Beckmann. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung würden dort bis 2020 rund 35.000 Lehrkräfte fehlen. Die Ausbildung von Seiteneinsteigern als Lehrkräfte sei nur eine "Notlösung", da laut der Studie etwa jeder dritte neue Seiteneinsteiger nicht ordentlich auf den Beruf vorbereitet werde. Beckmann forderte von den Ländern, mehr Studienplätze und bessere Ausbildungsbedingungen zu schaffen sowie die Lehrkräfte besser zu bezahlen.
In Nordrhein-Westfalen sind laut VBE-Studie die Probleme an den Schulen besonders eklatant. Im bevölkerungsreichsten Bundesland verwiesen 64 Prozent der Befragten auf den Lehrermangel als mit Abstand größtes Problem, das waren sieben Punkte mehr als im Bundesdurchschnitt. Der Anteil der unbesetzten Lehrerstellen lag mit 13 Prozent ebenfalls über dem Durchschnitt (zehn Prozent). Grund dafür waren zu wenig Bewerber. Um das Problem zu lösen, müssten vor allem die Gehälter von Grundschullehrern angehoben werden, sagte der VBE-Landesvorsitzende Stefan Behlau.
Zudem liege in NRW die Beschäftigung von Seitenansteigern an den Schulen mit 53 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt (37 Prozent), erklärte Behlau weiter. Hier müsse dringend dafür gesorgt werden, dass die Seiteneinsteiger besser ausgebildet und auf die Anforderungen des Unterrichts vorbereitet werden. Allein im vergangenen Jahr wurden in NRW rund 600 Seiteneinsteiger in den Schuldienst eingestellt.
Der siebte Deutsche Schulleiterkongress in Düsseldorf fand am 9. und 10. März statt. Erwartet wurden rund 2.500 Teilnehmer aus ganz Deutschland. In Vorträgen und Workshops ging es um Themen wie Digitalisierung, Inklusion oder Unterrichtsentwicklung.
Ende des Turbo-Abiturs: NRW beschließt Rückkehr zu G9
Das Turbo-Abitur soll in NRW zum Schuljahr 2019/20 abgeschafft werden. Einzelne Schulen dürfen auf eigenen Wunsch bei der achtjährigen Gymnasialzeit bleiben. Die Umstellung bringt enorme Kosten mit sich.Düsseldorf (epd). Der Weg zum Abitur wird in Nordrhein-Westfalen länger: Die gymnasiale Schulzeit umfasst ab dem Schuljahr 2019/2020 wieder neun Jahre. Den entsprechenden Gesetzentwurf beschloss die schwarz-gelbe Landesregierung auf einer Kabinettssitzung am 6. März in Düsseldorf. Der Landtag soll das Gesetz nach dem Willen von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) noch vor den Sommerferien verabschieden.
Die Umstellung soll dann zum übernächsten Schuljahr 2019/20 mit den Klassen 5 und 6 erfolgen. Einzelne Gymnasien können sich nach den Plänen der Landesregierung entscheiden, bei der bisherigen achtjährigen Gymnasialzeit (G8) zu bleiben. Schulministerin Gebauer rechnet aber damit, dass rund 90 Prozent der Gymnasien die Rückkehr zu G9 einleiten werden.
Mit dem Gesetz könne noch vor der Sommerpause "ein Schlussstrich unter die jahrelange, oft emotionale Debatte" um die Schulzeit an den Gymnasien gezogen werden, betonte die Ministerin. Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf biete eine gute Grundlage und sorge für Klarheit an den Schulen. Zugleich werde kein Gymnasium gezwungen, gegen den Willen der Beteiligten vor Ort zu G9 zurückzukehren, wenn dort G8 gut umgesetzt und breit akzeptiert sei, ergänzte Gebauer.
Mit der Rückkehr zu G9 kommen auf das Land hohe Kosten zu. So rechnet das Schulministerium mit einem Bedarf von zusätzlichen 2.200 Lehrerstellen. Dafür fallen allein pro Jahr 110 Millionen Euro an. Darüber hinaus brauchen die Schulen mehr Räume. Ein Gutachten soll den zu erwartenden Gesamtaufwand nun ermitteln, damit das Land einen Kostenausgleich mit den Städten und Gemeinden vereinbaren kann.
Die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Sigrid Beer, kritisierte, das Land schicke die Kommunen mit Blick auf die Kosten in die Warteschleife. "Was kostet und wer bezahlt das alles, woher kommen die zusätzlichen Räume? Diese Fragen werden auch bis zur Verabschiedung des Gesetzes im Sommer nicht geklärt sein", sagte sie. Auch der schulpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag, Jochen Ott, bezeichnete es als "nicht seriös" von CDU und FDP, ein Gesetz zu verabschieden, dessen Kosten noch nicht absehbar seien. "Die Kommunen werden sich damit nicht zufriedengeben", sagte Ott.
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) NRW begrüßte die Abschaffung von G8. Zugleich warnte der Lehrerverband vor künftigen Lücken beim Übergang von Schülern der Real-, Sekundar- und Hauptschulen auf die gymnasiale Oberstufe.
Die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf acht Jahre, das sogenannte Turbo-Abitur, war zum Schuljahr 2008/2009 von der damaligen schwarz-gelben Landesregierung unter Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) eingeführt und von allen Parteien im Landtag unterstützt worden. In der Schulpraxis hagelte es jedoch regelmäßig Kritik von Lehrern und Eltern. NRW ist nicht das erste Bundesland, das wieder zu G9 zurückkehrt. Zuletzt hatte sich Bayern für eine Abkehr von G8 entschieden.
Schulen dürfen bei G9-Rückkehr auch samstags unterrichten
Düsseldorf (epd). Bei der Rückkehr zu G9 an den Gymnasien in NRW wäre nach den Worten von Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) auch Samstagsunterricht denkbar. Das liege allerdings in der Zuständigkeit der jeweiligen Schulkonferenz und des Schulträgers, sagte Gebauer am 7. März in Düsseldorf. "Wenn es den Wunsch danach gibt, geht das." Derweil kritisieren Kommunen in Nordrhein-Westfalen, dass Schulen auf eigenen Wunsch weiterhin bei der achtjährigen Gymnasialzeit bleiben können.
Am 6. März hatte das Kabinett den Gesetzentwurf zur Neuregelung der Bildungsgänge am Gymnasium beschlossen, wonach die gymnasiale Schulzeit ab dem Schuljahr 2019/2020 grundsätzlich wieder neun Jahre beträgt. Auf Wunsch können einzelne Schulen aber bei G8 bleiben. Die neuen Kernlehrpläne werden nach Gebauers Worten derzeit erarbeitet.
Für die Klassen 5 bis 10 der neunjährigen Gymnasien sind den Angaben nach 188 Wochenstunden vorgesehen. Acht davon seien nicht verbindlich, sondern könnten von den Schulen nachmittags etwa für ihre jeweiligen Profile genutzt werden, sagte Gebauer. Für die Schülerinnen und Schüler an künftigen G9-Gymnasien bedeutet das eine Fünf-Tage-Woche mit jeweils 30 Schulstunden und einer zusätzlichen Pflichtstunde. Die Ministerin wies darauf hin, dass leistungsstarke Schüler individuell oder als Lerngruppe ein Jahr überspringen könnten, um schneller das Abitur zu machen.
Wieder eingeführt werden soll nach Gebauers Worten der Erwerb der Mittleren Reife. Zudem soll künftig eine Zentrale Prüfung am Ende der Sekundarstufe I über die Versetzung in die gymnasiale Oberstufe mitentscheiden. Die Prüfung soll in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch erfolgen. Gymnasien als gebundene Ganztagsschule sollen laut Schulministerin 20 Prozent mehr Lehrerstellen erhalten. Dabei könnten die einzelnen Gymnasien entscheiden, ob sie Ganztagsschule sein wollten, sagte die Ministerin.
Derweil hielt die Kritik an der Wahlfreiheit für Schulen bei der Rückkehr zu G9 an. Der Städte- und Gemeindebund NRW warnte am 8. März, der Streit um die Ausrichtung der Gymnasien drohe sich dadurch in die Kommunen zu verlagern. "Bayern hat vorgemacht, wie eine konsequente Rückkehr aussehen kann", sagte Hauptgeschäftsführer Bernd Jürgen Schneider. "Dort ist innerhalb des G9-Gymnasiums eine Überholspur für leistungsstarke Schüler eingerichtet."
Bereits im vergangenen Jahr hatte der Zusammenschluss kreisangehöriger Kommunen in einer gemeinsamen Stellungnahme mit acht weiteren Verbänden vor einer Wahlfreiheit für Schulen zwischen G8 und G9 gewarnt. In dem Schreiben verweisen die Unterzeichner, darunter neben Kommunalverbänden auch Lehrergewerkschaften und Elternorganisationen, auf die Notwendigkeit einer "befriedeten, einheitlichen Schullandschaft".
Dagegen hatte Gebauer am 7. März im WDR-Radio erklärt, sie sehe durch die Wahlfreiheit keine Gefahr der Unübersichtlichkeit. In Hessen seien über 90 Prozent der Gymnasien zu G9 zurückgekehrt, das zeichne sich auch in NRW ab.
AWO fordert langfristige Absicherung der Schulsozialarbeit
Düsseldorf (epd). Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in NRW fordert eine langfristige Absicherung der Schulsozialarbeit. Die finanziellen Mittel müssten entfristet und dynamisiert werden, sagte der Abteilungsleiter Jugendhilfe der AWO Niederrhein, Michael Maas, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Rande einer Tagung in Düsseldorf. "Schulsozialarbeit ist Beziehungsarbeit zu Schülern, Eltern und Lehrern. Das braucht Zeit und Vertrauen."
Zudem müssten Schulsozialarbeiter Netzwerkarbeit leisten und Kontakte zu außerschulischen Einrichtungen und Partnern etwa aus der Jugendhilfe aufbauen und pflegen, sagte Maas. Müsse ein Schulsozialarbeiter nach einer befristeten Vertragsdauer seine Stelle verlassen, sei eine verlässliche Beziehungspflege zu Institutionen schwierig. Zumal es angesichts des Fachkräftemangels in der sozialen Arbeit für eine Schule schwierig sein könne, einen geeigneten Nachfolger zu finden.
Hinzu komme, dass sich die Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen derzeit wie ein Flickenteppich ausmache, kritisierte Maas. Unterschiedliche Träger, rechtliche Zuständigkeiten und verschiedene Förderprogramme machten es einem Bereich schwer, der wie kein anderer Bereich der sozialen Arbeit in den vergangenen zehn bis 15 Jahren gewachsen sei. Maas forderte einheitliche Mindeststandards bezüglich Personalschlüssel, räumlicher Ausstattung und Qualifikation. Wünschenswert sei eine klare Verortung der gesamten Schulsozialarbeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz, sagte der Experte. "Die rechtlichen und finanziellen Regelungen hinken der Realität hinterher."
Derzeit gebe es nicht einmal belastbare Zahlen, wie viele Schulsozialarbeiter tatsächlich in NRW oder gar bundesweit im Einsatz seien, erklärte Maas. In Trägerschaft des Landes NRW seien etwa 4.400 Menschen auf rund 3.000 Stellen tätig. Hinzu kämen aber auch Schulsozialarbeiter, die direkt vom Schulträger, einer Kommune oder von einem freien Träger angestellt seien. In Trägerschaft der AWO sind in NRW den Angaben nach 200 Schulsozialarbeiter tätig.
Integrationsforscher: Stärken zugewanderter Schüler fördern
Düsseldorf (epd). Der Integrationsforscher Haci-Halil Uslucan fordert Lehrer auf, stärker auf die Potenziale von zugewanderten Schülern zu achten. Lehrer und Erzieher sollten bei Schülern mit Zuwanderungsgeschichte deren Fähigkeit "nicht nur daran messen, wie gut sie im Schnitt zu den anderen sind, sondern daran, welche Entwicklungen sie gemacht haben", sagte der Professor der Universität Duisburg-Essen am 10. März in Düsseldorf auf dem Deutschen Schulleiterkongress. Möglicherweise seien die Leistungen dieser Kinder und Jugendlichen nur schwach oder durchschnittlich. "Aber wer sich in nur einem oder zwei Jahren sprachlich verständigen kann, hat möglicherweise hohe kognitive Potenziale, die man entdecken und fördern sollte."
Vielfach würden kulturspezifische Begabungen und Talente von Migrantenkindern zu wenig berücksichtigt und gewürdigt, betonte Uslucan, der auch Leiter des Essener Zentrums für Türkeistudien und Integrationsforschung ist. So würden etwa bestimmte Formen der Musikalität oder Körperbeherrschung hierzulande noch zu wenig anerkannt. Gerade Flüchtlingskinder seien benachteiligt, weil sie aufgrund der Flucht oftmals ein oder mehrere Jahre lang keinen Schulunterricht hatten.
Uslucan wies darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland deutlich häufiger ein Schuljahr wiederholten als ihre deutschen Mitschüler. Die Wiederholerrate sei nicht selten doppelt oder viermal so hoch, erklärte der Integrationsforscher. Vielfach hätten diese Schüler in der Vergangenheit Erfahrungen der Hilflosigkeit gemacht, die sie dann irgendwann verinnerlicht hätten. "Das heißt, sie haben mehrere Versuche unternommen, sind gescheitert und haben dann Hilflosigkeit als misslingenden Bewältigungsstil erlernt", sagte Uslucan.
Mehr begabte Schüler aus NRW sollen Stipendien erhalten
Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen soll die Bildungsförderung von jungen Talenten verstärkt werden. Auch mehr Kinder aus Nichtakademikerfamilien sollen nach einer Kooperationsvereinbarung von Hochschulen und der Studienstiftung des deutschen Volkes die Chance auf ein Studium erhalten, wie das NRW-Kulturministerium mitteilte. Der Kooperationsertrag zwischen dem NRW-Zentrum für Talentförderung der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bottrop, Recklinghausen und der Studienstiftung sei am 9. März in Düsseldorf unterzeichnet worden. Gemeinsam wollen die Partner soziale Ungleichheiten in den Schulen abbauen und neue Zugangswege in die Förderung der Studienstiftung schaffen.
Durch die Kooperation würden gerade auch diejenigen begabten Schüler erreicht, die in der Vergangenheit eher selten den Weg in die Studienstiftung fanden, sagte der Parlamentarischer Staatssekretär im Kulturministerium, Klaus Kaiser. Talente müssten unabhängig von ihrer Herkunft bestmöglich gefördert werden. Deshalb unterstütze das Kulturministerium die Zusammenarbeit zwischen der Studienstiftung und dem NRW-Zentrum für Talentförderung.
Die Kooperation mit dem NRW-Talentzentrum sei für die Studienstiftung besonders wertvoll, weil über die Talentscouts auch Bewerber von Schulen die Stiftung erreichten, die bislang kaum von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch gemacht hätten, erklärte die Generalsekretärin der Studienstiftung des deutschen Volkes, Annette Julius.
Das Talentscouting begann 2011 an der Westfälischen Hochschule. Mit der Unterstützung des Landes NRW wurde das Modellprojekt auf das ganze Land ausgeweitet und das NRW-Zentrum für Talentförderung in Gelsenkirchen gegründet. Es unterstützt die Partnerhochschulen bei der Gestaltung und Umsetzung ihrer Programme und entwickelt Formate weiter, um Talente in Schule, Hochschule und Berufsausbildung besser zur Entfaltung zu bringen. Aktuell werden knapp 10.000 Schüler im NRW-Talentscouting betreut. Ende des Schuljahres 2018/19 sollen es knapp 15.000 sein. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft stellt dafür bis 2020 jährlich bis zu 6,4 Millionen Euro zur Verfügung.
Über 60 NRW-Talentscouts von 17 Fachhochschulen und Universitäten sind derzeit an mehr als 300 Schulen in Nordrhein-Westfalen unterwegs, um unentdeckte Talente individuell zu fördern. Für die Kooperationsschulen können nun Talentscouts Schüler für das Auswahlverfahren der Studienstiftung vorzuschlagen. Bislang lag das Vorschlagrecht ausschließlich bei den Schulen.
Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das älteste und größte Begabtenförderungswerk in Deutschland. Aktuell fördert die Stiftung nach eigenen Angaben rund 12.900 Studenten und etwa 1.100 Doktoranden. Die Auswahl und Förderung der Stipendiaten erfolgt unabhängig von politischen, weltanschaulichen und religiösen Vorgaben.
Universität Heidelberg schließt Vergleich mit Theologie-Studenten
Mannheim, Wuppertal (epd). Im Streit über die Anerkennung eines kirchlichen Fachschulabschlusses als Bachelor haben Universität Heidelberg und klagender Student einen Vergleich geschlossen. Auf Anregung der Richter des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) verpflichtete sich die Universität am 8. März in Mannheim dazu, den Studenten schnellstmöglich zum Masterstudium Evangelische Theologie zuzulassen. Dafür verzichtete der Kläger auf Schadensersatzansprüche gegen die Hochschule. Beide Parteien haben bis jetzt zum 29. März Zeit, den Vergleich zu widerrufen. (9 S 1074/17)
Geklagt hatte ein Student, der eine vierjährige biblisch-theologische Ausbildung an der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal absolviert hat. Seine Bewerbung für den weiterbildenden Masterstudiengang (M.A.) Evangelische Theologie zum Wintersemester 2014/2015 hatte die Universität Heidelberg abgelehnt, obwohl deren Zulassungsausschuss erklärt hatte, dass der erforderte Abschluss des grundständigen Studiengangs nachgewiesen worden sei.
Nach den Worten des Vorsitzenden Richters, Andreas Roth, habe sich der Student darauf verlassen können, nach dieser Zulassung auch das Studium beginnen zu können. Der Kläger hatte dafür seine Vollzeittätigkeit als Jugendreferent beim Evangelischen Gemeinschaftsverband Pfalz e.V. gekündigt. Habe die Hochschulverwaltung Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der Zulassung, müsse sie diese widerrufen, sagte Roth. Dies sei jedoch nicht rechtzeitig geschehen.
Mittlerweile hat der Student nach eigenen Angaben alle erforderlichen Prüfungsleistungen für den Masterstudiengang im ebenfalls angeboten Magisterstudium an der Universität Heidelberg erbracht. Lediglich die abschließende Masterarbeit stehe noch aus, für die er für im Masterstudiengang eingeschrieben sein muss.
Soziales
Union und SPD bleiben uneins beim Thema Abtreibungsrecht

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). In der neuen großen Koalition droht beim Thema Abtreibungsrecht bereits ein erster Streit. Hintergrund ist der Wunsch der SPD, das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche zu streichen. Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte nun das Nein ihrer Partei zur Abschaffung des Paragrafen 219a. In einem Schreiben an alle Funktions- und Mandatsträger der CDU, das dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, plädiert sie für ein offensives Eintreten zur Beibehaltung der bisherigen Regel, die Werbung für Abtreibungen verbietet. Aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde es keine Unterstützung zur Abschaffung der Regelung geben, betont Kramp-Karrenbauer in dem parteiinternen Schreiben.
Der Prozess gegen die Gießener Ärztin Kristina Hänel vor knapp vier Monaten hatte eine Debatte über das Werbeverbot ausgelöst. Hänel hatte auf der Internetseite ihrer Praxis über Abtreibungen informiert und war dafür zu einer Geldstrafe verurteilt worden. SPD, Linke und Grüne sind der Überzeugung, dass das Werbeverbot auch Informationen für schwangere Frauen verhindert. Sie wollen den Paragrafen daher streichen. Union und AfD sind dagegen. Die FDP wirbt für einen Kompromiss.
"Befremdlich"
Bei einer ersten Beratung im Bundestag hatte die SPD aus Rücksicht auf die geplante Koalition ihren eigenen Entwurf zur Abschaffung des Werbeverbots nicht eingebracht. Eine Woche später teilte die SPD-Politikerin Eva Högl dann mit, das nun doch tun zu wollen. Als "bedauerlich" und befremdlich" bezeichnet die CDU in einem an Kramp-Karrenbauers Schreiben angehängten Papier das Vorgehen der SPD.
Darin heißt es, dass in den verpflichtenden Beratungen zum Schwangerschaftsabbruch darüber informiert werde, wo der Eingriff vorgenommen werden kann. Von Informationsdefizit könne daher keine Rede sein. Schwangerschaftsabbrüche seien keine normale medizinische Dienstleistung. "Wenn auf der Homepage eines Arztes der Schwangerschaftsabbruch neben normalen medizinischen Dienstleistungen auftaucht, dann ist dies keine reine Information, sondern geht darüber hinaus", heißt es in dem CDU-Papier.
Zustimmung von EKD
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) teilt die Auffassung Kramp-Karrenbauers. Der Rat der EKD halte die Streichung des Paragrafen 219a für "entbehrlich, sogar für kontraproduktiv", sagte der EKD-Bevollmächtigte in Berlin, Martin Dutzmann, dem epd. "Eine Streichung würde das Gesamtkonstrukt der Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch gefährden, das in den vergangenen Jahrzehnten in der Frage von Abtreibung für gesellschaftlichen Frieden gesorgt hat", erklärte er. Dort bleibe klar, dass Abtreibung rechtswidrig sei. Andererseits würden Ausnahmen definiert, in denen Schwangerschaftsabbrüche straffrei bleiben. "An dieser ausgewogenen Konstruktion sollte nicht gerüttelt werden", sagte Dutzmann.
Eine Möglichkeit zum Kompromiss sieht er in den derzeitigen Plänen des Landes Berlin. Die Gesundheitsverwaltung soll dort eine vollständige Liste aller Praxen und Kliniken veröffentlichen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. "Für Information wäre dann verlässlich vonseiten des Landes gesorgt, ohne dass für einen Abbruch geworben würde", sagte Dutzmann. Es lohne sicher, zu überlegen, ob nicht alle Bundesländer, die ja ohnehin die Strukturen für Schwangerschaftskonfliktberatung bereitstellen müssten, solche Register veröffentlichen sollten. "Es gäbe dann für Ärzte keine Notwendigkeit mehr, die Bereitschaft zur Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen selbst zu veröffentlichen und somit in dieser Frage eine höhere Rechtssicherheit", sagte Dutzmann.
Sozialverbände: Tafel-Debatte zeigt politisches Versagen

epd-bild/Thomas Berend
Berlin (epd). Vor dem Hintergrund der Debatte um die Essener Tafel macht ein Bündnis aus Sozialverbänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen die Politik für drohende neue Verteilungskämpfe verantwortlich. "Dass Menschen, egal welcher Herkunft, überhaupt die Leistungen der Tafeln in Anspruch nehmen müssen, ist Ausdruck politischen Versagens in diesem reichen Land", heißt es in einer am 6. März in Berlin vorgestellten Erklärung des Bündnisses, dem unter anderen der Paritätische Wohlfahrtsverband, der Bundesverband der Tafeln, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Arbeiterwohlfahrt angehören.
Die Essener Tafel hatte mit ihrem Beschluss, keine Ausländer mehr anzunehmen, für Schlagzeilen gesorgt und eine Debatte über soziale Leistungen für Deutsche und Migranten ausgelöst. Für Kritik sorgt das auch beim Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider. Die Entscheidung sei ganz objektiv eine ethnische Diskriminierung und müsse korrigiert werden, sagte er.
"Verteilungskämpfe"
Das Bündnis aus insgesamt mehr als 30 Organisationen warnte zugleich, arme Menschen dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es sei ein Skandal, dass die politisch Verantwortlichen das seit Jahren bestehende Armutsproblem verharmlosten. "Damit drohen neue Verteilungskämpfe", heißt es in der Erklärung.
Die Sprecherin der Nationalen Armutskonferenz, Barbara Eschen, sagte, nicht die Flüchtlinge hätten Probleme verursacht, sondern eine verfehlte Sozialpolitik sei dafür verantwortlich. "Die Menschen werden schon seit Jahren zu den Tafeln getrieben", sagte die Direktorin des Diakonischen Werks Berlin-Brandenburg. Die Tafeln seien bereits vor der Fluchtbewegung zu "Ausputzern" geworden. Flüchtlinge würden zu Sündenböcken gemacht für Missstände, die es bereits ohne sie gegeben habe, sagte der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, dessen Organisation auch Teil des Bündnisses ist.
Die Organisationen erneuern in ihrer Erklärung die Forderung nach einer Erhöhung der Regelsätze in der Altersgrundsicherung, für Hartz-IV-Empfänger und der Leistungen für Asylbewerber, die unter denen der Sozialhilfe liegen. "Die Sicherung des Existenzminimums ist Aufgabe des Sozialstaates und nicht privater Initiativen und ehrenamtlichen Engagements", sagte Schneider.
"Staat zuständig"
Der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtverbandes rechnete vor, im Hartz-IV-Regelsatz seien für einen Single pro Tag 4,77 Euro für Ernährung vorgesehen, für größere Kinder 3,93 Euro und für Kinder im Vorschulalter 2,77 Euro. Damit seien die Tafel kein Zusatz mehr, sondern stellten das Existenzminimum sicher. Dafür sei aber der Staat zuständig.
Schneider kritisierte, der Koalitionsvertrag greife das Thema Armut nicht genügend auf. Über Hartz-IV-Regelsätze sei kein Wort darin zu lesen. Das Bündnis werde hier weiter "Druck aufbauen", kündigte er an.
Essener Tafel will Aufnahmestopp für Ausländer bald aufheben
Essen (epd). Die Essener Tafel will ihren Aufnahmestopp für Ausländer als Neukunden bald aufheben. "Die jetzige Praxis wird in circa zwei bis drei Wochen wieder beendet", schrieb der Essener Sozialdezernent Peter Renzel am 11. März auf Facebook. Der Vorstand der Tafel habe berichtet, dass das Ziel der vorübergehenden Maßnahme "schon fast erreicht ist".
Wie die Stadt Essen am 11. März nach einem Treffen des Runden Tisches zur Situation an der Tafel mitteilte, würden bei möglichen künftigen Engpässen bevorzugt Alleinerziehende, Familien mit minderjährigen Kindern und Senioren als Neukunden aufgenommen, unabhängig von ihrer Herkunft. Künftig sollen zudem auch über 50-Jährige Essener, die Arbeitslosengeld oder Sozialleistungen beziehen, zur Kernzielgruppe der Tafel gehören.
An dem Runden Tisch nahmen den Angaben nach neben Vertretern der Stadt und der Tafel auch die Essener Wohlfahrtsverbände und Migrantenselbstorganisationen teil. Sie hätten sich auf weitere Kooperationen verständigt, um über das Angebot der Tafel aufzuklären, erklärte die Stadt. So sollen Informationen in unterschiedliche Sprachen übersetzt und etwa im Rahmen der Integrationskonferenzen der Stadt Essen verteilt werden. Der Verbund der Essener Migrantenselbstorganisationen habe sich ausdrücklich für die Arbeit der Essener Tafel bedankt, hieß es. Der Verband habe angeboten, über die Arbeit der Tafel zu informieren und die eigenen Mitglieder zu mobilisieren, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Die Essener Tafel hatte mit ihrer Entscheidung, vorerst keine Ausländer mehr als Neukunden aufzunehmen, viel Kritik, aber auch Verständnis geerntet.
Laschet: Andrang bei Tafeln kein Zeichen für steigende Armut

epd-bild / Rolf Zöllner
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht im Andrang bei den Tafeln "kein Zeichen für eine steigende Armut" im Lande. Zugleich räumte er am 9. März in Düsseldorf ein, dass die ehrenamtlichen Tafeln stärker genutzt würden als noch vor ein paar Jahren. "Das ermöglicht vielen Menschen ein Leben über dem Existenzminimum hinaus", erklärte der Ministerpräsident. Viele Rentner etwa könnten sich durch den Besuch der Tafeln und das so eingesparte Geld für Lebensmittel "noch etwas anderes leisten".
Laschet wies in der Debatte um den Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel darauf hin, dass es "keinen Rechtsanspruch gibt, dort etwas zu bekommen". Das habe man vielleicht in der Vergangenheit nicht deutlich genug gemacht, gerade für Flüchtlinge, sagte der Christdemokrat. Der finanziell festgelegte Satz, den ein junger Flüchtling in Deutschland für Essen erhält, ist seiner Ansicht nach "in hohem Maße ausreichend". Er plädierte dafür, dass die Tafeln "die Gruppen definieren, die Hilfe bekommen".
Die Essener Tafel hatte mit ihrem Beschluss, vorerst keine Ausländer mehr als Neukunden aufzunehmen, für Schlagzeilen gesorgt und eine Debatte über soziale Leistungen für Deutsche und Migranten ausgelöst. Der Tafelvorstand begründete seine Entscheidung damit, dass der Anteil der Migranten unter den Kunden auf 75 Prozent gestiegen sei. Ältere Menschen und Alleinerziehende würden dadurch verdrängt.
Modellrechnung: Kommunen mit 82 Milliarden Euro verschuldet
Düsseldorf (epd). Die Schulden der Kommunen in NRW sind laut einer Modellrechnung des Statistischen Landesamtes deutlich höher, wenn man auch die Außenstände der ausgegliederten Betriebe berücksichtigt. So wiesen die Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen auf der Basis einer solchen Berechnung zum Abschluss des Jahres 2016 Schulden in Höhe von 82 Milliarden Euro auf, wie das Landesamt am 8. März in Düsseldorf mitteilte. Das entsprach einer durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von fast 4.600 Euro je Einwohner.
Berücksichtigt man allerdings nur die Schulden in den Kernhaushalten der Kommunen, so belief sich die Summe für Ende 2016 auf 63,3 Milliarden Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei rund 3.500 Euro.
Laut den Statistikern haben die Kommunen in NRW in den vergangenen Jahren zahlreiche Aufgaben aus den Kernhaushalten in öffentlich bestimmte Fonds, Einrichtungen und Unternehmen verlagert. "Öffentlich bestimmt" bedeutet, dass die öffentliche Hand die Mehrheit der Anteile an den Einrichtungen hält.
Die Modellrechnung wurde laut einem Sprecher von IT.NRW erstmals durchgeführt. Sie ermögliche einen besseren interkommunalen Vergleich, weil sie auch die Schulden der ausgegliederten Aufgabenbereiche der Kommunen berücksichtige. Ende 2016 habe bereits etwa jeder dritte geschuldete Euro der Kommunen einen dieser Eigenbetriebe betroffen.
Drahtkunst mit Herz: Kunstprojekt für Obdachlose

epd-bild/Hans-Jürgen Bauer
Düsseldorf (epd). Man könnte eine Stecknadel fallen hören in der Werkstatt von Wagenbaukünstler Jacques Tilly in Düsseldorf. In höchster Konzentration legen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seines Workshops das in Knochenleim getränkte weiße Blumenpapier auf die Drahtskelette, die schon am nächsten Tag als bunt bemalte Skulpturen fertiggestellt werden sollen. Die acht Teilnehmer sind ganz in ihre Arbeit versunken. Der erste Figurenbau-Workshop für Wohnungslose bei Deutschlands prominentesten Karnevalswagenbauer dauert vier Tage, sechs Stunden täglich.
Es ist ein langer Weg von der Idee zur Skizze, über die Drahtfigur und das Kaschieren, bei dem der Maschendraht der Skulptur mit Papier oder Stoff verkleidet wird, bis hin zum Bemalen mit Acrylfarben und Fertigstellen. Auch Frustration und Misserfolge, Anstrengung und Erschöpfung gehören dazu. "Für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das eine große Herausforderung, eine so lange Zeit konstant an einem Thema zu arbeiten", erklärt Georg Schmidt, Projektleiter der Diakonie Düsseldorf.
Aber an Tag drei des Workshops ist von Frustration oder Erschöpfung nichts zu spüren: In gespannter Aufmerksamkeit lauschen die wohnungslosen Teilnehmer Tilly, als er die Technik erklärt, und gehen dann an die Arbeit, die Hände voll weißem Leim. Magda macht ein Selbstporträt - sie sagt, sie sei ein nachdenklicher Mensch. Auch die kleine, kaum wahrnehmbare Warze an ihrem linken Kinn soll auf der Skulptur mit dem riesigen Frauen-Torso verewigt werden.
Nebenan müht sich Helga an ihrer lebensgroßen Blüte ab. "Ich habe ein paar Probleme, aber es geht", sagt sie stolz. Gestern hätte sie die Arbeit richtig in den Knochen gespürt. Konzentriert legt sie Streifen für Streifen des glitschigen Papiers auf die Blütenblätter. Eine Blüte aus Maschendraht zu formen, war für Helga schon ein Gemeinschaftswerk - ihre Mitstreiter haben dabei geholfen. Zum Dank hat sie ihr vorher gefertigtes Herz aus Draht weiterverschenkt.
Auch Peter hat sich viel vorgenommen mit der Skulptur eines lachenden Mädchens mit riesigen Schleifen im Haar. Geschickt kaschiert er die Figur. Die gesunde rechte und die irgendwann schwer verletzte linke Hand arbeiten harmonisch zusammen.
"Wir arbeiten zusammen und wir essen zusammen", erzählt Jacques Tilly, der sonst etwa die Figuren für den Düsseldorfer Rosenmontagszug gestaltet. Dass er bei dem Projekt für Wohnungslose mitmacht, war für ihn keine Frage. "Das ist einfach sinnhaft und eine gute Sache", sagt er schlicht.
Der Workshop begann mit einem Herz, das jeder als erste Figur gedrahtet hat. Ums Herz geht es überhaupt in dem Projekt: zusammen sein, etwas Produktives schaffen, auf das man stolz sein kann. "Die Idee ist, dass die Skulpturen bei der Auktion in der Fiftyfifty-Galerie in Düsseldorf im September ausgestellt und versteigert werden können", sagt Projektleiter Schmidt. Jeder Teilnehmer entscheidet aber selbst, was er damit machen möchte.
Möglich wurde das Projekt durch eine Spende der Düsseldorfer Vendus Gruppe, einem Beratungsunternehmen im Gesundheitsmarkt. "Jeder kann in die Situation hineinrutschen, wohnungslos oder obdachlos zu werden", begründet Geschäftsführer Guido Mecklenbeck das Engagement. "Nach dem Motto, lieber soziale Zwecke unterstützen, als Geld für Weihnachtsgeschenke auszugeben, möchten wir für Menschen auf der Straße Chancen schaffen, um durch solche Projekte aus dem Tal herauszukommen und das Leben anders gestalten zu können." Der Kreativ-Workshop schenkt den betroffenen Menschen vor allem neues Selbstvertrauen, etwas schaffen und durchhalten zu können.
Wenn an Tag vier des Workshops die Skulpturen fertig sind, gibt es nur noch ein Problem: Wo können die teilweise lebensgroßen Figuren bis zur Versteigerung im September untergebracht werden? Wer Lagermöglichkeiten hat, kann sich bei der Diakonie Düsseldorf melden.
Sozialer Wohnungsbau im Sinkflug

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Die künftige große Koalition von Union und SPD will mit zwei Milliarden Euro ab 2020 den sozialen Wohnungsbau ankurbeln. Doch ob Geld allein hilft, die Misere beim Bau von Mietwohnungen mit Preisbindung rasch zu beenden, bezweifeln viele Experten. Fehlendes Bauland, lange Genehmigungsverfahren, hohe Baustandards und nicht selten Proteste von Anwohnern gegen Neubauten gelten als hohe Hürden.
Derzeit gibt es nach Angaben des Deutschen Mieterbundes rund 1,2 Millionen Sozialwohnungen. Ende der 80er Jahre waren es noch etwa vier Millionen. Dann kam die Föderalismusreform 2006. Der Bund übergab seine Verantwortung für die soziale Wohnraumförderung samt der Gesetzgebung dazu vollständig in die Zuständigkeit der Bundesländer. Er strich seine Finanzhilfen, hilft aber seither mit sogenannten "Kompensationshilfen". In diesem Jahr gibt die Regierung 1,5 Milliarden, 2019 eine Milliarde Euro.
"Hausgemachtes Problem"
Für den Wohnungsbau blieb diese Reform nicht ohne Folgen, wie die Bundesregierung im März 2017 auf eine Anfrage der Linksfraktion einräumte: "Seit der Föderalismusreform I sanken in den folgenden Jahren die Neubauzahlen deutlich. Im Jahr 2009 wurden nur noch knapp 160.000 Wohnungen gebaut. Der Anteil des geförderten Wohnungsneubaus an den fertiggestellten Wohnungen sank von 15 Prozent im Jahr 2009 auf rund sechs Prozent jeweils in den Jahren 2013 und 2014."
Für den Deutschen Mieterbund ist das ein hausgemachtes Problem. Geschäftsführer Ulrich Ropertz sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Eine konkrete gesetzliche Verpflichtung für die Länder, die Gelder des Bundes für den Bau von Sozialmietwohnungen einzusetzen, gibt es nicht." Die Folge: Eine Reihe von Ländern habe die Gelder für die Wohneigentumsförderung, Modernisierungen von Bauten oder Infrastrukturmaßnahmen verwendet.
Zeitliche Befristung
Grund für die sinkende Zahl an mietpreisgebundenen Wohnungen sind aber nicht nur fehlende Neubauten. Der Mieterbund verweist darauf, dass Sozialwohnungen, die mit öffentlichen Geldern oder Zinsverbilligungen gefördert wurden, stets nur zeitlich befristet einer Belegungs- oder Mietenbindung unterliegen. Je nach Förderbedingungen des Landes kann das 15 bis 35 Jahre gelten. Ropertz: "Systembedingt fallen jedes Jahr Zigtausend Wohnungen aus den Bindungen mit der Folge, dass ehemalige Sozialwohnungen wie frei finanzierte Wohnungen am Wohnungsmarkt behandelt werden." Aktuell gilt das pro Jahr für bis zu 60.000 Wohnungen.
Um dieses Abschmelzen der Sozialwohnungsbestände zu verhindern, müsste der Neubau von Sozialwohnungen auf ein weit höheres Niveau gehoben werden. 2016 wurden nur knapp 25.000 neue Sozialwohnungen errichtet.
Vor diesem Hintergrund nimmt Ropertz die Länder in die Pflicht: Sie sollten nicht nur die Kompensationszahlungen des Bundes für die soziale Wohnraumförderung verwenden, sondern gleichzeitig Finanzmittel mindestens in der gleichen Höhe zur Verfügung stellen: "Auch das ist in der Vergangenheit vielfach nicht passiert."
350.000 Wohnungen jährlich
Auf die Frage der Linksfraktion, wie viele neue Wohnungen bundesweit überhaupt gebraucht werden, erklärte die Bundesregierung, der genaue Bedarf könne nur von den Ländern eingeschätzt werden. Doch die Einschätzung des Eduard Pestel Instituts für Systemforschung vom August 2012, dass derzeit in Deutschland vier Millionen Sozialwohnungen fehlen, teilt die Regierung ausdrücklich nicht: Die Forscher gingen davon aus, "dass grundsätzlich alle einkommensschwachen Haushalte Sozialwohnungen benötigen. Dies ist nicht zutreffend."
Laut Bundesbauministerium besteht kurz- und mittelfristig ein jährlicher Neubaubedarf von mindestens 350.000 Wohnungen pro Jahr. Die Länder seien mittels finanzieller Hilfe des Bundes in der Lage, "für die Jahre 2017 und 2018 den Bau von schätzungsweise 45.000 neuen Sozialwohnungen jährlich zu ermöglichen". Doch selbst wenn diese Zahl erreicht würde, blieben die Engpässe bestehen. Die Bauwirtschaft hat in einer aktuellen Studie nachgewiesen, dass es jährlich mindestens 80.000 neue Sozialwohnungen sein müssten.
Diakoniepräsident: Situation in der Pflege ist dramatisch

epd-bild/Rolf Zöllner
Eichstätt (epd). Der Präsident des Bundesverbandes der Diakonie, Ulrich Lilie, sieht den "gravierenden Personalmangel" in der Kranken- und Altenpflege als Gefahr für die Fachkräfte und die Pflegebedürftigen. Es fehlten Zigtausende Pflegekräfte, sagte er am 5. März auf einer Fachtagung zum Leistungsdruck in der Sozialbranche in Eichstätt. Vor diesem Hintergrund sei die Ankündigung der künftigen Bundesregierung, 8.000 zusätzliche Pflegestellen schaffen zu wollen, nicht mehr als "ein Tropfen auf dem heißen Stein".
Die Personalnot bekommen die Beschäftigten nahezu täglich zu spüren, sagte der Chef des evangelischen Wohlfahrtsverbandes: Dienstpläne würden ständig umgeworfen, freie Tage könnten oft nicht genommen werden. "Ein eigentlich schöner Beruf verliert auf diese Weise an Attraktivität", sagte Lilie.
Burnout
Die Folgen seien dramatisch: In den Burnout-Statistiken stünden Pflegekräfte "ganz oben". In Studien werde aber auch ein "Cool-out" beschrieben - "ein Prozess der moralischen Desensibilisierung". Manche Pflegekräfte entwickelten einen unterkühlten Umgang mit Patienten und Pflegebedürftigen.
Die Beschäftigten reagierten auf ihre Überforderung und Überbeanspruchung mit Kündigungen. "Jede fünfte Pflegekraft steigt irgendwann aus dem Beruf aus", sagte Lilie. Auch gebe es besonders häufig den Versuch, durch einen Arbeitgeberwechsel die persönliche Situation zu verbessern. "Angesichts dieser Arbeitssituation darf sich niemand auf dem politischen Parkett an diesem Thema vorbeimogeln" erklärte der Diakoniepräsident.
Lilie sieht aber nicht nur die Politiker in der Pflicht, sondern auch die kirchlichen Einrichtungen. Klar sei, dass die Defizite nicht allein durch technische oder organisatorische Maßnahmen in den Betrieben aufgefangen werden könnten. Der Theologe und Verbandschef forderte, trotz der widrigen Umstände sollten in evangelischen Einrichtungen die "Menschlichkeit und das christliche Profil im Vordergrund stehen".
Pflegende Angehörige nutzen Darlehen kaum
Rund 1,4 Millionen Pflegebedürftige werden von Familienmitgliedern betreut. Weil viele Angehörige dadurch beruflich kürzertreten müssen, gibt es seit 2015 zinslose Darlehen vom Bund. Genutzt wird das Angebot aber kaum.Düsseldorf, Berlin (epd). Pflegende Angehörige rufen die zinslosen Darlehen des Bundes für die Finanzierung der Familienpflegezeit kaum ab. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit nur 181 neue Darlehen bewilligt, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Im Haushaltsjahr 2017 seien insgesamt rund 756.000 Euro für 311 laufende Darlehensverträge ausgegeben worden. Nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post", die zuerst über die Zahlen berichtet hatte, waren im Haushalt aber 8,1 Millionen Euro veranschlagt.
Nach Angaben des statistischen Bundesamts werden etwa 1,4 Millionen Pflegebedürftige von ihren Angehörigen versorgt. Pflegende Familienmitglieder haben einen Rechtsanspruch auf eine zehntägige Auszeit, in der die Pflegeversicherung ein Unterstützungsgeld zahlt, sowie eine bis zu sechsmonatige Freistellung von der Arbeit. Seit 2015 können sie zur Finanzierung dieser Pflegezeit ein zinsloses Darlehen beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragen.
"Die große Koalition muss sich eingestehen, dass dieses Pflege-Darlehen keine Wirkung entfaltet", sagte die Haushaltsexpertin der Grünen, Ekin Deligöz, der "Rheinischen Post". "Man wollte gezielt Pflegenden helfen, hat sich aber für eine Spar-Variante entschieden, die gefloppt ist." Sie sprach sich stattdessen für die Einführung einer dreimonatigen Pflegzeit mit Lohnersatz aus.
Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte die Zahlen zu den bewilligten Darlehen als "Desaster". Stiftungsvorstand Eugen Brysch sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), pflegende Angehörige erlebten eine "staatliche Wüste". Zudem stiegen die Kosten der Pflegeheimbewohner. "Gefordert sind jetzt Realismus und ein Hundert-Tage-Sofortprogramm für die Pflege", forderte Brysch.
Studie: Bundesbürger sehen ältere Gesellschaft skeptisch

epd-bild/Jürgen Blume
Gütersloh (epd). Die Mehrheit der Bundesbürger sieht in einer älter werdenden Gesellschaft eher Risiken als Chancen. Auslöser für die zunehmende Skepsis seien vor allem Sorgen um den Wohlstand und die Lebensqualität zum Lebensabend, erklärte die Bertelsmann Stiftung am 7. März in Gütersloh bei der Vorstellung einer neuen Studie. Zugleich nimmt die Bereitschaft zu, länger als gesetzlich nötig zu arbeiten. Bei geringeren Einkommen würden die Beschäftigten das jedoch eher als finanzielle Notwendigkeit denn als sinnstiftende Chance sehen.
Mehr als jeder zweite Befragte (65 Prozent) sah im vergangenen Jahr im demografischen Wandel ein Risiko. Im Jahr 2014 waren es noch 55 Prozent gewesen. Besorgt seien die meisten vor allem über Altersarmut (83 Prozent), einen späteren Renteneintritt (80 Prozent) und steigende Rentenbeiträge (77 Prozent), heißt es in der Studie. Weniger als jeder Zehnte (acht Prozent) sieht im demografischen Wandel Chancen für Deutschland.
Zugleich sind der Studie zufolge immer mehr Menschen bereit, im Alter länger als gesetzlich nötig zu arbeiten. Lediglich jeder vierte (25 Prozent) Erwerbstätige gab an, früher als gesetzlich vorgesehen in den Ruhestand gehen zu wollen. Im Jahr 2002 waren es mit 52 Prozent mehr als doppelt so viele. Aktuell wollten zwölf Prozent der berufstätigen Bundesbürger über die gesetzliche Ruhestandsgrenze hinaus arbeiten.
Die Beweggründe dafür seien jedoch je nach Situation der Beschäftigten unterschiedlich. Bei einem höheren Qualifikationsniveau und Einkommen spielten "Freude an der Arbeit" und "Kontakt mit Menschen" eine Rolle. Je niedriger das Einkommen, desto eher sähen die Befragten längeres Arbeiten als finanzielle Notwendigkeit.
Die Umfrage zeige deutlich, dass die Bürger den demografischen Wandel als einschneidenden Trend wahrnehmen, von dem sie starke Folgen für die Zukunft Deutschlands erwarteten, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung, Aart De Geus. Die Folgen würden jedoch von den meisten negativ eingeschätzt.
Die Autoren der Studie mahnten flexible Regelungen für den Übergang in den Ruhestand an, die den unterschiedlichen Lagen der Beschäftigten gerecht werden. Starre Regelungen seien hier fehl am Platz, erklärte Studienleiter André Schleiter. Wer ohnehin schon in prekären Jobs arbeite, wenig verdiene oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten könne, werde durch pauschale Rentenregelungen noch weiter abgehängt, warnte der Studienleiter. "Notwendige Reformen als Antwort auf den demografischen Wandel müssen die sozialen Folgen sorgfältig im Blick behalten."
Für die Studie "Wahrnehmungen und Einschätzung der deutschen Bevölkerung zum demografischen Wandel" der Bertelsmann Stiftung befragte das Institut für Demoskopie Allensbach 1.454 Bundesbürger ab 16 Jahren. Die Erhebung wurde im Oktober 2017 durchgeführt.
Anhaltende Benachteiligung von Frauen kritisiert
Düsseldorf (epd). Zum Weltfrauentag am 8. März fordern Vertreterinnen von Arbeitsagentur und Gewerkschaftsbund in Nordrhein-Westfalen Verbesserungen für Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Positiv sei zwar, dass viele Frauen von Teilzeitarbeit profitierten, aber Teilzeit und vor allem Minijobs dürften keine Sackgasse sein, erklärte die Leiterin der Bundesagentur für Arbeit in NRW, Christiane Schönefeld, am 7. März in Düsseldorf. Der DGB in NRW verlangte mehr Chancengleichheit für Frauen, auch mit Blick auf das Gehalt. Sozialverbände wie der VdK fordern mehr Aufmerksamkeit für alte Frauen in Armut.
Fast vier Fünftel aller Teilzeitstellen in NRW werden nach Angaben der Arbeitsagentur von Frauen besetzt. Während nur rund ein Zehntel der Männer einer sozialversicherungspflichtigen Teilzeittätigkeit nachgehen, sind es bei den Frauen fast 50 Prozent. Bezieht man auch Minijobs mit ein, arbeiten in NRW weniger als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen in Vollzeit.
Die Entscheidung für Teilzeit sei in den meisten Fällen eine persönliche Entscheidung der Frauen, erklärte Schönefeld. Andere würden jedoch gerne mehr arbeiten, könnten es aber aufgrund etwa fehlender Kita-Plätze nicht. Für Unternehmen zahle es sich aus, Teilzeitarbeit, aber auch eine Rückkehr in Vollzeit möglich zu machen, erklärte die Arbeitsmarktexpertin. Arbeitgeber könnten sich dadurch Fachkräfte sichern. "Wenn Teilzeit keine Sackgasse ist und die Rahmenbedingungen es erlauben, Arbeit und Familie unter einem Hut zu bekommen, profitiert die ganze Gesellschaft davon."
Der DGB kritisiert, das Frauen vorwiegend Minijobs, kurze Teilzeitbeschäftigungen und befristete Arbeitsverhältnisse zur Verfügung stehen. Auch bei den Karrierechancen hätten sie das Nachsehen, erklärte die Landesvorsitzende Anja Weber zum Weltfrauentag. Beim Gehalt klaffe ebenfalls eine große Lücke. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern liege seit Jahren bei rund 22 Prozent. "Wir vergeuden ein enormes Potenzial an Talent, Leistung und Kreativität, wenn wir Frauen weiterhin als Beschäftigte zweiter Klasse behandeln", sagte Weber.
Der Sozialverband VdK macht zum Weltfrauentag auf Frauenarmut aufmerksam. "Armut ist und bleibt weiblich", erklärte die stellvertretende Vorsitzende Katharina Batz. Von den derzeit rund 500.000 Betroffenen, deren Einkommen unterhalb der Armutsrisikoschwelle liegt, sei der Frauenanteil in den vergangenen sechs Jahren deutlich stärker angestiegen als der Männeranteil. Mittlerweile sei jede sechste Frau über 65 Jahren von Armut bedroht, bei den über 80-Jährigen liege der Anteil noch höher. Die Landespolitik müsse bei der Armutsbekämpfung verstärkt alte Frauen in den Blick nehmen, forderte sie.
Der Sozialdienst katholischer Frauen forderte die neue Bundesregierung auf, für eine bessere Bezahlung in den Pflege- und Sozialberufen einzutreten. In diesem Bereich arbeiten überproportional viele Frauen. Die bessere Bezahlung sei ein entscheidender Schritt zur mehr Anerkennung und zur Steigerung der Attraktivität der Berufe, betonte der Verband. Zudem müsse die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen sowie zwischen technischen Berufen und sozialer Arbeit geschlossen werden.
Zahlen zum Weltfrauentag
Frankfurt a.M. (epd). Frauen verdienen weniger als Männer, leisten mehr unbezahlte Hausarbeit und werden häufig Opfer von Gewalt. Ein statistischer Überblick zum Weltfrauentag am 8. März:
FRAUEN UND HAUSARBEIT: Frauen leisten deutlich mehr unbezahlte Arbeit als Männer, insbesondere in der Kinderbetreuung oder bei der Hausarbeit. Das geht aus Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervor. In Deutschland sind Frauen vier Stunden und zwei Minuten am Tag mit diesen Aufgaben beschäftigt, während es bei den Männern nur zwei Stunden und 30 Minuten sind. Europaweit am wenigsten aktiv im Haushalt sind die türkischen Männer, während die Männer in Dänemark mit täglich drei Stunden und sechs Minuten pro Tag die meiste unbezahlte Arbeit leisten.
FRAUEN UND VERDIENST: Im Jahr 2016 betrug das Verdienstgefälle zwischen Männern und Frauen innerhalb der Europäischen Union (EU) gut 16 Prozent. Wie die Behörde Eurostat mitteilte, verdienten Frauen, wo Männer einen Euro pro Stunde verdienten, im Schnitt nur 84 Cent. Zwischen den Mitgliedstaaten reichte die Spanne des Verdienstunterschieds von knapp über fünf Prozent in Rumänien und Italien bis zu über 25 Prozent in Estland.
Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist in Deutschland in den vergangenen 30 Jahren kleiner geworden. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat errechnet, dass der prozentuale Unterschied zwischen den durchschnittlichen Bruttostunden-Verdiensten von Männern und Frauen in Vollzeitjobs von 26,6 Prozent im Jahr 1986 auf zuletzt 16 Prozent gesunken. Im Niedriglohnsektor ging der Unterschied um zehn Prozentpunkte zurück, beträgt aber immer noch 20 Prozent
Rund 72 Prozent der Frauen zwischen 25 und 55 Jahren haben ihren überwiegenden Lebensunterhalt im Jahr 2016 aus eigener Erwerbstätigkeit bestritten. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil mit 64 Prozent noch deutlich niedriger, so das Statistische Bundesamt. Im Osten Deutschlands bestritten im Jahr 2016 rund 77 Prozent der Frauen ihren Lebensunterhalt vorrangig durch eigene Erwerbsarbeit. Im Westen lag der Anteil bei 70 Prozent.
BERUFSTÄTIGE FRAUEN UND KINDER: Frauen, die in der Informations- und Kommunikationsbranche arbeiten, haben am seltensten Kinder. Hier lag der Anteil kinderloser Frauen 2016 bei 40 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Während dieser Wert in den Reinigungsberufen bei neun Prozent lag, wurde in den medizinischen, sozialen, und ausbildenden Berufen eine Quote zwischen 16 und bis 21 Prozent ermittelt. Der Anteil der kinderlosen Frauen insgesamt nahm zwischen den Jahren 2012 und 2016 nach einem zuvor langanhaltenden Anstieg nur geringfügig von 20 auf 21 Prozent zu. Bei den berufstätigen Frauen stieg er von 21 auf 22 Prozent.
FRAUEN UND GEWALT: Weltweit hat rund ein Drittel aller Mädchen und Frauen physische oder sexualisierte Gewalt erfahren. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung kommen die Täter häufig aus dem unmittelbaren Umfeld. Die Folgen seien oft gravierend: Viele junge Frauen würden ungewollt schwanger und müssten Schule oder Ausbildung abbrechen, würden mit HIV infiziert, litten an Depressionen oder begingen Selbstmord. In den ärmsten Ländern der Welt werde jedes achte Mädchen vor seinem 15. Geburtstag verheiratet.
Marlies Krämer kämpft für Gleichberechtigung in der Sprache

epd-bild/Jörg Fischer
Sulzbach (epd). "Suche fünf fleißige Männer oder eine Frau". Diese Postkarte hat Marlies Krämer im Flur ihres Häuschens im saarländischen Sulzbach aufgestellt. Die 80-Jährige bezeichnet sich selber als "bekennende Feministin" - der Begriff "Frauenrechtlerin" ist ihr zu wenig.
Seit Jahrzehnten kämpft sie gegen die Benachteiligung der Frau in der Sprache, dem "Schlüssel zur Gleichberechtigung", wie sie sagt. Jetzt hat sie die Saarbrücker Sparkasse verklagt. Sie will in allen Formularen mit weiblicher Anrede angesprochen werden - also etwa als "Kundin" oder "Kontoinhaberin". Am 13. März will der Bundesgerichtshof in Karlsruhe sein Urteil zu dem Fall verkünden.
Bereits Anfang der 90er Jahre war sie nach eigenen Angaben sechs Jahre ohne jeglichen Ausweis, weil sie sich weigerte, den Antrag auf einen neuen Pass zu unterschreiben: Damals war darin noch allein vom "Inhaber" die Rede. Erst nach Beratungen in der EU wurde das geändert: Jetzt heißt es in allen Ausweisen "Unterschrift der Inhaberin/des Inhabers". Und Marlies Krämer unterschrieb den Antrag.
Demo vor Institut für Meteorologie
Ende der 90er Jahre demonstrierte sie zusammen mit einer befreundeten Journalistin vor dem Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin und wurde zu einer Ikone für die Gleichberechtigung beim Wetter: Seit 1998 gibt das Institut Hoch- und Tiefdruckgebieten im jährlichen Wechsel Männer- und Frauennamen. Früher waren Hochs immer männlich, Tiefs weiblich.
Gleichberechtigung und Sprache gehören für Marlies Krämer zusammen: "Obwohl wir Frauen - mit 52 Prozent - die Mehrheit der Bevölkerung sind, werden wir ständig 'geschlechtsumgewandelt' und zum Mann umfunktioniert", argumentiert sie.
Ihr Leben und ihre politischen Vorstellungen sind durch den frühen Tod ihres ersten Mannes 1972 geprägt. Sie wurde "ins kalte Wasser gestoßen", wie sie sagt. Mit Mitte 30 musste sie sich als alleinerziehende Mutter von vier Kindern im katholisch geprägten Saarland durchschlagen, arbeitete als Küchenhilfe, Serviererin oder Putzfrau.
Rückblickend sieht die lebenslustige Saarländerin aber auch ein Gutes in der "Katastrophe": "Wenn mein Mann nicht so früh gestorben wäre, wäre ich vielleicht eine von den Millionen Frauen, die sich für nichts interessieren und zu Hause sitzen", bilanziert die 80-Jährige.
Herz schlägt links
Früher sei sie streng katholisch gewesen. Den monotheistischen Weltregionen stehe sie wegen deren Frauenbild jetzt aber skeptisch gegenüber. Nach dem Tod ihrer strenggläubigen Mutter trat sie aus der katholischen Kirche aus. Als Gasthörerin studierte sie im fortgeschrittenen Alter Soziologie. "Da sind bei mir die letzten patriarchalischen Knoten im Kopf geplatzt."
Außer für die Sache der Frauen schlägt das Herz der Linken-Politikerin für Umwelt und soziale Gerechtigkeit. Fotos an den Wänden und in den vollen Regalen ihres Wohn- und Arbeitszimmers zeigen Marlies Krämer, Arm in Arm mit Oskar Lafontaine und ihrem Lebensgefährten Günter Meyer, oder Krämer, wie sie 1996 vor dem Saarbrücker Schloss eine rote Rose an Michail Gorbatschow überreicht - die für dessen Frau Raissa gedacht war.
Und auch ein Dankesbrief von Hillary Clinton hängt an der Wand. Die Saarländerin hatte ihr 1993 nach der Wahl von Bill Clinton gratuliert. Denn, so Krämer, hinter einem erfolgreichen Mann steht oft eine starke Frau.
Nun wartet sie auf die Entscheidung des BGH im Sparkassen-Fall. Die Vorinstanzen - das Amtsgericht und das Landgericht Saarbrücken - wiesen die Klage zurück.
Generisches Femininum
Die Richter schlossen sich der Sichtweise des Beklagten an: Das "generische Maskulinum" werde geschlechtsneutral verwendet, das sei schon seit 2.000 Jahren so. Doch das will Krämer nicht gelten lassen: In den nächsten 2.000 Jahren sollte doch einfach das "generische Femininum" verwendet werden. Denn schließlich sei in Worten wie Kundin, Bürgerin, Antragstellerin, Wählerin, Journalistin oder Chirurgin auch die männliche Form enthalten.
Von Männern, aber auch von Frauen, werde sie immer wieder als "Emanze" angefeindet, erzählt sie. Kürzlich habe ein Journalist angerufen und sie als "Arschloch" beschimpft. Solche Anfeindungen spornen die 80-Jährige indes noch an. Sollte der BGH am kommenden Dienstag ihre Klage abweisen, will sie gerichtlich weiter machen und vor das Bundesverfassungsgericht oder gar vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) ziehen. "Letztendlich macht mir das einfach Spaß, ich bin dabei auch nicht verbissen, aber ich lasse mir auch nichts gefallen."
Bedauerlich sei, dass sie viele Einladungen und Termine außerhalb des Saarlandes nicht mehr wahrnehmen könne: Seit einem Sturz vor zwei Jahren fällt es ihr schwer zu laufen. "Der Rollator ist mein wichtigstes Einrichtungsstück", scherzt sie. Auch zur Urteilverkündung am 13. Märzt will sie nicht nach Karlsruhe fahren. Die Reise sei doch zu beschwerlich.
Geheilt - aber der Krebs verändert alles

epd-bild/Verena Mörath
Berlin (epd). Fast zehn Jahre dauerte die Chemotherapie. So lange hat Mike Wolff (Name von der Redaktion geändert) dem Krebs die Stirn geboten und schließlich seine Leukämie besiegt. Mit 32 Jahren bekam der heute 50-jährige Berliner seine Diagnose. Er gehört zu den rund 175.000 Menschen, die laut Statistik des Zentrums für Krebsregisterdaten in Deutschland jährlich zwischen dem 16. und 65. Lebensjahr an Krebs erkranken. Dank des medizinischen Fortschritts ist das nicht mehr gleichbedeutend mit einem Todesurteil.
Die Heilungschancen in der Altersgruppe der 15- bis 40-Jährigen sind recht hoch, 80 Prozent von ihnen überleben den Krebs. Das Zentrum für Krebsregisterdaten geht derzeit von zwei bis 2,5 Millionen Menschen in Deutschland aus, die fünf und mehr Jahre nach ihrer Krebserkrankung noch am Leben sind.
Ein Drittel mit Spätfolgen
Etwa ein Drittel der Krebsüberlebenden leidet nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft an den Spätfolgen von Tumoren, Operationen, Bestrahlungen und Chemotherapie. Die Liste von gesundheitlichen und seelischen Problemen ist lang: chronische Erschöpfung, Nervenschäden, Lymphödeme, geschwächtes Immunsystem, Depressionen und kognitive Störungen - eine Rückkehr in den Job ist nicht selten unmöglich.
"Je länger die Therapien dauern, desto größer sind häufig die Einschränkungen", sagt Rainer Göbel, der sich ehrenamtlich im Berliner Selbsthilfeverein "Leben nach Krebs!" engagiert. Wegen dieser Spätfolgen könne ein Drittel der Krebsüberlebenden nicht wieder in die Arbeitswelt zurückzukehren. Der Verein "Leben nach Krebs!" unterstützt gemeinsam mit der Beratungseinrichtung "KOBRA – Beruf Bildung Arbeit" Krebsüberlebende beim Versuch, wieder in die Erwerbsarbeit zurückzufinden.
Austausch wichtig
"Es hat sich gezeigt, dass die Teilnehmenden den Austausch untereinander schätzen und gestärkt hier herausgehen", sagt Helga Lind, Beraterin und Dozentin von KOBRA. Wichtig sei es für sie, die eigene Belastbarkeit einschätzen zu lernen, eine berufliche Neuorientierung und Bewerbungsstrategien zu entwickeln. Viel diskutiert werde die Frage, wie offen man mit Arbeitgebern über seine gesundheitlichen Handicaps sprechen soll.
Das ist für Sabrina Leh nicht das Thema, denn sie stand noch gar nicht im Berufsleben, als sie mit 22 Jahren einen bösartigen Hirntumor bekam. Zwar konnte dieser operativ entfernt werden, aber dabei wurde Lehs motorisches Zentrum verletzt. Die Studentin, mit 15 Jahren Berliner Stadtmeisterin im Mehrkampf, war plötzlich halbseitig gelähmt. Auch beschädigte die Bestrahlung ihre Hirnanhangsdrüse, nun muss Leh lebenslang Hormone nehmen. Außerdem leidet sie an Migräne und hat deshalb oft sehr starke Kopfschmerzen. Dennoch schloss die junge Frau ihr Studium ab.
Flexibilität
Die heute 36-jährige Akademikerin konnte aufgrund ihrer schweren Behinderungen noch nie einer festen Arbeit nachgehen. Sie lebt seit 14 Jahren von einer vollen Erwerbsminderungsrente. "Ich würde sehr gerne arbeiten", sagt sie, "aber ich bräuchte einen Job mit flexiblen Arbeitszeiten, der er es mir erlaubt, auch an schlechten Tagen zu Hause zu arbeiten oder Ausfallzeiten an guten Tagen nachzuholen" - eben individuell auf ihre Einschränkungen angepasst.
"Es gibt durchaus berufliche Wiedereinstiegsmodelle, aber sie werden leider nur teilweise der reduzierten Leistungsfähigkeit von Krebsüberlebenden gerecht", sagt Göbel vom Verein "Leben nach dem Krebs!". Das Instrument des Betrieblichen Eingliederungsmanagement, kurz BEM, sei vielen Arbeitgebern nicht bekannt oder bleibe ungenutzt.
Es soll Beschäftigten nach langer Krankheit ermöglichen, an den Arbeitsplatz zurückzukehren, der dann mit Rücksicht auf ihre gesundheitlichen Beeinträchtigungen individuell gestaltet wird. Arbeitgeber sind seit 2004 gesetzlich verpflichtet, bei Bedarf ein Betriebliches Eingliederungsmanagement umzusetzen, "aber nicht alle halten sich daran", kritisiert Göbel.
Studie: Vorab-Besuche nehmen Behinderten Angst vor Klinikaufenthalt
Bielefeld (epd). Krankenhausaufenthalte von Menschen mit Behinderungen haben einer Studie zufolge eine bessere Erfolgschance, wenn die Patienten zuvor in ihrem Zuhause mit Besuchen von Pflegekräften darauf vorbereitet werden. Erste Ergebnisse der 2016 gestarteten Praxisstudie "Klinik inklusiv" zeigten, dass die Betroffenen dadurch Vertrauen aufbauen und sich eher auf eine Behandlung einlassen, wie die Fachhochschule der Diakonie am 8. März in Bielefeld mitteilte. Gleichzeitig würde das Klinikpersonal vorab über individuelle Grenzen und besondere Gewohnheiten informiert, die sie respektieren müssten.
An dem bundesweit einmaligem Projekt sind das Evangelische Klinikum und das Krankenhaus Mara am Standort Bielefeld-Bethel beteiligt. Zwei Pflegeexpertinnen von der Fachhochschule Diakonie haben in den vergangenen zwei Jahren überwiegend Patienten des Krankenhauses Mara, wo die Betheler Zentren für Epilepsie und Behindertenmedizin angesiedelt sind, begleitet. Sie besuchten die Menschen vorab in ihrem vertrauten Umfeld in Betheler Wohneinrichtungen. Dabei ermittelten sie ihre Gewohnheiten, ihre besonderen Ängste, ihren Bedarf an Hilfsmitteln und ihre Möglichkeiten sich mitzuteilen.
Bei ihren Besuchen fanden die Forscherinnen demnach heraus, zum Beispiel ob jemand keine körperliche Nähe mag, auf welche Anrede jeweils reagiert wird oder in welchen Situationen besonders viel Stress entsteht. "Solche Erkenntnisse sind für die Mitarbeiter im Krankenhaus und ihren Umgang mit den behinderten Patienten wichtig", erklärte die klinische Pflegeexpertin Susanne Just.
"Mit den prästationären Besuchen nehmen wir den Patienten nachweislich bereits vor ihrem Aufenthalt viele Ängste", betonte Projektleiterin Doris Tacke von der FH Diakonie. Dadurch werde ihre Versorgung erleichtert und verbessert.
In der zweiten Projektphase von "Klinik inklusiv" sollen nun vor allem Patienten vor ihrer Behandlung in der Klinik für Neurochirurgie des Evangelischen Krankhauses Bethel besucht werden, wie es hieß. Die gesammelten Daten werden von der FH der Diakonie bis März 2019 ausgewertet. Das Forschungsprojekt wird von der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW gefördert.
Leitungswechsel bei Königsberger Diakonie
Wetzlar (epd). Der theologische Vorstand der Königsberger Diakonie, Jörn Contag, verlässt zum 30. April seine Stelle. Ab 1. Mai wird er theologischer Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, wie die Königsberger Diakonie mitteilte. Eva Steinmetz, die bisher im Vorstand vor allem für den Bereich Pflege zuständig gewesen sei, übernehme zunächst allein verantwortlich die Leitung. Der Verwaltungsrat wird den Angaben zufolge gemeinsam mit ihr und dem Kuratorium in den kommenden Monaten über die zukünftige Verbandsstruktur beraten.
Der Verwaltungsratsvorsitzende Jörg Ludwig dankte Contag für seine Arbeit. "Er hat seine Aufgabe im Jahr 2009 in einer schwierigen Zeit angetreten und die Königsberger Diakonie souverän und immer mit Blick auf den Einzelnen auf einen erfolgreichen Kurs zurückgeführt", sagte Ludwig. Zudem habe er als Seelsorger das theologische Profil der Königsberger Diakonie geprägt. "Wir bedauern, aber respektieren seine Entscheidung", erklärte der Verwaltungsratsvorsitzende.
Die 1850 im ostpreußischen Königsberg zunächst als Krankenhaus der Barmherzigkeit gegründete Einrichtung betreut nach eigenen Angaben in ihren Häusern in Wetzlar, Braunfels und Hüttenberg rund 400 Menschen, davon etwa 300 Pflegebedürftige. Mit über 300 Mitarbeitern ist sie ein großer Arbeitgeber in der Region.
"Theodora" klärt Hunderte Prostituierte über neues Schutzgesetz auf
Herford/Soest (epd). Die kirchliche Beratungsstelle für Prostituierte "Theodora" in Herford hat im vergangenen Jahr 141 Frauen intensiv beraten und mehr als 540 aufgesucht. Dabei hätten die Themen Ausstieg aus der Prostitution, Gesundheitsvorsorge und Krankenversicherung, Legalisierung der Arbeit sowie ausländerrechtliche Fragen im Mittelpunkt erstanden, teilte die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen am 5. März in Soest mit. Die Frauenhilfe ist Trägerin der Beratungsstelle, die seit 2011 Prostituierte in Ostwestfalen-Lippe begleitet.
Seitdem das neue Prostituiertenschutzgesetz Mitte 2017 in Kraft getreten sei, müsse Theodora die Frauen über die Neuregelung informieren und aufklären, hieß es weiter. Das Gesetz verpflichtet Prostituierte unter anderem, ihre Tätigkeit persönlich oder unter einem Alias-Namen anzumelden, eine jährliche Gesundheitsberatung wahrzunehmen und Behörden den Zutritt zu den Geschäftsräumen zu gewähren.
Allein im Rahmen des vor zwei Jahren gestarteten Programms "Hilfe-Lotsinnen" hat "Theodora" 2017 nach eigenen Angaben 141 Frauen begleitet. Ziel sei die Vermittlung von neu zugewanderten Armuts-Prostituierten aus Ländern der Europäischen Union in das Hilfesystem der Kommunen. Viele dieser Frauen könnten von den "Theodora"-Mitarbeiterinnen in ihrer Muttersprache erreicht werden, weil die Beratung in neun Sprachen erfolge, hieß es. Auch 40 bis zu sieben Jahre alte Kinder der Klientinnen seien mitbetreut worden.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle haben 2017 den Angaben nach 82 bordellähnliche Betriebe und Wohnungen aufgesucht, teilte die Frauenhilfe weiter mit. Die meisten davon lagen mit 27 Prozent im Kreis Herford, 22 Prozent waren im Kreis Gütersloh angesiedelt, gefolgt von den Kreisen Paderborn (17 Prozent) und Minden-Lübbecke (15 Prozent). Bei den Besuchen wurde demnach Kontakt zu fast 540 Prostituierten aufgenommen.
Das "Theodora"-Projekt wird zum größten Teil aus EU-Mitteln sowie vom Bundessozialministerium, fünf Kreisen und der Stadt Bielefeld finanziert. In Ostwestfalen-Lippe gibt es den Angaben zufolge 300 bordellähnliche Betriebe, vor allem in kleineren Städten. Die "Theodora"-Beratungsstelle geht von etwa 2.200 Prostituierten jährlich in der Region aus.
Mehr als 150 Anfragen bei NRW-Opferschutzbeauftragter
Düsseldorf (epd). Seit dem Amtsantritt der neuen NRW-Operschutzbeauftragten Elisabeth Auchter-Mainz vor 100 Tagen haben mehr als 150 Kriminalitätsopfer bei ihr Hilfe gesucht. Teils seien die Straftaten gerade erst geschehen, teils lägen sie Jahre zurück, seien für die Opfer aber immer noch sehr belastend, erklärte das nordrhein-westfälische Justizministerium am 7. März in Düsseldorf. Die Betroffenen, die sich telefonisch, schriftlich, per Mail oder persönlich gemeldet haben, kamen den Angaben nach aus allen Altersgruppen. Etwa zwei Drittel von ihnen waren Frauen, ein Drittel Männer.
"Schon die ersten 100 Tage zeigen, wie notwendig es war, den Opfern von Kriminalität endlich eine Stimme zu geben", sagte Justizminister Peter Biesenbach (CDU). Er verwies auf das Beispiel eines Mannes, der sich bei der Opferschutzbeauftragten gemeldet hatte, nachdem er ausgeraubt wurde und in der Folge mittellos war. "Bislang war keine staatliche Stelle dafür zuständig, diesem Mann Hilfe zu vermitteln", sagte Biesenbach. Die Opferschutzbeauftragte Auchter-Mainz habe sich mit Hilfe des Opferschutzvereins Weisser Ring um ihn gekümmert.
Neben der Arbeit mit Opfern von Straftaten vernetze die ehemalige Kölner Generalstaatsanwältin sich auch mit anderen Akteuren im Bereich Opferschutz, erklärte das Ministerium weiter. In dieser Woche besuche Auchter-Mainz etwa die Geschäftsstelle des Beauftragten für die Opfer und Hinterbliebenen des Terroranschlags am Breitscheidplatz in Berlin, Kurt Beck.
Medien & Kultur
Deutsches Exilarchiv zeigt Leid und Kampf der Emigranten

epd-bild/Thomas Rohnke
Frankfurt a.M. (epd). Die unscheinbare Abreiß-Fahrkarte mit dem Aufdruck "Köln - Aachen 23.4.1933" verweist auf eine Geschichte auf Leben und Tod. Auf der Rückseite findet sich die handschriftliche Notiz des jüdischen Fotografen Walter Zadek: "Die Fahrkarte in die Freiheit. Absichtlich zur Täuschung Rückfahrt gekauft. Von Aachen mit Taxi ins Niemandsland". Zadek floh über die grüne Grenze in die Niederlande und weiter nach Palästina.
Das Miniaturexponat ist eines von rund 250 Originalen aus Nachlässen von Künstlern, Schriftstellern und Wissenschaftlern, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten Deutschland verlassen mussten. Nun können die Exponate besichtigt werden: Das Deutsche Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main eröffnete die Dauerausstellung "Exil. Erfahrung und Zeugnis".
Ihre Welt zurückgelassen
Die Schau veranschauliche den Alltag, die Situation der Familie, den beruflichen Auf- oder Abstieg, die eigene Sprache und fremde Sprachen, Widerstand gegen den Nationalsozialismus und schließlich die Frage nach Rückkehr oder Bleiben, erläutert die Leiterin des Deutschen Exilarchivs, Sylvia Asmus. Auf 400 Quadratmetern in der Dauerausstellung und daneben in der gleichgroßen Wechselausstellung werden Notizzettel, Fotos und Objekte gezeigt. Dazu gehört etwa ein handschriftlicher Brief des Schriftstellers Franz Werfel (1890-1945) an seine Eltern von Bord eines Schiffes kurz vor der Ankunft in New York. Er berichtet über die geglückte Flucht und hat den Satz unterstrichen: "Weitaus das Allerschlimmste dabei aber war, Euch zurücklassen zu müssen."
Zurücklassen mussten die Exilanten nicht nur die Liebsten, sondern alles, was ihre Welt bislang ausmachte. Von der jüdischen Rechtsanwältin Clementine Zernik (1905-1996), die 1938 aus Wien in die USA floh, ist ein Holzkästchen zu sehen. Darin hat sie Erinnerungsstücke gesammelt, Postkarten, Fotos, Fahrkarten, Eintrittskarten zu den Salzburger Festspielen, die sie mit ins Exil nahm - materiell wertlos, aber die Vergewisserung ihres bisherigen Lebens. Wie sehr die Vertreibung Emigranten verbitterte, macht ein Brief Albert Einsteins (1879-1955) an seinen früheren deutschen Verleger von 1950 deutlich: Der Physiker verweigerte dem Verleger die Herausgabe seiner Bücher in Deutschland.
"Erde vom Grab meiner lieben Mutter"
Die Schau bietet neben den chronologischen Kapiteln "Auf der Flucht", "Im Exil" und "Nach dem Exil" acht biografische Einstiege. Eine Persönlichkeit davon ist die Journalistin und Schriftstellerin Stefanie Zweig (1932-2014), die in Erinnerung an ihre Kindheit im Exil in Kenia den Bestsellerroman "Nirgendwo in Afrika" schrieb. Ein unscheinbares graues Säckchen, etwa zwei mal vier Zentimeter, liegt unter Glas: "Erde vom Grab meiner lieben Mutter", hatte Stefanies Vater Walter 1938, dem Jahr der Flucht aus Oberschlesien, wohl mit Abschiedsschmerz geschrieben.
Fotobücher von Stefanie Zweig geben einen Eindruck vom fremden Land der Zuflucht und vom ersten Winter zurück in Deutschland 1947. Die alte Heimat war für immer verloren. Stefanies Eltern kehrten nicht nach Leobschütz zurück, das war polnisch geworden, sondern landeten in Frankfurt am Main. Sie selbst musste ihre Heimat Kenia verlassen und fand sich in Deutschland in der Fremde.
Flüchtlinge im Mittelmeer
Eine aktuelle Fotoinstallation zeigt ein Flüchtlingsschiff voller Menschen, von dem einzelne in ein Boot auf dem Mittelmeer hinabsteigen. Die Installation wechselt von Farbe in Schwarz-Weiß und gleicht dann verblüffend dem Motiv von Fotos in einer Vitrine: Der geflohene Fotograf Walter Zadek nahm 1939 die illegale Landung eines Frachters mit 850 Flüchtlingen vor Tel Aviv auf. Die Menschen waren nicht willkommen, die britische Verwaltung hatte die Einwanderung von Juden nach Palästina verboten.
Die Ausstellung habe traurige Aktualität, erklärt Archivleiterin Asmus. Dadurch spreche die Epoche des Exils 1933 bis 1945 den Betrachter heute unmittelbar an. Die Emigranten gäben ein Beispiel, wie man mit extremen Situationen umgehen könne. Es zeige sich, wie überlebensnotwendig Familienzusammenhalt und Freundschaften seien. "Man blickt dann anders auf sein eigenes Leben", sagt Asmus. "Und man erkennt, wie wichtig es ist, Kontakte zu halten."
Deutschland präsentiert sich als internationales Kunstland
Etwa alle fünf Jahre zeigt der Bund die Neuankäufe seiner Kunstsammlung. Wesentliche Botschaft der jüngsten Präsentation in Bonn: In Deutschland produzierte Kunst wird immer globaler.Bonn (epd). Wer die Halle mit den Neuerwerbungen der Kunstsammlung des Bundes ansteuert, hört die Klänge der deutschen Nationalhymne. Das klingt vertraut - und sehr deutsch. Oder doch nicht? Je näher der Besucher der dunklen Nische mit den versteckten Lautsprecherboxen kommt, desto weniger versteht er. Denn die Toninstallation des nigerianischen Künstlers Emeka Ogboh lässt die deutsche Hymne in zehn afrikanischen Stammessprachen erklingen.
Ogbohs Arbeit ist gleichsam Programm der Ausstellung "Deutschland ist keine Insel. Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland", die seit 8. März in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen ist. "Deutschland ist ein sehr internationales Kunstland", sagt Stefan Berg, Mitglied der fünfköpfigen Expertenkommission, die von 2012 bis 2016 rund 170 Werke für den Bund angekauft hat. Die Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Installationen, Fotografien und Videoarbeiten sollen einen Überblick über die aktuelle Kunstproduktion in Deutschland geben. 150 von ihnen werden bis zum 27. Mai in der Bundeskunsthalle präsentiert - "im Sinne eines Rechenschaftsberichts", wie Bundeskunsthallenchef Rein Wolfs sagt.
Etwa alle fünf Jahre präsentiert der Bund die neusten Ankäufe seiner Sammlung, die das Ziel hat, die Entwicklungen der Kunst in Deutschland festzuhalten. Ausgewählt werden die Werke von einer fünfköpfigen Expertenkommission, die alle fünf Jahre neu berufen wird. Dabei entwickelt jede Kommission eigene Schwerpunkte. Die jüngste Jury investierte das Budget von rund 400.000 Euro pro Jahr vor allem in Werke, die den "multikulturellen Ort Deutschland beschreiben", wie Wolfs sagt.
Ganz neu ist diese Entwicklung nicht. Denn spätestens seit sich Berlin nach der Wiedervereinigung zur globalen Kunstmetropole mauserte, könne von deutscher Kunst eigentlich nur noch als "Kunst aus Deutschland" gesprochen werden, sagt Wolfs. Die von der Kommission angekauften Werke stammen zwar von in Deutschland lebenden Kreativen. Viele der 81 in Bonn präsentierten Künstler haben jedoch einen ausländischen Pass.
So bilden neben der Klanginstallation des Nigerianers Ogboh Arbeiten des Niederländers Erik van Lieshout den Auftakt der Ausstellung. Lieshout thematisiert den Flüchtlingszuzug in Zeichnungen und Collagen. Mittendrin: ein Porträt Angela Merkels mit knallrotem Mund und angstvollen, dunkel geränderten Augen. Der Titelsatz der Ausstellung "Deutschland ist keine Insel" stammt von der Bundeskanzlerin.
Der Blick auf die deutsche Realität war laut Berg einer der Themenschwerpunkte bei den Ankäufen der Kommission. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die 1968 geborene Künstlerin Antje Majewski etwa verwendet als Motive für ihre Gemälde Schnitzereien, die von den Gefangenen des Konzentrationslagers Ravensbrück hergestellt wurden. Das irisch-israelische Künstler-Duo Clegg&Guttmann zeigt die Großaufnahme eines Regals der Kinderbücherei Pritzwalk, das mit DDR-Kinderliteratur gefüllt ist.
Eine aktuelle Entwicklung machten die Ankäufer auch beim Einfluss der Digitalisierung auf die Bildwelten aus. Ein Beispiel ist die in Berlin lebende russische Künstlerin Viktoria Binschtok, die Suchmaschinenergebnisse nach Bildern aus dem Internet zur Produktion neuer, zusammengesetzter Bilder nutzt.
Zu der Expertenkommission der Ankaufsperiode bis 2016 gehörten neben dem Bonner Kunstmuseums-Direktor Berg die Chefin der Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Susanne Gaensheimer, die Leiterin der Kieler Kunsthalle, Anette Hüsch, der Chef des Münchner Lenbachhauses, Matthias Mühling und die Leiterin der Kunsthalle Berlin, Svenja von Reichenbach.
Die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland wurde 1970 auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD) gegründet. Die Sammlung umfasst mittlerweile rund 1.750 Werke und wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters (CDU), verwaltet.
Suhrkamp-Verlag distanziert sich von Autor Tellkamp
Dresden/Berlin (epd). Nach umstrittenen Äußerungen des Schriftstellers Uwe Tellkamp ("Der Turm") über Flüchtlinge hat sich der Berliner Suhrkamp-Verlag von seinem Autor distanziert. Bei einer Podiumsdiskussion am 8. März in Dresden hatten sich Tellkamp und der Dichter Durs Grünbein einen Schlagabtausch zum Thema Meinungsfreiheit geliefert. Unter anderem vertrat Tellkamp die Ansicht, dass mehr als 95 Prozent der Flüchtlinge nicht vor Krieg und Verfolgung fliehen würden, sondern kommen, "um in die Sozialsysteme einzuwandern".
Der in Berlin ansässige Suhrkamp-Verlag, der auch Tellkamps Erfolgsroman "Der Turm" veröffentlicht hat, twitterte am 9. März: "Aus gegebenem Anlass: Die Haltung, die in Äußerungen von Autoren des Hauses zum Ausdruck kommt, ist nicht mit der des Verlags zu verwechseln." Tellkamp vertrat bei der Veranstaltung teilweise Positionen der AfD und der ausländerfeindlichen "Pegida"-Bewegung. Unter anderem kritisierte er die Medien und behauptete: "Viele Journalisten sind auf Regierungslinie."
"Gesinnungsdiktatur"
Die Diskussion vor rund 1.000 Teilnehmern im Dresdner Kulturpalast stand unter dem Motto "Streitbar". Ausgangspunkt war die "Charta 2017", die sich im vergangenen Jahr gegen den Ausschluss rechter Verlage von der Buchmesse ausgesprochen hatte. In der Erklärung, die eine Dresdner Buchhändlerin initiiert hatte, warnten die Unterzeichner vor einer "Gesinnungsdiktatur". Der gebürtige Dresdner Tellkamp gehörte zu den Erstunterzeichnern.
Grünbein, ebenfalls in Dresden geboren, hatte die Charta nicht unterzeichnet. Bei der Diskussion am 8. März betonte er den Wert der "freien uneingeschränkten Meinungsäußerung". Zugleich kritisierte er die "Zunahme an aggressiver Verbalität" und warb für einen unbedingten Wandel in der politischen Debatte.
Deutscher Hörbuchpreis für Tscheplanowa und Fröhlich
Köln (epd). Die Schauspielerin Valery Tscheplanowa und der Rezitator Andreas Fröhlich sind mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet worden. In einer von dem Musiker Götz Alsmann moderierten Gala erhielten sie am 6. März in Köln die Preise als beste Interpretin und bester Interpret. Mit der Preisverleihung im WDR-Funkhaus wurde zugleich das Literaturfest Lit.Cologne eröffnet.
Valery Tscheplanowa erhielt den Preis für ihre Hörbuch-Lesung von Paulus Hochgatterers Erzählung "Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war". Die Schauspielerin lese den Text über einen jungen Waisen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs "intensiv wie ein Kammerspiel", hieß es in der Jurybegründung. Andreas Fröhlich, bekannt als Bob Andrews von den "Drei ???", erhält den Hörbuchpreis bereits zum dritten Mal. Er wurde für seine Lesung von Walter Moers' Roman "Prinzessin Insomnia & der alptraumfarbene Nachtmahr" geehrt.
Der Preis für das beste Hörspiel ging an "Dienstbare Geister" des Autoren und Regisseurs Paul Plamper, das die Geschichte und Gegenwart der Migration zwischen Deutschland und Afrika erzählt. Das Hörspiel werde getragen von einem "herausragenden, spielfreudigen Ensemble" und überzeuge durch subtile Details, entlarvende Wortwahl und punktgenaue Dialoge, lobte die Jury.
Publikumspreis für Marc-Uwe Kling
Mit dem alle zwei Jahre vergebenen Sonderpreis ehrte der Verein Deutscher Hörbuchpreis die Schauspielerin Eva Mattes. Die Jury erklärte, Mattes schaffe Strukturen, ergründe die Tiefe vermeintlich bekannter Texte und erschließe auch schwierige Figuren.
Der Preis für das beste Sachhörbuch ging an die Dokumentation "Fritz Bauer. Sein Leben, sein Denken, sein Wirken" über den hessischen Generalstaatsanwalt, der maßgeblich für das Zustandekommen der Frankfurter Auschwitz-Prozesse verantwortlich war. In der Kategorie Unterhaltung siegte "Der Club", eine inszenierte Lesung des Debütromans von Takis Würger von Regisseurin Theresia Singer. Bestes Kinderhörbuch wurde "Die furchtlose Nelli, die tollkühne Trude und der geheimnisvolle Nachtflieger" von Verena Reinhardt, gelesen von Franziska Hartmann.
Der erstmals vergebene Publikumspreis, über den die WDR-Hörer und -Zuschauer abstimmten, ging an den Autoren Marc-Uwe Kling für seine satirische Zukunftsversion "QualityLand". Der Autor der "Känguru-Chroniken" legte Roman und Hörbuch in zwei Versionen vor: einer hellen für Optimisten und einer dunklen für Pessimisten. Als Hörbuch des Jahres 2017 der hr2-Hörbuchbestenliste wurde "Requiem für Ernst Jandl" geehrt.
Mit dem 2003 vom WDR ins Leben gerufenen Deutschen Hörbuchpreis, der je Kategorie mit 3.333 Euro dotiert ist, werden herausragende deutschsprachige Hörbuchproduktionen ausgezeichnet. Seit 2006 vergibt der Verein Deutscher Hörbuchpreis die Auszeichnung, dem unter anderem auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie der Norddeutsche und der Hessische Rundfunk angehören.
Mike Hammer-Schöpfer Spillane vor 100 Jahren geboren
Von der Kritik wurde er verrissen, bei Fans haben die Krimis mit Privatdetektiv Mike Hammer Kultstatus: Mit seinem Pulp-Stil beeinflusste Mickey Spillane Autoren und Filmemacher. Der Schriftsteller wurde vor 100 Jahren geboren.Frankfurt a.M. (epd). Als Privatdetektiv Mike Hammer erkennt, dass seine Geliebte die Mörderin seines Freundes ist, erschießt er sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Im Sterben will sie wissen: "Wie konntest du nur?" Hammers Antwort: "Es war leicht." Schon das Ende des ersten Auftritts des chauvinistischen und brutalen Privatermittlers Mike Hammer in "Ich, der Richter" im Jahr 1947 löste bei Kritikern einen Sturm der Entrüstung aus.
Mit Mike Hammer schickte Mickey Spillane (1918-2006) nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen Privatermittler durch die finsteren Gassen New Yorks, der wesentlich weniger Skrupel kannte als die Vorgänger Sam Spade von Dashiell Hammett oder Philip Marlowe von Raymond Chandler. Vor 100 Jahren, am 9. März 1918, wurde Mickey Spillane in New York geboren.
"Gewalt und Pornografie"
"Spillane ist, soweit ich sehen kann, nichts als eine Mischung aus Gewalt und offener Pornografie", ätzte der renommierte Krimi-Autor Raymond Chandler (1888-1959) damals. In Deutschland setzte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 1954 den Roman "Die Rache ist mein" auf den Index. Sie monierte "zynische Brutalität der Darstellung einer ununterbrochenen Kette von Verbrechen", eine "starke sexuelle Note" sowie die "barbarische, dem Jargon der Gosse entnommene Sprache".
Mit seinem Stil, der sich an den billigen und reißerischen "Pulpmagazinen" orientierte, beeinflusste Spillane spätere Krimi-Autoren wie Jim Thompson oder Elmore Leonard. Auch Filme wie "Sin City" (2005) von Robert Rodriguez, Frank Miller und Quentin Tarantino zeugen von Spillanes Einfluss.
Kritik, machte der Autor Spillane immer wieder klar, ließ ihn kalt. Er lese keine Literaturkritiken, sondern nur seine Schecks. Angeblich schrieb er ein Buch innerhalb von vier Wochen runter. "Ich bin Schreiber, kein Autor", gab er gern zu Protokoll. Er schreibe nicht für einen Platz in der Literaturgeschichte, sondern "damit Rauch aus dem Schornstein kommt". Gern verbreitete er das Bild eines erzkonservativen Machos, der Liberale und Antikriegsdemonstranten ablehnte.
Auflage 200 Millionen
Bei den Lesern kamen seine Bücher an: Bis heute wurden nach Angaben des Portals "Krimicouch" weltweit mehr als 200 Millionen seiner Bücher verkauft. 13 Mike-Hammer-Romane veröffentlichte er, viele seiner Werke wurden verfilmt. In dem Streifen "Der Killer wird gekillt" (1963) ist Spillane selbst als Mike Hammer zu sehen. Von 1984 bis 1987 ermittelte der Detektiv - gespielt von Stacey Keach - in der Fernsehserie "Mike Hammer", die in Deutschland zuerst auf Sat.1 lief.
Die Brutalität in seinen Büchern rechtfertigte Spillane, der als Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg Piloten ausbildete, mit folgendem Argument: Er schreibe für Kriegsveteranen, die seien an diese Art Gewalt gewöhnt.
Der deutsche Autor Jörg Fauser (1944-1987, "Der Schneemann") schrieb in seiner Spillane-Würdigung "Mein ist die Rache, spricht der Mike", dass Spillanes Werke die immer brutalere Seite der amerikanischen Nachkriegsgesellschaft zeigten. Dazu gehörten der hysterische Antikommunismus, die Watergate-Affäre des US-Präsidenten Richard Nixon, der Kalte Krieg und die schleichende Korrumpierung durch das organisierte Verbrechen. "Man mag von Spillane halten, was man will - diese Wirklichkeit hat er zwar vereinfacht, aber keineswegs geschönt", schrieb Fauser.
Der am 9. März 1918 in New York als Frank Morrison Spillane geborene Autor wuchs in Brooklyn auf. Vor dem Zweiten Weltkrieg schrieb er bereits für Pulp-Magazine und textete Comics. Nach der Rückkehr aus dem Krieg brauchte er Geld für ein Haus. Daher habe er seinen ersten Mike-Hammer-Roman "in neun oder 19 Tagen" in seine Schreibmaschine getippt, wie er sagte.
Zeuge Jehovas
Im Gegensatz zu seinem raubeinigen Helden lebte der Autor mit dem kurzhaarigen Militärschnitt eher bieder: Er war kein Raucher und Trinker. Nachdem er Mitglied der "Zeugen Jehovas" geworden war, pausierte er zwischen 1952 und 1962 auch als Krimischreiber. Stattdessen soll er an den Haustüren Traktate der "Zeugen Jehovas" verteilt haben. Insgesamt war er dreimal verheiratet, hatte vier Kinder aus seiner ersten Ehe.
Erfolgreich war Spillane auch als Autor von Kinderbüchern wie "Der Tag, an dem das Meer verschwand". Und der Mann, der über Jahrzehnte Alkoholabstinenzler war, machte ein Vermögen durch Werbespots für die Bierbrauerei Miller.
Für seine Leistungen in der Krimi-Literatur wurde ihm 1995 die höchste Auszeichnung des US-Krimi-Schriftsteller-Verbands "Mystery Writers of America" verliehen, der "Grand Master Award". Spillane starb im Alter von 88 Jahren, am 17. Juli 2006, in South Carolina. Über sein Werk sagte er selbst: "Die Leute sagen, ich schreibe Schund. Ich sehe das auch so - aber es ist guter Schund."
Zwischen Romantik und Multimedia: Kunstlied mehr gefragt

epd-bild/Hans Morren
Frankfurt a.M. (epd). "Ach, ich kann nicht anders, ich möcht mich tot singen wie eine Nachtigall", schrieb Robert Schumann an seine geliebte Clara. Sein produktives "Liederjahr" 1840 steht im Fokus des Festivals "Heidelberger Frühling" im März/April. Die Veranstalter wollen einer Kunstform mehr Geltung verschaffen, die lange als bedroht galt, aber plötzlich zarte Ansätze neuer Lebendigkeit zeigt: dem Lied. Junge Künstler wenden sich ihm wieder stärker zu, auch Festivals öffnen sich, nicht nur in Heidelberg.
Tenor Christoph Prégardien, häufig mit Liedern von Schubert, Schumann wie auch von modernen Komponisten auf der Bühne, ist fasziniert von der "intimen Kunstform", die Poesie und Klang verbindet. Aber er kennt auch das Problem: "Gab es vor 20 Jahren Liedreihen in allen deutschen Großstädten, so sind es heute nur noch einzelne Liederabende", sagt er. Jedoch gebe es auch eine "Gegenbewegung", die mit dem von Initiativen geförderten Singen in Schulen und Kindergärten beginne.
"Junge Bewegung"
"Es gibt eine neue junge Bewegung", sagt auch der Intendant des Heidelberger Festivals, Thorsten Schmidt: Einerseits entstehe das Interesse am Lied durch das eigene Singen, und das nehme wieder zu. Zum anderen dächten junge Künstler über "neue Formate" nach. Und das Lied eigne sich gut für multimediale Präsentationen.
Auch neue Wettbewerbe rücken das Lied wieder stärker in den Fokus. Die Frankfurter Sängerin und Professorin Hedwig Fassbender verweist auf den Grazer Wettbewerb, die Hugo-Wolf-Gesellschaft in Stuttgart und die Deutsche Lied-Akademie in Trossingen. Mit Wettbewerben, die durch Live-Streaming und Mediatheken mehr Zuhörer erreichen könnten, steige auch das Interesse des Publikums, sagt Fassbender: "Das Lied erfreut sich nach einem Dornröschenschlaf wieder wachsender Beliebtheit."
Das Heidelberger Festival hat unter dem Namen "Neuland.Lied" einen Schwerpunkt moderner Liedinterpretation geschaffen. "Darin liegt eine Chance, dass wir das Lied befreien aus der Nische des 'Kunstlieds'", sagt Intendant Schmidt.
Am Anfang war Schubert
Die "Kunstlied"-Nische in den Konzertsälen sah oft so aus: Ein Sänger, ein Flügel, eine meist kleine, gediegene Zuhörerschaft. Neben Prégardien stehen heute Namen wie Christian Gerhaher, Thomas Hampson, Sarah Maria Sun und Christine Schäfer für exzellenten Liedgesang. Das Repertoire reicht von den Romantikern über Brahms, Strauss, Mahler und Wolff bis hin zu Wolfgang Rihm und Aribert Reimann.
Entstanden zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist das Kunstlied aber vor allem mit Franz Schubert verbunden, der rund 660 Lieder komponierte. Seine ein Jahr vor seinem Tod entstandene "Winterreise" (1827) gilt heute als Meilenstein der Gattung - der romantische Liederzyklus schlechthin.
"Im Lied geht es um das zutiefst Menschliche - um Liebe, Tod, unerfüllte Wünsche, Sehnsucht, um Gott und Glauben, um das, was den Menschen im Innersten bewegt", sagt Prégardien. Lied-Hörer müssten innerlich darauf vorbereitet sein, sich einlassen und Emotionalität zulassen können. Auch junge Leute lassen sich nach seiner Erfahrung davon berühren, wenn der Rahmen weniger bildungsbürgerlich steif ausfällt.
Es braucht ein neues Setting, findet der Kölner Gesangsprofessor. Zwei Leute im Frack auf einem Podest, da sei die Hemmschwelle groß. Aber wenn Künstler auf "Tuchfühlung" mit dem Publikum seien, dann komme "emotionaler Impact" zustande. Wichtig sei auch das Gespräch danach, viele Menschen wollten über das Erlebte reden.
"Verknöchert"
Hedwig Fassbender, die im Frankfurter Goethehaus die Reihe "Lied und Lyrik" gestaltet, sieht es genauso: Es sei absolut notwendig, "den etwas verknöcherten klassischen Liederabend-Aufbau zu brechen". Etwas alt-bekannt Wertvolles könne durch die Kombination mit Neuem oder Ungewohntem neu beleuchtet werden. Im Goethehaus lesen Sänger die Gedichte auch vor.
Andere Musiker suchen neue Zugänge zum Lied, indem sie die politische Dimension betonen. So wird gerade die "Winterreise", die oft mit deutscher Innerlichkeit und romantischem Gefühl assoziiert wird, in jüngster Zeit immer wieder in den Kontext von Asyl und Obdachlosigkeit gestellt.
Am Neckar nimmt unterdessen - schneller als erwartet - ein Projekt Gestalt an, das dem Lied weit über die Landesgrenzen hinaus mehr Aufmerksamkeit verschaffen soll: das Internationale Kompetenzzentrum Lied, "Villa Abegg" genannt als Hinweis auf Schumanns "Abegg-Variationen". Derzeit liefen Gespräche über eine Immobilie, sagt der Intendant des "Heidelberger Frühlings", dessen Liedzentrum die Keimzelle des neuen Hauses sein soll. Eine Stifter-Familie habe die Idee mit großer Begeisterung aufgegriffen und ihre finanzielle Unterstützung zusagt.
Aber zunächst steht in Heidelberg "Neuland.Lied" an. Dabei soll es 2018 um "Eigen-Arten" gehen, um Identitäten. Mit Schumann als Gewährsmann und seinen Liedern voller Widersprüchlichkeit, Heimatlosigkeit und Sehnsucht, Angst und Hoffnung.
Wie Facebook, nur anders
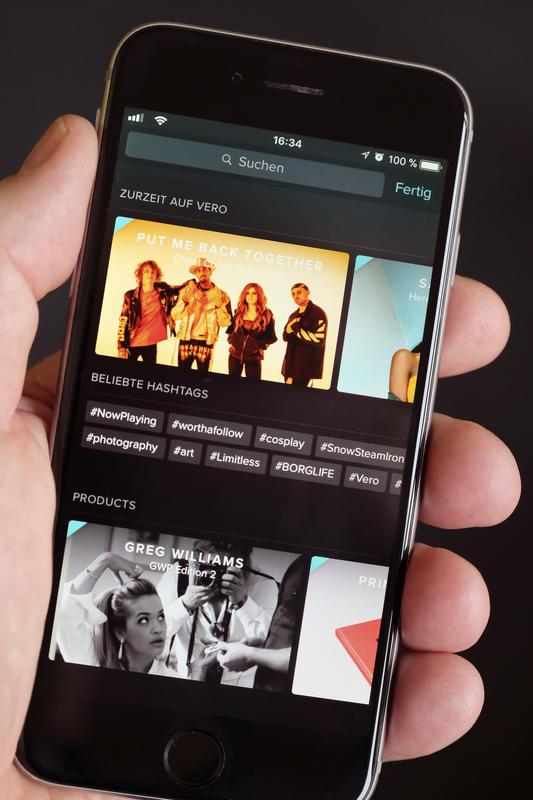
epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit surfen täglich auf Facebook, bei Instagram sind es rund 500 Millionen Nutzer. Das soziale Netzwerk Vero will die Internet-Giganten ablösen: indem es seinen Nutzern verspricht, auf Werbung, selektierende Algorithmen und Datensammelei zu verzichten. "True social", echt sozial, soll das Miteinander im Internet laut Vero wieder werden.
Auch Stephan Röger aus Berlin ist neugierig auf Alternativen zu Facebook und Co - er hat seit circa einer Woche ein Vero-Nutzerkonto. Ihm gefällt, dass das Netzwerk verspricht, sparsamer mit seinen Daten umzugehen. Viel Zeit habe er dort aber noch nicht verbracht, sagt er. "Es rumpelt derzeit noch ziemlich auf Vero. Dass mein Registrierungsprozess funktioniert hat, war mehr oder weniger Zufall."
Plötzlicher Hype
Auf den ersten Blick ähnelt Vero der Foto-Plattform Instagram - nur, dass es einen dunklen grau-grünen Anstrich hat. Wie in den etablierten Netzwerken sollen auch die Vero-Nutzer Postings oder Fotos teilen, die dann in einer Timeline erscheinen - aber in chronologischer Reihenfolge und ohne Unterbrechung von Anzeigen. Jeder kann seine Online-Beziehungen in Gruppen einteilen - unterschieden wird zwischen "engen Freunden", "Freunden", "Bekannten" und "Followern".
Die Smartphone-App gibt es zwar schon seit 2015, aber erst in der vergangenen Woche löste sie einen regelrechten Hype aus: Im Apple App Store und im Google Play Store stand Vero zwischenzeitlich ganz oben in den Charts, auch der Hashtag #Vero trendete bei Twitter. Nach Angaben der Betreiber hat Vero inzwischen eine Million registrierte Nutzer. So viele, dass sogar Gerüchte laut wurden, das Unternehmen hätte prominente Blogger für Werbung bezahlt. Für sie ist Vero ideal - ohne einen Algorithmus werden ihre Posts nicht von denen zahlender Werbekunden verdrängt.
Server überlastet
Scheinbar trifft Vero einen Nerv: Viele Social-Media-Fans haben offenbar kein Interesse mehr an überladenen Werbeplattformen, zu denen sich Facebook und Instagram zunehmend entwickelten. Bei der jungen Generation verliert Facebook sogar drastisch an Bedeutung: Nur noch ein Viertel der zwölf- bis 19-Jährigen nutzt die Plattform regelmäßig, wie aus einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest hervorgeht. Im Jahr 2016 waren es noch 43 Prozent.
Auf Twitter beschweren sich indes viele User über Server-Abstürze bei Vero. Die Betreiber haben offensichtlich nicht mit einem so starken Ansturm gerechnet. Auf ihrer Internetseite entschuldigten sie sich und versprachen, die App als Entschädigung länger kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ursprünglich wollten die Betreiber eine jährliche Gebühr einführen - sobald Vero eine Million Nutzer hat. Die Marke war Ende Februar geknackt worden. Mit dem Abo-Zahlmodell wollen die Erfinder die fehlenden Werbeeinnahmen ersetzen.
Experte skeptisch
Der Kölner Social-Media-Experte Hendrik Unger ist skeptisch, ob sich Vero als soziales Netzwerk etablieren wird. Die App braucht seiner Meinung nach eine Funktion, die Nutzer bislang noch nicht von Facebook oder Instagram kennen. Die Besonderheiten, mit denen Vero werbe, seien nicht neu, erklärt Unger. Auch Facebook sei ohne Werbung und Algorithmus gestartet. Unger vermutet, dass auch Vero bei steigenden Nutzerzahlen nicht ohne eine Art der Sortierung auskommen wird. "Wenn Vero versucht, alle Meldungen der Reihe nach abzubilden, ist vielleicht erst an Platz 349 die spannendste Nachricht des Tages. Aber ich habe keine Lust, immer bis nach ganz unten runterzuscrollen", sagt Unger.
Auch Marleen Wesselmann hat die App installiert - begeistert ist die Studentin aber bislang nicht. Der 22-Jährigem fällt es schwer, eindeutig zwischen Freunden und Bekannten zu trennen. Auch empfindet sie das dunkle Layout von Vero als erdrückend. Gelöscht hat sie die App trotzdem noch nicht. "Ich möchte gucken, wie sie sich bei meinen Freunden verbreitet. Es ist auch ein bisschen Gruppenzwang", gesteht sie.
Doch noch bevor die Seiten bei Vero mit Inhalten gefüllt sind, scheint der Hype wieder abzunehmen. Nachdem Vorwürfe aufkamen, wonach das Familienunternehmen von Vero-Mitgründer Ayman Hariri, ein Milliardär libanesischer Herkunft, seine Mitarbeiter offenbar nicht ausreichend bezahlte, startete bei Twitter eine Protest-Kampagne. Unter dem Hashtag #DeleteVero fordern Twitterer dazu auf, die App wieder zu löschen.
Weniger Beschwerden über Presse wegen Herkunftsnennung
Die Herkunftsangabe bei Verdächtigen in der Presse sorgte vor einem Jahr für heftige Diskussionen in Verlagshäusern. Die für Journalisten geltende Richtlinie wurde daraufhin präzisiert - mit Erfolg, findet der Deutsche Presserat.Berlin (epd). Ein knappes Jahr nach der Änderung der Richtlinie zur Herkunftsnennung in Berichten über Straftaten hat der Deutsche Presserat eine vorsichtig positive Bilanz gezogen. Die Beschwerden über die Erwähnung der Nationalität von Straftätern seien zurückgegangen, sagte der Sprecher des Selbstkontrollorgans, Manfred Protze, am 7. März bei der Vorstellung des Jahresberichts des Presserats in Berlin. Seit der Neuformulierung der Richtlinie im März 2017 bis Dezember 2017 gingen demnach 23 Beschwerden ein, im gleichen Zeitraum 2016 waren es noch 42 gewesen. Protze geht dennoch davon aus, dass die Diskussion um Herkunftsnennungen weitergeht, schon allein weil die Informationspolitik der Polizei andere Standards hat als die Presse.
Am 22. März 2017 hatte der Presserat auf Initiative von Printmedien seine Richtlinie 12.1 im Pressekodex geändert. Sie fordert seitdem statt eines "begründbaren Sachbezugs" ein "begründetes öffentliches Interesse" als Voraussetzung dafür, die Herkunft von Tätern oder Verdächtigen zu erwähnen. Die alte Praxis war vor allem im Zuge der Berichterstattung über die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht 2015/16 in die Kritik geraten. Unter dem Schimpfwort "Lügenpresse" wurden Journalisten beschuldigt, die Herkunft ausländischer Täter bewusst zu verschweigen.
Vorurteile
Ziel der Richtlinie ist es, so formuliert es der Presserat, "Menschen davor zu schützen, für das Fehlverhalten einzelner Mitglieder ihrer Gruppe unbegründet öffentlich in Mithaft genommen zu werden". Belastbare Studien zeigten, dass die Erwähnung der Herkunft Vorurteile schüre, erläuterte Protze. Es sei konkreter Ansatz der Nationalsozialisten gewesen, im Zusammenhang mit Kriminalität bestimmte Gruppen zu nennen. "Das will die deutsche Presse nicht", sagte Protze und betonte, eine substanzielle Änderung der Richtlinie habe es auch mit der Neufassung nicht gegeben.
Vielmehr sollte die Richtlinie seinen Worten zufolge handhabbarer für Redaktionen gemacht werden. Im Mai 2017 formulierte Leitsätze geben nun Anhaltspunkte, wann die Herkunftsnennung vertretbar ist, etwa bei besonders schweren Straftaten oder wenn die Taten aus einer Gruppe heraus begangen werden, die ein bestimmtes Merkmal verbindet. Reine Neugier sei aber kein Grund.
Eine häufigere Nennung von Nationalitäten sei seit der Änderung der Richtlinie nicht festzustellen, sagte Protze dem epd. Weitere Diskussionen erwartet er nach eigenen Worten dennoch durch die inzwischen leicht für jedermann verfügbaren Veröffentlichungen der Polizei. Redaktionen rät er, Entscheidungen über die Weitergabe von Details über Täter oder Verdächtige zu erklären, wenn Leser fragen, warum die Polizei die Herkunft nennt, die Zeitung aber nicht.
21 Rügen
Der Deutsche Presserat als Selbstkontrollorgan der deutschen Presse prüft bei Beschwerden von Lesern oder Institutionen, ob die beanstandete Berichterstattung mit den Regeln des Pressekodex' vereinbar ist. Der Kodex formuliert Standards journalistischer Arbeit und ethischen Verhaltens der Presse.
Dem Jahresbericht zufolge gingen 2017 insgesamt 1.788 Beschwerden ein, etwas weniger als 2016. Zur härtesten Sanktion - der öffentlich zu machenden Rüge - griff der Presserat 21 Mal. 2016 gab es 33 Rügen. Fast die Hälfte der Rügen (neun) erging wegen Verstößen gegen das Gebot der Trennung von Redaktion und Werbung.
Zudem wurden vom Presserat 2017 insgesamt 58 Missbilligungen und 153 Hinweise ausgesprochen. Am häufigsten ging es bei den Sanktionen insgesamt um Verletzungen der Sorgfaltspflicht, gefolgt von Verstößen gegen den Grundsatz der Trennung von Werbung und Redaktion oder das Persönlichkeitsrecht. Abgemahnt wurde beispielsweise die Veröffentlichung der Fotos von Opfern des Terroranschlags in Manchester, die von Facebook stammten oder die in den Augen des Presserats mit einer Prangerwirkung behaftete Darstellung von G-20-Demonstranten in Verbindung mit einem Fahndungsaufruf.
Anwalt: Rösner hat nach "Gladbeck" keine Chance auf Resozialisierung
Aachen (epd). Der Anwalt von Geiselgangster Hans-Jürgen Rösner sieht nach Ausstrahlung des ersten Teils der "Gladbeck"-Verfilmung im Ersten die Resozialisierung seines Mandanten gefährdet. "Die eindimensionale und schablonenhafte Darstellung Rösners verhindert, dass er je resozialisiert werden kann", sagte der Jurist Rainer Dietz am 7. März in Aachen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Rösner sitzt in der Justizvollzugsanstalt Aachen ein und bemüht sich derzeit um Haftlockerungen.
Dietz kritisierte, der Film gebe die Ereignisse von damals ohne jede Reflexion der Täterrollen wieder. "Rösner empfindet diese Darstellung als bedrückend und belastend." Bereits während der Dreharbeiten hatte dieser erfolglos versucht, gegen den Film vorzugehen. "Sowohl das Landgericht Aachen als auch das Oberlandesgericht Köln haben in ihren Entscheidungen erklärt, dass es am Ende auf die konkrete Darstellung unter der zu berücksichtigenden Resozialisierungsmöglichkeit ankommt", sagte Dietz. Rösner werde nach Ausstrahlung des zweiten Teils eine Entscheidung dazu fällen, "ob er den Film aus dem Verkehr ziehen lassen will".
Haftlockerung wird geprüft
Derzeit laufe die Überprüfung für eine mögliche Haftlockerung, seit dem vergangenen November befinde sich Rösner zudem in Therapie. "Nach Einschätzung seines Therapeuten ist es nicht zielführend für Rösner, die Tat, die 30 Jahre her ist, wieder und wieder zu reflektieren", sagte Dietz. Auch Rösner müsse die Chance bekommen, nach vorne zu blicken. "Der ARD-Film verhindert das."
Die beiden "Gladbeck"-Teile liefen am 7. und 8. März im Ersten, der zweite Teil sollte am Donnerstag um 20.15 Uhr folgen. Der Zweiteiler nach dem Buch von Holger Karsten Schmidt wurde von Ziegler Film für die ARD-Produktionstochter Degeto und Radio Bremen unter der Regie von Kilian Riedhof hergestellt. Er erzählt chronologisch von der Geiselnahme in der Gladbecker Bank am 16. August 1988 und von den 54 Stunden danach. Bei der anschließenden zweitägigen Flucht Rösners und seines Komplizen Dieter Degowski durch Deutschland und die Niederlande kamen zwei Geiseln und ein Polizist ums Leben. Rösner und Degowski wurden 1991 zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Degowski ist seit Mitte Februar wieder auf freiem Fuß.
Lesen gehört für Merkel zum "Lebenselixier"
Berlin (epd). Bücher gehören für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum "Lebenselixier": Fünf Tage vor Eröffnung der Leipziger Buchmesse warb sie am 10. März in ihrem wöchentlichen Video-Podcast für das Lesen. Auch in der Zeit der Digitalisierung sei es eine Grundkompetenz, die einem Vieles im Leben erschließe, betonte Merkel.
Es sei sehr traurig, dass 14 Prozent der deutschen Bevölkerung nicht über eine aktive Lesefähigkeit verfügten, erklärte die Kanzlerin. Das beschränke den Radius im täglichen Leben. "Und als Bildungsnation, die wir ja eigentlich sein wollen, dürfen wir das nicht akzeptieren."
"Lesen gehört für mich seit Kindheitstagen mit zu meinem Lebenselixier", sagte Merkel im Gespräch mit dem Berliner Lesepaten Andreas Thewalt. "Und ich beobachte, zum Teil auch mit Sorge, dass heute gar nicht mehr so viel vielleicht gelesen wird." Ausdrücklich dankt die Bundeskanzlerin allen Lesepaten, die Schüler ehrenamtlich ans Lesen heranführen: "Die Lesepatenschaften sind etwas ganz Großartiges."
ZDF-Gottesdienst am Ostersonntag live aus Detmold
Detmold (epd). Am Ostersonntag überträgt das ZDF einen Fernsehgottesdienst live aus Detmold. Der Gottesdienst unter dem Motto "Eine überwältigende Nachricht" beginnt am 1. April um 9.30 Uhr in der Christuskirche, wie die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Detmold-West mitteilte. Die Predigt hält Pfarrerin Stefanie Rieke-Kochsiek. An der Gestaltung sei ein Team von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beteiligt. Ein musikalischer Akzent werde unter der Leitung von Burkhard Geweke durch die Kantorei der Christuskirche gesetzt. Die sonntäglichen Fernsehgottesdienste des ZDF werden von durchschnittlich 700.000 Zuschauern verfolgt.
Entwicklung
Eine Nähmaschine als Starthilfe in unruhigen Zeiten

epd-bild/Christoph Püschner/Diakonie Katastrophenhilfe
Latakia (epd). Im Keller surren 14 Nähmaschinen. Frauen mit Kopftüchern nähen Trainingsanzüge, Westen und Hemden. Ein christliches Hilfswerk betreibt die Werkstatt in einem Gebäude in der Küstenstadt Latakia im Norden Syriens: Gopa-Derd. Das Kürzel steht für Griechisch-Orthodoxes Patriarchat von Antiochien - Abteilung für Ökumenische Beziehungen und Entwicklung. Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt das Hilfswerk.
Weil die Männer bei der Armee oder außer Landes sind, lernen fast nur Frauen in der Näherei von Latakia. Nach mehrmonatiger Ausbildung bekommen sie ein Zertifikat sowie Startgeld für Nähgarn, Stoff und eine Nähmaschine - für die Selbstständigkeit. Die Frauen sollen für ihren Unterhalt selbst sorgen können.
Die Kirche hilft ohne Ansehen der Religion. Die Christen in Syrien brauchen auch das Wohlwollen der anderen Religionsgemeinschaften. Im siebten Kriegsjahr setzen fast nur noch sunnitische Rebellen den Aufstand gegen das Regime fort. Christen, Alawiten und andere scharen sich hinter Diktator Baschar al Assad. Ausländische Mächte befeuern den Krieg. Etwa die Hälfte der 18 Millionen Syrer sind aus ihrer Heimatregion geflohen. Jeder zweite Flüchtling blieb im Land.
Werkstatt in Latakia
Schaajaan A. ist Sunnit. Der junge Mann floh 2011 mit seiner Familie aus Aleppo, leistete Militärdienst und bügelt jetzt in der Werkstatt in Latakia Strass auf T-Shirts und Innenkragen in Trainingsjacken. Der 26-Jährige streicht das Material glatt und presst ein Bügeleisen darauf, schnell und routiniert. In Aleppo hatte Schaajaans Familie ihr eigenes Haus. Mittlerweile lebt er mit seiner Frau und der drei Monate alten Tochter in Latakia zur Miete. Das Gehalt aus der Näherei hat er bitter nötig. Es geht Schaajaan wie vielen anderen Syrern, die ihr Eigentum verloren haben und nun zu hohen Mieten in kleinen Unterkünften hausen.
Der Lehrer Hussam Abu-K., 44, wohnte bis August 2016 mit seiner Mutter in der Kleinstadt Skeilbija nordwestlich von Hama. Die Vier-Zimmer-Wohnung über einem Laden hatte sein Vater gekauft. Dann traf eine Rakete die belebte Verkehrsstraße vor seinem Wohnzimmerfenster, an dem Hussams Onkel stand. Splitter streuten über die ganze Umgebung. Etwas traf den Onkel am Hals, er war sofort tot. Die Wand im hinteren Flur ist heute noch durchsiebt. Nun werden die Schäden beseitigt.
Wohnung renoviert
Hussams Wohnung ist eine von 400, die im Auftrag des griechisch-orthodoxen Hilfswerks in der Region Hama renoviert werden. Arbeiter haben die Wände neu verputzt und im Wohnzimmer nachgemauert. Das Geld kommt von der Diakonie Katastrophenhilfe. Vor allem Alleinerziehenden, Alten, Großfamilien, chronisch Kranken, Mittellosen und akut Gefährdeten wird so geholfen.
In Mhardeh ziehen Handwerker die Schlafzimmerwand einer jungen Frau namens Nermin wieder hoch. Beim Einschlag einer Mörsergranate im Oktober 2017 brach sie sich den Unterarm. Er ist noch immer geschient. Mit ihrem Mann und zwei Kindern bewohnt sie seither das einzige Zimmer, das der Familie geblieben ist.
Nebenan hausen eine alte kleine Frau und ihr zahnloser Mann in einem dunklen Raum. Eine Granate zerstörte Bad und Küche. Nun hocken sie auf ihren Sofas. Im Fernsehen läuft eine arabische Talkshow. Bauarbeiter schleppen Zement durchs Zimmer. Auch das Ehepaar gehört zu den Begünstigten von Gopa-Derd.
75 Kilometer weiter südlich in Homs herrschten von 2011 bis 2014 die Rebellen. Die Altstadt liegt nun weitgehend in Trümmern. In einigen Vierteln stehen nur noch Betongerippe. Der Schutt ist aus den Straßen geräumt. Vereinzelt werden Wohnungen renoviert.
Kein Geld für Herz-OP
Im Wadi al Nasara, dem "Tal der Christen" nördlich der libanesischen Grenze, blieb es dagegen überwiegend ruhig. Viele Flüchtlinge trafen hier ein. Imad B., ein Muslim mit grauem Bart, kam mit seiner Frau und sieben Töchtern aus Homs. Der 58-Jährige fand Arbeit als Wachmann an der Wadi International University. Aber er hat Herzprobleme. Vor dem Krieg war das staatliche Gesundheitssystem kostenlos. Dann brach es zusammen. Wer ärztliche Hilfe braucht, muss in private Kliniken. Und die sind teuer.
Von den monatlich 35.000 syrischen Pfund Gehalt (etwa 55 Euro) brauche er 10.000 für Medizin, sagt Imad. Er hatte einen Herzinfarkt. 200.000 Pfund (315 Euro) habe der Arzt für die Untersuchung verlangt. Tags drauf hieß es: "Wir müssen einen Stent legen - für eine Million syrische Pfund." Imad bekam einen weiteren Infarkt. Er verzichtete auf die Operation und hofft, dass die Tabletten unter der Zunge ihn am Leben halten. Einen Eingriff könnte er nur bezahlen, wenn er finanzielle Hilfe bekommt.
Zwischen Marshall-Plan und fairen T-Shirts

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). So schnell gibt Gerd Müller nicht auf. Als bei den Koalitionsverhandlungen andere Namen für die Leitung des Entwicklungsministeriums auftauchten, meldete der 62-Jährige unmissverständlich seinen Anspruch an. "Ich würd' mich freuen, wenn ich mein eigener Nachfolger würde", sagte der CSU-Politiker vor kurzem in Brüssel. Seit vier Jahren leitet der Bauernsohn aus dem Allgäu das Ressort, das sich mit Landwirtschaft und Fußballplätzen in Afrika wie mit Solarenergie in Indien und Textilarbeiterinnen in Bangladesch befasst. Nun teilte die CSU mit, dass Müller sein Ministerium behalten wird.
In der Flüchtlingsdebatte bezog Müller klar Position: Es sei eine Illusion, zu glauben, dass Europa sich durch Mauern und Grenzen abschotten könne, schrieb der Schwabe auch seinen Parteifreunden ins Stammbuch. Sein Marshall-Plan mit Afrika, der vor allem sogenannte Reformpartnerschaften mit den Ländern und Privatinvestitionen ankurbeln soll, trug ihm die Bezeichnung "Marshall Müller" ein.
Etat aufgestockt
Im Zuge der Flüchtlingskrise erreichte Müller eine deutliche Aufstockung des Entwicklungsetats auf über acht Milliarden Euro (2017). Die Bekämpfung von Fluchtursachen erkor er zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit, während die Opposition ihm allerdings vorhielt, vor allem Mittel umgeschichtet zu haben. Auch mit plakativen Forderungen nach einem EU-Nothilfefonds, einem EU-Flüchtlingskommissar oder einem EU-Afrika-Kommissar erntete er Kritik. Der Grünen-Politiker Uwe Kekeritz spricht von "PR-Manövern ohne Substanz".
Als wichtigen Erfolg wertet Müller das von ihm 2014 initiierte Textilbündnis, das zu besseren Arbeitsbedingungen in Fabriken in Asien führen soll. Nun aber bröckelt der Zusammenschluss, und zu einem Gütesiegel "grüner Knopf" kam es schon gar nicht. Rund 140 Firmen, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen gehören der Initiative an, die auf freiwillige Selbstverpflichtungen setzt. Doch als die Unternehmen sich nun erstmals konkrete Ziele setzen sollten, traten wichtige Firmen aus. Der Geschäftsführer des Textildiscounters KiK, Patrick Zahn, beklagt, dass die Mitglieder nun nicht einmal mehr die Hälfte des deutschen Marktes abdecken.
Nähe zu kirchlichen Hilfswerken
Müller will Weltminister und Zukunftsminister sein, neigt zu plakativen Aussagen, geißelt die "Geiz-ist-geil-Mentalität" und appelliert unermüdlich an die Verbraucher, Kaffee, T-Shirts und Jeans aus fairem Handel zu kaufen. "Jeder trägt Verantwortung auf der Haut", betont der Katholik, der die Nähe zu kirchlichen Hilfswerken sucht. "Wir können unseren Wohlstand nicht länger auf Kosten der Menschen in den Entwicklungsländern leben." Auch boykottierte er die Olympischen Spiele in Brasilien - aus Protest gegen die sozialen und ökologischen Folgen für die Bevölkerung.
Die Opposition hält ihm allerdings vor, dass er sich im Kabinett zu wenig für ein gerechtes Handelssystem mit Entwicklungsländern eingesetzt hat - und sich nicht dagegen sträubt, dass Mittel aus dem EU-Entwicklungsetat für Grenzsicherung zur Flüchtlingsabwehr verwendet werden dürfen.
An Spontaneität fehlt es dem ehemaligen Landwirtschaftsstaatsekretär nicht. So lässt er bei einem Nigeria-Besuch schnell Computer für Schülerinnen organisieren - und in Kolumbien möchte er unbedingt eine Kokapflanze sehen, weil er nicht so genau weiß, wie die aussehen. Launige Selbstironie zeigt er auf dem evangelischen Kirchentag, als er stürmischen Applaus erntet für eine weitere Forderung - nämlich die Globalisierung durch ökologisch-soziale Mindeststandards gerechter zu gestalten: "Ich bin der Entwicklungshilfeminister, ich bin nicht der Redner von Attac."
Präsidentin Michelle Bachelet hinterlässt liberaleres Chile

epd-bild / Gerhard Dilger
Santiago (epd). Die Glückwünsche der Präsidentin ließen nicht lange auf sich warten. "Der Preis erkennt nicht nur einen Film von hoher Qualität an, sondern auch eine Geschichte des Respekts für die Vielfalt", twitterte Michelle Bachelet wenige Minuten, nachdem der chilenische Film "Eine fantastische Frau" mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet worden war. Während ihrer Amtszeit hat sich die 66-Jährige stets für Minderheiten und Frauenrechte starkgemacht.
In dem Film schlagen der jungen Transsexuellen Marina Hass und Ablehnung entgegen. Die Reaktionen zeichnen ein Spiegelbild der stark konservativ geprägten Gesellschaft in Chile. Eine Gesellschaft, die in den vergangenen Jahren nach Einschätzung von Menschen- und Frauenrechtgruppen aber deutlich liberaler geworden ist.
Die rechtlichen Grundlagen für diesen Wandel schuf unter anderen die Mitte-Links-Regierung von Präsidentin Michelle Bachelet. Die Sozialdemokratin führte die Lebenspartnerschaft für Homosexuelle ein, legte ein Gesetz zur sexuellen Identität vor, das aktuell im Kongress diskutiert wird, und schaffte das seit der Diktatur bestehende strikte Abtreibungsverbot ab.
Niedrige Zustimmungswerte
"In diesen vier Jahren hat unser Land einen Weg der Eroberungen eingeschlagen, der sozialen Rechte, die uns erhalten bleiben werden", sagte Bachelet wenige Tage vor Ende ihrer Präsidentschaft. Am 11. März übergab die 66-Jährige das Präsidentenamt zum zweiten Mal an den konservativen Multimillionär Sebastián Piñera und tritt damit als letzte Staatschefin in Südamerika ab.
In der Bevölkerung gilt Bachelets zweite Amtszeit als gescheitert. Ihre Zustimmungswerte sind zuletzt unter 40 Prozent gefallen. Dabei habe die Präsidentin mehr erreicht als viele andere Regierungen vor ihr, sagt der Politikwissenschaftler Claudio Fuentes. Bachelet habe wichtige Strukturreformen wie die Wahl-, die Steuer- und die Bildungsreform angepackt und auf erneuerbare Energien gesetzt. Sie habe den Wertekanon verschoben und Fakten geschaffen, die Nachfolger Piñera nicht einfach wieder rückgängig machen könne. Zumal das Parlament mit dem neuen Parteienbündnis Frente Amplio deutlich nach links gerückt ist.
Kostenlose Hochschulen
Ein Beispiel ist die kostenlose Hochschulbildung: Während Piñera in seiner ersten Amtszeit von 2010 bis 2014 hart gegen Studentenproteste vorging und kostenlose Bildungsangebote noch kategorisch ausschloss, lenkte er während des Wahlkampfes im Dezember ein und kündigte an, die kostenlose Hochschulbildung im Bereich der technischen Studiengänge auszubauen.
Das Gesetz, das Abtreibungen in Ausnahmefällen zulässt, werde er umsetzen, betonte Piñera in einem Interview. Als Präsident sei es seine Pflicht, auch wenn es der eigenen Haltung widerspreche.
Bachelet hinterlässt ihrem Nachfolger aber auch einige unvollendete Projekte und einen wieder aufgeflammten Konflikt. So sei die Präsidentin die vollmundig angekündigte Verfassungsreform schuldig geblieben, erläutert Fuentes. Der Mapuche-Konflikt im Süden von Chile bleibt weiter ungelöst, Forderungen der Ureinwohner nach Anerkennung in der Verfassung wurden nicht berücksichtigt. Stattdessen hat sich die Spirale der Gewalt während des Papstbesuches Anfang dieses Jahres weiter zugespitzt. Es kam zu zahlreichen Angriffen auf Kirchen. Polizei und Militär sind in Korruptionsskandale verwickelt.
Wirtschaftsprogramm
Piñera hat bereits angekündigt, im Mapuche-Konflikt und bei der Neuordnung der Polizei hart durchzugreifen. Er verspricht ein Wirtschaftsprogramm für die Araucanía, das Stammland der Mapuche und eine der ärmsten Regionen Chiles. Der Unternehmer will in den kommenden vier Jahren vor allem das Wirtschaftswachstum wieder ankurbeln und dadurch Arbeitsplätze schaffen. Die Rechte von Minderheiten drohen in den Hintergrund zu treten.
Doch der Oscar für "Eine fantastische Frau" setzt die neue Regierung noch vor ihrem Amtsantritt unter Druck. Das Gesetz zur sexuellen Identität müsse möglichst schnell verabschiedet werden, fordern die Schauspieler und einige Abgeordnete. Doch das künftige Regierungsbündnis Chile Vamos ist sich untereinander nicht einig, auch wenn Piñera sich ebenfalls in die Reihe der Oscar-Gratulanten einreihte.
Brasilien: Ex-Präsident Lula will trotz Verurteilung kandidieren
Es ist ein fast aussichtsloser Kampf, aber der frühere brasilianische Präsident gibt nicht auf. Lula fühlt sich als Opfer einer feindlichen Justiz und strebt ein politisches Comeback an - auch wenn eine Gefängnisstrafe immer näher rückt.São Paulo (epd). Trotz seiner Verurteilung zu zwölf Jahren Haft wegen Geldwäsche und Korruption will Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wieder bei der Präsidentenwahl im Oktober antreten. "Ich werde meine Kandidatur bis zur letzten Konsequenz aufrechterhalten", sagte Lula am 7. März in einem Interview mit Rádio Metrópole in Salvador da Bahia. Er werde weiter dafür kämpfen, "dass Brasilien seinem Volk zurückgegeben wird". Der Oberste Gerichtshof in Brasília hatte zuvor einen Antrag Lulas zurückgewiesen, mit dem der sozialistische Politiker einer Inhaftierung vor der Ausschöpfung aller Rechtsmittel entgehen wollte.
Ein Berufungsgericht in Porto Alegre hatte im Januar in zweiter Instanz eine Revision Lulas zurückgewiesen und die Haftstrafe von neun auf zwölf Jahre und einen Monat erhöht. In dem Verfahren gegen Lula geht es um ein Luxusappartement im Küstenort Guarujá, dass er als Gegenleistung bei der Hilfe von Auftragsvergaben von dem Baukonzern OAS bekommen haben soll. Der Politiker der linksgerichteten Arbeiterpartei PT hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Lulas Anwälte kündigten den Gang vor das Oberste Bundesgericht und damit der letzten Instanz an.
"Politischer Gefangener"
Dem 72-Jährigen droht jetzt nicht nur Gefängnis, sondern auch der definitive Ausschluss von der Wahl. Seit Wochen liegt Lula in Umfragen mit rund 36 Prozent weit vor seinen Kontrahenten. Er kündigte jetzt an, dass er seinen Wahlkampf mit ganzer Kraft fortführen werde. "Ich erwarte, dass es Gerechtigkeit gibt", sagte Lula. "Deshalb trete ich an." Wenn er inhaftiert werde, sei er ein "politischer Gefangener", betonte er.
Die Richter stützten sich in dem Verfahren gegen Lula auf Indizien wie abgehörte Telefonate. Schriftliche Beweisstücke wie etwa eine Kaufurkunde gibt es nicht. Lula und seine Anhänger sprechen deshalb von einem politischen Prozess. Lula betonte vor Gericht, dass er die Wohnung zwar besichtigt und "500 Fehler dort festgestellt" habe. Deshalb habe er sie nicht gekauft und sei auch nie wieder dort gewesen
Lula, der Brasilien von 2003 bis 2010 regiert hatte, hatte nach dem Amtsenthebungsverfahren gegen seine Nachfolgerin Dilma Rousseff sein politisches Comeback angekündigt. In seiner Amtszeit erlebte Brasilien einen Wirtschaftsboom, die Regierung legte zahlreiche Programme gegen Armut und für Landreformen auf.
Terrormiliz verbietet Fußballspiele in Mogadischu
Frankfurt a.M., Mogadischu (epd). In Somalia hat die Terrormiliz Al-Shabaab die Schließung privater Fußballplätze in drei Bezirken der Hauptstadt Mogadischu erzwungen. Die Betreiber von über 20 Spielstätten seien der Anweisung nachgekommen, berichtete der somalische Radiosender Radio Dalsan am 7. März. Zuvor seien Manager mit Anführern der islamistischen Terrorgruppe zusammengetroffen.
Die Miliz Al-Shabaab, die sich als Teil des Terrornetzwerks Al-Kaida versteht, bekämpft die von den Vereinten Nationen unterstützte somalische Regierung und verübt auch in Uganda und Kenia Anschläge. Fußballlokale waren mehrfach Ziel ihrer Attacken. Ende Februar wurden bei zwei Terroranschlägen in Mogadischu mindestens 38 Menschen getötet. Al-Shabaab bekannte sich zu den Bombenexplosionen.
Nach Berichten des britischen Senders BBC veranstaltet Al-Shabaab auch selbst Sportwettbewerbe, um Anhänger zu gewinnen. Dazu gehörten Tauziehen und Bogenschießen.
Die Miliz wurde mit Hilfe der 22.000 Mann starken afrikanischen Eingreiftruppe Amisom zwar aus Mogadischu und anderen Landesteilen vertrieben, attackiert aber weiter. Beim bislang schwersten Anschlag waren im Oktober 2017 etwa 500 Menschen ums Leben gekommen.
Ausland
UN: Diskriminierung, Verfolgung und Gewalt in 50 Ländern

epd-bild/privat
Genf (epd). Die Vereinten Nationen haben schwerwiegende Verstöße gegen die Menschenrechte in rund 50 Staaten angeprangert. Die Liste der Länder mit zum Teil gravierenden Verbrechen reiche von Syrien über die Demokratische Republik Kongo bis Nordkorea, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Ra'ad al-Hussein, am 7. März in Genf.
Der Jordanier kritisierte in seinem Jahresbericht ebenso EU-Staaten wie Ungarn, Polen und Tschechien sowie auch die USA für eine Politik, die gegen Ausländer gerichtet sei und auf Abschottung setze. Er forderte die chinesische Führung auf, die Grundfreiheiten der Bürger nicht weiter massiv einzuschränken. Besonders scharf prangerte Seid vor dem UN-Menschenrechtsrat das Regime des Gewaltherrschers Baschar al-Assad in Syrien an, das für eine sich abzeichnende Apokalypse in dem Bürgerkriegsland die Hauptverantwortung trage.
400.000 Tote
Laut dem Hochkommissar wurden in Syrien seit Beginn der Kämpfe 2011 mehr als 400.000 Menschen getötet. Mehr als eine Million Kinder, Frauen und Männer seien verletzt worden und elf Millionen seien auf der Flucht. Besonders dramatisch sei die Lage in den belagerten Gebieten wie Ost-Ghuta. Das Assad-Regime sei für die Abschnürung und das Aushungern der meisten Territorien verantwortlich.
Als weitere Länder, in denen Menschen unterdrückt, verfolgt und Opfer von Gewalt seien, nannte Seid Libyen, den Jemen, Afghanistan, den Südsudan und Burundi. Im Iran würden Menschen zum Tode verurteilt für Verbrechen, die sie mutmaßlich als Kinder verübt hätten. Der UN-Hochkommissar prangerte ebenso die Vertreibung Hunderttausender Angehöriger der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem buddhistisch geprägten Myanmar an. Die Menschen harrten nun unter erbärmlichen Umständen in Bangladesch aus.
Der UN-Funktionär beschuldigte skrupellose Politiker für viele der Verbrechen. Diese Art von Menschen machten sich überall auf der Welt breit, sagte Seid. Der Typus, der schwach im Geiste sei und Menschlichkeit nicht kenne, schüre Intoleranz unter den Bürgern und spalte die Gesellschaften.
Lutheraner in den USA für Schusswaffenkontrolle
Washington (epd). Die Bischöfe der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika (ELKA) haben ihre Unterstützung für geplante nationale Kundgebungen für Schusswaffenkontrolle zum Ausdruck gebracht. Man stehe in Solidarität mit den Kindern und Jugendlichen, erklärte die Konferenz der ELKA-Bischöfe am 6. März. Die ELKA ist die größte lutherische Kirche in den USA. Schüler der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland in Florida haben nach dem Massaker an ihrer Schule am 14. Februar zu Kundgebungen gegen Waffen aufgerufen.
Die Hauptkundgebung ist für den 24. März in Washington geplant. Erwartet werden bis zu 500.000 Teilnehmer. Weitere Demonstrationen sollen in mehr als 400 Orten stattfinden. Bei den Kundgebungen soll unter anderem ein Verbot von Sturmgewehren gefordert werden. Am 14. Februar hatte ein schwer bewaffneter 19-Jähriger in Parkland 14 Schülerinnen und Schüler und drei Lehrer erschossen.
Deutsche Flaschenpost nach 132 Jahren in Australien entdeckt
Hamburg (epd). In Australien ist eine alte Flaschenpost entdeckt worden, die vor 132 Jahren von einem deutschen Schiff ins Meer geworfen wurde. Am Strand von Wedge Island, 180 Kilometer nördlich von Perth im Westen Australiens, hat ein Ehepaar am 21. Januar eine Flaschenpost der Deutschen Seewarte entdeckt, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am 6. März in Hamburg mit. Die Flasche war am 12. Juni 1886 von dem deutschen Hochseefrachter "Paula" 900 Seemeilen vor der Küste zur Erkundung von Meeresströmungen dem südindischen Ozean übergeben worden.
Auf dem Zettel der Flaschenpost ist als Ort für die Übergabe ans Meer "32° 49‘‘ S und 105° 25‘‘ O" vermerkt. Die "Paula" war auf dem Weg von Cardiff (Großbritannien) nach Makassar (Indonesien). Um die Mittagszeit am 12. Juni 1886 befand sie sich auf diesen Koordinaten. Der Kapitän hat im Journal "Stromflasche über Bord" vermerkt. Die Schrift in der Flaschenpost ist identisch mit seiner Schrift im Journal. Die Flasche wurde um 1880 in den Niederlanden produziert und enthielt ursprünglich Gin oder Schnaps.
Flaschenfindezettel
Erste wissenschaftliche Meeresforschungen mit verschlossenen Flaschen fanden 1786 zeitgleich in der Biscaya-Bucht und vor der US-Küste statt. Die Flaschen enthielten sogenannte Flaschenfindezettel, auf denen die genaue Zeit und die Lage des Ortes vermerkt waren, an dem die Flaschenpost ins Meer geworfen wurde. Der Flaschenfindezettel forderte meist in mehreren Sprachen auf, Ort und Zeit des Fundes zu vermerken und den Zettel an das hydrographische Institut des Landes oder eine diplomatische Einrichtung zu übergeben.
In Deutschland führte Georg von Neumayer, Direktor der Deutschen Seewarte, 1864 die Flaschenpost als wissenschaftliches Hilfsinstrument zur Untersuchung von Strömungen ein. Ab 1887 waren deutsche Schiffe verpflichtet, Flaschenpost an die Meere zu übergeben.
Mit rund 660 zurückgesandten Briefen beherbergt das Hamburger Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die wahrscheinlich größte Flaschenpostsammlung der Welt. Darunter befindet sich neben zahlreichen Flaschenfindezetteln aus der Zeit der Deutschen Seewarte auch die älteste von Georg von Neumayer 1864 dem Meer übergebene Flaschenpost. Die jetzt entdeckte Flasche soll im Western Australien Museum in Perth ausgestellt werden.
Bekanntgegeben wurde der Fund beim Hamburger Senatsempfang zu Ehren der Gründung der Norddeutschen Seewarte vor 150 Jahren. Die Gründung gilt als Start der maritimen Dienste in Deutschland.

