Kirchen
Ökumenischer Kirchentag: "Wir halten uns an die Regeln"

epd-bild/Heike Lyding
Frankfurt a.M. (epd). Er findet statt - aber ganz anders als ursprünglich geplant: Die Organisatoren des Ökumenischen Kirchentags arbeiten mit Hochdruck an Hygiene- und Abstandskonzepten.
epd: Ist es da nicht äußerst riskant, eine Großveranstaltung für 30.000 Menschen im kommenden Frühjahr zu planen?
Bettina Limperg: Wir haben es uns ganz gewiss nicht leicht gemacht. Alternativ hätten wir den 3. Ökumenischen Kirchentag absagen oder ein rein virtuelles oder "Kongress"-Format planen können. Aber nach allem, was wir heute wissen, auch nach Beratung mit Virologen und Medizinern, können wir die Veranstaltung so verantworten. Nach diesem Kenntnisstand und in engem Kontakt mit den beteiligten Behörden können wir ein Programm für 30.000 Personen in Frankfurt und der Region anbieten. Uns ist vollkommen klar, welche Verantwortung wir damit übernehmen. Wir werden den Kirchentag in Frankfurt am Main nur dann tatsächlich veranstalten, wenn wir dieser Verantwortung auch im Mai 2021 noch gerecht werden können.
Thomas Sternberg: Mir ist wichtig, dass wir den Ökumenischen Kirchentag unter Corona-Bedingungen neu denken. Ich sehe auch die Chance für neue Formate, die wir jetzt entwickeln. Die Abläufe für die in Frankfurt geplanten Gottesdienste werden wir in ganz Deutschland verbreiten. Dann können Gemeinden vor Ort wie auf den Kirchentag ökumenisch mitfeiern. Das Frankfurter Ereignis kann dann nicht nur privat und einsam in den eigenen vier Wänden, sondern auch in Gemeinschaft miterlebt werden.
epd: Von Kirchentagen sind wir volle Hallen mit Warteschlangen davor gewöhnt. Wie stellen Sie sicher, dass das nicht eintritt und sich niemand infiziert?
Sternberg: Wir werden nicht leichtfertig sein. Wir werden keine Regeln überschreiten. Wir wollen einen Kirchentag in öffentlicher und politischer Verantwortung. Auf die Impfung werden wir nicht vertrauen können. Aber verlässliche Schnelltests könnten für uns mitentscheidend sein.
Limperg: Die Experten sagen uns, dass Schnelltests Großveranstaltungen unterstützen könnten. Sie sind eines der vielen Mosaiksteine unseres Konzepts. Der Vorteil dieser Tests ist, dass das Ergebnis in weniger als einer Stunde verfügbar ist. Das könnte die Planungen wesentlich erleichtern, wenn wir an internationale Gäste, Podiumsteilnehmende oder auch die Gemeinschaftsquartiere denken.
epd: Gibt es Konzepte, wie man die Besucher besser lenken kann?
Limperg: Ja, wir arbeiten intensiv an diesen Themen, die ja auch Teil der Genehmigungsverfahren unseres Hygienekonzepts sind. Es wird Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen geben, und wir werden Teilnehmerzahlen immer wieder begrenzen müssen. Natürlich werden niemals 30.000 Menschen an einem Platz sein, sondern sie verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet und die Region. Der Kirchentag wird dezentraler und hybrid. Das heißt, an einer Veranstaltung können Tausende Menschen teilnehmen, aber nur 500 von ihnen sind vor Ort, und viele andere sind digital zugeschaltet - und zwar nicht in digitaler Einsamkeit, sondern vielleicht aus einem Gemeinderaum in München, einem Krankenhaus oder einem Altenpflegeheim. Auf diese Weise könnten auch Menschen teilhaben, die sonst gar nicht kommen könnten.
epd: Kann unter diesen Bedingungen überhaupt die heimelige und teils mitreißende Atmosphäre von Kirchen- und Katholikentagen entstehen?
Sternberg: Natürlich bleibt ganz viel auf der Strecke. Wir geben uns ja nicht mal mehr die Hand - das einfachste Zeichen europäischer Kultiviertheit und gegenseitiger Höflichkeit.
Limperg: Es wird nicht die enggedrängten, singenden Massen geben. Aber: Hygienestationen, 1,50 Meter Abstand und Mund-Nasenschutz sind immer noch besser als eine Videokonferenz. Es wird eine neue Form von Gemeinschaft geben. Sich zu begegnen, tut uns einfach gut. Wir sehen, dass die Menschen das starke Bedürfnis nach Gemeinschaft haben. Und auch wenn gerade etwa Familienfeiern in der Kritik stehen: Sie zeigen genau dieses Moment. Für diese Gefühle und Bedürfnisse wollen wir Angebote schaffen - die wir zugleich mit Disziplin und Vorsorge begleiten werden.
epd: Egal, ob es um das Thema Sterbehilfe oder Schwangerschaftskonflikte geht, die evangelische und katholische Kirche tun sich momentan schwer, gemeinsame Positionen zu finden. Welches Zeichen für die Ökumene setzt dieser Kirchentag?
Limperg: Unser Leitwort lautet "schaut hin". In der Vergangenheit war ein Vorwurf an Kirchentage, dass es kaum Kontroverse gibt. Wir werden natürlich auch über strittige Dinge reden. Das ist beispielsweise die Sterbehilfe, und es ist auch das unterschiedliche theologische Verständnis der Mahlfeier. Wir wollen nicht nur dahin schauen, wo es schön ist, sondern auch dahin, wo es etwas zu besprechen gibt.
Sternberg: Es ist gut, wenn wir 2021 das Zeichen senden, wir diskutieren nicht nur über uns selbst, sondern wissen um unseren gemeinsamen christlichen Auftrag, die Welt mitzugestalten - angefangen beim Kampf gegen den Klimawandel, der Finanzordnung, Strukturen der Macht, beim Schutz der Demokratie und weltweiter Gerechtigkeit. Ich habe den Eindruck, dass wohl auch unsere ökumenischen Kirchentage dafür gesorgt haben, dass Katholikentage längst viel evangelischer und evangelische Kirchentage viel katholischer geworden sind.
epd: Bei der eucharistischen Gastfreundschaft hat die jüngste Intervention aus dem Vatikan zu einer Vertagung der Entscheidung in der Bischofskonferenz geführt. Wird es die eucharistische Gastfreundschaft auf dem Kirchentag wirklich geben?
Limperg: Wir gehen davon aus, dass wir die beschlossenen Konzepte umsetzen. Wir freuen uns sehr darauf. Das ist ein großer Schritt in der praktischen, gelebten Ökumene und in der Sichtbarkeit unserer Gemeinsamkeiten. Es war uns immer klar, dass das Themen sind, die vielleicht theologisch noch nicht zu Ende diskutiert sind. Wir sind aber auch nicht "die" Kirche, wir sind vor allem Laienbewegungen. Und: Wir stellen eine Gewissensprüfung in den Mittelpunkt, die für alle Christinnen und Christen immer eine wichtige Instanz sein sollte.
Sternberg: Der Vatikan hat gesagt, dass das Papier des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen "Gemeinsam am Tisch des Herrn" theologisch nicht ausreicht. Das heißt für mich, dass ich mich bei meiner Gewissensentscheidung beim 3. Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt nicht auf dieses Papier berufen werde. Wir werden aber natürlich für den ÖKT bei unserer Konzeption bleiben.
epd: Herr Sternberg, würden Sie unter den gegenwärtigen Bedingungen im Mai an einer evangelischen Abendmahlsfeier teilnehmen?
Sternberg: Ich möchte das im Moment nicht beantworten. Die Fragen, die da diskutiert werden, sind keine Petitessen. Aber jeden Sonntag müssen Tausende konfessionsverbundene Familien die Entscheidung treffen, welcher Gottesdienst besucht wird. Denen ist nur sehr schwer verständlich zu machen, wie die Feinheiten katholischen und evangelischen Amtsverständnisses aussehen.
epd: Kirchentag unter Corona-Bedingungen: Macht Ihnen Ihre Aufgabe unter den aktuellen Umständen eigentlich Spaß?
Limperg: Es ist ein hartes Stück Arbeit und macht nicht immer Spaß. Uns drückt beide die Verantwortung, und das wird in den nächsten Monaten auch so bleiben. Wir haben aber ein ganz starkes Team. Es ist auch wieder schön, wenn man gemeinsam auf dem Berg steht und den Horizont sieht, nachdem der Nebel sich aufgelöst hat. Es macht mir Freude, weil dieser Kirchentag gerade in dieser Zeit so unbedingt lebensrelevant ist.
Sternberg: Es macht auch deshalb nicht immer Spaß, weil hier zwei Apparate und zwei Traditionen aufeinandertreffen. Hinter den Kulissen ist auch unter Personen, die sich gut verstehen, viel Abstimmung nötig. Mir macht es vor allem wieder mehr Spaß, wenn wir uns endlich wieder physisch treffen können.
Bischöfe haben Vorbehalte gegen eucharistische Gastfreundschaft

epd-bild / Stefan Arend
Bonn, Hannover (epd). Führende katholische und evangelische Bischöfe haben weiter Vorbehalte gegen die eucharistische Gastfreundschaft zum jetzigen Zeitpunkt. In dieser Hinsicht bedürfe es noch weiterer Klärung, hieß es in einem am 6. Oktober von der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlichen Dokument zum Prinzip der wechselseitigen Öffnung von Eucharistie und Abendmahl für Christen anderer Konfessionen. Diese hatten evangelische und katholische Theologen im vergangenen Jahr vorgeschlagen.
Der Ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen hatte im September 2019 sein Votum mit dem Titel "Gemeinsam am Tisch des Herrn" veröffentlicht, das sich für eine mögliche Teilnahme von Protestanten an der katholischen Eucharistie und Katholiken am evangelischen Abendmahl ausspricht, ohne dass konfessionelle Unterschiede geleugnet würden. Das Prinzip der sogenannten eucharistischen Gastfreundschaft wird vor allem mit Blick auf den 3. Ökumenischen Kirchentag im Mai 2021 in Frankfurt am Main diskutiert.
Sichtbares Zeichen der Kirchentrennung
In Abendmahl und Eucharistie erinnern Christinnen und Christen aller Konfessionen an den Tod Jesu am Kreuz und seine in der Bibel beschriebene Auferstehung - und damit an die zentrale Botschaft der christlichen Religion. Dass Protestanten und Katholiken nicht gemeinsam Abendmahl feiern können, ist das sichtbare Zeichen für die Kirchentrennung seit der Reformation.
Die jetzt veröffentlichte Stellungnahme von Bischofskonferenz und EKD würdigt das Votum des Arbeitskreises als "theologisch kenntnisreichen und differenzierten Beitrag". Das Votum werfe aber auch theologische Fragen auf. Die Tragweite der Fragen werde von evangelischer und katholischer Seite unterschiedlich bewertet. Für die katholische Kirche seien die offenen Fragen so gewichtig, dass sie sich nicht in der Lage sehe, vor deren Klärung eine wechselseitige Teilnehme generell zu erlauben. Für die evangelische Seite sei das gemeinsame Taufverständnis die Grundlage für die Einladung zum Abendmahl.
Skepsis im Vatikan
Die Bischöfe schreiben aber in ihrer Stellungnahme, die auch vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und vom Ratsvorsitzenden der EKD, Heinrich Bedford-Strohm, verfasst wurde, dass das Votum eine Grundlage für die "individuelle Gewissensentscheidung einzelner Gläubiger" sein könne, wechselseitig zur Eucharistie und zum Abendmahl zu treten.
Die Stellungnahme von DBK und EKD wurde bereits im Mai verfasst, aber erst jetzt veröffentlicht. Die Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz hatte Ende September in Fulda eine Entscheidung darüber vertagt, weil der Vatikan theologische Zweifel an dem Votum der Theologen geäußert hatte. Daraufhin hatte Bätzing angekündigt, die Stellungnahme von DBK und EKD zu veröffentlichen.
Friedenspreis an Marx und Bedford-Strohm verliehen

epd-bild/Annette Zoepf
Augsburg (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat zusammen mit Kardinal Reinhard Marx am 10. Oktober den Augsburger Friedenspreis erhalten. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck würdigte beide als "Vorbilder ökumenischer Verständigung" und als "Vorbilder im Sinne von Haltung, im Sinne von Grundwerten, im Sinne von Orientierung". Die Bischöfe seien durch ihre christlichen Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit und Hoffnung über konfessionelle Unterschiede hinweg miteinander verbunden.
Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, die Preisträger zeigten in ihrem "Aufeinander zugehen" etwas, von dem man auch außerhalb des kirchlichen Kontextes lernen könne. Sie konzentrierten sich "auf das, was verbindet und nicht auf das, was trennt". Damit setzten sie nicht nur für das Miteinander der Konfessionen ein Zeichen, "sondern auch für unsere Demokratie", sagte Weber.
"Einheit höher stellen als Zerrissenheit"
Bedford-Strohm sagte, die Auszeichnung sei für ihn eine "große Freude, große Ehre". Er sei überzeugt, dass "die Religionen, dass die christliche Religion in der ersten Reihe stehen müssen, wenn es um das Engagement für den Frieden geht - innen wie nach außen". Die Kirchen könnten nur glaubwürdig nach außen wirken, wenn sie eigene traditionelle Abgrenzungen überwänden. Spätestens seit den Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zu 500 Jahre Reformation im Jahr 2017 sei ihm klargeworden, dass Kirche - wenn sie ihren Auftrag ernst nehme - "nur einen ökumenischen Weg" gehen könne, sagte der Theologe, der auch bayerischer Landesbischof ist.
Marx sagte, es falle ihm als gebürtigen Westfalen grundsätzlich eher schwer, ein Lob anzunehmen - auch wenn man es trotzdem gerne höre: "So ein Lob trifft einen Nerv, dass man unsicher wird." Er habe die lobenden Worte Gaucks "eher als Ermutigung verstanden", weiter so zu machen wie bislang. Der Münchner Erzbischof betonte, zur Ökumene brauche es den Willen, "die Einheit höher zu stellen als die Zerrissenheit". Man dürfe "nicht die Fehler des anderen und die Haare in der Suppe der Vergangenheit" suchen, sondern vielmehr das Verbindende.
"Werden nicht locker lassen"
Marx sagte dem Sender Bayern2 zur Absage des Vatikans an das gemeinsame Abendmahl von Katholiken und Evangelischen, es sei mühsam - er sei aber guter Hoffnung, das gemeinsame Abendmahl noch zu erleben. Bedford-Strohm zeigte sich in dem gemeinsamen Interview enttäuscht über die römische Absage. Man sei hier aber noch nicht am Ende: "Wir werden nicht locker lassen, das kann ich versprechen."
Gauck sagte in seiner Laudatio, die Preisträger machten in ihrem ökumenischen Bemühen immer wieder deutlich, dass unterschiedliche Ansichten und Glaubensüberzeugungen einem vernünftigen Dialog, einem friedlichen Miteinander niemals im Wege stehen müssen. Zwischen Bedford-Strohm und Marx sei dabei etwas ganz Beglückendes geschehen: eine persönliche Freundschaft, die auf Vertrauen und theologischer Wertschätzung basiere. Das zeige, dass die Ökumene zwischen den Kirchen lebt.
Bedford-Strohm und Marx sind langjährige Weggefährten: Seit 2008 ist Marx Erzbischof von München und Freising, 2011 wurde Bedford-Strohm bayerischer evangelischer Landesbischof. Und auch auf Bundesebene bildeten die zwei Kirchenmänner jahrelang ein enges ökumenisches Duo: Von 2014 bis 2020 war Marx Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bedford-Strohm ist seit 2014 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Preisgeld an Sant'Egidio
Der mit je 12.500 Euro pro Preisträger dotierte Friedenspreis wird seit 1985 alle drei Jahre von der Stadt Augsburg und der Landeskirche für Verdienste um ein tolerantes und friedvolles Miteinander von Kulturen und Religionen vergeben. Marx und Bedford-Strohm kündigten an, ihr Preisgeld der "ökumenisch offenen" Laienbewegung Sant'Egidio für deren Alten- und Obdachlosenarbeit in Bayern zu spenden.
Unter den Trägern des Augsburger Friedenspreises waren der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker und der Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow. Der Preis wird im Rahmen des Augsburger Friedensfestes verliehen. Es wurde von den Augsburger Protestanten 1650 erstmals zum Dank an den Westfälischen Frieden von 1648 begangen.
Ehrung für lippischen Kirchenrat Arno Schilberg
Detmold (epd). Die lippische Kirche hat Kirchenrat Arno Schilberg anlässlich seines 60. Geburtstags und der inzwischen mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Juristischer Kirchenrat der Landeskirche mit einer Festschrift geehrt. Sie ist in der Publikationsreihe "Kirche und Recht“ unter dem Titel "Veränderungen in der Kirche gestalten" mit Beträgen von renommierten Wissenschaftlern und Kirchenvertretern erschienen, wie die lippische Kirche am 6. Oktober in Detmold mitteilte. Schilberg ist Mitherausgeber der überkonfessionellen Zeitschrift.
Der lippische Landessuperintendent Dietmar Arends würdigte in einer Feierstunden in der Detmolder Erlöserkirche den leitenden Juristen. "Wir können uns als Lippische Landeskirche glücklich schätzen, einen so versierten und ausgewiesenen Juristen als Kirchenrat in unserer Mitte zu haben", sagte Arends. Schilberg sei ein "Jurist mit Leidenschaft, auch als Wissenschaftler". So halte der promovierte Jurist seit 2018 als Honorarprofessor der juristischen Fakultät der Ruhruniversität Bochum gemeinsam mit seinem katholischen Kollegen Burkhard Kämper Vorlesungen zum Religionsverfassungsrecht und zum Kirchenrecht.
Innerhalb der Landeskirche habe sich die Verwaltung unter der Leitung von Schilberg in den vergangenen 20 Jahren zu einer Service-Einrichtung für die Kirchengemeinden entwickelt, sagte Arends weiter. "Daran haben alle im Landeskirchenamt mit viel Kollegialität und Engagement mitgearbeitet", betonte Schilberg in seiner Danksagung. Er wünsche sich, noch einige Jahre gemeinsam mit allen Weggefährten unterwegs zu sein, ganz im Sinne von "Gottes wanderndem Volk".
Die Feierstunde wurde den Angaben nach musikalisch von den Kirchenmusikdirektoren Burkhard Geweke an der Orgel und Christian Kornmaul an der Trompete gestaltet. Unter den Gästen war unter anderem der Chefredakteur der evangelischen Monatszeitschrift "zeitzeichen", Reinhard Mawick. Er gab mit einem Impulsvortrag über "Evangelische Kirche und Corona: Mediale Resonanzen" einen Eindruck über die mediale Wahrnehmung von Kirche in den vergangenen Monaten, wie es hieß.
Ulmer Münster will im Advent keinen "schwarzen" König zeigen

epd-bild/Evang. Dekanatamt Ulm
Ulm (epd). Im Ulmer Münster wird dieses Jahr vor Weihnachten nicht wie üblich die Krippe mit den "Heiligen Drei Königen" aufgestellt. Damit sollte eine der Figuren, der schwarzhäutige König Melchior, aus einer möglichen Rassismusdebatte genommen werden, sagte der Ulmer evangelische Dekan Ernst-Wilhelm Gohl dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 5. Oktober. Einen entsprechenden Beschluss, die Krippe in einer anderen Variante zu zeigen, habe der Kirchengemeinderat in seiner jüngsten Sitzung getroffen.
Gohl erläuterte, der von einem Künstler vor rund 100 Jahren gestaltete Ulmer Melchior sei eine Besonderheit in mehrfacher Hinsicht. Er sei vermutlich der einzige heilige König mit Brezel in der Hand. Gleichzeitig sei er so geschaffen, dass er rassistisch geprägte Stereotype anspricht mit seinen wulstigen Lippen, seiner Körperfülle und seinem Goldreifen an den nackten Fußknöcheln.
Öffentliche Diskussion
Die historische Krippe wurde vor rund 30 Jahren gestiftet mit der Auflage, sie jährlich ab 1. Advent im Münster auszustellen. Gohl unterstrich, dass es bei der Krippenaufstellung nicht darum gehe, den schwarzen König zu unterschlagen. Infrage stehe die Art der Darstellung. Wie mit dem Ulmer Melchior künftig umgegangen wird, soll trotz des vorzeitigen Aufsehens erst nach Weihnachten und in Ruhe öffentlich diskutiert werden, kündigte der Dekan an.
Dramaturg erzählt Bibel mit Playmobil-Figuren auf Youtube

epd-bild/Klaus Wankmiller
Frankfurt a.M. (epd). Der Literaturwissenschaftler Michael Sommer will binnen eines Jahres die Geschichten der Bibel auf Youtube nacherzählen. Die Darsteller sind dabei Playmobilfiguren. 66 Videos sollen entstehen, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 6. Oktober in Frankfurt am Main mit. Sommer ist für seinen Youtube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" bekannt, auf dem er Klassiker der Literatur mit Playmobilfiguren als Kurzversion nachspielt. Beliebt sind die Videos vor allem bei Schülern. Der Dramaturg erhielt 2018 für seinen Kanal den Grimme Online Award.
Das evangelische Contentnetzwerk "yeet" hat Sommer nun als neuen Sinnfluencer gewonnen. Das erste Video wurde binnen zwei Tagen bereits fast 7.000 Mal abgerufen. Es erzählt das 1. Buch der Bibel, das 1. Buch Mose, angefangen bei der Schöpfungsgeschichte, Adam und Eva, Abraham und Jakob bis hin zu Josef in Ägypten. Kuratiert werden die Videos durch die Redaktion des Internetportals "evangelisch.de", das zum GEP gehört. Die Videos sollen montags auf dem Youtube-Kanal "Sommers Weltliteratur to go" online gehen.
Das GEP mit Sitz in Frankfurt am Main ist das zentrale Medienunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Neben "evangelisch.de" und "yeet" trägt es unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) sowie die Redaktion des evangelischen Magazins "chrismon" und organisiert die Rundfunkarbeit der EKD.
Papst Franziskus erhält Seite aus "Amsterdam Machsor"

epd-West/ Wallraf-Richartz-Museum
Köln (epd). Papst Franziskus hat den Nachdruck einer Seite aus dem jüdischen Manuskript "Amsterdam Machsor" erhalten. Abraham Lehrer, Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, habe dem Papst den Druck aus dem hebräischen Manuskript aus dem 13. Jahrhundert vor rund einer Woche bei seiner Reise nach Rom überreicht, erklärte der Landschaftsverband Rheinland (LVR) am 6. Oktober in Köln. Das Dokument ist ein besonderes Zeugnis jüdischer Kulturgeschichte des Rheinlands und wird künftig im Jüdischen Museum im Archäologischen Quartier Köln "MiQua" ausgestellt.
Lehrer, der auch Vorstand der Synagogengemeinde Köln ist, war Teil der Rom-Delegation um den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Bei dem Papstbesuch wurde den Angaben zufolge unter anderem über jüdisches Leben in Deutschland und antisemitische Tendenzen in der Gesellschaft gesprochen, aber auch über das Gedenkjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" 2021.
Der "Amsterdam Machsor" stellt den spezifischen Kölner Ritus zu den jüdischen Feiertagen dar und zählt zu den ältesten noch erhaltenen hebräischen illuminierten Manuskripten im deutschsprachigen Raum. Das Manuskript wurde 2017 durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) und das Joods Historisch Museum Amsterdam mit Unterstützung verschiedener Stiftungen und Sparkassen erworben.
Nach der Fertigstellung des archäologischen Quartiers "MiQua" in der Kölner Altstadt in den kommenden Jahren soll der Machsor in der Dauerausstellung des Museums als Herzstück der Sammlung gezeigt werden. In dem vom LVR getragenen Museum soll die 2.000-jährige Geschichte Kölns und damit auch die Geschichte der Juden am Ort und in der Region beleuchtet werden.
Echte Reue oder Ergebnis einer Erpressung?
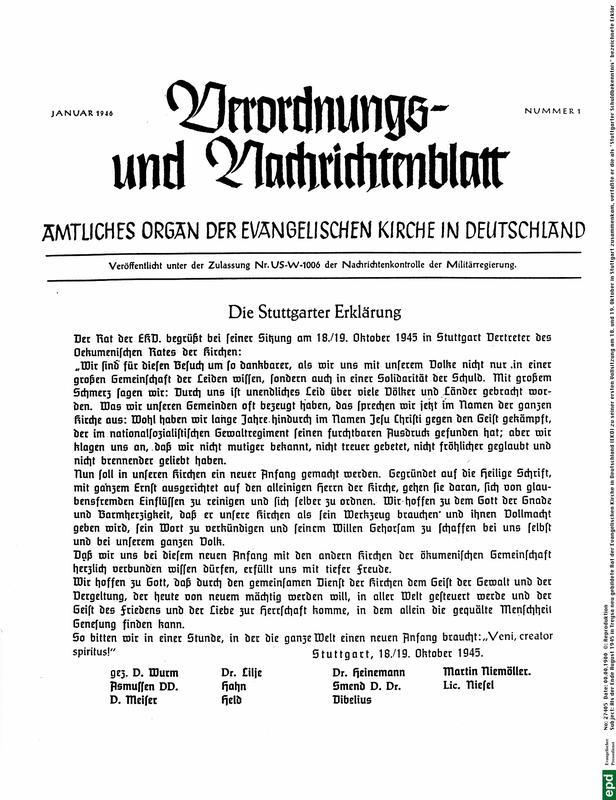
epd-bild
Stuttgart (epd). Deutschland, 1945. Die Städte liegen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern, die braunen Parolen vom "Endsieg" sind verhallt. Wie soll die evangelische Kirche auf diesen Zusammenbruch reagieren - eine Kirche, die sich in großen Teilen mit der nationalsozialistischen Sache gemein gemacht hat? Am 19. Oktober 1945 unterzeichnen protestantische Bischöfe und Kirchenpräsidenten in Stuttgart ein Schuldbekenntnis, das einen Neuanfang signalisiert. Damit ernten sie vor 75 Jahren einen Sturm der Entrüstung.
"Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden", heißt es in dem Dokument. "Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben." Zu den Unterzeichnern gehören amtierende und spätere Landesbischöfe sowie der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann. Verfasst wurde das Papier von Mitgliedern des Rats der neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Christian Asmussen, Otto Dibelius und Martin Niemöller.
Der Kirchenhistoriker Gerhard Besier betrachtet das Papier als das Ergebnis einer Erpressung. Hochrangige Kirchenvertreter aus Ländern, gegen die kurz zuvor noch Krieg geführt worden war, hatten sich nach Stuttgart aufgemacht, um die Beziehungen zu den evangelischen Kirchen wieder aufzunehmen. Die weltweiten Ökumene-Partner hatten laut Besier vorher deutlich gemacht, dass es nur Auslandshilfe für die notleidenden Deutschen geben könne, wenn die Kirchen sich ihrer Mitverantwortung für die NS-Verbrechen stellen. "Die deutschen Kirchen hätten von sich aus keine Schulderklärung formuliert", sagt er.
Kein Wort über den Holocaust
Tatsächlich schrieb der niederländische Theologe Willem Adolf Visser ’t Hooft, der die ökumenische Delegation in Stuttgart leitete, später in seiner Autobiografie: "Wie sollten wir die Wiederaufnahme voller ökumenischer Beziehungen erreichen? Die Hindernisse für eine neue Gemeinschaft ließen sich nur beseitigen, wenn die deutsche Seite ein klares Wort fand."
Damit erklärt sich für Besier auch, warum das Papier wesentliche Punkte auslässt. So ist der Holocaust an den Juden mit keiner Silbe erwähnt. Die Formulierungen im Komparativ ("nicht mutiger", "nicht treuer", "nicht brennender") können so verstanden werden, dass durchaus viel Mut, Treue und Brennen vorhanden gewesen seien, aber eben nicht genug. Die Verstrickungen mit dem Regime und das unselige Wirken der Deutschen Christen, der gleichgeschalteten evangelischen Kirche, sowie der Antisemitismus in der Kirche finden keine Erwähnung.
Dabei waren einige der Unterzeichner auf riskanten Konfrontationskurs zum Regime gegangen. Der Berliner Generalsuperintendent Otto Dibelius etwa erhielt Predigtverbot und kam mehrfach ins Gefängnis. Der württembergische Landesbischof Wurm hatte die Eingliederung seiner Landeskirche in die Reichskirche verhindert und gegen das Euthanasieprogramm der Nazis protestiert, wofür er vorübergehend Hausarrest und später ebenfalls Schreib- und Predigtverbot erhielt.
Kartonweise Protestbriefe
Die Schulderklärung traf damals in Deutschland auf Ablehnung und Wut. Im hannoverschen Kirchenamt füllten die Protestbriefe ganze Kartons. Menschen sahen sich für Verbrechen in Mithaftung genommen, obwohl sie sich unschuldig fühlten. In ihrer Selbstwahrnehmung waren sie Opfer, nicht Täter.
Außerhalb Deutschlands zeigte das Bekenntnis den gewünschten Erfolg. Kirchengemeinden etwa in den USA schickten Hilfspakete an die ausgebombten Glaubensgeschwister. Auch einer Rehabilitierung deutscher Protestanten und einer Mitarbeit in weltweiten ökumenischen Gremien wurde der Weg gebahnt.
Kirchenhistoriker Besier wünscht sich ein milderes Urteil über die damals Verantwortlichen. Die führenden Kirchenmänner seien Kinder ihrer Zeit gewesen. Antisemitische Aussagen des württembergischen Bischofs Wurm und des führenden Vertreters der Bekennenden Kirche, Martin Niemöller, basierten auf Vorurteilen, die über Jahrhunderte in Mitteleuropa gepflegt worden und tief ins Bewusstsein gesunken seien. "Es ist falsch, die Maßstäbe von heute an das Jahr 1945 anzulegen", sagt der emeritierte Geschichtsprofessor.
Die EKD wird am Sonntag, 18. Oktober, bei einer zentralen Feier in Stuttgart an die vor 75 Jahren veröffentlichte Schulderklärung erinnern. Gefeiert wird in der Markuskirche - jenem Gotteshaus, in dem 1945 deutsche und internationale Kirchenvertreter erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenkamen.
Verband plant Zertifikat für kirchliche Friedensarbeit
Bonn, Leipzig (epd). Evangelische Friedensgruppen wollen das Engagement von Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen für Frieden und Verständigung künftig mit einem Zertifikat würdigen. Die ersten Zertifizierungen sind zur Ökumenischen Friedensdekade 2022 geplant, wie die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) am 9. Oktober zum Abschluss ihrer Herbsttagung in Leipzig mitteilte. Bestehende Friedensarbeit solle auf diese Weise stärker sichtbar gemacht werden.
Die Arbeitsgemeinschaft wolle sich zudem künftig stärker in die Debatte um den Umgang mit Rechtsextremismus und Rassismus einbringen, erklärte ein Sprecher des in Bonn ansässigen Verbands. Kirche stehe für eine offene, friedliche und tolerante Gesellschaft. Im Dachverband EAK sind die für Kriegsdienstverweigerung und Friedensarbeit zuständigen Personen innerhalb der "Konferenz für Friedensarbeit im Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)" zusammengeschlossen.
1.319 Papier-Boote sollen an ertrunkene Flüchtlinge erinnern

epd-bild/Grischa Roosen-Runge/ekd
Soest (epd). Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen will mit einer Solidaritätsaktion am Tag der Menschenrechte Mitte Dezember an das Schicksal von Menschen auf der Flucht erinnern. Mitglieder und Interessierte sind dazu auf gerufen, bis zum 10. Dezember mindestens 1.319 kleine Boote aus Zeitungspapier zu falten, wie der Verband am 9. Oktober in Soest mitteilte. Das entspricht der Zahl der Menschen, die laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) 2019 auf dem Mittelmeer gestorben oder vermisst worden sind.
Die Papier-Boote sollen demnach am Gedenktag zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, auf öffentlichen Plätzen in NRW aufgestellt werden. Die Aktion solle auch auf die anhaltende schwierige Situation der zivilen Seenotrettung hinweisen, hieß es. So werde die "Sea-Watch 4" weiterhin am Auslaufen gehindert. Bereits vor drei Wochen hatte die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend Saar (aej saar) mit rund 3.300 Solidaritäts-Schiffchen gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung demonstriert.
Die "Sea-Watch 4" wurde in der Nacht zum 20. September in der sizilianischen Hafenstadt Palermo festgesetzt, nachdem die Crew mehr als 350 Menschen aus Seenot gerettet hatte. Die italienische Küstenwache gibt Sicherheitsmängel als Grund für das Auslaufverbot aus dem Hafen von Palermo an.
Mitte August war das Rettungsschiff zu seiner ersten Mission ins zentrale Mittelmeer gestartet. Es wurde aus überwiegend kirchlichen Spenden finanziert - größtenteils gehen sie auf das zivile Bündnis "United4Rescue" zurück, das auf Initiative der evangelischen Kirche gegründet wurde. Mehr als 600 Mitglieder hat das Bündnis mittlerweile, die westfälische Frauenhilfe schloss sich bereits im Dezember 2019 an. Sea-Watch und "Ärzte ohne Grenzen" betreiben das Schiff im Auftrag des Bündnisses, das auch der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, unterstützt.
Paderborner Superintendent: Durch Corona Reformen in Kirche aktuell
Paderborn (epd). Die Corona-Pandemie verstärkt nach Worten des Paderborner Superintendenten Volker Neuhoff die Notwendigkeit von Reformen in der Kirche. "Kirche verändert sich. Das tut sie seit 2.000 Jahren. Und das ist gut so!", sagte Neuhoff in seinem Bericht vor der Synode des Kirchenkreises Paderborn. Die Botschaft des Evangeliums wolle in jede Zeit hinein aktualisiert werden. Die äußere Form von Kirche sei tatsächlich zweitrangig, solange die Kommunikation des Evangeliums geschehe. Als Bereiche praktischer Veränderungen nannte Neuhoff "Mitgliederbindung, Finanzierungsfragen, Personalentwicklung, Beteiligungsformen und Social Media".
Die Corona-Pandemie wirke dabei wie ein Brennglas und stelle deutlich die Frage: "Warum und wo und wie und mit wem und für wen seid ihr Kirche?", sagte Neuhoff weiter. Veränderung brauche neben Bereitschaft auch Kraft. "Unsere Kirche ist nicht systemrelevant", sagte der Superintendent. Die Kirche sei aber in ihrem Kern "existenzrelevant".
Psychosoziale Erstberatung für Flüchtlinge endet
Scharf kritisierte Neuhoff eine Kriminalisierung von Flüchtlingen. "Menschen werden haftbar gemacht dafür, dass sie aus Notsituation fliehen, und sie werden in Haft genommen, um sie abzuschieben", sagte der Superintendent. Vor Bedrohung Geflüchtete würden selbst als Bedrohung empfunden. Und sie würden in Bedrohungssituationen zurückgeschickt. Kirchenasyl sei eine besondere Aufgabe für eine Kirchengemeinde. Hier sei für den Kirchenkreis Paderborn ein solidarisches System aus finanzieller und ehrenamtlicher Unterstützung angeregt worden.
Der Paderborner Superintendent bedauerte, dass die Arbeit der Psychosozialen Erstberatung und das übernommene Beschwerdemanagement in den Zentralen Unterbringungs-Einrichtungen Bad Driburg und Borgentreich zum Jahresende beendet werde. Die Diakonie Paderborn-Höxter sehe sich wegen der politischen Rahmenbedingungen finanzieller und inhaltlicher Art gezwungen, die von ihr aufgebaute Arbeit zu beenden. Würde die Diakonie diese Arbeit fortsetzen, müsste sie mehr als 60.000 Euro Eigenmittel aufbringen. "Wir bedauern es sehr, dass die Politik des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW die Arbeit der Wohlfahrtsverbände erschwert und uns daran hindert, diese erfolgreiche und wichtige Arbeit weiter fortzusetzen", beklagte Neuhoff. Das gehe zulasten der geflüchteten Menschen in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen.
Gelsenkirchen und Wattenscheid: Neuer Kreissynodalvorstand gewählt
Gelsenkirchen (epd). Die Synode des Kirchenkreises Gelsenkirchen und Wattenscheid hat einen neuen Kreissynodalvorstand gewählt. Neue Synodalassessorin und damit Stellvertreterin von Superintendent Heiner Montanus wurde Pfarrerin Elga Zachau, wie der Kirchenkreis mitteilte. Die 47-Jährige ist seit 2014 Pfarrerin der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Buer. Als Scriba wiedergewählt wurde Pfarrer Bernd Naumann von der Epiphanias-Gemeinde.
Als weitere KSV-Mitglieder neu gewählt wurden Pfarrer Norbert Deka und die Presbyter Dirk Blum und Jürgen Sauerland, im Amt bestätigt wurden die Presbyterinnen und Presbyter Beate Cizmowski, Kornelia Schmidtfranz und André Bsdurrek. Die Amtszeit des KSV beträgt acht Jahre. Die nächste Kreissynode findet den Angaben zufolge bereits am 23. November statt, da der Haushaltsplan für das Jahr 2021 beschlossen werden muss. Dann soll auch der neue KSV in sein Amt eingeführt werden.
Kirschstein neuer Vorsitzender der Gossner Mission
Bad Salzuflen, Berlin (epd). Neuer Vorsitzender der Gossner Mission wird der ostfriesische Theologe Helmut Kirschstein. Das Kuratorium wählte den bisherigen Stellvertreter in der Herbstsitzung im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen einstimmig ins Amt, wie die Gossner Mission am 12. Oktober in Berlin mitteilte. Der 63-jährige Superintendent des ostfriesischen Kirchenkreises Norden tritt die Nachfolge des 71-jährigen Harald Lehmann an. Der ehemalige Leiter der Evangelischen Gesamtschule in Gelsenkirchen hatte im Juni aus Altersgründen seinen Rücktritt angekündigt. Kirschstein soll am 6. Januar in der Berliner Marienkirche offiziell in sein Amt eingeführt werden.
Der ostfriesische Theologe Kirschstein wurde 2009 ins Gossner Kuratorium gewählt, im Jahr 2016 wurde er stellvertretender Vorsitzender der Gossner Mission. Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde auf der Herbstsitzung ebenfalls einstimmig die Diplom-Mathematikerin Hanna Töpfer gewählt.
Die Gossner Mission wurde 1836 auf Initiative ostfriesischer Handwerker von dem Berliner Pfarrer Johannes Evangelista Gossner (1773-1858) gegründet. Gossner war zunächst katholischer Priester und konvertierte 1826 zum Protestantismus. Das vergleichsweise kleine unabhängige Missionswerk mit Sitz in Berlin wird von mehreren deutschen Landeskirchen unterstützt, darunter die Evangelische Kirche im Rheinland, die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche. Es setzt sich für sozial benachteiligte Menschen ein und bietet verschiedene Bildungs- und Gesundheitsprojekte an.
Theologisches Netzwerk in Westfalen gegründet
Münster/Steinhagen (epd). Evangelische Theologinnen und Theologen haben in Westfalen ein Netzwerk mit dem Namen "Credo" gegründet. Bisher haben sich 21 Personen angeschlossen, wie die beiden Sprecher Michael Czylwik aus Steinhagen und Volker Roggenkamp aus Münster am 9. Oktober mitteilten. Bei der konstituierenden Sitzung im September wurde ein fünfköpfiger Leitungskreis gewählt, in dem die beiden Sprecher den Vorsitz haben.
Ziele des Netzwerks sind den Angaben zufolge unter anderem der Austausch über umstrittene theologische Themen in der Landeskirche, der Austausch mit der Kirchenleitung und gegenseitige Unterstützung bei möglichen Konflikten aufgrund von Fragen des Bekenntnisses. Credo will nach eigenen Angaben Presbyterien und Gemeindegliedern geistliche Stärkung und biblisch fundierte Orientierung anbieten und den christuszentrierten Gemeindeaufbau fördern.
Gesellschaft
Halle gedenkt des Synagogen-Anschlags vor einem Jahr

epd-bild/Jens Schulze
Halle (epd). Mit einem Spaziergang evangelischer und katholischer Christen zur Synagoge der Stadt endete am Abend des 9. Oktober in Halle das ganztägige Gedenken an die Opfer des antisemitischen Anschlags vor einem Jahr. Nach einem Friedensgebet in der Marktkirche machte sich trotz strömenden Regens eine große Gruppe Menschen, darunter der mitteldeutsche Bischof Friedrich Kramer und der Bischof des Bistums Magdeburg, Gerhard Feige, auf den Weg zum etwa eine halbe Stunde entfernten jüdischen Gotteshaus. Dabei wurde ein Zwischenstopp für Gebete und Gesang bei dem Döner-Imbiss eingelegt, der am 9. Oktober 2019 ebenfalls zum Ziel des Attentäters geworden war.
Dabei wurde der beiden Todesopfer gedacht. Aus rechtsextremistischer Gesinnung heraus hatte der Täter vor einem Jahr versucht, am wichtigen jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge in Halle einzudringen. Er scheiterte an der Tür und ermordete danach eine 40-jährige Passantin und einen 20-jährigen Gast in dem Döner-Imbiss.
Steinmeier: Zusammenstehen
Bei der zentralen Gedenkveranstaltung in der Ulrichskirche rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Zusammenstehen der gesamten Gesellschaft gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Ausgrenzung auf. Menschenfeindlichkeit sei ein Angriff gegen die offene Gesellschaft und die Demokratie, sagte Steinmeier.
Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, sagte, ein normales Leben werde für die Gemeinde so bald nicht wieder möglich sein. "Wir sind empfindlicher geworden als früher", sagte er - auch mit Verweis auf Äußerungen von Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) über entstehende Personalengpässe bei der Polizei aufgrund der Schutzmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen.
Unter den Gästen der Gedenkfeier befanden sich neben Betroffenen und ihren Angehörigen auch der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, Landesbischof Kramer und der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff.
Mahnmal eingeweiht
Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte, noch vor einem Jahr sei für ihn eine solche schreckliche Tat undenkbar gewesen. Er sicherte der jüdischen Gemeinschaft im Land die Unterstützung von Politik und Gesellschaft zu. So entstünden im Land derzeit zwei Synagogen-Neubauten, etwa in Dessau, aus deren jüdischer Gemeinde einst der Philosoph Moses Mendelsohn (1729-1786) hervorgegangenen sei.
Vor der Gedenkfeier war im Innenhof der Synagoge ein Mahnmal mit der beim Anschlag beschädigten Tür als Kernstück eingeweiht worden. Dabei hatte Zentralrats-Präsident Schuster zu Respekt und Toleranz aufgerufen. Zudem war an dem Döner-Imbiss eine Gedenkplatte enthüllt worden.
Den ganzen Tag über wurde in Halle auf vielfältige Art den Opfern des Anschlags gedacht. So läuteten punkt 12.01 Uhr, dem Zeitpunkt, als vor einem Jahr die ersten Schüsse auf die Eingangstür der Synagoge abgefeuert wurden, die Glocken aller Kirchen der Stadt. Mehrere hundert Menschen hielte zugleich auf dem Marktplatz für mehrere Minuten inne. Auf dem Gelände des Steintor-Campus der Luther-Universität wurde zudem eine Ausstellung eröffnet, die den Opfern des Anschlags eine Stimme geben soll.
Jüdische Vertreter fordern mehr Engagement gegen Antisemitismus

epd-bild/Christian Ditsch
Köln (epd). Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, der Publizist Michel Friedman und Vertreter mehrerer Kölner Organisationen haben am 8. Oktober in Köln an den Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) erinnert und von der Politik mehr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus gefordert. Friedmann plädierte leidenschaftlich für mehr zivilgesellschaftliches Engagement für die Demokratie und gegen Antisemitismus. "Ich will nie wieder hören 'Wehret den Anfängen'. Wir sind bereits mittendrin." Er verwies darauf, dass die größte Oppositionspartei im Bundestag, die AfD, "eine Partei des Hasses" sei. "Wenn die Demokratie in Deutschland stabil ist, können auch die Juden hier leben. Wenn die Demokratie in Deutschland nicht stabil ist, können nicht nur Juden hier nicht leben", warnte der Publizist.
"Wenn wir Demokratie wollen, warum sind wir dann nicht lauter gegen die, die heute noch in der Minderheit sind?", fragte Friedmann. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten viele gesagt, sie hätten gegen das NS-Regime nichts ausrichten können. "Heute sind wir dran. Wir können etwas ausrichten. Und das ist unsere Pflicht." Nach Veranstalterangaben nahmen etwa 250 Menschen an der Kundgebung auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz teil, zu der die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, die Deutsch-Israelische Gesellschaft Köln, das Bündnis gegen Antisemitismus und mehrere antifaschistische Gruppen aufgerufen hatten.
"Ein Gefühl der Unsicherheit und des Ungewolltseins"
Abraham Lehrer, Vorstand der Synagogen-Gemeinde Köln, erinnerte sich an den Tag des Anschlags: "Wir waren in der Synagoge in Köln an der Roonstraße. Wir haben den Gottesdienst fortgesetzt, waren aber mit einem Ohr immer bei den Ereignissen in Halle." Einige Gottesdienstbesucher seien nach Hause gegangen. Bei der jüdischen Synagogengemeinde in Köln habe sich ein "ein Gefühl der Unsicherheit und des Ungewolltseins" ausgebreitet, berichtete Lehrer. Der Antisemitismus in Deutschland habe "explosionsartig" zugenommen. "Wir brauchen jetzt ganz konkrete Aktionen", forderte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden. "Da ist die Politik gefragt, da sind aber auch Vereine, Verbände und Initiativen gefragt."
"Wir wissen nicht erst seit dem Anschlag in Halle, dass der Antisemitismus mörderisch ist", sagte Hannelore Bartscherer von der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Eine solche Tat dürfe sich nicht wiederholen. "Dafür braucht es mehr als Lippenbekenntnisse und verbale Kraftmeierei", betonte die langjährige Vorsitzende des Katholikenausschusses Köln. Nötig sei eine dauerhafte politische Arbeit gegen den weit verbreiteten Rassismus und Antisemitismus, sagte Bartscherer.
Am 9. Oktober vor einem Jahr hatte der Attentäter Stephan B. einen Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale verübt. Er versuchte mit Sprengsätzen und Schusswaffen in die abgeschlossene Synagoge zu gelangen. Schließlich erschoss der Attentäter vor der Synagoge eine 40 Jahre alte Passantin und in einem nahe gelegenen Döner-Imbiss einen 20 Jahre alten Mann. Die Bundesanwaltschaft hat B. wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten Mordes in mehreren Fällen sowie weiterer Straftaten angeklagt. Seit Ende Juli läuft der Prozess vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Aus Platzgründen finden die Verhandlungen im Landgericht Magdeburg statt.
Hamburgs Bürgermeister will jüdisches Leben "sichtbarer" machen
Hamburg (epd). Das jüdische Leben in Hamburg soll nach den Worten von Bürgermeister Peter Tschentscher sichtbarer und erfahrbarer gemacht werden. Vor allem der jüngeren Generation müsse der Zugang erleichtert werden, sagte der SPD-Politiker nach einem Spitzengespräch mit der Jüdischen Gemeinde am 6. Oktober im Rathaus. So wolle die Stadt den Jugendaustausch mit Israel fördern. Wer jüdische Menschen persönlich kenne, sei gegen antisemitische Vorurteile eher gewappnet. Am 4. Oktober hatte ein Mann einen jüdischen Studenten vor der Synagoge in Hamburg attackiert und schwer verletzt.
Der Angreifer ist inzwischen in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden. Es gebe Hinweise auf eine psychische Krankheit, die zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit geführt haben könnte, sagte die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, Nana Frombach, am 6. Oktober dem epd.
Antisemitismusbeauftragten einsetzen
Tschentscher sagte, die Stadt wolle dem entgegenwirken, dass sich die Jüdische Gemeinde aus der Öffentlichkeit zurückziehe. Ein sichtbares Zeichen für das jüdische Leben in Hamburg solle der geplante Wiederaufbau der Synagoge am Bornplatz im Grindelviertel sein, die in der NS-Zeit zerstört wurde. Zudem werde die Hansestadt in nächster Zeit einen Antisemitismusbeauftragten bestellen, bekräftigte der Bürgermeister. Mit der Suche nach einer geeigneten Persönlichkeit sei bereits vor dem Anschlag begonnen worden.
Landesrabbiner Shlomo Bistritzky sprach sich für mehr Schulprojekte zum Judentum aus. Jeder junge Mensch in Hamburg sollte eine Synagoge oder eine jüdische Einrichtung besucht haben, forderte er.
Sicherheit verbessern
Die Jüdische Gemeinde will trotz des Anschlags ihre regulären Aktivitäten fortsetzen. Es werde nicht die geringsten Änderungen im Programm geben, sagte Philipp Stricharz, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, dem epd. Die Sicherheit für die Gemeinde müsse verbessert werden. Dazu zählten auch bauliche Veränderungen. Die Jüdische Gemeinde sei dafür im Gespräch mit der Polizei und anderen Sicherheitsstellen.
Die Stimmung unter den Gemeindemitgliedern ist nach den Worten Stricharz' "gefasst", aber auch "ernüchtert". Man sei bisher davon ausgegangen, dass die Schutzmaßnahmen in Hamburg greifen müssten. "Es hätte nicht so weit kommen dürfen." Es könne nicht sein, dass jüdische Gemeindemitglieder nicht einmal mehr vor der Synagoge eine Kippa tragen dürften.
Vor der Synagoge in Hamburg-Eimsbüttel war am 4. Oktober ein 26-jähriger jüdischer Student mit einem Klappspaten angegriffen und schwer verletzt worden. Er war unmittelbar nach der Tat mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, hat nach Polizeiangaben das Krankenhaus am Dienstag aber wieder verlassen. Der 29-jährige Angreifer, ein Deutscher mit kasachischen Wurzeln, wurde in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Es gibt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hinweise auf eine psychische Krankheit, die zu einer Einschränkung der Schuldfähigkeit geführt haben könnte.
"Jüdisches Leben bekannter machen"
Der Zentralrat der Juden in Deutschland bekräftigte unterdessen, "dass jüdische Einrichtungen einen hohen Schutz brauchen". Die Attacke von Hamburg zeige, dass es derzeit keine andere Möglichkeit gebe, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Vorfall sollte genau analysiert werden, um gegebenenfalls Schwachstellen aufzudecken und zu beseitigen.
Zugleich forderte Schuster - wie auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) - mehr öffentliche Information über jüdisches Leben, um antisemitische Gewalttaten besser zu verhindern. "Wir brauchen eine bessere Aufklärung und Bildung der Bevölkerung", Es geht darum, das Judentum, jüdisches Leben bekannter zu machen - nicht immer im Zusammenhang mit der Schoah, nicht nur aus der Opferperspektive" , sagte er. Jüdisches Leben sollte etwas Selbstverständliches sein. Auch Lambrecht dringt auf demokratische Bildung, um Antisemitismus vorzubeugen. "Wir müssen mehr für die Prävention tun, an Schulen, Bildungseinrichtungen und überall sonst, wo sich Menschen begegnen", sagte sie in der "Passauer Neuen Presse".
NRW-Landtag stimmt für Verbot von Reichskriegsflaggen
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Landtag hat sich für ein Verbot von Reichskriegsflaggen in NRW ausgesprochen. Die Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen forderten die Landesregierung am 8. Oktober gemeinsam auf, einen entsprechenden Erlass zu verabschieden, der das Zeigen oder Verwenden dieser Fahnen untersagt. Gegen den Antrag stimmte nur die AfD.
AfD stimmt dagegen
"Reichskriegsflaggen sind ein Symbol von Rechtsextremen, das in unserem öffentlichen Leben nichts zu suchen hat", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Fraktionen. Provokationen wie von den Demonstranten, die mit Reichskriegsflaggen den Deutschen Bundestag stürmen wollten, dürften nicht länger hingenommen werden.
Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich offen für das Anliegen, verwies aber auf die begrenzte Reichweite eines Erlasses auf Länderebene. Er kündigte Gespräche mit den Ressortchefs der anderen Bundesländer an, um einheitliche gesetzliche Regelungen auf Bundesebene zu erreichen.
In Brandenburg, Bremen und Niedersachsen ist das Zeigen von Reichskriegsflaggen bereits untersagt, in Bayern ist ein Verbot geplant. Mit dem Thema wird sich voraussichtlich auch die Innenministerkonferenz bei ihrem nächsten Treffen im Dezember in Weimar befassen.
Rechtsextreme in Uniform: Seehofer sieht kein strukturelles Problem

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht sich nach einem Lagebericht des Verfassungsschutzes in seinem Vertrauen in die Polizei bestätigt. Es gebe kein strukturelles Problem mit Rechtsextremen in den eigenen Reihen, sagte Seehofer am 6. Oktober in Berlin: "Wir haben es mit einer geringen Fallzahl zu tun."
Gemeinsam mit den Präsidenten von Verfassungsschutz, Bundespolizei und Bundeskriminalamt (BKA) stellte er den vom Verfassungsschutz erstellten Lagebericht "Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden" vor. Demzufolge haben die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern von Anfang 2017 bis Ende März dieses Jahres 377 rechtsextreme Verdachtsfälle in den eigenen Reihen registriert. 319 Fälle davon entfallen auf den Bereich der Bundesländer. 58 Verdachtsfälle betrafen Behörden des Bundes, 44 davon die Bundespolizei. Hinzu kommen dem Bericht zufolge 1.064 Verdachtsfälle beim Militärischen Abschirmdienst für den Bereich der Bundeswehr.
"99 Prozent auf dem Boden des Grundgesetzes"
In 100 Fällen endete ein Verfahren bei den Sicherheitsbehörden der Länder mit Konsequenzen für den Betroffenen, bei den Sicherheitsbehörden des Bundes in 24 Fällen. In 34 aller von Bund und Ländern gemeldeten Fälle sieht der Bericht "verdichtete Anhaltspunkte für Rechtsextremismus", 22 davon betrafen Polizisten, 11 die Bundeswehr und ein Fall den Zoll.
Diese Zahl sogenannter erwiesener Rechtsextremisten zog Seehofer für seine politische Bewertung des Berichts heran. Jeder Fall sei eine Schande. Die Zahl zeige aber, dass mehr als 99 Prozent der Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden fest auf dem Boden des Grundgesetzes stünden, sagte er.
Vorausgegangen war der Vorstellung des Berichts eine wochenlange Debatte über Rechtsextremismus und Rassismus in der deutschen Polizei, befeuert durch die Proteste gegen Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA und mehrere von Medien hierzulande aufgedeckte Fälle von Chatgruppen, in denen Polizisten rassistische und islamfeindliche Inhalte austauschten. SPD und Teile der Opposition fordern eine Studie über Rassismus in der Polizei.
Lambrecht für Studie
Seehofer lehnt dies ab. Am 6. Oktober kündigte er an, dem Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus eine umfassende Untersuchung der Erscheinungsformen von Rassismus vorzuschlagen, der alle Bereiche der Gesellschaft beleuchten soll - nicht nur eine Berufsgruppe. Zudem hat er den Verfassungsschutz beauftragt, nach dem Bericht über die Zahl rechtsextremer Fälle eine Analyse nachzuliefern. Der Lagebericht soll zudem fortgeschrieben und auf den gesamten öffentlichen Dienst ausgeweitet werden.
Auch der brandenburgische Innenminister Michael Stübgen (CDU) sprach sich gegen eine Studie über Rechtsextremismus in der Polizei aus. Konkrete Veränderungen seien ihm wichtiger, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) und verwies unter anderem auf seine Forderung, bei Einstellungen und unter Umständen Beförderung von Beamten eine Abfrage beim Verfassungsschutz zu machen.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die sich für die Polizei-Studie stark gemacht hatte, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, wissenschaftliche Untersuchungen seien für eine klare Faktenlage dringend erforderlich. Zudem forderte sie, "deutlich früher und konsequenter jedem Rechtsextremismus-Verdacht in Polizei- und Sicherheitsbehörden nachzugehen".
Vorwurf der Verharmlosung
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt kritisierte, der Lagebericht des Verfassungsschutzes bleibe an der Oberfläche. Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke warf Seehofer vor, das Rechtsextremismusproblem zu verharmlosen, wenn er nur auf die Zahl der Disziplinarverfahren und Ermittlungen schaue. Vielen Polizisten und Soldaten fehle das Problembewusstsein, oder sie schwiegen sich aus falsch verstandenem Korpsgeist aus, sagte sie.
Bundespolizeipräsident Dieter Romann und BKA-Chef Holger Münch widersprachen dem Korpsgeist-Argument. In der Mehrheit der Fälle sei ein Verdacht aus der Organisation heraus gemeldet worden, hieß es.
NRW: Sonderbeauftragter für Rechtsextremismus bei Polizei
Düsseldorf (epd). Die Fälle von Rechtsextremismus bei Polizei und Verfassungsschutz beschäftigen weiter das Parlament in Nordrhein-Westfalen. "Wir haben zu viele Fälle von Rechtsextremismus und Rassismus", sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am 8. Oktober in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags. Die allergrößte Mehrheit der Polizisten schäme sich aber dafür, was gerade passiere.
Als Konsequenz nimmt in der kommenden Woche ein Sonderbeauftragter für rechtsextremistische Tendenzen bei der NRW-Polizei, der Verfassungsschützer Uwe Reichel-Offermann, mit einem sechsköpfigen Team seine Arbeit auf. Reul geht davon auf, dass dann weitere Fälle zutage treten werden. Aktuell gibt es nach Angaben des Ministers 104 rechte Verdachtsfälle bei den NRW-Sicherheitsbehörden. Davon entfallen 100 auf die Polizei und vier auf den Verfassungsschutz. Bislang wurden 29 Disziplinarverfahren abgeschlossen, davon wurden in acht Fällen Disziplinarmaßnahmen ergriffen. Weitere 37 Hinweise aus der Polizei selbst würden derzeit geprüft.
Uneinig sind sich Landesregierung und Opposition darüber, wie das Problem rechter Tendenzen in den Sicherheitsbehörden weiter angegangen werden soll. Die Fraktionen von CDU und FDP brachten in der Debatte mit ihrer Regierungsmehrheit einen Antrag auf den Weg, der einen Ausbau verpflichtender Fortbildungsangebote bei der Polizei vorsieht. Diese sollen "für eine gefestigte demokratische sowie verfassungstreue Grundhaltung sorgen und relevantes Wissen zu Phänomenen, Erscheinungsformen und Verhaltensmuster vermitteln". Die Grünen scheiterten erwartungsgemäß mit ihrer Forderung nach einer Studie, um eine Bestandsaufnahme zu rechtsextremen Haltungen bei Polizei und Verfassungsschutz zu bekommen.
Saar-Landtag erlaubt Polizei Einsatz von Bodycams in Wohnungen

epd-bild/Annette Zoepf
Saarbrücken (epd). Der saarländische Landtag hat am 6. Oktober das Gesetz zur Neuregelung der polizeilichen Datenverarbeitung beschlossen. Demnach dürfen unter anderem Polizisten auch in Privatwohnungen Körper-Kameras (Bodycams) "zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib und Leben einer Person" nutzen. Jegliche weitere Verwendung der Aufzeichnung bedarf eines richterlichen Beschlusses. Das Gesetz tritt am 31. Dezember 2020 in Kraft. Zugestimmt hatten die Koalitionsfraktionen CDU und SPD, die AfD und der fraktionslose AfD-Politiker Lutz Hecker, dagegen stimmten die Linksfraktion und die fraktionslose Linken-Politikerin Dagmar Ensch-Engel.
Das nun in zweiter Lesung beschlossene Gesetz schließt auch verdeckte Maßnahmen gegen Journalistinnen und Journalisten aus. Der erste Entwurf hatte unter anderem Kritik von Datenschützern auf sich gezogen. So waren ursprünglich zwei Gruppen von Berufsgeheimnisträgern vorgesehen. Zu der einen hätten Geistliche, Parlamentarier, Strafverteidiger und Rechtsanwälte mit absolutem Schutz gehört, Journalisten zu einer zweiten Gruppe mit relativem Schutz, so dass verdeckte polizeiliche Maßnahmen nach Einzelfallabwägung generell zulässig gewesen wären.
In der Landtagsdebatte erklärte die SPD-Abgeordnete Petra Berg, dass das Gesetz eine rechtssichere und zukunftsfähige Basis für die polizeiliche Datenverarbeitung schaffen soll. Der Linken-Politiker Dennis Lander kritisierte, dass das Gesetz "massiv in die Freiheitsrechte der Bevölkerung einschneide", nicht nur durch die Bodycams, sondern etwa auch durch Ausweitung der Telefonüberwachung.
Der CDU-Abgeordnete Raphael Schäfer bezeichnete das Gesetz als verfassungskonform und warf der Linkspartei vor, ein Problem mit der Polizei zu haben. Dem widersprach der Linken-Fraktionsvorsitzende Oskar Lafontaine: "Wir brauchen Vertrauen in unsere Polizei." Sie sei konstituierend für jede gesellschaftliche Ordnung überhaupt. Wer sich um den Datenschutz Sorgen mache, greife die Polizei nicht an. Die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger müssten geschützt werden.
Weniger geflüchtete Menschen in Deutschland
Erstmals seit Jahren sinkt die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland wieder. Die Linken-Politikerin Jelpke sieht die Bundesregierung dadurch in der Pflicht, an anderer Stelle zu helfen.Berlin (epd). Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge und anderen Schutzsuchenden ist gesunken. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die zuerst die "Neue Osnabrücker Zeitung" (5. Oktober) berichtet hatte. Demnach hatten die Behörden zur Jahresmitte 1,77 Millionen geflüchtete Menschen mit unterschiedlichem Aufenthaltsstatus registriert - gut 60.000 weniger als noch Ende 2019.
Das Ministerium erklärte auf Anfrage der Zeitung, der aktuelle Rückgang sei hauptsächlich dadurch zu erklären, dass der Schutzstatus der Personen widerrufen oder zurückgenommen wurde oder erloschen ist. Ein "erheblicher Anteil" der Menschen halte sich nicht mehr im Bundesgebiet auf, sei also ausgereist. Einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben den Zahlen zufolge zurzeit mehr als 1,3 Millionen Flüchtlinge. Gut 450.000 hätten einen ungesicherten Status als Asylsuchende oder Geduldete.
"Wir haben Platz"
Die Linken-Abgeordnete Ulla Jelpke kritisierte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung scharf. "Wir haben Platz, die Zahlen zeigen es", erklärte sie und verwies darauf, dass Zehntausende Schutzsuchende unter unwürdigen Bedingungen in den europäischen Erstaufnahmestaaten ausharrten. Deutschland müsse seine humanitären Aufnahmekapazitäten nutzen, um Länder wie Griechenland oder Italien wirksam zu entlasten.
Das deutsche Recht sieht verschiedene Kategorien für den Schutz von Flüchtlingen vor. Am seltensten wird der umfassende Asylschutz nach Artikel 16 des Grundgesetzes gewährt, da er durch die Drittstaatenregelung nur auf wenige Menschen zutrifft, die unmittelbar nach Deutschland gelangen. Am häufigsten werden Asylsuchende in Deutschland nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Diesen Schutzstatus erhält, wer aufgrund seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Heimatstaat verfolgt wird.
Trifft dies auf einen Schutzsuchenden nicht zu, gibt es noch die Möglichkeit des subsidiären Schutzes. Er wird in der Regel gewährt, wenn nicht wegen der Diskriminierung einer ganzen Gruppe, im konkreten Fall aber dennoch Gefahr für Leib und Leben droht. Dies kann etwa im Fall von Krieg, einer verhängten Todesstrafe oder Folter der Fall sein. Die meisten Menschen, denen Flüchtlingsschutz gewährt wurde, stammen aus Syrien.
Italien schafft Millionenstrafen für Flüchtlingsretter ab
Rom (epd). Italien hat die unter Ex-Innenminister Matteo Salvini eingeführten Strafen in Millionenhöhe für private Seenotretter im Mittelmeer abgeschafft. Ein vom Ministerrat verabschiedetes Dekret sieht nach Regierungsangaben vom 6. Oktober überdies einen Ausbau der unter Salvini stark eingeschränkten Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge vor. Das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte betonte in dem Dekret ferner das Verbot, Flüchtlinge in seeuntauglichen Booten zurückzuweisen.
Salvini von der rechtspopulistischen Lega hatte als Innenminister sogenannte Sicherheitsdekrete durchgesetzt. Diese schlossen einen Großteil der Migranten von Aufnahme- und Integrationsmaßnahmen aus. Private Flüchtlingsretter wurden mit Strafen von bis zu einer Million Euro belegt, ihre Schiffe beschlagnahmt. Im August vergangenen Jahres verließ der damalige Innenminister die Regierung. Seine Nachfolgerin Luciana Lamorgese gilt als gemäßigt, verzögert jedoch nach wie vor die Genehmigungen für Schiffe mit geretteten Flüchtlingen, italienische Häfen anzulaufen.
Auch "Sea-Watch 4" festgehalten
Die Schiffe werden nach ihrer Ankunft wegen technischer Kontrollen am Auslaufen gehindert. Das geschah auch mit dem kirchlichen Rettungsschiff "Sea-Watch 4", das in der Nacht zum 20. September in der sizilianischen Hafenstadt Palermo festgesetzt wurde. Die Crew hatte mehr als 350 Menschen aus Seenot gerettet. Die "Sea-Watch 4" wird von dem Bündnis "United4Rescue" betrieben, das die Evangelische Kirche in Deutschland initiiert hatte.
Salvini steht mittlerweile wegen der Blockade der "Gregoretti" mit 131 Flüchtlingen an Bord vor Gericht. Im Zusammenhang mit der Weigerung, das Schiff der italienischen Küstenwache in einen Hafen einlaufen zu lassen, wird ihm in Catania Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Das zuständige Untersuchungsgericht in dem Fall will Ministerpräsident Conte und Innenministerin Lamorgese anhören. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Einstellung des Verfahrens.
Im Juli 2019 mussten die vor der libyschen Küste geretteten Flüchtlinge unter katastrophalen hygienischen Bedingungen mehrere Tage auf der "Gregoretti" ausharren. Erst unter internationalem Druck erteilte Salvini dem Schiff die Genehmigung, einen italienischen Hafen anzufahren.
Gedenken an Befreiung des "Stalag 326" vor 75 Jahren

epd-bild/Friedrich Stark
Schloß Holte-Stukenbrock/Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will das Leid sowjetischer Kriegsgefangener in der NS-Zeit mehr thematisieren. "Wir sind es den Opfern schuldig, die infolge mangelhafter Ernährung, Versorgung und Unterbringung sowie der ausbeuterischen Arbeitseinsätze ums Leben kamen, ihren Angehörigen und allen, die die Gräuel überlebt haben", sagte Laschet am 9. Oktober bei einer Gedenkveranstaltung in Schloß Holte-Stukenbrock. "Wir sind es aber auch uns selbst schuldig, damit wir uns bewusst bleiben, wohin Fanatismus, Verblendung und Hass führen können."
Laschet: Leid sowjetischer Kriegsgefangener in den Blick nehmen
Vor 75 Jahren wurde das ehemalige NS-Stammlager "Stalag 326" nahe Stukenbrock von US-Soldaten befreit. Es war zwischen 1941 und 1945 das wahrscheinlich größte Lager der Wehrmacht für sowjetische Kriegsgefangene und Verschleppte im Gebiet des damaligen Deutschen Reiches. Schätzungen zufolge starben etwa 65.000 Menschen aufgrund der katastrophalen Lagerbedingungen, in einem nahe gelegenen Lazarett und in den Arbeitskommandos. Die Toten wurden in Massengräbern einen Kilometer entfernt verscharrt, heute befindet sich dort ein sowjetischer Ehrenfriedhof.
Im "Stalag 326" hätten Lebenswege in Erniedrigung, Hunger, Schmerz und Tod geendet, sagte der Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags, André Kuper (CDU). "Dieser Ort ist mit einem Auftrag an uns alle verbunden: die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus bewahren, die Verbrechen weiter aufarbeiten und, wann immer notwendig, unser Wort gegen menschenfeindliche Ideologie erheben." Die nationalsozialistischen Verbrechen gegenüber der Menschlichkeit machen in ihrer unvergleichbaren Dimension schnell sprachlos. "Doch umso mehr dürfen wir Demokraten unsere Sprache und unsere Haltung niemals verlieren", rief der Landtagspräsident zu mehr Engagement gegen menschenfeindliche Ideologien auf.
Neukonzeption der Dokumentationsstätte
Seit 1996 informiert auf dem ehemaligen Lagergelände eine Gedenkstätte über die Geschichte des Stalag anhand von alten Dokumenten, Filmmaterial, Dias und Zeugenaussagen. In den kommenden Jahren soll der vergleichsweise kleine, lange Zeit ehrenamtlich betriebene Erinnerungsort mit einer Neukonzeption überregional stärker bekannt gemacht werden. Geplant sind unter anderem ein Neubau für Ausstellungen und Vermittlungsarbeit sowie eine Neukonzeption der historischen Orte, um an das Leid der Kriegsgefangenen zu erinnern.
In Verbindung mit dem Ehrenfriedhof soll ein würdiges Totengedenken ermöglicht und die Geschichte von Stalag 326 weiter erforscht werden. Die Ausstellung soll zudem thematisch auf die Nachkriegsgeschichte des Stalag ausgedehnt werden: Von 1948 bis in die 70er Jahre war das Areal Auffang- und Durchgangslager für Vertriebene und später für DDR-Flüchtlinge.
Die Kosten für den Ausbau werden auf rund 60 Millionen Euro geschätzt. Die Fertigstellung solle bis 2025 erfolgen, sagte Kuper dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Urenkelin eines früheren Lagerinsassen erzählt Familiengeschichte
Bei der Gedenkveranstaltung auf dem ehemaligen Lager-Gelände schilderte Marina Mehlis, die Urenkelin eines im Stalag 326 verstorben russischen Kriegsgefangenen aus Moskau, die persönliche Familiengeschichte. Lange Zeit galt der Urgroßvater als verschollen, erst über die Internetseiten der Gedenkstätte habe sie von seinem Schicksal erfahren. "Als Russin bin ich dankbar, dass man in Deutschland dafür sorgt, dass die Spuren dieses Krieges nicht verloren gehen", sagte sie. Als Stimmen der Zeitzeugen verlasen Schülerinnen des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock Berichte von Kriegsgefangenen, die das Grauen des Lebens und Überlebens im Stammlager 326 beschrieben.
BDS-Vereine scheitern vor NRW-Verfassungsgericht
Münster (epd). Zwei Vereine aus der israelkritischen BDS-Bewegung sind vor dem nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshof mit einer Beschwerde gegen einen Beschluss des NRW-Landtags gescheitert, in dem ihre Kampagne als "antisemitisch" bezeichnet worden war. Die Beschwerdeführer seien durch den Beschluss "nicht unmittelbar betroffen" und hätten außerdem zunächst vor den Verwaltungsgerichten klagen müssen, erklärten die Verfassungsrichter in ihrem am 6. Oktober in Münster veröffentlichten Urteil (AZ: VerfGH 49/19.VB-2). Aus diesen Gründen sei die Verfassungsbeschwerde unzulässig.
Der Landtag hatte im September 2018 einstimmig den Beschluss "In Nordrhein-Westfalen ist kein Platz für die antisemitische BDS-Bewegung" gefasst. In diesem Votum habe das Parlament die Bewegung, die weltweit zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen gegen Israel auffordert, "antisemitisch" genannt und die Kommunen aufgerufen, der Kampagne keine Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und deren Veranstaltungen nicht zu unterstützen, führte der Gerichtshof aus. Die Kläger hätten sich durch die Äußerungen diffamiert und stigmatisiert gefühlt, zudem seien sie mit Verweis auf den Beschluss nicht zu kommunalen Veranstaltungen zugelassen worden.
Umstrittene Kampagne gegen Israel
Der Ausschluss von der Nutzung öffentlicher Einrichtungen sei jedoch nicht "durch den unverbindlichen Beschluss selbst, sondern erst durch die eigenständigen Entscheidungen" von Städten und Gemeinden erfolgt, so die Verfassungsrichter. Gegen diese Entscheidungen könnten die BDS-Vereine vor die Verwaltungsgerichte ziehen, wie sie dies in der Vergangenheit bereits erfolgreich getan hätten. Diese Instanz hätten sie laut dem Gerichtshof auch vor der Erhebung einer Verfassungsbeschwerde zunächst anrufen müssen.
Auslöser für die BDS-Kampagne war ein Aufruf von 170 palästinensischen Organisationen im Jahr 2005, darunter Gewerkschaften, akademische Institutionen, politische Parteien, kulturelle Gruppen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Das Ziel ist nach Angaben der BDS-Kampagne, Israel zum Schutz der Menschenrechte der Palästinenser zu bewegen. BDS ist keine feste Organisation und sehr heterogen, weltweit unterstützen unterschiedliche Gruppen in zahlreichen Ländern die Initiative.
Immer wieder steht die BDS-Kampagne in der Kritik, antisemitische Hetze zu verbreiten. Sie will Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren - so sehr, sagen Kritiker der Initiative, dass sie Israel nachhaltig schade. Kritiker sehen in den Forderungen der Initiative zudem das Existenzrecht Israels bedroht. Außerdem würden die Aktivisten den Konflikt schüren und die Fronten verhärten.
NRW begrenzt private Feiern auf 50 Teilnehmer
Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen beschränkt die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf 50 Menschen. Weil das Land auf einen Inzidenzwert von 35 zusteuere, sei die Begrenzung für Feiern aus herausragendem Anlass außerhalb des privaten Raumes nötig, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am 11. Oktober nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Düsseldorf: "Die Verbreitung des Coronavirus ist besorgniserregend." Die Sieben-Tages-Inzidenz in NRW liege mittlerweile bei 34,1. Neun Städte und Kreise überschritten den Inzidenzwert von 50. Die Regel werde in der neuen Corona-Schutzverordnung festgeschrieben, spätestens ab dem 1. November könnten Bürgerinnen und Bürger sich darauf einstellen, kündigte Laschet an.
Verkürzte Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants geplant
Zudem sollen die Regeln für Corona-Hotspots landesweit vereinheitlicht werden: Ab einem Inzidenzwert von 50 sind Laschet zufolge nur noch Treffen von fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten im öffentlichen Raum erlaubt. Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants sollen dann eingeschränkt werden. Öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern draußen und 250 Teilnehmern in Innenräumen müssten abgesagt werden. Feiern im privaten Raum dürften ab einem Inzidenzwert von 50 nur noch mit 25 Menschen veranstaltet werden. "Wenn wir alles richtig machen, wird es keinen zweiten Lockdown geben", sagte Laschet. Deshalb seien viele der nun eingesetzten Regeln prophylaktisch. Das oberste Ziel sei, Schulen und Kitas offen und die Wirtschaft am Laufen zu halten.
Die Zahl der Städte in Nordrhein-Westfalen mit einem kritischen Wert der Corona-Neuinfektionen war am Wochenende weiter gestiegen. Am 11. Oktober hatten Laschet zufolge neun Städte und Kreise den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Mit Herne, Recklinghausen, Essen, Unna, Hagen und Hamm sind darunter vor allem Orte im Ruhrgebiet. Auch in Köln, Solingen und Wuppertal wurde die Marke überschritten.
Die betroffenen Städte verschärfen die Schutzregeln. In Köln etwa müssen in Fußgängerzonen Masken getragen werden, Alkohol darf ab 22 Uhr nicht mehr im öffentlichen Raum getrunken werden und an Party-Hotspots gilt von jeweils Freitagabend bis Montagmorgen ein Verkaufsverbot für Alkohol. Von privaten Feiern rät die Stadt ab.
Runder Tisch Karneval: Keine öffentlichen Feiern zum Sessionsstart
Köln (epd). In Köln wird es zum Start der bevorstehenden Karnevalssession am 11. November keine öffentlichen Veranstaltungen seitens der organisierten Vereine geben. Pandemiebedingt würden auch vonseiten der Stadtverwaltung keine Partys und keine Feiermöglichkeiten auf Plätzen und Straßen zugelassen, teilte die Stadt Köln am 7. Oktober Ergebnisse von Gesprächen des Runden Tischs Karneval mit. An dem seit Jahren bestehenden Runden Tisch sind Vertreter von Stadt, Festkomitee, Polizei, Ordnungsamt, Interessengemeinschaften aus Altstadt und dem Kneipenviertel "Kwartier Latäng", Hotel- und Gaststätten und "Arsch Huh" beteiligt. Der 11. November fällt in diesem Jahr auf einen Mittwoch.
Reker: "Der 11.11. soll ein ganz normaler Werktag sein"
Es werde sich am 11. November nicht lohnen nach Köln zu kommen, betonte Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos). "Der 11.11. soll ein ganz normaler Werktag sein." Seitens der Stadtverwaltung seien keine Straßensperrungen geplant, und es würden keine öffentlichen Toiletten aufgestellt, "da gar nicht erst der Platz und der Raum für Ansammlungen geschaffen werden soll". Sollte es dennoch zu Ansammlungen kommen, würden diese von den Behörden "konsequent aufgelöst". Bestehen bleibe das für den 11.11. übliche Glasverbot. Damit solle auch der private Transport von Glasflaschen, etwa im Bollerwagen, unterbunden werden.
Darüber hinaus seien bereits Gespräche mit Vertretern der Gastronomie an karnevalistischen "Hot Spots" geführt worden, hieß es. Ziel der Stadtverwaltung sei, dass Betriebe an diesem Tag nicht öffneten oder nur mit Reservierungen arbeiteten. Diese Gespräche dauerten noch an. Ziel der Stadtverwaltung sei es auch, Kioske und Supermärkte dafür zu gewinnen, an diesem Tag auf den Verkauf von Alkoholika zu verzichten.
Traditionell markiert der 11.11. um 11.11 Uhr den Start zu rheinischen Karnevalssession. In Köln findet üblicherweise in der Altstadt ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Musikern, Büttenrednern und den Vereinen statt. Verkleidete Jecken prägen das Stadtbild, in den Stadtteilen, den "Veedeln", Kneipen und Gaststätten wird gefeiert.
In einer ersten Handreichung hat sich bereits das Festkomitee Kölner Karneval von 1823 an seine Vereine und Mitglieder gewandt, deren grobe Linie unter der Maßgabe "Kein Feiern um jeden Preis" zusammengefasst werden kann. Nur kleinere Alternativveranstaltung sollen unter Umständen unter strengen Auflagen möglich sein. In der kommenden Woche wollen Stadt und Festkomitee konkrete Pläne für die Session vorstellen, deren "tolle Tage" im kommenden Jahr rund um den Rosenmontag am 15. Februar liegen.
65 Millionen Euro Corona-Zuschüsse an Studenten ausgezahlt
Rund 120.000 Studenten haben 65 Millionen Euro Corona-Hilfen erhalten. 36 Prozent der Anträge wurden abgelehnt. Der Grund: Die Corona-Pandemie war nicht schuld an der Notlage. Das Deutsche Studentenwerk fordert eine Reform der Studienfinanzierung.Essen, Berlin (epd). Die Studenten- und Studienwerke haben von Juni bis September bisher rund 65 Millionen Euro Corona-Überbrückungshilfen des Bundesbildungsministeriums an Studierende ausgezahlt. Insgesamt hatten etwa 120.000 Studierende rund 244.000 Anträge auf Hilfe gestellt, von denen bisher rund 150.000 positiv beschieden wurden, wie das Deutsche Studentenwerk (DSW) am 7. Oktober in Berlin mitteilte. Das Ministerium hatte insgesamt 100 Millionen Euro für den nicht rückzahlbaren Zuschuss zur Verfügung gestellt. Zunächst hatten die Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe über die Zahlen berichtet.
Die Zahl der Anträge verteilt sich den Angaben zufolge unterschiedlich auf die einzelnen Monate: Waren es demnach im Juni noch mehr als 82.000, sank die Zahl im September auf rund 36.000. Zurzeit seien noch rund 9.000 in Bearbeitung. Insgesamt 36 Prozent der Anträge hätten abgelehnt werden müssen.
Deutsches Studentenwerk fordert Reform der Studienfinanzierung
"Bei mehr als der Hälfte der abgelehnten Anträge befanden sich die Studierenden zwar in einer finanziellen Notlage, diese war aber schon vor der Pandemie gegeben und nicht Folge der Pandemie", teilte das Deutsche Studentenwerk mit. Deswegen hätte die Überbrückungshilfe der Bundesregierung für pandemiebedingte Notlagen nicht greifen können. "Für diese Studierenden brauchen wir dringend eine strukturelle Reform der Studienfinanzierung", sagte DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde.
Insgesamt waren den Angaben zufolge 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Überbrückungshilfe betraut. "Diese Teams - vor Ort teilweise bis zu 80 Köpfe stark - mussten sich inhaltlich einarbeiten, ein neues Online-System bedienen lernen, und über Monate hinweg mehrere Tausend Anträge bearbeiten", erklärte der DSW-Generalsekretär. "Das war ein immenser Kraftakt und ein enormer Stresstest, den die Studenten- und Studierendenwerke erfolgreich bestanden haben."
Studierende an staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland konnten bis zum 30. September eine Überbrückungshilfe beim zuständigen regionalen Studierenden- oder Studentenwerk beantragen. Der Zuschuss zur Linderung von pandemiebedingten Notlagen konnte jeweils für die Monate Juni, Juli, August und September ausgezahlt werden. Das Bundesbildungsministerium weist nach Auslaufen der Zuschüsse auf den weiterhin möglichen Studienkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hin.
Umwelt
"Sehr gesunde Reaktion"

epd-bild/Nancy Heusel
Frankfurt a.M. (epd). "Hattest du schon einmal richtig Panik wegen des Klimawandels?", "Fühlst du dich beim Thema Klimawandel unverstanden?", "Wird dir wegen der Klimakrise manchmal alles zu viel?". Wer diese Fragen mit "Ja" beantworte, leide vielleicht unter "Klimaangst", so heißt es in einem Selbsttest im Internet. Zugegeben, Fachpersonen haben ihn nicht erstellt. Das Phänomen wird aber unter Experten durchaus ernst genommen.
"Der Klimawandel ist eine große Bedrohung und das macht vielen Menschen zu Recht Angst", sagt Peter Zwanzger, erster Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung. Aus medizinischer Sicht sei "Klimaangst", wie diese Sorge in sozialen Medien und Blogs oft genannt wird, aber kein Fachausdruck.
"Dass sich dieser Terminus umgangssprachlich entwickelt hat, zeigt, wie sehr Menschen dieses Thema bewegt", sagt der Psychiater, der in Wasserburg am Inn praktiziert. Erstmals beschrieben wurde das Phänomen schon vor rund zehn Jahren. Die American Psychological Association (Apa) definiert es als "eine chronische Angst vor dem ökologischen Untergang".
Warnung vor "Pathologisierung"
Psychiater und Klimaaktivist Felix Peter aus Stuttgart warnt: Durch den "undifferenziert verwendeten" Begriff der "Klimaangst" könne es zu einer "Pathologisierung der Klimabewegung" kommen. "Die Menschen, die sich engagieren, zeigen im Gegenteil eine sehr gesunde und angemessene Reaktion auf die Bedrohung durch den Klimawandel", betont er. Denn er bedeute eine dauerhafte Veränderung der Lebensbedingungen.
Dass Bedenken um die Folgen des Klimawandels viele Menschen umtreiben, zeigen jüngste Studien. Das amerikanische Pew Research Centre befragte im Sommer Menschen in 14 Ländern zu ihren aktuell größten Sorgen. In Deutschland wurde der Klimawandel am häufigsten genannt, noch vor Cyberattacken, Atomwaffen, Terrorismus und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten.
Mediziner Zwanzger betont den Unterschied zu einer wirklichen Angsterkrankung. Eine solche belaste das Leben der Betroffenen stark. Bei Panikerkrankungen überfalle die Angst Menschen "auf heimtückische Art und Weise", meist mit starken körperlichen Begleiterscheinungen wie Herzklopfen. Haben Patientinnen und Patienten eine generalisierte Angststörung, machten sie sich den ganzen Tag Sorgen. "Im Unterschied zu gesunden Menschen können sie aber nicht mehr abschalten, was sich dann massiv auf ihr Alltagsleben und ihre Arbeit auswirkt." Dass sich infolge der Sorge um den Klimawandel solche Erkrankungen entwickelten, sei aber "äußerst selten".
Angst kann auch Energie liefern
Neurologe Felix Peter ist auch Mitglied der "Psychologists for Future", die die Ziele der Klimabewegung "Fridays for Future" unterstützen. Mit wissenschaftlich-psychologischen Erkenntnissen will die Gruppe dazu beitragen, dass die Politik mit "angemessenen Konsequenzen" auf die Klimakrise reagiert. Peter schätzt die Zahl der Menschen, die in Deutschland durch den Klimawandel derzeit psychisch besonders stark belastet sind, "auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz".
Dazu gehörten Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen oder Personen mit psychischen Vorerkrankungen. Auch Forschende oder Aktivistinnen und Aktivisten, die sich besonders stark mit der Bedrohung auseinandersetzen, sowie Menschen, die etwa in der Landwirtschaft von einer funktionierenden Umwelt abhängig seien, seien stärker betroffen.
Angst muss nicht lähmen, sie kann auch Energie liefern, für Veränderungen zu kämpfen. "Die Menschen könnten zu Demonstrationen gehen oder sich anderweitig politisch engagieren", sagt Peter. Generell helfe, mit der Familie und Freunden darüber zu sprechen, welche Sorgen man habe und was sich ändern lasse. Auf der individuellen Ebene könne man überlegen, wie man sich klimafreundlicher verhalten könne. "Das kann aber nicht das Ende sein", betont Peter. "Wir warnen davor, den gesamten Druck auf Individuen zu verteilen, die das Problem gar nicht allein lösen können."
Auch Angstforscher Zwanzger fordert, die Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. Angst werde durch Unvorhersehbarkeit gestärkt. Es sei daher eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, so viel wie möglich über den Klimawandel herauszufinden "und den Menschen Sicherheit zu geben".
Leitentscheidung zur Braunkohle: Dörfer sollen weichen

epd-bild/Stefan Arend
Düsseldorf (epd). Außerdem soll zwischen dem Tagebau Garzweiler II und den anliegenden Dörfern ein größerer Abstand verbleiben, wie aus dem Entwurf einer neuen Leitentscheidung der schwarz-gelben Landesregierung hervorgeht, die NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am 8. Oktober im Düsseldorfer Landtag vorstellte.
Die Leitentscheidung beruht auf dem im Sommer verabschiedeten Kohleausstiegsgesetz des Bundes. Demnach soll die klimaschädliche Kohleverstromung bis spätestens 2038 beendet werden. NRW strebt dabei nach Pinkwarts Worten einen Ausstieg "möglichst schon 2035" an. Mit dem weiteren Braunkohleabbau im Tagebau Garzweiler II müssten dennoch weitere Dörfer weichen, erklärte der Minister. Das Land wolle den von einer Umsiedlung betroffenen Bewohnern aber mehr Zeit einräumen.
Demnach sollen zunächst die bereits weitgehend unbewohnten Ortschaften im Süden des Tagebaus abgebaggert werden. "So gewinnen wir einige Jahre Zeit, um auch für das letzte Umsiedlungsverfahren sozialverträgliche Lösungen zu finden", erläuterte Pinkwart. "Wir setzen alles daran, dass mit der Unterstützung aller Beteiligten der Wandel im Rheinischen Revier gelingt und die sich daraus ergebenden Chancen für die Region genutzt werden."
Die neue Leitentscheidung ist die Grundlage für die damit anstehenden Plan- und Fachverfahren. Erst nach deren Abschluss wird sie für das Braunkohle-Unternehmen RWE Power AG verbindlich. Bis 1. Dezember können sich die betroffenen Bürger, Städte und Gemeinden zu der neuen Leitentscheidung über ein öffentliches Online-Beteiligungsverfahren äußern. Die abschließende Entscheidung wird 2021 gefasst.
Bis die Bagger rollen

epd-bild/Heike Lyding
Dannenrod (epd). Die Bäume knarzen im Wind. Hoch oben in den Kronen, in 20 oder 25 Metern Höhe, schwanken die Baumhäuser, hin und her. Carl (Name geändert) lebt seit einem Monat in einem der Baumhäuser im Dannenröder Forst in Mittelhessen. "Ich habe von der Aktion gehört und Widerstandspflicht gespürt", sagt er. Der Wald soll bald gerodet werden für den Weiterbau der Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen.
Viele Wege im Wald sind mit Barrikaden aus Ästen und Stämmen versperrt. Überall hängen Banner: "Wir sind stark, weil DU da bist" steht auf einem mit bunten Händen bedruckten Stück Stoff. Junge Leute sind auf den Wegen unterwegs, dick eingepackt in Regenklamotten, einige tragen Schalen mit Müsli und Apfelstücken vorbei.
Sie lebten "freegan", erklärt Carl: vegan und von dem Essen, was irgendwo übrig bleibt. Auch die Klamotten sind oft gespendet. "Die Leute misten ihre Keller aus." Er lebe hier wie in einer Blase: Herrschafts- und eigentumsfrei, gegenseitiger Respekt, gendergerechte Sprache, "hohes ökologisches Bewusstsein". Fähigkeiten würden geteilt: "Man fragt rum, irgendjemand weiß, wie man etwas repariert."
"Räumungen verzögern"
Die Baumhäuser, Hütten und Zelte sind über den ganzen Wald verteilt. An einem Ort hat sich eine Art kleines Dorf gebildet: Ein Baumhaus dient zum Schlafen, eines als Küche, eines als Ruheraum und eines ist die Toilette. Die Häuser sind durch ein Seilsystem verbunden. Pello hat im Hambacher Wald, wo Umweltschützer gegen den Braunkohletagebau kämpfen, das Klettern gelernt. Er lebte dort zwei Monate lang, baute an Baumhäusern mit und machte sie winterfest. "Seitdem bin ich klimapolitisch aktiv." Pello ist sein Aktivisten-Name. "Die Situation fühlt sich gerade stärkend an. Aus Aktivisten-Sicht läuft viel gut. Wir schaffen es, die Räumungen zu verzögern."
Seit den 1960er Jahren gibt es Pläne, die A 49 zu bauen. Trassen wurden entworfen, diskutiert, vor Gerichten verhandelt, verworfen. Seit 1994 ist das erste Teilstück hinter Kassel fertig, seit Jahren endet die Autobahn im Nirgendwo zwischen Kassel und Gießen. Im Juni wies das Bundesverwaltungsgericht eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) ab. Am 1. Oktober begann die Rodungssaison im Wald. Jetzt wird gebaut.
In den benachbarten Wäldern, im Herrenwald und im Maulbacher Wald, hat eine Baufirma schon mit den Rodungen begonnen, unter massivem Polizeischutz. Auch dort lebten einige Aktivistinnen und Aktivisten in Baumhäusern, die Polizei brachte sie aus dem Wald heraus. "Wir reden viel darüber, bereiten uns emotional darauf vor und tauschen uns mit den Leuten aus, die schon Räumungen erlebt haben", sagt Carl.
Mischwald mit alten Bäumen
Sie sei in einer Industriestadt aufgewachsen, berichtet Katharina Jacob. Sie wisse, was es heißt, chronisch krank zu sein. "Deshalb setze ich mich für den Naturschutz ein." Zu Hause päppelt die 54-Jährige Fledermäuse auf, jetzt verbringt sie ihre Herbstferien im Dannenröder Wald. Es breche ihr das Herz, wenn sie an die Tiere denke, die den Rodungen zum Opfer fallen: die Fledermäuse, die ihre Höhlen suchen, die Füchse, die in ihren Bauten erdrückt werden.
Befürworter der Autobahn verweisen unter anderem auf die 750 Hektar Ausgleichsflächen, die als Ersatz für die 85 Hektar gerodeten Wald entstehen. Aber der Dannenröder Forst ist ein Mischwald mit teilweise uralten Buchen, Eichen, Fichten und Birken und nicht so einfach zu ersetzen. "Der Dannenröder Wald wird seit Jahrzehnten nachhaltig bewirtschaftet", sagt Linda vom Bündnis "Wald statt Asphalt". "Er wird gerodet für ein Projekt, das dem Individual- und dem Warenverkehr dient." Den Waldbesetzern geht es um mehr als um einen Wald: um eine Verkehrswende in Zeiten von Klimakrise und Artensterben.
Am Ortsrand von Dannenrod hat die evangelische Kirche in einer Gaststätte einen Ruheraum für die Aktivistinnen und Aktivisten eingerichtet. Demnächst soll dort auch eine Ärztin gelegentliche Sprechstunden abhalten, berichtet der Referent für Bildung und Ökumene, Ralf Müller. Vor der kleinen Kirche finden Friedensandachten statt. Wann im Dannenröder Wald gerodet wird, ist unklar. "Ich will später sagen können, dass ich alles versucht habe", sagt Carl. Er wird bleiben, bis die Bagger rollen.
Baumsterben durch Klimawandel: Historische Gärten schlagen Alarm
Stuttgart, Düsseldorf (epd). Das "Initiativbündnis Historische Gärten im Klimawandel" sieht seine Gartendenkmale zunehmend durch den Klimawandel bedroht. "Es ist nicht mehr fünf vor zwölf. Es ist inzwischen 12 Uhr für den dauerhaften Erhalt der historischen Gärten", erklärte Michael Hörrmann, einer der Sprecher des Bündnisses und Vorsitzender des Vereins Schlösser und Gärten in Deutschland, am 8. Oktober in Stuttgart. Das ergebe sich aus der Schadensbilanz dieses Jahres.
So hätten Trockenheit und Hitze große alte Bäume anfälliger für Schädlinge gemacht. Im Park von Schloss Benrath in Düsseldorf mussten demnach bereits in den ersten Monaten dieses Jahres 67 Bäume gefällt werden. Dabei seien auch viele mächtige Exemplare mit mehr als einem Meter Stammdurchmesser dem Wassermangel zum Opfer gefallen, Bäume, die das Bild des Gartens prägten, hieß es. Im 200 Jahre alten Park von Schloss Dyck bei Neuss seien inzwischen bis zu 20 Prozent des Baumbestandes als gefährdet bis stark gefährdet eingestuft.
In Hannovers Herrenhäuser Gärten seien im Frühjahr sämtliche Zisternen ausgetrocknet, der Totholzanfall sei um 30 Prozent gestiegen. Im Fürst-Pückler-Park Branitz in Brandenburg habe es im Frühjahr in der Austriebphase gerade einmal drei Prozent des langjährigen durchschnittlichen Niederschlags gegeben. Fichten und Kiefern stürben trotz intensiver Pflege flächig ab, hieß es. Eine zunehmende Zahl von Bäumen treibe gar nicht mehr aus. In Wilhelmshöhe in Kassel müssten dieses Jahr rund 400 abgestorbene Fichten entnommen werden, im großen Garten in Dresden seien seit Jahresbeginn bereits 250 Fällungen notwendig gewesen.
Die erforderlichen Sonderpflegemaßnahmen bedeuteten einen wachsenden finanziellen und personellen Aufwand, betont das Initiativbündnis. Dennoch sei die Lage für die historischen Gärten noch nicht hoffnungslos. Es brauche mehr Geld für zusätzliche Gärtner, Baumpfleger und Baumschulgärtner. Was jetzt unterlassen werde, müsse in den kommenden Jahren durch ein Mehrfaches an Ausgaben ausgeglichen werden. "Jetzt kommt es auf schnelle Hilfe an", hob das Bündnis hervor.
Gutachter: Uranexporte nach Russland verstoßen gegen EU-Recht

epd-bild / Friedrich Stark
Gronau/Berlin (epd). Atomkraftgegner sehen sich durch ein am 5. Oktober bekannt gewordenes Rechtsgutachten in ihrer Kritik an den Atommüllexporten aus dem westfälischen Gronau nach Russland bestärkt. Die Bundesregierung habe laut dem für die Grünen-Bundestagsfraktion erstellten Gutachten bei der Bewilligung der Uranexporte EU-Recht "massiv unterlaufen", kritisierte Matthias Eickhoff von der Initiative Sofortiger Atomausstieg Münster. Der Erlanger Staatsrechtler Bernhard Wegener kommt in seiner Bewertung, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, zu dem Schluss, dass die Exporte gegen Russland-Sanktionen der EU verstoßen, weil eine militärische Verwendung des Urans nicht ausgeschlossen werden könne.
Nach den sogenannten "Dual-Use"-Sanktionsrichtlinien der EU, die seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 in Kraft sind, ist der Export von potenziell militärisch nutzbaren Materialien nach Russland verboten. Gerade Uran falle "in besonderer Weise" in diese Kategorie, weil es zum Beispiel für uranhaltige Munition genutzt werden könne, erklärten der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) und die Münsterländer Anti-Atom-Initiativen.
Initiativen blockieren Zug mit Uran
Die Bundesregierung habe diese Möglichkeit bislang immer wieder ausgeblendet, hieß es. Aktivisten blockierten am 5. Oktober bei Münster einen für Russland bestimmten Transportzug mit abgereichertem Uran. Die Initiativen unterstrichen damit ihre Forderung nach einem sofortigen Stopp der Lieferungen.
In dem Gutachten heißt es, laut der EU-Sanktionsverordnung reiche schon die "bloße Möglichkeit einer militärischen Verwendung oder der Bestimmung für einen militärischen Endnutzer" für ein Verbot der Exporte von abgereichertem Uran aus. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) müsse sich als nationale Genehmigungsbehörde "aktiv ein Bild von den Risiken einer möglichen militärischen Verwendung machen", stellt der Rechtswissenschaftler Wegener fest.
Es erscheine ausgeschlossen, dass das Bafa zu der "für die Exportgenehmigung an sich erforderlichen informierten Überzeugung" gelangen konnte, dieses Risiko bestehe nicht, erklärte der Gutachter. Die dennoch erteilte Erlaubnis erscheine daher "mit Unionsrecht unvereinbar".
Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Sylvia Kotting-Uhl verlangte in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), jegliche Transporte von abgereichertem Uran nach Russland einzustellen und die Genehmigungspraxis des ihm unterstellten Bundesamtes auf ihre Rechtskonformität zu überprüfen. Kotting-Uhl forderte zudem, die Urananreicherungsanlage zu schließen.
Klöckner sieht Umbau der Nutztierhaltung auf gutem Weg

epd-bild/Harald Koch
Bonn (epd). Der geplante Umbau der Nutztierhaltung hin zu einer stärkeren Berücksichtigung des Tierwohls ist nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf einem guten Weg. Nach dem dazu im Sommer erfolgten Beschluss des Bundesrats müsse nun die langfristige Finanzierung gesichert werden, sagte Klöckner nach einem Branchengespräch am 9. Oktober in Bonn.
Die Tierhalter müssten bei der Umgestaltung begleitet werden und bräuchten Planbarkeit, betonte die Ministerin. Mehr Außenfläche und Frischluft für die Schlachttiere bedeute, dass Landwirte ihre Stallungen umbauen müssten. Unter anderem seien dafür Änderungen im Baugesetzbuch geplant. Eine Machbarkeitsstudie solle zudem in den nächsten Monaten klären, ob die geplanten Tierwohlabgabe als Verbrauchssteuer eingeführt werden könne. Die Prüfung, ob sich die Pläne mit dem Europarecht vereinbaren ließen, sei unabdingbar.
Fonds soll zur Modernisierung von Ställen dienen
Die Ministerin schlägt einen Aufpreis von 40 Cent je Kilo Fleisch im Handel vor. Das zusätzliche Geld soll in einen Fonds fließen, aus dem die Landwirte Mittel für Investitionen zum Umbau der Ställe bekommen. Zu dem seit Sommer zweiten Branchentreff kamen Klöckner und ihre Amtskolleginnen aus NRW, Ursula Heinen-Esser, und Niedersachsen, Barbara Otte-Kinast (beide CDU) mit rund 60 Vertretern aus Tierhaltung, Schlachtereien, Ernährungswirtschaft und Lebensmittelhandel zusammen.
Mit Blick auf die Corona-Krise berichtete Klöckner, dass die Schlachtkapazitäten trotz zurückliegender vereinzelter Schließungen weitgehend wieder auf einem Niveau von 95 Prozent liegen. Allerdings sei der Schweinepreis auch wegen der grassierenden afrikanischen Schweine-Pest "in den Keller" gerutscht.
Die Schweinezüchter sind derzeit in einer schwierigen Situation. Weil einige Schlachthöfe und Zerlege-Betriebe wegen der Corona-Pandemie nicht mit voller Kapazität arbeiten, können nicht alle Tiere verarbeitet werden. Die Tiere bleiben damit länger im Stall. Allein in Niedersachsen, einer Hochburg der Schweinezüchtung, können laut Otte-Kinast derzeit pro Woche rund 120.000 Tiere nicht geschlachtet werden.
Vor diesem Hintergrund appellierten die Landwirtschaftsministerinnen von NRW und Niedersachsen an die Schweinezüchter, die Produktion entsprechend anzupassen, um den Druck aus den Ställen zu nehmen. Heinen-Esser rechnet noch für die nächsten neun bis zwölf Monate mit einer schwierigen Lage bei den Schlachtbetrieben.
Rote Liste: 30 Tierarten in Deutschland bedroht

epd-bild / Aktion Fischotterschutz e.V.
Bonn (epd). Tiere wie der Feldhase, Schweinswale oder die Bechsteinfledermaus sind in Deutschland gefährdet. Der Zustand vieler Säugetiere hat sich in den vergangenen 15 Jahren verschlechtert, zeigt die am 8. Oktober vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) und dem Rote-Liste-Zentrum (RLZ) in veröffentlichte "Rote Liste Säugetiere". Insgesamt seien 30 Arten und Unterarten und damit 31 Prozent der bewerteten Säugetiere Deutschlands bestandsgefährdet, sagt die Präsidentin des Bundesamts, Beate Jessel. Die Arten seien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder gefährdet. Zehn weitere Arten stehen auf der sogenannten Vorwarnliste.
lltis erstmal als gefährdet eingestuft
Das Vorkommen der Tiere gehe zurück, weil die menschliche Nutzung ihrer Lebensräume weiter zunehme, sagte Jessel. "Die Auswirkungen unserer Nutzungen sind es auch, die dazu geführt haben, dass das Graue Langohr als Fledermaus, der Luchs und der Zwergwal jetzt als vom Aussterben bedroht eingestuft sind." Erstmal als gefährdet eingestuft wurde etwa der Iltis. Für insgesamt 97 in Deutschland heimische Säugetiere haben die Autorinnen und Autoren der nach gut zehn Jahren grundlegend aktualisierten Roten Liste die Bestandssituation und das Ausmaß der Gefährdung ermittelt.
Positiv entwickelt haben sich den Angaben zufolge in den vergangenen zehn bis 15 Jahren hingegen die Bestände von 17 Säugetieren und damit rund 18 Prozent der bewerteten Arten und Unterarten, etwa die Atlantische Kegelrobbe, der Fischotter oder die Fledermaus Großes Mausohr. Ausschlaggebend dafür seien vor allem Maßnahmen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes gewesen. Bei weiteren 39 Arten sei zumindest eine stabile Entwicklung festgestellt worden. Das sei oft gezielten Artenhilfsmaßnahmen zu verdanken.
In der Roten Liste sind insgesamt zehn Säugetierarten als ausgestorben oder verschollen aufgeführt. Dazu gehören etwa der Große Tümmler (Delfin) oder das Europäische Ziesel (Erdhörnchen). Dank neuer Erfassungsmethoden, etwa durch Fotofallen, sei bei einigen Arten die Datenlage in der Roten Liste deutlich verbessert worden, erklärte Holger Meinig, Säugetierexperte und Erstautor.
NRW unterstützt ehrenamtliche Umwelt- und Naturschutzprojekte
Düsseldorf (epd). Das nordrhein-westfälische Umweltministerium unterstützt Projektideen von ehrenamtlichen Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen, die sich für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz einsetzen. Im Rahmen eines Programms zur "Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements" können sie fachliche Beratung bekommen, wie das Staatssekretär Heinrich Bottermann am 7. Oktober in Düsseldorf ankündigte. Das betreffe etwa Unterstützung bei einer Vereinsgründung oder Hilfe bei der Beantragung von Fördergeldern.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Organisationen können sich bis Ende Januar 2021 bewerben. Sie müssen ihre Ideen in einer Projektskizze beschreiben und deutlich machen, wo sie fachliche Beratung wünschen. Pro Initiative können den Angaben zufolge Beratungskosten von bis zu 20.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.
Mehr Recyclingpapier in Städten, Kreisen und an Hochschulen
Berlin, Paderborn (epd). Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat Städte, Landkreise und Hochschulen ausgezeichnet, die bei ihrem Papierverbrauch stark auf Recyclingpapier setzen. Die Gewinner des "Papieratlas 2020" erreichen durchschnittliche Recyclingpapierquoten zwischen 91 Prozent (Städte), 85 Prozent (Landkreise) und 75 Prozent (Hochschulen).
Als recyclingpapierfreundlichste Stadt wurde Erlangen ausgezeichnet, bei der Landkreisen ist Paderborn Sieger, bei den Hochschulen die Fernuniversität Hagen. Daneben gingen Auszeichnungen für die "Aufsteiger des Jahres" an Cuxhaven, den Ilm-Kreis in Thüringen und die Universität Köln. Die Städte Freiburg und Siegen sowie die Universität Tübingen wurden für ihr herausragendes langjähriges Engagement bei der Verwendung von Recyclingpapier ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird seit 2008 alljährlich von der Initiative Pro Recycling in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium, den Kommunalverbänden und Umweltschutzorganisationen veranstaltet.
Beste Strategie: Papier vermeiden
Schulze erklärte am 6. Oktober in Berlin, Recyclingpapier mit dem Umweltzeichen des Bundes, dem Blauen Engel, sei dem Normalpapier in der Umweltbilanz weit überlegen. 88 Prozent der Fasern kommen ihr zufolge aus den hiesigen Altpapiersammlungen. Bei der Produktion werden weniger Energie und 70 Prozent weniger Wasser verbraucht. Für neues Papier werden demgegenüber zwei Drittel der Fasern importiert, davon 40 Prozent aus Südamerika.
Fasern aus Eukalyptus-Plantagen in Brasilien über Tausende von Kilometern zur Papierproduktion nach Deutschland zu transportieren, sei "kein nachhaltiges Modell", sagte Schulze. Das Bundesumweltministerium verwende zu 100 Prozent Recyclingpapier. Die beste Strategie sei indes, Papier zu vermeiden, wo es möglich ist. Dabei werde die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielen.
Hierzulande werden pro Jahr rund 20 Millionen Tonnen Papier, Karton und Pappe verbraucht. Hinter China, den USA und Japan ist Deutschland das Land mit dem vierthöchsten Verbrauch. Er geht seit Jahren nicht zurück, verändert sich aber. Grafische Papiere und damit auch Büropapier machten vor 20 Jahren noch die Hälfte des Verbrauchs aus, heute ein Drittel. Im Gegenzug steigt der Bedarf an Papier, Pappe und Karton durch den Online- und Versandhandel stark an.
Soziales
Sterben soll seine Zeit bekommen

epd-bild/Jens Schulze
Hannover (epd). Auf der Kommode vor dem Bett funkeln Ohrringe mit bunten Steinen und Halsketten. "Jeden Tag trage ich meinen Schmuck", sagt Gudrun Hoppe. Die zierliche Frau mit kahlem Kopf und blauen Glitzerohrringen setzt sich mit etwas Mühe auf einen Stuhl neben der gläsernen Terrassentür und blickt in den herbstlichen Garten. "Ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals wieder schaffe, mich auch nur aufrecht zu halten." Die 61-Jährige aus Hannover ist ins evangelische Uhlhorn-Hospiz gebracht worden, um zu sterben.
Doch es kam anders. Im Hospiz ging es Hoppe, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs leidet, plötzlich besser. Das ist zwei Monate her. Sie hofft nun, entlassen zu werden. "Für Menschen, die schwer krank sind, kommt es oft anders als gedacht", sagt Hospizleiterin Gabriele Kahl. Zwar seien die Krankheitsverläufe nicht immer so außergewöhnlich wie bei Gudrun Hoppe. "Aber je nach dem, wie sie sich fühlen, entscheiden sich unsere Patienten mehrmals um, was ihr Leben und ihre Therapie angeht." Mal sagten sie, sie möchten nicht mehr leben und sich auch nicht weiter behandeln lassen. Dann, wenn die Schmerzmittel wirkten, kämpften sie wieder um jeden Tag. "Das ist vollkommen normal", sagt Kahl. "Nur: Würden wir Sterbehilfe leisten, auf welchen dieser widersprüchlichen Wünsche sollten wir hören?"
Skepsis bei Palliativmedizinern
Das Thema Sterbehilfe wird seit Monaten wieder kontrovers diskutiert. Ausgangspunkt ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Vor rund acht Monaten hat das oberste deutsche Gericht das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben. Selbst in den Kirchen ist das Für und Wider der Sterbehilfe seitdem Gegenstand intensiver Debatten. So hat sich unter anderem der evangelische Landesbischof Ralf Meister aus Hannover dafür ausgesprochen, bei der anstehenden gesetzlichen Neuregelung den Sterbewunsch von Schwerkranken ernst zu nehmen und den assistierten Suizid unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen - auch in kirchlichen Einrichtungen.
Die Mehrheit der Deutschen stimmt Umfragen zufolge dem Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben zu. Viele Palliativmediziner und Pflegende, die unheilbar erkrankte Menschen begleiten und behandeln, sehen diese Haltung indes kritisch.
Zu den Kritikern gehört auch Anke Reichwald, Geschäftsführerin des Uhlhorn-Hospizes. Sie bemängelt, das Bundesverfassungsgericht habe aus rein theoretischer Sicht geurteilt. Dass jemand sich bewusst für den Tod entscheide, um seinem Leid ein Ende zu setzen, komme selten vor: "Wir erleben in der Praxis eher das Gegenteil." Schwerstkranke, sogar Hochbetagte, bettelten regelrecht um noch eine Chemotherapie oder Antibiotika-Behandlung. Dass sie angesichts ihrer Diagnose so reagierten, überrasche viele selbst. "Das sind Entscheidungen, die wir uns schlicht nicht vorstellen können, solange wir gesund sind", sagt Reichwald.
"Leid lindern"
Auch der hannoversche Palliativmediziner Christian Seifert steht der Sterbehilfe ablehnend gegenüber. Seine Aufgabe sieht der 48-Jährige darin, seine Patienten so zu therapieren, dass sie nicht an den Punkt kommen, sich einen assistierten Suizid zu wünschen. Nur in sehr wenigen Einzelfällen sei eine ausreichende schmerz- und symptomlindernde Versorgung nicht möglich. In diesen Ausnahmefällen komme eine palliative Sedierung als letzte Möglichkeit in Betracht. Und auch wenn infolge dieser medizinisch herbeigeführten Bewusstlosigkeit die Patienten früher sterben, so sieht Seifert doch einen erheblichen Unterschied zu bewusster Sterbehilfe. "Unsere Intention als Palliativmediziner ist ausschließlich, Leid zu lindern."
Diese Überzeugung teilt Marion Pelzer. Die Palliativkrankenschwester beschreibt ihre Tätigkeit mit drei Worten: einlassen, aushalten, da sein. Seit mehr als drei Jahrzehnten pflegt sie Schwerstkranke und Sterbende, und seit acht Jahren arbeitet sie beim ambulanten Palliativdienst im evangelischen Friederikenstift in Hannover. Über die Sterbehilfe-Debatte sagt die 59-Jährige: "Ich bin erschrocken." Menschen, die unheilbar krank sind und am Ende ihres Lebens stehen, seien in existenzieller Not. "Sie sind verzweifelt, und es kann dazu kommen, dass sie den Wunsch äußern, sterben zu wollen." Das aber bedeute meist nicht, dass sie wirklich sterben wollten, sondern sei Ausdruck einer extremen Überforderung.
Noch einmal ans Meer
Diese Menschen bräuchten jemanden, der für sie da sei und sich nicht mit in den Strudel der Verzweiflung ziehen lasse. Pelzer befürchtet, dass sich Sterbende nicht trauen, ihrem Umfeld ihr Leid zuzumuten, wenn die Möglichkeit im Raum stehe, vorzeitig aus dem Leben scheiden zu können. "Dann müssten sie sich entscheiden, ob sie anstrengend sein dürfen", sagt sie. Den Sterbeprozess abzukürzen, sieht Pelzer auch deshalb kritisch, weil in dieser Phase oft Wichtiges geklärt werde. "Da kommt viel in Bewegung", sagt sie. Betroffene wollten sich verabschieden, aussprechen, versöhnen. "Das braucht Zeit."
Auch Gudrun Hoppe hat noch Pläne. Sie möchte unbedingt noch einmal mit ihrem Mann ans Meer, die Füße ins Wasser tauchen. Zum Urteil aus Karlsruhe sagt die gelernte Hauswirtschaftsleiterin flapsig: "Was, wenn einer in desolater Lage ist, und die anderen wollen ihn von der Platte putzen?" Sie selbst möchte auf keinen Fall Sterbehilfe. "Ich bitte den lieben Gott darum, dass er meine Aufenthaltsgenehmigung weiter verlängert."
Ohne Augenlicht mit der Digitalisierung Schritt halten
Für Menschen ohne Sehvermögen ist das Tempo der Digitalisierung eine Herausforderung: Jedes neue Konferenz-System und jede neue App erfordern ein Umlernen. Und: Viele Angebote sind nicht barrierefrei.Berlin (epd). Über die nächsten Monate im Schatten der Corona-Pandemie macht sich Leonore Dreves keine Illusionen. "In einer Zeit wie dieser kümmert sich niemand um Randgruppen", sagt sie: "Da müssen wir sehr laut schreien, damit wir gehört werden." Dreves ist von Geburt an blind. Die Softwareentwicklerin arbeitet teils im Homeoffice, teils im Büro. Doch beides hat etliche Tücken, wie sie berichtet.
Trotz voll ausgestattetem Arbeitsplatz zu Hause hatte sie mit dem wachsenden Angebot an digitalen Anwendungen zu kämpfen, vor allem im Austausch mit anderen: "Wie kann ich eine Selbsthilfegruppe moderieren, wenn ich nichts sehe?"
Der derzeitige Digitalisierungsschub droht blinde und sehbehinderte Menschen abzuhängen, warnen Experten. Das fängt im Homeoffice an: Ohne Arbeitsplatz mit Hilfsmitteln, Vorlesesoftware und einer guten Ausleuchtung können die Betroffenen nur bedingt zu Hause arbeiten. Viele Videokonferenzen und Team-Tools sind nur in Teilen oder gar nicht barrierefrei.
Online-Handel soll barrierefrei werden
Dazu kommen die privaten Lebensumstände: "Viele von uns leben allein, die sozialen Kontakte laufen über die Arbeit. Wenn das dauerhaft wegbricht, ist das tragisch", sagt Dreves.
Dabei hatte die EU die Grundlage für eine barrierefreie Digitalisierung bereits im vergangenen Jahr gelegt - mit der Barrierefreiheitsrichtlinie, dem European Accessibility Act (EAA), der bis 28. Juni 2022 in deutsches Recht gegossen sein muss. Die EU regelt darin die Anforderungen an barrierefreie Produkte und Dienstleistungen. Wie viel die Betroffenen damit gewinnen, ist jedoch offen. Für die Praxis sei in erster Linie die nationale Gesetzgebung maßgebend, nicht die EU-Richtlinie, erklärt die Bundesfachstelle Barrierefreiheit.
Unter anderem soll der Online-Handel großer Anbieter barrierefrei werden, außerdem Bankendienstleistungen, Geldautomaten und Zahlungssysteme zum Beispiel im Supermarkt, der öffentlich Nachverkehr und E-Books sowie PCs, Smartphones, Laptops und Tablets.
"Es wird darauf ankommen, wie Deutschland die Vorgaben interpretiert", sagt die Rechtsreferentin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV), Christiane Möller. "Auf europäischer Ebene hat die Wirtschaft bereits einige Lobbyarbeit geleistet, so dass leider nicht für alle Produkte und Dienstleistungen Barrierefreiheit zur Pflicht wird", bemängelt sie. Nicht einbezogen seien etwa Haushaltsgeräte.
Selbsthilfe-Organisationen unzufrieden
Unterstützung erhält der DBSV vom Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Schule und Beruf (DVBS). Beide Verbände fordern die Regierung auf, über die EU-Richtlinie hinauszugehen und Unternehmen zu verpflichten, beispielsweise beruflich genutzte Computer oder Geschäftskonten ebenfalls barrierefrei anzubieten. Außerdem müsse geklärt werden, was der Begriff Barrierefreiheit konkret bedeutet, erklärt die DVBS-Vorsitzende Ursula Weber.
Von der Bundesregierung sei bislang zu dem Thema nichts zu hören, kritisiert der inklusionspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Sören Pellmann. Die Umsetzung der vorherigen EU-Richtlinie zur digitalen Barrierefreiheit bei öffentlichen Stellen sei so spät erfolgt, dass jetzt "nichts Gutes zu erwarten ist". "Inakzeptabel" sei im Rückblick die Beteiligung der Selbsthilfe-Organisationen. Diese hätten nur knapp eine Woche Zeit erhalten, um auf den Referentenentwurf zu reagieren. Zudem müsse Barrierefreiheit unter anderem für den ganzen öffentlichen Verkehr gelten, auch im Tourismus, forderte er.
Die Grünen halten der Bundesregierung vor, sie verkenne das Innovationspotenzial von barrierefreien Angeboten. Die behindertenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Corinna Rüffer, verlangt, dass das nationale Gesetz über die Mindestanforderungen der EU-Richtlinie hinausgehen und die Privatwirtschaft umfassend zu Barrierefreiheit verpflichten müsse.
Grundsätzlich bewertet Christiane Möller vom DBSV die Digitalisierung als Chance für blinde und sehbehinderte Menschen. Durch Vergrößerungssoftware, Apps, die Texte in Braille-Blindenschrift übersetzen, oder eine automatisierte Sprachausgabe sei für die Betroffenen schon jetzt mehr Teilhabe möglich. "Diese Vorteile können wir aber nur nutzen, wenn Webseiten, Apps und Bedienoberflächen barrierefrei programmiert sind."
Covid-19-Fehlermeldesystem soll Kliniken und Heimen helfen
Detmold (epd). Die Gesellschaft für Risikoberatung in Detmold hat gemeinsam mit weiteren Fachleuten ein Corona-Fehlermeldesystem entwickelt. "Covid-19 Special" soll Kliniken, Pflegeheime und Arztpraxen helfen, aus Fehlern im Umgang mit Infizierten oder Verdachtsfällen zu lernen, um diese künftig zu vermeiden, wie Geschäftsführer Peter Gausmann dem Evangelischen Pressedienst (epd) erläuterte. Jeder Arzt oder Pfleger, aber auch jeder Patient und jeder Bürger könne in dem Online-Portal kritische Ereignisse, Versäumnisse, Sicherheitslücken und Fehler melden und sich über gemeldete Fehler informieren.
"Wir stellen das als Akt der Solidarität allen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung, um allen, die corona-infizierte Patienten versorgen, Hilfestellung zu bieten", sagte Gausmann. Es gehe bei dem System nicht darum, Menschen zu denunzieren oder Kliniken an den Pranger zu stellen, betonte er. Das System setze auf Transparenz sowie die Mitarbeit und das Risikobewusstsein der Mediziner und Pflegeexperten.
Online-Portal frei verfügbar
Sie sollen sich auf der Homepage regelmäßig informieren und so auf potenzielle eigene Fehlerquellen stoßen. "Das Ganze beruht auf der Grundphilosophie, dass Ärzte und Pflegende sich die Meldungen anschauen und überlegen: Könnte das auch bei uns passieren?", erläuterte Gausmann. Das Portal ist online über das allgemeine Fehlermeldesystem Cirs (Critical Incident Reporting System - Meldesystem für kritische Ereignisse) verfügbar.
Alle Meldungen werden den Angaben zufolge vor der Veröffentlichung anonymisiert. Für jeden einzelnen Fall werden Empfehlungen abgegeben, wie künftig Fehler oder kritische Ereignisse vermieden werden können und wie sich derjenige verhalten soll, der das Ereignis gemeldet hat. Auch diese Empfehlungen sind einsehbar.
Der Erfolg des Systems hänge stark davon ab, wie ernst Kliniken und Arztpraxen das Thema Patientensicherheit nähmen, betonte Gausmann. Vor allem seit der Verabschiedung des Patientenrechtegesetzes 2014 gewinne das Thema an Bedeutung. "Für immer mehr Krankenhäuser ist das eines ihrer Unternehmensziele", sagte der Gesundheitsökonom und Pädagoge. Dort würden in regelmäßigen Fallkonferenzen Todesfälle und Komplikationen untersucht. Auch die Medizinstudenten müssten sich mittlerweile mit Patientensicherheit auseinandersetzen.
Laumann ruft zu Grippeschutzimpfung auf

epd-bild / Andrea Enderlein
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat zur Grippeschutzimpfung aufgerufen. Gemeinsam mit den Ärztekammern, den Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen betonte der Minister am 6. Oktober in Düsseldorf vor allem die Bedeutung der Impfung für die gefährdeten Personengruppen der über 60-Jährigen, von Menschen mit chronischen Erkrankungen, für Schwangere sowie pflegerisches und medizinisches Personal in der Corona-Pandemie. "Der Nutzen nicht nur für sich selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen, sei es die Familie oder die Arbeitskollegen, ist hoch", erklärte Laumann.
Grade in der Pandemie sei eine hohe Influenza-Impfquote bei Risikogruppen und exponierten Berufsgruppen wichtig, um in der Grippewelle schwere Krankheitsverläufe zu verhindern, erklärte das Ministerium. So sollen Engpässe in Krankenhäusern, vor allem bei Intensivbetten und Beatmungsplätzen, vermieden werden. In der kommenden Influenzasaison 2020/21 sei mit den verfügbaren Impfstoffmengen der größte Effekt erzielbar, wenn die Impfquoten in den empfohlenen Gruppen deutlich gesteigert würden. Der Minister appellierte: "Nutzen Sie bei erhöhtem Risiko für eine schwere Erkrankung oder als möglicher Überträger die Impfangebote in Betrieben, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt - lassen Sie sich impfen!"
Ärzte empfehlen Impfung besonders für Risikogruppen
Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung gegen Influenza für Bevölkerungsgruppen, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf einer Influenza haben. Laumann warnte, die Impfquoten habe in den vergangenen Jahren in den gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie etwa in der Altersgruppe der über 60-Jährigen nur bei circa 35 Prozent gelegen und bei nur etwa 20 bis 50 Prozent bei Personen mit chronischen Grundleiden. Das sei "nicht ausreichend".
Mit einem gemeinsamen Schreiben bitten die Ärztekammern, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Krankenhausgesellschaft NRW und der Gesundheitsminister zudem die Krankenhäuser und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte um Unterstützung, zu einer Steigerung der Impfquoten in den Risikogruppen sowie dem pflegerischen und medizinischen Personal beizutragen.
Je nach Schwere der Grippewelle werden nach Ministeriumsangaben in Deutschland schätzungsweise fünf bis 20 Prozent der Bevölkerung infiziert. Zudem gebe es bis zu sieben Millionen Influenza-bedingte Arztbesuche und rund 3.000 bis 30.000 Krankenhauseinweisungen. In Deutschland treten saisonale Grippewellen im Winterhalbjahr meist nach dem Jahreswechsel auf. Die Impfung wird für Oktober und November empfohlen, damit der Körper ausreichend Zeit hat, einen Impfschutz aufzubauen.
Ärzte warnen: Versorgung in Kinderkliniken "akut gefährdet"
Rund 40 Prozent der Betten auf Kinderstationen sind in den vergangenen 25 Jahren in Deutschland weggefallen. Kinderärzte fordern ein Einlenken der Politik. Auf ihrem Herbstkongress geht es auch um Corona, Impfungen und Geschlechtsumwandlungen.Köln (epd). Die medizinische Versorgung in Kinderkliniken und -stationen ist laut den deutschen Kinder- und Jugendärzten "akut gefährdet". Die aktuelle finanzielle Ausstattung reiche bei weitem nicht aus, um die über eine Million Kindern pro Jahr stationär angemessen versorgen zu können, mahnte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) zum Start des 48. Herbst-Kongresses am 8. Oktober in Köln.
Nach Angaben von Vizepräsident Wolfgang Kölfen ist in den vergangenen 25 Jahren rund ein Viertel der Kinderkliniken und Kinderabteilungen an Krankenhäusern geschlossen worden. In dem Zeitraum hätten 40 Prozent aller Betten abgebaut werden mussten. Dabei seien die fachlichen, personellen und auch finanzielle Anforderungen an Kinderkliniken stetig gewachsen, sagte der Arzt von der Klinik für Kinder und Jugendliche am Elisabeth-Krankenhaus Rheydt in Mönchengladbach. Denn heute könne Kindern geholfen werden, für die es vor zehn Jahren noch keine Behandlungsmöglichkeit gab, etwa bei schweren Krebserkrankungen, Stoffwechselkrankheiten oder Epilepsien.
Verband fordert Änderungen bei Fallpauschalen
Die Versorgung kranker Kinder sei besonders zeit-, personal- und materialaufwändig, erläuterte der Mediziner. Das System der Fallpauschalen, mit dem die Leistungen in den Kinderkliniken einheitlich vergütet werden, sehe den Zusatzaufwand aber nicht vor. So würden immer mehr Kinderkliniken in finanzielle Schieflage geraten. Falls nicht schnell gegengesteuert wird, seien weitere Schließung von Kinderabteilungen oder gar ganzer Kinderkliniken zu erwarten. Kölfen forderte "klare Leitplanken von der Politik" um die Vergütung der Kliniken dem erhöhten Aufwand anzupassen. Denkbar sei, die Pädiatrie im Fallpauschalensystem besser zu stellen oder durch einen Mix zeitgemäßer Grundpauschalen auskömmlicher zu finanzieren.
Martin Terhardt, Kinder- und Jugendarzt und Mitglied der Ständigen Impfkommission (Stiko), unterstrich die Bedeutung vom Impfungen. Bei zu niedrigen Impfquoten könne es immer wieder zu regionalen Ausbrüchen bei ungenügend geschützten Menschen kommen, wie in den vergangenen Jahren bei Masern. Terhardt empfahl Ärztinnen und Ärzten, die Beratungsgespräche mit Impfgegnern und -skeptikern sehr sensibel zu führen. Argumentativ könnten etwa Mythen wie die Korrelation von Impfen und Autismus entkräftet werden. Auch die Theorie, dass das Durchmachen von Krankheiten besser sei als das Impfen dagegen, könnten medizinisch gut widerlegt werden.
Insgesamt stünden etwa 80 Prozent der Eltern in Deutschland Impfungen ihrer Kinder befürwortend oder eher befürwortend gegenüber. Den Anteil der Impfskeptiker unter Eltern bezifferte er auf etwa 14 Prozent, die Quote der "notorischen Impfgegner" auf zwei bis fünf Prozent.
In Deutschland fehlen 342.000 Kita-Plätze für Kleinkinder
Berlin, Köln (epd). In Deutschland fehlen einer Untersuchung zufolge derzeit etwa 342.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Das geht aus einer unveröffentlichten Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Die Betreuungslücke habe damit trotz Milliardeninvestitionen seit 2015 um mehr als 127.000 Plätze zugenommen. Grund dafür seien sowohl veränderte Betreuungswünsche der Eltern als auch die gestiegenen Kinderzahlen, hieß es in der Studie. Zuerst hatte die "Welt am Sonntag" darüber berichtete.
Bezogen auf alle Kinder unter drei Jahren gab es laut IW bundesweit für jedes siebte (14,4 Prozent) keinen Platz in Kindertagesstätten und bei Tagespflegepersonen. Im Jahr 2015 waren es 10,2 Prozent. Allerdings dürfte der Studie zufolge die Betreuungsquote in den kommenden Jahren in den meisten Regionen Deutschlands auch ohne die Einrichtung einer größeren Zahl neuer Plätze steigen, da die Geburtenzahlen seit 2016 gesunken sind.
Betreuungslücken im Saarland und NRW besonders groß
In den Bundesländern ist die Entwicklung der IW-Berechnung zufolge zum Teil sehr unterschiedlich: Besonders große Lücken weisen das Saarland auf, wo für 19,8 Prozent der unter Dreijährigen Betreuungsplätze fehlen, Bremen mit 19,1 Prozent und Nordrhein-Westfalen mit 18,9 Prozent. Deutlich besser ist die Lage der Studie zufolge in den ostdeutschen Bundesländern. Davon ausgehend, dass vor allem Zwei- und Dreijährige in Einrichtungen betreut werden sollen, kommen sie mit Betreuungsquoten von 52,8 Prozent in Sachsen und 58,3 Prozent in Sachsen-Anhalt nahe an den Bedarf. Allerdings sei die Personalausstattung dort mit durchschnittlich 5,7 Kindern pro Betreuungsperson kaum ausreichend (Westen 3,6 Kinder). Ein Wert von 3,0 sei pädagogisch sinnvoll.
Das Bundesfamilienministerium verwies in Bezug auf die Betreuungslücke laut "Welt am Sonntag" auf den Ausbau von 135.000 Plätzen seit 2015. "Es stimmt aber, dass weiterhin Plätze fehlen und auch, dass die Differenz zwischen Betreuungsbedarf und Betreuungsquote zwischen 2015 und 2020 gestiegen ist", sagte eine Sprecherin der Zeitung. Der von den Eltern geäußerte Bedarf sei über die Jahre hinweg ebenfalls gestiegen - und zwar um 6,2 Prozentpunkte auf 49,4 Prozent im Jahr 2019. Das entspricht laut IW-Berechnungen rund 1,17 Millionen benötigten Plätzen für unter Dreijährige.
Im März besuchten in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 829.200 Kinder in diesem Alter eine Tagesstätte oder eine öffentlich geförderte Tagespflege, die Betreuungsquote betrug 35 Prozent.
Ein Haus für Geschwister in Not

epd-bild/Thomas Lohnes
Darmstadt, Bremen (epd). Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung: Werden Kinder in einer akuten Notsituation vom Jugendamt aus der Familie geholt, haben sie meist Schlimmes hinter sich. Hinzu kommt: Sehr häufig werden sie dabei nicht nur von ihren Eltern getrennt, sondern auch von ihren Geschwistern. Viel zu oft habe er miterlebt, wie Kinder mitten in der Nacht regelrecht auseinandergerissen worden seien, sagt Peter Büttner, Psychotherapeut und Geschäftsführer des Kinder- und Jugendhilfeprojekts "Petra": "Es bricht einem das Herz."
Deshalb hat das Projekt "Petra" in Darmstadt Anfang des Jahres das nach eigenen Angaben erste Geschwisterhaus in Deutschland eröffnet - ein bundesweites Pilotprojekt, das wissenschaftlich begleitet wird. Im Juni folgte das SOS-Kinderdorf in Bremen mit einem Geschwisterhaus.
In der Jugendhilfe würden Kinder leider viel zu häufig als Einzelfälle betrachtet, berichtet auch der Leiter des Bremer Geschwisterhauses, Lars Becker. "Wir machen von Anfang an klar: Ihr seid eine Familie, ihr bleibt zusammen."
Großer Bruder schafft Vertrautheit
Warum das so wichtig ist? "Man muss sich nur die erste Nacht vorstellen", sagt der Sonderpädagoge. Ein zwei, drei Jahre altes Kind übernachte in der Regel zum ersten Mal in seinem Leben nicht zu Hause, ohne Mutter oder Vater, noch dazu in einer Krisensituation. "Was bietet ihm Sicherheit? Alles, was vertraut ist." Der Bruder, die Schwester. Sie vermittelten das Gefühl, nicht alleine zu sein, die Situation gemeinsam durchzustehen.
Becker ist überzeugt: "Geschwister sind eine wichtige Ressource, gerade in so einer schwierigen Zeit." Tagsüber flitze der Vierjährige vielleicht mit gleichaltrigen Kindern durchs Haus, veranstalte mit ihnen Wettrennen mit den Bobbycars. Doch wenn er abends ins Bett gehe, habe er seinen großen Bruder an seiner Seite, der zudem die Einschlafrituale der Familie kenne. "Diese Sicherheit kann man gar nicht überschätzen."
Als Schutz vor einer akuten Kindeswohlgefährdung werden in Deutschland jedes Jahr etwa 50.000 Kinder in Obhut genommen, darunter viele Geschwister. "Jedes einzelne Schicksal ist extrem schwierig und belastend", sagt Büttner. Eigentlich sage einem der gesunde Menschenverstand, dass Brüder oder Schwestern für die Krisenbewältigung ganz entscheidend sein könnten.
"Zur Ruhe kommen"
Doch die Praxis sieht oft anders aus. Bisher hänge es vor allem vom Zufall ab, ob Geschwister gemeinsam untergebracht würden, sagt Angelo Barba, Leiter des Darmstädter Geschwisterhauses. Eine zentrale Rolle spielten dabei das Alter der Kinder sowie die Kapazitäten in den Einrichtungen: Kleinkinder bis sechs Jahre kämen in der Regel vorübergehend in einer Bereitschaftspflegefamilie unter, ältere Geschwister in einer Einrichtung.
Das Institut für Kinder- und Jugendhilfe in Mainz begrüßt ausdrücklich den Aufbau von Geschwisterhäusern. Eine wissenschaftliche Untersuchung zeige, dass bei einer Herausnahme von Kindern aus der Familie auf die Geschwisterbindungen oft nicht hinreichend Rücksicht genommen werde, "die jungen Menschen sich dies aber deutlich wünschen", sagt die stellvertretende Institutsdirektorin Monika Feist-Ortmanns. Grund seien fehlende Strukturen für eine gemeinsame Unterbringung. Der Aufbau von Geschwisterhäusern sei daher "sinnvoll und notwendig".
Die Einrichtungen in Darmstadt und Bremen bieten jeweils zehn Plätze. Zum Haus in Darmstadt gehört ein großer Garten mit Schaukel und Planschbecken, drinnen gibt es einen Ruheraum mit Matratzen und Kuscheltieren, ein Spielzimmer mit Puppenküche und unterm Dach ein Klassenzimmer. Alles ist hell und freundlich. Die Kinder sollen sich wohlfühlen, betont Barba. "Sie sollen zur Ruhe kommen." Aber gleichzeitig nicht heimisch werden.
"Das hier ist kein Zuhause", stellt der Geschäftsführer des Projekts "Petra" klar. "Wir sind eine Notfallambulanz." Wichtig sei, dass die Kinder schnellstmöglich eine dauerhafte Perspektive bekommen. Das Ziel: "Sie sollten nicht länger als acht Wochen hierbleiben."
Bedarf auf 20 Häuse geschätzt
Darauf wird auch im Geschwisterhaus in Bremen großer Wert gelegt: "Die Kinder sollen so schnell wie möglich an einen Ort kommen, an dem sie dauerhafte Bindungen und Sicherheit aufbauen können", betont Lars Becker.
Allerdings kann es Ausnahmen von dem Prinzip geben, Geschwister möglichst gemeinsam unterzubringen: In Einzelfällen könnten Fachkräfte zu der Entscheidung kommen, dass dies kontraproduktiv sei, erklärt Peter Büttner. Wenn die Schwester zum Beispiel für ihre kleinen Geschwister immer die Mutterrolle übernehmen musste und damit völlig überfordert war. Deshalb sei eine gute Diagnostik wichtig. Zum Haus gehört ein Expertenteam, das gemeinsam die Krisensituation analysiert und Perspektiven für die Geschwisterkinder entwickelt.
Psychotherapeut Büttner schätzt, dass es etwa 20 Häuser in Deutschland für eine flächendeckende Versorgung bräuchte. Die Häuser in Darmstadt und Bremen sind ein erster Schritt. Sein Ziel: "Wir wollen aufklären und beweisen, dass es den Kindern so besser geht."
Corona: Hälfte der Deutschen nicht besorgt um Weihnachten mit Familie
Essen (epd). Gut die Hälfte der Deutschen erwartete einer Umfrage zufolge, Weihnachten trotz Pandemie wie üblich mit der Familie feiern zu können. Lediglich 34,1 Prozent der Befragten sind "auf jeden Fall" oder "eher" besorgt, dass die familiäre Zusammenkunft an Weihnachten gefährdet sein könnte, berichten die Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (10. Oktober). 54,7 Prozent seien hingegen der Meinung, dass das Weihnachtsfest im üblichen Rahmen stattfinden können wird.
Unterschiede zeigen sich den Angaben zufolge in verschiedenen Altersgruppen: In der jüngsten Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sei die Sorge vor negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ein Weihnachtsfest mit der Familie mit 41,5 Prozent am größten. Bei den älteren Altersgruppen bewege sich die Zahl zwischen 28,6 und 36,8 Prozent. Zudem hielten Frauen (31 Prozent) ein Weihnachten mit der Familie im üblichen Rahmen für weniger realistisch als Männer (37 Prozent). Für die repräsentative Umfrage befragte das Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Funke 5.052 Menschen.
Ob Kinder im Haushalt leben oder nicht, mache hingegen kaum einen Unterschied. So sind der Umfrage zufolge Erwachsene mit Kindern (35,5 Prozent) kaum besorgter als Haushalte ohne Kinder (32,5 Prozent), dass Sie die Weihnachtsfeiertage aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie sonst im Familien-Kreis verbringen können.
Saar-Innenministerium stellt Geld für CO2-Melder in Schulen bereit
Saarbrücken (epd). Das saarländische Innenministerium will eine Million Euro für die Anschaffung von CO2-Meldern in Schulen zur Verfügung stellen. Die Corona-Infektionszahlen stiegen wieder täglich an und deswegen müsse mit passenden Maßnahmen reagiert werden, sagte Innenminister Klaus Bouillon (CDU) am 9. Oktober in Saarbrücken. "Gerade vor dem Hintergrund, dass bereits jetzt schon Schulklassen in Quarantäne geschickt oder sogar ganze Schulen geschlossen werden mussten, ist es notwendig, dass wir alles dafür tun, unsere Kinder und das Lehrpersonal bestmöglich zu schützen."
Bouillon reagiert damit laut Ministerium auf die Bitte der kommunalen Spitzenverbände, die als Schulträger um die Beschaffung von CO2-Meldern gebeten haben. Die Melder sollen frühzeitig vor Erreichen einer bestimmten Kohlenstoffdioxidkonzentration in Innenräumen warnen, so dass mit Gegenmaßnahmen wie beispielsweise Durchlüften reagiert werden kann, wie das Ministerium mitteilte.
Tag der Begegnung in Köln erst 2022
Köln (epd). Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) verschiebt wegen der Corona-Pandemie bereits jetzt den für Juni kommenden Jahres geplanten "Tag der Begegnung" um ein ganzes Jahr: Der Tag mit Konzerten, Sportveranstaltungen und Mitmachaktionen für Behinderte und Nichtbehinderte im Kölner Rheinpark soll nun erst am 11. Juni 2022 stattfinden, wie der LVR am 5. Oktober in Köln ankündigte. Noch sei nicht absehbar, wie sich das Infektionsgeschehen im Rheinland entwickeln werde und wann ein Impfschutz zur Verfügung stehe, hieß es zur Begründung. Zudem könne man den Ausstellern und Künstlern keine Planungssicherheit bieten.
Auch passten die Abstandsregeln nicht zu der Idee des Festes, das in den vergangenen Jahren Zehntausende Besucher anlockte, begründete der LVR seine Entscheidung. Weil aber Inklusion auch in der Corona-Pandemie ein wichtiges Thema bleibe, entwickle der LVR derzeit neue, digitale Veranstaltungsformate für das Jahr 2021.
Der Landschaftsverband feiert den Aktionstag seit 1998 als Signal für ein besseres Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung. Seit 2017 findet der "Tag der Begegnung" nicht mehr jedes Jahr statt, sondern im jährlichen Wechsel mit einer "Tour der Begegnung" und regionalen inklusiven Festen. Auf diese Weise solle die Leitidee der Inklusion ins ganze Rheinland getragen werden.
NRW-Gesundheitsminister würdigt Arbeit von Hospizdiensten in Pandemie
Gronau (epd). Zum Welthospiztag hat NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) die Arbeit ambulanter Hospizdienste unter den schwierigen Bedingungen der Corona-Pandemie gewürdigt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten außergewöhnliches Engagement gezeigt, sagte Laumann am 11. Oktober bei einem Besuch bei der Hospizbewegung Gronau. "Dafür bin ich zutiefst dankbar."
Da zum Schutz der schwerstkranken Menschen während des Lockdowns enge persönliche Kontakte nicht möglich gewesen seien, hätten die Hospizbegleiter "ideenreich und kreativ" andere Formen für Kontakte gefunden, sagte Laumann. "Ein Telefonat, eine E-Mail oder ein Gespräch am geöffneten Fenster - eine kleine Geste reicht aus, um zu zeigen: du bist nicht allein." Sterben, Tod und Trauer seien Teile des Lebens, die gerne ausgeblendet würden, sagte Laumann anlässlich des Welthospiztages am 10. Oktober.
In Nordrhein-Westfalen gibt es nach Angaben des Gesundheitsministeriums zurzeit mehr als 300 ambulante Hospizdienste mit rund 10.800 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schwerstkranke und sterbende Menschen und deren Familien begleiten. Dazu kommen rund 70 stationäre Hospize und mehr als 200 ambulante Palliativpflegedienste.
Früherer KD-Bank-Chef Joachim Hasley gestorben
Dortmund (epd). Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratschef der Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank), Joachim Hasley, ist tot. Er starb bereits am 21. September im Alter von 79 Jahren, wie die evangelische Kirchenbank am 5. Oktober in Dortmund mitteilte. Hasley sei an fast allen wichtigen Weichenstellung der Bank in den letzten Jahrzehnten beteiligt gewesen, hieß es. Er sei über Jahrzehnte ehrenamtlich für die evangelische Kirche und verschiedene diakonische Einrichtungen aktiv gewesen und dafür unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. "Sein Glaube war für ihn stets Motor und Inspiration", erklärte die Bank.
Hasley trat seinen Dienst bei der KD-Bank 1963 an - sie hieß damals noch Darlehnsgenossenschaft Evangelischer Kirchengemeinden im Rheinland und später BKD. Ab 1965 leitete er die Innenrevision und wurde 1980 Geschäftsführer, 1981 hauptamtliches Vorstandsmitglied, 1984 Sprecher der Geschäftsführung und 1999 Vorstandsvorsitzender. Nach dem Zusammenschluss mit der DGM Evangelische Darlehensgenossenschaft Münster wechselte er 2003 in den Aufsichtsrat der KD-Bank und übernahm bis zu seinem Ausscheiden 2011 den Aufsichtsratsvorsitz.
Mit der Gründung der BKD Berlin nach der Wende, dem späteren Zusammenschluss mit der Prosparda in Magdeburg sowie den Vereinigungen mit der DGM Münster 2003 und der LKG Sachsen 2010 sei Hasley an wegweisenden Ereignissen beteiligt gewesen, hieß es. Auch die Gründung der KD-Bank Stiftung vor 25 Jahren gehe auf seine Initiative zurück.
Die KD-Bank ist eine Genossenschaftsbank mit rund 4.200 Mitgliedern aus Kirche und Diakonie und zählt zu den größten Kirchenbanken Deutschlands. Zu ihren Kunden gehören Kirchen, kirchliche Einrichtungen und Stiftungen sowie soziale Unternehmen wie Krankenhäuser, Hospize, Pflegedienste, Behindertenwerkstätten und Kindertagesstätten.
Medien & Kultur
Die Kunst der großen Gefühle

epd-bild/Angelika Osthues
Münster (epd). Der Kontrast könnte nicht größer sein. Leicht und spielerisch mutet Ernst Ludwig Kirchners "Farbentanz" von 1932 an. Drei bunte Figuren strecken die Arme einer nicht weniger farbenfrohen Sonne entgegen. Gegenüber hängt Edvard Munchs "Weinendes Mädchen" von 1909. Nackt steht es an der Seite ihres Bettes, den Kopf in tiefer Traurigkeit gesenkt. Die beiden so gegensätzlich wirkenden Bilder sind Teil der Ausstellung "Passion Leidenschaft. Die Kunst der großen Gefühle", die bis zum 14. Februar 2021 im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster zu sehen ist.
"Gefühle prägen unsere Gesellschaft und unser Miteinander", betont Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Die Ausstellung solle die Besucherinnen und Besucher emotional berühren und ihnen vor Augen führen, "dass große Gefühle zeitlos sind".
Leihgaben trotz Corona
Die Schmerzen des antiken Laokoon, der Rausch von Bacchus-Jüngerinnen, die Leiden Christi und die Euphorie, die Liebende befällt, all das wird in der Ausstellung anschaulich und bildmächtig präsentiert. Dazu hat Kuratorin Petra Marx rund 200 Werke thematisch zusammengestellt, die einen Zeitraum von 2000 Jahren umfassen. "Ich bin glücklich, dass wir die Ausstellung trotz Corona realisieren konnten", sagt sie. "Wir haben lange gezittert, dann aber doch alle Leihgaben bekommen, auch die Werke aus Frankreich, Italien und Großbritannien." Zu den Objekten zählen Gemälde und Skulpturen von namhaften Künstlern wie Rembrandt, Camille Claudel und Auguste Rodin, Egon Schiele, Edvard Munch oder Käthe Kollwitz bis hin zu Videoinstallationen des US-Amerikaners Bill Viola.
Die Ausstellung deckt sechs Themenbereiche ab. Der erste Raum beschäftigt sich mit Körpersprache, während im zweiten mit Kunstwerken von der Antike bis zur Gegenwart eine Art Theorie der Leidenschaft geliefert wird. Dort sticht "Der Bethlehemitische Kindsmord" von Peter Paul Rubens (1637) mit seinem dramatischen Bildaufbau ins Auge. Auch Nachbauten antiker Theatermasken sind zu sehen sowie ein 1682 entstandenes Gemälde von Jean Boinard, bei dem mit Hilfe eines Schiebemechanismus der Mund so verändert werden kann, dass der Porträtierte einmal fröhlich, einmal traurig wirkt.
Liebe und christliche Passion
Der dritte Raum ist ganz der Liebe gewidmet: Großformatig präsentiert Pauwels Franck beispielsweise eine Liebesszene mit sieben Paaren in unterschiedlichen Stadien der Annäherung, voll Begierde und Leidenschaft. Die dunklen Seiten der Liebe thematisiert dagegen das Selbstporträt von Nan Goldin aus dem Jahr 1984. Die Fotografie zeigt sie, nachdem ihr Freund sie verprügelt hat. "Die Ballade von der sexuellen Abhängigkeit" nennt Goldin in Anspielung auf Bertolt Brecht ihr Werk über Eifersucht und Gewalt.
Die christliche Passion ist ein Schwerpunkt der Themenschau. Aus dem Jahr 2007 stammt etwa eine lebensgroße Pietà-Skulptur der Belgierin Berlinde De Bruyckere, die allein den geschundenen Leib Christi zeigt. Ein sechsminütiger Videoausschnitt aus dem "Orgien Mysterien Theater" des Österreichers Hermann Nitsch lässt den Betrachter verstört zurück, während diverse Märtyrer-Darstellungen das Wechselspiel zwischen Schmerz und religiöser Ekstase in den Minen der dargestellten Personen wiedergeben.
Auch Martha Roslers Digitaldruck "Point & Shoot" von 2016 im fünften Themenraum über Gefühle im politischen Kontext rüttelt auf. Es ist ein Bild des US-Präsidenten Donald Trump, blutrot überschrieben mit dem Satz "Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren", den er vor vier Jahren in einem christlichen College in Iowa gesagt hatte.
"Sehnsucht nach tiefen Empfindungen"
Den Abschluss des Rundgangs bilden Selbstporträts von Künstlern und Künstlerinnen, in denen sie ihre Gefühle zum Ausdruck bringen. "Heute gibt es eine Sehnsucht nach tiefen Empfindungen, und die Kunst ist das Medium, das diese Leidenschaften am tiefsten zum Ausdruck bringt", erklärt Museumsdirektor Hermann Arnold und lädt die Besucher ein, mitzufühlen mit dem, was sie in der Ausstellung zu sehen bekommen.
Und wer sich selbst nicht ganz sicher seiner Gefühle ist, kann die sogenannte Leidenschaftskurve testen. Die Station im letzten Raum analysiert die Mimik des jeweiligen Betrachters und verrät, ob sie oder er gerade Liebe, Hass, Gelassenheit oder Wut empfindet.
Die Wiederentdeckung eines Einzelgängers

epd-bild/Meike Böschemeyer
Remagen (epd). Bei Antonius Höckelmann ging es drunter und drüber. Fotos seines Ateliers zeigen ein Durcheinander aus scheinbar achtlos hingeworfenen Zeichnungen und Gemälden, dazwischen Scheren, Pinsel und Farbtöpfe. Die Kölner Galeristin Ute Mronz schaute sich das Chaos bei ihren Atelierbesuchen eine Weile an und bot dem Künstler schließlich einen Ausweich-Arbeitsplatz in ihrem Haus an. So entstand eine Freundschaft und Mronz trug eine umfangreiche Sammlung von Höckelmann-Werken zusammen, die sie nun zu großen Teilen dem Arp Museum schenkte.
Anlass genug, Höckelmann 20 Jahre nach seinem Tod erstmals wieder eine umfassende Werkschau zu widmen. Zumal der Kölner Künstler zu Unrecht so gut wie in Vergessenheit geraten sei, sagt Museumsdirektor Oliver Kornhoff. Die Rolandsecker Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Bielefeld entstand, biete nun die Möglichkeit, das Werk wieder zu entdecken.
Kooperation mit Kunsthalle Bielefeld
Die Ausstellung "Antonius Höckelmann. Alles in allem" präsentiert bis zum 24. Mai insgesamt 85 Skulpturen, Reliefs, Gemälde und Zeichnungen des im westfälischen Oelde geborenen und in Köln gestorbenen Künstlers. Sie ist zugleich eine Rückkehr Höckelmanns nach Rolandseck, wo er vor 50 Jahren einen Studienaufenthalt im damaligen Künstler-Bahnhof verlebte.
In den 70er und 80er Jahren war Höckelmann neben berühmten Künstlern wie Georg Baselitz, Markus Lüpertz oder A.R. Penck an bedeutenden Ausstellungen beteiligt, etwa der documenta 6 und 7. Von den Kollegen wurde Höckelmann anerkannt und geschätzt, erreichte aber nie deren Bekanntheitsgrad. Antonius Höckelmann sei ein Einzelgänger gewesen, erklärt Markus Lüpertz, selbst einer der erfolgreichsten deutschen Künstler der Gegenwart. Höckelmann habe sich in sein eigenes Universum eingeschlossen. "Dennoch ist er sicher einer der zukunftsträchtigsten Künstler meiner Generation", urteilt Lüpertz, der über 20 Jahre Rektor der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf war.
Arbeiten an der Grenze von Abstraktion und Figürlichkeit
Antonius Höckelmann machte zunächst in Oelde eine Ausbildung zum Holzbildhauer und studierte danach Bildhauerei an der Hochschule für bildende Künste in Berlin, bevor er sich in Köln niederließ. Seine Arbeiten bewegen sich an der Grenze von Abstraktion und Figürlichkeit. Sie zeichnen sich durch wuchernde, organische Formen aus. Er beschäftigte sich mit Motiven aus der Tier- und Pflanzenwelt, der Sexualität und dem Pferdesport. In der Ausstellung sind auch eine Reihe von Selbstporträts zu sehen. Höckelmann hatte zwar eine Nähe zum spontanen, und aus dem inneren Erleben des Künstlers getriebenen Gestus des Informel. Doch er ließ sich dieser Kunstrichtung nicht zuordnen. Höckelmann habe großen Wert darauf gelegt, unabhängig zu bleiben, sagt Kuratorin Jutta Mattern.
Das spiegelt sich auch in seiner Arbeitsweise. Für seine Skulpturen verwendet er häufig ungewöhnliche Materialien. Höckelmann formt sie zum Beispiel aus Styropor oder Alu-Folie, die er farbig anmalt. Stabilität erhalten die verschlungenen Wesen und Gebilde durch einen Holzkern oder mit Hilfe in Kleister getränkter Gaze. Charakteristisch ist die Dynamik und Offenheit seiner Skulpturen. So wirkt Höckelmanns "Aluminium-Madonna" auf den ersten Blick wie ein abstraktes Gebilde. Erst beim Umschreiten der Skulptur zeigt sich der Kopf der Madonna sowie das Jesus-Kind, das den Eindruck macht, als entgleite es der Mutter gerade.
Wider der Schwerkraft
Höckelmanns Skulpturen scheinen sich der Schwerkraft zu widersetzen, was auch dadurch unterstrichen wird, dass einige aufgehängt sind. Hier zeigt sich der Einfluss des italienischen Barock mit seinen schwebenden Putten, den Höckelmann bei einem Studienaufenthalt in Neapel kennen- und schätzen lernte.
Auch für seine Bilder wählt Höckelmann ungewöhnliche Materialien. Er zeichnet auf Leinwand, malt auf Papier, mixt Wachskreiden, Bleistift, Tusche, Acrylfarbe oder Farbspray. So sei die Unterscheidung zwischen Zeichnung und Gemälde bei Höckelmann oft kaum zu treffen, sagt Mattern. Auch bei der Ausstellung seiner Werke ging Höckelmann ungewöhnliche Wege. Seine Kunst müsse an jedem Ort bestehen, entschied er. So zeigte er seine Arbeiten in Gaststätten oder Geschäften. Den Innenraum einer Kneipe an seinem Wohnort, dem Kölner Eigelstein, gestaltete er über Jahre mit seinen Deckenskulpturen, Zeichnungen und Gemälden. "Höckelmann war unabhängig, was den Kunst- und Galeriebetrieb anging. Er hatte keine feste Galerie, sondern er war autonom", sagt Mattern.
Dieser Drang zur Unabhängigkeit vom Kunstbetrieb mag ein Grund dafür sein, dass Höckelmanns Name weniger präsent ist als der seiner bekannten Kollegen. Markus Lüpertz, der sich im Gegensatz zu Höckelmann selbst als "Malerfürst" zu inszenieren weiß, ist jedoch der Meinung, dass das Werk seines verstorbenen Kollegen nicht in Vergessenheit geraten wird. "Die Zeit hat den tragischen Höckelmann erlebt. Die Zukunft wird ihn feiern", prophezeit er.
Kunstkritiker küren Museum Folkwang zum Museum des Jahres

epd West / Museum Folkwang Essen
Essen (epd). Das Museum Folkwang in Essen ist nach dem Urteil deutscher Kunstkritiker "Museum des Jahres 2019". Zwei weitere Auszeichnungen für wichtige Ausstellungen des vergangenen Jahres gingen am 5. Oktober nach Berlin und Rostock, wie die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes Aica mitteilte. Die Kritiker hatten über die Auszeichnungen bereits im Frühjahr entschieden. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Preise erst jetzt in Essen vergeben werden.
Dem traditionsreichen und besucherfreundlichen Essener Museum Folkwang sei es immer wieder gelungen, seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen zu verbinden, begründeten die Aica-Kunstkritiker ihre Wahl. Besonders durch den 2010 eröffneten Neubau von David Chipperfield Architects sei ein "sich nicht allein architektonisch für die Stadt öffnendes Haus entstanden". Dem Direktor des Museums, Peter Gorschlüter, sei es gelungen, den Vertrag mit der Krupp-Stiftung um eineinhalb Jahre zu verlängern und damit die Stadt Essen dafür zu gewinnen, den freien Eintritt in die ständige Sammlung dauerhaft zu ermöglichen. Zu erwähnen sei auch die erfolgreiche Kooperation des Museums mit der Essener Folkwang Universität der Künste als wichtiger Ausbildungsstätte, hieß es.
Beste Ausstellung in Rostock
Zur "Ausstellung des Jahres" kürten die Kritiker die Schau "Palast der Republik" in der Kunsthalle Rostock. Hier sei leicht verständlich und wissenschaftlich sachlich anhand von Design, Architektur und Fotografie sowie aktueller Kunst die Geschichte des gleichnamigen Gebäudes im Herzen Berlins dargestellt worden, erklärte der Kritikerverband. Ein besonderer Schwerpunkt der Ausstellung habe auf der Auseinandersetzung der zeitgenössischen Künstler mit dem umstrittenen und mittlerweile abgerissenen SED-Prachtbau gelegen. Die Ausstellung habe Maßstäbe gesetzt - über das mit Kunsthäusern spärlich besetzte Mecklenburg-Vorpommern hinaus.
Den Titel "Besondere Ausstellung" erhielt "The Making of Husbands: Christina Ramberg in Dialogue" in den Kunst-Werken Berlin. Auf beispielhafte Weise unterlaufe die Gruppenausstellung den "Trend zur kritiklosen Verstärkung von Einzelpositionen oder eindeutigen Statements". Gezeigt wurde nicht nur das wenig untersuchte Werk der Chicagoer Malerin Christina Ramberg (1946-1995), sondern auch Arbeiten von Alexandra Birckens, Senga Nengudis, Ghislaine Leung oder die für die Ausstellung entwickelten Papiertapeten Gaylen Gerbers.
Die rund 200 in der deutschen Aica-Sektion zusammengeschlossenen Autoren, Kritiker, Journalisten und Publizisten vergeben jedes Jahr ihre drei undotierten Auszeichnungen an Museen und für einzelne besonders gelungene Kunstausstellungen. In der internationalen Aica sind weltweit in 95 Ländern knapp 5.000 Mitglieder organisiert. Der Verband wurde 1948/1949 gegründet und von der Unesco als Nichtregierungsorganisation anerkannt.
Kunsthalle Bielefeld zeigt Werke von Monica Bonvincini
Bielefeld (epd). Die Kunsthalle Bielefeld widmet der italienischen Künstlerin Monica Bonvicini seit 10. Oktober eine Einzelausstellung. Unter dem Titel "Lover's Material" sind bis zum 17. Januar 2021 zahlreiche neue Werke wie Boden- und Rauminstallationen, Skulpturen sowie eine Video-Arbeit und Zeichnungen zu sehen. Zeitgleich präsentiert die Kunsthalle drei weitere Ausstellungen. Es ist das erste große Ausstellungsprojekt der neuen Kunsthallen-Leiterin Christina Végh. Ihr Anliegen sei es, sichtbar zu machen, "dass Ausstellungen und die Kunst immer in Verbindung mit unserem Leben stehen", erklärte Végh.
Die Arbeiten von Monica Bonvicini werden demnach im ersten Obergeschoss präsentiert. Die Werke seien zum Teil unter den Eindrücken der aktuellen weltweiten Proteste und der Isolation durch die Covid-19-Pandemie entstanden, hieß es. Thematisch gehe es um den Gegensatz zwischen privatem und öffentlichem Raum, Zwang und Freiheit.
Machtverhältnisse, Geschlechterrollen, Kontrolle
Die in Berlin lebende Monica Bonvicini wurde international mit renommierten Preisen ausgezeichnet, so gewann sie unter anderem den Goldenen Löwen der Venedig Biennale (1999), den Preis der Nationalgalerie in Berlin (2005) und zuletzt den Oskar-Kokoschka-Preis 2020. In ihren Werken beschäftigt sich die 55-jährige Italienerin mit Machtverhältnissen, Geschlechterrollen und Kontrolle, wie es hieß.
Die aktuelle Werkschau wird den Angaben zufolge flankiert von weiteren kleineren Ausstellungen in der Kunsthalle. Unter dem Titel "Raum, Zeit, Architektur, Gender" sind bis Januar Werke aus der Museumssammlung zu sehen, darunter von Josef Albers, Wassily Kandinsky oder Paula Modersohn-Becker. Im Foyer empfangen zudem zwei Arbeiten des kanadischen Künstlers Jeff Wall, "The Thinker" und "The Giant", die Besucherinnen und Besucher. Die beiden Skulpturen sollen Rodins "Denker" ersetzen, der seit der Eröffnung der Kunsthalle 1968 vor dem Gebäude steht, aber im Dezember als Leihgabe auf Reisen nach Basel geht.
Außerdem wird das Musikvideo "Wir haben die Schnauze voll" von Jeremy Dellers zur 7. Symphonie Ludwig van Beethovens präsentiert. Die filmische Arbeit hat der britische Konzeptkünstler den Angaben zufolge in Kooperation mit dem Beethoven Orchester Bonn und Bonner Schulkindern entwickelt. Das Werk entstand im Rahmen des Beethoven-Jubiläumsjahres und wurde Anfang 2020 im Bonner Kunstverein ausgestellt. Auch in dieser Arbeit werden aktuelle Themen aufgegriffen, etwa Freiheit, Natur oder Demokratie, die Ausdruck in den Fridays for Future-Demonstration finden, wie die Kunsthalle erklärte.
Springer eröffnet neues Verlagsgebäude

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Axel-Springer-Verlag am 6. Oktober in Berlin-Mitte ein neues Verlagsgebäude eröffnet. Der etwa 300 Millionen Euro teure futuristische Neubau des niederländischen Architekten Rem Koolhaas steht gegenüber dem alten Springer-Gebäude und erstmals auf östlicher Seite der einstmals geteilten Stadt. Auf mehr als 52.000 Quadratmetern und zehn Geschossen verteilen sich Büro- und Redaktionsflächen für mehr als 3.000 Mitarbeiter. Das Zentrum des Gebäudes bildet ein 45 Meter hohes Atrium mit terrassenförmigen Arbeitsbereichen.
In seiner Rede appellierte der Bundespräsident an die Medien, ihrer Verantwortung in der Demokratie gerecht zu werden. Im digitalen Zeitalter treibe größtmögliche Erregung die "Logik der Plattformökonomie" an, sagte Steinmeier. Dagegen müsse sich Qualitätsjournalismus behaupten.
"Existenzielle Auseinandersetzung"
"Wenn ich mit meinen Mutmaßungen richtig liege, wird sich der Qualitätsjournalismus, auf den die Demokratie zählen muss, auf unbekannte Zeit gegen die digitale Enteignung von Urheberrechten, gegen die Verflachung und Verzerrung, ja gegen den vollständigen Glaubwürdigkeitsverlust der Inhalte behaupten müssen", sagte der Bundespräsident. Das sei für den Journalismus eine "existenzielle Auseinandersetzung". "Entgehen wird ihr niemand", sagte Steinmeier. Die digitale Transformation zu verweigern, sei keine Option. Einer Revolution weiche man nicht aus.
Journalismus müsse sich vornehmen, "vor allem unterscheidbar zu bleiben von den schillernden Produkten der Empörungsökonomie, die in dichter Frequenz Feindbilder, Ressentiments und Vorurteile bedient", warnte der Bundespräsident. Die Verantwortung der Medien sei heute größer denn je.
Konkret warnte Steinmeier vor Falschinformationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. "In einer Pandemie wirken falsche Informationen wie ein Superspreader. Und spätestens wenn der gläubige Maskenverweigerer oder Impfgegner sich infiziert hat, schlägt die Realität zurück", sagte Steinmeier und fügte hinzu. "Die Realität, sie ist das, was bleibt, auch wenn man nicht daran glaubt."
Für Interaktion konzipiert
Der Bundespräsident bezeichnete das neue Verlagsgebäude als Symbol für den radikalen Umbau eines Verlages in ein Medienunternehmen, "eine Antwort auf die Anforderungen und die Herausforderungen der Digitalisierung". Steinmeier erinnert daran, dass vor 54 Jahren, am 6. Oktober 1966, Verlagsgründer Axel Springer das gegenüberliegende alte Verlagsgebäude im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke eröffnet hatte.
Springer-Chef Mathias Döpfner nannte das Gebäude eine "Antwort auf die aktuellen Herausforderungen". "Wir wollten mit dem Neubau ein Symbol und einen Beschleuniger unseres eigenen Wandels schaffen. Der Auftrag sei lange vor Corona gewesen, die Frage neu zu beantworten, warum man im digitalen Zeitalter überhaupt noch Büroräume brauche. Das sei Architekt Rem Koolhaas "spektakulär gelungen".
Koolhaas sagte, die Corona-Pandemie und die gleichzeitige digitale Beschleunigung zeige die Notwendigkeit von Räumen, die für die Interaktion von Menschen konzipiert sind. Der Neubau biete seinen Nutzern verschiedenste räumliche Gegebenheiten, "von intim bis monumental".
WDR-Programmausschuss will "Stichtag" erhalten
Köln (epd). Der Programmausschuss des WDR-Rundfunkrats hat sich "mit großer Mehrheit" für den Erhalt der Geschichtssendung "Stichtag" auf der Hörfunkwelle WDR2 ausgesprochen. Sie solle "sowohl in der Qualität als auch in der Länge" beibehalten werden. Das sagte die Ausschuss-Vorsitzende Petra Kammerevert bei der Sitzung des WDR-Rundfunkrats am 9. Oktober in Köln.
Der Ausschuss habe dem Sender die "Hausaufgabe" aufgegeben, diesen "kleinen Leuchtturm" auch in Zukunft zu finanzieren. "Wir reden hier über eine relativ kleine Summe, während wir an anderer Stelle locker-flockig Millionen ausgeben", sagte Kammerevert. Eine abschließende Beratung zu dem Thema soll in der nächsten Sitzung stattfinden.
Offener Brief von Prominenten
Der NDR hatte die Kooperation mit dem WDR bei der Finanzierung des 15-minütigen WDR5-Geschichtsformats "Zeitzeichen" zum 1. Januar 2021 gekündigt. Laut Programmdirektorin Valerie Weber muss der WDR deshalb an anderen Stellen sparen und umstrukturieren. Beim kürzeren historischen Rückblick "Stichtag" setze man aus diesem Grund auf eine Kooperation mit mehreren Rundfunkanstalten. Das gemeinsame Format soll unter Federführung von Radio Bremen entstehen. Bedenken dagegen wies Weber im Rundfunkrat zurück. "Wenn alle Geschichtsredaktionen der ARD ihre Köpfe zusammenstecken, kann es ja auch sein, dass etwas Besseres entsteht", sagte sie.
Zuvor hatten sich über 100 Prominente in einem offenen Brief an WDR-Intendant Tom Buhrow für den Erhalt des "Stichtags" und des "Zeitzeichens" ausgesprochen. "In Zeiten von Fake News, Verschwörungsfantasien und wachsender Demokratieverachtung wirken 'Stichtag' und 'Zeitzeichen' der gefährlichen Geschichtsvergessenheit entgegen", schrieben sie in einer Anzeige, die im "Kölner Stadt-Anzeiger" erschienen war. Der WDR hatte daraufhin angegeben, es werde im Rahmen einer ARD-Kooperation ein kurzes historisches Kalenderblatt geben, allerdings nicht zwangsläufig unter Federführung des WDR. Zu den Unterzeichnern gehörten die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), TV-Moderator Günther Jauch und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie.
Bücher ohne Bühne

epd-bild/Tim Wegner
Frankfurt a.M. (epd). Normalerweise würde Lisa Stöhr in ihrer Buchhandlung jetzt einen Tisch mit Neuerscheinungen kanadischer Autorinnen und Autoren aufbauen, von Margaret Atwood über Douglas Coupland bis Joy Fielding. Stattdessen stapeln sich dort nun Kalender fürs kommende Jahr. Die weitgehende Absage der Frankfurter Buchmesse mit dem Ehrengast Kanada macht sich sichtlich bemerkbar. "Das Thema ist jetzt ziemlich in den Hintergrund gerutscht", sagt die Inhaberin der Buchhandlung und Galerie Büchergilde Frankfurt am Main. Was die Auswirkungen auf ihr Geschäft angeht, schwankt Stöhr zwischen Hoffen und Bangen.
"Die Buchmesse war für uns immer ein wichtiger Vorläufer des Weihnachtsgeschäfts", sagt die 35-Jährige. "Viele Besucherinnen und Besucher sind durch die Hallen gegangen und hatten Gedanken wie: 'Oh, das Buch ist was für meine Tante'. Da ist ganz viel Inspiration passiert." Auch der Branchenverband Börsenverein des Deutschen Buchhandels betont die Bedeutung der Messe, um die Aufmerksamkeit auf das Lesen zu lenken. Welcher Anteil des stets starken Buchhandels-Umsatzes im vierten Quartal tatsächlich auf die Frankfurter Schau zurückzuführen sei, lasse sich aber natürlich nicht beziffern.
Sorge um Kleinverlage
Da diesmal trotz der Absage der Messestände Lesefeste und ein großes digitales Programm stattfinden, hofft Buchhändlerin Stöhr, "dass Lesen und Bücher in dieser Zeit trotzdem sehr präsent sein werden" und ihr größere Absatzeinbußen erspart bleiben. Ihr Buchladen nahe der Konstablerwache ist mit drei kleineren Lesungen am Kulturfestival Bookfest beteiligt.
Mehr Sorgen als um den Handel macht sich Stöhr um kleinere Verlage, denen nun nach dem Ausfall der Leipziger Buchmesse im Frühjahr schon die zweite Gelegenheit wegbricht, sich persönlich vorzustellen. "Indie-Verlage mit wenig Finanzkraft sind darauf angewiesen, ihr Programm sowohl dem Buchhandel als auch dem Publikum präsentieren zu können", erklärt sie zu den unabhängigen Verlagen. "Insolvenzen würden große Verluste für die Branche bedeuten, denn kleine Verlage sind wichtige Treiber von Innovationen und Experimenten, oft bringen sie die spannendsten Bücher heraus."
Ein Chance haben aus ihrer Sicht vor allem Verlage und Buchhändler, die schnell und kreativ auf digitale Angebote umsteigen: "Wer sich gute neue Sachen einfallen lässt, kann vielleicht sogar profitieren." Aufgrund von Corona seien zunächst zwangsweise viele neue Formate entstanden, die aber auch in Zukunft von Wert seien. "In der Schließzeit war bei uns erst einmal große Panik", erinnert sich Stöhr. Aber durch neue Social-Media-Angebote, Online-Veranstaltungen, Lieferdienste und eine Abholstation sei ihr Geschäft "wie viele andere kleine Buchhandlungen glimpflich davongekommen".
Nachfrage zog wieder an
Das gilt für die gesamte Branche, wie der Börsenverein bestätigt. Zwar sei während der Ladenschließungen im März und April der Umsatz erheblich zurückgegangen, erklärt Vorsteherin Karin Schmidt-Friderichs. Seit Juni sei die Nachfrage nach Büchern aber groß gewesen, und die Umsätze lägen jeweils über denen der Vorjahresmonate.
Daher demonstriert der Branchenverband als Veranstalter der Buchmesse trotz des Wegfalls des "physischen Auftritts" Optimismus. Man sei überzeugt, dass die Messe mit ihren digitalen und dezentralen Veranstaltungen große Aufmerksamkeit für Bücher und das Lesen erzeugen werde, sagt Schmidt-Friderichs. Da sich auch Buchhandlungen und Verlage mit ihrem Kundenservice und Marketing intensiv bemühten, selbst unter Pandemie-Bedingungen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft zu erzielen, rechne der Börsenverein mit einem "starken Bücherherbst und einem guten Verlauf des Geschäfts im restlichen Jahr".
Die Münchner Buchhandelskette Hugendubel zeigt sich ebenfalls "zuversichtlich, was den Umsatz im Herbst betrifft", wie die geschäftsführende Gesellschafterin Nina Hugendubel sagt. Die Augsburger Weltbild-Gruppe dagegen äußert "Bauchschmerzen mit Blick auf den Schwund an Leserinnen und Lesern, der aufgrund des Vorgehens der Frankfurter Buchmesse zu befürchten" sei. "Wenn Lesen, Autorinnen und Autoren, neue Bücher im Oktober kein großes Lesefest feiern können, kann das bedeuten, dass wieder eine erhebliche Anzahl von Menschen ihre Mediennutzung ändert und wir Leserinnen und Leser verlieren", sagt CEO Christian Sailer. Thalia und Amazon äußerten sich nicht auf Anfrage.
Auch Lisa Stöhr bedauert, dass die persönlichen Begegnungen auf der Messe dieses Jahr ausfallen, ist aber insgesamt trotzdem erleichtert über die Absage der großen Hallenausstellung. "Uns als kleinem Team wäre bei einer solchen Großveranstaltung sehr mulmig gewesen", sagt sie. "Denn im Fall der Fälle hätten wir komplett schließen müssen." Ins Weihnachtsgeschäft geht ihr Laden in der Pandemie-Zeit nun unter dem Motto "Sicher Buchgeschenke kaufen!": Angeboten werden unter anderen private Stöbertermine nach Ladenschluss und Videoberatungen via Whatsapp oder Zoom.
Louise Glück und die strenge Form
Für Louise Glück erscheint Poesie fast als Therapie. Mit ihren Gedichten und dem zauberhaften Garten aus "Wilde Iris" schrieb die neue Nobelpreisträgerin über die Heilkraft von Literatur und Natur. Der Band könnte in der Pandemie hochaktuell werden.Frankfurt a.M./Stockholm (epd). Louise Glück gilt als eine sehr gebildete Autorin. Ihre Kenntnisse der griechischen Mythologien sind ausgezeichnet, wie sie vielfach unter Beweis gestellt hat. Als am 11. September 2001 das World Trade Center zusammenbrach, reagierte die Lyrikerin mit dem Gedichtband "Oktober", der voller Bezüge zur Antike ist. Der Titel sollte auf die Zeit nach dem September hinweisen, wenn der Staub sich gelegt hat und das Gedenken an die Opfer beginnt. Am 8. Oktober wurde der 77-Jährigen US-Amerikanerin in Stockholm der diesjährigen Nobelpreis für Literatur zuerkannt - für viele hierzulande überraschend.
In dem Band "Oktober" beschwor Glück die antike Mythologie mit ihren Ritualen von Trauer und Leid herauf, in der Hoffnung, durch diesen historischen Rückgriff das nationale Trauma fühlbar und damit weniger kriegerisch und destruktiv zu machen. Der Kritiker Mark Strand schrieb damals: "In der Jahreszeit des Herbstes, der dunklen Zeit, geschrieben, ist Louise Glücks Stimme stärker, direkter, noch emotionaler aufgeladen als je zuvor. Dieses Poem ist ein Meisterwerk, gerade weil es voller Schönheit steckt, aber diese nie mit Erlösung verwechselt."
Als Jugendliche am Scheideweg
Diese fast therapeutische Funktion von Poesie begleitet den Lebensweg der 1943 in New York geborenen Louise Glück. Bereits als Jugendliche hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt an starker Anorexie und begab sich in psychologische Behandlung, jedoch ohne großen Erfolg. Sie zweifelte sogar daran, ob ihr unter diesen Bedingungen ein Studium möglich sein würde. Die gesundheitliche Krise wurde existenziell und sie bekannte: "Ich verstand auf einmal, dass ich dabei war zu sterben. Aber ich war mir sicher, auf intensive körperliche Art, dass ich nicht sterben wollte."
Noch Jahre später dachte sie über diesen Scheideweg ihres Lebens nach: "Meine ganze emotionale Grundausstattung, die extreme Starrheit und Festigkeit, mit der ich mein alltägliches Verhalten regelte, auch meine seltsame, verrückte Abhängigkeit von Ritualen, machten alle anderen Formen der Erziehung nahezu unmöglich." Sie brach ihr Studium ohne Abschluss ab und arbeitete Ende der sechziger Jahre als Sekretärin, um Geld zu verdienen. Aber die Literatur hatte sie in den Bann gezogen, vor allem die Verbindung von griechischer Kultur und Lyrik - denn in beidem fand sie wieder, was sie unbedingt brauchte: Eine strenge Form, Rituale, eine therapeutische Arbeit an sich selbst. Wer gedacht hatte, die alte griechische Kultur könne den Heutigen nicht mehr viel sagen, wurde von Louise Glück eines anderen belehrt.
"Der Triumph des Achilles" etwa hieß ein Gedichtband von 1985. Dort schaffte sie es tatsächlich, Fragen des Alterns, von Religion und Mythologie, Freundschaft und Verlust, anhand der alten griechischen Geschichten neu und poetisch zu fassen, in einer Sprache, die der amerikanische Poet Craig Teicher einmal so beschrieb: "Bei Louise Glück sind die Wörter immer spärlich. Sie sind hart dem Leben abgerungen und dürfen auf keinen Fall wieder verloren gehen."
Überraschende Aktualität
Bis heute hat Louise Glück 14 Gedichtbände veröffentlicht. Sie hat unzählige Ehrungen bekommen, für einzelne Bücher, für ihr Werk, und teilt doch das Schicksal vieler Kollegen und Kolleginnen, die als Lyriker wenig Beachtung finden. Zwei ihrer Bücher wurden ins Deutsche übersetzt, "Averno" (engl. 2006) und "Wilde Iris (engl. 1992)", der in der deutschen Kritik als "einer der vielstimmigsten und am straffsten komponierten amerikanischen Gedichtbände des Jahrzehnts" gelobt wurde, für den sie völlig verdient den Pulitzerpreis bekommen habe.
Vielleicht wird nicht nur die überraschende Zuerkennung des Nobelpreises für Literatur die Wertschätzung einer großen Lyrikerin verbessern, auch ihre Themen sind von verblüffender Aktualität. In "Wilde Iris" führt sie uns in einen zauberhaften Garten, in dem die Blumen Stimmen haben und mit Intelligenz und großem Gefühl zu allen sprechen, die diesen Garten betreten. "Nature Writing" würde man das heute nennen, doch über die Heilkraft von Literatur und Natur hat Louise Glück bereits Gedichte geschrieben, als dieses heute sehr erfolgreiche Genre noch kaum bekannt war. "Bei ihr bekommen Blumen eine Sprache des Trauerns", schrieb der Kritiker Morris Daniel.
Vielleicht ist es kein Zufall, das Louise Glück den Nobelpreis in einem Jahr bekommt, in dem eine schwere Pandemie herrscht, und ihr Land, die Vereinigten Staaten, der therapeutischen Funktion von Literatur dringend bedarf.
Vatikanischer "Kulturminister" würdigt verstorbenen Eddie Van Halen
Rom (epd). Der Präsident des päpstlichen Kulturrats, Kardinal Francesco Ravasi, hat den verstorbenen Gitarristen Eddie Van Halen gewürdigt. Der vatikanische "Kulturminister" verglich die Rock-Legende am 7. Oktober auf Twitter mit dem Barock-Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750). Ravasi zitierte den Rockmusik-Produzenten Ted Templeton mit den Worten: "Eddie kann 30 Sekunden lange Phrasen mit einer Komplexität spielen, die es mit Bach aufnehmen kann." Der gebürtige Niederländer Van Halen war am 6. Oktober nach einer Krebserkrankung gestorben.
Der vatikanische Kulturminister plädiert seit jeher für eine Öffnung des Kulturbegriffs in der katholischen Kirche. Der spätere Literaturnobelpreisträger Bob Dylan trat bereits 1997 mit seiner Gitarre vor dem damaligen Papst Johannes Paul II. auf.
Holger Kempkens wird neuer Leiter des Paderborner Diözesanmuseums

epd-bild/Ralf Meier
Paderborn/Bamberg (epd). Das Diözesanmuseum in Paderborn erhält einen neuen Leiter. Der promovierte Kunsthistoriker Holger Kempkens tritt am 15. Oktober die Nachfolge von Professor Christoph Stiegemann an, der dann im Alter von 66 Jahren in den Ruhestand geht, wie das Erzbistum Paderborn bekanntgab. Kempkens stammt gebürtig aus Köln und ist seit acht Jahren Direktor des Bamberger Diözesanmuseums. Zudem lehrt er an der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg. In Nordrhein-Westfalen war er den Angaben zufolge unter anderem als Kurator der Ausstellung "Goldene Pracht - Mittelalterliche Schatzkunst in Westfalen" im Jahr 2012 in Münster beteiligt.
Stiegemann, der 30 Jahre lang Direktor des Diözesanmuseums war und zudem die Fachstelle Kunst im Erzbistum Paderborn geleitet hat, sollte schon Ende Juni 2020 in den Ruhestand verabschiedet werden. Wegen der coronabedingten Verschiebung seiner letzten großen Ausstellung "Peter Paul Rubens und der Barock im Norden", die seit Juli in Paderborn zu sehen ist, wurde der Termin verschoben.
Langjähriger Leiter Stiegemann gewürdigt
Stiegemanns großen Sonderausstellungen sei es zu verdanken, dass Paderborner Diözesanmuseum inzwischen zu einer "veritablen Stimme im Chor der europäischen Museen" geworden sei, betonte der Generalvikar der Erzbistums, Alfons Hardt. Auch mit der umfangreichen Inventarisierung der Kunstausstattung der katholischen Kirchen in der Region hinterlasse er ein Erbe, das weitergeführt werde. "Mit Dr. Kempkens haben wir eine Persönlichkeit gefunden, die der westfälischen sakralen Kunst eng verbunden ist und die aus der Arbeit für das Erzbistum Bamberg um die Bedeutung von Kunst als Kulturträger in kirchlichem Umfeld und darüber hinaus weiß", erklärte Hardt.
Kempkens sagte, er freue sich auf die neuen Aufgaben im Diözesanmuseum Paderborn, das er durch verschiedene Projekte gut kenne. Die bewährte Ausstellungstätigkeit des Hauses im Dreiklang von Kunst, Kultur und Religion wolle er fortführen. Auf seiner Agenda stehe auch, das prägnante Museumsgebäude mit spiralförmigen Aufstieg barrierefrei zu machen.
Saarländischer Rundfunk schließt 2019 mit Überschuss ab
Saarbrücken (epd). Der Saarländische Rundfunk (SR) hat das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss von rund 1,66 Millionen Euro abgeschlossen. Nach Abzug der Beitragsrücklagen blieben noch 319.000 Euro über, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses, Armin Lang, am 5. Oktober in der SR-Rundfunkratssitzung in Saarbrücken. Der Rundfunkrat stimmte dem Abschluss des Wirtschaftsplans und des Geschäftsberichts 2019 einstimmig zu.
Für die Intendantenwahl im kommenden Jahr will das Gremium einen Wahlvorbereitungsausschuss einrichten. Intendant Thomas Kleist hatte Anfang September erklärt, dass er Ende April kommenden Jahres vorzeitig aus dem SR ausscheiden werde. Die Rundfunkratsvorsitzende Gisela Rink plädierte dafür, die Wahlvorbereitung und die anschließende Wahl transparent zu machen und auszuschreiben. Dem stimmte ihr Vorgänger Wolfgang Krause zu: "Wir sollten unser Augenmerk darauf richten, dass die öffentlich diskutierte Staatsferne in einem transparenten Verfahren zum Ausdruck gebracht wird."
Kleist kündigte an, bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt weiter "Vollgas" zu geben: "Der Wandel um uns herum duldet keine Verschnaufpause." Das Zauberwort für die nächsten Jahre heiße digital, sagte der Intendant. Es gehe darum, die lineare Welt in Hörfunk und Fernsehen zu bedienen und zugleich diejenigen nicht zu verlieren, die bereits im Internet unterwegs seien. "Die sind es gewohnt, dass sie nicht zu uns kommen, sondern wir müssen zu ihnen gehen", betonte Kleist.
Entwicklung
Lebensader für Millionen Menschen in Kriegen und Konflikten

epd-bild/Stefan Ehlert
Genf (epd). Die Arbeit wird viel gelobt, doch der Friedensnobelpreis kommt überraschend. Denn zu den großen Favoriten für die hohe Auszeichnung gehörte das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen nicht. Viele Experten räumten anderen Institutionen aus der UN-Familie wie der Weltgesundheitsorganisation weitaus höhere Chancen ein, den wichtigsten internationalen Preis zu erhalten. Die Auszeichnung für das Welternährungsprogramm mit Sitz in Rom, die "größte humanitäre Organisation der Welt", wie die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, am 9. Oktober sagte, ist aber auch eine Würdigung der Vereinten Nationen insgesamt.
"Die UN spielen eine Schlüsselrolle in der Aufrechterhaltung der multilateralen Kooperation", sagte die Vorsitzende. Die von der Corona-Pandemie, Krisen und Kriegen geschüttelte Welt brauche die enge multilaterale Kooperation mehr als jemals zuvor.
Für globale Zusammenarbeit, für Hilfe und für Solidarität steht das Welternährungsprogramm, das ausschließlich aus freiwilligen Beiträgen finanziert wird, wie kaum eine andere Organisation. Hauptsächlich Regierungen überweisen Gelder in die WFP-Kassen. Die insgesamt 17.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen planen, in diesem Jahr 138 Millionen Menschen mit überlebenswichtigen Lebensmitteln zu erreichen. Doch immer wieder muss das WFP Essensrationen kürzen, wie zuletzt etwa im Bürgerkriegsland Jemen, weil die Staaten zu wenig Geld für den Hilfseinsatz überwiesen haben.
Fast 13 Milliarden Mahlzeiten
Jeden Tag schickt das WFP im Durchschnitt rund 5.000 Lastwagen, 20 Frachtschiffe und 92 Flugzeuge in den Einsatz, "um die Bedürftigsten mit Nahrungsmitteln und anderen Hilfsgütern zu unterstützen". Jedes Jahr umfasst die WFP-Ernährungshilfe zirka 12,6 Milliarden Mahlzeiten.
Doch damit kann das WFP nicht alle hungernden Menschen satt machen. Das weiß auch der Exekutivdirektor, der US-Amerikaner David Beasley (63). Erst vor wenigen Tagen warnte der einstige Gouverneur des US-Bundesstaates South Carolina vor dem UN-Sicherheitsrat vor den Konsequenzen der Covid-19-Krise: "Die Auswirkungen haben die zwei Milliarden Menschen, die weltweit in der informellen Wirtschaft arbeiten, hauptsächlich in Ländern mit mittlerem und niedrigem Einkommen, am härtesten getroffen. Sie sind oft nur einen Tag Arbeit davon entfernt, Hunger zu leiden, sie leben mit anderen Worten von der Hand in den Mund."
Beasley befürchtet, dass die die Grenzschließungen und die Talfahrt der Weltwirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie noch viele Menschen tödlich treffen wird. Rund 270 Millionen Menschen werden laut seinen Worten in "Richtung Hungertod" gedrängt. Diesen Menschen müsse dringend geholfen werden, verlangte Beasley.
Bomben, Gewalt, Hunger
Schon vor Beginn der Corona-Pandemie spitzte sich der Hunger weltweit wieder bedenklich zu. Das WFP und andere Nahrungsmittelexperten der UN schätzen, dass Ende 2019 fast 690 Millionen Menschen nicht genug zu essen hatten. "135 Millionen Menschen in 55 Ländern litten akuten Hunger", warnt das WFP. Innerhalb von fünf Jahren stieg die Zahl der Kinder, Frauen und Männer, die von Hunger betroffen waren, um 60 Millionen.
Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung liegt in den vielen bewaffneten Konflikten rund um den Erdball. Egal ob im Jemen, in der Demokratischen Republik Kongo, in Nigeria, in den Sahelstaaten oder in Syrien: Die Kämpfe, die Gewalt, die Bomben zerstören die Volkswirtschaften der Länder und reißen die Zivilisten in den Abgrund.
Ein Konfliktland, in denen es den Menschen mit am schlimmsten geht, ist der Südsudan. Ein jahrelanger Bürgerkrieg verwüstete den noch jungen Staat, vor allem dessen Landwirtschaft. Bäuerliche Betriebe wurden reihenweise zerstört, Felder abgebrannt, Vieh getötet. Die Konfliktparteien setzen den Hunger sogar als Waffe in ihrem Krieg ein, wie eine UN-Kommission erst jüngst beklagte. Im Südsudan vermischen sich die Grausamkeiten des Konflikts und die Corona-Pandemie zu einem verheerenden Mix. WFP-Chef Beasley warnt eindringlich: "Durch Ausbrüche des Virus in städtischen Gebieten wie Juba drohen weitere 1,6 Millionen Menschen zu verhungern."
Corona stürzt 100 Millionen Menschen in extreme Armut
Berlin, Washington (epd). Durch die Corona-Pandemie werden nach Schätzung der Weltbank in diesem Jahr bis zu 115 Millionen Menschen weltweit neu in extreme Armut stürzen. Bis 2017 sank die Zahl der Menschen, die mit 1,90 US-Dollar oder weniger auskommen müssen, auf 689 Millionen Männer, Frauen und Kinder, wie aus dem Weltarmutsbericht der Weltbank hervorgeht, der am 7. Oktober in Washington veröffentlicht wurde. Bis 2021 könnte die Zahl der extrem Armen sogar um 150 Millionen Menschen zunehmen. Es ist laut dem Bericht der schwerste Rückschlag bei der Armutsbekämpfung nach 25 Jahren fast stetiger Fortschritte.
"Die Pandemie und die weltweite Rezession könnten mehr als 1,4 Prozent der Weltbevölkerung in extreme Armut fallen", sagte Weltbankpräsident David Malpass. Die Ärmsten der Welt müssten die Hauptlast dieser historischen globalen Rezession tragen. Den Berechungen zufolge wäre die Armutsrate 2020 auf 7,9 Prozent der Bevölkerung gefallen. Wegen der Corona-Krise steigt sie jedoch wieder auf etwa 9,2 Prozent, das Niveau von 2017. Zwischen 2015 und 2017 schafften es den Berechnungen zufolge 55 Millionen Menschen, sich aus der Armut zu befreien. Der Weltbankbericht wird alle zwei Jahre veröffentlicht.
Hälfte der extrem armen Menschen lebt in fünf Ländern
Die stärkste Zunahme der extremen Armut erwartet die Weltbank in Südasien und Afrika südlich der Sahara. Um den schweren Rückschlag bei Entwicklungsfortschritten zu stoppen, fordert Malpass die Länder auf, sich auf die Zeit nach Corona vorzubereiten, indem sie Kapital, Arbeitskräfte, Bildung und Innovationen auf neue Unternehmen und Sektoren lenken. "Mir machen diejenigen Länder Mut, die bereits entschlossen handeln, schnell lernen und ihre Erfahrungen und Ergebnisse zum Nutzen anderer weitergeben", sagte er und rief zur Kooperation auf. Nach dem Weltarmutsbericht lebt fast die Hälfte aller extrem armen Menschen in den fünf Ländern Nigeria, Kongo, Tansania, Äthiopien und Madagaskar, in denen das Bevölkerungswachstum hoch ist.
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte, die Armutsrate habe seit 1990 von 36 Prozent der Weltbevölkerung auf 9 Prozent gesenkt werden können. "Corona führt jetzt erstmals seit Jahren wieder zum Anstieg von Armut und Hunger in der Welt", betonte er. "Jetzt erst recht müssen wir am Ziel einer Welt ohne Hunger und Armut festhalten." Vor allem Europa müsse mehr tun, um Entwicklungsländer mitten in der Krise zu stabilisieren. Die Staatengemeinschaft hat sich 2015 mit den Nachhaltigkeitszielen verpflichtet, Hunger und Armut bis 2030 zu überwinden.
Deutschland fördert laut Müller mit drei Milliarden Euro über ein weltweites Corona-Sofortprogramm Ernährung, Gesundheitssysteme, Hilfe in Flucht- und Krisenregionen sowie die Sicherung von Jobs und Unternehmen. Mit dem Geld erhalten etwa arbeitslose Textilarbeiterinnen in Bangladesch sowie Bedürftige in Indien, Jordanien, Tunesien und Malawi Überbrückungshilfen.
Corona-Folgen: Schuldenerlass für überschuldete Länder gefordert
Berlin/Düsseldorf (epd). Hilfsorganisationen fordern umfassende Schuldenerlasse für Entwicklungs- und Schwellenländer, deren Wirtschaft durch die Corona-Pandemie besonders stark eingebrochen ist. Das bestehende Schuldenmoratorium der großen Wirtschaftsmächte (G20) reiche nicht aus, erklärten das deutsche Entschuldungsbündnis erlassjahr.de, "Brot für die Welt", Misereor und Oxfam Deutschland am 8. Oktober in Berlin. Bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank vom 121. bis 18. Oktober sollten die Bundesregierung und die anderen IWF-Mitgliedsstaaten Schuldenstreichungen für besonders kritisch verschuldete Länder ermöglichen.
Der vom IWF für 2020 prognostizierte globale Wachstumseinbruch um 4,9 Prozent werde viele dieser Länder überproportional treffen, hieß es. Selbst bei einer Verlängerung des Moratoriums um mehrere Jahre wären viele Länder nicht in der Lage, Schuldenrückzahlungen so bald wieder aufzunehmen, erklärte Oxfam-Experte Tobias Hauschild. "Es ist völlig unrealistisch, dass die für die Länder des Globalen Südens bedeutenden Wirtschaftssektoren, darunter Tourismus oder der Export von Rohstoffen, und die daraus resultierenden Einnahmen schon in Kürze wieder das Vorkrisen-Niveau erreichen."
Private Gläubiger einbeziehen
Die Organisationen übten zudem Kritik an der bislang fehlenden Beteiligung privater Gläubiger an der Aussetzung des Schuldendienstes. Über eine UN-Resolution oder über eine Änderung der IWF-Statuten müsse künftig die Einbeziehung privater Gläubiger sichergestellt werden, forderte Eva Hanfstängl, Referentin für Entwicklungsfinanzierung von "Brot für die Welt". Damit könnten die Kosten eines Schuldenerlasses auch auf private Banken und Fondsgesellschaften umgelegt und so die Haushalte in den Schuldnerländern entlastet werden. Jeder Dollar erlassener Schulden könnte direkt in die Stärkung der Gesundheits- und Bildungssysteme investiert werden, ergänzte Misereor-Referent Klaus Schilder.
Berliner Notarzt: Covid-19 ist im Jemen enorm tödlich
Berlin (epd). Das Coronavirus ist im kriegsgeschüttelten Jemen nach Beobachtung des Intensivmediziners Tankred Stöbe besonders tödlich. Der Berliner Notarzt, der bis vor kurzem für "Ärzte ohne Grenzen" in Aden im Süden des arabischen Landes tätig war, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), im dortigen Covid-19-Behandlungszentrum der Hilfsorganisation seien fast 60 Prozent der aufgenommenen Patientinnen und Patienten gestorben: "Damit sind wir schon fast im Ebola-Bereich."
Viele kamen seinen Worten nach in die Klinik, als sie schon schwer krank waren, und starben schnell. Es gebe kaum Sauerstoffzylinder und erst allmählich Testmöglichkeiten, beschrieb er die Lage. Wegen Armut, Kämpfen oder zerstörter Straßen hätten sich zudem zahlreiche Infizierte gar nicht erst auf den Weg zu den Ärzten gemacht: "Die meisten sind zu Hause erstickt."
"Aktute Katastrophe trifft auf chronische"
Stöbe war bereits zum zweiten Mal im Jemen und sollte zunächst Covid-19-Patienten behandeln, hatte aber nach Abklingen der ersten Welle als medizinischer Direktor im August und September in einem Unfallkrankenhaus auch Schuss- oder Explosionsverletzte und Unfallopfer versorgt. "Wegen der Pandemie trifft eine akute Katastrophe auf eine chronische", sagte Stöbe, der bis 2015 acht Jahre lang Präsident des deutschen Zweigs von "Ärzte ohne Grenzen" war.
Im Gegensatz zum Bürgerkrieg sei das Coronavirus nicht sichtbar oder hörbar, aber es gebe keinerlei Möglichkeit zur Vorbereitung, weshalb der Erreger sich rasant verbreiten könne: "Es ist ein gescheiterter Staat, da gibt es keine Maßnahmen, um die Kurve flach zu halten." Eine weitere Covid-19-Welle werde zu ähnlich katastrophalen Zuständen führen wie die erste, zeigte er sich überzeugt.
Im Bürgerkrieg im Jemen wurden seit 2015 mehr als 100.000 Menschen getötet. Friedensbemühungen der Vereinten Nationen blieben bislang ohne Erfolg. Zuletzt wurden im Jemen offiziell mehr als 2.000 Corona-Infektionen und rund 600 Corona-Tote gemeldet. Die Dunkelziffer ist vermutlich weitaus höher.

