Kirchen
Frohe Botschaft in Zukunft öfters digital

epd-bild/Jens Schulze
Hannover (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat einen durch die Corona-Krise ausgelösten Digitalisierungsschub in den Kirchen begrüßt. Die Pandemie habe Alltag und Verkündigungspraxis der Kirchen nachhaltig verändert, sagte Bedford-Strohm am 16. Juni bei einer Online-Pressekonferenz. Dabei wurde eine Studie zu digitalen Verkündigungsformaten vorgestellt, von der kurzen Andacht bis zur anspruchsvoll gestalteten Gottesdienstfeier. Danach hätten sich die Protestanten während der Corona-Krise "äußerst beweglich, kreativ und flexibel" gezeigt. 72 Prozent der Befragten wollten die digitalen Formate nach dem Lockdown fortführen. Die Kirche der Zukunft werde daher "bunter und vielfältiger", hofft Bedford-Strohm.
Der EKD-Ratsvorsitzende wies zugleich Kritik zurück, die Kirchen seien während der Corona-Pandemie nicht nahe genug an den Menschen gewesen. "Es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass die Kirche sich weggeduckt hat oder womöglich die Pfarrerinnen und Pfarrer sich zurückgezogen haben", sagte der Theologe, der auch bayerischer Landesbischof ist: "Die waren präsent, die haben Kontakt mit den Leuten gehabt und gehalten."
Kein Ersatz für persönliche Begegnungen
Die Mitarbeiter der Kirchen hätten diese Herausforderung mit großer Energie und Willenskraft angegangen, sagte Bedford-Strohm. Die frühere Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) hatte im Mai kritisiert, die Kirche habe in der Corona-Krise Hunderttausende Menschen allein gelassen - Kranke, Einsame, Alte, Sterbende.
Die digitalen Formate würden die persönlichen Begegnungen in den Kirchen freilich nicht ersetzen, betonte Bedford-Strohm. Deshalb sei es spannend, wie man die digitalen Formate und die Präsenzgottesdienste, "die natürlich weiter eine zentrale Bedeutung haben werden", miteinander verbindet. Es sei davon auszugehen, dass künftig vermehrt mit "hybriden Formaten", bei denen sowohl eine direkte Teilnahme in einer Kirche als auch die digitale Teilnahme möglich ist, zu rechnen sei.
60 Prozent digitale Verkündigungsformate
Das EKD-Kirchenamt hatte die Evangelische Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (midi) in Berlin Ende April beauftragt, die digitalen Verkündigungsformate während der Corona-Krise zu untersuchen. Als repräsentative Stichprobe wurden den Angaben zufolge vier evangelische Landeskirchen ausgewählt: die Nordkirche, die Kirche in Mitteldeutschland, die Kirche von Kurhessen-Waldeck und die Landeskirche in Württemberg. Von 897 Rückmeldungen hätten 729 angegeben, dass sie digitale Verkündigungsformate während der Corona-Krise angeboten haben.
60 Prozent der digitalen Verkündigungsformate seien digitale Andachten und "digitale andachtsähnliche Formate", noch vor den digitalen Gottesdiensten, so die Autoren. Während der Corona-Krise sei nach der Studie ein deutliches Mehr an Verkündigungsformaten im Vergleich zu der Zeit vor der Covid-19 Pandemie feststellbar gewesen. Mit Blick auf die durchschnittliche Gottesdienstbesucherzahl an einem normalen Sonntag vor der Pandemie und während der Corona-Krise sei ein Zuwachs "von 287 Prozent" zu verzeichnen gewesen. Daher könne man von einem "Nachfrage-Boom" sprechen, sagte Daniel Hörsch, der als Sozialwissenschaftlicher Referent bei "midi" die Studie geleitet hat.
EKD beschließt Missbrauchsstudien

epd-bild/Heike Lyding
Hannover, Berlin (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) will ab Oktober in mehreren Studien sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aufarbeiten. Die 20 Landeskirchen stimmten der Beauftragung eines unabhängigen Forschungsverbunds in einer digitalen Sitzung der Kirchenkonferenz einstimmig zu, wie die EKD am 18. Juni in Hannover mitteilte. Der Forschungsverbund soll in mehreren Teilstudien Ursachen und Besonderheiten von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche untersuchen. Vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, kam das Signal, eine übergreifende Dunkelfeldstudie anzugehen.
"Wir wollen Geschehenes rückhaltlos aufarbeiten, um so dafür Sorge zu tragen, dass künftiges Leid und Gewalt in Kirche und Diakonie bestmöglich verhindert werden", sagte die Sprecherin des Beauftragtenrates der EKD, Kirsten Fehrs. Nach Zahlen der EKD sind bislang 770 Menschen Opfer von sexualisierter Gewalt geworden.
Nach den Plänen des Forschungsverbunds soll es vier oder fünf Studien zu einzelnen Aspekten geben, etwa zu Täterstrukturen oder zu den Auswirkungen des sexuellen Missbrauchs auf die Biografie der Betroffenen. Außerdem ist eine Metastudie geplant, die sowohl bereits vorliegende Einzelstudien von Landeskirchen als auch die Teilstudien zusammenführt.
3,6 Millionen Euro Kosten
Die 3,6 Millionen Euro teure Studie soll den Angaben zufolge innerhalb von drei Jahren Ergebnisse liefern. Sie werde von Betroffenen begleitet, sagte die Hamburger Bischöfin Fehrs. So sollen Zwischenergebnisse regelmäßig mit Betroffenen diskutiert werden.
Der Betroffenenbeirat, der die Arbeit des Beauftragtenrates begleiten soll, solle im Laufe des Sommers berufen werden, teilte die EKD mit. Ursprünglich war geplant gewesen, dass der Betroffenenbeirat, der aus zwölf Mitgliedern bestehen soll, seine Arbeit im Mai aufnimmt. Doch zum Ende der Bewerbungsfrist Ende Januar hatten noch nicht genügend Bewerbungen vorgelegen, die Frist war daher auf Ende März verlängert worden. Die Auswahl der Mitglieder hatte sich zudem durch die Kontaktbeschränkungen infolge der Corona-Pandemie verzögert.
Die Studien sind Teil eines Maßnahmenpakets zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, das die EKD im November 2018 beschlossen hatte. Seitdem hat die evangelische Kirche unter anderem die unabhängige "Zentrale Anlaufstelle.help" für Betroffene eingerichtet.
Eine ursprünglich vorgesehene Dunkelfeldstudie, die die Dimensionen des Kindesmissbrauchs erhellen sollte, wurde zurückgestellt. Das Vorhaben stellte sich für die EKD als zu teuer heraus, wenn es wissenschaftlich valide durchgeführt werden soll. Der Unabhängige Beauftragte Johannes-Wilhelm Rörig sagte am 18. Juni bei einer Video-Pressekonferenz mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), dass eine solche Studie "ganz oben auf der Tagesordnung" des Nationalen Rats zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch stehe. Er wolle sich weiterhin dafür starkmachen.
Der Ulmer Kinderpsychiater Jörg Fegert forderte bei der Pressekonferenz ein umfassendes staatliches Monitoring des Dunkelfelds bei Kindesmissbrauch. Er zitierte Zahlen der Weltgesundheitsorganisation, wonach rund zehn Prozent der heute erwachsenen Menschen in Deutschland Erfahrungen mit Missbrauch in der Kindheit und Jugend gemacht hätten. "Der wahre Skandal ist das Ausmaß des unentdeckten Missbrauchs", sagte Fegert, der in einer Studie im März 2019 mehr als 100.000 potenzielle Missbrauchsopfer in der evangelischen Kirche angenommen hatte. Andere Wissenschaftler hatten danach die Datenbasis der Studie angezweifelt.
"Stärkung von Distanz"

epd-bild/Stefan Arend
Düsseldorf (epd). Die NRW-Landesregierung habe die Verfolgung von sexuellem Kindesmissbrauch zu einem Schwerpunkt ihrer Polizeiarbeit gemacht, erklärte der evangelische Theologe. Im Jahr 2019 wurden nach Angaben des Landeskriminalamts fast 5.000 Fälle von sexueller Gewalt und Kinderpornografie erfasst. Etwa 80 Prozent seien aufgeklärt worden. Die Auswerter und Analysten der Bilder und Datenträger, denen diese Ermittlungserfolge auch zu verdanken seien, seien zur Inanspruchnahme psychologischer Begleitung verpflichtet.
Viele Stunden täglich betrachteten etwa 100 Polizistinnen und Polizisten Bilder und Filme mit Szenen von Gewalt an Kindern, berichtete der ehemalige Gemeindepfarrer erläutert, der inzwischen für drei Landesoberhörden der Polizei für die Polizeiseelsorge zuständig ist. Um das auszuhalten und im eigenen Leben von den Eindrücken nicht überschwemmt zu werden, sei der wichtigste Schutz, "den Sinn ihrer Arbeit zu erkennen und zu wissen, dass sie sich den Bildern aussetzen, damit nicht noch mehr Kinder Opfer sexueller Gewalt werden".
Neben brutalen Gewalt- und Pornografiedarstellungen seien bestimmte Szenen für viele Ermittler besonders schwer zu ertragen. "Das sind Videos, auf denen die Kinder lächeln, in die Kamera gucken und dabei missbraucht werden." Diese Kinder seien so "verdreht sind von ihren Emotionen, dass die alles dafür tun, um dem Papa oder Onkel oder dem Freund, den sie lieben und der sie verwöhnt, einen Gefallen zu tun".
Zu Beginn ihrer Auswertungstätigkeit lernten die Ermittler, genau auf die Wirkung der Bilder zu achten. "Das ist so eine Art Weckruf am Anfang", sagte Bredt-Dehnen. Geschult würden sie auch, auf ihr Wohlbefinden zu achten. Um auf die Dauer die Szenen ertragen zu können, müssten sie kleine Veränderungen an sich wahrnehmen. Schließlich müssten sie ihre intimsten Lebensbereiche vor der Macht der brutalen Bilder schützen. Die Ermittlungsarbeit dürfe nicht das innerste Familienleben belasten. "Ob das nun der Umgang mit den eigenen Kindern ist, der weiter herzlich nah und auch körperlich sein muss, oder ob das auch die eigene Sexualität ist."
Tatsächlich sei es Analysten möglich, sich nach den Stunden am Bildschirm wieder von den Eindrücken zu distanzieren. "Das ist ungefähr so, wie ein Feuerwehrmann oder eine Sanitäterin nach einem Einsatz auch nicht mehr ständig an ein Unfallopfer denkt", erläuterte der Landespolizeiseelsorger, der wie alle acht Polizeiseelsorgerinnen und Seelsorger der Evangelischen Kirche im Rheinland Menschen in der Begleitung Traumatisierter ausgebildet ist.
Als Christ trage ihn die Gewissheit, dass die Gewalt nicht das letzte Wort hat. "Selbst die Kinder, die da so massiv von Gewalt betroffen sind, sind nicht verloren", zeigte er sich überzeugt. Zwar sei es in manchen Fällen schwer vorstellbar, dass die Jungen und Mädchen in ein weitgehend gesundes Leben hineinwachsen könnten. "Aber manchen gelingt das, nachdem sie aus dieser Gewaltmaschine herausgeholt wurden." Auch für diese Hoffnung arbeiteten die Polizistinnen und Polizisten.
Präses Rekowski ruft zur Unterstützung von Flüchtlingen auf
Kirchen und Verbände fordern zum Weltflüchtlingstag mehr Hilfe für Flüchtlinge. Sie kritisieren das hohe Corona-Risiko in den Flüchtlingslagern. Integrationsminister Stamp sprach von einer gemeinsamen Verantwortung, Flüchtlinge zu schützen.Düsseldorf (epd). Kirchen sowie Islam- und Sozialverbände haben anlässlich des am Samstag begangenen Weltflüchtlingstages eine stärkere Unterstützung für Flüchtlinge gefordert. "Flüchtlinge gehören zu Gottes großer Menschheitsfamilie und sie brauchen unsere Hilfe, unsere Unterstützung", sagte der rheinische Präses Manfred Rekowski in einer am 19. Juni veröffentlichten Videobotschaft. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki prangerte die unmenschlichen Bedingungen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln an und appellierte an die Politik, besonders unbegleitete Minderjährige und alte Menschen von dort aufzunehmen. Auch die Wohlfahrtsverbände in NRW drängten auf die sofortige Aufnahme von älteren und erkrankten Menschen,
Kirchen unterstützten die Seenotrettung im Mittelmeer, "damit Menschen auf der Flucht nicht ertrinken", sagte Rekowski, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. "Wir unterstützen die griechischen Kirchen bei ihrer humanitären Arbeit in den Flüchtlingslagern." Auch in Deutschland sei die Kirche in der Flüchtlingsarbeit aktiv.
Kardinal Woelki: Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen
Der Kölner Erzbischof Woelki, erklärte die Aufnahme von minderjährigen und alten Menschen sei "schlicht ein Gebot der Menschlichkeit und der Nächstenliebe", erklärte Woelki am 19. Juni in einem Videostatement zum Weltflüchtlingstag. "Auf den griechischen Inseln Samos, Lesbos und Kos hausen Menschen seit Monaten in erbärmlichen Lagern - traumatisiert, krank, der Corona-Pandemie nahezu schutzlos ausgeliefert", sagte der Kölner Kardinal. Sie brauchten eine Chance zum Überleben. "Wir müssen es uns leisten, diese Menschen bei uns aufzunehmen, um ihnen endlich einen sicheren Hafen zu geben."
Humanitäres Handeln sei in dieser beispiellosen Krise ein Gebot von Solidarität und Menschlichkeit, die sich über nationale Grenzen hinweg erstrecke, sagte der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege NRW, Frank Johannes Hensel. Die Corona-Pandemie bedrohe noch immer 42.000 Flüchtlinge "in den völlig überfüllten Elendslagern" auf den griechischen Inseln Lesbos, Samos, Chios, Leros und Kos, hieß es. Grundlegende Hygienemaßnahmen könnten aufgrund der Lebenssituation nicht umgesetzt werden. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" wies auf die große Not der Millionen geflüchteter Mädchen und Jungen hin. Kinder seien besonders gefährdet.
Der NRW-Flüchtlings- und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sagte dem epd: "Wir haben die gemeinsame Verantwortung, Flüchtlinge zu schützen und gleichzeitig Fluchtursachen zu bekämpfen. Und das nicht nur am Weltflüchtlingstag." Er betonte: "Niemand flieht freiwillig aus seiner Heimat."
Eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik mahnte die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) an. "Wir appellieren an die Politik, globale Verantwortung zu übernehmen und eine Politik zu etablieren, deren Leitlinie das Wohl des Menschen ist und nicht der Profit", erklärte IGMG-Generalsekretär Bekir Altas. Bewaffnete Auseinandersetzungen, Naturkatastrophen und Armut sorgten für eine steigende Zahl von Flüchtlingen.
Der Weltflüchtlingstag wurde erstmals 1914 von Papst Benedikt XV. vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges als Gedenktag ausgerufen. 2001 wurde der 20. Juni von den Vereinten Nationen zum jährlichen Weltflüchtlingstag erklärt.
Friedenswort der rheinischen Kirche wird kontrovers diskutiert
Kerpen (epd). Das 2018 von der Evangelischen Kirche im Rheinland veröffentlichte Friedenswort "Auf dem Weg zum gerechten Frieden" wird innerhalb der Kirche kontrovers diskutiert. Das Papier sei "ein Paradigmenwechsel weg von der Lehre vom gerechten Krieg hin zum Leitbild vom gerechten Frieden", erläuterte Landeskirchenrätin Anja Vollendorf am 18. Juni bei einer Diskussion in der Johanneskirche in Kerpen.
Der Text fordere, Frieden aktiv zu fördern und Auseinandersetzungen durch Verhandlungen, Schlichtungen und Mediationen zu befrieden, sagte Vollendorf. Es sei zu unterscheiden zwischen "power", demokratisch legitimierter Gewalt zum Beispiel der Polizei und des Militärs in eng begrenzten Ausnahmesituationen, und "violence", der zerstörerischen und ethisch nicht gerechtfertigten Gewalt.
Reiner Schwalb, Brigadegeneral a.D. und ehemaliger Militärattaché an der deutschen Botschaft in Moskau, wies darauf hin, dass es aus seiner Sicht "Probleme auf der Welt gibt, die gelöst werden müssen". Als Soldat denke man dabei zielorientiert, unterstrich Schwalb. "Wir befähigen Gesellschaften zur Rechtstaatlichkeit und zur Demokratie. Ohne Waffen geht das nicht." Evangelische Christen könnten auf solche Fragen unterschiedliche Antworten geben. Letztlich seien sie verantwortlich vor Gott.
Militärdekanin fehlt in der Schrift der spirituelle Friedensaspekt
Pfarrerin Almuth Koch-Torjuul von der evangelischen Kirchengemeinde Kerpen nannte das Friedenswort "einen tollen Impuls von der Landeskirche, Menschen anzuregen, für Friedens-Engagement zu werben". In ihrer Gemeinde gebe es einige Soldaten, die auch im Ausland eingesetzt werden. "Da ist es wichtig, dass man sich wahrnimmt. Und man muss ethisch darüber sprechen, was das für Ausnahmesituationen sind."
Petra Reitz, Leitende Militärdekanin der Bundeswehr, kritisierte, die Schrift kreise "sehr viel um unsere eigene Gerechtigkeit". Ihr fehle der spirituelle Friedensaspekt: "Wir haben den Frieden von Gott empfangen." Auch der "Balance-Akt zwischen der biblischen Friedenstheologie und der politischen Konzeption des liberalen Rechtsfriedens" werde nicht abgebildet, sagte Reitz. Fehlen würden zudem Aussagen über Biowaffen, an denen gerade intensiv geforscht werde, und Cyber-Räume.
Die Evangelische Kirche im Rheinland hatte das Friedenswort 2018, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, veröffentlicht. Das Papier ruft dazu auf, Krieg als Mittel der Konfliktlösung zu überwinden. Alle Gemeinden und Kirchenkreise wurden um Stellungnahmen gebeten. Auf der Landessynode 2021 sollen die Rückmeldungen diskutiert werden.
Kirchen wollen umweltfreundlichen Wiederaufbau in der EU
Brüssel, Bonn (epd). Die großen Kirchen in Deutschland dringen darauf, dass sich Deutschland während seiner EU-Ratspräsidentschaft für einen klima- und umweltfreundlichen Wiederaufbau der Wirtschaft einsetzt. Zudem bedürfe es für den Wiederaufbau einer schnellen Einigung auf den EU-Haushaltsrahmen für 2021 bis 2027, erklärten der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, am 17. Juni in Bonn und Hannover.
Unser aller Zukunft liege "nicht allein bei den Nationalstaaten, sondern in Europa", hieß es in der Erklärung: "Wir fordern die deutsche Politik daher auf, im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft 2020 und darüber hinaus die Zukunft unseres gemeinsamen Hauses Europa in Verantwortung für den europäischen Zusammenhalt zu gestalten." Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate den EU-Ratsvorsitz und wird damit die Agenda in Brüssel noch stärker mitprägen als sonst.
Die Vertreter der Kirchen wiesen vor diesem Hintergrund auf die Folgen der Corona-Pandemie hin, die arme Menschen und strukturschwache Länder mutmaßlich am stärksten treffe. Deutschland solle die Präsidentschaft zur Hilfe für besonders betroffene Staaten nutzen, forderten Bätzing und Bedford-Strohm. "Ein deutlicher Ausdruck der europäischen Verantwortung für das globale Gemeinwohl wäre etwa eine Initiative für die soziale und ökologische Gestaltung von Liefer- und Wertschöpfungsketten im Einklang mit den Menschenrechten", hieß es weiter.
Weitere wichtige Felder sind aus Sicht der Theologen die Digitalisierung, Arbeit und Qualifizierung insbesondere für junge Leute, eine menschenwürdige Asylpolitik und legale Zugangswege für Migranten sowie das Rechtsstaatsprinzip. Außerdem sollten die EU und das kürzlich ausgetretene Großbritannien eine enge Partnerschaft anstreben.
"Tag der Autobahnkirchen" mit Andachten und Gebeten

epd-bild/Christian Schwier
Kassel/Vlotho (epd). Wegen der Corona-Pandemie haben am 22. Juni nur 16 der insgesamt 44 Autobahnkirchen in Deutschland am "Tag der Autobahnkirchen" teilgenommen. In den geöffneten Kirchen seien die Besucher zu Andachten und gemeinsamen Gebeten eingeladen worden, teilte die Akademie des Versicherers im Raum der Kirchen, die den jährlich stattfindenden Aktionstag initiiert, in Kassel mit. Den Besuchern seien zudem neben einer Parkscheibe als Erinnerung kostenlose Broschüren wie "Gebete und Lieder für unterwegs" oder ein mehrsprachiger Reisesegen angeboten worden.
Über eine Million Menschen nutzen nach Angaben zufolge jährlich das bundesweite Angebot der Autobahnkirchen. Von den Kirchen sind 19 evangelisch, acht katholisch und 17 ökumenisch getragen. Die älteste katholische Autobahnkirche steht seit 1958 in Adelsried, die älteste evangelische seit 1959 in Exter, heute ein Ortsteil von Vlotho im Kreis Herford. Sie befindet sich an der A2 Bielefeld-Hannover, an der Abfahrt Exter.
Die Autobahnkirchen laden nach Angaben der Akademie dazu ein, beim Reisen zur Ruhe zu kommen, sich zu erholen und zu besinnen. Sie seien damit ein Gegenpol zum Leben auf der Überholspur. Die Menschen schätzten vor allem die Ruhe und die Anonymität. Viele von ihnen nutzten das "Anliegenbuch", um ihre Gedanken festzuhalten, viele zündeten eine Kerze an und geben eine Spende.
Die Akademie der Versicherer im Raum der Kirchen wurde 1978 gegründet. Ihr Anliegen ist es nach eigenen Angaben, christliche Werte zu fördern, indem sie sich in verschiedenen Arbeitsfeldern im Schnittpunkt von Kirche und Gesellschaft engagiert.
Ökumenischer Kirchentag soll als Corona-"Sonder-Edition" laufen
Frankfurt a.M. (epd). Der Ökumenische Kirchentag im Mai 2021 in Frankfurt am Main soll sich organisatorisch wie inhaltlich stark nach der Corona-Krise richten. Der Deutsche Evangelische Kirchentag plane die kommende Veranstaltung als eine "Art Sonder-Edition unter Corona-Bedingungen", sagte Generalsekretärin Julia Helmke dem Online-Portal "evangelisch.de" (16. Juni). "Eine besondere Handlungsanweisung ist nun, dass wir für voraussichtlich weniger Menschen vor Ort planen." Gleichzeitig wollten aber die Initiatoren mit Internet-Angeboten mehr Menschen erreichen: "Das ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen."
Der Ökumenische Kirchentag könnte dadurch zu einem Experimentierlabor werden, betonte die Theologin. Im Mittelpunkt stünden diesmal Themen, die sich während der Corona-Pandemie neu oder schärfer gestellt hätten. Dazu zählten Verschwörungstheorien, Menschenwürde, Geschlechtergerechtigkeit oder die Frage nach einer sozial-ökologischen Zukunft. So beleuchte ein Forum unter der Überschrift "Zivilcourage", wie die zahlreichen Corona-Verschwörungstheorien mit den Ängsten der Menschen zusammenhingen - und wie diese sich am Ende auf die Demokratie auswirkten.
Gerechtigkeit in der Pflege
In einer Podiumsreihe befassten sich die Gäste unter anderen mit der Würde älterer Menschen und der in Corona-Zeiten aufgekommenen ethischen Frage, für wen sich eine Corona-Behandlung noch lohne, erläuterte Helmke. Unter dem Motto "Der perfekte Mensch" solle dabei das christliche Menschenbild aus naturwissenschaftlicher und gesellschaftspolitischer Perspektive zur Diskussion stehen. Ein Thementag widme sich darüber hinaus der Gerechtigkeit in der Pflege. Zudem werde in einem eigenen Zentrum untersucht, warum während der Corona-Krise meist Frauen die zusätzliche familiäre Belastung schulterten.
Helmke ist seit 1. Juli 2017 Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Sie studierte Evangelische Theologie und Kulturjournalismus und ist ausgebildete geistliche Begleiterin. Helmke lehrt als Honorarprofessorin für Christliche Publizistik in Erlangen und engagiert sich ehrenamtlich in der evangelischen Filmarbeit.
Der 3. Ökumenische Kirchentag findet vom 12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main statt. Er wird vom Deutschen Evangelischen Kirchentag und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken ausgerichtet. Die beiden vorangegangenen Ökumene-Kirchentage wurden 2003 in Berlin und 2010 in München gefeiert.
Papst Benedikt fliegt zurück nach Rom

epd-bild/Paul Mazurek
Regensburg (epd). Der emeritierte Papst Benedikt XVI. will am 22. Juni seinen Deutschlandaufenthalt beenden und nach Rom zurückkehren. Der Rückflug von München sei für den Vormittag geplant, sagte der Sprecher des Bistums Regensburg, Clemens Neck, am 21. Juni dem Evangelischen Pressedienst (epd). Seit dem 18. Juni hatte sich der 93-jährige Benedikt überwiegend in Regensburg aufgehalten, wo er seinen schwerkranken Bruder Georg Ratzinger (96) besuchte. Am 21. Juni habe er mit diesem die Eucharistie gefeiert, sagte Neck.
Am 19. Juni hatten die Brüder gemeinsam eine Messe im Wohnhaus von Georg Ratzinger in der Regensburger Luzengasse gefeiert. Benedikt habe nach der Begegnung mit seinem Bruder "sehr gestärkt" gewirkt, hatte der Subregens des Priesterseminars, Christoph Leuchtner, mitgeteilt. Am 20. Juni feierte er erneut mit seinem Bruder eine Messe, später wurde er zum Grab seiner Eltern und seiner Schwester auf den Friedhof Ziegetsdorf gefahren. Am Abend besuchte er sein früheres Wohnhaus in Pentling, wo der 93-Jährige von 1970 bis 1977 gewohnt hatte.
Wie aus einem katholischen Mädchen ein evangelischer Pfarrer wurde

epd-bild/Winfried Rothermel
Überlingen (epd). Von sich selbst sagt Samuel Schelle, dass er "eigentlich ein absoluter Durchschnittsmensch" ist. Nur, dass seine Identität eine etwas größere Rolle spiele als bei anderen Menschen. Vor 37 Jahren wurde Samuel als Susanne in eine traditionelle katholische Familie hineingeboren, doch als Frau fühlte er sich im Katholizismus nicht willkommen. Er konvertierte, wurde evangelische Pfarrerin, sein Traumberuf - und war trotzdem todunglücklich. Irgendwas mit dem Liebesleben funktionierte bei ihm nicht. Bis er begann, sich mit Transsexualität zu beschäftigen, "mit dem Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein", wie er sagt. "Plötzlich machte alles Sinn", erzählt der Pfarrer aus Überlingen am Bodensee. Er trat den Weg zu einem neuen Leben als Mann an.
Schelle sagt, seitdem er denken könne, habe er gewusst, dass er anders sei: "Ich fand es immer komisch, dass die anderen mich für ein Mädchen hielten." Allerdings hatte er keinen Namen für sein "Anders-Sein". Seine Eltern ließen ihm alle Freiheiten. "Ich hatte dahingehend eine glückliche Kindheit, war kein Außenseiter." Er sei eben nur kein "klassisches Mädchen" mit Kleidern und langen Haaren gewesen.
Schnell an Grenzen gestoßen
Erst in dem Moment, als er Liebe und Sexualität entdeckte, wurde es wirklich schwierig. "Nichts schien zu passen", sagt Schelle. Weder bei Männern noch bei Frauen gelang es ihm, er selbst zu sein. Schelle sagt, er schob das Thema immer wieder weg, steckte seine Energie in andere Dinge - Schule, Studium, seinen Glauben.
In der katholischen Kirche fand er jedoch keine Erfüllung. "Als Mädchen bin ich schnell an Grenzen gestoßen. Das erschien mir unfair", erklärt Schelle. Mit 18 Jahren konvertierte er zum protestantischen Glauben und stellte fest: "Vom Denken und vom Herzen war ich schon immer Protestant gewesen." Er studierte Theologie und bekam mit 30 Jahren seine erste Pfarrstelle in einer Gemeinde im Schwarzwald. "Ich stand beruflich da, wo ich wollte, und war trotzdem nicht glücklich."
Er fragte sich, was an ihm "falsch" sei. Wieso die anderen eine Familie gründeten und bei ihm nichts in diese Richtung klappte. Eine Therapeutin machte ihn schließlich auf das Thema Transsexualität aufmerksam. Wobei Schelle den Begriff "Transidentität" bevorzugt. "Bei transsexuell denken viele, dass es etwas mit Sex zu tun hat", erläutert er. Aber es gehe um Identität.
Entdeckung der Identität
Für ihn war es eine großartige Entdeckung: "Ich habe erfahren, mein Denken, mein Sein, das ist alles richtig", erzählt er. Auch mit seinem Glauben konnte er seine neue Identität in Einklang bringen. "Gott hat mich so geschaffen, wie ich bin - als transidenter Mann", betont Schelle. Überhaupt, gibt er zu bedenken, sei die Welt doch so vielfältig, warum sollte Gott sich ausgerechnet beim Geschlecht auf nur zwei Alternativen beschränken.
Einzig, ob er gleichzeitig Mann sein und als Pfarrer arbeiten könne, machte ihm Sorgen. Daher wechselte er zunächst die Pfarrstelle, ging nach Überlingen. Der Plan war, dort zwei Jahre zu bleiben, in dieser Zeit wolle Schelle seinen Namen und seinen Körper verändern. "Danach wollte ich dann in einer anderen Gemeinde neu als 'Herr Schelle' anfangen", erzählte er. Das sei jetzt aber gar nicht mehr so wichtig. "Ich habe hier von Anfang an so viel Unterstützung erfahren, dass ich gerne auch im Bezirk bleiben würde." Ob es noch andere transidente Pfarrer in Baden gibt, dazu äußert sich die Landeskirche aus Datenschutzgründen nicht.
"Nicht nach Mann und Frau sortieren"
Regine Klusmann ist evangelische Dekanin im Kirchenbezirk Überlingen-Stockach und Schelles Vorgesetzte. Er sei ein beliebter Pfarrer, sagt sie: "Durch seine fröhliche Art und seinen offenen Umgang mit dem Thema Transidentität gab es keine Probleme." Einige Nachfragen seien zwar gekommen, aber schnell sei klar gewesen, dass man sich sein Geschlecht nicht einer augenblicklichen Laune folgend aussucht, sondern dass Transidentität biologische Ursachen hat. Grundsätzlich, sagt Klusmann, sei es als Vorgesetzte ihr Bestreben, gar nicht so viel Aufhebens um das Thema Transidenität zu machen, sondern es als normale Möglichkeit zu betrachten.
Schelle sieht das genauso. Er wünscht sich für die Zukunft einen offeneren Umgang mit dem Thema Geschlechtsidentität. Es wäre schön, wenn die Gesellschaft dem Geschlecht nicht so viel Gewicht beimessen würde. "Wir sollten Menschen nicht nach Mann und Frau sortieren, sondern besser nach Fähigkeiten und Eigenschaften", betont er.
"Jetzt gibt es mich ja wirklich"
Manchmal besucht er Schulen, um Jugendlichen von seinem Werdegang zu berichten. "Es ist wichtig, dass sie wissen, dass es Transidentitäre gibt", sagt er. Es sei für ihn kein Spaß gewesen, jahrzehntelang mit seiner Identität zu hadern. Sie sollten die Chance haben, schon in jüngeren Jahren einen Namen für ihr "Anders-Sein" zu bekommen - und einem ganz normalen Menschen zu begegnen, der eben transident ist. Dann seien die Menschen auch aufgeschlossener für das Thema.
Und auch für das kirchliche Leben hat Schelle noch eine Idee: "Es wäre schön, wenn es eine neue Kasualie gebe, um transidente Menschen zu begleiten", sagt er. Einen Gottesdienst für eine wichtige Lebensstation also, der Umbrüche wie seinen spiegelt. "Ich würde gerne noch einmal mit meinem neuen Namen, als Samuel Schelle, den Segen Gottes zugesprochen bekommen. Jetzt gibt es mich ja wirklich."
Schweizer Ordensfrauen gestalten Ökumene-Gebetswoche 2021
Genf, Frankfurt a. M. (epd). Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird im kommenden Jahr von Frauen aus der Schweiz gestaltet. Unter dem biblischen Motto "Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet reiche Frucht bringen" haben die Schwestern der "Kommunität von Grandchamp" die Materialien für die Vorbereitung der Gebetswoche entworfen, wie der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) am 16. Juni in Genf mitteilte. Zu der in den 1930er Jahren ins Leben gerufenen klösterlichen Gemeinschaft gehörten etwa 50 Schwestern aus verschiedenen Kirchen und Ländern.
"Seit Jahrzehnten haben die Schwestern von Grandchamp den Ökumenischen Rat der Kirchen und die ökumenische Bewegung mit ihrer stillen Anwesenheit und ihren täglichen Gebeten begleitet", sagte der kommissarische stellvertretende ÖRK-Generalsekretär, Pastor Odair Pedroso Mateus. Die Materialien stehen bereits auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch unter "www.oikoumene.org" zur Verfügung.
Kirchen in aller Welt nutzen die Texte den Angaben zufolge im ökumenischen Gottesdienst zur Eröffnung der Gebetswoche ebenso wie für die Gestaltung der acht Tage. Jedes Jahr werden ökumenische Partner in einer anderen Region der Welt gebeten, die Materialien für diese Woche auszuarbeiten.
Die weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen findet den Angaben des Rates zufolge auf der südlichen Halbkugel zwischen Himmelfahrt und Pfingsten und auf der nördlichen Halbkugel vom 18. bis 25. Januar statt. Sie wird seit Anfang des 20. Jahrhunderts von Christen aller Konfessionen mit zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen begangen. Der Päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen und der Ökumenische Rat der Kirchen verantworten sie seit den 60er Jahren gemeinsam. In Deutschland wird die Gebetswoche getragen von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland mit Sitz in Frankfurt am Main.
Afrikanischer Pfarrer erhält neue Aufgabe in Speyer
Speyer (epd). Der schwarze katholische Pfarrer Patrick Asomugha, der nach einer Morddrohung und wiederholten Anfeindungen seine Pfarrei in Queidersbach im Landkreis Kaiserslautern Ende April verlassen hat, erhält in Speyer eine neue Aufgabe. Der 56-jährige aus Nigeria stammende promovierte Theologe werde ab Juli übergangsweise als Priester in der Dompfarrei Pax Christi mithelfen, bestätigte der Sprecher des Bistums Speyer, Markus Herr, am 15. Juni dem Evangelischen Pressedienst (epd) entsprechende Medienberichte.
Asomugha werde zugleich in einer Arbeitsgruppe des Bistums mitwirken, die sich mit den Erfahrungen von Priestern und pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Weltkirche befassen werde, sagte Herr. Dabei solle es unter anderem auch um die Frage von Rassismus und Antisemitismus in Deutschland gehen.
Der Vorschlag der übergangsweisen Mithilfe als Priester in der Dompfarrei Pax Christi sei vom Bistum gekommen, und Pfarrer Asomugha sei damit einverstanden gewesen, sagte der Bistumssprecher. Die neue Aufgabe für Asomugha sei eine Übergangslösung, bis eine neue, dauerhafte Aufgabe in der Seelsorge des Bistums für ihn gefunden sei.
Asomugha hatte drei Jahre lang die Pfarrei Heiliger Franz von Assisi in Queidersbach geleitet. Ende April zog ihn die Speyerer Bistumsleitung einvernehmlich zu seinem persönlichen Schutz ab, wie es heißt. Der schwarze Pfarrer hatte eine verschlüsselte Morddrohung erhalten und war seit Mitte vergangenen Jahres mehrfach angefeindet worden. Auch in der Kirchengemeinde von Queidersbach hatte es Auseinandersetzungen über den Pfarrer gegeben, dessen liberale Haltung bei konservativen Kräften offenbar auf Ablehnung stieß.
Rheinische Kirche fördert 10 "Erprobungsräume" für innovative Kirche
Düsseldorf (epd). Virtuelle Kirche, Kindergemeinde und ökumenische Segensfeiern: Die Evangelische Kirche im Rheinland fördert zunächst zehn innovative und unkonventionelle Formen kirchlichen Lebens in sogenannten Erprobungsräumen. Die Modellprojekte und Initiativen erprobten mit Mut und Kreativität, wie Kirche neu Gestalt gewinnen könne, erklärte die zweitgrößte deutsche Landeskirche am 17. Juni in Düsseldorf. Beworben hatten sich für die erste Phase des Förderprogramms 17 unterschiedliche Teams mit ihren Ideen.
Präses Manfred Rekowski zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt und Experimentierfreude der ersten Erprobungsräume. "Ich wünsche den Initiativen, dass sie unsere Kirche verändern, Prozesse anstoßen, in denen Bewährtes um Neues ergänzt wird", sagte der leitende Theologe der rheinischen Kirche, die sich zwischen Niederrhein und Saar erstreckt und rund 2,45 Millionen Mitglieder hat. Ziel sei es, Menschen zu erreichen, die sich in bisherigen kirchlichen Angeboten nicht beheimatet fühlten.
Zu den ausgewählten Initiativen gehören das urbane Familienkloster "die Eis-Heiligen" im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, die Gemeindegründung "die dorf.kirche düsseldorf", die Kindergemeinde "kidscom" in Cochem und der Aufbau der virtuellen Gemeinde "Lorenz-Space" in der Kirchengemeinde Schafbrücke bei Saarbrücken. In Solingen werden die Ortsgemeinde Widdert, die mit geringer pastoraler Versorgung ehrenamtlich verantwortet wird, und das Projekt "freiraum+" junger Familien in der Gemeinde St. Reinoldi Rupelrath unterstützt.
Zweite Bewerbungsphase startet am Reformationstag
Weitere ausgewählte Erprobungsräume sind ökumenische Segensfeiern in Essen, die Gründung einer internationalen Gemeinde im Kirchenkreis an Nahe und Glan, die Initiative "beymeister" in Köln-Mülheim und die Gemeinwesenorientierung des Kirchenkreises Niederberg. Die Projekte würden für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren finanziell, fachlich und beratend gefördert, hieß es. Die Erfahrungen sollen am Ende evaluiert werden.
Die rheinische Landessynode hatte das Förderprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 13 Millionen Euro im Januar beschlossen. In den kommenden zehn Jahren werden demnach sechs Millionen Euro für neue Formen der Gemeindearbeit bereitgestellt. Zudem wurden Pfarrstellen und eine Projektstelle "Gemeindeformen/Erprobungsräume" eingerichtet. Sie wird von der Theologin Rebecca John Klug geleitet, die in Essen die Initiative "raumschiff.ruhr" aufgebaut hat.
Am 31. Oktober, dem Reformationstag, beginnt eine zweite Bewerbungsphase für weitere "Erprobungsräume". Außerdem hat die rheinische Kirche eine Kooperation mit der CVJM-Hochschule in Kassel aufgenommen, um so innovative Gemeinde- und Jugendarbeit anzustoßen. Dazu wird ein Stipendium für fünf Plätze vergeben.
Die ersten zehn "Erprobungsräume": https://erprobungsraeume.de/thema/erprobungsraeume/
"Dein Gesicht für Moria": Online-Demonstration wird Videoinstallation
Köln (epd). Die evangelische Christuskirche in Köln macht mit einer Online-Demonstration auf die Notlage der rund 20.000 Menschen im griechischen Flüchtlingslager Moria aufmerksam. An der Aktion unter dem Motto "Zeig dein Gesicht für Moria" hätten sich bereits mehr als 100 Menschen mit Fotos und Videostatements beteiligt, teilte der Evangelische Kirchenverband Köln und Region am 18. Juni mit.
Das Video mit allen Beiträgen gehe nun an die Bundesregierung, hieß es. Außerdem ist bis 27. Juni jeden Abend ab Einbruch der Dunkelheit als Video-Installation "Mahnmal für Moria" ohne Ton an der Wand der Christuskirche zu sehen.
Mit der Aktion appellieren die Initiatoren an Bundesregierung und EU, das Flüchtlingslager Moria zu evakuieren. Moria ist ein seit November 2015 bestehendes Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, nahe dem gleichnamigen Dorf. Hier leben etwa 20.000 Menschen aus Afghanistan, Syrien, Irak, Iran und Afrika. Ausgelegt war es ursprünglich für lediglich 3.000 Menschen als Transitstation.
Saskia Karpenstein wird neue Superintendentin in Recklinghausen
Recklinghausen (epd). Die 46-jährige Pfarrerin Saskia Karpenstein ist am 20. Juni zur neuen Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Recklinghausen gewählt worden. Die Theologin aus Wanne-Eickel setzte sich im ersten Wahlgang mit 72 zu 24 Stimmen gegen ihre Mitbewerberin Pfarrerin Dorothea Goudefroy aus Menden durch, wie der Kirchenkreis mitteilte. Damit hatte Karpenstein deutlich mehr als die erforderliche Mehrheit der 108 stimmberechtigten Mitglieder der Kreissynode. Eine Superintendentin oder ein Superintendent wird für acht Jahre gewählt.
Die Kreissynode fand wegen der Corona-Pandemie unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln in der Christuskirche in Recklinghausen. Die Kreissynodalen und zwei Kandidatinnen trugen Masken zur Mund-Nase-Bedeckung. Ein Team aus dem Kirchenkreis hatte zudem ein Einlasskonzept mit versetzten Eintrittzeiten an sechs verschiedenen Eingängen der Kirche erarbeitet, wie es hieß. Beide Kandidatinnen hatten sich den Synodalen im Vorfeld schriftlich vorgestellt.
Oberbürgermeister würdigt Kirchen
In einem Grußwort der westfälischen Kirche rief die Bielefelder Landeskirchenrätin Barbara Roth am Samstag zu Zuversicht auf: "Die Zeichen sind auf Hoffnung gerichtet." Die Corona-Krise zeige, dass das Leben nicht vorhersehbar und verfügbar sei. "Aus diesem Grund ist es gut, eine Superintendentin zu haben, die gute Gaben für dieses Leitungsamt mitbringt", erklärte Roth. Der Bürgermeister von Recklinghausen, Christoph Tesche (CDU), dankte den Kirche für ihr Engagement in der Krise. Die Kirchen seien ein essenzieller Bestandteil der Gesellschaft und wichtig für den Zusammenhalt. Er freue sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Die neue Superintendentin Karpenstein stammt aus Herne und studierte Theologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Ihr Vikariat absolvierte sie in Dortmund und im Pädagogischen Institut der westfälischen Kirche in Schwerte. Ihre Pfarrstationen waren Bochum und Wanne-Eickel, im Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Herne übte sie zudem das Amt der Scriba aus. Karpenstein ist ausgebildete Supervisorin, Gestalttherapeutin und Pastoralpsychologin. Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern.
Kirchen und Diakonie laden zum 8. Fundraisingtag in Dortmund ein
Dortmund (epd). Für einen Fundraisingtag von Kirche, Diakonie und KD-Bank am 17. September im Dortmunder Reinoldinum sind jetzt Anmeldungen möglich. Den Impulsvortrag hält Torsten Schmotz vom Institut Förderlotse in Neuendettelsau, wie die Evangelische Kirche von Westfalen mitteilte. Der Fördermittelexperte vermittele dabei lebendig und praktisch, welche Wege es zu erfolgreichen Projektpartnerschaften gebe. In Workshops würden die Anregungen auf unterschiedliche Themen und Interessen vertieft. Darüber hinaus solle der 8. Fundraisingtag Rheinland-Westfalen-Lippe eine Plattform bieten, um Ideen auszutauschen und neue Impulse zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Zahlreiche Organisationen und Programme förderten auf Antrag Projekte kirchlicher und diakonischer Träger, hieß es. Wesentlich sei hier, in der vielfältigen Förderlandschaft die passenden Partner zu identifizieren und Anträge richtig zu stellen. Oftmals gebe es die Möglichkeit, im Verbund mit anderen Kooperationspartnern den Verwaltungsaufwand gering zu halten. Beim Fundraisingtag böten Fachleuten dazu Beratung an.
Der Fundraisingtag ist eine Zusammenarbeit der westfälischen, rheinischen und lippischen Kirche mit der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und der Bank für Kirche und Diakonie. Anmeldung und Programm unter: www.kd-bank.de/fundraisingtag
Bayern: Kirche will zunächst keine Stellen einsparen
München (epd). Wegen der Corona-Krise wird es in der bayerischen evangelischen Kirche keine sofortigen Stelleneinsparungen geben. Wie der Personalchef der Landeskirche, Stefan Reimers, in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte, ist sich der Landeskirchenrat einig, "dass wir jetzt gerade nicht einen Einstellungsstopp oder ähnliches für Pfarrerinnen und Pfarrer beschließen". Damit hätte man dem Nachwuchs "ein fatales Signal" gegeben. Unabhängig von der Corona-Pandemie würden in der Landeskirche Personalprognosen "für eine verlässliche und langfristig finanzierbare Personalpolitik" erstellt, erklärte Reimers.
Entscheidend sei, welches Personal eine Kirche brauche, "die auch in Zukunft die Menschen in ihren Lebenssituationen erreichen will". Die in der Corona-Krise verstärkt angewandten neuen digitale Formate können nach Reimers Ansicht auch neue Zielgruppen der Kirche ansprechen und solche, "die früher eher einen Bogen um die Kirche gemacht haben". Die digitalen Formate würden aber die bisherige Seelsorge nicht in den Hintergrund drängen, sagte er. Ein vertieftes Gespräch wie in der Seelsorge und der Begleitung von Menschen "benötigt die direkte Begegnung", erklärte Reimers.
Corona hat die evangelische Landeskirche "mitten in einer Situation der Veränderung und des Aufbruchs" erwischt", sagte der Personalreferent weiter. "Dabei gehören Veränderungsprozesse sowieso schon zum schwierigsten, nicht nur für eine ganze Kirche, sondern für jeden einzelnen Menschen". Für die Kirche sei sie mit Fragen verbunden, wie können wir Menschen noch begegnen, "oder sind wir für viele völlig unwichtig in ihren je eigenen Corona-Krisen?" Die Corona-Krise hat daher nach den Worten Reimers die Herausforderung, sich weiter zu entwickeln und vieles auch ganz neu zu machen, größer gemacht. "Manches werden wir lassen müssen, anderes ganz neu beginnen".
Einbruch in Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche offenbar aufgeklärt
Berlin (epd). Der Einbruch von Mitte Februar in die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ist offenbar aufgeklärt. Wie die Polizei am 16. Juni mitteilte, stellte sich ein 48-Jähriger am Vortag der Polizei und führte die Beamten auch zum Diebesgut. Bei dem Einbruch in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar war aus mehreren Opferstöcken und einer Kasse Geld entwendet worden. Außerdem verschwanden aus einer ebenfalls aufgebrochenen Vitrine zwei Orden, ein Jubiläumsabzeichen, eine Medaille und ein paar Silbermünzen.
Wie die Polizei mitteilte, erschien der Tatverdächtige am 15. Juni zusammen mit einem Rechtsanwalt im Fachkommissariat für Kunstdelikte des Berliner Landeskriminalamtes und gab den Einbruch zu. Anschließend habe er die Beamten zu einer Grünanlage im Stadtteil Lichtenberg geführt. Dort fand die Polizei nach seinen Hinweisen eine vergrabene Plastikbox mit den gesuchten Orden und Silbermünzen. Der 48-Jährige sei bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt, hieß es. Er wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in anderer Sache einem Haftrichter vorgeführt.
Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen West-Berlins. Die 1895 eingeweihte Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff stark beschädigt. Nur die Turmruine blieb danach als Mahnmal gegen den Krieg erhalten. Zwischen 1959 und 1963 wurde der Alte Turm durch ein vierteiliges Bauensemble des Architekten Egon Eiermann ergänzt. Traurige Bekanntheit erlangte die Kirche durch den Terroranschlag am 19. Dezember 2016 auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz.
Gesellschaft
Tierwohl: Ethikrat fordert Umsteuern bei Nutztierhaltung

epd-bild/Steffen Schellhorn
Berlin (epd). Der Deutsche Ethikrat verlangt ein grundsätzliches Umsteuern in der Nutztierhaltung, hält sich aber mit konkreten Forderungen an die Politik zurück. Das Tierwohl setze den Nutzungsinteressen des Menschen Grenzen, erklärte das Gremium am 16. Juni in Berlin bei der Vorstellung seiner Stellungnahme "Tierwohlachtung - Zum verantwortlichen Umgang mit Nutztieren". Diese Grenzen würden aber ständig überschritten.
Es sei eher die Ausnahme als die Regel, dass die Vorgaben des Tierschutzgesetzes bei der Haltung von Nutztieren eingehalten würden, kritisiert der Ethikrat. Die frühere Landwirtschaftsministerin Renate Künast (Grüne) sprach von einer wichtigen ethischen Unterstützung für einen Umbau der Tierhaltung.
Der Ethikrat spricht sich nicht gegen die Nutztierhaltung und auch nicht ausdrücklich gegen die Massentierhaltung aus. Mit dem Leben der Tiere müsse aber "achtsam und sparsam" umgegangen werden, fordert er in der Stellungnahme. "Wenn wir Missstände abstellen, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass wir weniger Tiere halten und weniger tierische Produkte konsumieren", erläuterte Ethikratsmitglied Sigrid Graumann. Eine Achtung des Tierwohls würde auch dazu führen, dass Fleisch teurer werden müsse.
Andauernde Verstöße in der Geflügel- und Schweinehaltung
Der Jurist Steffen Augsberg, der dem Gremium ebenfalls angehört, sagte, es gebe ein "massives Vollzugsdefizit" zwischen Tierschutz auf dem Papier und der Praxis in der Nutztierhaltung: "Ich kenne kein einziges Rechtsgebiet, in dem so heuchlerisch vorgegangen wird wie im Tierschutz - wo so viel oben drinsteht und so wenig unten ankommt."
Der Ethikrat wandte sich insbesondere gegen andauernde Verstöße in der Geflügel- und Schweinehaltung. Das Kükenschreddern und die Kastenstandhaltung von Sauen widersprächen nicht nur dem Tierschutz, sondern auch geltendem Recht, kritisierte das Gremium. Gesetzwidrige Praktiken würden durch "jahrelange Übergangsregelungen" weiter ermöglicht. Dies sei abzulehnen, sagte die neue Vorsitzende des Gremiums, die Münchner Medizinethikerin Alena Buyx. Die Stellungnahme war noch unter ihrem Vorgänger Peter Dabrock erarbeitet worden.
Die Verbraucherorganisation foodwatch verlangte die schnellstmögliche Abschaffung der Käfige für zwei Millionen Zuchtsauen. Pläne der Bundesregierung sähen vor, die "Kastenstands-Tierquälerei" für weitere 17 Jahre zu erlauben, kritisierte foodwatch. Die Bundestagsabgeordnete Künast erklärte, der Schutz der Tiere stehe seit 2003 im Grundgesetz, aber es gebe immer noch unhaltbare Zustände durch "massivste Lobbyaktivitäten der alten Agrarpolitik."
Vage Empfehlungen an die Politik
Der Ethikrat beschäftigt sich in der Tierwohl-Stellungnahme ausschließlich mit der Nutztierhaltung. Tierversuche, religiös motivierte Schlachtpraktiken wie das Schächten, der Wildtierhandel, Tiere im Sport oder der Umgang mit Zoo- und Zirkustieren sind nicht Gegenstand der Expertise. Bei den Empfehlungen an die Politik bleibt das Gremium vage. Es empfiehlt unter anderem, den Tieren eine stärkere Lobby zu verschaffen. Die Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums für Tierschutzfragen sei "in diesem Sinne problematisch", heißt es in den Empfehlungen.
Für Veränderungen allein an die Konsumenten zu appellieren, reiche nicht, meint der Ethikrat. Die Politik müsse einen Strukturwandel hin zu einer ethisch vertretbaren Nutztierhaltung in Gang setzen. Es gehe nicht um eine Konfrontation zwischen Verbrauchern und Bauern, sondern um Regeln, die es Landwirten ermöglichen, unter für sie wirtschaftlichen Bedingungen das Tierwohl zu berücksichtigen. Dazu zähle auch, dass es für eine Umstellung von Betrieben Unterstützung geben müsse.
Laschet: Kein Lockdown für Kreis Gütersloh

epd-bild / Gustavo Alàbiso
Gütersloh/Düsseldorf (epd). Nach dem massiven Corona-Ausbruch bleibt die Großschlachterei Tönnies im nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück bis 2. Juli geschlossen. Der zuständige Kreis Gütersloh stellte am Wochenende die 7.000 Beschäftigten und das Management per Verordnung unter Quarantäne. Die NRW-Landesregierung entschied sich am 21. Juni aber gegen einen Lockdown und damit das massive Runterfahren des öffentlichen Lebens für die ganze Region. Er könne aber einen Lockdown nicht ausschließen, wenn es zu einer höheren Zahl an Infizierten kommen werde, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Gütersloh.
Über 1.300 Beschäftigte bei Tönnies mit Coronavirus infiziert
Laut aktuellem Stand der Behörden sind über 1.330 Beschäftige vor allem aus Osteuropa positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehrheitlich betroffen sind demnach Beschäftigte im Betriebsteil der Fleischzerlegung. Eine Ausbreitung auf die Bevölkerung im Kreis konnte bislang verhindert werden, wie es hieß.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dringt derweil auf schnelle Schritte zum Schutz der Beschäftigten in der Fleischbranche. "Wir wollen die Kontrollen weiter verschärfen, noch bevor das neue Gesetz zur Arbeitssicherheit in der Fleischindustrie da ist", sagte Heil dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (20. Juni).
Der Arbeitsminister bekräftigte: "Wir machen mit dem Verbot von Werkverträgen im Kernbereich der Fleischindustrie auf jeden Fall ernst - ganz egal, welche Anstrengungen milliardenschwere Unternehmen auch in die Wege leiten, um dieses Vorhaben zu torpedieren." Mehrere Ministerien arbeiteten daran, das Verbot rechtssicher zu machen. "Im Sommer werde ich den Gesetzentwurf vorlegen", versprach Heil.
Der nordrhein-westfälische Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, er sei es leid, auf freiwillige Vereinbarungen der Unternehmen zu setzen. Es gehe nicht darum, Fleischbetriebe zu schließen, sondern auf dem gesetzlichen Weg vernünftige Arbeitsbedingungen in der Branche zu schaffen.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier: Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen
Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach sich für konsequentes Handeln aus. Die Versorgung mit Lebensmitteln sei ein hohes Gut, sagte Altmaier im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. "Und ich möchte, dass das Vertrauen an Lebensmitteln und an Fleisch 'made in Germany' erhalten bleibt."
Das bedeute, "dass wir auch dafür sorgen, dass Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden und dass die Missstände abgestellt werden, indem man entsprechende Veränderungen trifft", erklärte der Wirtschaftsminister. Das gelte nicht nur für die Werkverträge mit osteuropäischen Arbeitnehmern, sondern auch für die Unterbringung und die Arbeitsbedingungen konkret vor Ort.
Hofreiter ruft zu Tönnies-Boykott auf
Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sprach sich für ein Boykott von Tönnies-Produkten aus. "Es ist an der Zeit, dass die großen Supermarktketten sich nicht länger mitschuldig machen", sagte Hofreiter der "Bild am Sonntag". "Sie sollten Tönnies-Produkte aus ihrem Angebot nehmen."
Laut NRW-Ministerpräsident Laschet zeigt sich das Tönnies-Unternehmen kooperativ, das Infektionsgeschehen in Kreis unter Kontrolle zu halten. Im Kreis Gütersloh sind derzeit 32 mobile Teams in den umliegenden Städten und Gemeinden unterwegs, um in Unterkünften und angemieteten Wohnungen die ausländischen Arbeitskräfte mit Werksverträgen in gesundheitlichen Fragen zu beraten und Unterstützung anzubieten. Um sprachliche Hürden zu überwinden, sollen Dolmetscher eingeflogen werden.
Laschet bat auch die negativ getesteten ausländischen Beschäftigten, die Quarantäneregeln einzuhalten und nicht in ihre Heimat zurückzukehren. In einer Sitzung der Landesregierung sei am 21. Juni mit den Konsuln aus Polen, Rumänien und Bulgarien über Präventionsmaßnahmen in den Ländern beraten worden.
Lauterbach und Kutschaty kritisieren Entscheidung der Landesregierung
Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und Thomas Kutschaty, SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, kritisierten den Verzicht auf einen Lockdown. Die vereinbarte Grenze von 50 Neuinfektionen pro Woche je 100.000 Einwohner sei dort klar überschritten, sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" in Düsseldorf (22. Juni). Im ehemaligen Hotspot Heinsberg habe man mit einem Lockdown die Ausbreitung schnell kontrollieren können. Im Kreis Gütersloh ist seiner Ansicht nach die Kontrolle der unter Quarantäne gestellten Mitarbeiter dagegen nicht ausreichend gewährleistet, weil lückenhaft. "Das birgt ein hohes Risiko für Infektionen über die Mitarbeiterschaft der Fleischfabrik hinaus", warnte der Sozialdemokrat.
Kutschaty forderte am 22. Juni im WDR-Radio strengere Beschränkungen. So sollten etwa Schwimmbäder wieder geschlossen und Veranstaltungen abgesagt werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Er mahnte eine vollständige Aufklärung des Corona-Ausbruchs bei Tönnies an. Die Landesregierung müsse zu dem Vorwurf Stellung beziehen, dass vorherige Test zum Teil in den Laboren von Tönnies selbst durchgeführt worden sein sollen, sagte er am 21. Juni.
Sozialpfarrerin fordert EU-weite Regeln für Fleischindustrie

epd West / Gerd-Matthias Hoeffchen
Schwerte, Bielefeld (epd). Das Arbeitsschutzprogramm für die Fleischwirtschaft kann nach Worten der westfälischen Sozialpfarrerin Heike Hilgendiek nur ein erster Schritt sein. "Darüber hinaus müssen alle Regelungslücken geschlossen werden und mindestens EU-weite Regelwerke geschaffen werden, die menschenwürdige und gerechte Arbeits- und Lebensbedingungen herstellen", sagte Hilgendiek in Schwerte dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf massiven Corona-Ausbruch bei der Großschlachterei Tönnies mit rund 1.300 Infektionen.
Hilgendiek kritisiert "Formen moderner Sklavenarbeit"
Über die bisher angekündigten Maßnahmen hinaus sei die grundsätzliche Diskussion der Produktionsbedingungen überfällig: "Hintergründe und grundsätzliche gesellschaftliche Orientierungen, die zu dieser Form moderner Sklavenarbeit führen, müssen hinterfragt werden". Der Markt dürfe nicht allein darüber entscheiden, welche Produkte verkauft werden, erklärte die Landespfarrerin des westfälischen Kirche für Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Er müsse durch rechtliche Rahmenbedingungen gezügelt werden, die prekäre Arbeit, Ausbeutung von Mensch und Tier und die weitere Gefährdung des Planeten verhindern.
Eine an Masse und damit an Massentierhaltung orientierte Fleischproduktion stehe dem Menschen- wie dem Tierwohl entgegen, kritisierte Hilgendiek. Eine ungebrochen auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft führe offenbar dazu, dass Ungerechtigkeit und Menschenverachtung auch in Deutschland nicht nur hingenommen, sondern geradezu gefördert würden. Die internationale Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen in ihrer auf Export ausgerichteten Produktion basiere auf Lohndumping und Ausbeutung, erklärte Hilgendiek. Die verbindlichen Rechte sozialversicherungspflichtig Beschäftigter würden umgangen. Anstelle einer Konzentration der Fleischindustrie auf wenige Unternehmen sei eine regionale Landwirtschaft und ein regionaler Lebensmittelmarkt nötig, der zudem auf hochwertige und fair produzierte Fleischprodukte setze.
Die hohen Corona-Infektionszahlen bei Mitarbeiten in der Fleischindustrie hätten "die unzureichenden, gefährlichen und gefährdenden, skandalösen Arbeits- und Lebensbedingungen erneut entlarvt", sagte Hilgendiek weiter. Besonders die Situation der Arbeitnehmer aus Ost- und Südosteuropa sei mehr als prekär. Die aktuelle Situation trage dazu bei, die Grundsatzdiskussion auf der einen und die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeitenden auf der anderen Seite zu fordern und zu fördern. "Diese Gelegenheit darf nicht ungenutzt bleiben", mahnte Hilgendiek.
Studie: Mehr Ausländer - weniger Hassverbrechen
Marburg (epd). Wo viele Ausländer leben, gibt es weniger fremdenfeindliche Straftaten: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter der Leitung des Marburger Sozialpsychologen Ulrich Wagner. An der Untersuchung war auch das Bundeskriminalamt (BKA) beteiligt, wie die Universität Marburg am 15. Juni mitteilte.
Als von 2015 an die Zahl der Flüchtlinge in der Bundesrepublik anstieg, kam es vermehrt zu fremdenfeindlichen Übergriffen. Der Anstieg war jedoch nicht überall gleich hoch. Zur Erklärung stellten Fachleute zwei Theorien auf, wie die Universität erklärte. Eine besagt: Wenn in einer Region viele Ausländer leben, gibt es mehr Möglichkeiten zum Kontakt mit ihnen - die positiven Erfahrungen mit ihnen führten zum Abbau negativer Vorurteile. Die Bedrohungstheorie hingegen geht davon aus, dass ein höherer Anteil an Ausländern in der Bevölkerung ein Gefühl der Bedrohung wecke. Beide Erklärungsansätze erschienen aus wissenschaftlicher Sicht plausibel, erklärte Wagner.
Die Forscher aus Marburg und Osnabrück nutzten für ihre Untersuchung Daten zur politisch motivierten Kriminalität des BKA aus dem Jahr 2015 und setzten sie ins Verhältnis zu Daten aus den insgesamt 402 deutschen Regierungsbezirken. Sie kamen zu dem Schluss: Je mehr Ausländer in einem Bezirk leben, umso geringer fällt die Anzahl fremdenfeindlicher Straftaten aus. Durch einen steigenden Ausländeranteil bestünden mehr Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gruppen, so dass Vorurteile der Bevölkerungsmehrheit abgebaut würden, heißt es in der Studie.
Steinmeier: "Wir müssen Antirassisten sein!"

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Aus Sicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier muss im Kampf gegen Rassismus das eigene Verhalten hinterfragt werden. Jeder entscheide sich jeden Tag, bewusst oder unbewusst, in seinem Handeln wie im Nichthandeln, auf welcher Seite er stehe, sagte Steinmeier am 16. Juni in Berlin. "Nein, es reicht nicht aus, 'kein Rassist' zu sein", sagte er: "Wir müssen Antirassisten sein!"
Rassismus finde sich in vielen Lebensbereichen. "Vom abschätzigen Blick und der verletzenden Bemerkung über Benachteiligungen im Bildungssystem, bei der Bewerbung um einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung bis hin zur tödlichen Bedrohung", sagte Steinmeier laut Redemanuskript. Deutschland sei "nicht immer und überall ein Hort der Toleranz": "Auch hier werden Menschen ausgegrenzt, angegriffen und bedroht, weil ein beliebiges Merkmal sie als Angehörige einer Minderheit ausweist: weil sie eine dunkle Hautfarbe haben, eine Kippa tragen, in der Moschee beten oder einfach anders aussehen als die Mehrheit", sagte der Bundespräsident im Schloss Bellevue zu Beginn einer Gesprächsrunde über Erfahrungen mit Rassismus.
"Rassismus will keinen Dialog"
Rassismus in jeder Form sei ein Feind der Demokratie. "Rassismus will keinen Dialog, keine Vielfalt, kein friedliches Miteinander. Er will Hass auf andere und Dominanz über andere", sagte Steinmeier.
Zu Rassismusvorwürfen gegen deutsche Sicherheitsbehörden sagte das Staatsoberhaupt, er sei überzeugt: "Die Polizei und Sicherheitskräfte in unserem Land sind vertrauenswürdige Vertreter des Staates. Ausnahmen von dieser Regel sind Ausnahmen geblieben."
Polizei und Sicherheitskräfte verdienten Respekt und Unterstützung. Auch deshalb sei es richtig, dass die Bundesregierung eine Studie zum sogenannten Racial Profiling in Auftrag gebe.
Seit dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners Georg Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA wird auch in Deutschland verstärkt über Rassismus im Alltag diskutiert. Zehntausende Menschen gingen auf die Straße, um zu protestieren.
Zu der Diskussion hatte Steinmeier neben anderen den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Gerald Asamoah eingeladen. Er ist Pate des Netzwerks "Schule ohne Rassismus". Zu Gast im Amtssitz des Bundespräsidenten waren außerdem die Lehrerin Gloria Boateng, Gründerin des Bildungsfördervereins SchlauFox, die Schülerin Vanessa Tadala Chabvunga vom Jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn in Berlin und Daniel Gyamerah, der am Berliner Thinktank Citizens For Europe arbeitet. Ehrenamtlich tätig ist Gyamerah unter anderem im Vorstand von Each One Teach One, einem Bildungsprojekt, das sich für Rassismusprävention einsetzt.
Verfassungsschutz stuft Brandenburger AfD als Beobachtungsobjekt ein
Die Bundes-AfD hat den brandenburgischen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz ausgeschlossen. Die Landtagsfraktion wählte Kalbitz in ihre Reihen zurück. Jetzt ist der gesamte AfD-Landesverband ein Beobachtungsfall.Potsdam (epd). Der Brandenburger Verfassungsschutz hat den kompletten AfD-Landesverband als Beobachtungsobjekt eingestuft. Innenminister Michael Stübgen (CDU) und Verfassungsschutzchef Jörg Müller begründeten den Schritt am 15. Juni in Potsdam mit der engen Vernetzung der Landespartei mit rechtsextremistischen Strukturen und Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Stübgen sprach vom "Ergebnis einer langen und intensiven Auswertung gesicherter Erkenntnisse". Die Brandenburger AfD habe sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und werde mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet seien.
Die Partei versuche, die "Mauern der Demokratie zu schleifen", sagte Stübgen: "Sie ist geprägt von einem ethno-kulturellen Volksbild, das Menschen anderer Herkunft oder Religion verächtlich macht und damit gegen die Würde des Menschen verstößt." Die Brandenburger AfD sei geprägt vom Gedankengut des völkisch-nationalen "Flügels". "In der Brandenburger AfD ist der 'Flügel' längst der ganze Vogel", sagte Stübgen.
Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel
Verfassungsschutz-Chef Müller kündigte den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel zur Beobachtung der Landes-AfD an. Er betonte: "Extremisten als Extremisten zu erkennen und zu benennen, ist Kernaufgabe des Verfassungsschutzes." Es lägen "hinreichend gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte" dafür vor, dass von der Brandenburger AfD Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgingen.
Als konkrete Gründe für die Entscheidung benannte Müller extremistische Positionierungen von AfD-Mitgliedern, den Einfluss des offiziell aufgelösten "Flügels" auf die Gesamtpartei in Brandenburg und "eine personelle und strukturelle Verflechtung der Brandenburger AfD mit anderen rechtsextremistischen Strukturen". In Brandenburg seien etwa 40 Prozent der rund 1.600 Mitglieder als Anhänger des "Flügels" zu werten.
Bezüglich des "Flügels" sprach der Landesverfassungsschutz-Chef von einer "Scheinauflösung". Keine der Aussagen sei revidiert worden, die Protagonisten seien weiter aktiv. Die dahinter stehenden Haltungen fänden sich somit weiterhin in der Partei. Die Landtagsfraktion wird nach den Worten Müllers aber nicht als solche beobachtet.
Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alexander Gauland, kritisierte den Vorgang dagegen. "Die Entscheidung ist genauso falsch wie die bisherigen Einstufungen der AfD durch den Verfassungsschutz", sagte Gauland, der früher Vorsitzender der Brandenburger AfD war.
Der AfD-Bundesvorstand hatte den Brandenburger Partei- und Fraktionschef Andreas Kalbitz wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu im Mai ausgeschlossen. Die Landtagsfraktion wählte ihn im Anschluss durch eine Satzungsänderung in ihre Reihen zurück.
Geständnisvideo im Lübcke-Prozess

epd-bild/Reuters-Pool/Kai Pfaffenbach
Frankfurt a.M. (epd). Der schweigende Angeklagte zeigt Emotionen: Als Stephan E. das Video seines ersten Geständnisses sieht, kommen ihm im Gerichtssaal erneut die Tränen. Eine Unterbrechung der Verhandlung am 18. Juni lehnt der Angeklagte kopfschüttelnd ab. Bundesanwalt Dieter Killmer reicht ein Taschentuch, und nach einem kurzen Durchatmen geht es weiter. Das Video ist das erste Beweismittel im Prozess um den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt am Main. Darin schildert E. unter anderem detailliert den Tathergang sowie dessen Vorgeschichte. Im Prozess selbst hat sich E. bislang nicht geäußert.
Geständnis widerrufen
Aufgezeichnet wurde das Video in einer polizeilichen Befragung am 25. Juni 2019 - zehn Tage nach E.s Verhaftung. Rund eine Woche später widerrief er jedoch das Geständnis. Später belastete er den Mitangeklagten Markus H., den tödlichen Schuss auf Lübcke versehentlich abgegeben zu haben. H. ist allerdings nur wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Beide sollen nach Auffassung der Bundesanwaltschaft aus rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Gesinnung gehandelt haben.
In dem Video erzählt E. - immer wieder von Weinen unterbrochen - über den Zeitraum von 2010 bis zur Tat. Nach vielen Jahren in der rechtsextremen Szene und mehreren Verurteilungen habe er versucht, sich aus dem Milieu zu verabschieden und ein bürgerliches Leben mit Frau, seinen beiden Kindern und einem geregelten Beruf zu führen.
Doch Themen wie Überfremdung und Ausländerkriminalität hätten ihn nicht losgelassen. Auf der Arbeit habe er dann seinen früheren Weggefährten Markus H. wiedergetroffen. Mit H. habe er an gemeinsamen Schießübungen teilgenommen. Zudem verkauften beide illegal Waffen.
Bürgerversammlung im Herbst 2015
Mit der Flüchtlingskrise 2015 habe er dann zunehmend Ängste bekommen, dass Deutschland mit Ausländern überflutet werde. Lübcke geriet ins Visier, als er bei einer Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel im Herbst 2015 sprach, bei der es um die geplante Unterbringung von Flüchtlingen in dem Ort ging. Dort waren auch die beiden Angeklagten unter den Besuchern.
Lübcke hatte nach Worten von E. gesagt, "dass wenn Ihnen das hier nicht gefällt, wie wir das hier machen, könnt Ihr das Land verlassen". H. habe die Aussage gefilmt und das Video ins Internet gestellt. E. verließ die Veranstaltung emotional aufgewühlt: "Ich war fassungslos." Von da an habe er Lübcke auf dem Schirm gehabt: "Ich habe halt einen Hass bekommen."
Dieser Hass sei in den folgenden Jahren durch Ereignisse wie die Silvester-Übergriffe in Köln und die Terroranschläge in Frankreich weiter angefacht worden. Immer wieder habe er den Gedanken gehabt, er müsse etwas unternehmen. "Spätestens nach dem Anschlag von Nizza habe ich den Beschluss gefasst, dem Herrn Lübcke etwas anzutun."
Lübcke ausgekundschaftet
In der Folgezeit habe er den Regierungspräsidenten ausgekundschaftet, sei mehrfach zu dessen Haus in Wolfhagen-Istha gefahren, immer wieder auch mit einer Waffe. In der Nacht zum 2. Juni 2019 kam es schließlich zu der Tat, die E. minuziös schilderte. Er sei an jenem Samstagmorgen zwischen sieben und acht Uhr aufgestanden, habe gefrühstückt und dann an seinem Haus gearbeitet.
Am frühen Abend sei er in seinem Auto und mit einem Revolver in einer Umhängetasche nach Istha gefahren, habe dort bis zum Einbruch der Dunkelheit gewartet. Er habe schon wieder gehen wollen, als er Lübcke auf dessen Terrasse sah. "Da dachte ich: Du machst das jetzt." Er sei mit der gespannten Waffe zu Lübcke gerannt, habe auf Kopfhöhe angelegt und einen Schuss aus 1,5 bis zwei Metern Entfernung abgegeben. "Er hat meinen Schatten wahrgenommen", sagte E. über sein Opfer. Wirklich gesehen habe er ihn wohl nicht. Dann sei er zurück zu seinem Auto gegangen und nach Hause gefahren.
Bevor es am 18. Juni zur Ansicht des Videos kam, hatte die Verteidigung mehrere Befangenheitsanträge gegen den Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel gestellt, immer wieder die Unterbrechung der Sitzung beantragt und auch die Reihenfolge der Beweiswürdigung moniert. Als eine längere Debatte darüber entbrannte, wie der Fernseher für die Videopräsentation aufgestellt werden sollte, platzte Sagebiel der Kragen: "Wir sind doch nicht dumm", sagte er. "Das grenzt hier langsam ans Lächerliche."
Der Prozess hatte am 16. Juni begonnen. Bis Ende Oktober sind derzeit 32 Verhandlungstage vorgesehen. Der nächste Termin ist für den 30. Juni angesetzt.
NRW-Beauftragte plant Meldestelle für antisemitische Vorfälle
Düsseldorf (epd). Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, plant eine Meldestelle, die antijüdische Vorfälle systematisch erfassen soll. Es gehe darum, das "Dunkelfeld" der antisemitischen Vorfälle zu erhellen und sowohl strafrechtlich relevante wie auch unterhalb der Strafrechtsgrenze liegende Ereignisse zu erfassen, sagte die ehemalige Bundesjustizministerin (FDP) am 17. Juni bei der Vorlage ihres ersten Antisemitismusberichts in einer Sitzung des Hauptausschusses im Düsseldorfer Landtag. Die Meldestelle könne zum Beispiel antisemitische Beschimpfungen und Pöbeleien in Schulen oder Sportvereinen erfassen. Ähnliche Einrichtungen gebe es bereits in Bayern und Baden-Württemberg.
Laut Leutheusser-Schnarrenberger soll für die Meldestelle eine Trägerstruktur genutzt werden, die auf "bestehende Netzwerke" - etwa in Kooperation mit den jüdischen Gemeinden und der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit Beratung bei Rassismus und Antisemitismus (Sabra) in Düsseldorf - zurückgreife. Die geplante Meldestelle solle niederschwellig sein und als zivilgesellschaftliche Organisation einem Ministerium zugeordnet werden, sagte die Antisemitismusbeauftragte. Über das Ministerium solle dann auch die Finanzierung der Einrichtung erfolgen. Ein Datum, bis wann die Meldestelle eingerichtet werden kann, ist noch unklar, da derzeit noch die Abstimmung mit dem Landeskabinett erfolgt.
Beleidigungen und Verunglimpfungen im Internet
Im Jahr 2019 wurden laut Leutheusser-Schnarrenberger in NRW 315 antisemitische Straftaten erfasst - mehr als 90 Prozent der Taten seien dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Bei der Zahl der Vorfälle gebe es gegenüber dem Vorjahr einen "leichten Rückgang", allerdings keinen allgemeinen Trend. Ein immer wichtigeres Thema seien dabei Beleidigungen, Schmähungen und Verunglimpfungen im Internet, besonders in den sozialen Medien, heißt es in dem 71 Seiten starken Bericht. Studien zeigten, dass der Antisemitismus in Deutschland nach wie vor einen fruchtbaren Boden habe.
Die Antisemitismusbeauftragte erklärte zudem, dass sie eine Studie in Auftrag gegeben habe, die sich mit Antisemitismus in Rap-Texten befasst. Die Untersuchung wird von Wissenschaftlern der Universität Bielefeld durchgeführt. Dabei soll unter anderem untersucht werden, welche Folgen antisemitische Rap-Texte auf die Einstellungen von Kindern und Jugendlichen haben.
Leutheusser-Schnarrenberger ist eine von bundesweit 13 Antisemitismusbeauftragten des Bundes und der Länder. Sie wurde 2018 berufen und nahm ihre Tätigkeit Anfang 2019 auf.
Rüstungsexporte 2019 wieder deutlich gestiegen
Der starke Anstieg der Genehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern stößt auf Kritik. Während Menschenrechtler strenge Exportauflagen fordern, verweist die Regierung auf Bündnispflichten, Verantwortung und Sicherheitsinteressen.Berlin (epd). Die Rüstungsexporte aus Deutschland steigen wieder. Die Bundesregierung erteilte 2019 Einzelgenehmigungen für Ausfuhren in Höhe von 8,015 Milliarden Euro, wie aus dem Rüstungsexportbericht hervorgeht, den das Kabinett am 17. Juni beschlossen hat. Im Jahr davor waren Ausfuhren von Rüstungsgütern im Umfang von 4,8 Milliarden Euro genehmigt worden. Amnesty International und die Grünen kritisierten besonders den Anstieg der Exportgenehmigungen an Drittstaaten außerhalb von EU und Nato, zu denen Algerien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indonesien gehören.
Als Grund für den Anstieg der Gesamtzahlen nannte das Bundeswirtschaftsministerium unter anderem Großaufträge. So habe 2019 ein großes Beschaffungsvorhaben des EU-Mitglieds Ungarn fast ein Viertel des Gesamtwertes aller Einzelgenehmigungen ausgemacht. Insgesamt entfiel 2019 ein Anteil von 55,9 Prozent der Genehmigungen auf Lieferungen an EU- und Nato-Länder sowie Australien, Japan, Neuseeland und die Schweiz, die den Nato-Staaten gleichgestellt sind. Für Drittländer wurden Ausfuhrgenehmigungen in Höhe von 3,53 Milliarden Euro erteilt, nach 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.
Kritik von Amnesty International
Amnesty International kritisierte, die Menschenrechte seien in der Genehmigungspraxis offenbar weiter nachrangig. "Erneut setzt die Bundesregierung das falsche Signal, wenn sie für Staaten wie Algerien, Ägypten und Indonesien in großem Umfang Rüstungsexporte genehmigt", sagte der Amnesty-Rüstungsexperte Mathias John. Besonders Exporte in die Vereinigten Arabischen Emirate seien angesichts der Rolle des Staates beim Krieg im Jemen inakzeptabel. John forderte einen Exportstop für diesen Staat und mehr Transparenz bei den Genehmigungen.
Die Grünen sprachen von unverantwortlichen neuen Rekordwerten bei den Rüstungsexporten. "Die zunehmend eskalierende Sicherheitslage in vielen Regionen der Welt hindert die Bundesregierung leider nicht daran, durch die Genehmigung von Waffenexporten an der Eskalationsspirale mitzuwirken", erklärte Katja Keul, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Abrüstung.
Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte indes, der Wert der Genehmigungen an Drittstaaten 2019 entspreche in etwa dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre. Nur 43 von insgesamt 2.881 Genehmigungen für Rüstungsexporte in diese Staaten beträfen Kriegswaffen. Der Begriff Rüstungsgüter umfasst laut Bundesregierung auch Minenräumgeräte, Funkgeräte, ABC-Schutzausrüstungen, Sicherheitsglas und gepanzerte Fahrzeuge.
Umstrittene Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen
Der Gesamtwert der ebenfalls besonders umstrittenen Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen und Kleinwaffenteile belief sich laut dem Bericht im Jahr 2019 auf 69,49 Millionen Euro. Davon entfielen 99,4 Prozent auf EU, Nato oder gleichgestellte Länder. Der Export von Kleinwaffen wird vielfach kritisiert, da sie in bürgerkriegsähnlichen Konflikten eine wichtige Rolle spielen.
Die Bundesregierung bekräftigte, dass sie eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreibe. Deutschland stehe zu seinen Bündnispflichten. Ausfuhren in Drittstaaten erfolgten ebenfalls im sicherheitspolitischen Interesse der Bundesrepublik, etwa als Beitrag zur Grenzsicherung oder zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus.
Erinnerung an Volksaufstand in der DDR 1953
Vor 67 Jahren wurde der DDR-Volksaufstand vom 17. Juni blutig niedergeschlagen. An vielen Orten wurde an die historischen Geschehnisse erinnert. Eine Erkenntnis: Die Freiheitskämpfer von 1989 stehen auf den Schultern derer von 1953.Berlin (epd). An etlichen Orten in Ostdeutschland ist an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR erinnert worden. Beim zentralen Gedenken der Bundesregierung und des Landes Berlin fand am Mahnmal für die Opfer des Volksaufstandes in Berlin-Wedding eine stille Kranzniederlegung statt. Auch an den damaligen Brennpunkten des Arbeiteraufstandes und der Demokratiebewegung in Leipzig, Magdeburg und Potsdam wurden die Freiheitskämpfer von 1953 gewürdigt. Der Bundestag widmete sich am 17. Juni in einer Debatte dem Volksaufstand.
Überwiegend aus Ostdeutschland stammende Redner aller Fraktionen würdigten im Bundestag den Mut der Frauen und Männer, die am 17. Juni 1953 für den Rücktritt der DDR-Regierung sowie für freie und geheime Wahlen auf die Straße gegangen waren. Die Streiks und Demonstrationen wurden damals vom sowjetischen Militär niedergeschlagen, mehr als 50 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt, bis zu 15.000 kamen in Haft. Rund um den 17. Juni 1953 waren nach Schätzungen eine Million Menschen in rund 700 Städten und Gemeinden auf die Straße gegangen.
Wanderwitz spricht von besonderem Tag
Der aus Sachsen stammende Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), nannte den 17. Juni 1953 einen besonderen Tag. Mit ihm habe eine der wenigen demokratischen Massenbewegungen der deutschen Geschichte ihren Höhepunkt erreicht und sei schließlich mit Waffengewalt brutal beendet worden. Die DDR habe die Freiheit vieler Einzelner systematisch beschnitten, sie sei ein Unrechtsstaat gewesen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär. Es habe 36 weitere Jahre gedauert, ehe 1989 die Forderungen nach Demokratie verwirklicht wurden.
Auch der CDU-Abgeordnete Manfred Grund sagte, die Freiheitskämpfer von 1989 stünden auf den Schultern der Freiheitskämpfer von 1953. Die SPD-Abgeordnete Katrin Budde erinnerte an den 17. Juni 1953 als ersten Nadelstich, der die Macht der Sowjetunion infrage gestellt habe. Der Tag habe mutige Heldinnen und Helden hervorgebracht, diese seien damit zu Wegbereitern der heutigen Demokratie geworden. Die Ereignisse von damals müssten heute zum Lehrkanon an den Schulen gehören, forderte die SPD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt.
Für die Linke nutzte Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau die Debatte für eine klare Abgrenzung ihrer Partei zum Stalinismus: "Ein Sozialismus, in dem die sozialen und die Bürgerrechte nicht als gleichwertig gelten, ist kein Sozialismus." Der Bruch ihrer Partei mit dem Stalinismus sei endgültig, sagte Pau. Wer dies infrage stelle, sei kein Sozialist. Der 17. Juni 1953 sei "ein schwarzer Tag" gewesen.
Die Grünen-Parlamentarierin Monika Lazar rief in Erinnerung, dass dieser Tag seine Schatten in die Zukunft geworfen habe und die Ängste der Bürgerrechtler geprägt habe. Auch 1989 sei die Angst vor einer gewalttätigen Niederschlagung präsent gewesen. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg erinnerte, dass die SED-Herrschaft keine Basis in der Bevölkerung gehabt habe und nur mit Waffengewalt aufrechterhalten werden konnte.
Für die AfD würdigte Leif-Erik Holm den Mut der Aufständischen von 1953, griff aber auch die CDU wegen der Wahl der umstrittenen Linken-Politikerin Barbara Borchardt zur Landesverfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern scharf an.
Klimaschutz: Schulze rechnet mit Schub durch Krisen-Hilfen

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) rechnet mit einem Schub für den Klimaschutz durch die Wirtschaftshilfen zur Überwindung der Corona-Krise. Das Konjunkturpaket helfe dabei, die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen, sagte Schulze dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Es enthalte mehr als 40 Milliarden Euro an Investitionen, "die auf den Klimaschutz einzahlen". Auf europäischer Ebene komme es darauf an, bis Ende des Jahres die Verschärfung der Klimaschutzziele verbindlich zu beschließen. Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft.
Die EU will bis 2050 als erster Kontinent klimaneutral werden. Die Kommission will dies per Gesetz festschreiben lassen und den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 50 Prozent statt, wie bisher vereinbart, um 40 Prozent reduzieren.
"Es zählt jede eingesparte Tonne CO2"
Schulze dringt insbesondere auf mehr Klimaschutz im Verkehr und eine Neuausrichtung der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Die Defizite bei der Einsparung von Treibhausgasen lägen vor allem im Verkehrssektor. "Je schneller wir werden, etwa bei der Elektromobilität, umso besser für das Klima", sagte sie: "Es zählt jede eingesparte Tonne CO2." Im Konjunkturpaket sind erhöhte Kaufprämien für Elektro-Autos, Milliardenhilfen für die Bahn und die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs vorgesehen. In Deutschland sollen die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken.
Für eine klima- und umweltverträglichere Landwirtschaft setzt Schulze auf die Unterstützung der Ökobauern und die gemeinsame europäische Agrarpolitik: "Wir müssen es den Landwirten ermöglichen, mit einer optimalen und nicht mit einer maximalen Nutzung der Flächen - also auch mit Blühstreifen und Hecken auf ihren Feldern - ein Einkommen zu erzielen, von dem sie leben können", sagte sie. Wenn die Bauern keine Unterstützung bekämen, "werden sie weiter darum kämpfen, dass sie so weitermachen können wie bisher".
Sowohl für den Verkehrssektor als auch die Landwirtschaft sei klar, dass es nicht weitergehen könne wie bisher, sagte Schulze. Mit Blick auf die Interessenkonflikte erklärte sie, es sei die Aufgabe einer Umweltministerin "unbequem zu sein". Zu umweltpolitischen Lehren aus der Corona-Krise sagte Schulze, sie wünsche sich, dass aus dieser Zeit einiges herübergerettet werde. So seien beispielsweise viele Dienstreisen nicht notwendig: "Einfache Absprachen kann man über die digitalen Tools erledigen."
Schulze äußerte sich zuversichtlich, dass Veränderungen zu mehr Umwelt- und Klimaschutz schon bald zu spüren sein werden. Das sei das Ziel des Konjunkturpakets. Alle Ministerien seien an der Umsetzung beteiligt, "und alle wissen, dass wir schnell sein müssen", sagte die SPD-Politikerin. Zudem sei festgelegt, dass die Gelder zur Ankurbelung der Konjunktur in den nächsten beiden Jahren ausgegeben werden müssen. Deutschland werde 2023 anders aussehen, sagte Schulze.
Bund unterstützt Umweltprojekt im Ruhrgebiet
Berlin, Essen (epd). Das Bundesumweltministerium fördert ein auf sechs Jahre angelegtes Projekt, das den Schülern im Ruhrgebiet "grüne Lernorte" auf stillgelegten Zechen oder Industriebrachen nahebringen will. Im Zuge des Programms "Biologische Vielfalt" stellt der Bund dafür etwa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung, wie das Ministerium am 18. Juni in Berlin mitteilte.
Das Projekt "Lelina - Lern- und Erlebnislabor Industrienatur" wolle die "große Vielfalt an natürlichen Lebensräumen direkt neben Industrieruinen" deutlich machen, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Diese "Industrienatur" wolle man mit dem Projekt erlebbar machen und "gemeinsam mit Schulen als Lernort für Umweltthemen nutzen".
Das Ruhrgebiet sei der größte Ballungsraum Deutschlands, betonte Schulze. Das geplante Projekt fördere das "Bewusstsein für die Gefährdung der biologischen Vielfalt und trägt zugleich zur positiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei". Das Vorhaben wird vom Bundesamt für Naturschutz betreut und im Verbund mit dem Regionalverband Ruhr (RVR), der Ruhr-Universität Bochum, der Bergischen Universität Wuppertal und der Biologischen Station Westliches Ruhrgebiet durchgeführt.
An den "grünen Lernorten" sollen Schüler ihre natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Kenntnisse erweitern. Als außerschulische Lernstandorte dienen der Landschaftspark Duisburg-Nord, der Essener Gleispark Frintrop und die Halde Eickwinkel, die Dortmunder Kokerei Hansa und die Halde Sachsen in Hamm. Auf diesen Flächen sollen die Lernlabore in großen Containern untergebracht werden, in denen experimentiert und geforscht werden kann.
Derzeit befindet sich das Projekt laut einem RVR-Sprecher noch in der Entwicklung. In der ersten Projektphase nehmen zunächst zehn Schulen an den Standorten in Essen und Hamm teil. Im Laufe des Projektverlaufs sollen bis zu 35 Schulen das Angebot nutzen. Geplant ist darüber hinaus, das Thema "Biologische Vielfalt der Industrienatur" im Schulalltag langfristig zu verankern.
Landtag tagt nach Sommerpause wieder regulär
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Landtag tagt bei den Plenarsitzungen ab 22. Juni wieder in voller Besetzung. Der Parlamentarische Krisenstab Pandemie habe beschlossen, für den Infektionsschutz Trennwände aus Acrylglas im Plenarsaal zu befestigen, erklärte der Landtag. So könnten alle Abgeordneten wieder gleichzeitig im Saal sitzen, erklärte Landtagspräsident André Kuper (CDU). In den Sommerferien sollen zudem in zwei anderen Sälen Acrylglas-Kabinen installiert werden, damit wieder mehr Ausschüsse in voller Besetzung tagen können. In der Corona-Krise kam das Parlament Kuper zufolge nur mit reduzierter Abgeordnetenzahl zu Sondersitzungen zusammen.
Weil die Öffentlichkeit der Sitzungen wieder sichergestellt sei, gelten Landtag zufolge wieder die vor der Corona-Pandemie festgelegten Regeln für Livestreams. "Übertragen werden ausschließlich die Plenarsitzungen sowie Anhörungen von Sachverständigen, wenn dies der jeweilige Ausschuss einstimmig beschließt", hieß es. Besuchergruppen könnten den Landtag weiterhin nicht besuchen. Plenar- und Ausschusssitzungen könnten von Einzelbesucherinnen und -besuchern nach Anmeldung und von Journalistinnen und Journalisten vor Ort verfolgt werden.
Richtfest beim Synagogen-Neubau im rheinischen Neuss
Neuss (epd). Im rheinischen Neuss ist für einen Synagogen-Neubau am 18. Juni das Richtfest gefeiert worden. Die Veranstaltung des neuen "Alexander-Bederov-Zentrums" fand coronabedingt in kleiner Runde statt, teilte Bert Römgens von der örtlichen Jüdischen Gemeinde mit. Aktuell wird der eingeschossige Bau, der zwischen Schulen und Kleingärten liegt, komplett entkernt sowie mit neuen Zwischenwänden versehen und erweitert. In der Mitte des Komplexes liegt der künftige Gebetssaal für bis zu 80 Personen. Im seitlich angrenzenden Neubau ist ein Gemeindesaal entstanden, der Platz für bis zu 130 Menschen bieten soll. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.
Bereits im März wurde in der Leostraße der Grundstein für den Neubau der Synagoge gelegt. In dem Flachbau war früher eine katholische Kindertagesstätte untergebracht. Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf hatte das Gebäude 2007 mit finanzieller Unterstützung der Stadt Neuss gekauft. Genutzt wurde der Flachbau seitdem von rund 600 jüdischen Einwohnern aus Neuss und den umliegenden Ortschaften.
Die Stadt Neuss fördert den Bau mit 1,5 Millionen Euro. Im Jahr 2018 hatten die Stadt und die Jüdische Gemeinde dazu einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Nach der Fertigstellung wird es wieder eine neue Heimat und mit der Synagoge wieder einen religiösen Mittelpunkt für jüdisches Leben in Neuss geben. Die vorherige Synagoge war in der Pogromnacht 1938 von den Nationalsozialisten zerstört und dann in Brand gesteckt worden.
Klage in Karlsruhe für selbstbestimmten Geschlechtseintrag
Karlsruhe, Berlin (epd). Die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) will mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe erreichen, dass Menschen ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister selbst bestimmen können. Ziel der am 15. Juni eingereichten Klage vor dem höchsten deutschen Gericht ist es, dass ein unzutreffender Geschlechtseintrag auch ohne ärztliche oder psychologische Begutachtung gestrichen und der Eintrag offengelassen wird, teilte die Organisation mit Sitz in Berlin am 16. Juni mit. Die GFF unterstützt Kläger Lann Hornscheidt, der sich weder als weiblich noch als männlich identifiziert und den eigenen Geschlechtseintrag nachträglich streichen lassen will.
Zuvor hatte Hornscheidt bereits vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe geklagt und die Anerkennung einer "genderlosen Identität" verlangt. Dies hatte der BGH hatte am 22. April abgelehnt und entschieden, dass Änderungen des Geschlechtseintrags auf Interpersonen beschränkt sind. Andere Menschen verwies der BGH auf das Transsexuellengesetz. (AZ: XII ZB 383/19)
Dies verstößt nach Auffassung der Kläger gegen das Verbot der Geschlechterdiskriminierung. Maßgeblich für das Geschlecht einer Person sei nicht ihr Körper, sondern wie sie sich selbst versteht, heißt es vonseiten der GFF. Das Recht auf Anerkennung der eigenen Identität stehe jedem Menschen zu. Das sollten nicht Ärzte und Psychologen entscheiden dürfen, sondern die Betroffenen selbst.
Seit 2018 ermöglicht das Personenstandsrecht, dass Menschen ihren Geschlechtseintrag durch Erklärung beim Standesamt in "männlich", "weiblich" oder "divers" ändern oder ganz streichen lassen können. Es ist aber umstritten, wer dieses Verfahren nutzen darf und ob eine ärztliche Bescheinigung dafür notwendig ist.
Soziales
Corona-Warn-App soll auch bei Auslandsreisen funktionieren

epd-bild/Heike Lyding
Berlin, Brüssel (epd). Die neue deutsche Corona-Warn-App könnte bald mit ähnlichen Apps anderer EU-Länder interagieren und so Nutzer auch bei Auslandsreisen oder nach der Heimkehr warnen. Am 16. Juni einigten sich die Mitgliedstaaten dafür auf technische Standards, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Damit soll das Zusammenwirken der Apps und damit die Verfolgbarkeit von Infektionen über Grenzen hinweg sichergestellt werden. Am Morgen des Tages hatte die Bundesregierung die sogenannte Tracing-App zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten in Berlin vorgestellt.
Die digitale Anwendung alarmiert Nutzer, wenn sie Erkrankten zu nahe gekommen sind, die ebenfalls die App verwenden und positiv getestet wurden. Sie "dient vor allem der Vermeidung einer zweiten Welle", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Ebenso wie bei den Regeln zum Abstandhalten, zur Hygiene und Alltagsmaske sei das Ziel der App, einem nicht mehr nachvollziehbaren, dynamischen Infektionsgeschehen vorzubeugen, wie es im März in Deutschland der Fall gewesen sei. Die App sei aber kein Allheilmittel und kein Freifahrtschein, betonte Spahn. "Diese App ersetzt nicht vernünftiges Verhalten und Aufeinander-Acht-Geben."
Energiesparende Bluetooth-Variante
Zahlreiche Prominente gaben im Laufe des Tages über soziale Medien bekannt, dass sie die App jetzt nutzten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilte per Foto über Facebook und Instagram mit, dass er ebenfalls User sei. Die App arbeitet mit einer energiesparenden Bluetooth-Variante, über die Daten nur in geringer Menge und Reichweite übertragen werden können. Sie erzeugt Zufallszahlen und sendet diese aus. Das Gerät und die Person bleiben durch die Nutzung solcher Pseudonyme anonym. Wer innerhalb von zwei Wochen mehr als 15 Minuten weniger als zwei Meter von einer infizierten Person entfernt war, wird gewarnt und kann sich testen lassen.
Spahn sagte, gerade in der Phase der Lockerung mit zunehmender Mobilität der Menschen mache die App Sinn: Etwa im Zug, Bus, in der S-Bahn oder bei Demonstrationen "kommen wir wieder immer mehr in Kontakt mit Personen, die wir nicht persönlich kennen". Kontaktnachverfolgung klassischer Art über Befragungen könne da nicht funktionieren.
Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) erläuterte, dass es leichter sei, Infektionszahlen niedrig zu halten, als hohe Zahlen zu reduzieren. Angesteckte sollten zudem von ihrer Infektion am besten bereits erfahren, bevor sie selbst merkten, dass sie erkrankt seien. So könnten sie sich rascher testen lassen und eine Infektionskette könne frühzeitiger unterbrochen werden. Die App herunterzuladen und zu nutzen, sei für jeden ein kleiner Schritt, "aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung".
Lilie spricht von "Gebot der Solidarität"
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie nannte es "ein Gebot der Solidarität", die App zu nutzen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter bekräftigte indes die Forderung nach einem "stützenden Gesetz". Er erklärte, dass die Freiwilligkeit am Ende eine theoretische sein könne, wenn Arbeitgeber auf die Nutzung bestünden. Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) wies darauf hin, dass ein gemeinsam mit ihren Amtskollegen aus Thüringen, Hamburg und Berlin erarbeiteter Gesetzentwurf dem Justizministerium übersandt worden sei.
Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hält eine gesetzliche Regelung allerdings nicht für notwendig. Bei der App seien die "goldenen Regeln des Datenschutzes" eingehalten - sie sei freiwillig, anonym, Daten würden sparsam verwendet.
Laut EU-Kommission haben neben Deutschland fünf weitere europäische Länder eine ähnliche, dezentral arbeitende Anwendung in Betrieb, weitere elf Staaten entwickeln sie. Eine Interaktion zwischen verschiedenen nationalen Apps sei ab sofort möglich, sie hänge von den jeweiligen Ländern ab. Darüber hinausgehend arbeitet die Behörde an einem System mit einem zentralen Server, über das die Apps mehrerer Länder auf einmal zusammengeschaltet werden. Dazu soll in ungefähr drei Wochen ein Pilotprojekt mit Deutschland, den Niederlanden, Polen und Irland starten.
Fast zehn Millionen haben Corona-Warn-App
Berlin (epd). Die Corona-Warn-App ist nach Angaben der Bundesregierung bis zum 19. Juni von 9,6 Millionen Smartphone-Nutzern heruntergeladen worden. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin: "Jeder Nutzer nützt." Auf entsprechende Nachfragen versicherte sie, die Bundesregierung wolle, dass auch die Besitzer älterer Mobiltelefone die App nutzen könnten.
Damit sind binnen zwei Tagen rund drei Millionen Nutzer hinzugekommen. Bis zum 17. Juni hatten knapp 6,5 Millionen Menschen die neue Corona-Warn-App heruntergeladen. Sie war in der Nacht zum 16. Juni an den Start gegangen. Die App kann auf Apple- und Android-Smartphones heruntergeladen werden und soll die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten in der Corona-Pandemie erleichtern. Auf älteren Geräten funktioniert sie aber nicht.
Corona-Besuchsregeln: Umarmen in Pflegeheimen wieder erlaubt
Düsseldorf (epd). Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat die Kontaktbeschränkungen zum Schutz vor dem Corona-Virus in Pflegeeinrichtungen und Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen größtenteils aufgehoben. Bei Besuchen in den Pflegeeinrichtungen sind ab sofort ausdrücklich wieder körperliche Berührungen zugelassen, wie das Ministerium am 20. Juni in Düsseldorf mitteilte. Auch ein Gang zu einem Café außerhalb der Einrichtungen sei möglich. Ab dem 1. Juli könnten Bewohnerinnen und Bewohner zudem wieder Besuch in ihren Bewohnerzimmern empfangen.
Bei den Besuchen in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe werden grundsätzlich die zeitliche Begrenzung und die Begrenzung der Besucherzahl aufgehoben, wie es weiter hieß. Lediglich in den Einrichtungen, in denen besonders gefährdete schwerstmehrfachbehinderte Menschen leben, sollen die bisherigen Regelungen für Besuche noch gelten.
"Infektionsschutz ist lebensnotwendig. Soziale Kontakte sind es aber auch"
"Mich haben in der letzten Zeit viele Zuschriften erreicht, die mich sehr bewegt haben", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Darin hätten ihm Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen als auch ihre Angehörigen und Freunde geschildert, wie sie unter den Corona-Schutzmaßnahmen litten. "Infektionsschutz ist lebensnotwendig. Soziale Kontakte sind es aber auch", betonte der Minister. Mit den neue Vorgaben erhielten den Einrichtungen "die notwendige Sicherheit, um den Bewohnerinnen und Bewohnern so viele soziale Kontakte wie aktuell vertretbar zu ermöglichen".
Die Zahl der Infektionen in Pflegereinrichtungen ist den Angaben zufolge in NRW deutlich zurückgegangen. Während Mitte April insgesamt 1.180 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner in 171 Pflegeeinrichtungen verzeichnet wurden, sind es zwei Monate später noch 84 Bewohner in 25 Pflegeeinrichtungen (Stand 20. Juni). Eine vergleichbare Entwicklung zeigt sich auch bei den Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe, wie es hieß. Nur noch fünf Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen seien von Corona-Infektionen betroffen.
"Ich bin froh, dass die Zahlen es zulassen, dass wir die Besuchsregelungen nach Mai nun nochmals ändern können", sagte Laumann. Er mahnte zugleich zu Vorsicht: "Klar ist aber auch: Wir müssen weiterhin wachsam sein und wirksame Infektionsschutzmaßnahmen in den Einrichtungen verankern."
Niederlande bedanken sich mit Matjes für Corona-Hilfe
Münster (epd). Die niederländische Regierung hat sich bei einem Besuch im Universitätsklinikum in Münster für die Behandlung von Corona-Patienten bedankt und den Mitarbeitenden 4.000 Matjes-Heringe mitgebracht. "Mein Dank für die Hilfe, die die Niederlande für die Aufnahme von Patienten auf Intensivstationen vor allem in Nordrhein-Westfalen erhalten haben, ist groß", sagte der niederländische Minister für Medizinische Versorgung und Sport, Martin van Rijn, am 15. Juni. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte Anfang April die Übernahme niederländischer Intensivpatienten durch die Krankenhäuser in NRW koordiniert vom Universitätsklinikum Münster angekündigt.
"Unsere Kliniken waren und sind gut aufgestellt", sagte Laumann. Wegen der Pandemie sei die Zahl der Intensivbetten auf mehr als 7.800 ausgebaut worden. "Glücklicherweise haben wir diese Betten auch während der Zeit der höchsten Infektionszahlen bei weitem nicht benötigt, betonte der Minister. "In so einer Situation Hilfe vorzuenthalten, wäre unethisch."
Insgesamt wurden den Angaben zufolge 58 Patienten aus den Niederlanden mit Covid-19 in deutschen Krankenhäusern untergebracht, 49 alleine in NRW. Neun Patienten starben.
Bundestagsdebatte über Verschärfung von Strafen bei Missbrauch
Schon in dieser Woche will die Bundesjustizministerin einen Gesetzentwurf für härtere Strafen bei Kindesmissbrauch vorstellen. Der Koalitionspartner sichert Unterstützung zu, bei der Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz hingegen nicht.Berlin (epd). Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will in dieser Woche einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Strafen für Kindesmissbrauch vorlegen. Sie wolle, "dass in Zukunft jeder sexuelle Missbrauch ohne Wenn und Aber ein Verbrechen ist", sagte sie am 19. Juni im Bundestag in Berlin. Lambrecht wehrte sich gegen den Vorwurf, zu spät und zu zögerlich gehandelt zu haben, der auch von Unionspolitikern erhoben worden war.
Lambrecht hatte angekündigt, die Mindeststrafen für Kindesmissbrauch und den gewerbsmäßigen Handel und Tausch von Missbrauchsdarstellungen zu erhöhen. Im Bundestag fügte sie hinzu, sie wolle auch die Strafen für den Besitz von sogenannter Kinderpornografie verschärfen. Hinter jeder dieser Darstellungen stehe ein Missbrauch, sagte die SPD-Politikerin.
Mit Blick auf die schweren Missbrauchsfälle in Münster, Bergisch Gladbach und Lügde sagte Lambrecht, "diese systematisch organisierten Gräueltaten gegenüber Kindern lassen uns fassungslos zurück". Solche Täter handelten planmäßig, täuschten ihr Umfeld und setzten die Opfer perfide unter Druck. Selbst bei schweren Missbrauchsverbrechen werde aber nur in 0,5 Prozent aller Verurteilungen der Strafrahmen von bis zu 15 Jahren ausgeschöpft. Auch bei schweren Fällen werde zudem jede dritte Strafe zur Bewährung ausgesetzt, erklärte Lambrecht.
Die Justizministerin hatte es zunächst abgelehnt, die Strafen zu verschärfen und darauf verwiesen, dass das Strafmaß besser ausgeschöpft werden müsse. Sie gab aber dann dem Druck aus der Union nach.
Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU) sicherte Lambrecht die Zusammenarbeit zu. Er lehnte aber die Forderung der SPD-Politikerin ab, auch die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz zu verhandeln. "Im Grundgesetz steht nichts, das uns hindern würde, alles Notwendige zu tun, um unsere Kinder zu schützen", sagte Frei.
Giffey dringt auf Kinderrechte im Grundgesetz
Auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) forderte am 19. Juni bei einer Video-Pressekonferenz in Berlin die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vereinbart. Lambrecht hatte im November 2019 einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt.
Zu der Debatte um höhere Strafen bei Kindesmissbrauch sagte Giffey, ihr Ministerium unterstütze alle Anstrengungen in dieser Hinsicht. Man müsse entschlossen gegen "unzählige Terabytes ankämpfen", sagte sie. Giffey und der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, teilten außerdem mit, dass im kommenden Jahr eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne ausgerollt werden soll. Bislang sind fünf Millionen Euro dafür vorgesehen.
Nach Überzeugung des Missbrauchsbeauftragten reichen schärfere Gesetze allein nicht aus im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Strafrechtsverschärfungen seien "eindeutig wichtig", sagte Rörig. Aber man müsse auch vermeiden, dass einem 16-Jährigen, der einer 13-Jährigen einen Zungenkuss gebe, demnächst eine Strafe drohe.
Der Kampf gegen Kindesmissbrauch komme immer nur dann voran, wenn Missbrauchsskandale wie jüngst in Münster öffentlich würden, kritisierte der Missbrauchsbeauftragte. Dabei sei der Kampf eine andauernde Aufgabe vor allem mit Blick auf die vielen Kinder und Jugendlichen, die tagtäglich unsichtbar zum Opfer würden, sagte er.
Ärztekammer fordert Kinderschutzbeauftragten für NRW
Münster (epd). Die Ärztekammer Westfalen-Lippe fordert die Einrichtung eines Kinderschutzbeauftragten auf Landesebene. Es müsse in Nordrhein-Westfalen eine unabhängige Stelle geben, an die sich jeder auch anonym bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch wenden könne, heißt es in einer am 20. Juni in Münster veröffentlichten Resolution der Kammerversammlung. Der oder die NRW-Kinderbeauftragte solle auf institutioneller Ebene alle Möglichkeiten der Prävention und Sensibilisierung für das Thema sexueller Missbrauch und Kinderpornografie nutzen sowie die neben den Jugendämtern bestehende Hilfeangebote stärker miteinander vernetzen.
Die Kammer sieht landesweit bei der Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs noch erheblichen Handlungsbedarf. "Lügde, Bergisch Gladbach und jetzt Münster, die Zahl der entdeckten Fälle von oft jahrelangem Missbrauch nimmt zu", sagte Kammerpräsident Hans-Albert Gehle am 20. Juni. Kindesmisshandlung und kinderpornografisches Material gebe es in allen sozialen Verhältnissen, inzwischen verbreiteten auch Kinder und Jugendliche über ihre Smartphones solche Inhalte.
Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz angemahnt
Gehle plädierte für die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz. Trotz Bundeskinderschutzgesetz und der Einrichtung sogenannter Frühwarnsysteme bundesweit hätten Kinder noch immer keine verfassungsrechtlich gesicherten Rechte, kritisiert der Mediziner, der Oberarzt am Krankenhaus Bergmannsheil und Kinderklinik Buer in Gelsenkirchen ist. Elternrecht gehe hier immer noch vor Kinderrecht. "Die Ärztekammer Westfalen-Lippe sieht Kinderschutz in der Priorität vor dem Elternrecht, vor Datenschutz und grenzenlos pädagogischem Optimismus." Auch müsse der Opferschutz Vorrang haben vor dem Täterschutz.
In dem mehrheitlich beschlossenen Resolution für eine "konzertierte Aktion Kinderschutz" fordert die Kammerversammlung zudem einen 24-Stunden-Notruf bei den Jugendämtern. Der solle im Vorfeld, ohne die Polizei einzuschalten, Verdachtsfälle prüft, heißt es. Außerdem werden unter anderem Pflichtfortbildungen zum Thema Kindeswohlgefährdung und Kindesmisshandlung für Jugendhilfe, Kindergärten, Schulen, Sportvereine und Behinderteneinrichtungen sowie alle Arztgruppen angemahnt.
Saarland soll Kinderschutzbeauftragten bekommen
Im Saarland soll es künftig das Amt eines oder einer Kinderschutzbeauftragten geben. Dieser Vorschlag gehöre zu den ersten Handlungsempfehlungen der saarländischen Kinderschutzkommission, erklärte Familienministerin Monika Bachmann (CDU) am 19. Juni in Saarbrücken. Der oder die Beauftragte solle "Schnittstelle zwischen Politik, Betroffenen, Angehörigen und denen, die sich im Kinderschutz engagieren" sein.
Als weitere Maßnahmen empfiehlt die Kommission den Angaben zufolge kostenlose Online-Fortbildungsmodule für Fachpersonal, eine engere Vernetzung der verschiedenen Akteure im Bereich Kinderschutz sowie die Entwicklung verbindlicher Schutzkonzepte beispielsweise für Schulen und Sportvereine. "Ein wirksamer Kinderschutz ist eine der zentralen Aufgaben unserer Gesellschaft", betonte Bachmann. "Es sind die Kleinsten unter uns, die unsere Unterstützung und unsere Rückendeckung am meisten benötigen." Zur Stärkung des Kinderschutzes stünden für die Dauer von drei Jahren jährlich 300.000 Euro zur Verfügung.
Die saarländische Kinderschutzkommission hatte im August 2019 ihre Arbeit aufgenommen. Das interdisziplinär zusammengesetzte unabhängige Gremium ist beim Familienministerium angesiedelt. Es soll die vorhandenen Schutz- und Hilfesysteme bewerten und Rahmenkonzepte und Handlungsempfehlungen zum besseren Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt und Missbrauch erarbeiten.
Diakonie: Sonderkredite lassen Einrichtungen kurz aufatmen
Düsseldorf (epd). Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (Diakonie RWL) bewertet das von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Sonderkreditprogramm für gemeinnützige Organisationen positiv, ist aber skeptisch wegen des Nutzens. "Es bleibt abzuwarten, ob gemeinnützige Träger Sonderkredite tatsächlich in Anspruch nehmen können, da die Möglichkeit einer Rückzahlung auch bei günstigen Konditionen nicht geklärt ist", sagte die Beauftragte für Sozialpolitik der Diakonie RWL, Helga Siemens-Weibring, dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Düsseldorf.
Zudem ermöglichten die Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro, die im Rahmen des Konjunkturpakets zur Bekämpfung der Corona-Krise bereitgestellt werden, möglicherweise nur ein "kurzes Aufatmen für die Träger zu einer Zeit, in der Einnahmen wegbrechen und die Ausgaben durch Hygienemaßnahmen, zusätzliche Räumlichkeiten und Personalausfall rapide steigen", sagte Siemens-Weibring. Derzeit seien die Auswirkungen der Pandemie auf die Einrichtungen der Diakonie noch nicht abzusehen. Die Folgen "werden uns alle sicherlich noch mehrere Jahre beschäftigen", betonte die Sozialexpertin.
Gleichwohl sei das Sonderkreditprogramm des Bundes eine Bestätigung für die Arbeit gemeinnütziger Organisationen. "Erstmalig ist die soziale Infrastruktur umfassender Teil eines Konjunkturprogramms der Bundesregierung. Das ist eine wesentliche politische Aussage", sagte Siemens-Weibring. Allerdings gebe es schon seit einiger Zeit die Tendenz, dass Bereiche des Sozialwesens chronisch unterfinanziert waren. "Dazu gehören zum Beispiel die wichtigen Schuldnerberatungen, Betreuungsvereine, aber auch die Bahnhofsmissionen. Wir wünschen uns, dass generell ein Umdenken einsetzt."
Die Arbeit in den Einrichtungen der Diakonie hat sich nach Angaben von Siemens-Weibring durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen verändert. "Die Corona-Pandemie hat in der diakonischen Welt die Digitalisierung massiv beschleunigt. Wir haben durch die vergangenen Wochen eine Menge gelernt", sagte sie. Im Bereich der stationären Jugendhilfe habe man zum Beispiel "tolle Rückmeldungen" erhalten, seit die Einrichtungen verstärkt auf digitale Angebote setzten. "Die Jugendlichen freuen sich, dass sie sich stärker digital ausprobieren können, zum Beispiel auf Lernplattformen oder im Programmieren kleinerer Apps." Ähnliche Rückmeldungen gebe es übrigens auch aus dem Bereich der stationären Altenhilfe, unterstrich Siemens-Weibring.
Millionenförderung für Digitalisierung sozialer Arbeit in NRW
Beratung und Schulung per Chat oder Video, Schaffung eines Online-Kontakts zwischen Heimbewohnern und Angehörigen: Auch in der sozialen Arbeit ist Digitalisierung wichtig. In NRW soll sie kräftig gefördert werden.Düsseldorf (epd). Die Stiftung Freie Wohlfahrtspflege NRW fördert die Digitalisierung der sozialen Arbeit im Land mit einem Sonderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro. Mit einem höheren Grad an Digitalisierung könnten die Wohlfahrtsverbände künftig mehr Menschen in Krisensituationen erreichen und krisenfester werden, sagte Stiftungsratsmitglied Johannes Hensel, zugleich Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in NRW, am 16. Juni in Düsseldorf. "Weitere Fortschritte bei der Digitalisierung werden die Arbeit in den sozialen Diensten und Einrichtungen verbessern helfen."
Die Mittel von 5.000 bis maximal 100.000 Euro pro Projekt sind für anwendungsorientierte Maßnahmen und Projekte gedacht. Die jeweils für ein Jahr angelegte Projektförderung der Stiftung sei "kein Strohfeuer", erklärte der Stiftungsratsvorsitzende, Peter Preuß. Vielmehr sollen die Digitalisierungsprojekte zur klassischen Ausstattung in den sozialen Einrichtungen werden und damit längerfristig wirken können.
Stiftung Freie Wohlfahrtspflege legt Sonderprogramm auf
Denkbar sei etwa die Einrichtung einer ständigen W-LAN-Verbindung eines Pflegeheim- oder Seniorenheimbewohners zu seinen Angehörigen, hieß es. Gerade in Zeiten der aktuellen Corona-Pandemie hätten Bewohner von Sozialeinrichtungen keinen direkten Kontakt zu Angehörigen pflegen können. Das Geld kann auch zur Förderung des Zusammenspiels von analogen und digitalen Prozessen und Angeboten einschließlich der Befähigung der Mitarbeitenden zur Umsetzung genutzt werden.
Zudem können etwa die Anpassung und Ausweitung der Beratungs- und Begleitungsangebote oder auch die nachhaltige Steigerung der Medienkompetenz von Nutzern etwa in der Sucht- oder Schuldnerberatung gefördert werden. "Manchmal fehlte es einfach nur an modernen Geräten oder stabilem W-Lan, manchmal an Zugängen zu einer Cloud oder auch nur Administratorenrechten und -kenntnissen", sagte Hensel. Das Sonderprogramm trägt den Titel "Zugänge erhalten - Digitalisierung stärken."
Antragsberechtigt sind freie gemeinnützige oder mildtätige Träger von Einrichtungen und Projekte, die entweder der Arbeitsgemeinschaft Freien Wohlfahrtpflege angehören oder Mitglied eines solchen Spitzenverbandes sind. Personalkosten dürfen maximal 20 Prozent der Fördersumme ausmachen. Das Sonderprogramm wird vom Forschungszentrum Jülich im Auftrag der Stiftung gemanagt.
Bis März kommenden Jahres sollen alle ausgewählten Förderanträge bewilligt sein. Die Laufzeit der geförderten Projekte beträgt ein Jahr. Danach sollen die besten Projekte ausgesucht und als Modelle möglichst vielen Sozialeinrichtungen empfohlen werden. Anträge können bis zum 15. November gestellt werden.
Saar-Aktionsplans gegen Armut soll rasch umgesetzt werden

epd-bild/Steffen Schellhorn
Saarbrücken (epd). Die am zweiten saarländischen Aktionsplan zur Armutsbekämpfung beteiligten Verbände und Einrichtungen dringen auf eine schnelle Umsetzung der geplanten Maßnahmen. "Damit die weiteren beschlossenen Projekte zeitnah umgesetzt werden, müssen die verantwortlichen Ministerien jetzt einen konkreten Maßnahmenkatalog mit Kostenplanung, der Benennung von Verantwortlichen und einer konkreten Zeitplanung vorlegen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer des Saarlandes, Thomas Otto, am 17. Juni in Saarbrücken. Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) erklärte: "Wir werden gemeinsam einen Weg gehen, der noch lang ist."
Der Aktionsplan mit seinen Sofortmaßnahmen und längerfristigen Zielen sei "ein Auftakt für einen weiteren Prozess", betonte Bachmann. "Es ist ein wirklich guter Anfang gemacht, nicht glücklich, aber zufrieden sind wir." Zu den Sofortmaßnahmen zählen eine Energiesicherungsstelle sowie ein Notfallfonds Stromsperren für arme Haushalte, beitragsfreie Mittagessen für Kinder von Geringverdienern, der Ausbau eines Pilotprojekts zu Frühe Hilfen in Geburtskliniken, die Einrichtung oder der Ausbau weiterer Kinderhäuser sowie ab 2021 ein Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr.
Der Aktionsplan wurde interministeriell in einem Beirat zur Armutsbekämpfung entwickelt, zu dem unter anderem Sozialverbände, Kirchen, Städte- und Gemeindetag, die Arbeitskammer und die Saarländische Armutskonferenz gehören. Von Mai 2018 bis Februar 2020 hätten sie insgesamt zehnmal getagt, berichtete Bachmann. Der Plan beinhaltet sowohl bereits bekannte Maßnahmen als auch spezielle Schwerpunktsetzungen in den Bereichen Wohnraum, Kinderarmut und Bildung, Langzeitarbeitslosigkeit sowie Mobilität. Der Plan enthält allerdings auch einen von Städte- und Gemeinde- sowie Landkreistag geforderten Finanzierungsvorbehalt.
Diakonie Saar: Strukturelle Bekämpfung von Armut im Vordergrund
Die Geschäftsführerin der Diakonie Saar, Anne Fennel, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), dass in hartem Ringen ein Plan entstanden sei, der greife und umsetzbar sei. "Es ging darum einen seriösen Plan zu erstellen und nicht schlicht Worthülsen zu verkünden, aus denen dann nichts wird." Alle Maßnahmen seien daran zu messen, "dass sie bei den von Armut betroffenen Menschen direkt ankommen und dort nachhaltig spürbar sind", betonte Fennel.
Es müsse grundsätzlich um die strukturelle Bekämpfung von Armut und Armutsursachen gehen, betonte Fennel mit Blick auf zukünftige Themenbereiche. So müsse es bundesweit um die Bemessung von Sozialleistungen und das Thema Kindergrundsicherung gehen. Gerade um Chancengleichheit herstellen zu können, bräuchten Kinder aus armen Familien bessere Unterstützung.
Außerdem müssten bei weiteren Besprechungen die von Armut betroffenen Menschen stärker eingebunden werden. "Wir müssen einfach immer aufpassen, da greifen wir uns als Sozialverbände auch an die eigene Nase, dass wir nicht aus einer Professionalität heraus sagen, wir wissen schon, was für die anderen gut ist", betonte sie.
Armutskonferenz wirbt für Empathie
Ähnlich äußerte sich auch der Vorsitzende der Saarländischen Armutskonferenz, Wolfgang Edlinger. Die Lebenswirklichkeit armer Menschen müsse immer im Blick sein. In der aktuellen Sozialpolitik würden sie oft als zu minimierender Kostenfaktor gesehen, die an ihrer Lage selbst Schuld seien. Dieses gesellschaftliche Bild müsse sich ändern.
"Nur, wenn wir Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit zur Maxime unseres Handelns machen, kann der vorliegende Plan gelingen", betonte er. Im Gegensatz zum ersten Aktionsplan sei ein Handlungsrahmen erarbeitet, der vordringliche Maßnahmen beschreibe. "Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann können wir einpacken."
Der Beirat bestimmt den Angaben zufolge über die Mittelzuweisung aus dem Sonderfonds der Landesregierung zur Armutsbekämpfung. Dieser sieht der Ministerin zufolge für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 500.000 Euro vor. Da das vergangene Jahr nur aus Beratungen bestanden habe, stehe nun eine Million Euro zur Verfügung.
Der erste Aktionsplan zur Armutsbekämpfung erschien bereits 2013. Im Jahr 2015 erschien ein Armuts- und Reichtumsbericht, Anfang 2017 der erste saarländische Familienreport. Der neue Aktionsplan für das Saarland verzögerte sich zuletzt wegen der Corona-Pandemie erneut.
Demonstrationen für bezahlbaren Wohnraum

epd-bild/Christian Ditsch
Düsseldorf/Berlin (epd). Mehrere hundert Menschen haben am 20. Juni in Nordrhein-Westfalen für mehr bezahlbaren Wohnraum demonstriert. Mit den Kundgebungen in großen Städten NRWs solle nicht zuletzt auf die Folgen der Corona-Pandemie für die Mieter hingewiesen werden, die durch die wirtschaftlichen Einschränkungen in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, sagte Kalle Gerigk von der Initiative "Recht auf Stadt - Köln". Zu einer Kundgebung in Köln fanden sich nach Angaben der Veranstalter rund 250 Menschen ein.
Aufgerufen zu den Demos hatte das Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Die Demonstrationen waren Teil eines bundesweiten Tages unter dem Motto "Shut down Mietenwahnsinn - Sicheres Zuhause für alle!", der in einem guten Dutzend Städten stattfand. In Berlin lag die Teilnehmerzahl nach Polizeiangaben im "oberen dreistelligen Bereich". Das Aktionsbündnis sprach selbst von rund 2.000 Beteiligten. In der Finanzmetropole Frankfurt am Main waren es nach Angaben der Veranstalter etwa 500 Demonstranten.
Fahrradkorso in Krefeld
In NRW gab es neben der Demo in Köln unter anderem Kundgebungen in Aachen und Düsseldorf, zu denen nach Angaben der Polizei insgesamt etwa 80 Teilnehmer kamen. In Krefeld startete eine "mietenpolitische Fahrradtour".
Gefordert wurde der Erlass von Mietschulden und eine Senkung der Mieten. Auch nach dem Auslaufen des Kündigungsschutzes für Mieter, die wegen der Corona-Krise ihre monatlichen Zahlungen einstellen mussten, müsse es weiterhin einen Schutz für finanziell angeschlagene Familien geben, erklärte Aktivist Gerigk. Ansonsten drohe die Zahl der Obdachlosen weiter zu steigen. Zudem verwiesen Redner darauf, dass Zwangsräumungen und Zweckentfremdung von Wohnraum verhindert sowie Wohnungsgesellschaften vergesellschaftet werden sollten.
Ende Juni laufen den Angaben zufolge die coronabedingten Stundungen der Mietzahlungen bei krisenbedingter Zahlungsunfähigkeit aus. Viele Menschen könnten jedoch auch danach nicht die Miete zahlen, erklärte das Bündnis. Allein durch Kurzarbeit und vermehrte Arbeitslosigkeit seien bislang rund zwölf Millionen Menschen mehr mit zum Teil erheblichen Einkommenseinbußen konfrontiert. Selbst wenn der Kündigungsaufschub bis Ende September verlängert werde, drohten ab Herbst Kündigungen und Zwangsräumungen.
Das bundesweite Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn war im August 2019 in Göttingen gegründet worden. Gemeinsam mit weiteren Netzwerken hatte das Bündnis für Ende März dieses Jahres zu einem europaweiten "Housing Action Day" aufgerufen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Aktionstag bis auf weiteres verschoben. Ein Datum dafür steht noch nicht fest.
Mehr Bedürftige versorgen sich wegen Corona-Krise bei Tafeln
Berlin (epd). Die bundesweit rund 830 geöffneten Tafeln müssen wegen der Corona-Krise immer mehr Menschen versorgen. "Wir haben in den letzten Wochen bei den Tafeln eine neue Form der Not erlebt", sagte der Vorsitzende des Tafel Deutschland e.V., Jochen Brühl, am 17. Juni in Berlin. Es kämen vermehrt jüngere Menschen, die bis vor kurzem überhaupt nicht auf die Tafeln angewiesen waren "und nun vor Erleichterung weinen, weil sie etwas zu essen bekommen und ihren Kühlschrank wieder füllen können".
Die Menschen suchten Unterstützung, weil sie selbstständig seien, in Kurzarbeit oder ihren Job oder Nebenjob aufgrund der Corona-Pandemie verloren hätten. Auch wenn die Bundesregierung bereits schnelle und unbürokratische Hilfen auf den Weg gebracht habe, seien einige Menschen in existenzielle Not geraten, sagte Brühl.
Gleichzeitig zeigte sich der Tafel-Vorsitzende besorgt um Menschen, die schon vor der Corona-Pandemie zu den Tafeln kamen. Vor allem ältere Menschen blieben aus Angst vor Ansteckung zuhause: "Es gelingt uns momentan nicht, alle Menschen zu erreichen, die eigentlich unsere Unterstützung benötigen."
Einige Tafeln hätten Lieferdienste für besondere Risikogruppen einrichten können. Begegnungen und Gespräche in der Tafel würden aber weiterhin wegfallen. Den Angaben zufolge sind derzeit noch 120 der 949 Tafeln bundesweit geschlossen. Gründe seien vor allem beengte Räumlichkeiten sowie fehlende Ehrenamtliche. Ein Großteil der Tafel-Aktiven gehöre aufgrund des Alters oder Vorerkrankungen der Risikogruppe an.
Studie: Jedes achte Krankenhaus in Insolvenzgefahr
Essen (epd). Die wirtschaftliche Lage der deutschen Krankenhäuser hat sich verschlechtert. Jede achte Klinik (13 Prozent) befand sich 2018 in erhöhter Insolvenzgefahr, wie aus dem am 18. Juni veröffentlichten Krankenhaus Rating Report 2020 des Essener RWI - Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht. Im Jahr zuvor lagen erst elf Prozent im "roten Bereich" der erhöhten Insolvenzgefahr.
Für die 16. Ausgabe des Berichts analysierten Forscher vom RWI und der Institute for Healthcare Business GmbH in Kooperation mit der Bank im Bistum Essen und der Organisation Healthcare Information and Management Systems Society Jahresabschlüsse von 942 Krankenhäusern. Danach stieg auch die Zahl der Krankenhäuser, die ein Minus machten, an: Während 2017 noch 27 Prozent auf Konzernebene einen Jahresverlust schrieben, waren es 2018 bereits 29 Prozent.
Im "grünen Bereich" lag 2018 jedoch die Mehrheit der Krankenhäuser (64 Prozent). Größere Krankenhäuser schnitten dabei typischerweise besser ab als kleine, zudem beeinflusse ein hoher Grad an Spezialisierung das Rating und die Patientenzufriedenheit positiv, hieß es. Auch regionale Unterschiede erfassten die Forscher: Während Kliniken in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern schlechtere Bewertungen aufwiesen, schnitten Krankenhäuser im Osten Deutschlands signifikant besser ab.
Die schlechtere wirtschaftliche Lage der Kliniken führen die Wissenschaftler auf den Rückgang der stationären Fallzahl um 0,1 Prozent zurück. Diese Entwicklung liege an der zunehmenden Ambulantisierung der Medizin, dem Fachkräftemangel und der intensiveren Prüfung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK). Für dieses Jahr prognostizieren die Studienautoren aufgrund der verschobenen Operationen wegen der Corona-Pandemie einen weiteren spürbaren Rückgang der Fallzahlen von mindestens sechs Prozent. Bis zum Jahr 2030 werde die Verweildauer weiter zurückgehen, weshalb der Bedarf an Krankenhausbetten sinken werde.
Hospizverband lehnt Suizidbeihilfe in Pflegeheimen ab
Die Debatte um das jüngste Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts hält an. Die Caritas sieht den Richterspruch problematisch. Der Hospizverband warnt Altenheime vor einer Zusammenarbeit mit Sterbehilfevereinen.Berlin (epd). Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband (DHPV) hat die Forderung eines Sterbehilfevereins zurückgewiesen, Alten- und Pflegeheime sollten in ihren Hausordnungen auf das Grundrecht auf Suizid und Suizidbeihilfe hinweisen. Suizidbeihilfe dürfe "niemals zu einer gängigen Behandlungsmethode für Heimbewohner werden", sagte der Vorsitzende Winfried Hardinghaus am 15. Juni in Berlin.
Der Druck, dem sich ältere Menschen durch die Möglichkeiten der Suizidbeihilfe ausgesetzt fühlten, drohe sich durch eine solche Praxis zu verstärken. "Dabei brauchen gerade ältere, auf Hilfe und Unterstützung angewiesene Menschen die Gewissheit, von der Gesellschaft solidarisch getragen zu werden", betonte der Osnabrücker Palliativmediziner. Er appellierte an die Betreiber von Pflegeeinrichtungen, der Forderung nicht Folge zu leisten.
Der "Verein Sterbehilfe" des ehemaligen Hamburger Justizsenator Roger Kusch hatte gemeldet, dass er erstmals einem Bewohner eines deutschen Altenheims zum Suizid verholfen habe. Zugleich hatte der Verein verlangt, "alle Alten- und Pflegeheime in Deutschland" sollten ihre Hausordnung entsprechend ergänzen. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern solle die gültige Rechtssprechung verdeutlicht werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte Ende Februar das seit 2015 geltende Verbot organisierter Hilfe beim Suizid gekippt und das Recht auf selbstbestimmtes Sterben betont.
"Zusammenarbeit mit Hospizdiensten"
Hardinghaus betonte, der Fall mache deutlich, "wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und das schwebende neue Gesetzesverfahren von Sterbehilfevereinen genutzt werden, um ein regelhaftes Angebot nach ihrem Zuschnitt zu fordern". Die Forderung des Vereins verstoße gegen das Selbstverständnis der meisten Pflegeeinrichtungen. Sie seien darauf ausgerichtet, "die ihnen anvertrauten Bewohnerinnen und Bewohner bis zum Lebensende würdig zu betreuen, das heißt ihnen im Sterben beizustehen - nicht beim Sterben zu helfen". Das Bundesverfassungsgericht habe auch klargestellt, dass niemand verpflichtet werden könne, Suizidbeihilfe zu leisten: "Das gilt natürlich auch für die Betreiber von Alten- und Pflegeeinrichtungen."
Kooperationen mit Sterbehilfevereinen gehen laut Hardinghaus in eine falsche Richtung. Notwendig sei vielmehr eine zuverlässige medizinisch-pflegerische Versorgung in allen Pflegeeinrichtungen, "das heißt genügend Personal und gegebenenfalls entsprechende Zusammenarbeit mit Hospizdiensten und Palliativteams", sagte er.
Caritaspräsident Peter Neher forderte unterdessen eine intensive gesellschaftliche Debatte um den Wert des Lebens. Er halte Entscheidung des Gerichts für problematisch, "weil sie das Selbstbestimmungsrecht letztlich als einziges Kriterium über Tod und Leben nennt", sagte Neher der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (15. Juni). Fraglos handele es sich beim Selbstbestimmungsrecht "um ein hohes Gut", erläuterte der Präsident des Deutschen Caritasverbandes. "Das setzt aber voraus, dass jeder Suizidwunsch aus einer selbstbestimmten Haltung heraus geäußert wird", sagte er. "Und ob das immer der Fall ist, hinterfrage ich mindestens kritisch."
Katholische Kirchenbank erreicht neuen Rekord bei Kundengeldern
Münster (epd). Die katholische Kirchenbank Darlehnskasse Münster hat im vergangenen Jahr einen Rekord bei ihren Kundengelder verzeichnet. So habe das betreute Kundenvolumen mit 7,5 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert in der Geschichte der Kirchenbank erreicht, erklärte der Vorstandsvorsitzende Christoph Bickmann am 16. Juni laut Mitteilung des Bistums Münster. Ausschlaggebend dafür seien vor allem das Interesse und der Erwerb von Wertpapieren, aber auch die positive Entwicklung des Einlagen- und Kreditgeschäftes. Wegen der Corona-Pandemie fand die Generalversammlung als Videoübertragung im Internet statt.
Die Bilanzsumme stieg den Angaben zufolge um 237 Millionen Euro auf 4,52 Milliarden Euro zum Jahresende 2019. Der Jahresüberschuss 2019 belief sich auf 6,7 Millionen Euro. Mit ihrer Eigenmittelausstattung sei die Kirchenbank gut vorbereitet, die aus der Corona-Pandemie entstehenden weitreichenden Herausforderungen wirtschaftlich und finanziell zu bestehen. Mit der Auflage eines eigenen Sonderkreditprogramms werde die Bank Kunden Liquiditätshilfen zur Verfügung stellen. Die bisherigen Kreditprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) könnten von gemeinnützigen Organisationen nicht in Anspruch genommen werden, hieß es.
Bei der Aufsichtsratssitzung wurde der Münsteraner Domkapitular Antonius Hamers zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreter ist der Caritasdirektor für das Bistum Münster, Heinz-Josef Kessmann.
Die 1961 in Münster gegründete Darlehnskasse Münster betreut kirchliche Einrichtungen und Mitarbeiter im Bistum Münster sowie in den Bistümern Osnabrück, Hamburg, Hildesheim und Berlin. Das Bankinstitut, das aus Kostengründen auf Filialstandorte verzichtet, hat nach eigenen Angaben knapp 130 Mitarbeiter.
Medien & Kultur
EKD stellt Youtube-Kanal "Jana" ein

epd-bild/Jörn Neumann
Frankfurt a.M./Köln (epd). Der von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mitfinanzierte christliche Youtube-Kanal "Jana" wird eingestellt. Grund dafür seien finanzielle Einbußen, die durch die Corona-Krise entstanden sind, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 16. Juni in Frankfurt am Main mit. Das GEP hatte den Kanal gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) im Auftrag der EKD verantwortet. Im Februar war das evangelische Contentnetzwerk "yeet" an den Start gegangen, das mediale Inhalte verschiedener Sinnfluencerinnen und Sinnfluencer anbietet.
Wie das GEP mitteilte, wird der Vertrag mit der Kölner Produktionsfirma Mediakraft für den Youtube-Kanal nicht verlängert. Die EKD hatte nie Zahlen darüber veröffentlicht, was der Kanal kostet. Das Gesicht des Kanals ist die mittlerweile 22-jährige Medizinstudentin Jana Highholder. Sie hatte im April 2018 mit dem Kanal begonnen. In ihrem letzten Video äußerte sie sich stolz über das Erreichte. Der Kanal hat mittlerweile mehr als 22.000 Abonnenten. 185 Videos habe sie produziert, die insgesamt 1,75 Millionen Mal angeklickt worden sein. Darüber könne sie nur staunen und dankbar dafür sein, sagt Highholder in dem Abschiedsvideo, das am 17. Juni veröffentlicht wurde. Die Videos bleiben bis auf weiteres online sichtbar.
Highholder könnte weiter für "yeet" aktiv bleiben
"Wir würden uns freuen, wenn wir Jana dafür gewinnen könnten, ihre besonderen Gaben auch weiterhin bei 'yeet' einzubringen", sagte GEP-Direktor Jörg Bollmann. "Jana" hatte mit dazu beigetragen, dass das Online-Netzwerk christlicher Sinnfluencerinnen und Sinnfluencer gegründet wurde. Dazu gehören neben anderen die norddeutsche Pfarrerin Josephine Teske, die Berliner Pfarrerin Theresa Brückner und die beiden niedersächsischen Pfarrerinnen Steffi und Ellen Radke, die auf dem Youtube-Kanal "andersamen" über ihren Alltag als homosexuelles Ehepaar berichten.
Im vergangenen Jahr hatte es eine kircheninterne Debatte über den Kanal "Jana" gegeben, weil Highholder in einem Video ein konservatives Familienbild vertreten hatte. Dafür war sie kritisiert worden.
Das GEP ist die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland, ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Zum GEP gehört unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd).
Claussen: Über Kolonial-Denkmäler neu nachdenken

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Im Streit um deutsche Kolonial-Denkmäler hat der evangelische Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen dafür plädiert, diese Denkmäler möglichst stehenzulassen und sie historisch und künstlerisch zu kommentieren. Es sei wichtig, über die Präsentation gemeinsam neu nachzudenken, weil inzwischen viele Menschen in Deutschland lebten, die eine Migrationsgeschichte aus ehemaligen Kolonialgebieten hätten, sagte Claussen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bei der Auseinandersetzung mit problematischer Erinnerungskultur in Deutschland hätten Kolonial-Denkmäler bislang kaum im Fokus gestanden. "Endlich ändert sich das."
Große Bildungsaufgabe
Deutschland und die USA oder Großbritannien ließen sich beim Umgang mit Denkmälern schwer vergleichen, sagte Claussen mit Blick auf Denkmal-Stürze in Minneapolis und Bristol nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd. "Aufgrund unserer Geschichte haben wir viel früher begonnen, uns kritisch mit problematischen Denkmälern zu beschäftigen, sie abzubauen oder mit Gegendenkmälern zu konfrontieren." Er rief dazu auf, auch im Blick auf Denkmäler mit Bezug zur Kolonialzeit nicht pauschal vorzugehen.
"Das Erste ist, dass wir uns überhaupt mit unserer Kolonialgeschichte befassen", sagte der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Hier liegt eine große Bildungsaufgabe vor uns." Die Denkmäler könnten in diesem Zusammenhang eine wichtige Aufgabe übernehmen. Sie präsentierten das Thema ja im öffentlichen Raum, allerdings auf problematische Weise. "Aber es gibt viel bewährte und kreative Möglichkeiten, das zum Anlass der Auseinandersetzung zu machen", sagte der Theologe.
Von Fall zu Fall entscheiden
Angesichts der Forderung bestimmter betroffener Gruppen, Denkmäler oder auch andere Erinnerungsformen wie Straßennamen abzuschaffen, die im Zusammenhang mit Antisemitismus-, Rassismus- oder Sexismus-Vorwürfen gesehen werden, sagte Claussen: "Wir müssen von Fall zu Fall entscheiden. Manchmal sind solche Denkmäler schlicht falsch und dumm, andere sind wirklich verletzend, andere wiederum werden zu unrecht angegriffen." Zu letzteren zähle zum Beispiel das Gomringer-Gedicht "Alleen". "Da gilt es, ein rechtes Maß zu finden, Opfer von Diskriminierung wahrzunehmen, aber keine polarisierende Identitätspolitik zu betreiben", sagte der EKD-Kulturbeauftragte.
Das Gedicht "avenidas" ("Alleen") von Eugen Gomringer wurde 2018 von der Fassade einer Berliner Hochschule entfernt, weil Studentinnen und Studenten es sexistisch fanden. Inzwischen ist es im gleichen Stadtteil an einer anderen Hauswand zu sehen.
Wirtschaftsphilosoph Amartya Sen erhält Friedenspreis
Seit Jahrzehnten erforscht der indische Ökonomieprofessor Amartya Sen die Ursachen von Armut, Hunger und wirtschaftlicher Ungleichheit. Jetzt erhält der Vordenker den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.Frankfurt a.M. (epd). Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geht 2020 an den indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen Amartya Sen. Der Stiftungsrat habe den 86-jährigen Harvard-Professor und Nobelpreisträger ausgewählt, weil er sich "als Vordenker seit Jahrzehnten mit Fragen der globalen Gerechtigkeit auseinandergesetzt" habe. Seine Arbeiten seien für die Bekämpfung der sozialen Ungerechtigkeit in der Welt so relevant wie nie zuvor. "Amartya Sen hebt Solidarität und Verhandlungsbereitschaft als essenzielle demokratische Tugenden hervor und beweist, dass Kulturen keine Quelle des Streits um Identitäten sein müssen", heißt es in der am 18. Juni veröffentlichten Begründung der Preis-Jury.
Amartya Sen wurde 1933 in der indischen Region Westbengalen geboren. Er forscht seit Jahrzehnten an weltweit führenden Hochschulen über die Folgen der Globalisierung und die Ursachen von Armut und Hunger. Seine Überlegungen liegen dem von den Vereinten Nationen verwendeten Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index) zugrunde. Für seine Theorien zur Wohlfahrtsökonomik in Entwicklungsländern erhielt er 1998 den Wirtschaftsnobelpreis.
Verleihung am 18. Oktober
Die Verleihung des Friedenspreises findet traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse am 18. Oktober in der Paulskirche statt und wird live im Fernsehen übertragen. Die Auszeichnung wird seit 1950 vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert. Sie soll laut Statut eine Persönlichkeit auszeichnen, "die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat". Zu den Trägern des Preises gehören der DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer, der Schriftsteller Martin Walser und der Philosoph Jürgen Habermas. Im vergangenen Jahr erhielt der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado den Preis.
US-Autorin Van Draanen gewinnt "Buxtehuder Bulle"
Buxtehude (epd). Die US-Autorin Wendelin van Draanen (55) erhält den renommierten deutschen Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle". Die mit elf Jugendlichen und elf Erwachsenen besetzte Jury stimmte erstmals in einem virtuellen Preisentscheid unter insgesamt 90 Titeln für ihren Roman "Acht Wochen Wüste". Die sonst öffentliche Jurysitzung wurde aufgrund der Corona-Pandemie am 19. Juni im Internet übertragen. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wird jährlich seit 1971 für das nach Meinung der Jury beste in deutscher Sprache veröffentlichte Jugendbuch des jeweiligen Vorjahres verliehen.
Ziel der Auszeichnung ist es, Jugendliche zu intensivem Lesen zu bewegen und gleichzeitig gute Jugendbücher zu fördern. Preisgeld und eine Stahlplastik in Form eines Bullen sollen Ende des Jahres in Buxtehude bei Hamburg an Van Draanen übergeben werden. Das siegreiche Buch sei eindeutiger Favorit der Jury gewesen, hieß es. In der Erzählung geht es um die 14-jährige Wren, die zu Hause nicht mehr klar kommt und von ihren Eltern gegen ihren Willen in ein Wildnis-Therapie-Camp geschickt wird.
Der Buxtehuder Buchhändler Winfried Ziemann hatte die Auszeichnung ins Leben gerufen, die mittlerweile zu den bedeutendsten deutschen Jugendliteraturpreisen zählt. 1981 übernahm die Stadt Buxtehude die Trägerschaft. Für den Namen des Preises stand der friedfertige Stier Ferdinand Pate. Die Figur stammt aus dem zuerst 1936 publizierten Buch "The Story of Ferdinand" des amerikanischen Autors und Kinderbuch-Illustrators Munro Leaf (1905-1976).
Zu den Preisträgern gehören unter anderen Suzanne Collins, Michael Ende, Gudrun Pausewang, Leonie Ossowski, Ursula Wölfel und Jostein Gaarder sowie der Bremer Bestsellerautor David Safier. Im vergangenen Jahr wurde die US-amerikanische Schriftstellerin Amy Giles ausgezeichnet.
Medienwissenschaftler Jarren kritisiert Angst-Framing in Corona-Krise

epd-bild/Christian Ditsch
Frankfurt a.M (epd). Aus Sicht des Zürcher Medienwissenschaftlers Otfried Jarren haben öffentlich-rechtliche Fernsehsender in der Corona-Pandemie durch wiederholende Darstellungen und die Fokussierung auf gesundheitliche Aspekte Ängste verstärkt. "Das Repetitive hat einen erheblichen Framing-Effekt", sagte Jarren am 17. Juni in einer online übertragenen Diskussion zum Thema "Qualitätsmedien in der Corona-Krise?". So vernünftig der Verweis auf begrenzte Kapazitäten im Gesundheitswesen gewesen sei, so sehr stelle jede Verabsolutierung ein Problem dar.
Werner D'Inka, ehemaliger Herausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ), verteidigte die Fernsehsender. "Ich habe mich eigentlich angemessen informiert gefühlt", sagte er. Auch im Fernsehen seien die notwendigen Fragen gestellt worden, fügte der Präsident des Frankfurter Presseclubs hinzu. Pauschale Vorwürfe gegen "das Fernsehen" oder "die Medien" aus der Medienwissenschaft habe er in den vergangenen Wochen als unangemessen empfunden.
Corona-Krise als Anstoß für neue journalistische Perspektiven
Jarren warnte vor einem Selbstverständnis des Journalismus als systemrelevant. "Journalismus soll autonom und unabhängig sein", sagte der Wissenschaftler. "Seine Relevanz hat er zu zeigen gegenüber der Gesellschaft, nicht gegenüber der Politik."
D'Inka räumte ein, dass Medien gelegentlich zu stark auf Institutionen fixiert seien. Zu häufig werde über Beschlüsse von Kultusministerien berichtet, zu selten über den Alltag an den Schulen. Die Corona-Pandemie könne ein Anstoß sein, journalistische Perspektiven zu überdenken.
Der ehemalige FAZ-Herausgeber riet dazu, die Ungewissheit über den Verlauf und die Folgen der Pandemie in der Berichterstattung immer wieder herauszustellen. "Die Schwierigkeit, mit einer offenen Zukunft umzugehen, ist nicht auf den Journalismus begrenzt", gab D'Inka zu bedenken. Man solle nicht so tun, als wüsste man, wie die Dinge ausgehen.
Mehr Transparenz
Moderatorin Diemut Roether, Verantwortliche Redakteurin von epd medien, empfahl als eine Lehre aus der Corona-Berichterstattung ein stärkeres Bemühen um Transparenz. Für die Publikumsbindung sei es wichtig, seine eigene Arbeit immer wieder zu erklären. Das sei gerade in der aktuellen Krisensituation entscheidend, sagte sie in der Diskussionsrunde, zu der epd medien, der Frankfurter Presseclub und die Evangelische Akademie Frankfurt gemeinsam eingeladen hatten.
Der Medienwissenschaftler Jarren gehörte zu den frühen Kritikern der Medienberichterstattung in der Corona-Krise. Er schrieb Ende März in einem Beitrag für epd medien, das öffentlich-rechtliche Fernsehen lasse seit Wochen die immer gleichen Experten und Politiker auftreten und präsentiere diese als Krisenmanager. Wenige Wochen später nahm D'Inka die Medien in Schutz. In einem Kommentar in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" warnte er vor einer allzu pauschalen Kritik an der Corona-Berichterstattung.
Ministerpräsidenten ebnen Weg für Erhöhung des Rundfunkbeitrags

epd-bild/Heike Lyding
Berlin (epd). Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ab 2021 wird immer wahrscheinlicher: Die Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer haben den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag unterzeichnet. "Damit kommen wir unseren verfassungsrechtlichen Verpflichtungen nach und stellen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter zukunftssicher auf", erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer (SPD), am 17. Juni nach der Konferenz der Länderchefs in Berlin.
Ratifizierung durch die Landtage
Das Gesetzeswerk muss nun noch von den Landtagen ratifiziert werden, bevor es in Kraft treten kann. Der Vertrag sieht eine Anhebung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent auf 18,36 Euro ab der kommenden Beitragsperiode (2021 bis 2024) vor. Zuletzt war die Abgabe 2009 erhöht worden, im Jahr 2015 gab es eine Senkung.
Die Ministerpräsidenten hatten sich im vergangenen März darauf verständigt, der Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) zu folgen. Das Land Sachsen-Anhalt enthielt sich damals. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) wies bei seiner Unterschrift in einer Protokollnotiz nun nochmals explizit auf diese Enthaltung hin. "Diese Unterschrift dient dazu, die den 16 Länderparlamenten obliegende Entscheidung zu ermöglichen", heißt es in der Notiz weiter. Im sachsen-anhaltischen Landtag sehe er zurzeit keine Mehrheit für diesen Vertrag und damit für eine Beitragserhöhung, erklärte Haseloff nach der Ministerpräsidentenkonferenz.
Widerstand gegen Erhöhung
Ob alle Landesparlamente den Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag ratifizieren, ist ungewiss. Neben einigen Landtagsfraktionen in Sachsen-Anhalt versuchen im Bundestag die FDP sowie Teile der Union, die Anhebung zu verhindern oder eine Verschiebung zu bewirken. Begründet wird dies unter anderem mit der durch die Corona-Pandemie verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Situation.
Dreyer warb am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz nach Auskunft einer Sprecherin der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz für die Zustimmung der Länderparlamente. Die Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent sei "ein maßvolles Ergebnis" angesichts der Tatsache, dass die Abgabe seit mehr als zehn Jahren nicht erhöht wurde, sagte Dreyer. Zugleich sprach sie sich für eine Verlängerung der Beitragsperiode auf acht Jahre aus.
Dreyer erklärte, gerade auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe in der Corona-Pandemie bewiesen, wie wichtig die Medien für die Gesellschaft sind. Gleichzeitig seien alle Medien auf unterschiedliche Art und Weise wirtschaftlich unter Druck geraten. "Neben Hilfen für den privaten Rundfunk ist deshalb auch die moderate Beitragspassung ein wichtiger Baustein zum Erhalt unseres vielfältigen dualen Rundfunksystems, das sich gerade in dieser Krisenzeit bewährt hat."
Buhrow: Wichtiger Zwischenschritt
Der ARD-Vorsitzende und Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Tom Buhrow, sprach von einem wichtigen Zwischenschritt. "Auch bei einer Anpassung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent werden wir als ARD unsere Reformen nicht aus dem Blick verlieren und weiter strikt daran festhalten", erklärte er in Köln.
Die Landesparlamente können dem Vertrag in seiner jetzigen Form nur zustimmen oder ihn ablehnen. Von dem KEF-Vorschlag dürfen sie, ebenso wie die Ministerpräsidenten, allerdings nur dann abweichen, wenn die Beitragshöhe den freien Zugang zu Informationen zu erschweren droht oder die Belastung der Rundfunknutzer nicht mehr angemessen erscheint. Hierfür müssen nachprüfbare Gründe angegeben werden.
Einzug durch Beitragsservice
Der Rundfunkbeitrag ersetzt seit 2013 die Rundfunkgebühr. Seitdem zahlen jeder Haushalt und jede Betriebsstätte die Abgabe für die öffentlich-rechtlichen Sender, und zwar unabhängig davon, ob Empfangsgeräte vorhanden sind. Die Abgabe wird durch den Beitragsservice eingezogen, der die Einnahmen an ARD, ZDF und Deutschlandradio verteilt. Im Jahr 2018 nahm der Beitragsservice insgesamt 8,01 Milliarden Euro ein. Knapp zwei Prozent des Beitrags gehen an die Landesmedienanstalten.
Bei einer Beitragserhöhung von 86 Cent entfallen 47 Cent auf die ARD, 33 Cent auf das ZDF und vier Cent auf das Deutschlandradio. Die Finanzforderungen der Sender hätten dagegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 19,24 Euro pro Monat bedeutet.
Jüngere finden unabhängigen Journalismus weniger wichtig
Hamburg (epd). Junge Internetnutzer in Deutschland halten unabhängigen Journalismus für weniger bedeutend als ältere Generationen. Nach einer Studie des Hamburger Leibniz-Instituts für Medienforschung gaben in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen lediglich 56 Prozent an, dass für das Funktionieren einer Gesellschaft unabhängiger Journalismus wichtig sei. Bei den über 55-jährigen Onlinern waren es dagegen 88 Prozent, wie das Institut am 15. Juni mitteilte. Internetnutzer informieren sich demnach weiterhin auch in den traditionellen Medien über das Weltgeschehen: 70 Prozent schauen sich mindestens einmal pro Woche Nachrichten im Fernsehen an, 45 Prozent hören Nachrichten im Radio und ein Drittel liest ein Printmedium.
Das Nachrichteninteresse bleibt auf hohem Niveau stabil. 94 Prozent der erwachsenen Onliner nutzten im Januar 2020 mehrmals pro Woche die Nachrichten. 71 Prozent sagen, dass sie sehr oder überaus an Nachrichten interessiert sind. Merklich angestiegen ist gegenüber dem Vorjahr das Interesse der 18- bis 24-Jährigen mit 50 Prozent (sieben Prozentpunkte) und der 25- bis 34-Jährigen mit 66 Prozent (neun Prozentpunkte).
Eine ergänzende Studie während der Corona-Pandemie ergab, dass sich 72 Prozent der erwachsenen Internetnutzer in Deutschland im linearen Fernsehen, 50 Prozent über etablierte Nachrichtenanbieter im Internet und 39 Prozent über soziale Medien informierten. Die Nutzung von Radionachrichten und gedruckten Erzeugnissen war etwas rückläufig.
Reichweite von sozialen Medien als Nachrichtenquelle steigt
Auffällig ist nach Einschätzung des Medieninstituts der Anstieg der Reichweite von sozialen Medien als Nachrichtenquelle. 2020 nutzen 37 Prozent der befragten Onliner eine dieser Plattformen als Quelle für Nachrichten, 2019 waren es noch 34 Prozent. In der Gruppe der 18- bis-24-Jährigen nutzen Anfang des Jahres 56 Prozent soziale Medien als Quelle für Nachrichten, das waren sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 30 Prozent gaben soziale Medien als wichtigste Nachrichtenquelle an, ein Anstieg um acht Prozentpunkte gegenüber 2019. WhatsApp, Youtube und Facebook sind nach wie vor die sozialen Medien mit der weitesten Verbreitung.
Den Nachrichten, die die Befragten tatsächlich nutzen, vertrauen insgesamt 59 Prozent, 13 Prozent vertrauen ihnen nicht. In ihrer Tendenz ist diese Verteilung seit 2017 stabil. Nach wie vor geringes Vertrauen haben Internetnutzer in Nachrichten aus den sozialen Medien. Nur 14 Prozent vertrauen ihnen, 50 Prozent dagegen nicht. Zehn Prozent gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten für Online-Nachrichten Geld bezahlt zu haben, ein Anstieg von zwei Prozentpunkten gegenüber 2019.
Die Ergebnisse gehen auf eine deutsche Teilstudie zurück, die das Leibniz-Institut für den Reuters Institute Digital News Report erarbeitete. Insgesamt basiert die Studie auf Daten von 80.155 Befragten aus 40 Ländern. Die Feldarbeit in Deutschland wurde zwischen dem 17. und 30. Januar dieses Jahres vom Umfrageinstitut YouGov durchgeführt. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge repräsentativ für die deutsche Bevölkerung im Alter ab 18 Jahren mit Internetzugang im Jahr 2020.
Nicht mehr nur Warhol und Co.

epd-bild/Guido Schiefer
Köln (epd). Die berühmten Repräsentanten der US-Kunst der 60er und 70er Jahre haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind weiß und männlich. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg oder Robert Indiana etwa wurden als Vertreter der Pop Art berühmt. Das Kölner Museum Ludwig kann als Eigentümer der weltweit größten Pop Art-Sammlung außerhalb der USA mit Schlüsselwerken dieser Künstler aufwarten.
Doch für Museumsdirektor Yilmaz Dziewior ist das kein Grund, sich auf diesen Schätzen des Museumsbestandes auszuruhen. Die berühmten Pop-Art-Protagonisten seien zwar die Namen, die sich in die Kunstgeschichte eingeschrieben hätten. "Aber es gab viele mehr, die genauso relevant waren." Die Ausstellung "Mapping the Collection" begibt sich in einer neuen Ausstellung auf die Suche nach den weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern dieser Jahrzehnte.
"Es geht darum, ein Bild zu zeigen, das viel näher an der US-amerikanischen Realität ist", erklärt Janice Mitchell. Die Kuratorin hat die Museumssammlung US-amerikanischer Kunst im Rahmen eines Forschungsprojekts zwei Jahre lang hinsichtlich postkolonialer, feministischer, queerer und gender-theoretischer Fragestellungen untersucht.
Gesellschaftliche Reibungspunkte
In der Ausstellung, die bis zum 23. August zu sehen ist, ergänzt sie die bekannten Namen durch Vertreter unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen, die bislang in der Kunstgeschichtsschreibung kaum auftauchen, darunter afroamerikanische und indigene Künstlerinnen und Künstler sowie feministische Positionen. Ihnen sei oftmals der Zugang zum Kunstmarkt und damit der Erfolg versperrt gewesen. "Wir finden, dass diese Künstlerinnen und Künstler viel mehr Beachtung verdienen", betont Dziewior. "Sie haben Fragen verhandelt, die auch heute wieder aktuell sind."
Tatsächlich berühren die Gemälde, Fotografien, Videoarbeiten und Skulpturen der 32 Künstlerinnen und Künstler gesellschaftliche Reibungspunkte, die heute in Zeiten der Anti-Rassismus-Proteste in den USA hochaktuell erscheinen. Da waren die Künstlerinnen und Künstler der Black-Power-Bewegung, die Rassismus und Sexismus innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft anprangerten. David Hammons Bild "Feed Folks" (1974) etwa zeigt die blassen Umrisse eines alten afroamerikanischen Mannes mit weißem Bart vor einer in kräftigen Farben leuchtenden US-Flagge. In der Hand trägt er in der Haltung eines Bettlers eine etwas zerknautschte Bierdose. Unterhalb sind die Schriftzüge "Feed" und "Folks" zu lesen: Eine kritische Anspielung auf eine Regierung, die lieber in patriotische Selbstdarstellung investiert, statt sich um die Bekämpfung von Armut und Rassismus im Land zu kümmern.
Robert Indianas "LOVE"-Schriftzug in Schwarz-Weiß
Flankiert wird das Bild von einem Werk Robert Indianas. Der Pop-Art-Künstler wurde bekannt für seine "LOVE"-Schriftzüge. In der Ausstellung wird eine schwarz-weiße Variante präsentiert, die in Kombination mit den kritischen Werken des afroamerikanischen Künstlerkollegen mit anderen Augen gesehen werden kann.
Nicht nur die Proteste gegen Rassismus erfuhren Ende der 60er und in den 70er Jahren einen ersten Höhepunkt. Auch die Diskussion um die Geschlechtergerechtigkeit entstand in dieser Zeit und ist durch die Me-too-Debatte wieder aktuell. Die weiblichen künstlerischen Positionen fanden Ende der 60er Jahre trotz Frauenbewegung deutlich weniger Beachtung als die der Männer. In Köln sind nun einige Werke zu sehen, die sich mit der gesellschaftlichen Perspektive von Frauen beschäftigen. Die kubanisch-amerikanische Künstlerin Ana Mendieta klebte sich für die Fotoserie "Untitled (Gesichtshaartransplantation)" (1972) einen Schnäuzer aus abrasierten Barthaaren ins Gesicht. Damit bricht sie mit landläufigen Vorstellungen vom Erscheinungsbild eines männlichen oder weiblichen Körpers.
Weibliche Stimme der Antikriegsbewegung
Eine wichtige weibliche Stimme unter den Künstlerinnen und Künstlern der Antikriegsbewegung der 60er Jahre war Corita Kent. Sie verband die Pop Art mit einer Botschaft der Liebe und des Mitgefühls. Auch Kent, die einen Großteil ihres Lebens als katholische Nonne verbrachte, arbeitet mit Schrift und Schlagworten. Ihr Siebdruck "American sampler" (1969) etwa spielt mit dem Begriff "assassination" (Ermordung), den sie durch unterschiedliche Farbgebung verändert. Durch die Aufspaltung ruft sie unterschiedliche Assoziationen hervor, die auf die Rolle der USA im Vietnamkrieg anspielen, etwa durch die Aufteilung des Wortes in "assassi" und "nation".
Mendieta und Kent gehören zu den weniger bekannten Positionen, die das Museum Ludwig bereits in seinem Bestand ergänzt hat. Auch eine Farbfeld-Malerei von Leon Polk Smith, die sich nahtlos in die Reihe der beiden bedeutendsten Vertreter des Genres, Kenneth Noland und Morris Louis einreiht, besitzt das Museum seit kurzem. Dziewior will die Sammlung in diese Richtung weiter entwickeln. "Es soll nicht bei einer einmaligen Ausstellung bleiben", kündigt er an.
Spurensicherung jenseits des Mainstreams

epd-bild / Udo Gottschalk
Oberhausen (epd). Die unbekannte Seite eines bekannten Künstlers: Als Kabarettist zählt Dieter Nuhr zu den Stars der deutschen Szene, als Fotokünstler dagegen ist er weniger bekannt. Auch wenn ihm selbst seine bildnerische Arbeit genauso wichtig ist und das Reisen in ferne Länder seine Leidenschaft: "Ich sehe mich nicht als Fotograf, sondern als Bildermacher", sagt Nuhr über seine teils großformatigen Werke.
Die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen zeigt nun eine Auswahl von 23 Exponaten mit Motiven aus Marokko, Georgien, Vietnam und dem Iran. Zweiter Gast der sommerlichen Projektreihe Parallel des Kunstvereins Oberhausen bis zum 13. September ist die gebürtige Iranerin Bahar Batvand mit zwölf Materialkollagen über "Akzidenz", das Zufällige.
Enge künstlerische Zusammenarbeit
Was die beiden Düsseldorfer Künstler verbindet, ist neben ihren nahe gelegenen Ateliers eine enge künstlerische Zusammenarbeit, trotz unterschiedlicher Arbeitsweise, wie Dieter Nuhr am 18. Juni betonte. Bahar Batvand sei für ihn eine Alchimistin, die in ihrem Atelier Bilder aus Drahtnetzen und Textilgarnen baue, während er selbst mehr ein Jäger und Sammler sei.
"Was mich am Reisen interessiert, ist fremd zu werden und fremd zu bleiben", sagte der 59-Jährige, der vor seiner Karriere als Comedian an der ehemaligen Folkwang-Schule in Essen bildende Kunst studierte. Von daher seien seine Bilder auch "keine dokumentarischen Reisebilder".
Tatsächlich lassen Nuhrs Werke in der weitläufigen Panoramagalerie der Ludwiggalerie viel Raum für Assoziationen: rätselhafte Strukturmuster aus Linien, Schriftzeichen und Formen, oft auf abblätternden, vielschichtigen Oberflächen, die Schönheit und Vergänglichkeit gleichzeitig spiegeln. Und Farbe, immer wieder Farbe in allen Schattierungen. Dazu Fundstücke, die Menschen achtlos hinterlassen haben wie Fetzen von Werbeplakaten oder ein verrosteter Haken, der leuchtend roten Räucherstäbchen als Halterung dient.
Bei seinen Reisen in alle Welt richtet Dieter Nuhr weit abseits touristischer Motive den Blick auf scheinbar alltägliche und unbeachtete Details. Es ist eine faszinierende Spurensuche jenseits des Mainstreams mit Motiven, die in der fotografischen Rezeption wie gemalt wirken. "Viele glauben nicht, dass das keine Malerei ist", erzählt Nuhr. Im Laufe der Jahre seien seine Arbeiten immer abstrakter geworden.
Werke ohne Titel, ohne Erklärungen
Auch die Werke von Bahar Batvand werden ohne Titel und Erklärungen präsentiert. Alle verschieden in Farbe und Gestaltung, weisen sie doch Gemeinsamkeiten auf, etwa ein kaum noch sichtbares, stabilisierendes Drahtkorsett im Inneren und ein kunstvolles Labyrinth aus Fäden, Farben und Strukturen. Ein großformatiges, zentrales Werk in der Mitte des Ausstellungsraumes etwa mutet an wie das drahtige Innere einer alten Sprungfedermatratze mit einem neuen Gewand aus verschlungenem weißen Band.
Lange Zeit waren Desolation, Zerstörung und eine neue Sinngebung ihres Materials das Markenzeichen der 2001 nach Deutschland emigrierten Iranerin - Reminiszenzen an schmerzliche Ereignisse. Als Kind hatte die heute 45-Jährige den ersten Golfkrieg in den 1980er Jahren hautnah miterlebt. Später studierte sie Malerei in Teheran und in Düsseldorf an der Kunstakademie, wo sie Meisterschülerin war.
"Ich möchte mit meiner Kunst nicht unbedingt politisch sein", sagt sie heute, aber angesichts ihrer Biografie könne sie auch nicht unpolitisch sein. Mittlerweile spricht Batvand von einem Wandel in ihren Werken. Die jetzt in Oberhausen ausgestellte neue Serie sei nicht so sehr Ausdruck von Zerstörung, sondern es seien aufbauende Arbeiten.
Rückkehr ans Deutsche Eck
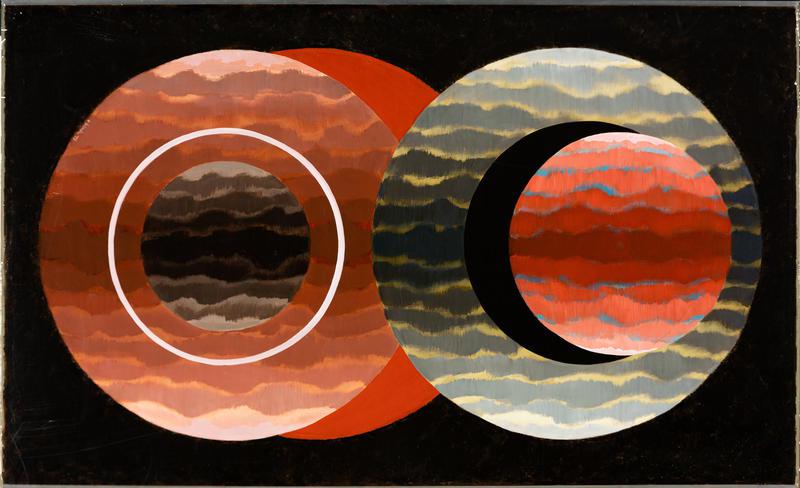
epd-West/ Otto Fried, newcut werbefilme
Koblenz (epd). Es war eine etwa zwei Meter große Rolle, die das Interesse von Beate Reifenscheid weckte. Im Pariser Atelier von Otto Fried stieß die Leiterin des Koblenzer Ludwig Museums auf ein vier Meter langes Gemälde, das dort jahrelang unbeachtet in einer Ecke stand. Nun ist das Bild in Koblenz erstmals öffentlich zu sehen. Reifenscheid hofft, das Gemälde, das aus plastisch wirkenden bogenförmigen Pinselstrichen in Braun-, Orange- und Grüntönen besteht, ankaufen zu können. Damit würde Otto Fried, dem das Ludwig Museum seit Sonntag eine Retrospektive widmet, dauerhaft mit einem seiner großformatigsten Werke in seine Heimatstadt zurückkehren.
Unter dem Titel "Otto Fried - Heaven Can Wait/Heaven Can't Wait" ehrt das Ludwig Museum einen jüdischen Künstler, der Nazi-Deutschland bereits als Jugendlicher verlassen musste, und seine künstlerische Karriere im Ausland startete. Otto Fried, der 1922 in Koblenz-Horchheim geboren wurde, ist vor allem für seine abstrakten Gemälde bekannt. Mit seinen Kompositionen aus kosmisch wirkenden Scheiben und Kreisen erzielt Fried durch Überlagerung und eine spezielle Maltechnik eine räumliche Wirkung. Die Ausstellung präsentiert rund 40 Werke, darunter neben Gemälden auch Zeichnungen, Assemblagen sowie einige Skulpturen.
Otto Fried, Sohn eines jüdischen Fleischers, wurde 1936 im Alter von 13 Jahren von seiner Familie zu Verwandten nach Portland im US-Bundesstaat Oregon geschickt, um ihn vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Auch den Eltern gelang noch 1939 die Flucht in die USA. Im Zweiten Weltkrieg diente der Sohn bei der US-Luftwaffe und begann danach 1947 in Portland ein Kunst- und Designstudium.
Rundgang zum Lebenswerk
Der Rundgang durch das Lebenswerk des heute 97-jährigen Künstlers beginnt mit einigen frühen Gemälden aus den 50er Jahren mit kubistischen Zügen. Sie lassen den Einfluss Fernand Légers erkennen, bei dem Fried von 1949 bis 1951 in Paris Unterricht nahm. Da ist etwa eine Landschaft mit Bergen, Häusern, einer Brücke und Strommasten - alles auf geometrische Formen reduziert. Fried wählt eine für die Zeit typische Farbgebung in gedeckten Grün-, Rotbraun- und Blautönen.
Nach seinem Aufenthalt in Paris lebte Fried zunächst in New York. Zu dieser Zeit ist die US-Metropole Zentrum des abstrakten Expressionismus, der mit Künstlern wie Jackson Pollock, Willem de Kooning oder Sam Francis internationalen Einfluss gewann. Fried bleibt davon unbeeindruckt. Er malt zunächst noch figurativ. Eine Strandszene etwa zeigt mit kreisrunden Sonnenschirmen und wellenförmigen Sandhügeln schon Anklänge seiner späteren abstrakten Formensprache. Eine Phase, in der er sich in den 60er Jahren mit Landschaften beschäftigte, ist in der Ausstellung kaum berücksichtigt. Grund sei, dass diese Bilder alle an Privatleute verkauft wurden und kaum noch auffindbar seien, erklärt Reifenscheid.
Kosmische Formensprache
Entscheidender für Frieds Werk scheint ohnehin die Entwicklung seiner abstrakten kosmischen Formensprache, zu der er Anfang der 70er Jahre findet. Die bereits in dem figurativen Strandbild aus den 50er Jahren angelegten Formen finden sich hier als abstrakte Kompositionen wieder: Die Kreise, Ringe und Scheiben gewinnen durch wolken- oder wellenförmige Strukturen Plastizität. Später löst er die Ringe weiter zu bogenförmigen Strukturen auf. Diese Form findet sich auch in seinen Skulpturen, die zum Teil aus Metallbögen zusammengesetzt sind. Spitzere, blitzartige Formen, die an eine Sternenexplosion erinnern, tauchen in seinen Assemblagen aus Holz, Blech und Papier auf sowie in einem aus farbgetränkten und bemalten Stofftaschentüchern zusammengesetzten Bild.
Die Ausstellung präsentiert Fried als Maler mit einem in sich schlüssigen Werk, an dem er unbeeindruckt von künstlerischen Strömungen seiner Zeit arbeitete. Sein Schaffen zeigt keinerlei Anklänge seines Flüchtlingsschicksals, obgleich zumindest ein Teil seiner Familie dem Nazi-Regime zum Opfer fiel. "Er hat sein Leid nie thematisiert, sondern wohl sublimiert", sagt Reifenscheid.
Fried lebte seit Anfang der 60er Jahre abwechselnd in Paris und New York, ist aber seit 2010 in der französischen Hauptstadt sesshaft. Seiner Heimatstadt Koblenz blieb er offenbar immer verbunden. 1958 stellte er schon einmal im Deutschherrenhaus, dem heutigen Ludwig Museum, frühe Werke aus. Er soll auch regelmäßig zum Wandern in die Region gekommen sein. 2002 stiftete Fried für die Sankt Maximin Kirche in seinem Heimatort Horchheim sein Ölgemälde "Leewärtige Illusion" (1986). Zur Ausstellungseröffnung im Ludwig Museum wollte Fried ursprünglich anreisen. Doch die Corona-Pandemie und sein hohes Alter machten ihm einen Strich durch die Rechnung. Letztlich sprechen seine Bilder auf besondere Weise für ihn. "Ein Bild besteht aus Farben und Formen und hat mit Worten wenig zu tun", sagte der Künstler selbst einmal.
documenta stellt Konzept vor
Kassel (epd). Die indonesische Künstlergruppe Ruangrupa, die die Weltkunstausstellung documenta 15 im Jahr 2022 in Kassel künstlerisch leiten wird, hat ihr Konzept vorgestellt. Dieses beruhe auf "lumbung", ein indonesisches Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird, teilte die Gruppe am 19. Juni auf der Internetseite der documenta mit. Die Werte und Ideen von "lumbung" sollen demnach den Werten und Ideen der Ausstellung zugrunde gelegt werden.
"lumbung" als künstlerisches und ökonomisches Modell lägen Werte wie Kollektivität, Großzügigkeit, Humor, Vertrauen, Unabhängigkeit, Neugier, Ausdauer, Regeneration, Transparenz und Genügsamkeit zugrunde, erklärte die Gruppe. "Wir haben ein ausgeprägtes Interesse daran, von anderen Konzepten und Modellen zu Erneuerung, Bildung und Ökonomie zu lernen und mit ihnen zu arbeiten", heißt es in der Erläuterung des Konzeptes.
Die Erfahrungen in der Reaktion auf die Corona-Pandemie habe die Künstlergruppe zudem dazu bewogen, nochmals über die Bedeutung von Solidarität nachzudenken. Angesichts der aktuellen Entwicklungen zeige sich das Konzept von "lumbung" mit seinen Werten von Solidarität und Kollektivität nun von größerer Bedeutung und Relevanz denn je. In Momenten, in denen so viele Menschen die Ungleichheit und Ungerechtigkeit der herrschenden Systeme zu spüren bekommen, könne "lumbung" neben vielen anderen Denkansätzen zeigen, dass die Dinge auch anders gelöst werden können, heißt es. Die documenta 15 findet vom 18. Juni bis 25. September 2022 statt.
Andrea Jahn neue Direktorin des Saarlandmuseums
Saarbrücken (epd). Die Kunsthistorikerin Andrea Jahn wird neuer kunst- und kulturwissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz und Leiterin des Saarlandmuseums. Gemeinsam mit Verwaltungsvorstand Philipp Schneider werde die bisherige Leiterin der Saarbrücker Stadtgalerie ab 1. Juli die Stiftung führen, teilte das Ministerium für Bildung und Kultur in Saarbrücken mit. Jahn folgt auf Roland Mönig, der am 1. April die Leitung des Von der Heydt-Museums in Wuppertal übernahm.
Kulturministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) erklärte, dass Jahn mit einem "innovativen und frischen Zukunftskonzept" überzeugt habe. Die Kunsthistorikerin wolle gemeinsam mit den Stiftungsbeschäftigten die Ausstellungskonzepte und die Museumspädagogik weiterentwickeln, das Marketing stärker in den Vordergrund setzen und die grenzüberschreitende Arbeit stärken. "Ich sehe bei allen Stiftungseinrichtungen großes Entwicklungspotenzial", betonte die Ministerin.
OB Conradt: großer Gewinn für Kultur im Saarland
Jahn lobte die Offenheit der Stadt für unkonventionelle künstlerische Positionen. "Das ist ein unschätzbarer Standortvorteil, der es möglich macht, ein großartiges Haus wie die Moderne Galerie, aber auch ein Museum für Vor- und Frühgeschichte konzeptuell ganz klar im 21. Jahrhundert zu positionieren", erklärte sie. "Gleichzeitig gilt es auch, das Deutsche Zeitungsmuseum und die Römische Villa Nennig als wertvolle Bestandteile der Stiftung nah in die Arbeit der Stiftung einzubinden und so eine gemeinsame Identität zu schaffen." Es gehe darum, das Profil und die Sichtbarkeit der Stiftung zu stärken und die Museen mit neuem Leben zu erfüllen.
Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) erklärte, dass der Weggang Jahns von der Stadtgalerie zwar schmerzlich sei, ihr Wechsel zur Stiftung aber ein "großer Gewinn für die Kultur im ganzen Saarland". "Wir setzen hier auf eine neue Qualität in der Kooperation von Stadt und Land", betonte er.
Jahn studierte in Tübingen, München, Florenz, Washington und New York. Sie promovierte über die US-amerikanische Bildhauerin Louise Bourgeois. Am Kunstmuseum Stuttgart und im Kunstverein Friedrichshafen war sie als Ausstellungskuratorin und Künstlerische Leiterin tätig, bevor sie 2012 nach Saarbrücken kam.
Kirchenmusikfest ION: Musik zwischen Einsamkeit und Hoffnung
Nürnberg (epd). Das Musikfestival ION (Internationale Orgelwochen Nürnberg) hat sein alternatives Konzept für das diesjährige Programm vorgestellt. Bereits im Mai hatten die Veranstalter wegen der Corona-Pandemie und der Einschränkungen für Veranstaltungen das Motto geändert. Es lautet jetzt "Nah bei dir". An neun Abenden zwischen dem 27. Juni und 5. Juli finden in den Nürnberger Innenstadtkirchen Konzerte statt, die sich auf einem Weg "von der Einsamkeit zu einer neuen Hoffnungsmaschine" befinden, hieß es.
Alle Abende werden als Livestream in Bild und Ton auf "www.musikfest-ion.d"e übertragen und bleiben nach den Konzertterminen abrufbar, hieß es. Für die diesjährige ION sei man auf der Suche nach "Konzertformaten für die Zukunft". Die Programmpunkte seien "tagesaktuell, diskursiv, modular und ein Stück weit unvorhersehbar", kündigen die Veranstalter an. Der Künstlerische Leiter Moritz Puschke und Dramaturg Oliver Geisler hätten für jeden der neun Abende Themen entwickelt.
Die Internationale Orgelwoche Nürnberg wurde von den Kirchenmusikern der beiden großen evangelischen Innenstadtkirchen in Nürnberg, St. Lorenz und St. Sebald, 1951 erstmals ausgerichtet. Sie gilt als eines der renommiertesten Festivals für Geistliche Musik und Orgelmusik in Europa. Der dazugehörige Orgelwettbewerb findet in diesem Jahr nicht statt.
Gedenkmünze für die "Maus"

epd-bild / Jens Schulze
Köln (epd). "Die Sendung mit der Maus" erhält laut WDR eine eigene Gedenkmünze. Das außergewöhnliche Sammlerstück soll zum 50. Geburtstag der Sendung im kommenden Jahr erscheinen, wie der Sender am 17. Juni in Köln mitteilte. Die 20-Euro-Münze des Bundes mit dem Konterfei der orangefarbenen WDR-Maus sei auch als offizielles Zahlungsmittel zu verwenden. Ihre Premiere hatten die beliebten "Lach- und Sachgeschichten" mit der Trickfilmfigur am 7. März 1971.
Inzwischen habe sich "Die Sendung mit der Maus" zu einer Marke entwickelt, die auf allen Plattformen ein generationenübergreifendes Publikum erreiche, erklärte der WDR. Viele Kinder wüchsen mit der Maus auf, im Fernsehen, im Radio, auch online und mobil. Besonders in Corona-Zeiten sei die werktägliche TV-Sendung auf große Resonanz gestoßen; auch die Nutzung der digitalen Maus-Angebote habe seither stark zugenommen.
Radebeuler Stadtrat wählt neue Kulturamtsleiterin
Radebeul (epd). Nach dem Rückzug des Schriftstellers Jörg Bernig (56) hat der Stadtrat im sächsischen Radebeul dessen Mitbewerberin Gabriele Lorenz zur Kulturamtsleiterin gewählt. Die Entscheidung für die aus dem Erzgebirge stammende 58-Jährige sei am 15. Juni mit großer Mehrheit in nichtöffentlicher Sitzung gefallen, teilte die Stadtverwaltung am 16. Juni mit. Die Romanistin, Germanistin und Ethnologin solle das Amt so bald wie möglich antreten.
Bernig, der mit der Neuen Rechten in Verbindung gebracht wird, war am 20. Mai als CDU-Kandidat offenbar auch mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden. Die Entscheidung des Stadtrates hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) legte wenige Tage danach sein Veto gegen die Wahl ein.
Der Autor und Lyriker Bernig soll unter anderen für die neurechten Publikationen "Tumult" und "Sezession" geschrieben haben. Zudem zählte er zu den Erstunterzeichnern der flüchtlingskritischen "Gemeinsamen Erklärung 2018".
Entwicklung
UN: Immer mehr Menschen auf der Flucht

epd-bild/Christian Ditsch
Genf (epd). Die Zahl der vor Gewalt und Konflikten geflüchteten Menschen hat laut den Vereinten Nationen einen neuen Höchststand erreicht. Weltweit seien 79,5 Millionen Kinder, Frauen und Männer Ende des vergangenen Jahres auf der Flucht gewesen, heißt es in dem am 18. Juni veröffentlichten Jahresbericht des Hilfswerks UNHCR. Menschenrechtler und Helfer forderten eindringlich mehr Einsatz, um Konflikte zu beenden, und deutlich bessere Unterstützung für Geflohene, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.
"Die Zahl der Menschen auf der Flucht entspricht einem Prozent der Weltbevölkerung", sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, vor dem Weltflüchtlingstag (20. Juni). "Niemals zuvor haben wir so viele Menschen auf der Flucht erfasst." Ende 2018 waren demnach 70,8 Millionen Menschen geflohen.
Vorwurf: Politische Untätigkeit
Die Zahl der Flüchtlinge sei ein vernichtendes Urteil über unverantwortliches, kraftloses und nationalistisches Regierungshandeln weltweit, kritisierte die NRC Flüchtlingshilfe. Ein Ende der politischen Untätigkeit im Umgang mit zahlreichen Kriegen auf der Welt sei dringend nötig.
Auch Amnesty International forderte die Politik zum Handeln auf. Während innerhalb der vergangenen zehn Jahre fast doppelt so viele Menschen zur Flucht gezwungen gewesen seien, seien in Europa immer weniger Mitgliedsstaaten bereit, Schutzsuchende aufzunehmen.
Der UNHCR-Bericht deckt das Jahr 2019 ab, neue Flüchtlingsbewegungen in diesem Jahr wie in Libyen sind noch nicht erfasst. Grandi ging jedoch auf die Corona-Pandemie ein, die auch die Menschen auf der Flucht bedroht. Zwar sei es in Flüchtlingsunterkünften noch nicht zu großen Corona-Ausbrüchen gekommen. Doch die Pandemie stürze viele Geflohene in noch tiefere wirtschaftliche Not.
Aufruf: Hilfe in Pandemie
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) wies darauf hin, dass 80 Prozent der Geflohenen in Regionen lebten, wo die Ernährungslage sehr kritisch sei, wie im Jemen oder in der Sahelregion. "Für viele Flüchtlinge ist die Corona-Krise bereits eine dramatische Hungerkrise", sagte Müller den Zeitungen der Funke Mediengruppe (18. Juni). 90 Prozent der weltweiten Flüchtlinge würden von Entwicklungsländern aufgenommen. Auch in Flüchtlingslagern seien die Zustände katastrophal: "Händewaschen, Abstand zu anderen, mit dem Ersparten über die Runden kommen – all das ist für Flüchtlinge nicht möglich."
Caritas und Diakonie Katastrophenhilfe riefen die Staaten auf, Flüchtlinge auch beim Kampf gegen die Pandemie im Blick zu haben. So hinderten Grenzschließungen viele Menschen daran, Schutz vor Gewalt und Verfolgung zu finden. "Die Möglichkeit auf Einreise in den Nachbarstaat, um das Leben zu retten, darf nicht einfach Corona-Maßnahmen geopfert werden", kritisierte der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher.
Flüchtlinge müssten weltweit in die reguläre Gesundheitsversorgung aufgenommen und bei Hilfsprogrammen im Rahmen der Corona-Pandemie mitgedacht werden, forderte die "Aktion gegen Hunger". In vielen Ländern seien sie von Nothilfemaßnahmen ausgeschlossen und könnten sich kaum mit dem Notwendigsten versorgen.
Neue Vertreibungen
Dass die Zahl der Geflohenen im vergangenen Jahr so deutlich stieg führte Grandi vor allem auf neue Vertreibungen im Kongo, in der Sahelregion, im Jemen und in Syrien zurück. Der mehr als neun Jahre tobende Konflikt in Syrien alleine habe mehr als 13 Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Vielen von ihnen droht der Welthungerhilfe zufolge eine Hungerkrise.
Gleichzeitig können laut Grandi immer weniger Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren, weil Konflikte wie in Syrien sehr lange andauern. Seien in den 1990er Jahren noch durchschnittlich pro Jahr 1,5 Millionen Menschen nach einer Flucht zurück nach Hause gelangt, sank diese Zahl im vergangenen Jahrzehnt auf 385.000.
Unter den Menschen auf der Flucht befinden sich den Angaben nach knapp 46 Millionen Binnenflüchtlinge: Sie versuchen sich innerhalb des eigenen Landes vor Gewalt und Repression in Sicherheit zu bringen. Knapp 30 Millionen Kinder, Frauen und Männer suchten als Flüchtlinge Schutz außerhalb ihrer Heimatländer. Rund vier Millionen Menschen befinden sich den Angaben nach in einem Bewerbungsverfahren für Asylschutz in einem fremden Land.
Maas mahnt Schutz von Flüchtlingen in der Corona-Krise an
Fast 80 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, mehr als je zuvor. In der Corona-Krise sind sie zusätzlichen Gefahren ausgesetzt, wie Außenminister Maas am Weltflüchtlingstag hervorhebt.Berlin (epd). Angesichts der Corona-Pandemie hat Außenminister Heiko Maas (SPD) einen verstärkten Schutz von Flüchtlingen gefordert. Am Weltflüchtlingstag am 20. Juni erklärte er in Berlin, gerade jetzt in der Corona-Krise seien Schutz und Versorgung von Flüchtlingen eine Notwendigkeit, die oft über Leben und Tod entscheide. "Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir daran, eine Ausbreitung des Virus unter Flüchtlingen, die oft unter besonders beengten Verhältnissen leben, zu verhindern." Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, forderte die Menschen in Deutschland zu Solidarität mit Flüchtlingen auf.
Maas sagte, die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikt und Verfolgung fliehen mussten, sei im vergangenen Jahr erneut gestiegen. 79,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder hätten ihre Heimat verlassen. Das entspreche etwa der Einwohnerzahl Deutschlands, "ein sehr trauriger neuer Rekordwert". Maas wies darauf hin, dass weniger als zehn Prozent der Flüchtlinge in Europa lebten. Die große Mehrheit finde Zuflucht in ihren Nachbarländern, die häufig selbst unter Krisen und Armut litten.
"Menschen, die weltweit von Flucht und Vertreibung betroffen sind, müssen ein Leben in Würde führen können", forderte Maas. "Und sie müssen die Möglichkeit bekommen, ihr Potenzial zu entfalten und einen positiven Beitrag in ihren Aufnahmegemeinde zu leisten. Dafür setzen wir uns weltweit ein."
Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, appellierte an die Bundesregierung, die Familienzusammenführung Geflüchteter zu erleichtern. «Familien gehören zusammen. Die Bundesregierung muss endlich unbürokratisch Familienvisa ausstellen», sagte sie der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (20. Juni). Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie werde die Situation für getrennte Familien oft noch verschärft. «Wenn Jugendliche volljährig werden, solange die Visa-Stellen an den deutschen Auslandsvertretungen noch geschlossen sind, können sie für immer das Recht verlieren, mit ihren Familien zusammenzuleben», erläuterte Göring-Eckardt.
Bedford-Strohm: "Verschließt euer Herz nicht"
Der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm rief zur Unterstützung für Menschen auf der Flucht auf. «Verschließt euer Herz nicht. Und helft», sagte Bedford-Strohm in einem am 20. Juni veröffentlichen Facebook-Video. «Indem ihr Menschen, die hier Zuflucht suchen, begleitet. Indem ihr euch politisch für mehr Solidarität mit Geflüchteten einsetzt. Indem ihr mit eurem Geld dazu beitragt, dass Menschen in Würde leben können, wo immer sie sind. Indem ihr für sie betet."
Die Präsidentin von "Brot für die Welt", Cornelia Füllkrug-Weitzel, forderte eine neue EU-Flüchtlingspolitik. Sie erwarte, dass die Bundesregierung die EU-Ratspräsidentschaft nutze, um "ganz entschiedene Schritte" dafür einzuleiten, sagte die Theologin, die künftig als Vorstandsvorsitzende das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung leiten wird, am 20. Juni im Berliner RBB-Inforadio. Faire Asylverfahren und eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen müssten europaweit durchgesetzt werden. Deutschland übernimmt die Ratspräsidentschaft am 1. Juli.
Friedensgutachten: Corona-Pandemie verschärft Konflikte weltweit
Die Corona-Krise bringt die Waffen nicht zum Schweigen, sondern führt vielerorts zu neuer Gewalt und Armut. Die Hauptlast der Pandemie tragen die Länder des Südens, betonen Friedensforscher. Zugleich fordern sie eine entschiedene Klimapolitik.Berlin (epd). Die Corona-Pandemie hat laut führenden Friedensforschern alarmierende Auswirkungen auf Krisenherde in der Welt. Die Bundesregierung müsse sich deshalb intensiv für die friedliche Überwindung von Gewaltkonflikten einsetzen, sagte der Bonner Friedensforscher Conrad Schetter vom International Center for Conversion (BICC) am 16. Juni bei der Vorstellung des Friedensgutachtens 2020 in Berlin.
Die an dem Gutachten beteiligten vier Forschungsinstitute rufen die Bundesregierung zugleich dazu auf, die Corona-Krise auch als Chance für eine Stärkung Europas und für eine entschiedene Klimapolitik zu nutzen. Mit Blick auf den Isolationismus der USA müsse über eine Sicherheits- und Friedenspolitik "jenseits der Nato" diskutiert werden, sagte Schetter.
Besonders wichtig sei eine Debatte über die nukleare Teilhabe Deutschlands, hob Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) hervor. Den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Teilabzug von US-Truppen aus Deutschland wertete sie "vor allem als Wahlkampfgetöse". Deitelhoff riet erst einmal zu Ruhe und Gelassenheit.
Die Bewältigung der Corona-Krise sollte laut den Friedensforschern auch als Chance genutzt werden, Schritte zu einer nachhaltigen Klimapolitik zu unternehmen. Denn der Klimawandel könne in vielen Regionen zu Konflikten führen oder diese verschärfen, etwa in Ost- und Westafrika, sagte Schetter.
Plädoyer für globale Strategie der Bundesregierung
Die Friedensforscher plädieren für eine globale Strategie der Bundesregierung, die multilaterale Institutionen stärkt und zivile Krisenprävention zum Leitbild erhebt. "Corona endet nicht an den europäischen Außengrenzen", betonte Schetter. In Afghanistan, Mali oder am Tschadsee breche neue Gewalt aus. Militär und Polizei zögen sich aus der Fläche zurück, während dschihadistische und lokale Milizen auf dem Vormarsch seien.
Eine Folge seien neue dramatische Fluchtbewegungen. Gleichzeitig seien internationale Friedensmissionen erschwert. "Die weltweite Krisendiplomatie kocht auf Sparflamme", sagte Schetter. Trotz des Aufrufs von UN-Generalsekretär António Guterres zu einem globalen Waffenstillstand gingen die Kämpfe in Libyen, Syrien oder Jemen unvermindert weiter. Friedensverhandlungen wie in Afghanistan kämen wegen der Corona-Krise zum Erliegen.
Zugleich führe die Corona-Pandemie zu neuen sozialen Verwerfungen wie einem Anstieg der Arbeitslosigkeit. So befürchte das Welternährungsprogramm eine Verdopplung der Zahl der Hungernden auf der Welt. Die Hauptlast trügen die Länder des Südens, sagte Schetter. Globale Hilfspakete seien notwendig.
Das Friedensgutachten erscheint jährlich seit 1987. Beteiligt sind die Friedensforschungsinstitute Bonn International Center for Conversion (BICC), das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) sowie das Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) der Universität Duisburg-Essen.
Nachtragshaushalt: 1,55 Milliarden Euro Corona-Hilfen für arme Länder
Berlin (epd). Das Bundeskabinett hat eine Milliarden-Finanzspritze für arme Länder in der Corona-Krise beschlossen. Die Ministerrunde brachte am 17. Juni in Berlin einen zweiten Nachtragshaushalt 2020 auf den Weg, der eine zusätzliche Neuverschuldung von rund 62,5 Milliarden Euro vorsieht - hauptsächlich für das Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise. Demnach sollen in diesem Jahr auch zusätzlich 1,55 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Pandemie, zum Ausbau der Entwicklungszusammenarbeit und für die gesundheitliche Vorsorge in Entwicklungsländern ausgegeben werden sowie für den wirtschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und afrikanischen Staaten.
Der Bundestag muss dem Entwurf noch zustimmen. Bis Ende 2021 sollen insgesamt vier Milliarden Euro Corona-Soforthilfen für arme Länder bereitgestellt werden: Noch einmal 1,55 Milliarden Euro sind im Bundeshaushalt 2021 vorgesehen, eine weitere Milliarde hat das Entwicklungsministerium durch Umschichtungen im eigenen Etat zur Verfügung. Ein großer Teil der Mittel fließt in die Grundversorgung insbesondere in Flüchtlingsregionen.
Gelder stehen außerdem für Maßnahmen in afrikanischen Partnerländern zur Verfügung. Der Fokus liegt auf den zwölf Staaten, die bei der Initiative "Compact with Africa" (Übereinkunft mit Afrika) mitmachen: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo und Tunesien. Sie verpflichten sich im Gegenzug dazu, Korruption zu bekämpfen.
Corona-Spendenaufruf für Kirchenmitarbeiter in Afrika und Asien
Bielefeld/Düsseldorf (epd). Die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen rufen ihre Mitarbeitenden zu Spenden für ihre Kolleginnen und Kollegen in Afrika und Asien auf. Bis zum Jahresende sollen die Gelder helfen, dass Mitarbeitende in von der Corona-Krise besonders betroffenen Partnerkirchen finanziell über die Runden kommen, teilten die Kirchen am 15. Juni mit. Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) übernehme die Vergabe der Gelder und achte auf eine faire Verteilung. Die VEM hat bereits mit finanzieller Unterstützung der westfälischen und der rheinischen Kirche einen Corona-Hilfsfonds eingerichtet.
Die rheinische Oberkirchenrätin Barbara Rudolph und der westfälische Oberkirchenrat Ulrich Möller haben den Spendenaufruf unterschrieben. Viele Gehälter könnten in den Partnerkirchen nicht mehr gezahlt werden, weil das kirchliche und schulische Leben fast zum Erliegen gekommen sei, heißt es in dem Schreiben. "Wenn keine Gottesdienste mehr stattfinden, werden auch Kollekten und Mitgliedsbeiträge der Gemeindeglieder nicht mehr eingesammelt." Auch Schulgebühren entfielen, wenn Kinder nicht zur Schule gehen könnten.
Das Finanzsystem der Kirchen sei fast völlig zusammengebrochen, erklärten sie. Gehaltszahlungen zum Monatsbeginn seien schwierig bis unmöglich. Pfarrerinnen, Lehrer und Angestellte in der Kirche stehen den Angaben zufolge vor einer doppelten Herausforderung: Sie sorgten sich um die Menschen, für die sie arbeiteten, und seien selber mit ihren eigenen Familien in Not. Viele Menschen in Afrika und Asien seien insbesondere durch die Schutzmaßnahmen arbeitslos geworden, könnten durch die Ausgangssperre nicht mehr ihre Felder bewirtschaften und ihren eigenen Verdienstmöglichkeiten nachgehen.
Füllkrug-Weitzel übernimmt Vorsitz im Werk für Diakonie und Entwicklung
Berlin (epd). Cornelia Füllkrug-Weitzel (65) übernimmt am 1. Juli den Vorstandsvorsitz im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung von Ulrich Lilie. Die Position geht turnusgemäß nach drei Jahren vom Präsidenten der Diakonie Deutschland auf die Präsidentin von "Brot für die Welt" und Diakonie Katastrophenhilfe über, wie das kirchliche Werk am 15. Juni in Berlin mitteilte. Diakonie-Präsident Lilie übernimmt den stellvertretenden Vorstandsvorsitz.
Füllkrug-Weitzel sieht das Werk vor großen Herausforderungen, erkennt aber auch Chancen: "Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Die Zukunft der Menschen im globalen Süden und bei uns ist eng miteinander verwoben. So wie das Covid19-Virus nur weltweit oder gar nicht besiegt werden kann, können Armut, soziale Ungerechtigkeit und die Folgen des Klimawandels auch nur weltweit und mit vereinten Kräften überwunden werden." Für diese vernetzte Arbeit stehe das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung.
Unter dem Dach des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung arbeiten Diakonie Deutschland, "Brot für die Welt" und die Diakonie Katastrophenhilfe. Neben Füllkrug-Weitzel und Lilie gehören dem vierköpfigen Vorstand Maria Loheide und Jörg Kruttschnitt an.
Unicef Deutschland: Große Spendenbereitschaft im Jahr 2019
Köln (epd). Das Deutsche Komitee für Unicef hat im Jahr 2019 deutlich mehr Spenden erhalten als im Vorjahr. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen erzielte im Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von rund 126,2 Millionen Euro aus Spenden und dem Verkauf der Unicef-Karten, wie Unicef Deutschland am 19. Juni in Köln mitteilte. Die Einnahmen liegen damit deutlich über dem Ergebnis des Vorjahres (111,6 Millionen Euro).
Zu dem positiven Gesamtergebnis und einem der weltweit höchsten Beiträge aus privaten Spenden zur Unicef-Programmarbeit für Kinder hätten rund 493.000 aktive Spender in Deutschland beigetragen, hieß es. Besonders wertvoll sei die kontinuierliche Hilfe aus inzwischen fast 291.000 Unicef-Patenschaften.
Die große Unterstützung der Bundesbürger ermögliche es Unicef in schwierigen Zeiten, an der Seite der Kinder zu stehen, erklärte der Vorsitzende von Unicef Deutschland, Georg Graf Waldersee. Gerade die weltweite Corona-Krise zeige, dass die Bedürfnisse von Kindern und jungen Menschen "noch immer viel zu oft eine nachgeordnete Rolle" spielten. Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssten ihren Einsatz für Kinder verstärken, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und die weitreichenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen für Kinder zu verringern.
Insgesamt konnte das Deutsche Komitee für Unicef in 2019 die weltweite Unicef-Hilfe für Kinder mit 94,22 Millionen Euro unterstützen. Dank der Spenden aus Deutschland konnte Unicef im vergangenen Jahr unter anderem lebensrettende Hilfe in Kriegs- und humanitären Krisengebieten wie Syrien, Jemen und dem Südsudan auf den Weg bringen. In Mosambik leistete die Organisation nach den schweren Wirbelstürmen schnelle Nothilfe. Ein weiterer Schwerpunkt waren Bildungsprogramme für benachteiligte Kinder, etwa in Afghanistan, der Elfenbeinküste, Nepal, Liberia und Malawi.
Kirchenkreis Bonn gibt 5.000 Euro für Partnerkreis in Tansania
Bonn (epd). Der Kirchenkreis Bonn hat 5.000 Euro Soforthilfe an den Partnerkirchenkreis "Kusini A" in Tansania überwiesen, die bei der Bewältigung der coronabedingten wirtschaftlichen Notlage helfen sollen. Auch mit der Kollekte am Partnerschaftssonntag wurde kirchenkreisweit für diesen Zweck gesammelt, wie der Kirchenkreis mitteilte. An 21. Juni gab es einen zentralen Gottesdienst im Kirchenkreis, der in der Johanniskirche in Bonn-Duisdorf gefeiert und online gestreamt auch in Tansania verfolgt werden konnte
Die Kirchenkreise Bonn und "Kusini A" im äußersten Nordwesten Tansania verbindet seit mehr als 40 Jahren eine Partnerschaft, die vor allem von gegenseitigen Besuchen lebt. "Gerade in den Zeiten, wo das durch die Corona-Pandemie nicht geht, soll unser gemeinsamer Gottesdienst die Brücke zwischen Bonn und Tansania stärken", erklärte Superintendent Pistorius im Vorfeld des Gottesdienstes. Es sei in dieser Zeit "besonders wichtig wie bereichernd, mit den Partnern weltweit im Kontakt zu bleiben".
Ausland
Kirchen äußern Kritik an Annexionsplänen Israels

epd-bild / Debbie Hill
Bielefeld/Bonn (epd). Die stellvertretende Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, kritisierte am 19. Juni die Pläne der israelischen Regierung zur Annexion palästinensischer Gebiete scharf. Eine solche Annexion sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht, erklärte Kurschus in Bielefeld unter Hinweis auf die Position der Evangelischen Mittelost-Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Die katholische Deutsche Bischofskonferenz sorgt sich um die Situation der Christen in Israel und Palästina. Die israelische Regierung hatte Anfang Juni angekündigt, Gebiete im Westjordanland zu annektieren.
Bischof Ludwig Schick (Bamberg) und Weihbischof Udo Bentz (Mainz) warnten davor, dass die arabischen Christen in der Region einmal mehr zwischen die Fronten geraten. "Sie werden in einer Konfrontation, die auch mehr und mehr religiös aufgeladen wird, kaum noch die Chance haben, vermittelnde Positionen zur Geltung zu bringen", erklärten beide laut einer Mitteilung der Bischofskonferenz am 19. Juni. Schick ist Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, Bentz Vorsitzende der Arbeitsgruppe Naher und Mittlerer Osten.
Kurschus schreibt an Bischof Sani Ibrahim Azar
Die Ankündigungen der israelischen Regierung würden den "radikalen Positionen in Israel und Palästina zuarbeiten" und die Gewalt neu aufflammen lassen, warnte Kurschus in einem Brief an den Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, Sani Ibrahim Azar. Ein solches Vorhaben gefährdet nach ihren Worten den Frieden, den Wohlstand und die Entwicklung der Gesellschaften im Nahen Osten.
Die Chancen auf eine Zweistaatenlösung würden durch das einseitige Vorgehen weiterhin minimiert, beklagte die westfälische Präses. "Besorgt nehmen wir wahr, dass das Ziel eines gerechten Friedens noch lange nicht greifbar ist", schreibt sie. Sie sicherte zu, "unseren Einfluss in Politik und Gesellschaft zur Geltung zu bringen". Auch Erzbischof Schick sieht die Zweistaatenlösung gefährdet. Er teile die große Sorge vor einer weiteren Destabilisierung der Region. Die Gefahr, dass eine Zweistaatenlösung außer Sicht gerate, wachse damit erheblich, erklärte er.
Schick und Bentz bekundeten ihre Solidarität mit den Patriarchen und Kirchenführern Jerusalems. In einem Aufruf vom 7. Mai 2020 hatten diese die Vereinten Nationen, Russland, die Europäische Union und die USA aufgefordert, auf die einseitigen Annexionspläne mit einer gemeinsamen, verbindlich terminierten Friedensinitiative im Einklang mit dem Völkerrecht zu reagieren. Bentz appellierte an die Bundesregierung, sich weiterhin mit allem Nachdruck für eine Einhaltung völkerrechtlich verbindlicher Abkommen sowie der entsprechenden UN-Resolutionen einzusetzen.
Erzbischof Schick betonte, in den Kirchen des Heiligen Landes breite sich große Anspannung und Unsicherheit aus. Viele Bischöfe aus der Region setzten ihre Hoffnung auf die Staats- und Regierungschefs der EU. Von ihnen werde erwartet, alle politischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Regierung Israels von Annexionsplänen abzubringen.
Jubiläum im Schatten der Pandemie

epd-bild/Marc Engelhardt
Genf (epd). Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, gilt als gewiefter Meister der Diplomatie. Er wägt seine Worte ab, rhetorische Schnellschüsse sind seine Sache nicht. Anfang Februar umriss der Portugiese die Schwerpunkte der UN-Aktivitäten für 2020 - das Jahr, in dem die Weltorganisation an ihre Gründung vor 75 Jahren erinnert. Damals ahnte Guterres noch nicht, welche globale Katastrophe sich im Jubiläumsjahr der Vereinten Nationen zusammenbraut: die Corona-Pandemie.
Der UN-Generalsekretär versprach, mit den Instrumenten der Diplomatie die Welt sicherer zu machen. Denn: "Ein Wind des Wahnsinns fegt über den Globus", warnte er mit Blick auf die vielen Konflikte mit Millionen Flüchtlingen, Verletzten und Toten: "Von Libyen über Jemen bis Syrien und darüber hinaus. Die Eskalation ist zurück." Guterres hätte mühelos weitere Konflikte auflisten können: Von Afghanistan über die Demokratische Republik Kongo bis zur Ukraine.
Guterres sagte es nicht laut, die Zuhörer wussten es aber: Die Vereinten Nationen spielen bei ihrem wichtigsten Ziel, der Schaffung von Frieden, nicht die Rolle, die viele Menschen bei ihrer Gründung vor 75 Jahren erhofft hatten. Zu viele Staaten, besonders die USA unter Präsident Donald Trump, China unter Präsident Xi Jinping und Russland unter Staatschef Wladimir Putin, stellen ihre nationalen Interessen rücksichtslos über das globale Gemeinwohl. Wegen dieses Versagens und der Corona-Pandemie ist die Stimmung bei den UN mit heute 193 Mitgliedsstaaten im Jubiläumsjahr sehr gedämpft.
Sicherheitsrat als Herzstück
Vor einem dreiviertel Jahrhundert, am 26. Juni 1945, unterzeichneten Vertreter von 50 Staaten im kalifornischen San Francisco die Charta der UN. Am 24. Oktober 1945 trat das Regelwerk in Kraft: Es war der Geburtstag der Weltorganisation. Angesichts des Schreckens des Zweiten Weltkrieges sollte der neue Staatenbund mit seinem Herzstück, dem Sicherheitsrat, eine Ära des gewaltlosen Miteinanders einleiten. "Künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren", wurde als Leitmotiv ausgegeben. Zwar trugen die UN seit 1945 zur Vermeidung "großer Kriege" bei und sie halfen vielen Kleinstaaten in einer gefährlichen Welt "zu überleben", wie der Außenminister Singapurs, Vivian Balakrishnan, sagt.
Doch selbst während der Corona-Pandemie, die bereits Hunderttausende Menschenleben auslöschte und die Welt ins wirtschaftliche und soziale Chaos stürzt, schweigen die Waffen auf den Schlachtfeldern nicht. Guterres hoffte auf die Gunst der Stunde und rief am 23. März angesichts der eskalierenden Pandemie alle Konfliktparteien "in allen Ecken der Welt" zu einem Waffenstillstand auf: "Es ist die Zeit bewaffnete Konflikte in einen Lockdown zu stecken und uns zusammen auf den wahren Kampf unseres Lebens zu konzentrieren." Das Ende der Kämpfe könnte Kräfte freisetzen, um das Coronavirus zu besiegen.
"Deprimierendes Desaster"
Die Bilanz des Guterres-Appells fällt ernüchternd aus. Zwar unterstützen weit mehr als 100 Länder und bewaffnete Gruppen die Initiative. Darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Doch fehlt dem Appell das entscheidende völkerrechtliche Siegel des Sicherheitsrates. Vor allem die Vetomächte USA und China verhindern eine rechtlich verbindliche Resolution zur Unterstützung des Appells. Es sei ein "deprimierendes Desaster", urteilt der UN-Experte der Friedensforschergruppe Crisis Group, Richard Gowan. "Der Globale Waffenstillstands-Appell war sehr vielversprechend", sagt er. Hätte sich der UN-Sicherheitsrat von Anfang an "entschlossen hinter den Aufruf gestellt, dann wäre mehr Unterstützung weltweit zusammengekommen".
Auch der Leiter der globalen Risiko-Bewertung des Genfer Zentrums für Sicherheitspolitik, Jean-Marc Rickli, betont: "Damit ist möglicherweise eine große Chance für eine etwas friedlichere Welt verspielt worden." Die USA und China dominierten das internationale politische System - und somit die UN. "Das Ganze ist eine harte Machtpolitik und reflektiert das oftmalige Versagen der UN, sich kollektiv auf Lösungen für globale Herausforderungen zu einigen."
UN-Menschenrechtsrat lässt Tod von George Floyd untersuchen
Genf (epd). Der UN-Menschenrechtsrat hat am 19. Juni in Genf eine Untersuchung des gewaltsamen Todes von George Floyd beschlossen. Die Entscheidung über die Resolution fiel einstimmig. Darin wird die Hochkommissarin für Menschenrechte außerdem aufgefordert, weitere Fälle von Polizeigewalt sowie systematischen Rassismus gegen Afrikaner und Menschen afrikanischer Herkunft zu untersuchen und einen entsprechenden Bericht vorzulegen.
Die ursprünglich geforderte Einrichtung einer internationalen Untersuchungskommission ließen die Antragsteller fallen. Auch werden die USA in dem Antrag nicht mehr ausdrücklich erwähnt. Dem Konsens über den Antrag in seiner veränderten Form schloss sich auch Deutschland an. Weil der Kampf gegen Rassismus eine globale Aufgabe sei, wende man sich aber gegen die Hervorhebung einzelner Staaten.
Der 46-jährige Afroamerikaner Floyd war am 25. Mai in Minneapolis (US-Staat Minnesota) von einem weißen Polizisten getötet worden, der sein Knie minutenlang auf den Hals des in Handschellen am Boden liegenden Mannes gedrückt hatte. Sein Tod hatte Burkina Faso als Vertreter der afrikanischen Nationen im Menschenrechtsrat zu dem Antrag veranlasst.
Neue Debatte um Hagia Sophia

epd-bild/Gerold Meppelink
Frankfurt a.M. (epd). Die Debatte um den religiösen Status der Hagia Sophia in Istanbul geht offenbar weiter. Der armenisch-apostolische Patriarch von Konstantinopel, Sahag Mashalian, habe die Idee befürwortet, den Status des antiken Sakralbaus als Gebetsstätte für Muslime und Christen wiederherzustellen, berichtete das deutsche Online-Portal der türkischen Zeitung "Hürriyet" am 15. Juni unter Bezug auf eine Twitterbotschaft des Patriarchen der türkischen Armenier. Die Hagia Sophia sollte als Kult- und Gebetsstätte, aber nicht als Museum erhalten werden, schrieb Mashalian. Führende Politiker in der Türkei wollen das heutige Museum in eine Moschee verwandeln.
Auf die Hagia Sophia erheben Christen wie Muslime gleichermaßen Anspruch. Die Hagia Sophia wurde als "Kirche der göttlichen Weisheit" im Jahr 537 geweiht und war fast ein Jahrtausend lang die christliche Hauptkirche Konstantinopels. Als die Türken 1453 die Stadt eroberten, wurde sie zur Moschee umfunktioniert. In den 1930er Jahren wandelte der türkische Staatsgründer Kemal Atatürk sie in ein Museum um.
"Simultan-Gotteshäuser"
Nach Angaben der Stiftung "Pro Oriente" in Wien erneuerte der armenisch-apostolische Patriarch Mashalian damit den bereits vor zehn Jahren vom Leiter des "Islamischen Forschungszentrums", Mehmet Akif Aydin, eingebrachten Vorschlag, die Hagia Sophia "simultan" für den christlichen und den muslimischen Gottesdienst zu nutzen. Solche "Simultan-Gotteshäuser" seien im ersten Jahrtausend im östlichen Mittelmeerraum durchaus üblich gewesen, fügte die Stiftung hinzu. Die Hagia Sophia solle wieder als "Ort des Gottesdienstes" dienen, meinte der Patriarch; sie sei groß genug, damit sowohl Christen als auch Muslime dort beten könnten.
Eine einseitige Re-Islamisierung der Hagia Sophia würde ihrer Berufung als einst bedeutendste Kirche der Christenheit nicht gerecht, zitiert die Stiftung "Pro Oriente" den Patriarchen. Er empfinde zudem die Anwesenheit von betenden Muslimen und Christen angemessener als die derzeitigen Besucherströme von schaulustigen, aber auch oft ehrfurchtslosen Touristen. "Mögen wir auch verschiedenen Religionen angehören, so dienen wir doch dem Einen Gott", so der Patriarch. Einer Meinungsumfrage des Forschungsinstituts "Areda Survey" zufolge sind laut "Pro Oriente" 73,3 Prozent der türkischen Bürger für eine Wiedereröffnung der Hagia Sophia für den islamischen Kultus, 22,4 Prozent sind dagegen, 4,3 Prozent haben keine Meinung.
Eurostat: EU stagniert beim Klimaschutz
Brüssel, Luxemburg (epd). Die Leistung der EU beim Klimaschutz hat laut Eurostat in den vergangenen Jahren stagniert. Die Union sei demnach nicht auf dem Weg, das Ziel von 40 Prozent weniger Treibhausgasen bis 2030 im Vergleich zu 1990 zu erreichen, heißt es in einem am 22. Juni veröffentlichten Bericht des EU-Statistikamtes in Luxemburg zu den UN-Nachhaltigkeitszielen. Grundlage waren Daten von 2013 bis 2018. Neue Pläne wie etwa der Europäische "Grüne Deal" wurden nicht berücksichtigt.
Bei den meisten der 17 Nachhaltigkeitsziele machte die EU laut Eurostat in den letzten fünf Jahren, für die Daten vorlagen, Fortschritte. Am erfolgreichsten war die Europäische Union demnach beim Ziel 16, welches Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen umfasst. Auch beim Kampf gegen Armut und im Bereich Gesundheit verbesserte sich die EU demnach stark. Bei der Geschlechtergleichheit machten die Statistiker dagegen sogar einen Rückschritt aus.
Die Vereinten Nationen haben die Nachhaltigkeitsziele 2015 verabschiedet, die EU bekennt sich ausdrücklich zu den 17 Zielen und 160 Unterzielen. Allerdings hat die EU-Kommission trotz entsprechender Forderungen von Europaparlament und europäischen Regierungen noch keine umfassende Strategie zur Umsetzung vorgelegt. Eurostat misst Fort- und Rückschritte nach einem komplizierten System, welches teils auf von der EU selbst gesteckte Ziele und Indikatoren zurückgreift.

