Kirchen
Neuer Institutsdirektor ermutigt Kirche zu Experimenten

epd-bild/Jens Schulze
Hannover (epd). Der neue Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Georg Lämmlin, hat die Kirchen angesichts zurückgehender Mitgliederzahlen zu mehr Offenheit und Experimenten ermutigt. Sich auf neue Formen einzulassen, könne eine positive Bewegung in Gang bringen, sagte Lämmlin dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Da entsteht etwas, das immer weiter führt, selbst wenn es Rückschläge gibt." Lämmlin (60) wurde am 24. Januar in Hannover in sein neues Amt eingeführt. Das Sozialwissenschaftliche Institut begleitet und kommentiert aktuelle Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft.
Der Theologe lobte den Mut einer Kirchengemeinde in Oldenburg-Ohmstede, die sich nach zweijähriger Beratung unter anderem dafür entschieden hatte, ihren Hauptgottesdienst künftig nicht mehr am Sonntagmorgen, sondern am Sonntagabend zu feiern. "Das Vielversprechende liegt darin, es auszuprobieren", sagte er. Am Ende werde sich zeigen, ob das Ergebnis stimmig für die Menschen vor Ort sei.
Lämmlin warnte die Kirche davor, nur in Passivität zu verharren und in einen "Rückzugszirkel" zu geraten: "Das wird am Ende dazu führen, dass es einen noch weiteren Abstieg gibt." Wenn sie sich zu sehr an althergebrachten Ordnungen festklammere, verbaue sich die Institution ihre Zukunftschancen.
"Spirituelle Bedürfnisse"
"Die Kirche hat für die immer stärker individualisierte Gesellschaft eine ganz wichtige Botschaft", sagte Lämmlin. Sie habe gerade in der heutigen Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle, indem sie deutlich mache, dass jeder dazugehöre und niemand zurückgelassen werden dürfe. "Sie hat im Moment noch nicht die richtigen Kommunikationsformen, um alle zu erreichen. Aber die kann sie entwickeln."
Als Beispiele nannte Lämmlin neue Formen der Taufe, etwa an Gewässern als Tauffest unter freiem Himmel. "So wird deutlich, dass die Kirche den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommt." In lebensbiografischen Festen lägen große Chancen für die Kirchen: "Weil Glaube an lebensgeschichtliche Ereignisse anknüpft."
Auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen und so positive "Resonanzen" zu schaffen, bedeute nicht, den Menschen nach dem Mund zu reden, betonte der Theologe. "Den Menschen haben spirituelle Bedürfnisse, aber das Bedürfnis ist noch nicht die Antwort."
Georg Lämmlin war zuvor Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll in der Nähe von Stuttgart. 2011 übernahm er die Leitung des Theologischen Instituts der Universität Mannheim. Seit 2014 lehrte er als außerplanmäßiger Professor für Praktische Theologie in Heidelberg.
Neuer Leiter des Evangelischen Büros NRW eingeführt

epd-West/Gerald Biebersdorf
Düsseldorf (epd). Spitzenvertreter von Politik und evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben die Bedeutung ihrer Zusammenarbeit für das Gemeinwesen hervorgehoben. "Staat und Kirche geht es gemeinsam um das Wohl der Menschen und den Zusammenhalt in der Gesellschaft", sagte der stellvertretende Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) am 21. Januar in Düsseldorf beim Wechsel im Amt des Evangelischen Beauftragten bei Landtag und Landesregierung. Die NRW-Regierung sei dankbar für das kirchliche Engagement etwa in den Bereichen Bildung und Wohlfahrtspflege: "Sie sind ein wichtiger Partner für uns."
Der 51-jährige Theologe Rüdiger Schuch wurde zuvor in einem Gottesdienst als neuer Leiter des Evangelischen Büros eingeführt. Er pflegt nun die Verbindungen der drei evangelischen Landeskirchen in NRW zu Landtag und Landesregierung und hält Kontakt zu Parteien und Verbänden. Schuchs Vorgänger Thomas Weckelmann (46) wurde in dem Gottesdienst verabschiedet, er war als Abteilungsleiter ins Familienministerium gewechselt. Weckelmann leitete die Vertretung von rheinischer, westfälischer und lippischer Kirche in der Landeshauptstadt seit 2013.
NRW-Regierung und Parlament würdigen Zusammenarbeit mit Kirchen
Landtagspräsident André Kuper (CDU) hob die Bedeutung des Beauftragten als Ansprechpartner für die Politik hervor."Es ist wichtig, sich regelmäßig miteinander auszutauschen über die Fragen unserer Zeit, in der wir einstehen müssen für unsere Institutionen und für unsere Demokratie", sagte er. Die Demokratie sei nicht selbstverständlich und müsse verteidigt werden.
Für die SPD-Fraktion sagte Landtags-Vizepräsidentin Carina Gödecke, Schuch sei nun als "Lobbyist des Gemeinwohls" eine "gewichtige Stimme in demokratischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen". Er könne dazu beitragen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu festigen.
Die westfälische Präses Annette Kurschus nannte Schuch einen Mann der Kirche mit weitem Horizont. Er sei als "theologische Stimme" der evangelischen Kirchen in NRW "Grenzgänger zwischen Staat und Kirche" und Vermittler zwischen gesellschaftlichen und kirchlichen Themen. Sein Auftrag sei, Gottes Verheißung "als Gegen-Gift gegen die Verrohung und den Hass und die Angst um uns herum in die Debatten zu streuen".
Der rheinische Präses Manfred Rekowski dankte Weckelmann für sein Wirken als Seelsorger und Kirchenbeauftragter, er sei ein gefragter Gesprächspartner der Politik gewesen. Die Positionen der evangelischen Kirchen habe er stets klar und prägnant in den politischen Diskurs eingebracht.
Schuch kündigte an, er wolle zusammen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren als Partner der Politik agieren. Die Botschaft des Evangeliums sei immer auch politisch. Es gehöre zur Verantwortung der Christen, sich für eine menschengerechte Gesellschaft und eine lebenswerte Welt einzusetzen. Der Beauftragte wies darauf hin, dass der säkulare Staat den Kirchen eine wichtige Rolle zumesse, die auch in einer pluralen Gesellschaft an Bedeutung nichts einbüße.
Stamp erklärte vor den Kirchenvertretern seine Unterstützung für Seenotrettung, niemand dürfe im Meer ertrinken. Zugleich lehnte er die Aufnahme von Bootsflüchtlingen über die festgelegten Verteilungsquoten hinaus erneut ab. Eine Reihe von Städten des Bündnisses "Sichere Häfen" will mehr geflüchtete Menschen etwa aus Lagern in Griechenland aufnehmen, als sie nach ihrer Aufnahmequote müssten.
Zur Person: Evangelischer Beauftragter Rüdiger Schuch
Der 51-jährige Theologe Rüdiger Schuch wurde am 12. Dezember 1968 in Dortmund geboren. Er studierte in Bochum, Tübingen und Wuppertal Theologie und machte sein Vikariat in Wuppertal und Ahaus, anschließend war er Gemeindepfarrer in Hagen und Iserlohn.
Von 2006 bis 2013 stand Schuch als Superintendent an der Spitze des Kirchenkreises Hamm. Von 2014 bis 2019 war er Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Perthes-Stiftung, einer großen diakonischen Einrichtung mit Sitz in Münster. In der Evangelischen Kirche von Westfalen war Schuch unter anderem Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für politische Verantwortung. Er gehört mehreren diakonischen Leitungsgremien an.
Der neue Leiter des Evangelischen Büros in Düsseldorf arbeitete auch als Dozent an der Führungsakademie für Kirche und Diakonie in Berlin. Er erwarb zudem Qualifikationen in Personalführung, Organisationsstruktur und Betriebswirtschaft. Schuch ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Bedford-Strohm: Können Flüchtlinge nicht ertrinken lassen

epd-bild/Heike Lyding
München (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat das Engagement seiner Kirche bei der Seenotrettung von Flüchtlingen verteidigt. "Wir wollen, dass die Menschen sicher und in Würde leben können. Man kann sie nicht aus politischen oder Abschreckungsgründen ertrinken lassen", sagte der bayerische Landesbischof am 23. Januar im Münchner Presseclub. Die EKD hatte im Dezember angekündigt, sich im Bündnis "United 4 Rescue", das sich aktuell um die Ersteigerung eines Schiffes bemüht, an der Seenotrettung zu beteiligen.
"Die Kirche ist aber nicht Reeder - wir wissen, was wir können und was wir nicht können", erläuterte Bedford-Strohm. Man wolle sich an der zivilen Seenotrettung beteiligen, weil die staatliche beendet worden sei. Wenn er den Vorwurf höre, die Kirche solle lieber Fluchtursachen bekämpfen, als in die Seenotrettung einzusteigen, dann glaube er, er sei im "falschen Film", sagte Bedford-Strohm. Die Kirchen betrieben seit Jahrzehnten durch ihr internationales Netzwerk Entwicklungsarbeit und machten auf Ungerechtigkeiten aufmerksam.
Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen
"Ich lasse mir nicht sagen, wir müssten uns endlich mal um Afrika kümmern", sagte Bedford-Strohm weiter. Und er lasse sich auch nicht sagen, dass die Kirchen sich endlich mal um die Obdachlosen in Deutschland kümmern sollten. "Den Kirchen vorzuwerfen, sie würden sich nicht um die Armen in Deutschland kümmern, das grenzt ans Absurde." Die Diakonie tue genau das jeden Tag. Bedford-Strohm hatte vor allem wegen seines Engagements in der Seenotrettung Morddrohungen erhalten, wie er vor wenigen Tagen mitgeteilt hatte. Er wisse, dass er in manchen Kreisen eine "Hassfigur" sei, sagte der EKD-Ratsvorsitzende. Aber innerlich bewegten ihn solche Drohungen nicht.
Bedford-Strohm plädierte außerdem dafür, Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen. Angesichts eines Haushaltsüberschusses von 19 Milliarden Euro könne man nicht sagen, dass sich Deutschland die Aufnahme nicht leisten könne: "Wer so etwas sagt, soll sich nicht mehr mit dem Prädikat 'christlich' schmücken oder vom 'christlichen Abendland' sprechen." Deutschland sei, materiell gesehen, gesegnet wie noch nie. Wenn in dieser Situation jemand meine, man solle erst die Armen im eigenen Land versorgen, bevor man den Menschen anderswo helfe, dann habe jemand die Bedeutung von "christlich" nicht verstanden. Ihn erreichten oft Briefe mit solcher Kritik.
Gemeinsame Kraft der Kirchen
Der Landesbischof betonte im Münchner Presseclub auch die gemeinsame Kraft der Kirchen. "Es gibt keine Zukunft der Kirche, außer einer ökumenischen." Für ihn sei es ein "Skandal", dass die Kirche Jesu Christi in Einzelkirchen aufgeteilt ist. Er werde sich nie damit zufrieden geben, dass es immer noch kein gemeinsames Abendmahl gibt. Denn es gebe nur einen Gott - keinen evangelischen oder katholischen. Es gebe auch kein evangelisches oder katholisches Leid, sondern nur menschliches. Darauf müssten die Kirchen gemeinsam reagieren und nicht doppelt nebeneinanderher arbeiten.
Angesichts sinkender Mitgliedszahlen rief Bedford-Strohm die Kirchen zu "entschlossener Gelassenheit und gelassener Entschlossenheit auf". Derzeit gehörten rund 45 Millionen Menschen in Deutschland einer christlichen Kirche an; wenn die Zahl in 40 Jahren auf 22 Millionen zurückgehe, sei das immer noch "sensationell". Dennoch dürfe Kirche nicht davon ausgehen: "Der alte Tanker ist gesetzt und die Menschen müssen sich fügen." Es sei genau andersherum: Kirche müsse sich nach den Bedürfnissen der Menschen richten. "Wir müssen rausgehen und nicht in kirchlichen Milieus bleiben."
Menschenrechts-Experte Bielefeldt: Politik muss zumuten

epd-bild / Friedrich Stark
Bonn (epd). Politik muss den Bürgern nach Ansicht des Menschenrechts-Experten Heiner Bielefeldt etwas abverlangen. "Ohne Zumutung wird Politik Glaubwürdigkeit und Vertrauen nicht mehr erarbeiten können," warnte Bielefeldt am 20. Januar auf dem gemeinsamen Neujahrsempfang der kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor in Bonn. Wer Menschen aus Angst vor der populistischen Konkurrenz Zumutungen ersparen wolle, habe den Glauben an die Demokratie schon aufgegeben, sagte der Erlanger Menschenrechtsforscher. "Zumutungen müssen aber erklärt und gerecht verteilt werden."
Angesichts der eklatanten Ungleichheit der Lebenschancen in verschiedenen Regionen der Erde sei es Aufgabe der Politik, eine weltbürgerliche Friedensordnung zu gestalten, forderte der Professor der Universität Erlangen-Nürnberg. "So wie man in der Feudalgesellschaft irgendwann nicht mehr akzeptieren wollte, dass der Geburtsstand über alles entscheidet, so wird es immer weniger plausibel sein, dass die Lebenschancen der Menschen in so drastischer Weise vom Geburtsort abhängig sein sollen." Gerade die Menschen in den ärmsten Ländern litten am meisten unter dem Klimawandel. Die Klimakrise sei auch eine Gerechtigkeitskrise. "Hier wird das Verursacherprinzip auf den Kopf gestellt."
"Politisierung der Gesellschaft wie lange nicht mehr"
Bielefeldt sieht aber Grund zur Hoffnung, dass große Teile der Gesellschaft bereit seien, Zumutungen zugunsten einer gerechteren Weltordnung zu akzeptieren. "Wir erleben derzeit eine Politisierung der Gesellschaft wie man sie so lange nicht mehr gesehen hat." Beispiele seien etwa die große "Unteilbar"-Demonstration in Berlin im Oktober 2018 gegen Rassismus oder die Klimaproteste der Schüler- und Studentenbewegung "Fridays for Future", die auch von vielen Älteren unterstützt werde.
Zugleich gebe es Steigerungen bei der Wahlbeteiligung, zum Beispiel einen zehnprozentigen Zuwachs bei den Europa-Wahlen. Das noch vor einigen Jahren verbreitete Gefühl, dass bestimmte institutionelle Weichenstellungen irreversibel seien, habe sich gewandelt, beobachtete Bielefeldt. "Mittlerweile haben wir festgestellt, dass es Alternativen gibt."
EKD will verstärkt auf Konfessionslose zugehen
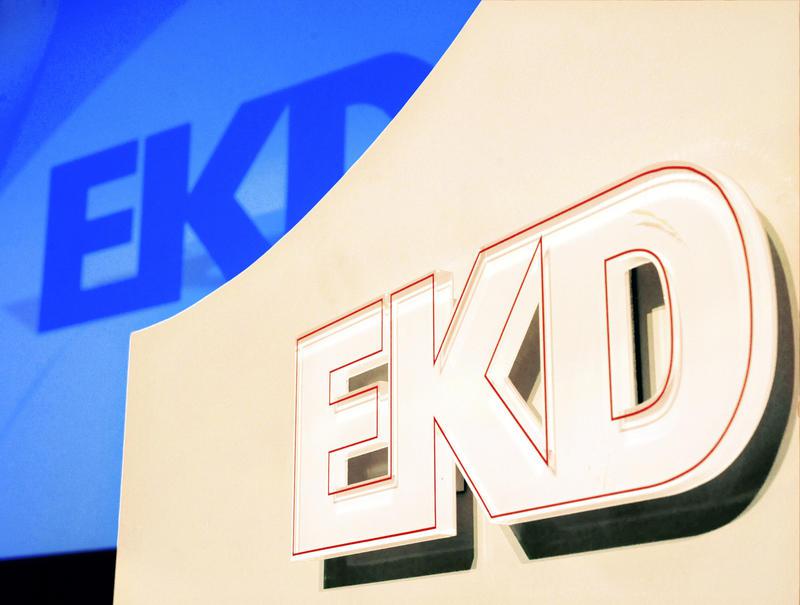
epd-bild/Hanno Gutmann
Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) möchte in Zukunft verstärkt mit Konfessionslosen in Kontakt treten. Man wolle unter anderem den Raum für Auseinandersetzung eröffnen und die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer Kommunikation des Evangeliums verbessern, heißt es in dem am 20. Januar in Hannover veröffentlichten Grundlagentext "Religiöse Bildung angesichts von Konfessionslosigkeit - Aufgaben und Chancen". Erstmals stünden Konfessionslose damit systematisch im Mittelpunkt einer EKD-Veröffentlichung, betont der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im Vorwort des Textes.
Als konfessionslos werden Menschen bezeichnet, die weder katholisch, evangelisch, jüdisch, muslimisch sind noch einer anderen religiösen Weltanschauung angehören. 30 Millionen Menschen gehören nach Zahlen der EKD in Deutschland derzeit keiner Religionsgemeinschaft an. Sie machen etwa ein Drittel der Bevölkerung aus, wobei der Anteil je nach Region sehr stark schwankt. In den ostdeutschen Bundesländern liegt dieser Anteil teilweise bereits heute zwischen 70 und 90 Prozent. Lange sei Konfessionslosigkeit als primär ostdeutsches Phänomen in den Blick genommen worden, heißt es in dem Text. Das werde den gegenwärtigen Entwicklungen jedoch nicht mehr gerecht.
Schwindende Kirchenbindung
Der demografische Wandel und das Austrittsverhalten vor allem junger Erwachsener sind die Ursache für eine schwindende Bindung an die Kirche. Seit Jahren sterben mehr Kirchenmitglieder, als getauft werden. Das bedeutet, dass in den jüngeren Generationen, Religionszugehörigkeit nicht mehr "vererbt" wird. Das Problem betrifft augenblicklich die evangelische Kirche stärker als die katholische.
Die EKD definiert in ihrem Text zehn Maßnahmen, wie und wo sie Konfessionslose besser erreichen kann. Als erste Maßnahme wird die Unterstützung religiöser Sozialisation und Erziehung genannt. Außerdem will man stärker als bisher Fragen der Lebens- und Weltdeutung konfessionsloser Menschen identifizieren und theologisch bearbeiten. Das komme auch Theologie und Kirche zugute, da es sich um Themen handele, die auch Christinnen und Christen beträfen.
Die Maßnahmen seien von der Hoffnung getragen, konfessionslose Menschen für den (Wieder-)Eintritt in die evangelische Kirche zu gewinnen. Die Auseinandersetzung mache aber auch deutlich, dass das Recht auf negative Religionsfreiheit auch in den Augen der evangelischen Kirche ein hohes Gut sei.
Superintendent Wüster nach 20-jähriger Amtszeit verabschiedet
Bonn (epd). Nach 20 Jahren an der Spitze des Evangelischen Kirchenkreises Bonn ist der Theologe Eckart Wüster am 24. Januar als Superintendent verabschiedet worden. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, sagte im Festgottesdienst, Wüster habe seine kirchlichen Ämter auf den unterschiedlichen Ebenen über viele Jahre in herausragender Weise ausgeübt.
Wüster war im Jahr 2000 zum Superintendenten gewählt und danach zweimal im Amt bestätigt worden, seit 2007 gehörte er zudem der Kirchenleitung der rheinischen Landeskirche an. Im März geht der 65-jährige Pfarrer der Kirchengemeinde Hersel, gebürtiger Wuppertaler und verheirateter Vater von vier erwachsenen Töchtern, in den Ruhestand.
Brückenbauer zwischen Kirche und Stadtgesellschaft
Der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) würdigte Wüster als einen Brückenbauer zwischen Kirche und Stadtgesellschaft, der sich für die Menschen engagiert und auch die Ökumene vorangebracht habe. Wüsters Namen verbinde sich unter anderem mit dem Neubau des Kirchenpavillons vor der Kreuzkirche mit Sozialberatung, Café und Kircheneintrittsstelle und mit der 200-Jahr-Feier der evangelischen Kirche in Bonn 2016, sagte Sridharan laut Redetext.
Der katholische Stadtdechant Wolfgang Picken lobte, Wüster habe die Zusammenarbeit zwischen evangelischer und katholischer Kirche in der Bundesstadt Bonn in herausragender Weise geprägt. Mit Engagement und Verbindlichkeit habe er dafür Sorge getragen, dass Ökumene in Bonn geschwisterlich erlebbar sei.
Wüsters Nachfolger als Superintendent ist der 53-jährige Pfarrer Dietmar Pistorius aus Troisdorf. Er wird am 13. März in sein Amt eingeführt. Der Kirchenkreis Bonn umfasst elf Kirchengemeinden in Bonn, Alfter und Bornheim mit insgesamt knapp 47.000 Gemeindemitgliedern.
Drei Bewerber für Bischofsamt in Sachsen

epd-bild/privat.evlks/Steffen Giersch/Maike Glöckner
Dresden (epd). Die Kandidatenliste für die Bischofswahl in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens ist komplett: Aus den Reihen der Landessynode ist zum Vorschlag der Kirchenleitung ein weiterer Bewerber dazugekommen. Demnach tritt auch der Meißener Superintendent und Dompfarrer Andreas Beuchel (56) bei der Wahl für das neu zu besetzende Bischofsamt an, wie die Landeskirche am 21. Januar in Dresden mitteilte. Damit stellen sich Ende Februar drei Personen zur Wahl.
Die Leitung der sächsischen Landeskirche hatte bereits am 10. Januar mit der Plauener Superintendentin Ulrike Weyer (46) und dem sächsischen Oberlandeskirchenrat Tobias Bilz (55) zwei Kandidaten benannt. Der 56-jährige Beuchel war von 2007 bis 2015 Rundfunk- und Senderbeauftragter der evangelischen Landeskirchen beim MDR.
Wahl auf Sondersynode
Der 55-jährige Bilz leitet seit Anfang 2019 im Landeskirchenamt das Dezernat für Kirchliche Werke und Einrichtungen, Seelsorge, Gemeindeaufbau und Medien. Die 46-jährige Weyer ist seit 2015 Superintendentin im Kirchenbezirk Plauen.
Die neue sächsische Bischöfin oder der neue Bischof soll auf einer Sondersynode am 29. Februar und 1. März in Dresden gewählt werden. Die Kandidaten stellen sich Anfang Februar in drei öffentlichen Foren in Dresden, Chemnitz und Leipzig vor.
Der bisherige Landesbischof Carsten Rentzing (52) war Ende Oktober aus dem Amt ausgeschieden, nachdem antidemokratische Texte aus seiner Studienzeit bekanntgeworden waren. Das sächsische Landeskirchenamt stufte diese als "elitär, in Teilen nationalistisch und demokratiefeindlich" ein.
Methodisten wollen Streit um Homosexualität beilegen

epd-bild/Stephan Wallocha
Frankfurt a.M. (epd). Die weltweite Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) steht vor einer Spaltung. Konservativ und traditionell orientierte Christen wollen sich von der Kirche abtrennen. Damit soll die jahrzehntelange Auseinandersetzung um die Einbindung lesbischer und schwuler Christen in der Freikirche beigelegt werden. Endgültig entschieden wird über den Vorschlag einer internationalen Mediatorengruppe im Mai in den USA. Der Weltrat Methodistischer Kirchen verbindet rund 51 Millionen Menschen. Die Evangelisch-methodistische Kirche (EmK) in Deutschland zählt rund 51.000 Gläubige. Der Methodismus bildete sich im 18. Jahrhundert in England als Erweckungsbewegung.
In Deutschland sucht man einen anderen Weg: Die Chancen, dass die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland trotz grundlegender unterschiedlicher Überzeugungen in diesen Fragen die Einheit bewahren kann, stehen gut, sagte deren Bischof Harald Rückert dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ein dazu eingesetzter Runder Tisch mit Vertretern der unterschiedlichen Überzeugungen ist nach elf Monaten Arbeit zu einem einstimmigen Vorschlag gekommen. Ein Teil des Vorschlags ist die Außerkraftsetzung der wenigen restriktiven Passagen der Kirchenordnung im Blick auf Segnung und Ordination gleichgeschlechtlich lebender Menschen.
Verbandsgründung erwogen
Ein zweiter Teil ist die Möglichkeit der Gründung eines Verbunds, der traditionellen Gemeinden und Einzelpersonen in Zukunft eine Heimat bietet. Strukturell wäre dieser Verbund "vergleichbar mit anderen Werken und Einrichtungen, die wir in unserer Kirche haben, die gewisse Freiheiten, auch personelle Ausstattung bekommen, aber zugleich fest mit der Evangelisch-methodistischen Kirche verbunden sind", fügte Rückert hinzu. Eine Entscheidung über diese neue Struktur soll im November auf der für die Belange in Deutschland zuständigen Zentralkonferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche fallen.
Wittenberger "Judensau" vor Gericht

epd-bild/Jens Schlüter
Naumburg (epd). Die Berufung gegen ein Urteil zum Verbleib der antisemitischen Schmähplastik an der Wittenberger Stadtkirche wird voraussichtlich wenig Erfolg haben. Der Vorsitzende Richter des Oberlandesgerichtes Naumburg, Volker Buchloh, erklärte in der Verhandlung am 21. Januar, das Gericht beabsichtige, die Berufung zurückzuweisen. Es bestehe kein Zweifel daran, dass das Sandsteinrelief zur Zeit seiner Entstehung dazu diente, Juden verächtlich zu machen. Das Relief allein mit der Darstellung der Sau und der Juden sei eine Herabwürdigung von Juden. Der Richter verwies aber darauf, dass die mehr als 700 Jahre alte "Judensau" in ein Gesamtensemble mit einem Mahnmal eingebunden sei. Damit sei eine Beleidigung objektiv nicht mehr gegeben.
Kläger: Relief ins Museum
Der Kläger, Michael Düllmann, ist Mitglied einer jüdischen Gemeinde und verlangt indes die Abnahme der Plastik. Aus seiner Sicht könnte die "Judensau" in einem Museum untergebracht und dort entsprechend eingeordnet werden. Er sieht sich durch die Plastik als "Saujude" und das "ganze Judentum" diffamiert. Der gebürtige Sachsen-Anhalter erklärte mit Blick auf die beklagte Evangelische Stadtkirchengemeinde als Eigentümerin der Kirche in der Lutherstadt: "Ich mache Sie dafür verantwortlich." Das vorhandene Mahnmal aus den 1980er Jahren lehnt Düllmann ab. Er hält es für verfälschend: "Schämen Sie sich."
Düllmann sieht "einen gewaltigen Unterschied", ob die "Judensau" an der Stadtkirche verbleibt oder in ein Museum, beispielsweise in das Lutherhaus, wandert. Im Museum hätte die Plastik eine aufklärerische Wirkung, an der Stadtkirche dagegen eine "aufhetzende Wirkung", sagte er und verwies unter anderem auf das Museum Yad Vashem, in dem man aufgeklärt und eben nicht beleidigt werde. Stadtkirchenpfarrer Johannes Block äußerte vor Gericht zunächst Bedauern und erinnerte daran, dass die Stadtkirchengemeinde nicht Auftraggeber der Schmähplastik, sondern nur deren Erbe sei.
"Stätte der Mahnung"
Vor mehr als 30 Jahren habe sich die Gemeinde bereits für die Errichtung des Mahnmals vor der Stadtkirche entschieden, so Block. Die Memorialgeschichte sei aber noch nicht abgeschlossen. Es sei angedacht, die "Stätte der Mahnung" weiterzuentwickeln und mehr Schritte in Richtung Versöhnung zu gehen, betonte er. "Wir wollen mit dem Originalstück an die Geschichte erinnern. Für diesen Weg haben wir uns entschieden." Zu Düllmann gerichtet sagte Block: "Wir wollen eigentlich das Gleiche." Seine Gefühle und Aggression könne er nachvollziehen, ergänzte er.
Das Urteil wird am 4. Februar um 15 Uhr im Oberlandesgericht Naumburg verkündet. Sollte die Berufungsklage abgewiesen werden, könnte der Kläger noch Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe einlegen, so das Gericht die Revision zulässt. Der Richter deutete am Dienstag bereits an, dass der BGH darüber entscheiden könnte, da es nicht nur einen Fall an der Wittenberger Stadtkirche, sondern noch an vielen anderen Kirchen, unter anderem am Erfurter Dom und am Magdeburger Dom, solche Schmähplastiken gebe.
Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte am 24. Mai 2019 die Klage abgewiesen, weil es den Tatbestand der Beleidigung nicht als erfüllt ansah.
Hanweiler Hakenkreuzglocke in Saarbrück ausgestellt
Saarbrücken (epd). Die frühere Hakenkreuz-Glocke der evangelischen Erlöserkirche im saarländischen Hanweiler ist aktuell in der Ausstellung "Protestanten ohne Protest" in der Saarbrücker Ludwigskirche zu sehen. "Zerstören darf man so was nicht. Es ist ein Stück der Kultur, wenn auch einer Unkultur, aber einfach eine historische Entwicklung, der man sich stellen muss", sagte der evangelische Theologe und Kirchenhistoriker Joachim Conrad in Saarbrücken. Die Glocke ergänzt die Schau zu Protestantismus und Nationalsozialismus.
Schau beleuchtet Rolle der Protestanten in NS-Zeit
Die noch bis zum 28. Februar laufende Ausstellung ist aus der Publikation "Protestanten ohne Protest" von 2016 entstanden und wurde mit Blick auf den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar) am 26. Januar offiziell eröffnet. Auf Bannern geht es neben der evangelischen Kirche der Pfalz auch um die rheinische Kirche im damaligen Saargebiet. Die zusätzlichen Banner zum rheinischen Teil des Saarlandes behandeln die verbotene Kirchenwahl von 1933, die erste Synode der Bekenntnisgemeinschaft in der Saarbrücker Schlosskirche 1934 sowie den Burgfrieden vor und die Begeisterung nach der Saarabstimmung 1935.
Die aus dem Jahr 1933 stammende Hakenkreuzglocke wurde im Juni 2018 aus der evangelischen Erlöserkirche entfernt. Danach schenkte die Kirchengemeinde Obere Saar sie dem Historischen Museum Saar, welche sie in ihre Dauerausstellung aufnehmen wird. Die Glocke ist nun erstmals öffentlich zu sehen. Zudem thematisiert die Ausstellung den Umgang mit der "NS-Glocke" im rheinland-pfälzischen Herxheim.
"Eine Glocke kann nicht beliebig beschriftet werden", sagte Conrad. Als liturgisches Gerät verkünde sie, was auf ihr stehe. Die Ausstellung ermögliche eine differenzierte Betrachtung. Die Hakenkreuzglocke sei damals als eindeutiges Bekenntnis zur Wiedervereinigung mit dem Deutschen Reich gesehen worden.
Telegramm an Adolf Hitler und Paul von Hindenburg
Museumsdirektor Simon Matzerath erklärte, dass 1920 klar gewesen sei, dass das Saargebiet wieder zurück zum Deutschen Reich wollte. Der Jurist Horst Rieth habe zu seinem Vorfahren, dem Pfarrer Ernst Rieth, und der Hakenkreuzglocke Nachforschungen betrieben. Er habe herausgefunden, dass die Glockengießerwerkstatt in Saarburg mit der damaligen Gemeinde mehrmals in Kontakt stand. Noch 1933 sei die Inschrift geändert worden. Zudem hätte die Gemeinde in einem Telegramm an Adolf Hitler und Paul von Hindenburg darauf hingewiesen, die erste "Hitlerglocke" im Saargebiet zu haben.
Zusammen mit Conrad wird Matzerath am 12. Februar einen Diskussionsabend zu belasteten Glocken gestalten. Die Hakenkreuzglocke sei Symbol und Mahnmal, betonte der Museumsdirektor. Das Objekt sei auch ein Hinweis darauf, dass der Nationalsozialismus und seine Gräueltaten in Familien, Dörfern und Städten immer noch mit Tabus belegt seien.
Kleine Gemeinde in großer Stadt

epd-bild/Renate Haller
New York (epd). Ein paar Worte im Vorübergehen, eine Aufmerksamkeit: Wenn Miriam Groß in New York unterwegs ist, sucht sie das Gespräch. Einem jungen Mann im Café macht sie ein Kompliment für seinen Ohrring in Kreuzform. Am "Vessel", einem einzigartigen Treppengebäude in den Hudson Yards, spricht sie mit dem Ticketkontrolleur, auf der "High Line", der begrünten ehemaligen Güterzugtrasse im Westen der Stadt, wechselt sie ein paar Worte mit einer Touristin.
Miriam Groß ist seit 2014 Pfarrerin der deutschsprachigen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in New York: Sonntagsgottesdienste, Chorkonzerte, Jugendgruppe, Weihnachtskrippenspiel wie in jeder deutschen Kirchengemeinde, das alles inmitten der Tag und Nacht pulsierenden Metropole. Die Eltern-Kind-Gruppe heißt "Kirchenmäuse Manhattan".
Zum schwarzen Kleid trägt Groß den weißen Stehkragen, den Kollar. Er macht sie als Seelsorgerin in der Stadt erkennbar. Und er dient auch ihrer Sicherheit: Nachts in der U-Bahn wird der Pfarrerin mehr Respekt entgegengebracht als der Privatperson, hat die 42-Jährige erfahren.
"Unbarmherzig schneller Rhythmus"
Aufgewachsen ist die Pfarrerin der Evangelischen-Lutherischen Kirche in Bayern in der Nähe von Würzburg. Teil ihrer Ausbildung war ein Praxisjahr, das sie als Flugbegleiterin bei Japan Airlines verbracht hat. Sie hat eine andere Arbeitswelt gesehen, lernte Japanisch. An Bord habe sie viele Glaubensgespräche geführt, erzählt sie, "obwohl ich keine Missionstheologin bin".
Gleich nach ihrem Vikariat in Franken war sie drei Jahre lang Pfarrerin auf den schottischen Orkney-Inseln. "Dort musste ich drei Kirchen verkaufen", erinnert sie sich. "Die Gemeinde hätte sonst nicht überleben können." Es folgten vier Jahre als Pfarrerin in München, dann lockte New York. Eine Stadt "mit einem unbarmherzig schnellen Rhythmus", sagt die Theologin. Wer den nicht mithalte, fliege raus.
Die deutschsprachige Evangelisch-Lutherische Gemeinde haben deutsche Einwanderer 1841 gegründet. Das Gemeindegebiet erstreckt sich heute über die drei Staaten New York, New Jersey und Connecticut. Zu einem Taufgespräch fährt Pfarrerin Groß mitunter zweieinhalb Stunden. Das Pfarrhaus, in dem sie mit Ehemann und vier Kindern zwischen elf und 17 Jahren lebt, steht gut 40 Kilometer außerhalb von New York.
Armut ist allgegenwärtig
Die Kirche der Gemeinde heißt St. Pauls und liegt in Manhattan im Stadtteil Chelsea. In der etwas ruhigeren Seitenstraße zwischen achter und neunter Avenue stehen Bäume vor den traditionellen, braunen Brownstone-Häusern.
Armut und Obdachlosigkeit sind allgegenwärtig. Rund 60.000 Menschen in der Stadt haben Schätzungen zufolge kein Dach über dem Kopf. Miriam Groß ist immer wieder schockiert über den großen Gegensatz zwischen Armut und Wohlstand. "Ich finde diesen zur Schau gestellten Reichtum unanständig", sagt sie und blickt auf einen Swimmingpool auf einer Terrasse, die zu einem Fitnesszentrum gehört. Einen Straßenzug weiter liegen Obdachlose in Hauseingängen.
Die St. Pauls Kirche wurde 1897 erbaut. Die beiden Türme des neugotischen Gotteshauses müssen neu verankert werden, im Inneren bröckelt der Putz. "Die Finanzierung der notwendigen Renovierung ist für uns eine große Herausforderung", sagt Groß. Die Evangelische Kirche in Deutschland beteiligt sich am Gemeindehaushalt mit fünf Prozent, der Rest muss über Mitgliedsbeiträge und Spenden hereinkommen.
Gemeinde vermietet ihre Räume
Um die Handwerker bezahlen zu können, organisieren die Protestanten darum Konzerte und die Frühstückstreffen "Fundraising Brunch". Und sie vermieten ihre Räume, inklusive Kirche. "Das ist nicht immer einfach", sagt Groß. Ihre Gemeinde verstehe sich als liberal und offen. Dieses Menschenbild erwarte sie auch von ihren Mietern. Wenn andere christliche Glaubensgemeinschaften die Kirche mieten und dort ihre Taufen und Trauungen feiern, "müssen wir die Balance halten", sagt sie.
Die Gemeinde hat 200 eingeschriebene Mitglieder, diese stehen für etwa 700 bis 800 Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen. Etwa 60 Prozent sind "Expatriots" - Deutsche, die im Auftrag von internationalen Unternehmen, des Auswärtigen Amtes oder der deutschen Schule für einige Jahre im Ausland leben. 40 Prozent sind Einheimische, deren Familien nach dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika ausgewandert sind. Durch den hohen Anteil an "Expats" erneuert sich die Gemeinde ständig. Das bedeutet, dass sich auch Angebote im Gemeindealltag wie Krabbelgruppen für Kleinkinder ständig verändern.
Webaffine Pfarrerin
Dem derzeitigen Konfirmandenjahrgang bietet Groß erstmals ein digitales Element an: Die Jugendlichen leben verteilt auf drei Staaten, manche haben sehr lange Wege zum Unterricht. Sie können sich nun punktuell digital am Unterricht beteiligen, indem sie sich auf einer Plattform einwählen.
Die Website für den digitalen Unterricht hat Miriam Groß selbst aufgebaut. "Ich bin hier Mädchen für alles", sagt sie lachend. Tatsächlich aber ist die Pfarrerin webaffin. Lange Zeit hat sie einen regelmäßigen Blog geschrieben, im vergangenen Jahr dann jeden Sonntag einen Videoblog auf Youtube hochgeladen.
Sie wollte "digitale Türen öffnen, um jene zu erreichen, die sich noch erreichen lassen wollen", sagt sie. Nach einem Jahr des Ausprobierens stellt sie zurzeit allerdings keine weiteren Videos online, die Zahl der Aufrufe war bescheiden. An ihrer Grundeinstellung ändert das nichts: "Ich bin öffentliche Theologin", erklärt Groß. Das bedeutet, dass christlicher Glaube nicht im stillen Kämmerlein bleibt und sich um sich selbst dreht, sondern in die Öffentlichkeit hineinwirkt. Ob im Netz oder auf den Straßen von New York.
Reformdialog mit schwierigen Voraussetzungen

epd-bild/Meike Böschemeyer
Frankfurt a.M. (epd). Die Unkenrufe sind unüberhörbar: Selbst Teilnehmer des sogenannten Synodalen Wegs, der die katholische Kirche in Deutschland aus der Krise führen soll, sind von seiner Wirksamkeit nicht überzeugt. Die Erfurter Theologin Julia Knop kritisierte die Zusammensetzung des Gremiums, in dem der Klerus überwiegt. Sie nimmt am Synodalen Weg teil.
Der Kirchenrechtler Thomas Schüller sprach von einem "kirchenrechtlichen Nullum". Der Jesuitenpater Klaus Mertes, der vor zehn Jahren die Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich machte, dämpfte die Erwartungen, weil der Vatikan das letzte Wort behalten werde und hofft auf ein drittes Vatikanisches Konzil in ein paar Jahren. Trotzdem hoffen Deutsche Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) mit dem Synodalen Weg aus der Krise zu finden. Die Krise ist eine Vertrauenskrise - mit ausgelöst durch den Umgang der katholischen Bischöfe mit dem Missbrauchsskandal.
Missbrauchsskandal schon in der Präambel
Die erste Synodalversammlung des Synodalen Wegs findet in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Jahrestag der Aufdeckung der Missbrauchsfälle 2010 statt. Der Missbrauchsskandal taucht in den Statuten schon in der Präambel auf. Der Druck, endlich Transparenz herzustellen und die Strukturen aufzubrechen, die all das ermöglicht haben, ist riesig.
230 Teilnehmer, darunter 69 Bischöfe aller 27 Diözesen und 69 gewählte Vertreter der wichtigsten katholischen Laienorganisation in Deutschland, dem ZdK, treffen sich vom 30. Januar bis zum 1. Februar in Frankfurt. Auf der ersten Synodalversammlung soll zunächst sondiert werden, welche Themen zu besprechen sind in den kommenden zwei Jahren. Die Vorarbeit haben die Delegierten in den sogenannten Synodalforen geleistet. Vier übergeordnete Themenbereiche sind identifiziert: klerikaler Machtmissbrauch, die katholische Sexualmoral, priesterliche Lebensformen und Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Die vier Synodalforen, die je von einem Laien oder einer Laiin und einem Bischof geleitet werden, bringen Beschlussvorlagen in die Synodalversammlung ein - sie stimmt darüber ab.
Die Findung der Mehrheiten wird ein kommunikativer Prozess, der viel Fingerspitzengefühl und Umsicht erfordern wird. Denn die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig: Beschlüsse können nur mit Zwei-Drittel-Mehrheit gefasst werden, die am Ende eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe enthalten muss. So reichen die Stimmen von 24 Bischöfen aus, um das Votum von mehr als 200 Delegierten "zu torpedieren", kritisierte die Theologin Julia Knop. Klerikale Vertreter sind zudem in der Überzahl in der Synodalversammlung.
Missbrauchsopfer sind strukturell nicht beteiligt. Sollten Reformbeschlüsse gefasst werden, müssen sie dem Vatikan vorgelegt werden, wenn sie weltkirchliche Themen betreffen. Darunter fallen ungefähr alle strittigen Themen wie der Pflichtzölibat, das Diakonat der Frau oder die Frage einer gemeinsamen Abendmahlspraxis mit den Protestanten.
Protestanten interessierte Beobachter
Es ist offen, ob sich liberale Bischöfe wie der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode oder der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer gegen erklärte Skeptiker wie den Regensburger Bischof Rudolf und den Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki, durchsetzen.
Die Protestanten beobachten den Reformprozess mit Interesse. Vor dem Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt, der ein halbes Jahr vor Ende des Synodalen Wegs stattfindet, erhofft man sich Fortschritte etwa bei einer gemeinsamen Abendmahlpraxis. Das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist offiziell eingeladen, die Synodalversammlungen zu beobachten. Mit "Reformation" kennen sich die Protestanten bestens aus: Der evangelische Ökumene-Bischof Karl-Hinrich Manzke sprach zuletzt Anfang Januar von einem "mutigen Schritt" der Katholiken.
Erwartungen und erwartbare Realität scheinen den Prozess schon jetzt zu behindern. Aber da ist ein "Trotzdem", auf das sich Laien und Bischöfe geeinigt haben. Trotz aller Widerstände aus dem Vatikan, trotz aller Kritik von Kirchenfunktionären und trotz aller Zweifel am Ergebnis - Laien und Bischöfe haben es sich zur Herzensaufgabe gemacht, die Kirche, an die sie glauben, von innen zu verändern.
Woelki fühlt sich nicht an Beschlüsse des Synodalen Wegs gebunden
Köln (epd). Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki fühlt sich nicht an die Entscheidungen des Synodalen Wegs gebunden. Die Diözesanbischöfe müssten am Ende des innerkatholischen Reformprozesses entscheiden, welche der Voten des Synodalen Wegs sie in ihren Diözesen umsetzen und welche nicht, sagte der Kardinal der katholischen Monatszeitschrift "Herder-Korrespondenz" (Februar). "Ich fühle mich hier vollkommen frei, nur meinem Gewissen und dem Glauben der ganzen Kirche verpflichtet." Am 30. Januar treffen sich die 230 Delegierten des Synodalen Wegs erstmals in der Synodalversammlung in Frankfurt am Main.
Er lasse sich "in aller Offenheit auf diesen Weg ein", sagte Woelki. Er forderte, dass der Anlass für den Reformdialog, die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, genug zur Sprache komme. Die Frage nach der Macht in der Kirche sei der Ausgangspunkt für den Synodalen Weg gewesen. Das betreffe sowohl die Frage nach dem Machtmissbrauch als auch die Entscheidungsstrukturen in den kirchlichen Institutionen. "Es ist gut, auf diesem Weg offen und aufrichtig nach Lösungen zu suchen", sagte Woelki.
Der Reformdialog von katholischer Deutscher Bischofskonferenz und der katholischen Laienorganisation, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. Woelki hatte im September auf der Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda gegen den Satzungsentwurf gestimmt, jedoch zugesagt, den Synodalen Weg mitzutragen.
Erzbistum Köln plant 2020 mit 685 Millionen Euro Kirchensteuern
Köln (epd). Das Erzbistum Köln hat seinen Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 vorgelegt. Erwarteten Erträgen von insgesamt 894 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von rund 914 Millionen Euro gegenüber, wie das Erzbistum am 23. Januar mitteilte. Wichtigste Einnahmequelle bleiben die Kirchensteuern: für dieses Jahr rechnet das Erzbistum mit 685 Millionen Euro. Dazu kommen Zuschüsse des Landes für die kirchlichen Schulen und Erträge etwa aus Finanzvermögen, wie es hieß.
Größter Posten auf der Ausgabenseite ist nach Angaben des Erzbistums mit 237 Millionen Euro die Seelsorge vor Ort in den Kirchengemeinden. Für zielgruppenorientierte Angebote etwa für Jugendliche und besondere Dienste wie Notfall-, Telefon- oder Obdachlosenseelsorge sind 52 Millionen Euro vorgesehen. Mit 58 Millionen Euro werden die Caritasverbände, Fachdienste und Beratungsstellen finanziert.
Für die Finanzierung der 33 erzbischöflichen Schulen, vier Tagungshäuser und 20 weiteren Bildungseinrichtungen sind 75 Millionen Euro eingeplant. In die 550 Kindertagesstätten im Erzbistum fließen 51 Millionen Euro. Die Altersversorgung der Bistumsmitarbeiter schlägt mit 59 Millionen Euro zu Buche, für Investitionen in Gebäude und deren Verwaltung sind 65 Millionen Euro vorgesehen. Für den Bereich Mission und Entwicklungshilfe will das Erzbistum 44 Millionen Euro ausgeben.
Neue BasisBibel erscheint 2021
Stuttgart (epd). Die mehrjährigen Übersetzungsarbeiten für die BasisBibel sind abgeschlossen. Am 21. Januar 2021 erscheint die BasisBibel mit dem vollständigen Text des Alten und Neuen Testaments, teilte die Deutsche Bibelgesellschaft am 24. Januar mit. Die BasisBibel zeichnet sich nach eigenen Angaben durch eine klare und prägnante Sprache aus und eignet sich besonders für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Bisher sind das Neue Testament und Psalmen erschienen, von denen seit 2012 mehr als 200.000 Exemplare verkauft wurden, und außerdem ausgewählte Texte des Alten Testaments. Zudem ist die BasisBibel die erste Bibelübersetzung, die das durch die digitale Medien veränderte Leseverhalten berücksichtigt. Die Sätze sind in der Regel nicht länger als 16 Wörter, zentrale Begriffe werden direkt am Rand erklärt. Der Bibeltext ist direkt aus dem griechischen und hebräischen Urtext übersetzt.
Kombination von Buch und digitalen Medien
Laut Annette Kurschus, Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bibelgesellschaft und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, bietet die Übersetzung der BasisBibel allen einen Zugang zur Bibel, denen die Hürden für das Lesen bisher zu hoch erschienen. Die Kombination von Buch und digitalen Medien gebe hier neue Möglichkeiten. Der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, Christoph Rösel, sagte, die BasisBibel stehe in der Tradition des Bibelübersetzers Martin Luther: Sie sei urtextnah und prägnant in der Sprache.
Die BasisBibel mit dem Neuen Testament und den Psalmen gibt es bisher als gedrucktes Buch, in der Reihe "bibeldigital", als Hörbuch sowie kostenlos im Internet und als App für Smartphones und Tablets.
Glööckler gestaltet Kirchenfenster in Rümmingen
Binzen (epd). Ein "pompöses" Kirchenfenster kommt in die evangelische Jakobuskirche in Rümmingen in Baden-Württemberg. Der Modeschöpfer Harald Glööckler werde ein Fenster gestalten, bestätigte Jürgen Schlechtendahl, Kirchenbau-Leiter der Evangelischen Landeskirche in Baden, am 23. Januar dem epd. Die Landeskirche und die Denkmalschutzbehörde hätten nach einer Begehung grünes Licht gegeben.
Initiiert wurde die Aktion vom Pfarrer der Kirchengemeinde Binzen-Rümmingen, Dirk Fiedler. Er hatte bereits vor längerer Zeit bei Glööckler angefragt und dieser habe sofort einen "pompösen Vorschlag" gemacht. Glööcklers Markenzeichen ist ein Kronenmotiv, das oft von dem Schriftzug "POMPÖÖS" ergänzt wird. Der Designer hat bereits einen Schmuckschuber für die Lutherbibel 2017 entworfen und ein Buch über Reformbedarf bei beiden großen Kirchen geschrieben.
Holocaust-Gedenktag
"Never again - Nie wieder"

epd-bild/Matthias Rietschel
Berlin, Jerusalem (epd). In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die deutsche Verantwortung für das Erinnern an den millionenfachen Mord der Nationalsozialisten unterstrichen. Die Mörder, Wachleute, Helfershelfer, Mitläufer seien Deutsche gewesen, sagte Steinmeier am 23. Januar beim World Holocaust Forum in Jerusalem. Die deutsche Verantwortung vergehe nicht. Deshalb dürfe es "keinen Schlussstrich unter das Erinnern geben", sagte der Bundespräsident, der die Rede auf Englisch hielt.
Er stehe als Präsident "beladen mit großer historischer Schuld" dort, sagte Steinmeier. Er hielt als erstes deutsches Staatsoberhaupt überhaupt eine Rede in Yad Vashem. Zu der großen Gedenkveranstaltung in Israel waren Delegationen aus rund 40 Ländern geladen, darunter höchste Vertreter der Siegermächte im Zweiten Weltkrieg aus den USA, Großbritannien, Russland und Frankreich.
"Es ist dasselbe Böse"
Steinmeier forderte dazu auf, Antisemitismus und das "Gift des Nationalismus" heute und in Zukunft zu bekämpfen, jüdisches Leben zu schützen und an der Seite Israels zu stehen. Er würde sich wünschen, sagen zu können, die Deutschen hätten für immer aus der Geschichte gelernt, sagte Steinmeier. Das könne er aber nicht angesichts von Hass und Hetze, Angriffen auf jüdische Schüler und dem jüngsten Anschlag auf die Synagoge in Halle.
Die bösen Geister zeigten sich heute in neuem Gewand. Sie präsentierten ihr antisemitisches, rassistisches und autoritäres Denken als Antwort für die Zukunft. "Es sind nicht dieselben Worte. Es sind nicht dieselben Täter. Aber es ist dasselbe Böse", warnte Steinmeier. Die einzige Antwort darauf könne nur sein: "Never again. Nie wieder", sagte Steinmeier.
Der Bundespräsident drückte zugleich Dankbarkeit für die Einladung nach Yad Vashem und den "Geist der Versöhnung" aus. Seine Rede begann und beendete er mit Worten eines Dankgebets aus dem Talmud: "Gepriesen sei der Herr, dass er mich heute hier sein lässt." Steinmeier trug sie auf Hebräisch vor.
Gedenken in Auschwitz
Am kommenden 27. Januar jährt sich die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau zum 75. Mal. Die Gedenkveranstaltung in Yad Vashem stand bereits im Zeichen des Jahrestags. Steinmeier wird an dem Tag auch an der Gedenkveranstaltung in Auschwitz teilnehmen.
Auf seiner Israel-Reise traf der Bundespräsident auch Überlebende des Holocaust. Am 27. Januar werden ihn Auschwitz-Überlebende auf der Reise zur zentralen Gedenkfeier begleiten.
NRW-Erklärung zum 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung

epd-bild/Daniel Schäfer
Düsseldorf (epd). "75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz nimmt der Antisemitismus in unserem Land erneut zu", heißt es in einer am 26. Januar veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von Juden, Christen, Muslimen, Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Landesregierung. "Dieser Entwicklung, aber auch der Diskriminierung anderer Religionen, dem Fremdenhass und dem Rassismus stellen wir uns sowohl auf gesellschaftlicher Ebene als auch in unseren eigenen Reihen entschieden entgegen."
Die Erfahrung des Holocaust lehre, "dass wir bereits den Anfängen wehren müssen und nie wieder zulassen dürfen, dass in unserer Gesellschaft Minderheiten aufgrund von Religion, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung oder sonstigen Merkmalen diskriminiert werden", betonen die Unterzeichner. "Wir wollen nicht wegsehen, wenn Hass gesät, die Gesellschaft entzweit wird und Gruppen gegeneinander aufgebracht werden", auch Benachteilung und oder Bedrohung dürften nicht toleriert werden. Stattdessen gelte es, Minderheiten zu schützen, die demokratische und freiheitliche Ordnung des Landes zu stärken und sich für die Achtung der Würde jedes Einzelnen einzusetzen.
Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nannte die "Nordrhein-Westfalen-Erklärung" ein bedeutendes Zeichen für den Zusammenhalt im gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus, Ausgrenzung und Diskriminierung. "Der Kampf gegen Antisemitismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle und jeden Einzelnen von uns verpflichtet", betonte er. "'Nie wieder' muss in jedem unserer Köpfe tief verankert sein, 'nie wieder' muss unser aller Handeln und Entscheiden prägen, 'nie wieder' muss Teil der Staatsräson sein."
Unterzeichner des Papier sind neben Laschet die NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, für die evangelischen Landeskirchen, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki für die Bistümer, Metropolit Augoustinos für die Orthodoxe Bischofskonferenz, Zekeriya Altug für den Koordinationsrat der Muslime, Abraham Lehrer für die jüdischen Landesverbände, Anja Weber für den Deutschen Gewerkschaftsbundes in NRW und Arndt Günter Kirchhoff für die Landesvereinigung der Unternehmensverbände.
Die deutschen Gräueltaten der Jahre 1933 bis 1945 und die Verbrechen des Holocaust erschütterten die ganze Welt bis heute, heißt es in der Erklärung. "Immer wieder fragen wir uns, wie es möglich war, dass in unserem Land zunächst jüdische Gotteshäuser geschändet und niedergebrannt, dass Menschen aus der Mitte der Gesellschaft verprügelt, gedemütigt, eingesperrt, schließlich aus Deutschland und ganz Europa in Konzentrationslager verschleppt und ermordet wurden." Die daraus erwachsende persönliche und gesellschaftliche Verantwortung gehöre zum Grundkonsens in Deutschland und verpflichte "alle Menschen, die in unserem Land leben - egal, ob sie hier geboren wurden oder zu uns gekommen sind und hier eine neue Heimat gefunden haben".
Gedenken an die Shoah im NRW-Landtag
Düsseldorf (epd). Mit einer Gedenkveranstaltung hat der nordrhein-westfälische Landtag am 26. Januar in Düsseldorf an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren erinnert. Ministerpräsident Armin Laschet rief dabei zum entschiedenen Kampf gegen den Antisemitismus in der Gesellschaft auf. "Auch 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz ist Antisemitismus leider noch immer Realität in Deutschland", sagte der CDU-Politiker vor 400 Gästen. Der Hass auf Juden sei nie weg gewesen, wie der Anschlag auf die Synagoge in Halle an der Saale zeige.
Appell gegen Antisemitismus
Die Gesellschaft dürfe nicht zulassen, dass Minderheiten diskriminiert, benachteiligt und verfolgt werden. Der Staat setze sich deshalb auch für den Schutz der jüdischen Einrichtungen ein. Zudem fühlten sich die Politik und die Gesellschaft der Erinnerung an den Nationalsozialismus und dem Kampf gegen Antisemitismus verpflichtet. In diesem Zusammenhang begrüßte der Ministerpräsident, dass sich Staat, Religionsgemeinschaften und Wirtschaftsvertreter in NRW in einer gemeinsamen Erklärung gegen jede Form von Diskriminierung und für den Schutz von Minderheiten einsetzen.
Der Vorstand der Synagogengemeinde Köln und Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, sagte: "Es ist für jeden Juden eine große Herausforderung, sich mit den Lücken auseinanderzusetzen, die durch die Shoa in der eigenen Familie entstanden sind." Die Erinnerung an Auschwitz sei ein aktiver Einsatz für die Demokratie. Es gehe auch darum, die junge Generation in die Erinnerungskultur einzubinden: "Wenn wir junge Menschen nicht erreichen, dann sind sie für unsere Demokratie verloren", betonte Lehrer. Er wies darauf hin, dass in Deutschland weiterhin ein Viertel der Bevölkerung "mehr oder minder antisemitische Einstellungen" habe.
Zentralrat der Juden kritisiert AfD
Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden kritisierte in der Gedenkstunde die AfD, ohne sie ausdrücklich zu nennen. Die Partei wolle eine "geschichtspolitische Wende" erreichen und spiele Minderheiten gegeneinander aus. Die deutsche Gesellschaft müsse sich dagegen für "Toleranz und Inklusivität" einsetzen.
Zu der Gedenkstunde waren auch der aus Düsseldorf stammende Auschwitz-Überlebende Gary Wolff und seine Enkel Danielle Wolff Ser und Julian Wolff aus den USA in den Landtag gekommen. Die beiden Enkel erinnerten in einer auf Deutsch gehaltenen Rede an die Geschichte ihres Großvaters und seinen Einfluss auf ihr Leben. Dabei warnten sie auch vor der Gefahr eines wachsenden Antisemitismus und vor Intoleranz in der Gesellschaft.
Landtagspräsident André Kuper erklärte, Auschwitz gehöre "für alle Zeiten zum mahnenden Gedächtnis der Menschheit". Es sei wichtig, sich im Gedenken an den millionenfachen Mord an den Juden nachdrücklich und entschlossen gegen jede Form von Antisemitismus zu stellen.
Das Konzentrationslager Auschwitz war am 27. Januar 1945 von Soldaten der Roten Armee befreit worden. Etwa 7.000 teilweise völlig entkräftete Menschen wurden befreit, mehrere zehntausend Insassen waren zuvor von den Wachmannschaften des KZ in sogenannten Todesmärschen nach Westen getrieben worden. Die Vereinten Nationen hatten im Jahr 2005 den 27. Januar zum internationalen Tag des Gedenkens an den Holocaust erklärt.
Bundeskanzlerin dankt Holocaust-Überlebenden
75 Porträts von Holocaustüberlebenden: Die Schau "Survivors. Faces of Life after the Holocaust" zeigt diese Bilder des Fotokünstlers Martin Schoeller. Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnete die Ausstellung im Unesco-Welterbe Zollverein.Essen (epd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnt vor Rassismus, Antisemitismus, Hass und Gewalt in Deutschland. Sie seien "ein Angriff auf grundlegende Werte, die unsere Gesellschaft tragen", sagte Merkel am 21. Januar in Essen. Damit eröffnete sie die Ausstellung "Survivors. Faces of Life after the Holocaust" im Unesco-Welterbe Zollverein. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 zeigt die Schau weltweit erstmalig 75 Porträts des Fotokünstlers Martin Schoeller von Holocaust-Überlebenden aus Israel.
Merkel würdigte alle porträtierten Augenzeugen als "Zeugen eines Leids, das niemand ermessen" könne, der die Hölle der Schoah nicht selbst erlitten habe. "Ich bin Ihnen und allen, die die Kraft aufbringen, die Erinnerung wachzuhalten unendlich dankbar", sagte die CDU-Politikerin an den stellvertretend anwesenden 87-Jährigen Naftali Fürst gewandt. Es grenze an ein Wunder, dass es mittlerweile auch in Deutschland wieder jüdisches Leben gebe: "Dieses Vertrauen müssen wir pflegen."
"Gesellschaftliche Aufgabe"
Naftali Fürst, geboren in Bratislava (heute Slowakei), bezeichnete es als seine Pflicht, im Namen aller Ermordeten, die Erinnerung an die Schoah zu bewahren: "Damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholt." Er selbst war als Zwölfjähriger auf einen der Todesmärsche nach Buchenwald geschickt worden. In einer mit viel Applaus bedachten Rede zur Ausstellungseröffnung betonte er, dass sich in seinem Leben von 1945 bis jetzt ein Kreis geschlossen habe, und das sei ein Glück.
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rief dazu auf, das Eintreten gegen Antisemitismus "als gesellschaftliche Aufgabe für jeden Einzelnen" zu begreifen. Mit Blick auf den rechtsextremistischen Anschlag auf die Synagoge in Halle im vergangenen Oktober betonte Laschet, es sei "ein Skandal", das es 75 Jahre nach dem Holocaust noch immer nötig sei, Synagogen in Deutschland zu bewachen. Trotz aller Gewalt in der Vergangenheit könne man jedoch sagen: "Das Verbrechen hat nicht gesiegt, jüdisches Leben ist nicht ausgelöscht in Deutschland."
Extreme Frontalansicht
Die Ausstellung des 1968 in München geborenen und in New York lebenden renommierten Fotografen Schoeller zeigt 75 großformatige Porträts. Er setzt bei seinen Porträts eine spezielle Beleuchtung ein und sucht die extreme Frontalansicht. In der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem entstanden seine Aufnahmen für das Projekt "Survivors" (Überlebende).
Das Foto- und Ausstellungsprojekt in Kooperation mit der Stiftung Zollverein und dem Ruhr Museum in Essen, das erstmals auf Zollverein gezeigt wird, wurde vom deutschen Freundeskreis von Yad Vashem unter dem früheren "Bild"-Chefredakteur Kai Diekmann initiiert und von der RAG-Stiftung finanziert. Die Ausstellung ist in Essen bis 26. April zu sehen und soll im Anschluss an weiteren Stationen gezeigt werden.
Kirchen: "Vor allen Opfern verneigen wir uns"
Hannover/Düsseldorf (epd). Der Holocaust-Gedenktag ist für die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland auch ein Anlass zur Dankbarkeit. Recht verstanden sei der 27. Januar ein Tag, für den man Dankbarkeit empfinden könne, denn er handle davon, dass den Verbrechen der Nationalsozialisten ein Ende gesetzt wurde, heißt es einer gemeinsamen Erklärung, die am 24. Januar in Hannover und Bonn veröffentlicht wurde. Zusammen mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, erinnere dieser Gedenktag auch an die Überwindung eines politischen Systems, das keinerlei Respekt für das Leben und die Würde des Menschen gekannt und die Ausrottung ganzer Menschengruppen zum Programm erklärt und systematisch organisiert habe.
Am 27. Januar wird international der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 75 Jahren gedacht. "Vor allen Opfern verneigen wir uns. Ihr Andenken darf weder den heute lebenden Generationen noch den künftigen gleichgültig werden", schreiben der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm.
"Oft mit dem Rücken zu den Opfern"
Man dürfe nicht darüber hinwegsehen, dass viele Christen mit dem nationalsozialistischen Regime kollaboriert, zur Verfolgung der Juden geschwiegen oder ihr sogar Vorschub geleistet hätten, heißt es in der gemeinsamen Erklärung von Bischofskonferenz und EKD weiter. "Auch Verantwortliche und Repräsentanten der Kirchen standen oft mit dem Rücken zu den Opfern." Antijudaismus, also die Ablehnung der Juden aus religiösen Gründen, habe die europäische Kultur über Jahrhunderte geprägt. Die Kirchen hätten sich dieser Geschichte nach 1945 gestellt. Man sei dankbar dafür, dass schon wenige Jahre nach der Shoah auch in Deutschland Juden das offene und ehrliche Gespräch mit Christen gesucht hätten, schreiben Bedford-Strohm und Marx.
Dass der Mord an sechs Millionen Juden von einem Land mit jahrhundertelanger christlicher Prägung, mit humanistisch-aufklärerischer Bildungstradition ausging, führe allen vor Augen, wie brüchig die Grundlagen der Menschlichkeit zu allen Zeiten sind. Deshalb werde die Shoah fast überall in der Welt erinnert. Es sei ein Gedenken um unser aller Zukunft willen.
Rekowski fordert entschiedenes Auftreten gegen Antisemitismus
Der rheinische Präses Manfred Rekowski hat dazu aufgerufen, sich entschieden gegen jegliche Form von Antisemitismus zu stellen. "Des Vergangenen gedenken heißt zugleich, der Wahrheit ins Auge zu sehen", sagte der oberste Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland am 24. Januar in Düsseldorf anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Dazu gehöre eine reale Bedrohung für Juden durch einen "tief verwurzelten Antisemitismus" in Deutschland.
Kirche hat nach Rekowskis Worten die Verantwortung, deutlich "Nie wieder!" zu sagen. "Es ist dabei unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung, auf antisemitische Tendenzen und Gefahren aufmerksam zu machen", betonte er. "Das sind wir nicht nur unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern schuldig, das ist auch schlicht unsere gesellschaftliche Pflicht." Vor der rheinischen Landessynode hatte der Theologe vergangene Woche für mehr Gemeindepartnerschaften und gemeinsame Projekte zwischen Juden und Christen geworben.
Zum Holocaust-Gedenktag machte die rheinische Kirche auf den Film "GehDenken - eine Reise nach Krakau und Auschwitz" aufmerksam, den sie gemeinsam mit Mitgliedern der Evangelischen Jugend Essen und der Alevitischen Jugend Essen gedreht hat. Im Jahr 2018 waren die Jugendlichen zu einer Gedenkstättenfahrt nach Krakau und Auschwitz aufgebrochen. Sie berichten in dem Video unter anderem davon, wie sich ihr Leben durch Auschwitz verändert hat.
Kirche in Lippe: Erinnerung NS-Gewaltherrschaft wachhalten
Die Lippische Landeskirche mahnte, die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu bewahren und Antisemitismus und Rassismus in Deutschland keine Chance zu geben. Die Opfer und das, was ihnen angetan wurde, dürften niemals vergessen werden, erklärte die Landeskirche am 24. Januar in Detmold. Der Name "Auschwitz" stehe seither für die "unfassbaren Verbrechen", die durch das NS-Regime an Millionen Menschen begangen wurden. Viele Schulen, Kommunen und Kirchengemeinden erinnerten auch in diesem Jahr an die Befreiung von Auschwitz. Man sei allen dankbar, die sich dieser Erinnerungs- und Gedenkkultur verpflichten sehen und sie aktiv mitgestalten, hob die Landeskirche hervor.
Bei dem Gedenken gehe es auch darum, "uns und zukünftige Generationen vor erneuten antisemitisch und rassistisch motivierten Verbrechen zu bewahren", hieß es weiter. "Die aktuelle Zunahme hassvergifteter Haltungen, ausgrenzender Worte und gewalttätiger Anschläge macht die Erinnerung an das Grauen notwendiger denn je", erklärte die Landeskirche. Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) hätten vor Augen geführt, wie hoch die Gefahr rassistisch und antisemitisch motivierter Gewalt in der Gesellschaft sei.
Antisemitismusbeauftragte: Judenhass in Behörden bekämpfen
Bildung, Gedenkstätten, Erinnerungsorte: Was kann politische Bildung im Blick auf die NS-Gewaltherrschaft und heutige Probleme wie Antisemitismus leisten? Politik und Wissenschaft sehen alle gefragt und rücken auch die Opfer in den Blick.Schwerte (epd). Die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, fordert die Bekämpfung von Judenfeindlichkeit auch in Behörden durch die Einsetzung eigener Beauftragter. Die frühere FDP-Bundesjustizministerin begründete ihre Forderung am Wochenende in Schwerte unter anderem mit Fällen, in denen Polizisten als sogenannte Reichsbürger enttarnt wurden. Es dürfe aber keine Pauschalverdächtigung von Berufsgruppen geben, sagte sie auf der Villigst-Tagung aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung des Vernichtslagers Auschwitz.
Leutheusser-Schnarrenberger forderte eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen von Antisemitismus, den "von manchen ersehnten Schlussstrich" dürfe es nicht geben: "Noch so viele Polizeibeamte, Richter und Staatsanwälte werden Judenfeindschaft vermischt mit israelischer Politikkritik und Rassismus nicht aus den Köpfen bringen." Antisemitismus und Rassismus könnten am ehesten mit frühzeitiger Bildung in allen gesellschaftlichen Bereichen verhindert werden.
Ein positiver Ansatz sei die Auseinandersetzung mit einzelnen Schicksalen und Lebensbiografien von Nazi-Opfern: "Projekte, die mit lokalem Bezug das Lebensschicksal von verfolgten jüdischen Familien nachzeichnen, können häufig eine nachhaltigere Wirkung erzeugen als das Nachlesen in Geschichtsbüchern." Ein einmaliger Besuch in einer Mahn- und Gedenkstätte reiche nicht für eine "Immunisierung" und könne die Auseinandersetzung mit dem Thema nicht ersparen, betonte Leutheusser-Schnarrenberger.
Forscherin: Gedenkstätten nicht überhöhen
Die Erziehungswissenschaftlerin Astrid Messerschmidt warnte davor, Gedenkstätten zu nationalen Erinnerungsorten zu überhöhen. Dieser Trend der "Aufladung" sei besonders nach der deutschen Vereinigung zu beobachten, sagte die Forscherin der Bergischen Universität Wuppertal. Im Vordergrund habe die Würdigung der Opfer zu stehen. Eine Reduzierung auf das Nationale schließe zudem Migranten aus, die ohnehin strukturell benachteiligt würden. Dabei äußere gerade diese Gruppe von Studierenden ein hohes Interesse an dem Thema.
In der Tagung zum Thema "75 Jahre nach Auschwitz" in der Akademie Villigst ging es um die Potenziale von NS-Erinnerungsorten für die politische Bildung und die Demokratieerziehung junger Menschen. Veranstalter waren das Institut für Kirche und Gesellschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen und das Internationale Bildungs- und Begegnungswerk (IBB) Dortmund.
Umfrage: Mehr als jeder Dritte für Schlussstrich unter NS-Zeit
Bonn (epd). Eine Mehrheit der Deutschen will nach wie vor die Erinnerung an den Nationalsozialismus wachhalten. Der Anteil derjenigen, die einen "Schlussstrich" unter die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ziehen wollen, ist aber in den letzten Jahren gestiegen, wie eine am 24. Januar in Bonn veröffentlichte Umfrage im Auftrag der Deutschen Welle zum Holocaust-Gedenktag zeigt. Danach stimmten 37 Prozent der Befragten der Aussage zu, die Deutschen sollten sich nicht mehr so viel mit der NS-Zeit beschäftigen, "sondern endlich einen Schlussstrich ziehen". 2018 lag ihr Anteil erst bei 26 Prozent, im vergangenen Jahr bei 33 Prozent.
Dabei gibt es den Angaben zufolge große Unterschiede im Umgang mit diesem Thema je nach Bildungsgrad. Während mit 21 Prozent nur jeder Fünfte mit Abitur oder Fachhochschulreife für einen Schlussstrich unter die Zeit des Nationalsozialismus ist, fordern dies mit 56 Prozent mehr als die Hälfte derjenigen mit Haupt- oder Volksschulabschluss.
Sehr unterschiedlich ist auch die Haltung bei den Anhängern der im Bundestag vertretenen Parteien: Die meisten Befürworter eines Schlussstrichs unter die Beschäftigung mit der NS-Zeit gibt es mit 72 Prozent bei den AfD-Anhängern, die wenigsten mit 13 Prozent bei den Anhängern der Grünen.
Insgesamt empfindet mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) die derzeitige Erinnerungskultur an die NS-Verbrechen als angemessen. Ein Viertel (25 Prozent) findet, es werde zu viel erinnert, ein Sechstel (17 Prozent) meint, es gebe zuwenig Erinnerung an die Nazizeit. Auf die Frage, wie die Erinnerung wachgehalten werden soll, sprachen sich drei Viertel dafür aus, dass der Besuch einer KZ-Gedenkstätte Bestandteil des Schulunterrichts sein sollte.
Für die repräsentative Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap 1.018 Menschen in Telefoninterviews.
NS-Gedenkstätten in NRW mit Besucherrekord
Düsseldorf (epd). Die NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen haben 2019 einen neuen Höchststand bei den Besucherzahlen erreicht. Im vergangenen Jahr seien etwa 410.000 Menschen in die 29 NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte zu Führungen, Seminaren oder weiteren Veranstaltungen gekommen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft, Klaus Kaiser, am 24. Januar in Düsseldorf. Das bedeute gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg um fast 15.000 Besucher.
Gerade vor dem Hintergrund, dass rechtspopulistische und rechtsextreme Parolen in Deutschland "wieder salonfähig" würden, zeige sich damit, wie wichtig die NS-Gedenkstätten "als Orte der Verständigung über unser gemeinsames Selbstverständnis und die Grundlagen des Zusammenlebens sind", betonte Kaiser. Im Mittelpunkt der Arbeit der Einrichtungen, die in der Regel aus ehrenamtlichen, lokalgeschichtlichen Initiativen entstanden, stehe die Auseinandersetzung mit dem konkreten Handeln von Tätern und der Situation von Opfern und Zuschauern.
Die meisten Besucher hatte im vergangenen Jahr das NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln mit über 97.000. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel (über 76.800 Besucher) und die frühere SS-Kaderschmiede Wewelsburg bei Paderborn (fast 63.100).
Perspektive der Opfer und auch der Täter
Die Gedenkstätten leisteten "einen wichtigen Beitrag für die historisch-politische Bildung und die Demokratie in Deutschland", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte, Alfons Kenkmann. Die wachsende Besucherzahl bezeichnete er als "positive Abstimmung mit den Füßen". In den Einrichtungen lernten die Besucher - unter ihnen viele Schulklassen - Geschichte aus der biografischen Perspektive der Opfer und Täter.
Das Land unterstützt die Einrichtungen derzeit mit 1,8 Millionen Euro pro Jahr. Das sei etwa ein Fünftel mehr als noch 2017, sagte Kaiser. Der Betrag macht etwa 20 Prozent der Gesamtfinanzierung der NS-Gedenkstätten aus, die in der Regel von den Kommunen getragen werden. Unterstützt wird die Arbeit der Einrichtungen zudem durch Förderprogramme der Landeszentrale für politische Bildung.
Um die Arbeit der Gedenkstätten bekannter zu machen, wird am 28. April eine Wanderausstellung im Düsseldorfer Landtag eröffnet, die die Arbeit der Einrichtungen vorstellt. Die Schau soll nach den Sommerferien auch in den weiteren Regierungsbezirken in NRW zu sehen sein.
Bronze-Platten schützen Shoah-Denkmal in Herne
Herne (epd). Das Shoah-Denkmal in Herne hat eine künstlerische Erweiterung aus Bronzeplatten bekommen, die es vor Beschädigung schützen sollen. Bei der Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar war das umgebaute Mahnmal erstmals zu sehen.
Das 2010 eingeweihte Denkmal besteht nach Angaben der Stadt aus einer senkrechten Betonplatte mit einem Davidstern und rund 400 Okularen, Halbkugeln aus Glas, in die die Namen und Daten der jüdischen Opfer aus Herne und Wanne-Eickel eingelassen sind. Nach mehrfachen Beschädigungen wurde nach einem baulichen Schutz gesucht. Die neuen Bronzeplatten, die einen stilisierten Stadtplan mit früheren Orten jüdischen Lebens zeigen, sind verschiebbar und sollen das Mahnmal nachts verschließen.
Ausstellung über Neugeborene im KZ Auschwitz
Berlin (epd). In der Berliner Gedenkstätte Deutscher Widerstand ist am 23. Januar eine Ausstellung über Kinder eröffnet worden, die im KZ Auschwitz-Birkenau geboren wurden. Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, sprach von einem "fast unglaublichen und bislang wenig bekannten Kapitel" des Holocaust. Gezeigt wird die Geschichte von Frauen und Männern, die als Säuglinge in dem Konzentrationslager unter widrigsten Umständen überlebten und am 27. Januar 1945 befreit wurden.
Für die Überlebenden sei der anstehende 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz kein Abschluss, sondern beschwert mit neuen antisemitischen Hass-Momenten. Mit Blick auf die jüngere Generation begingen die Überlebenden den Gedenktag deshalb mit Unruhe, sagte Heubner.
Die Ausstellung beruht auf Recherchen von Alwin Meyer, unter anderem Autor des Buches "Vergiss deinen Namen nicht. Die Kinder von Auschwitz." Demnach wurden am 27. Januar 1945 rund 60 Babys in Auschwitz befreit. Insgesamt waren es seinen Angaben zufolge 650 Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 17 Jahren. Die meisten waren jünger als 13 Jahre.
230.000 Säuglinge, Kinder und Jugendliche deportiert
Während Meyer zufolge seit Mitte 1943 Neugeborene nichtjüdischer Abstammung mit Duldung der SS nicht mehr sofort getötet wurden, wurden jüdische Säuglinge weiterhin sofort getötet oder sie verhungerten. Erst ab November 1944 gelang es einzelnen jüdischen Müttern, ihre Neugeborenen zu retten.
Mehr als 1,3 Millionen Menschen wurden zwischen 1940 und 1945 nach Auschwitz deportiert. Darunter waren Meyer zufolge mindestens 232.000 Säuglinge, Kinder und Jugendliche.
Lebenshilfe fordert Aufarbeitung der NS-Euthanasie-Morde
Hürth (epd). Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar hat die Lebenshilfe NRW eine Aufarbeitung der Geschichte der "Euthanasie"-Morde des NS-Regimes an Menschen mit Behinderung gefordert. "75 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes sind noch immer nicht alle Opfer der 'Euthanasie'-Morde bekannt", erklärte Bärbel Brüning, Landesgeschäftsführerin der Lebenshilfe NRW, in Hürth. Angehörige der Opfer hätten sich noch nach 1945 für ihre behinderten Familienmitglieder geschämt oder hätten Angst gehabt, ebenfalls diskriminiert zu werden.
Der Lebenshilfe-Landesvorsitzende Gerd Ascheid rief alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zu engagieren. Inklusion sei ein Menschenrecht. "Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen", erklärte Ascheid. Bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sei noch viel zu tun.
Im Nationalsozialismus wurden Menschen mit psychischen Krankheiten und Behinderungen als "lebensunwert" stigmatisiert, zwangsweise unfruchtbar gemacht und ab 1940 systematisch ermordet. Insgesamt fielen etwa 200.000 kranke und behinderte Menschen den nationalsozialistischen "Euthanasie"-Maßnahmen zum Opfer.
Bundesweites Festjahr 2021 zum jüdischen Leben geplant
Im Jahr 2021 soll mit einem Festjahr ein Zeichen gegen Judenhass und Antisemitismus gesetzt werden. Gleichzeitig soll vermittelt werden, was jüdisches Leben in Deutschland zur Gesellschaft beiträgt.Berlin, Köln (epd). Sonderbriefmarke, Reiseführer, das weltweit größte Laubhüttenfest - und ein gesellschaftliches Zeichen gegen Antisemitismus: Ein Kölner Verein hat für das kommende Jahr ein bundesweites Festjahr für jüdisches Leben in Deutschland ausgerufen. Anlass ist die erste schriftliche Erwähnung der jüdischen Gemeinde in Köln im Jahr 321. Mit 1.700 Jahren ist sie die mutmaßlich älteste nördlich der Alpen. Bundesweit soll zu ihrem Jahrestag jüdisches Leben sichtbar gemacht, in seiner Normalität gezeigt und dessen Beitrag für die deutsche Gesellschaft gewürdigt werden.
Rüttgers fordert "Aufstand gegen Antisemitismus"
"Wir wollen einen Aufstand gegen Antisemitismus organisieren. Wir wollen aber auch zusammen feiern", sagte der Kuratoriumsvorsitzende des Vereins "321 - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" und frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) am Dienstag in Berlin. Nur wenige wüssten, was jüdisches Leben in Deutschland bedeute.
Abraham Lehrer, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Köln und stellvertretender Präsident des Zentralrats der Juden, betonte, das Festjahr solle deutlich machen, welchen kulturellen Beitrag jüdische Menschen für das Land geleistet haben. Er könne und wolle den Holocaust nicht vergessen. Es sei aber wichtig, dass Juden nicht nur darüber definiert werden. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, unterstrich, man solle Juden nicht nur als bedrohte Minderheit sehen, sondern als Teil der Gesellschaft.
Geplant sind den Angaben zufolge bundesweit Veranstaltungen. Lehrer erwartet nach eigenen Worten, dass sich die überwiegende Mehrheit der jüdischen Gemeinden im Land an Veranstaltungen beteiligt und in Synagogen einlädt. Klein zufolge soll es für das Festjahr auch eine Sonderbriefmarke geben. Zudem soll ein Reiseführer erscheinen, der auf aktuelle und frühere Orte jüdischen Lebens in Deutschland hinweist.
Lehrer zufolge bemüht sich der Verein gemeinsam mit dem Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki auch darum, die historische Urkunde nach Köln zu holen. Das Edikt von Kaiser Konstantin, das eine Zulassung von Juden zum Stadtrat verbriefte, lagert Lehrer zufolge in den vatikanischen Archiven.
Am Festjahr beteiligen sich den Angaben zufolge unter anderem der Zentralrat der Juden, der Deutsche Städtetag, die israelische Botschaft, Gewerkschaften und Parteien. Vonseiten der Kirchen haben die Laienorganisationen Deutscher Evangelischer Kirchentag und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ihre Beteiligung zugesagt.
Der Bund stellt in diesem Jahr dem Verein zufolge sechs Millionen Euro zur Verfügung. Für das Festjahr selbst soll es weitere Mittel geben.
Gesellschaft
Ein Acker in Franken wird Mittelpunkt der EU

epd-bild/Daniel Peter
Veitshöchheim (epd). Viel unspektakulärer geht es eigentlich nicht: eine hübsche halbrunde Sitzbank mit Tisch, drei Fahnenmasten, ein Mülleimer und ein Findling aus Muschelkalk, aus dem schräg ein rot-weiß gestreifter Mast ragt - fertig. Das ist er also, der zukünftige geografische Mittelpunkt der EU, auf einem Acker am Rand des 60-Einwohner-Dorfes Gadheim, einem Ortsteil der Gemeinde Veitshöchheim im Landkreis Würzburg. Am 31. Januar soll es so weit sein: Großbritannien wird die Europäische Union verlassen - sofern das britische Oberhaus und das Europaparlament dem Brexit zustimmen. Beides gilt als Formsache.
Veitshöchheims Bürgermeister Jürgen Götz (CSU) ist ganz Politiker, wenn er zum Thema Brexit befragt wird. Er hatte in den vergangenen Jahren ja auch eine Menge Übung. Der britische Rundfunksender BBC hat ihn bereits interviewt, die englische Zeitung "Guardian" ebenso wie das chinesische Staatsfernsehen. "Das ist eine zweischneidige Sache", sagt er, während er am Bald-EU-Mittelpunkt steht. Natürlich freuten sich die Einwohner "über die Ehre". Aber eigentlich wäre es ihnen allen hier lieber gewesen, die Briten würden in der Europäischen Union bleiben.
EU-Mittelpunkt bleibt in Franken
"Viele Jahrzehnte Stabilität, Sicherheit und Wohlstand - das hat uns allen die EU gebracht", findet Götz. Dass die Briten dies nun aufgeben, so ganz versteht er es nicht. Aber wenn's denn schon so kommt, wollte man in Veitshöchheim auch nichts anbrennen lassen. Noch während die Briten mit sich rangen und der Brexit mal wieder mehr, mal weniger wahrscheinlich war, pachtete die Gemeinde den Teil es Ackers, ließ ihn pflastern, bepflanzen und richtete den "zukünftigen geografischen Mittelpunkt der EU ein". Und wenn's doch keinen Brexit gegeben hätte? "Dann wäre der Platz ein Mahnmal für die Einheit Europas geworden."
Durch den Brexit verschiebt sich der geografische Mittelpunkt der EU um nicht einmal 60 Kilometer Luftlinie: Von Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg und nur einen Steinwurf von der bayerisch-hessischen Grenze entfernt nach Veitshöchheim bei Würzburg. Kulturell trennt die beiden Regionen manches, auch wenn beides in Unterfranken liegt. Veitshöchheim ist bekannt durch den bayerischen Fernsehfasching, hat ein Schloss mit Rokoko-Garten, Mainpromenade und man "schöppelt" dort Wein - in Westerngrund ist es dialektal schon ziemlich hessisch und man trinkt lieber "Äbbelwoi".
Die Menschen in Westerngrund nehmen den drohenden Verlust des Titels als geografischer Mittelpunkt der EU übrigens gelassen. Ohnehin waren sie dies erst seit dem 1. Juli 2013, als Kroatien der Europäischen Union beitrat. Auch Bürgermeister Götz ist bewusst, dass der neue Titel für Gadheim nur ein zeitlich befristeter ist: "Vielleicht spaltet sich ja Schottland von Großbritannien ab und kommt wieder in die EU. Oder ein anderer Beitrittskandidat wird wirklich Mitglied." Bis dahin aber wollen sie in Veitshöchheim und Gadheim mit dem Titel werben - denn Tourismus spielt eine große Rolle.
Sorge vor zuviel Trubel
Genau davor, nämlich vor Touristenbussen und Blechlawinen, graut es aber so manchem Gadheimer. Nur mit Namen sagen mag es keiner. "Man will ja kein Spielverderber sein", sagt ein Besucher der kleinen Bäckerei im Ort. Unterdessen glaubt Walter Dieck nicht an (zu) viele Touristen. Und wenn, dann sollen die ruhig kommen und den Acker bestaunen, sich auf die Bank setzen und in Richtung Maintal gucken, sagt der inoffizielle Ortssprecher Gadheims. "Man darf das Ganze nicht zu hoch hängen", findet er und demonstriert Gelassenheit.
Am Abend des 31. Januar jedenfalls, da will Dieck schon mal ganz bewusst "an die Briten denken". Und vielleicht stelle sich ja gegen Mitternacht spontan jemand an die drei Fahnenmasten und spiele die Europahymne. Offiziell muss der neue geografische EU-Mittelpunkt noch auf seine Einweihung warten. Das soll erst im März geschehen. Wenn das Wetter besser, der Boden nicht mehr so matschig und der Terminkalender von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) etwas lichter ist. Wobei der schon vorher kommt: Am 14. Februar wird "Fastnacht in Franken" live aus Veitshöchheim gesendet.
Gauck besorgt über Akzeptanz der liberalen Demokratie

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Altbundespräsident Joachim Gauck äußert sich besorgt über die Zustimmung der Bürger zur Demokratie. Es gibt eine "fragilere Haltung" großer Bevölkerungsschichten gegenüber der Ordnung, in der sie leben, sagte Gauck dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das gelte auch für die Akzeptanz der liberalen Demokratie.
"Viele europäische Länder sind geprägt von Erfolgen nationalpopulistischer Gruppierungen", erklärte Gauck, der am 24. Januar 80 Jahre alt wurde. Es existiere eine Neigung, "Politik möge bitte einfacher sein". Dazu gebe es eine "Melange von Ängsten, die Leute in der aktuellen Situation geprägt von Europäisierung, Globalisierung und rasanter technologischer Innovation miteinander teilen", sagte er.
Sehnsucht nach Überschaubarkeit
Der Erfolg von Populismus und "Retro-Politik" sei bei Vielen als Sehnsucht nach Überschaubarkeit und Beheimatung im Vertrauten erklären, erklärte der frühere Bundespräsident. Er selbst schätze die Lage im Land als gut ein. "Das Land sollte gelegentlich in seine Geschichte schauen, sich die Höhen und Tiefen anschauen und sich dann fragen, warum es sich nicht besser fühlt", sagte er und ergänzte: "Die Deutschen neigen zu einer gewissen Verdrießlichkeit."
Gauck warnte auch davor, den Prozess der Wiedervereinigung von Ost und West vor 30 Jahren schlecht zu reden. Bei genauem Hinsehen sei zum Beispiel die Arbeit der Treuhand nicht so kritikwürdig wie von manchen dargestellt, sagte Gauck, der nach der Einheit erster Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen war.
Sympathie für Klimaaktivisten
"Das Tempo des Vereinigungsprozesses hat manches Problem gebracht", räumte er ein. Die Menschen in der DDR seien aber aus verständlichen Gründen ungeduldig gewesen und hätten schnelle Veränderungen gewollt. "Wenn man bei all dem ehrlich ist, wird man sehen, dass unter diesem Zeitdruck das meiste so entschieden wurde, wie es die Mehrheit wollte - und so, dass eine Mehrheit der Betroffenen auf lange Sicht ganz gut klargekommen ist", resümierte Gauck.
Der Altbundespräsident äußerte auch Sympathie für die jungen Klimaaktivisten. "Sie zeigen eine sehr wichtige Haltung für eine lebendige, offene Demokratie, nämlich ein Wir-sind-zuständig", sagte er. Es sei erlaubt, radikale Forderungen zu stellen. "In der Praxis muss der Klimaschutz aber zusammengebracht werden mit anderen Themen unserer Gesellschaft", ergänzte Gauck. Wer weiter in Wohlstand und sozialer Sicherheit leben wolle, werde eine starke Wirtschaft brauchen. Gerade die Volksparteien müssten diese unterschiedlichen Interessen abwägen. "Das dauert dann manchmal länger, aber ohne solche Kompromisse bleibt unsere Gesellschaft nicht zusammen", sagte er.
Bürgermeister von Kerpen gibt wegen Drohungen auf
Die Drohungen gegen Amtsträger hören nicht auf. Jetzt zieht sich der Bürgermeister der Stadt Kerpen, Dieter Spürck, aus dem Amt zurück, weil seine Familie bedroht wurde. Der CDU-Politiker kritisiert eine "Verrohung" der Gesellschaft.Köln (epd). Wegen Bedrohungen gegen sich und seine Familie verzichtet der Bürgermeister der rheinischen Stadt Kerpen, Dieter Spürck (CDU), auf eine erneute Kandidatur. Es gebe eine "zunehmende Verrohung in der ganzen Gesellschaft", sagte der 53-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger" und der "Kölnischen Rundschau" (23. Januar). "Soweit mich das selbst betrifft, halte ich das für ein tragbares Berufsrisiko, aber nicht für meine Frau und meine Kinder."
Politik sei "teilweise ein sehr dreckiges" Geschäft geworden. Er habe in seinem Briefkasten die Nachricht gefunden, dass seine Kinder "es zu spüren" bekämen, wenn er sich nicht "intensiver für den Hambacher Wald einsetzen" würde, berichtete Spürck. Auch Gegner der Flüchtlingspolitik hätten versucht, ihn einzuschüchtern. Wenn einem Kind in Kerpen etwas geschehe, dann werde das seinen Kindern "ebenfalls so gehen", sei er gewarnt worden. Auch gab es Ankündigungen, "mir die Mafia auf den Hals zu hetzen oder sich bei mir zu Hause einzuquartieren".
Anfeindungen von rechts wie von Umweltaktivisten
Der Bürgermeister war unter anderem wegen der Aufnahme von Flüchtlingen angegangen worden - in der Stadt findet sich eine zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge. Auch seine Haltung in der Diskussion um den von der Braunkohle-Abbaggerung betroffenen Hambacher Forst stieß in Teilen der Öffentlichkeit auf Kritik.
In einer persönlichen Erklärung hatte der Bürgermeister seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur bereits vor einigen Tagen bekanntgemacht. Er habe sich "schweren Herzens" zu der Entscheidung durchgerungen, auf eine erneute Kandidatur für die im September anstehende Kommunalwahl zu verzichten, erklärte er darin. Laut einem Sprecher der Stadt hat Spürck wegen der Bedrohungen in einem Fall Anzeige erstattet.
Spürck hatte das Bürgermeisteramt 2015 übernommen. Seitdem habe er "wiederholt Schrammen" an seinem Auto vorgefunden. "Vor meiner Haustüre hat man mir die Luft aus den Reifen gelassen. An der Rathaustüre hingen Beschimpfungen", sagte der Vater von zwei Kindern.
Städte- und Gemeindebund: "Alarmzeichen für die ganze Gesellschaft"
Der Bürgermeister von Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt (SPD), hatte vor rund zwei Wochen eine Diskussion über die Sicherheit von Kommunalpolitikern entfacht, als er wegen Drohungen aus der rechten Szene einen großen Waffenschein beantragt hatte.
Der Städte- und Gemeindebund bezeichnete es als "Alarmzeichen für die ganze Gesellschaft", wenn sich Amtsträger in den Kommunen aus Angst um das Wohl ihrer Familie aus dem politischen Geschäft zurückziehen. "Das Ausmaß der Bedrohungen gegen Bürgermeister Dieter Spürck und seine Familie ist erschütternd", sagte der Hauptgeschäftsführer der Städte- und Gemeindebundes NRW, Bernd Jürgen Schneider, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, seien nun alle Bürger gefordert, "Haltung zu zeigen und sich schützend vor die zu stellen, die sich für das Gemeinwesen einsetzen".
In den vergangenen Jahren wurden mehrfach Bürgermeister oder weitere Amtsträger verletzt oder getötet. 2017 wurde etwa der Bürgermeister von Altena, Andreas Hollstein (CDU), mit einem Messer angegriffen und verletzt, ebenso wie die spätere Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) im Jahr 2015. In Hessen wurde im Juni 2019 der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) auf seiner Terrasse von einem mutmaßlichen Neonazi erschossen.
Wohlfahrt fordert Aufnahme von Flüchtlingskindern
Düsseldorf, Köln (epd). Die Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege NRW fordert, Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern die sofortige Einreise nach Deutschland zu erlauben. "Die Bilder von durchnässten, frierenden, oft kranken und unversorgten Kindern sind unerträglich, hier muss gehandelt werden", erklärte der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Frank Johannes Hensel, am 21. Januar in Köln. Die Situation sei dramatisch und eine Herausforderung für alle, die sonst immer die westlichen Werte betonen.
Kindern und Jugendlichen mit Angehörigen in Deutschland sollte die sofortige Einreise erlaubt werden, forderte Hensel. Auch für Kinder ohne Angehörige müsse eine Lösung gefunden werden. Der Vorstand des Caritasverbandes im Erzbistum Köln rief zu einer Hilfsaktion auf, auch ohne europäische politische Lösung. Wenn sich die Europäer nicht einigen könnten, brauche es "zur Not eine konzertierte Aktion der Willigen". Hensel bot an, dass die Wohlfahrtsverbände sich um Nothilfe und Betreuung der unbegleiteten Minderjährigen im Falle ihrer Aufnahme kümmern würden.
NRW-Innenminster bleibt bei ablehnender Haltung
"Worte über die humanitäre Verantwortung ohne konkretes Handeln werden in diesem Zusammenhang sonst zum reinen Lippenbekenntnis", mahnte Hensel an die Adresse von NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP). Stamp hatte dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (20. Januar) gesagt: "Wer Bootsflüchtlinge bevorzugt aufnimmt, provoziert, dass sich noch mehr Menschen in Hoffnung auf ein besseres Leben auf die Lotterie um Leben und Tod im Mittelmeer einlassen." Bei der Aufnahme von Flüchtlingen müsse klar sein, dass es in den Asylverfahren keine Privilegierung einzelner Gruppen geben könne.
Die ablehnende Haltung der NRW-Landesregierung zur Aufnahme von Bootsflüchtlingen über die festgelegten Verteilungsquoten hinaus stieß bei Städten des Bündnisses "Sichere Häfen" auf Kritik. Die Städte Köln und Düsseldorf sprachen sich am 20. Januar dafür aus, nicht-staatliche Seenotrettungsorganisationen zu unterstützen und Staaten, in denen Geflüchtete ankommen, nicht mit der Aufnahme und Unterbringung der Menschen alleinzulassen.
Das Bündnis "Sichere Häfen", dem 29 nordrhein-westfälische Städte und Gemeinden angehören, stellt sich nach eigenen Angaben gegen "die Abschottungspolitik Europas" und will mehr Menschen ein sicheres Ankommen ermöglichen. 21 Städte, unter anderem Köln, Bonn, Dortmund, Münster und Bielefeld, wollen aus Seenot gerettete Menschen zusätzlich zu ihrer Verteilungsquote aufnehmen.
Deutsche weiter uneins in Flüchtlingsdebatte
Köln (epd). Die deutsche Bevölkerung ist nach wie vor gespalten in der Frage, wie viele Flüchtlinge hier aufgenommen werden sollen. Nach einer am 24. Januar in Köln veröffentlichten ARD-Umfrage sind 42 Prozent der Wahlberechtigten der Ansicht, dass Deutschland auch künftig so viele geflüchtete Menschen aufnehmen sollte wie derzeit. Dagegen meinen 40 Prozent, es sollten weniger Flüchtlinge aufgenommen werden. Gut jeder Zehnte (11 Prozent) findet, Deutschland sollte mehr Flüchtlingen Zuflucht gewähren.
Eine restriktivere Flüchtlingspolitik wird im Osten häufiger befürwortet als im Westen: In den ostdeutschen Bundesländern wollen 50 Prozent der Befragten, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnimmt, in den westlichen Bundesländern sind es 38 Prozent. Bei der gleichen Umfrage im September 2015 waren 37 Prozent der Bundesbürger für die Aufnahme gleich vieler, 33 Prozent für die Aufnahme von weniger und 22 Prozent für die Aufnahme von mehr Flüchtlingen.
Das Institut Infratest dimap befragte für den "Deutschlandtrend" im Auftrag des ARD-"Morgenmagazins" am 21. und 22. Januar telefonisch 1.043 Wahlberechtigte.
Kohleausstieg: Ex-Kommissionsmitglieder kritisieren Umsiedlung
Düsseldorf (epd). Die Einigung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung stößt bei einigen ehemaligen Mitgliedern der sogenannten Kohlekommission weiterhin auf Ablehnung. Es sei "nicht akzeptabel", dass laut der zwischen Bund und Kohleländern erzielten Einigung nun fünf Dörfer am Rand des Tagesbaus Garzweiler II abgebaggert werden sollten, sagte die Vertreterin der Tagebaubetroffenen im Rheinland, Antje Grothus, am 24. Januar in Düsseldorf. Ziel des vor einem Jahr erzielten Kohlekompromisses der Kommission sei es gewesen, die Umsiedlung weiterer Bewohner an den Tagebauen zu vermeiden. Dass jetzt dieser Punkt nicht berücksichtigt werde, vergifte das "gesellschaftliche Klima in Nordrhein-Westfalen".
Moratorium gegen RWE gefordert
Grothus forderte in diesem Zusammenhang, dass die Landesregierung ein Moratorium gegen RWE durchsetzt, mit dem unter anderem Maßnahmen zur Umsiedlung der Anwohner oder Abrissaktivitäten in den betroffenen Dörfern gestoppt werden sollen. Die Kohlebagger von RWE schafften "unwiederbringliche Fakten" und zerstörten die Umwelt, während den Energieunternehmen für den Ausstieg aus der Kohleverstromung millionenschwere Entschädigungen aus Steuergeldern gezahlt würden.
Der Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW, Reiner Priggen, räumte ein, dass die vorgelegte Planung zum Ausstieg aus der Kohleverstromung eine "vernünftige Grundlage" sei, allerdings gebe es sowohl bei den Umweltverbänden wie auch den Anwohnern der Tagebaue Unzufriedenheit. So kritisierte der ehemalige Grünen-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, dass der Tagebau Garzweiler II komplett ausgekohlt werden soll, während der nur 30 Kilometer entfernte Tagebau Inden vorfristig geschlossen werden soll.
Wegen der Abbaggerung am Tagebau Garzweiler II müssten Menschen umziehen, obwohl dies möglicherweise gar nicht mehr nötig sein könnte, wenn der Tagebau Inden länger genutzt werden könnte, sagte er. Dort seien die Umsiedlungen bereits beendet, so dass keine weiteren Anwohner von den Maßnahmen betroffen seien.
In dieser Frage müsse die Landesregierung Transparenz schaffen und eine Berechnung vorlegen, wie viel Kohle bis wann benötigt werde, forderte Priggen, der ebenfalls Mitglied der Kohlekommission war. Mit jedem einzelnen der betroffenen Bewohner am Tagebau Garzweiler II müsse gesprochen werden, um zu klären, ob er umsiedeln oder bleiben wolle. In diesem Zusammenhang gehe es um den "sozialen Frieden" in der Region.
Petition fordert Stopp von Uranmüllexporten nach Russland
Berlin/Münster (epd). Rund 70.000 Menschen in Russland haben eine Online-Petition von Greenpeace gegen deutsche Uranmülltransporte in ihr Land unterzeichnet. Darin wird von der Bundesregierung gefordert, die im Mai 2019 wieder aufgenommenen Exporte von der Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau nach St. Petersburg mit sofortiger Wirkung einzustellen, wie das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen mitteilte. Die Petition, die am 23. Januar dem Bundesumweltministerium in Berlin übergeben wurde, richtet sich demnach auch an die Energiekonzerne RWE und EON. Sie sind je zu einem Drittel Anteilseigner an der Gronauer Uranfabrik, die der Urenso-Konzern betreibt.
"Russland ist nicht Atommüllkippe"
Das Aktionsbündnis Münsterland, der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) sowie die Arbeitskreise Umwelt Gronau und Schüttorf unterstützen die russische Initiative. "Es ist ein Unding, dass die Bundesregierung diese Exporte überhaupt durchgewunken hat", kritisierte Matthias Eickhoff vom Aktionsbündnis. Atomabfälle, die in Deutschland anfallen, müssten auch hierzulande entsorgt werden. "Russland ist nicht die Atommüllkippe für die hiesige Atomindustrie."
Der Energieexperte von Greenpeace Russland, Rashid Alimov, und Vladimir Slivyak von der Umweltorganisation "Ecodefense" wiesen auf die vielen ungelösten Probleme in ihrer Heimat im Umgang mit dem abgereicherten Uranhexafluorid hin. Mittlerweile lagerten in Russland rund eine Million Tonnen solcher radioaktiven Abfallstoffe aus Urananreicherungsanlagen wie in Gronau, erklärten die Umweltschützer.
Eine sichere Entsorgung sei dort genauso ungelöst wie in Deutschland. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom habe deshalb im vergangenen November den Bau von neuen Schnellen Brütern vorgeschlagen, um den Uranmüll bis 2080 zu bewältigen. Das aber würde de facto einen Ausbau der Atomindustrie in Russland bedeuten, beklagten Alimov und Slivyak.
Politik und Gesellschaft nehmen Abschied von Manfred Stolpe

epd-bild/Sören Stache/dpa-Pool
Potsdam (epd). Mit einer Trauerfeier in Potsdam haben Vertreter aus Politik und Kirche sowie Familie und Weggefährten Abschied von Brandenburgs langjährigem Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (1936-2019) genommen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den SPD-Politiker und früheren Kirchenjuristen bei der Gedenkfeier in der evangelischen Nikolaikirche am 21. Januar als Mann des Ausgleichs und der Verständigung. Stolpe war am 29. Dezember nach langer Krankheit mit 83 Jahren gestorben.
"Wir trauern um eine politische Persönlichkeit", sagte Steinmeier: "Wir trauern um einen Brückenbauer, einen Meister des Dialogs, um einen Freund." Stolpe sei ein "Ostdeutscher, der den Ostdeutschen Mut machte" gewesen, sagte Steinmeier: "Er kämpfte um das Selbstwertgefühl der Ostdeutschen im geeinten Land." Die gesamte Bundesrepublik habe ihm viel zu verdanken.
"In einer Zeit der Extreme die Zuspitzung vermeiden, die Gewalt abzuwenden, Menschen zu schützen, das war sein Credo", betonte Steinmeier. Für die innere Einheit Deutschlands sei Stolpe von "überragender Bedeutung" gewesen. Er habe auch mit dem Herzen gespürt, was die Umbrüche für die Menschen bedeuten. Diese Geschichten müssten heute stärker Gehör finden.
"Gesicht und Stimme" Brandenburgs
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte, Stolpes Verdienste um Brandenburg seien groß. Er habe dem Land als erster Ministerpräsident "Gesicht und Stimme" gegeben. In der DDR habe er sich als Mittler zwischen Kirche und Staat und als "besonnener und mutiger Problemlöser" Verdienste erworben.
"Der Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus und gegen Menschenfeindlichkeit war ihm immer besonders wichtig", sagte Woidke: "Ihn ehren heißt, sein Werk fortsetzen." Dazu gehöre, den Menschen zuzuhören, das Miteinander zu pflegen sowie Frieden, Demokratie und Toleranz zu stärken und weiterzuentwickeln.
Der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, sagte in seiner Predigt, Stolpe habe Brücken zwischen Ost und West gebaut. Er habe in der DDR als Mann der Kirche "Freiheitsräume in einem System der Unfreiheit" geschaffen und stehe für "praktisch gelebte Humanität". Als "Vater des modernen Brandenburg" habe er im Amt des Ministerpräsidenten Identität und Selbstbewusstsein gegeben, sagte Stäblein.
Die Erinnerung an Manfred Stolpe sei mit Freude und Dankbarkeit verbunden, sagte die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU). Stolpe sei ein ungewöhnlicher Mensch gewesen, der anderen Schutz und Hoffnung gegeben habe.
Bestattung in Potsdam
Die Erschütterungen der Zeitgeschichte seien mitten durch Stolpes Leben gegangen, betonte Steinmeier. In einer Zeit der Kriegsgefahren und Kriege sei es ihm politische Pflicht gewesen, sich für Ausgleich und friedliche Verständigung einzusetzen. In der DDR sei Stolpes Telefonnummer für viele eine Versicherung gewesen, bei drohender Verhaftung um Hilfe bitten zu können.
Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident von Brandenburg und danach bis 2005 Bundesverkehrsminister. Der frühere Ost-Berliner Konsistorialpräsident der evangelischen Kirche in der DDR soll auf dem Bornstedter Friedhof in Potsdam bestattet werden.
Brückenbauer mit moralischem Kompass

epd-bild/Heike Lyding
Frankfurt a.M., Paris (epd). Einen "Moralpädagogen" hat er sich selbst einmal genannt: Alfred Grosser, in Deutschland geborener französischer Publizist und Politikwissenschaftler, hat sich wie nur wenige um die Annäherung und die Verständigung zwischen den beiden Nachbarländern nach dem Zweiten Weltkrieg verdient gemacht. Mit seinen mehr als 30 Büchern, ungezählten Vorträgen und Streitgesprächen ist der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels zum Brückenbauer zwischen den einstigen "Erzfeinden" geworden. Am 1. Februar wird Grosser 95 Jahre alt.
"Es war ein volles Leben", blickt der Politologe im epd-Gespräch zurück. Grosser wurde 1925 in Frankfurt am Main in eine bürgerlich-jüdische Familie geboren, die 1933 nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten nach Frankreich emigrierte. 1937 nahm er die französische Staatsangehörigkeit an, im Zweiten Weltkrieg hatte er Kontakt zur Résistance. Schon 1947 arbeitete Grosser an einer Zeitung für deutsche Kriegsgefangene mit. Das zeigte die Richtung: Getragen von der Überzeugung, dass es keine Kollektivschuld gibt, wollte er die Menschen "durch Wissen und Wärme aufklärerisch beeinflussen".
"Moralisierender Einzelgänger"
Von 1955 bis 1992 lehrte der "moralisierende Einzelgänger" als Professor an der Pariser Elitehochschule Sciences Po, publizierte regelmäßig in Zeitungen dies- und jenseits des Rheins, spießte deutsches Selbstmitleid und französische Überheblichkeit auf. Neben dem Friedenspreis (1975) wurde er unter anderem mit der Goethe-Medaille und dem Henri-Nannen-Preis ausgezeichnet. Sein Talent als Redner setzte der Pro-Europäer auch auf evangelischen Kirchentagen und im Deutschen Bundestag ein. Dort sprach er zuletzt 2014 bei der Gedenkfeier zu 100 Jahre Erster Weltkrieg.
Ein klarer moralischer Kompass leitet den Atheisten durchs Leben. "Mein Einsatz war eben nicht intellektuell begründet", schrieb Grosser einmal: "Es war der Wunsch, nach einer Moral zu handeln und handeln zu lassen." Dabei wirbt er um Verständnis für den Standpunkt des Anderen. "Die Einsicht in die Art, wie andere denken: Diese Pluralität ist für mich fundamental", sagt er im epd-Gespräch und nennt den Philosophen und Schriftsteller Albert Camus sein "Vorbild auf dem Gebiet des Menschseins".
Aus dieser Grundhaltung heraus kritisierte er immer wieder die israelische Politik. "Ich wurde als Jude von Deutschen verachtet - und glaubte nach Auschwitz doch an unsere gemeinsame Zukunft", schrieb Grosser 2007 in der Zeitschrift "Internationale Politik": "Ich verstehe nicht, dass Juden heute andere verachten und sich das Recht nehmen, im Namen der Selbstverteidigung unbarmherzig Politik zu betreiben."
Im epd-Gespräch sagt er: "Israel fordert heraus, dass es einen Antisemitismus gibt, indem man Antisemitismus nennt, was eine berechtigte Kritik an Israel oder der israelischen Politik ist." Diese Haltung trug ihm heftige Kritik ein, auch vom Zentralrat der Juden. Am 9. November 2010 drohte anlässlich seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 gar ein Eklat, der dann aber doch ausblieb.
Trump "einer der abstoßendsten Politiker"
Mit zunehmenden Alter hat der vierfache Familienvater die Zahl der öffentlichen Auftritte reduziert, Bücher will er nicht mehr schreiben. Doch noch immer verfolgt er von seiner Pariser Wohnung unweit des Eiffelturms aus das politische Leben, mit klarem Urteil und spitzer Zunge: US-Präsident Donald Trump sei einer "der abstoßendsten Politiker dieser Zeit", sagt Grosser dem epd: "Er ist für mich die Verkörperung dessen, was ein Politiker nicht sein soll." Mit Sorge erfüllt ihn auch der Aufstieg der AfD in Deutschland.
Zeit seines Lebens setzte sich der bibelfeste Atheist mit dem christlichen Glauben auseinander, blieb aber bei aller Verbundenheit klar auf Distanz: "Gott ist eine Schöpfung der Menschen", schrieb Grosser, der jahrzehntelang in der katholischen Zeitung "La Croix" veröffentlichte. So sieht er den Tod als "normales Phänomen": "Nach dem Tod ist nichts, also fürchte ich nichts für die Zukunft." In seinem Buch "Die Freude und der Tod" schrieb er 2011, dass er bereits sein Begräbnis vorbereitet habe. Mit seinem Schalk und der ihm nicht ganz fremden Eitelkeit fügte er hinzu: "Allerdings würde ich doch gerne kurz auferstehen, um die Nachrufe lesen zu können!"
Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing für Dunja Hayali

epd-bild/Jennifer Fey
Tutzing (epd). Die Journalistin und ZDF-Fernsehmoderatorin Dunja Hayali hat am 25. Januar den Toleranz-Preis der Evangelischen Akademie Tutzing in der Kategorie "Zivilcourage" erhalten. Damit würdigte die Akademie Hayalis besonderes Engagement gegen Rassismus, Fremdenhass und Rechtsextremismus und ihr beherztes Eintreten für eine offene Gesellschaft, sagte Akademiedirektor Udo Hahn. Die Haltung Hayalis, auch andersdenkenden Menschen mit Respekt und Fairness zu begegnen, sei beispielgebend. Deshalb solle der Preis auch ein Zeichen der Ermutigung und Solidarität sein, sagte Hahn.
"Fundament von Sachlichkeit"
In ihrer Laudatio beschrieb Shermin Langhoff, Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, die Preisträgerin als mutige und engagierte Journalistin. Selbst in den Kakophonien der sozialen Netze mit ihrem Zwang zur Verkürzung bemühe sich Hayali um "ein Fundament von Sachlichkeit, Fakten und Respekt", sagte Langhoff laut Redemanuskript. Allerdings bedeute dieses "Verstehenwollen" nicht, für alles Verständnis zu haben. Wer sich rassistisch äußere, sei, wie Hayali betont habe, "verdammt noch mal ein Rassist".
Der nicht dotierte Toleranzpreis wird seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre verliehen. Die neue Kategorie "Zivilcourage" wurde 2012 unter dem Eindruck eingeführt, dass mehr Zivilcourage gebraucht werde, wie Akademiedirektor Hahn sagte. Denn das Wesen einer Gesellschaft zeige sich im Umgang mit Minderheiten, Schutzsuchenden und Schwachen.
Verein Amica bekommt Göttinger Friedenspreis 2020
Göttingen (epd). Der Verein Amica, der Mädchen und Frauen in Kriegsgebieten unterstützt, erhält den Göttinger Friedenspreis 2020. Damit würdige die Stiftung Dr. Roland Röhl die langjährige engagierte Tätigkeit einer Organisation, "die nicht sehr laut, dafür umso effizienter an der Basis von Gesellschaften arbeitet", teilte die Preisjury am 24. Januar mit. "In diesem Sinne ist Amica für uns das Synonym für Zivilcourage und der Beleg für die Effizienz menschlichen und vor allem geschlechtergerechten Einsatzes." Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wird in diesem Jahr zum 22. Mal vergeben.
Amica hilft seit mehr als 25 Jahren Frauen und Mädchen in Kriegs- und Nachkriegsregionen wie Bosnien-Herzegowina, Syrien, Libyen oder der Ostukraine, ihr Leben zu meistern. Zu den Kernaufgaben des Vereins gehören die psychosoziale Arbeit mit Traumatisierten, medizinische Versorgung, Rechtsberatung, Maßnahmen zur Existenzsicherung sowie Projekte zu Chancengleichheit. Mit der Stärkung dieser Frauen und Mädchen leiste Amica einen entscheidenden Beitrag zur Versöhnung und zu einer künftigen, nachhaltigen Friedensordnung in diesen Konfliktländern, hieß es.
Streit über Preisträger 2019
Stifter des Göttinger Friedenspreises ist der 1997 verstorbene Göttinger Wissenschaftsjournalist Dr. Roland Röhl. Er beschäftigte sich vor allem mit Sicherheitspolitik sowie der Konflikt- und Friedensforschung und verfügte in seinem Testament, dass sein Nachlass zur Bildung eines Stiftungsvermögens verwendet wird. Stadt und Universität Göttingen sind Mitglied im Kuratorium der Stiftung. Die Entscheidung über die Preisträger fällt eine unabhängige dreiköpfige Jury. Der Friedenspreis 2020 wird am 7. März in der Aula der Hochschule vergeben.
Im vergangenen Jahr hatte es Streit wegen der Verleihung des Göttinger Friedenspreises an den Verein "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost" gegeben. Der Zentralrat der Juden und andere Organisationen kritisierten den Verein als antisemitisch, weil er die gegen Israel gerichtete Boykottbewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) unterstütze. Stadt und Universität zogen ihre Unterstützung für die Verleihfeier zurück. Der Preis wurde schließlich unter großem öffentlichen Interesse in einer privaten Galerie übergeben.
100 Sekunden vor Mitternacht: Weltuntergangsuhr vorgestellt
Washington (epd). Das US-Wissenschaftsmagazin "Bulletin of the Atomic Scientists" hat die Zeiger seiner symbolischen Weltuntergangsuhr von zwei Minuten auf 100 Sekunden vor Mitternacht gestellt. Demnach ist eine globale Katastrophe näher gerückt als jemals zuvor. Die Welt sei in einer "wahren Notsituation", erklärte "Bulletin"-Geschäftsführerin Rachel Bronson am 23. Januar in Washington.
Die Wissenschaftler des Magazins beklagten weltweit ungenügende Maßnahmen gegen die Erderwärmung und eine Schwächung internationaler Atomabkommen. Die Menschheit sehe sich gleichzeitig mit zwei existenziellen Gefahren, Atomkrieg und Klimawandel, konfrontiert, hieß es in der Erklärung des "Bulletin". Das öffentliche Bewusstsein für die Klimakrise sei im Jahr 2019 gewachsen, doch die Klimaschutzbemühungen der Regierungen seien zu dürftig, um den Herausforderungen zu begegnen.
Der Vorsitzende des "Bulletin"-Ausschusses für Wissenschaft und Sicherheit, Robert Rosner, warnte vor einer "Normalisierung" des Gefahren für die Welt. Er prangerte eine "Informations-Kriegsführung" an, mit der die erforderliche Zusammenarbeit untergraben werde.
Zeiger vorgestellt wegen Trump-Wahl
Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon beklagte bei der Präsentation der Weltuntergangsuhr ein Versagen der Regierungen im Umgang mit den drohenden Gefahren. Er forderte mehr Multilateralismus. Die USA müssten beginnen, Führung zu zeigen, denn sonst könne man die erforderlichen Klimaziele nicht erreichen.
Die "Doomsday-Uhr" soll verdeutlichen, wie nah die Menschheit vor der Selbstzerstörung steht. Erstmals publizierte das Wissenschaftsmagazin die Uhr im Jahr 1947. Damals ging die größte Gefahr von Atomwaffen und dem drohenden Wettrüsten aus. Im Jahr 2007 haben die Forscher erstmals den Klimawandel berücksichtigt.
1947 stand die Uhr auf sieben Minuten vor zwölf. Wegen des ersten Atomwaffentests in der Sowjetunion stellte das "Bulletin" die Uhr zwei Jahre danach auf drei Minuten vor zwölf. 1953 erreichten die Zeiger wegen des sowjetischen Wasserstoffbombentests zwei Minuten vor zwölf. Am weitesten entfernt von Mitternacht (17 Minuten) stand die Uhr im Jahr 1991, also nach dem Ende des Kalten Krieges.
Seitdem bewegen sich die Zeiger schrittweise Richtung Mitternacht. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten rückte das "Bulletin" den Zeiger 2017 auf zweieinhalb Minuten vor zwölf und 2018 auf zwei Minuten vor zwölf. 2019 blieben die Zeiger auf zwei Minuten vor zwölf stehen. Das "Bulletin of the Atomic Scientists" wurde 1945 von US-Wissenschaftlern gegründet, die am Bau der ersten Atombombe beteiligt waren.
Rund 1,4 Millionen Euro Spenden für Krefelder Zoo
Solidaritätswelle für den Krefelder Zoo: 1,4 Millionen Euro Spenden nach dem Brand des Affenhauses. An einer Gedenkveranstaltung haben 250 Menschen teilgenommen. Der Krefelder OB verteidigte den geplanten Bau eines "Artenschutzzentrums Affenpark".Krefeld (epd). Geldspenden in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro sind bisher nach dem Brand im Krefelder Zoo zusammengekommen. Etliche Menschen hätten Geld gespendet und Aktionen ins Leben gerufen, um für den Zoo zu sammeln, sagte der Vorsitzende der Zoofreunde, Friederich Berlemann, am 24. Januar bei der offiziellen Gedenkveranstaltung vor dem Krefelder Rathaus. Außerdem gab es Sport- und Kulturveranstaltungen zugunsten des Zoos. "Krefeld und das Umland stehen zusammen", betonte Berlemann.
Etwa 250 Menschen waren laut Polizei zu der Gedenkstunde gekommen. Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD), der gemeinsam mit der Zooleitung zur Gedenkveranstaltung unter dem Motto "Unser Zoo - unsere Verantwortung" eingeladen hatte, sagte in seiner Ansprache, er sei als kleiner Junge oft im Zoo gewesen und natürlich auch im Affenhaus: "45 Jahre lang war das einer der beliebtesten und meistbesuchten Orte in Krefeld."
Rund 250 Menschen bei Gedenkveranstaltung
Meyer dankte für die Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität mit dem Zoo, die Menschen etwa mit Kerzen, Briefen und Anteilnahme in sozialen Netzen zum Ausdruck gebracht hätten. Die Zoo-Mitarbeiter sowie die vielen Kräfte von Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz und Notfallseelsorge hätten in der Neujahrsnacht "Großartiges geleistet".
Der SPD-Politiker sprach sich ausdrücklich dafür aus, dass die Tradition, im Krefelder Zoo Affen zu beherbergen, fortgesetzt werden soll. Er zeigte Verständnis für das Anliegen von Tierschützern, die Tiere lieber in freier Wildbahn geschützt und bewahrt sähen. Allerdings wären viele Tierarten längst ausgestorben, wenn es keine Zoos gäbe, argumentierte Meyer. "Außerdem helfen Zoos auf der ganzen Welt durch Auswilderung auch der natürlichen Population, sich zu erholen." Zoos seien zudem Orte der "emotionalen Bildung", an denen Menschen Empathie mit anderen Lebewesen lernen und ein Gefühl für die Bedeutung der Vielfalt des Lebens bekommen könnten.
An der Gedenkveranstaltung nahm auch Weltzoo-Präsident Theo Pagel teil, der die Wiederaufbaupläne der Stadt und der Zooleitung bekräftigte. In einem neuen "Artenschutzzentrum Affenpark" sollen die Tiere künftig gehalten werden. Die Errichtung des Parks werde allerdings Jahre dauern, da der Zoo von Grund auf neu planen müsse, hieß es.
Zoodirektor Wolfgang Dreßen erinnerte in seiner Rede an die Tierpersönlichkeiten, die das Affenhaus geprägt haben und die "wir alle schmerzlich vermissen". Während seiner Ansprache wurden Fotos der verstorbenen Menschenaffen gezeigt.
Bei dem Feuer waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere des 1975 eröffneten Affenhauses verendet, darunter acht Menschenaffen. Es entstand ein Sachschaden in zweistelliger Millionenhöhe. Verursacht wurde der Brand nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft durch drei Krefelderinnen, die fünf sogenannte Himmelslaternen in die Luft steigen ließen, die zwar legal gekauft werden können, deren Benutzung aber verboten ist. Eine dieser fliegenden Leuchtfackeln hatte den Brand des Affenhauses im Bereich des Daches ausgelöst.
Soziales
Zahl der Multi-Jobber auf mehr als 3,5 Millionen gestiegen

epd-bild/Steffen Schellhorn
Berlin (epd). Mehr als 3,5 Millionen Menschen in Deutschland hatten im Juni 2019 mehr als einen Job. Das geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, wie die Partei am 21. Januar in Berlin mitteilte. Demnach ist die Zahl der Multi-Jobber oder Mehrfachbeschäftigten gegenüber dem Jahr 2018 um 3,6 Prozent gestiegen. 2004 gab es den Angaben nach 1,86 Millionen Mehrfachbeschäftigte.
Fast drei Millionen Menschen hatten im Vorjahr neben einem regulären Job noch eine geringfügige Beschäftigung, wie es weiter hieß. 345.440 Menschen gingen zwei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen nach. Dritthäufigste Variante war die Kombination von zweien oder mehr sogenannter Minijobs. Das galt für 260.666 Fälle.
"Aus purer finanzieller Not"
Die Linken-Arbeitsmarktexpertin Zimmermann sagte, für immer mehr regulär Beschäftigte reiche der Verdienst nicht aus, um über die Runden zu kommen. Der überwiegende Teil der Multi-Jobber "dürfte aus purer finanzieller Not mehr als einen Job haben und nicht freiwillig".
Sie verwies auf eine im vergangenen Jahr erschienenen Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Danach sind für 53 Prozent der Befragten finanzielle Schwierigkeiten ausschlaggebend für die Nebentätigkeit. 24 Prozent konnten keine Vollzeitstelle finden und nahmen daher die Nebentätigkeit auf, um ihr Einkommen aufzustocken.
Um der Zunahme von Multi-Jobbing zu begegnen, sei eine Erhöhung des Mindestlohns in einem ersten Schritt auf zwölf Euro pro Stunde dringend notwendig, sagte Zimmermann. Zugleich sprach sie sich für das Ende von Leiharbeit und von sachgrundlosen Befristungen von Jobs aus. "Arbeit, von der man leben kann, ist das Maß der Dinge", sagte sie. Dafür müsse die Bundesregierung die Voraussetzungen schaffen.
12.000 Langzeitarbeitslose in NRW finden neue Jobs
Seit Anfang 2019 ist das neue Teilhabechancengesetz auch in Nordrhein-Westfalen am Start. Bislang hat das Programm in NRW etwa 12.000 Langzeitarbeitslosen eine neue Beschäftigung vermittelt. Die Arbeitgeber erhalten dabei eine umfangreiche Förderung.Düsseldorf (epd). Torsten Kämper hat dank seiner neuen Beschäftigung wieder "Struktur im Leben" bekommen, und seinem neuen Kollegen Bodo Michael Sosnowski gibt der neue Job das "tolle Gefühl, das Geld wieder selbst zu erwirtschaften". Die beiden 45 und 56 Jahre alten Männer arbeiten derzeit beim ambulanten Pflegedienst Heinzelmännchen in Düsseldorf - nachdem sie zuvor mehrere Jahre lang arbeitslos und auf Hartz IV (Arbeitslosengeld II) angewiesen waren. Sie profitieren von dem vor einem Jahr in Kraft getretenen Teilhabechancengesetz, das Langzeitarbeitslose in dauerhafte Beschäftigung bringen soll. Am 20. Januar informierten das NRW-Arbeits- und Sozialministerium, die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit sowie der Städtetag NRW in Düsseldorf über die bisherige Bilanz des Programms.
Positives Zwischenfazit zum Teilhabechancengesetz
Kämper und Sosnowski sind zwei von etwa 12.000 Menschen, die im ersten Jahr des neuen Programms eine Beschäftigung fanden. Als "großen Durchbruch" bei der Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen würdigte denn auch Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann das Teilhabechancengesetz. Fast 13.000 seit langem arbeitslose Menschen in Nordrhein-Westfalen hätten auf diese Weise einen Job bekommen, sagte der CDU-Politiker. Etwa 1.000 von ihnen hätten die neue Beschäftigung dann wieder aufgegeben - eine vergleichsweise geringe Abbruchquote, betonte der Minister. Die neuen Fördermöglichkeiten kämen auch stark betroffenen Regionen zugute, wie etwa das Ruhrgebiet oder das Bergische Land.
Nach dem Start gehe es nun darum, dass die Beschäftigten auch nach Ende des Förderzeitraums eine dauerhafte Tätigkeit bei den Arbeitgebern erhalten, betonte Laumann. Er erwarte deshalb, dass auch ein "gewichtiger Anteil" der geförderten Arbeitsplätze in die Regelbeschäftigung übergehe. Wie hoch die Quote sein sollte, wollte der Minister auf Nachfrage nicht sagen.
Laut dem Vorsitzenden der NRW-Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Torsten Withake, gibt es derzeit rund 240.000 Langzeitarbeitslose in NRW - also Menschen, die seit mindestens einem Jahr keinen sozialversicherungspflichtigen Job haben. Die neue Tätigkeit sei "nah an der Realität", es würden "echte Arbeitsplätze" gefördert, betonte Withake. Zur Unterstützung der neuen Beschäftigten gibt es zudem eine Begleitung durch Coaches der Jobcenter, die den neuen Mitarbeitern helfen, im Berufsleben wieder Fuß zu fassen. In diesem Jahr sollten über das Programm etwa 9.000 weitere Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.
Zwei Zielgruppen
In diesem Jahr stehen 1,44 Milliarden Euro in NRW für die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen zur Verfügung. Das Förderprogramm hat zwei Zielgruppen: Zum einen Arbeitssuchende ab 25 Jahren, die in den vergangenen sieben Jahren sechs Jahre lang Arbeitslosengeld II bezogen. Die zweite Zielgruppe umfasst die, die mindestens zwei Jahre arbeitslos sind. Firmen, die Arbeitssuchende der ersten Gruppe einstellen, erhalten in den ersten beiden Jahren eine Förderung von 100 Prozent des Mindestlohns. In jedem weiteren Jahr verringert sich der Zuschuss um jeweils zehn Prozent. Die Förderung dauert maximal fünf Jahre. Unternehmen, die Menschen einstellen, die zwei Jahre arbeitslos waren, erhalten einen Zuschuss von zwei Jahren: Die Förderung liegt bei 75 Prozent im ersten und bei 50 Prozent im zweiten Jahr.
Auch der Städtetag NRW begrüßte das neue Programm. Der Vorstand des kommunalen Spitzenverbandes, Andreas Mucke (SPD), ist Oberbürgermeister in Wuppertal: Dort habe die Stadt dank des Programm etwa 300 neue Stellen geschaffen - für Menschen, die zum Beispiel im Stadtteilservice arbeiten.
Der Fachbereichsleiter beim Jobcenter Essen, Dietmar Gutschmied, verwies darauf, dass die Jobcenter in der Pflicht seien, die Arbeitgeber auf das Programm hinzuweisen. Das Teilhabechancengesetz sei "kein Selbstläufer", sondern müsse immer wieder beworben werden. Bislang sei zudem der Frauenanteil unter den Vermittelten mit 33 Prozent deutlich zu niedrig.
Die NRW-Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Anja Weber, lobte die Einführung des Programms, machte aber "enormen Verbesserungsbedarf" aus. Bislang hielten sich etwa Kommunen und Wirtschaft bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze noch zurück. Überdies müsse das Programm über den Förderzeitraum von derzeit fünf Jahren hinaus bestehen bleiben.
App "Heimfinder NRW" zeigt freie Pflegeplätze an

epd-bild/Jürgen Blume
Düsseldorf (epd). Mit einer App "Heimfinder NRW" will das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium den Überblick über freie Pflegeplätze verbessern. In der Datenbank werden freie Langzeit- und Kurzzeitpflegeplätze in der Umgebung angezeigt, wie das NRW-Gesundheitsministerium am 21. Januar in Düsseldorf mitteilte. Zudem werden Ansprechpartner und Kontaktdaten der Pflegeeinrichtungen angezeigt. Neben der App ist die Datenbank auch im Netz unter "heimfinder.nrw.de" abrufbar. Am Dienstag zeigte die Datenbank 959 freie Plätze in der Kurzzeitpflege und 1.921 in der Dauerpflege. Private Pflegeanbieter kritisieren zusätzlichen Bürokratieaufwand.
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, das Angebot solle die Suche nach freien Plätzen für Betroffene und Angehörige einfacher und übersichtlicher machen. So müssen nicht mehr alle Einrichtungen in der Umgebung einzeln auf der Suche nach einem freien Platz kontaktiert werden. Kein anderes Bundesland habe bisher ein vergleichbares Angebot, betonte die FDP-Landtagsfraktion. Auch Pflegeheime sollen von dem Angebot profitieren, indem sie ihre freien Plätze gezielter anbieten und so unnötige Platzanfragen vermieden würden, sagte die gesundheitspolische Sprecherin Susanne Schneider.
Private Pflegedienstleister kritisieren Bürokratieaufwand
Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) kritisierte, das neue Angebot werde lediglich versorgungspolitische Probleme offenbaren: "Aufgrund von schlechten Finanzierungsbedingungen und der zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen wird es zunehmend schwieriger, einen Platz in einem Pflegeheim zu finden, und die Wartelisten werden immer länger", sagte der NRW-Landesvorsitzende Christof Beckmann. Zudem sei ein weiterer Bürokratieaufbau bei den Pflegeeinrichtungen zu befürchten. Das Land hat die Einrichtungen gesetzlich dazu verpflichtet, tagesaktuell in die Datenbank einzugeben.
Neben einer vereinfachten Suche verspricht sich die Regierung auch mehr Informationen über die Lage in NRW: "Gleichzeitig gewinnen wir damit nun erstmals einen Überblick über die tatsächliche Versorgungssituation in den Regionen", sagte Laumann. Die App wurde nach dem Vorbild eines ähnlichen Angebots im Rhein-Kreis Neuss entwickelt. Für kommende Versionen ist unter anderem auch ein Überblick über Plätze in Tagespflegeeinrichtungen geplant.
KD-Bank steigert Kreditvergabe um zehn Prozent
Dortmund (epd). Die Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) hat ihr Kreditvolumen im vergangenen Jahr um 10,3 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro gesteigert. Dabei wurden 285 Millionen Euro an neuen Krediten vergeben, wie die Bank in Dortmund mitteilte. Die Bilanzsumme stieg um drei Prozent auf über 5,8 Milliarden Euro. Die Anlagen der Kunden in Wertpapieren, inklusiven Vermögensverwaltungen und Spezialfonds legten um 9,3 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro zu.
Von den neuen Krediten ging knapp ein Drittel an Einrichtungen für ältere Menschen, ein Fünftel floss an Investitionen sozialer Einrichtungen von der Jugendhilfe bis zur Behindertenhilfe. Die übrigen Kreditmittel verteilen sich auf die Bereiche bezahlbarer Wohnraum, Gesundheitswirtschaft, lebendiges Gemeindeleben und Bildung.
"Die starke Entwicklung im Kreditgeschäft zeigt, dass Finanzierungen für sozialverantwortliche Projekte ein weiterhin wachsender Markt sind", erklärte der Vorstandsvorsitzende Ekkehard Thiesler. Die KD-Bank sei in diesem Segment erfolgreich positioniert. Es sei ihr in einer Dekade im Schatten der Finanzkrise gelungen, bei den Einlagen um ein Drittel und bei den Krediten um 58 Prozent zuzulegen. "Die Eigenmittel konnten wir um über 100 Prozent aufstocken, die Ertragslage ist stabil."
Soziale Dimension nicht vernachlässigen
Thiesler warnte davor, beim Finanzwirtschafts-Trend Nachhaltigkeit nur auf das Thema Klimawandel zu achten und die soziale Dimension aus dem Blick zu verlieren: "Die Armutsbekämpfung und der Umweltschutz müssen Hand in Hand gehen." Die KD-Bank orientiere sich an den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und setze den Schwerpunkt dabei auf die klassischen diakonisch-sozialen Themen Hilfe, Gesundheit und Bildung.
Die KD-Bank ist eine Genossenschaftsbank mit rund 4.200 Mitgliedern aus Kirche und Diakonie und zählt zu den größten Kirchenbanken Deutschlands. Zu ihren Kunden gehören Kirchen, kirchliche Einrichtungen und Stiftungen sowie soziale Unternehmen wie Krankenhäuser, Hospize, Pflegedienste, Behindertenwerkstätten und Kindertagesstätten.
Modellversuch: Diakonie vernetzt Dorfbewohner
Berlin, Hörstel (epd). Die Diakonie hat in Berlin gemeinsam mit der Nachbarschaftsplattform nebenan.de das Modellprojekt "Dörfer mit Zukunft" gestartet. "Ziel ist ein digitaler Dorfplatz als Chance für mehr Teilhabe von Dorfbewohnern am öffentlichen Leben", sagte Diakonievorstand Maria Loheide am 24. Januar in Berlin. Man wolle in fünf Bundesländern testen, ob und wie sich das soziale Miteinander in ländlichen Räumen durch digitale Vernetzung ergänzen und verbessern lasse.
Bei dem Testlauf werden fünf diakonische Einrichtungen mit Unterstützung von nebenan.de individuelle digitale Nachbarschaften für ihre Gemeinde aufbauen und die Bewohner vernetzen. Das solle den persönlichen Austausch initiieren und fördern.
Beteiligt sind Einrichtungen in Züssow (Mecklenburg-Vorpommern), Weilrod (Hessen), Hörstel (Nordrhein-Westfalen), Bischofswerda (Sachsen) und Ratzeburg (Schleswig-Holstein). Sie erhalten den Angaben nach ein sogenanntes Organisationsprofil, über das sie vorher registrierte Personen im Dorf über Neuigkeiten, Veranstaltungen und Aktionen informieren und in Dialog treten können. So entstehe ein digitaler Dorfplatz, an dem sich alle Akteure in einem geschützten Raum vernetzen könnten.
Während Nachbarschaftsplattformen in der Stadt bereits erfolgreich genutzt würden, seien sie im ländlichen Raum noch selten, erläutert die Diakonie. Digitale Nachbarschaftsnetzwerke böten als Plattform gerade für kleine Ortschaften und weit verstreut lebende Menschen enormes Potenzial.
Zahl der Tests an Embryonen auf Erbkrankheiten gestiegen
Berlin (epd). Die Zahl der Fälle, in denen mithilfe von Präimplantationsdiagnostik (PID) Embryonen auf schwere Erbkrankheiten untersucht werden, steigt. Wie aus dem am 22. Januar vom Bundeskabinett beratenen Bericht über die Erfahrungen mit der PID hervorgeht, wurde 2018 in 319 Fällen einer PID zugestimmt, in 315 Fällen wurde sie angewendet. Im Jahr zuvor lag die Zahl der Zustimmungen bei 286, 2016 bei 174. Die Zahl der Zustimmungen liegt leicht über der Erwartung der entsprechenden Verordnung, die von rund 300 Fällen pro Jahr ausgeht, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte.
Bei der PID werden befruchtete Eizellen vor dem Einpflanzen in den Mutterleib auf schwere Erbkrankheiten untersucht. Ausgelöst durch ein Urteil des Bundesgerichtshofs hatte der Bundestag 2011 beschlossen, diese Tests in Ausnahmefällen zu erlauben. Danach sind die Gentests an Embryonen bei der künstlichen Befruchtung möglich, wenn aufgrund der Anlagen des Elternpaares ein hohes Risiko für eine schwere Erbkrankheit des Kindes zu befürchten ist oder die Gefahr einer Tot- oder Fehlgeburt besteht. Die Bundesregierung muss alle vier Jahre einen Bericht über die Erfahrungen mit der PID vorlegen.
Ethikkommission entscheidet
Über jeden einzelnen Fall einer Präimplantationsdiagnostik muss eine Ethikkommission entscheiden. Wie aus dem Regierungsbericht hervorgeht, gab es mit Stand September 2019 fünf solcher Ethikkommissionen, die teilweise für mehrere Bundesländer Anträge prüfen. Zehn sogenannte PID-Zentren, in denen die Untersuchungen vorgenommen wurden, waren im Herbst vergangenen Jahres zugelassen.
Paare, die eine PID beantragen, haben oft wegen eines Gen-Defekts bereits Fehl- oder Totgeburten erlitten. Es ist streng geregelt, dass die Tests nur solche Gen-Defekte vermeiden sollen, nicht aber andere Merkmale des Kindes untersuchen. Die Paare müssen die Untersuchung, die bis zu 20.000 Euro kosten kann, selbst bezahlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im vergangenen Jahr eine Kassenfinanzierung vorgeschlagen, war dabei aber auf Widerstand in der eigenen Partei gestoßen.
"March for Life": Trump bei Kundgebung gegen Abtreibung
Washington (epd). Als erster US-Präsident hat Donald Trump am 24. Januar bei der jährlichen Anti-Abtreibungskundgebung "March for Life" in Washington gesprochen. Trump sagte vor Zehntausenden Teilnehmern, jedes Kind sei eine "heilige Gabe Gottes". "Ungeborene Babys" hätten noch nie einen so starken Beschützer im Weißen Haus gehabt wie ihn.
Der "Marsch für das Leben" findet jährlich statt. Er wendet sich gegen das Urteil des Obersten US-Gerichtes vom 22. Januar 1973 zur Legalisierung der Abtreibung. Schwangerschaftsabbruch sei durch das Recht auf die Privatsphäre gedeckt, befanden die Richter damals. "Eure Generation wird Amerika zur Pro-Life-Nation machen", ermutigte Trump die vielen jungen Teilnehmer in seiner etwa zehnminütigen Ansprache.
Man müsse Abtreibung "undenkbar" machen, sagte die "March for Life"-Präsidentin Jeanne Mancini. Sie dankte Trump für das, was er für die Bewegung getan habe und für das, was er noch tun werde. "Four more years" (Nochmal vier Jahre), riefen Kundgebungsteilnehmer mit Blick auf die Präsidentschaftswahl im November.
Gerichte umbesetzt
Hoffnung macht Lebensschützern die Umbesetzung der Gerichte mit "konservativen" Juristen durch Trump und seine Ernennung von zwei Richtern zum Obersten Gericht. Bei Testfällen zur Abtreibung würden die Richter das Urteil von 1973 aufheben oder schwächen, wird vermutet.
In den USA ist die Zahl der Abtreibungen dem Familienplanungsinstitut "Guttmacher Institute" zufolge in den vergangenen Jahren gesunken. Im Jahr 2017 seien 862.320 Abtreibungen vorgenommen worden, rund 200.000 weniger als 2011. Noch nie seit 1973 sei die Abtreibungsrate von Frauen im gebärfähigen Alter (15 bis 44) so niedrig gewesen, hieß es.
Kaum ein politisches Thema weckt in den USA so starke Emotionen wie Abtreibung. Über die Jahre haben sich die politischen Fronten verhärtet. Republikaner sind gegen das Urteil von 1973. Demokraten lehnen Abtreibungsrestriktionen weitgehend ab.
Angeklagt wegen hundertfachen schweren sexuellen Missbrauchs
Dem Angeklagten wird schwerer sexueller Missbrauch von vier Jungen vorgeworfen. Vor dem Landgericht Freiburg hat der Prozess gegen den 42-jährigen ehemaligen Leiter einer Pfadfinder-Gruppe im baden-württembergischen Staufen begonnen.Freiburg (epd). Schwerer sexueller Missbrauch, Körperverletzung und versuchte Vergewaltigung von Kindern: Vor dem Landgericht Freiburg hat am 20. Januar die Verhandlung gegen den ehemaligen Leiter einer evangelischen Pfadfindergruppe wegen hundertfachen Missbrauchs von Kindern begonnen. Dem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich seit Februar 2019 in Untersuchungshaft befindet, werden 330 Fälle sexueller Übergriffe auf vier Jungen im Tatzeitraum von 2010 bis 2018 vorgeworfen.
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte des Angeklagten und der Opfer findet die Verhandlung in weiten Teilen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Vorgesehen sind sieben Verhandlungstage. Ein Urteil könnte es danach am 18. Februar geben.
"Schweigegelübde"
Der Angeklagte habe eine starke Nähebeziehung zu den Jungen aufgebaut und deren Vertrauen ausgenutzt, um sie zu missbrauchen, sagte Staatsanwältin Nikola Novak bei der Verlesung der Anklageschrift. Die Jungen seien im Tatzeitraum zwischen acht und 14 Jahre alt gewesen. Er habe die Kinder manipuliert und ihnen gesagt, dass solche intimen Kontakte zu Erwachsenen normal sind.
Auf ablehnende Gefühle der Kinder oder Schmerzen sei er nicht eingegangen, hieß es weiter. Die Kinder hätten sich lange Zeit niemanden anvertraut, da sie um die Sympathie des Pfadfinderleiters gefürchtet hätten. Sie hätten von einem "Schweigegelübde" gesprochen.
Über Pfadfindergruppe kennengelernt
Den Angaben zufolge soll der angeklagte Christian L. zwei Jungen über seine Tätigkeit bei der Pfadfindergruppe "Lazarus von Schwendi" im Schwarzwaldort Staufen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kennengelernt haben, zwei weitere Jungen in einer Theatergruppe und auf einem Campingplatz. Die Übergriffe auf die Jungen sollen sich überwiegend in der Wohnung des Angeklagten ereignet haben. Ursprünglich beschuldigte ihn die Staatsanwaltschaft des Missbrauchs der vier Jungen in fast 700 Fällen. Die Jugendkammer des Landgerichts ließ 330 Taten zur Verhandlung zu.
Bei den Pfadfindern in Staufen leitete der Beschuldigte von 1999 bis 2011 mit einer dreijährigen Unterbrechung die Gruppe "Wölflinge" mit Grundschulkindern von der ersten bis zur vierten Klasse. In der Zeit der Unterbrechung von 2004 bis 2007 lief gegen ihn ein Strafverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Damals war der gelernte Krankenpfleger freigesprochen worden. Anschließend sei er von den Pfadfinderleitern gebeten worden, ob er nicht wieder einsteigen wolle, sagte der Angeklagte vor Gericht. Auflagen habe er keine bekommen.
Landeskirche beauftragt externen Juristen
Die Christliche Pfadfinderschaft Deutschland (CPD) bestätigte, dass der Beschuldigte und auch einzelne Betroffene Mitglieder der CPD-Gruppe in Staufen im Breisgau waren. Von dem Prozess erhoffen sich die Verantwortlichen "eine umfangreiche Aufklärung, insbesondere im Sinne der Betroffenen, denen weiteres Leid soweit möglich erspart bleiben soll", heißt es auf der Homepage.
Auch die Landeskirche sei in Gedanken bei den Opfern und hoffe auf umfassende Aufklärung durch das Gericht, sagte der Sprecher der Evangelischen Landeskirche in Baden, Daniel Meier. Christian L. sei von allen ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der Pfadfinderarbeit entlassen worden, als der Kirchengemeinderat von dem ersten Verfahren erfahren habe, sagte Meier dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Nach der damaligen Gerichtsentscheidung habe die Kirchengemeinde keinen Anlass gesehen, die Entscheidungsfindung des Gerichts nachzuprüfen, sagte Meier weiter. Jetzt habe die Landeskirche jedoch einen externen Juristen beauftragt, der nach Abschluss des derzeit laufenden Verfahrens den Prozess der damaligen Wiedereinstellung überprüfen soll.
"Weil ich schwarz bin"

epd-bild / Böschemeyer
Frankfurt a.M. (epd). Am Anfang wollte es niemand wahrhaben. Doch eines Morgens, als die fünfjährige Besma an der Garderobe ihrer Kita Mantel und Mütze ablegte und ihre Hausschuhe hervorholte, wurde das Problem in aller Schärfe klar. "Oh Besma, voll eklig", krakeelte ein Junge statt einer Begrüßung. Schon seit Tagen hatte das Mädchen nicht mehr in die Kita gehen wollen, klagte, dass andere Kinder nicht mehr mit ihr spielen wollten: "Weil ich schwarz bin." Doch bisher hatten die Erzieher und Erzieherinnen die rassistische Ausgrenzung nicht ernstgenommen.
"Kinder reden halt so", hieß es zunächst in der Kita im Rhein-Main-Gebiet. Doch nachdem Besmas Mutter Alarm geschlagen hatte, wurden die Beschäftigten aufmerksamer - und erschraken selbst, was sie unter den Jungen und Mädchen im Kindergartenalter hörten. Da fielen Sätze wie: "Du bist braun, ich will nicht neben dir sitzen" und "Du darfst nicht mitspielen". Besma, die in Wirklichkeit anders heißt, ist als Tochter afrikanischer Eltern in Deutschland geboren und das einzige Kind mit dunkler Haut in ihrer Kita. Sonst fröhlich, lebhaft und offen, kam sie nun häufig weinend zu einer Erzieherin: "Niemand mag mich."
"Ohnmachtsgefühl"
Die Soziologin, Journalistin und Moderatorin Nkechi Madubuko kennt solche Fälle und hat die Wirkung rassistischer Äußerungen wissenschaftlich untersucht. Sie sieht Eltern und Erzieher dringend gefordert, ausgegrenzte Jungen oder Mädchen zu schützen. "Rassismus-Erfahrungen sind eine ernste Bedrohung für das Selbstwertgefühl eines Kindes. Sie verletzen das Kind auf eine solche Weise, dass es sich selbst nicht mehr positiv wahrnimmt, sich schämt und unsicher wird", warnt die nigerianische Autorin und Diversity-Trainerin, die in Deutschland aufgewachsen ist und selbst drei Kinder hat. "Es ist ein Ohnmachtsgefühl." Schwere Persönlichkeitsstörungen könnten die Folge sein.
Bei Jayden, heute zehn Jahre alt, führten solche Erlebnisse fast zu einer Art Identitätskrise, wie seine Mutter Michelle Jackson berichtet. Besonders schlimm in Erinnerung blieb, dass der Junge als Fünfjähriger während einer Übernachtung in einem Tennis-Camp als einziger im Zelt der Betreuer schlafen musste. Wegen seiner dunklen Hautfarbe wollte kein anderes Kind mit ihm ein Zelt teilen. Viele Menschen wollten zudem nicht glauben, dass sein Vater Afroamerikaner ist, und hielten ihn für ein adoptiertes Kind. Da Jayden wenig Kontakt zu seinem Vater hatte, zweifelte er selbst und fragte seine weiße deutsche Mutter: "Bin ich wirklich dein Sohn?"
Die Pädagogin Miriam Nadimi Amin in Leipzig appelliert an Betreuungspersonal, sofort auf rassistische Äußerungen zu reagieren: "Es ist ganz wichtig, mit dem Kind zu reden, das ausgegrenzt wurde, es zu schützen, zu trösten und zu bestärken", erläutert die 48-jährige Diversity-Trainerin, deren Vater aus dem Iran stammt. Denn sonst werde dem Kind vermittelt: "Mit mir stimmt was nicht." Und dass es nicht dazugehöre. Deshalb müsse man dem Kind sagen: "Mit dir stimmt alles, du bist richtig, du bist toll, so wie du bist." Es sei nicht in Ordnung, dass ein Kind nicht mit ihm spielen wolle, weil es eine andere Hautfarbe habe als dieses Kind. Und: "Komm wir suchen dir jemanden, der gerne mit dir spielen möchte."
"Feine Beobachter"
Woher solche Sprüche kommen? "Kinder greifen auf, was sie so hören. Das muss nicht im Elternhaus sein", sagt Amin. "Kinder sind feine Beobachter, sie registrieren auch nonverbale Botschaften wie Augenrollen - so werden Vorurteile weitergegeben." Kinder seien noch beim Erlernen ihres Sozialverhaltens. Deshalb sei kluges Reagieren so wichtig.
Auch die Berliner Soziologin Madubuko warnt davor, rassistische Äußerungen schweigend durchgehen zu lassen. "Kinder, die ausgrenzen, lernen auf diese Weise, dass es in Ordnung ist, und führen dieses Verhalten weiter", sagt sie. Aber es gehe auch um die Mädchen und Jungen, die die Szene beobachtet haben. "Kinder, die Ausgrenzung mitbekommen, sehen, dass nichts passiert, und lernen, es sei akzeptiert."
In Besmas Kita begann das Betreuungspersonal, das Thema Vielfalt im Morgenkreis aufzugreifen, Gespräche mit einzelnen Kindern und auch deren Eltern zu führen. Auch eine Aussage, die ohne verletzende Absicht gemacht werde, könne wehtun, sagt Pädagogin Amin. "Wichtig ist, dass wir Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion in eine Kategorie packen, sondern als Individuum wahrnehmen." Schwarz-Sein müsse auch nicht bedeuten, aus Afrika zu kommen: "Die meisten Kinder sind in Deutschland geboren. Und Deutsche sehen ganz unterschiedlich aus."
Jayden kommt in der Schule nun etwas besser klar. Er spielt Basketball und trägt seine Haare als Afro. "Das ist cool", sagt seine Mutter. Doch in ihrem hessischen Dorf hört sie immer noch Sprüche wie "Da wohnt der Neger".
Besma geht inzwischen wieder fröhlich in ihre Kita. Doch die Erzieherinnen berichten: "Das Anderssein ist immer noch Thema." Das zeigt sich auch, als das Mädchen sich an eine befreundete Frau wendet: "Wenn Du meine Mutter wärst und ich wäre weiß, was wäre dann?" Die Pädagogin Amin ist überzeugt: "Diese Frage wird sie leider wohl ihr ganzes Leben begleiten." Denn weiße Haut bedeute immer noch Privilegien.
Die Kraft des Atems

epd-bild/Heike Lyding
Gießen (epd). Ulrich Ott startet auf seinem Handy eine App mit einer Atemübung: Ein blauer Ball bläht sich auf, größer und größer, und fällt dann in sich zusammen: Einatmen, Pause, Ausatmen, Pause. Die Konzentration auf den Atem "führt uns in die Gegenwart", erklärt der Gießener Neurowissenschaftler. Der immerwährende Fluss der Gedanken stoppt, Ruhe tritt ein.
Gemeinsam mit seiner Kollegin Janika Epe hat der Psychologe und Meditationslehrer Ott ein Acht-Wochen-Programm mit Atemübungen entwickelt. "In der hektischen Betriebsamkeit des Alltags kann es passieren, dass wir unseren Körper kaum noch beachten", schreibt Ott in seinem Buch "Gesund durch Atmen". Die Wirkung der Atmung auf die Abläufe im Gehirn sei bisher unterschätzt worden, sagt der Forscher am Fachbereich Psychologie und Sportwissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen. Mit Atemübungen kann man den Körper entspannen.
Ott zückt wieder sein Handy und legt einen Finger auf die Handykamera: Mittels eines Sensors misst eine App seine Herzrate. Einatmen, Pause, Ausatmen: Mit etwas Übung lassen sich die Atmungsphasen verlängern, die Atemzüge auf wenige pro Minute reduzieren. "Das hat eine entspannende und sammelnde Wirkung", erklärt der Wissenschaftler.
Übungen bei Schlafstörungen hilfreich
Eine weitere Übung: abwechselnd durch die beiden Nasenlöcher atmen. Bei der Atmung durch das linke Nasenloch wird der Blutdruck gesenkt, durch das rechte steigt er an. "Es ist erstaunlich", sagt Ott. "Man kann es nachweisen, aber nicht erklären."
Janika Epe wertet gerade in ihrer Doktorarbeit das achtwöchige Programm aus, gleichzeitig absolviert sie ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin. Mit Versuchspersonen hat sie die Übungen ausprobiert: Vor allem bei Schlafstörungen seien sie sehr hilfreich, sagt sie. Eine verlängerte Ausatmung beruhige die Probanden, Menschen mit Antriebsschwierigkeiten könnten "aktivierende Atemtechniken nutzen".
Die bewusste Wahrnehmung der Atmung hat in vielen Kulturen eine lange Tradition. So sei das Beobachten des Atems "eine Technik, die bei allen Meditationstraditionen eine zentrale Rolle spielt", schreibt der Chemnitzer Forscher Peter Sedlmeier in seinem Buch "Die Kraft der Meditation", in dem er einen Überblick über wissenschaftliche Erkenntnisse zur Meditation gibt. "Viele Meditierende haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Schmerzen nach einiger Zeit verschwinden oder sich zu einem anderen Körperteil verlagern, wenn man den Atemstrom bewusst auf sie lenkt", erklärt Sedlmeier.
Beim Einatmen in die Tiefe gehen
Kerstin Veigt ist Meditationslehrerin und praktiziert das Herzensgebet, eine uralte christliche Gebetsform, bei der die Betenden ein persönliches Wort oder ein Mantra im Stillen beten. Eine Grundübung sei das Beobachten des Atems. "Über den Atem kommen wir wieder in Verbindung mit unserem natürlichen Rhythmus", sagt sie, etwa so: Beim Einatmen in die Tiefe gehen, beim Ausatmen in die Weite.
Heilen durch Atmen, das machen auch die rund 500 Atemtherapeuten und -pädagogen, die in Deutschland dem Bundesverband BV-Atem angehören. Die Atemtherapie zählt zu den alternativen Heilverfahren. Allein schon, wenn man die Aufmerksamkeit auf den Atem richte und ihn zulasse, verändere sich etwas, sagt Annechien Ihnen vom Vorstand.
Den Körper wahrnehmen
Ihnen arbeitet als Sonder- und Atempädagogin unter anderem an einer Schule mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern und macht mit ihnen einfache Atemübungen. In andere Praxen kämen Patienten mit Asthma oder der Lungenkrankheit COPD, Burn-out-Erkrankte und Stressgeplagte. Einige Krankenkassen haben die Atemtherapie in ihr Programm aufgenommen. Sie könne beispielsweise die Rehabilitation nach Operationen im Brustbereich unterstützen, erklärt die AOK Hessen.
Sich nach innen richten, den Körper wahrnehmen - spannend werde es, wenn die Übung beendet sei, sagt Ulrich Ott: "Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, kann man auch besser mit anderen umgehen." Dann könne man "offen und innerlich befreit auf die anderen zugehen."
Diakonie RWL: 800 soziale Projekte aus Kollekten gefördert
Düsseldorf (epd). Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) hat im vergangenen Jahr rund 1,35 Millionen Euro an kirchlichen Kollektengeldern für soziale Projekte, Initiativen und Einzelfallhilfen vergeben. Insgesamt seien rund 800 diakonische und kirchliche Vorhaben gefördert worden, teilte eine Sprecherin am 24. Januar in Düsseldorf mit. Die Bandbreite der Unterstützung reicht von der Babyausstattung für einkommensschwache Familien bis zum Kunstprojekt für psychisch kranke Menschen. Die Projekte erhalten den Angaben zufolge in der Regel niedrige vierstellige Euro-Beträge.
Darüber vermittelte das "Zentrum Drittmittel, Fundraising und Quartiersentwicklung" der Diakonie RWL 11,6 Millionen Euro an Fördermitteln aus Lotterien, Stiftungen und diakonieeigenen Fonds. Gerade kleinere Träger von Projekten hätten oft weder Zeit noch Personal, sich ausführlich in die aufwändigen Antragsverfahren einzuarbeiten, hieß es. Mit Unterstützung der Diakonie-Fundraiser habe zum Beispiel die Evangelische Stiftung Hephata in Mönchengladbach Fördergelder der "Aktion Mensch" für die Aufstellung eines Social-Media-Teams aus Menschen mit Behinderung erhalten.
Bei der traditionellen Diakoniesammlung in den rheinischen, westfälischen und lippischen Kirchengemeinden kommen den Angaben zufolge jährlich rund 1,5 Millionen Euro zusammen. Für die weltweite Diakonie mit dem evangelischen Hilfswerk "Brot für die Welt", der Diakonie-Katastrophenhilfe und den Aktionen "Hoffnung für Osteuropa" und "Kirchen helfen Kirchen" seien im Gebiet der drei evangelischen Landeskirchen 2019 knapp 17 Millionen Euro an Spenden und Kollekten erzielt worden.
Theologischer Vorstand der Stiftung Hephata geht in den Ruhestand
Mönchengladbach (epd). Der theologische Vorstand der Evangelischen Stiftung Hephata, Christian Dopheide, scheidet zum Ende dieses Jahres aus dem Amt und geht in den Ruhestand. 14 Jahre hat Dopheide mit dem kaufmännischen Vorstand Klaus-Dieter Tichy das Unternehmen geleitet, wie die in Mönchengladbach ansässige Stiftung am 24. Januar mitteilte. "Ich blicke zurück auf die schönste und übrigens auch erfolgreichste Strecke meiner beruflichen Laufbahn", erklärte der scheidende theologische Vorstand. Mit seinem Schritt wolle er "den Generationenwechsel in der Stiftungsleitung und damit den langfristigen Erfolg der Stiftung verantwortungsvoll" absichern.
Nachfolger von Dopheide wird Harald Ulland (55), der seit 1997 Pfarrer in der Kirchengemeinde Waldniel und seit 2012 stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss ist. In dieser Zeit hat er maßgeblich die Umstrukturierungsprozesse mitgestaltet, die durch den Rückgang der Zahl der Gemeindemitglieder und die Reduzierung von Pfarrstellen notwendig wurden. "Mit Harald Ulland verlieren die Kirchengemeinde Waldniel und der Kirchenkreis Gladbach-Neuss zum Jahresende einen engagierten und profilierten Theologen", sagte der Superintendent des Kirchenkreises, Dietrich Denker.
Medien & Kultur
Mahnerin gegen Atomkraft

epd-bild / Daniel Peter
Frankfurt a.M. (epd). In Panik ergreifen sie die Flucht. Janna-Berta und Uli wollen zu ihrer Tante nach Hamburg, um sich vor den Strahlen zu schützen, doch Uli wird überfahren. Die Geschichte des Mädchens, das den Super-GAU eines bayrischen Atomkraftwerks überlebt, war Gudrun Pausewangs erfolgreichstes Buch, millionenfach verkauft. "Die Wolke" erschien 1987, ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Am 23. Januar ist die Autorin im Alter von 91 Jahren gestorben.
Geboren wurde sie 1928 in Wichlstadtl, dem heutigen Mladkov im Nordosten Tschechiens. Ihre Eltern waren Reformlandwirte, versuchten auf ihrem Anwesen, eine alternative Lebensform zu verwirklichen. Der Zweite Weltkrieg beendete ihr Experiment: 1943 fiel der Vater, 1945 flüchtete Gudrun Pausewang mit ihrer Mutter und den fünf jüngeren Geschwistern nach Wiesbaden, wo sie ihr Abitur machte.
Lieblingsautorin der Friedens- und Anti-AKW-Bewegung
Nach dem Studium an einer pädagogischen Hochschule verbrachte Gudrun Pausewang viele Jahre im Auslandsschuldienst in Venezuela, Chile und Kolumbien, bevor sie 1972 mit ihrem damals zweijährigen Sohn nach Deutschland zurückkehrte. Bis zu ihrer Pensionierung 1989 unterrichtete Pausewang an der Grundschule im osthessischen Schlitz bei Fulda, dem Ort, in dem auch das Mädchen Janna-Berta in "Die Wolke" bis zum Reaktorunfall wohnt.
Mit dem Bücher schreiben hatte Pausewang Ende der 1950er Jahre begonnen. Zehn Jahre lang richteten sich ihre Werke an Erwachsene, bevor sie eher zufällig Kinder und Jugendliche als Leser entdeckte. Ihre Themen schöpft sie aus eigenen Erlebnissen und ihrem Alltag. 1983, auf dem Höhepunkt der Nachrüstungsdebatte, erschien ihr Buch "Die letzten Kinder von Schewenborn", in dem die überzeugte Pazifistin das Horrorszenario eines durch den Atomkrieg verwüsteten Landes aus der Perspektive eines Jungen schildert.
Spätestens mit "Die Wolke" vier Jahre später wurde Gudrun Pausewang zur Lieblingsautorin der Friedens- und Anti-AKW-Bewegung. Doch auch außerhalb davon erfuhr sie Anerkennung: Sie erhielt zahlreiche Ehrungen wie den Deutschen Jugendliteraturpreis 1988 für "Die Wolke". 2017 erhielt sie die Auszeichnung noch einmal für ihr Lebenswerk.
Pausewang heftete den Blick auf eine Vielzahl von Details, die sich in einer oft brutalen Deutlichkeit jeder Interpretation verweigern. "Ulis Kopf, von der Kapuze umhüllt, lag seltsam flach in einer Blutlache, die sich zusehends vergrößerte," schreibt sie in "Die Wolke".
Mit ihren drastischen Schilderungen und unverpackten Botschaften blieb Pausewang umstritten: Für die einen war sie die "Lehrerin der Angst" und "Weltangstexpertin", wie die Journalistin Susanne Gaschke es einmal in der "Zeit" formulierte. Doch die anderen schätzten ihre Bücher eben weil sie die Wirklichkeit auch für die Jüngsten nicht ausklammert.
Doktortitel mit 70 Jahren
Häufig tragen Pausewangs Figuren durch ihre Passivität zu den Katastrophen bei, deren Opfer sie später sind. Darin ähneln sich die Schicksale der Vertriebenen oder der Opfer des Super-GAUs. Selbst in ihren Büchern für die ganz Kleinen kommen die Helden nicht ungeschoren davon. In "Neues vom Räuber Grapsch" (2008) quält sich die Hauptfigur mit dem Älterwerden: Grapsch wird Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers und seine alt gewordenen Tiere sterben ihm weg.
Auch mit dem Nationalsozialismus beschäftigte sich Pausewang in ihren Büchern. So beschrieb sie in "Adi, Jugend eines Diktators" (1997) das Heranwachsen Adolf Hitlers oder in "Die Meute" (2006) den Aufbau einer nationalsozialistischen Jugendgruppe durch einen eigentlich liebenswerten Großvater, der ein unverbesserlicher Nazi geblieben ist.
1999 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz, 1998 legte sie im Alter von 70 Jahren ihre Doktorarbeit über "Vergessene Jugendschriftsteller der Erich-Kästner-Generation" an der Frankfurter Goethe-Universität vor.
Noch im hohen Alter schrieb Pausewang weiter: 2012 erschien ihr Roman "Au revoir, bis nach dem Krieg" über die Liebe zwischen einem deutschen Mädchen und einem französischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg. In ihrem letzten Buch "So war es, als ich klein war" (2016) vermachte sie den jungen Lesern ihre eigenen Kindheitserinnerungen.
Film "Neubau" gewinnt Max-Ophüls-Filmpreis
Fenster in eine ambivalente Welt: Der Film "Neuland" über einen Transmann siegt beim 41. Filmfestival Max Ophüls Preis und erhält gleich zwei Auszeichnungen.Saarbrücken (epd). Eine langsam sterbende, demente Großmutter in der Uckermark und eine queere Wahlfamilie in Berlin: Transmann Markus (Tucké Royale) packt im Film "Neuland" immer wieder die Sehnsucht nach einem Leben fernab der Provinz. Das Werk von Regisseur Johannes Maria Schmitt und Drehbuchautor sowie Hauptdarsteller Royale erhielt am 25. Januar in Saarbrücken den mit 36.000 Euro dotierten Hauptpreis des 41. Filmfestivals Max Ophüls Preis gewonnen. Auch der Preis für den gesellschaftlich relevanten Film in Höhe von 5.000 Euro ging an "Neuland".
"Es gibt Filme, die sind leise, aber sie wirken lange nach", sagte Spielfilm-Jurymitglied und Vorjahressiegerin Susanne Heinrich bei der Preisverleihung. "Wir lernen eine Figur kennen, in der sich verschiedene Welten überlagern." Von einem "barrierefreien Fenster in eine ambivalente Welt" sprach Jurymitglied Jonas Weydemann. "Es ist kein Kitsch. Kein Themenfilm nämlich, sondern einer, der sagt: So ist das Leben."
"Manifest der neuen Selbstverständlichkeit"
Drehbuchautor Royale nutzte die Gelegenheit, um das "Manifest der neuen Selbstverständlichkeit" vorzustellen, zu dem "Neuland" zählt. Es gehe darum, sich selbst anzuerkennen und nicht anzupassen, sich nicht erklären zu müssen und zu bleiben oder zu werden, wer man sein will. Die neue Selbstverständlichkeit sei eine "Absage ans Deportationstheater", welches das Publikum normalerweise dort abhole, wo es steht.
Seit 21. Januar traten 63 Filme in den Wettbewerben an, davon konkurrierten 16 in der Kategorie Spielfilm. Das nach dem in Saarbrücken geborenen Regisseur Max Ophüls (1902-1957) benannten Festival ist eines der bedeutendsten für Nachwuchsfilmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Geschichte einer Flucht
Der Film "Jiyan" von Regisseurin Süheyla Schwenk bekam den Preis der ökumenischen Jury in Höhe von 2.500 Euro. Er erzählt die Geschichte einer syrischen Familie, die nach ihrer Flucht versucht, in Deutschland Fuß zu fassen. Es gehe darum, ankommen zu wollen, aber nicht ankommen zu können, sagte Schwenk. "Jetzt merke ich, dass ich angekommen bin."
Als bester Schauspielnachwuchs wurden Maresie Riegner für ihre Rolle in "Irgendwann ist auch mal gut" und Mehdi Meskar für seine Darstellung in "Nur ein Augenblick" geehrt. Sie erhielten jeweils 3.000 Euro. Riegner konnte wegen einer Theaterprobe in Wien nicht an der Preisverleihung teilnehmen und dankte per Videobotschaft. Meskar erklärte, der Film habe sein Leben verändert.
Publikumspreis für Film über tschtschenische Kinder
Regisseur Arash T. Riahi gewann den mit 5.000 Euro dotierten Publikumspreis für "Ein bisschen bleiben wir noch" über zwei tschetschenische Flüchtlingskinder, die seit sechs Jahren in Österreich leben. In seiner Dankesrede appellierte er an Verleiher, nicht skeptisch zu sein, weil keine bekannten deutschen Schauspieler darin vorkommen oder weil es um eine tschetschenische Familie geht. Der Preis zeige, dass es ein Publikum für einen solchen Filme gebe: "Das Saarland kann nicht lügen."
Ehrengast Heike Makatsch bezeichnete den Schauspielnachwuchs als kompromisslos, eigen, mutig und unangepasst. Sie würde sich freuen, wenn sie sich "in diesem Haifischbecken so unangepasst weiterentwickeln" könnten, sagte die Schauspielerin. Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zog eine Parallele zwischen Regisseuren und Politikern: Beide sollten sich fragen, "ob man es nur wegen des Applauses macht oder ob man versucht, gute Arbeit abzuleisten".
Festivalleiterin Svenja Böttger wünscht sich weiterhin "tolle Einreichungen, aufregende Filme" und "dass wir die Möglichkeit haben, die Filme so zu higlighten, dass sie ins Kino kommen". Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) warb dafür, "dass alle Filmschaffenden, die nachwachsen, immer wieder alles neu infrage stellen, dass sie dabei kreativ sind und mutig und unangepasst und ihren eigenen Weg gehen".
Evangelische Filmjury empfiehlt "Sorry We Missed You"
Berlin (epd). Die Jury der Evangelischen Filmarbeit hat "Sorry We Missed You" zum "Film des Monats" Februar gekürt. Regisseur Ken Loach werfe am Beispiel der Paketbranche einen präzisen Blick auf heutige Arbeitsbedingungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft, erklärte die Jury am 20. Januar in Berlin. Der britische Filmemacher verdeutliche, was passiere, wenn Flexibilität und Selbstverantwortung zum neuen Heilsversprechen würden und die Menschlichkeit dabei vielfach auf der Strecke bleibe.
"Sorry We Missed You" kommt am 30. Januar in die deutschen Kinos. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie: Ricky Turner (Kris Hitchen) heuert als Paketbote bei einem Lieferdienst an - als "Eigentümer-Fahrer", also als selbstständiger Subunternehmer. Rickys Frau Abbie (Debbie Honeywood) hat als mobile Pflegekraft ebenfalls mit zu vielen Aufträgen in zu kurzer Zeit und für zu wenig Geld zu tun.
Premiere in Cannes
Damit nicht genug rebelliert der Teenagersohn Sebastian (Rhys Stone), während die elfjährige Tochter Liza Jane (Katie Proctor) zu bettnässen beginnt, weil ihre Eltern zu wenig Zeit haben, sich um sie zu kümmern. Aus dieser Konstellation konstruiert der Film eine Notlage nach der anderen, die Ricky noch mehr in Bedrängnis bringen, als es sein eng getakteter Job von allein tut. Der Film feierte im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes im Mai 2019 Premiere.
Die Jury der Evangelischen Filmarbeit zeichnet Kinofilme aus, die dem Zusammenleben der Menschen dienen, zur Überprüfung eigener Positionen, zur Wahrnehmung mitmenschlicher Verantwortung und zur Orientierung an der biblischen Botschaft beitragen. Die Arbeit der Juroren wird vom Filmkulturellen Zentrum im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) betreut. Zum GEP gehören unter anderem auch die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) und das evangelische Magazin "chrismon".
Pastorinnen-Ehepaar startet You-Tube-Kanal
Hannover, Hildesheim (epd). Ellen und Stefanie Radtke (35 und 34) sind lesbisch, miteinander verheiratet und leben in dem Dorf Eime bei Hildesheim. Was sie dort als Ehepaar erleben, zeigen sie künftig auf dem Kanal "Anders Amen", wie der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen am 22. Januar mitteilte. "Wir wollen eine Online-Gemeinde für alle sein, denn die evangelische Kirche braucht definitiv mehr Glitzer in ihren Türmen", sagte Stefanie Radtke.
In den Beiträgen geht es etwa um den Kinderwunsch der beiden, um das Leben im Dorf oder um ihre Arbeit als Seelsorgerinnen. Geplant sind etwa Studio-Talks an der Bar, bei dem die beiden über Gott und die Welt, über ihr Outing oder andere "queere" Fragen sprechen. In Video-Tagebüchern, sogenannten "Vlogs", wollen die beiden Pastorinnen ihre Zuschauer auch mit zum Besuch in die Kinderwunschklinik oder auf Ausflüge mit Konfirmanden nehmen und zeigen, wie "queeres" Leben in der Kirche und auf dem Land gelingen kann. Die Beiträge, die vom Kirchenfunk produziert werden, erscheinen künftig jeden Mittwoch um 19 Uhr.
Gottschalk als Erzähler beim Live-Event "Die Passion" in Essen
Köln (epd). Der Entertainer Thomas Gottschalk (69) wird zu Ostern als Erzähler durch das RTL-Live-Event "Die Passion" führen. Für die Inszenierung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus dient das Zentrum der Stadt Essen als Bühne, wie der Privatsender RTL am 20. Januar in Köln mitteilte. "Mitten in Essen werden bekannte Schauspieler und Sänger mit Hilfe deutscher Popsongs die über 2.000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken und die dramatischen Ereignisse in unsere heutige Zeit transportieren." Geplant ist auch eine Passions-Prozession, bei der ein großes leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens zur Hauptbühne getragen wird.
"Respekt und Liebe für den Nächsten"
In den Niederlanden hat "Die Passion" als Live-Musik-Event bereits seit zehn Jahren Tradition im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. In Deutschland beauftragte RTL Television die Firma Mediawater in Kooperation mit Kimmig Entertainment mit der Produktion. Musikalischer Direktor ist Michael Herberger, der unter anderem auch für Musik und Ton der Vox-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" verantwortlich ist und mit den Söhnen Mannheims Erfolge feiert.
"Mit dieser Geschichte zeigen wir Haltung und dass es sich lohnt, gemeinsam füreinander einzustehen. Hier geht es um Respekt und Liebe für den Nächsten - unabhängig von Herkunft und Religion", erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm. Auf der Hauptbühne im Stadtzentrum Essens erlebten die Zuschauer "die Geschichte von Verrat, Leiden und Sterben, aber auch von Hoffnung, Liebe und Vergebung in einer modernen noch nie dagewesenen Art". Bekannte Sänger treten zudem an verschiedenen Schauplätzen der Stadt auf.
NRW feiert 2021 den 100. Geburtstag von Joseph Beuys
Düsseldorf (epd). Eine großangelegte Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe erinnert im kommenden Jahr an den Künstler Joseph Beuys, dessen Geburtstag sich am 12. Mai 2021 zum 100. Mal jährt. Das Jubiläumsjahr solle dazu dienen, das komplexe Wirken und die internationale Ausstrahlung des im Rheinland geborenen und arbeitenden Künstlers zu würdigen, neu zu entdecken und kritisch zu befragen, erklärte das nordrhein-westfälische Kulturministerium am 23. Januar in Düsseldorf. Das Projekt mit dem Titel "Beuys 2021. 100 Jahre Joseph Beuys" wird vom Ministerium in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf umgesetzt. Beteiligt sind rund 20 Museen in NRW. Schirmherr ist Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).
Laschet: Beuys beeinflusst bis heute künstlerischen und gesellschaftlichen Diskurs
Joseph Beuys (1921-1986) habe von Nordrhein-Westfalen aus weltweit Kunstgeschichte geschrieben, sagte Laschet. "Er zählt zu den bekanntesten Kunstschaffenden Deutschlands und hat als Bildhauer, Aktionskünstler und Zeichner den Kunstbegriff revolutioniert." Das Jubiläumsjahr sei deshalb "ein hervorragender Anlass, um zurückzublicken auf einen einflussreichen Künstler, der begeistert und inspiriert, der hinterfragt und zum Nachdenken anregt". NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) ergänzte: "Joseph Beuys hat mit einem progressiven Kunstbegriff und seinen Ideen von Demokratie und Freiheit etwas riskiert und bewegt." Seine Impulse beeinflussten bis heute den künstlerischen und gesellschaftlichen Diskurs.
20 Museen beteiligt
Das Jubiläumsprogramm bietet demnach Ausstellungen, Aktionen und Theateraufführungen oder Musik- und Lehrveranstaltungen. Das Projekt wird geleitet vom Kurator der Sammlung Marx, Eugen Blume, sowie der Kunst- und Literaturwissenschaftlerin Catherine Nichols. Beide haben bereits gemeinsame mehrere Ausstellungen zu Beuys organisiert. An dem Projekt beteiligen sich unter anderem die Bundeskunsthalle in Bonn, die K20 Kunstsammlung NRW in Düsseldorf und das Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau. Die Ausstellungen befassen sich mit Themen wie Schamanismus oder dem bekannten Beuys-Zitat "Jeder Mensch ist ein Künstler", wie es hieß.
Joseph Beuys wurde 1921 in Krefeld geboren, wuchs in Kleve auf und starb 1986 in Düsseldorf. Der als "Mann mit dem Filzhut" bekanntgewordene Künstler zählt neben Marcel Duchamp, John Cage und Andy Warhol zu den bedeutendsten Vertretern der Kunstszene im 20. Jahrhundert. Er setzte sich nach Angaben von Experten in seinem universell angelegten Werk mit Fragen des Humanismus, der Sozialphilosophie und der Anthropologie auseinander. Seine Kriegserfahrungen als Soldat hätten dabei einen wesentlichen Einfluss auf seine Werkentwicklung gehabt, hieß es.
Gefangen in der Welt der Objekte

epd-West/Museum Morsbroich
Leverkusen (epd). Michèle hat eine innige Liebesbeziehung zu ihrem Schatz. In ihren Augen ist er das perfekteste Wesen der Welt. Nur einen Nachteil hat er: Er ist zu groß, um ihn mit ins Bett zu nehmen: Michèle liebt die Boeing 737-800. Ihre Wohnung ist vollgestopft mit Modellflugzeugen und Fotos von dem Flugzeug. Da ihre große Liebe nun mal nicht komplett in ihre Wohnung passt, kuschelt sie nachts mit einer original Tragflächenspitze des Fliegers. Ihr größter Traum: "Zusammen mit meinem Liebling in einem Hangar zu wohnen."
Michèle ist eine von vier Menschen, die die Künstlerin Kathrin Ahäuser in ihrer Videoarbeit zum Thema Objektsexualität vorstellt. Die Liebesbeziehung zwischen Mensch und Ding ist ein noch relativ neues und bislang wenig erforschtes Phänomen. Es ist sozusagen die Extremform der innigen Beziehung zwischen Mensch und Objekt, mit der sich rund 20 Künstler in der neuen Wechselausstellung im Leverkusener Museum Morsbroich auseinandersetzen.
"Liebes Ding"
Unter dem Titel "Liebes Ding" sind rund 40 künstlerische Arbeiten zu sehen, die das Verhältnis des Menschen zu den Dingen in seinem Besitz hinterfragen. Gezeigt werden bis zum 26. April Skulpturen, Gemälde, Fotografien, Videos und Rauminstallationen von Künstlern wie dem deutschen Fotografen Andreas Gursky, dem Österreicher Erwin Wurm, dem dänischen Kollektiv Superflex oder der niederländischen Glaskünstlerin Maria Roosen.
Die Arbeiten kreisen um die Frage, warum Menschen nach Dingen streben und welche Beziehung sie zu ihrem Besitz entwickeln. Oft werde in den Werken ein schizophrenes Verhältnis zu den Dingen sichtbar, sagt Ausstellungskurator Fritz Emslander. "Wir wissen um die Konsequenzen des Konsums und doch fällt es uns schwer, unser Verlangen nach den Dingen zu zügeln."
Zwar ist es der Mensch, der die Objekt-Welt um sich herum geschaffen hat, um sein Leben angenehmer zu machen. Doch der künstlerische Blick auf die Situation zeigt, dass die Dinge nicht selten die Herrschaft ergreifen, ohne dass der Besitzer es bemerkt. Die niederländische Künstlerin Melanie Bonajo fotografierte Frauen an die Dinge gefesselt, die ihren Alltag bestimmen: Das Fahrrad, das Bügelbrett, der Geschirr-Abtropfständer, eine Farbrolle schränken die Bewegungsfreiheit komplett ein.
Die Künstlerin selbst versucht nach eigener Aussage, möglichst wenig Dinge zu besitzen, weil sie sie als Ballast empfindet. "Wie viel Zeit vergeudete ich damit, mich um meine Sachen zu kümmern?", fragt sie. Denn alle Besitztümer wollen gepflegt und weggeräumt werden. Erstaunliche Erkenntnis: Trotz technischer Neuerungen sei die Arbeitszeit für den Haushalt in den vergangenen 100 Jahren etwa gleichgeblieben, sagt Emslander. Der Grund: "Wir haben heute viel mehr Dinge und eine größere Wohnfläche."
Prada-Schuhe auf einem Altar
Dennoch werden wir immer verleitet, noch mehr Dinge zu kaufen. Den verführerischen, wenn auch kalten Charme der Konsumwelt verdeutlichen die Fotografien von Erwin Olaf und Andreas Gursky. Olaf lichtete eine schwarzhäutige, nackte Frau ab, die gleichsam mit einem glänzend braunen Ledersofa verschmilzt. Gursky fotografierte die puristische Auslage in einer Prada-Boutique, in der Schuhe wie auf einem Altar präsentiert werden.
Doch allzu oft verlieren die Besitzer schnell das Interesse an einst teuer erstandenen Objekten. Der Frankfurter Künstler Karsten Bott sammelt seit seiner Kindheit Gegenstände aus dem Alltagsleben. Im Museum Morsbroich legte er 55 Quadratmeter Fläche mit Tausenden Gegenständen aus, die den Menschen von der Kindheit bis zu seinem Tod begleiten: Vom Spielzeugauto über die Hochzeitstorte bis zum Gebiss. Der Besucher geht auf einem Holzsteg über dieses Meer aus Dingen. Oft würden diese Gegenstände überhaupt nicht beachtet, sagt Bott. "Ich möchte, dass man wirklich wahrnimmt, was man hat und sieht, dass das eine große Schönheit hat."
Überflutung von Plastikmüll
Die Folgen des überhitzten Konsumverhaltens der Menschheit thematisiert das dänische Künstlerkollektiv Superflex. In einem Video wird die allmähliche Überflutung eines McDonalds-Restaurant gezeigt. Völlig geräuschlos versinken Plastikbecher, Tische, Tresen und Kasse in den Fluten: Ein Sinnbild für den durch die Klimaerwärmung steigenden Meeresspiegel.
Der belgische Künstler Maarten Vanden Eynde blickt auf eine weitere Folge des ungebremsten Konsums. Er bereiste vier Jahre lang die Weltmeere und sammelte Plastikmüll ein. "Plastik verrottet nicht. Das Beängstigende ist, dass das ganze Plastik, das irgendwann einmal weggeworfen wurde, noch immer in irgendeiner Form existiert", sagt Vanden Eynde. Sein Beitrag zur Bewältigung des Plastik-Müllbergs: Die Skulptur "Plastic Reef", für die er einen Teil seines eingesammelten Mülls verarbeitete.
Ludwig-Galerie in Oberhausen zeigt Ausstellung zu Jacques Tilly
Oberhausen (epd). Unter dem Titel "Politik und Provokation - Karikaturen XXL" zeigt die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen ab 2. Februar eine Ausstellung mit Arbeiten des Düsseldorfer Satirikers und Karnevalswagenbauers Jacques Tilly. Die bis zum 14. Juni dauernde Schau sei die erste Museumspräsentation mit Werken von Tilly, kündigte die Ludwig-Galerie an. Die Ausstellung zeige auch, wie Tilly die Ideen zu seinen Karikaturen entwickelt und in Figuren umsetzt. Auch die Reaktion der Medien auf die Skulpturen wird als Thema angeschnitten.
Tilly hat nach Angaben des Museums einen einzigartigen Weg gefunden, seine mit beißendem Humor gespickten Beiträge zu Politik und Gesellschaft zu formulieren: Er baut sie dreidimensional und überlebensgroß für den Karnevalszug in Düsseldorf. Ob Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan oder Donald Trump - die Despoten, Demagogen und Diktatoren dieser Welt würden von ihm entlarvt und entzaubert. Dabei sorgten seine Motive nicht nur im Düsseldorfer Karneval für Aufmerksamkeit, mittlerweile fänden sich seine Wagenmotive zu Greta Thunberg, Viktor Orbán und Jaroslaw Kaczynski oder dem Brexit auch im Ausland. Damit zeige sich, dass Tillys Bilder eine allgemeinverständliche Sprache sprechen, die auch in Thailand oder in den arabischen Staaten in der Lage ist, humorvoll auf die Missstände der Welt hinzuweisen.
NRW-Landesmusikrat jetzt im Netzwerk "Interkulturelle Öffnung"
Köln (epd). Der Landesmusikrat NRW und die Landesmusikakademie NRW sind der Landesinitiative "Erfolgsfaktor Interkulturelle Öffnung" beigetreten und haben sich damit verpflichtet, Maßnahmen zur interkulturellen Öffnung zu ergreifen. Die beiden Multiplikatoren "tragen in Zukunft noch stärker dazu bei, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Verbänden und Vereinen besser repräsentiert sind", sagte Integrationsstaatssekretärin Serap Güler (CDU) nach Angaben des Ministeriums vom 25. Januar bei der Vertragsunterzeichnung in Köln.
Der Präsident des Landesmusikrats und Vorsitzende der Landesmusikakademie, Reinhard Knoll, kündigte an: "Gemeinsam wollen wir uns für mehr Vielfalt in den Musikvereinen und -verbänden und für kulturelle Brückenschläge einsetzen." Alle Bürger sollten am Musikleben in Nordrhein-Westfalen teilhaben können.
Rat und Akademie wollen unter anderem den Anteil der Mitglieder mit Einwanderungsgeschichte in ihren Gremien erhöhen und die Fort- und Weiterbildung zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz ausbauen. In dem Netzwerk sind laut Integrationsministerium 31 Organisationen mit mehr als 80.000 Beschäftigten aktiv.
WDR und ZDF ziehen unter ein Dach
Düsseldorf (epd). Der WDR und das ZDF werden zukünftig gemeinsam aus dem Funkhaus Düsseldorf senden. Das ZDF-Landesstudio NRW und die ZDF-Redaktion von "Volle Kanne - Service täglich" werden als Mieter ab Mitte dieses Jahres über 3.000 Quadratmeter Büro- und Produktionsfläche im Funkhaus Düsseldorf nutzen, wie die beiden Sender am 22. Januar mitteilten. Dazu gehören auch ein Fernsehstudio und eine Regiezone für die Live-Sendung "Volle Kanne".
Nach dem vollständigen Umzug an das Funkhaus am Rhein wird das ZDF seinen derzeitigen Standort in Düsseldorf-Golzheim aufgeben und veräußern. Die Anmietung stehe sowohl beim WDR als auch beim ZDF unter dem Vorbehalt der Zustimmung zuständigen Gremien, hieß es.
Die Flächen im Düsseldorfer Funkhaus wurden frei, da der WDR den Angaben nach seine aktuelle Berichterstattung in einem crossmedial arbeitenden Newsroom in Köln bündelt. Hier arbeiten Redaktionen von Online und Social Media, Hörfunk und Fernsehen eng zusammen. Vor diesem Hintergrund haben in den vergangenen Monaten Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze von Düsseldorf nach Köln verlagert. Zuletzt zogen im November 2019 die Teams von "Aktueller Stunde" und "WDR aktuell" nach Köln, so dass der Newsroom jetzt komplett ist, wie der WDR erläuterte. Im Funkhaus Düsseldorf wird weiterhin die landespolitische und regionale Berichterstattung des WDR produziert.
Entwicklung
UN-Gericht: Myanmar muss Rohingya vor Völkermord schützen

epd-bild/Nicola Glass
Frankfurt a.M., Den Haag (epd). Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat angeordnet, dass Myanmar die muslimische Minderheit der Rohingya vor einem Völkermord schützen muss. Das südostasiatische Land müsse alles in seiner Macht Stehende tun, um die Gräueltaten gegen die Rohingya zu beenden und weitere Verbrechen zu verhindern, erklärten die Richter am 23. Januar. Per einstweiliger Verfügung wurden Myanmar "vorläufige Maßnahmen" auferlegt.
Menschenrechtsorganisationen begrüßten den Richterspruch als Meilenstein für den Schutz der Rohingya. Von der Regierung Myanmars gab es zunächst keine offizielle Reaktion. Ein Sprecher der Regierungspartei "Nationale Liga für Demokratie" erklärte lediglich, der Gerichtsentscheid komme nicht überraschend. Man müsse abwägen, welche Konsequenzen das Urteil habe, zitierte ihn das Magazin "Frontier Myanmar".
Politischer Druck wächst
Nach dem einstimmigen Richterspruch muss das Militär in Myanmar für alle Sicherheitskräfte sicherstellen, dass keine Gewalttaten verübt werden, die gegen die UN-Völkermordkonvention von 1948 verstoßen. Myanmar soll zudem gewährleisten, dass keine Beweise vernichtet werden, die Völkermord-Verbrechen belegen könnten. Binnen vier Monaten soll Myanmar dem Gericht einen Bericht über die ergriffenen Maßnahmen vorlegen. Danach soll alle sechs Monate berichtet werden.
Die Anordnungen des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen sind für alle UN-Mitglieder bindend. Ob die Verfolgung der Rohingya als Völkermord zu werten ist, hat das Gericht noch nicht entschieden. Bis zur Hauptverhandlung kann es Monate oder Jahre dauern.
Das Urteil erging aufgrund einer Völkermord-Klage gegen Myanmar, die das westafrikanische Gambia im November im Namen der "Organisation für Islamische Zusammenarbeit" eingereicht hat. Die Klage stützt sich im wesentlichen auf einen UN-Bericht, in dem Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an den Rohingya beklagt werden.
Mit dem Urteil vom Donnerstag wächst der internationale politische Druck auf Regierung und Militär in Myanmar. Wegen einer brutalen Militäroffensive Ende August 2017 waren mehr als 740.000 Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen. Die Flüchtlinge beklagten Morde, Vergewaltigungen und Brandstiftungen. Die zivile Regierung unter Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gilt als mitverantwortlich. Bei den Anhörungen des Gerichts im Dezember hatte Suu Kyi an die Richter appelliert, die Klage abzuweisen.
Wichtiges Signal
Menschenrechtler werteten das Urteil als wichtiges Signal: Damit werde den Verantwortlichen in Myanmar gezeigt, dass die Welt die Gewalt nicht toleriere, erklärte Amnesty International. Ähnlich äußerte sich "Human Rights Watch": "Die Anordnung des Internationalen Gerichtshofs ist ein Meilenstein, um weitere Gräueltaten gegen eine der am stärksten verfolgten Volksgruppen der Welt zu stoppen", sagte die Vize-Direktorin für Internationale Justiz, Param-Preet Singh.
Suu Kyi bat in einem kurz vor Urteilsverkündung veröffentlichten Gastskommentar darum, Myanmar Zeit zu geben, um den Berichten über die Gewalt nachzugehen. Die internationale Ächtung habe sich negativ auf die Bemühungen ausgewirkt, dem Rakhine-Staat Stabilität und Fortschritt zu bringen, kritisierte sie in der Zeitung "Financial Times".
Regierungsmitgliedern und Militärs in Myanmar drohen indes weitere Verfahren wegen der Verfolgung der Rohingya. Denn auch der Internationale Strafgerichtshof (ebenfalls in Den Haag) nahm im November Ermittlungen auf. Er ist zuständig bei Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.
Die lange Geschichte der Gewalt im Westen Myanmars
Frankfurt a.M., Den Haag (epd). Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat ein erstes Urteil zum Völkermord-Vorwurf gegen Myanmar gefällt. Das südostasiatische Land müsse sofort Maßnahmen ergreifen, um die muslimische Volksgruppe der Rohingya zu schützen, erklärte das höchste Gericht der Vereinten Nationen am 23. Januar.
Menschenrechtler begrüßten die Entscheidung. Denn der Bundesstaat Rakhine (historisch bekannt als Arakan) im Westen Myanmars ist seit langem ein Schauplatz von Verbrechen. Die frühere Militärjunta ging brutal gegen die Rohingya-Minderheit vor, etwa mit der "Operation Drachenkönig" (1977/78) oder der "Operation Saubere und Schöne Nation" (1991/92). In der Folge flohen Hunderttausende Rohingya aus dem buddhistisch geprägten Myanmar nach Bangladesch, wo der Islam dominiert.
Der Ultra-Nationalismus in Myanmar dient Hardlinern im Militär, unter buddhistischen Geistlichen und in der Politik bis heute dazu, Hetze und Hass zu verbreiten. Durch das Staatsbürgerschaftsgesetz von 1982 wurden die Rohingya, von denen viele seit Generationen in Rakhine leben, faktisch staatenlos.
Vorwurf der "ethnischen Säuberung"
Der Rakhine-Staat, trotz Bodenschätzen eine der ärmsten Regionen des Landes, blieb ein Konfliktherd: 2012 weitete sich Gewalt zwischen Buddhisten und Muslimen zu Exzessen aus, bei denen offiziell mindestens 200 Menschen getötet und 140.000 vertrieben wurden, die meisten davon Rohingya. Im April 2013 warf die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" der damaligen Regierung unter Ex-General Thein Sein "ethnische Säuberungen" an den Rohingya vor. Manche sprachen bereits damals von einem "verdeckten Völkermord".
Als die Rohingya-Miliz Arsa im Oktober 2016 und August 2017 Dutzende Polizeiposten überfiel, begann Myanmars Militär unter dem Vorwand eines "Anti-Terror-Kampfes" eine Offensive gegen die gesamte Rohingya-Bevölkerung. Mehr als 740.000 flohen seit Ende August 2017 nach Bangladesch.
Während Armeechef Min Aung Hlaing die Massenflucht als "Rückkehr in deren angestammte Heimat" herunterspielte, dokumentierte die Organisation "Fortify Rights", dass Sicherheitskräfte bereits im Herbst 2016 Morde, Vergewaltigungen und Brandanschläge begangen hatten. Darüber hinaus seien Bewohnern in Rakhine Schusswaffen und Schwerter geliefert worden, um Rohingya zu attackieren. Myanmar hingegen wies die Anschuldigungen zurück.
"Militarisierung"
In einer Ansprache am 19. September 2017 behauptete Friedensnobelpreisträgerin und De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, es habe seit dem 5. September 2017 keine Militäroperationen mehr gegeben. 2018 machte jedoch Amnesty International publik, wie auf Landstrichen niedergebrannter Rohingya-Dörfer neue Stützpunkte des Militärs, Unterkünfte und Straßen gebaut wurden, und sprach von einer "Militarisierung mit alarmierender Geschwindigkeit".
Seit 2019 wird die Unruheregion von einem weiteren Konflikt erschüttert: Regierungstruppen führen Krieg gegen die buddhistischen Rebellen der "Arakan Army". Die 2009 gegründete Gruppierung kämpft für Selbstbestimmung in Rakhine. Menschenrechtler sprechen von staatlich sanktionierter Gewalt und beklagen Morde, Folter und Entführungen von Zivilisten, darunter Buddhisten, Muslime und Christen.
Noch immer mehr als 200.000 Lepra-Fälle pro Jahr

epd-bild/Christopher Thomas/DAHW
Frankfurt a.M. (epd). Mit mehr als 200.000 neuen Fällen pro Jahr muss die Lepra nach Ansicht von Medizinern ernster genommen werden. Noch immer sei der genaue Übertragungsweg bei der schon aus biblischen Zeiten bekannten Krankheit nicht bekannt, mahnt Lepra-Experte Sebastian Dietrich im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) intensivere Forschung an. "Es gibt wahrscheinlich mehr Forschung zu Haarwuchsmitteln als zu Lepra", sagte der medizinische Berater der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW).
Bei der Übertragung des "Aussatzes" wird Tröpfcheninfektion angenommen. Eine kurze Berührung reicht, entgegen anhaltender Vorurteile, hingegen nicht aus. Genauere Forschung aber sei nötig, um die Übertragungskette letztlich zu durchschlagen, betonte Dietrich zum Welt-Lepra-Tag am 26. Januar. Die Aufmerksamkeit dürfe angesichts der anhaltend vielen Neuerkrankungen nicht nachlassen.
Betroffene werden diskriminiert
Dabei sei es wenig hilfreich, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Lepra vor rund 20 Jahren als eliminiert erklärt habe, sagte der Mediziner. Denn damit sei lediglich gemeint, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt weniger als einen Lepra-Fall pro 10.000 Einwohner gegeben habe. In manchen Länder und Regionen liege die Zahl aber deutlich höher. Und selbst unter dieser Marke bedeute das keineswegs, dass die Krankheit ausgerottet sei: "Gäbe es in Deutschland 8.000 Lepra-Fälle im Jahr, dann würden wir, glaube ich, die Krankheit nicht als beendet betrachten."
Die weitaus meisten Fälle treten in Entwicklungs- und Schwellenländern auf. Allein aus Indien wurden zuletzt wieder 120.000 Neuerkrankungen gemeldet - und selbst dort gilt die Krankheit laut Dietrich als eliminiert. Wenn Lepra rechtzeitig erkannt wird, ist sie folgenlos heilbar. Haben die Bakterien jedoch die Nerven schon zu stark geschädigt, bleiben oft schwere Behinderungen - die typischen Verstümmelungen an Armen und Beinen - zurück. Die Betroffenen werden noch immer häufig gemieden und diskriminiert, vom Arbeitgeber entlassen oder aus der Familie verstoßen.
Aufmerksamkeit zurückgegangen
Zuerst seien mit der Einführung einer wirksamen Medikamententherapie vor fast 40 Jahren große Erfolge im Kampf gegen Lepra verbucht worden, beschrieb Dietrich die Anstrengungen der Weltgemeinschaft. Angesichts sinkender Infektionszahlen sei dann aber auch die Aufmerksamkeit zurückgegangen - nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Bekämpfung der Lepra vor Ort. Wo es früher eigene Strukturen zum Aufspüren und Behandeln der Lepra gegeben habe, seien diese vielerorts in das normale Gesundheitssystem integriert worden: "Die Lepra-Arbeit fällt dann am Ende oft hinten runter."
Die Zahl der neuen Fälle gehe damit kaum noch zurück, erklärte Dietrich. "Wenn das so weitergeht, reden wir auch in 50 Jahren noch über Lepra und Neuerkrankungen."
Neue Namibia-Verhandlungsrunde im Februar oder März

epd-bild / Kristina Schäfer
Berlin (epd). Die Bundesregierung verhandelt weiter mit Namibia über eine Entschädigung und Entschuldigung für den Genozid an den Volksgruppen der Herero und Nama während der deutschen Kolonialherrschaft. Die Gespräche sollten im Februar oder März fortgesetzt werden, sagte der Namibia-Beauftragte der Bundesregierung, Ruprecht Polenz, dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Die namibische Seite werde zu dem Treffen nach Berlin kommen. Wann es zu einem Abschluss der seit 2015 andauernden Gespräche komme, sei "schwer zu sagen". Polenz betonte: "Wenn es soweit ist, werden wir alle Ergebnisse auf einen Schlag veröffentlichen."
Vor mehr als 100 Jahren ermordeten deutsche Kolonialtruppen Zehntausende Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Historiker bezeichnen diese Gräueltaten als "ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts".
Individuelle Entschädigungen nicht vorgesehen
Polenz sagte, bei den Verhandlungen gehe es darum, die damaligen Ereignisse "in einer gemeinsamen Sprache" zu benennen und zu beschreiben. "Dabei wird auch der Begriff Völkermord vorkommen und es werden die Grausamkeiten in Erinnerung gerufen, die Deutschland verübt hat." Die gemeinsame Sprachregelung könne beispielsweise in einen Resolutionstext fließen, der von den Parlamenten verabschiedet werden könnte. "Der Text beschreibt die Grundlage dessen, wofür wir um Entschuldigung bitten wollen", betonte der langjährige CDU-Außenpolitiker.
Individuelle Entschädigungen seien als Wiedergutmachung indes nicht vorgesehen. "Wir Deutsche haben sehr viel Schuld auf uns geladen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts", sagte Polenz. "Aber persönliche Entschädigungen wurden nach 1945 so geregelt, dass nur Menschen sie bekommen haben, die selber in Konzentrationslagern gelitten hatten oder in Zwangsarbeit gezwungen worden waren." In Namibia habe man es jetzt mit der Urenkelgeneration zu tun. "Es ist also keine Rechtsfrage über die wir sprechen, sondern eine politisch-moralische Frage."
Dammbruch in Brasilien: Anklage gegen Bergbaukonzern und TÜV
Ein Jahr nach dem Minenunglück in Brasilien hat die Staatsanwaltschaft gegen den Bergbaukonzern Vale und die Prüfgesellschaft TÜV Süd Anklage erhoben. 16 Mitarbeiter müssen sich Mordvorwürfen stellen.Berlin, São Paulo (epd). Knapp ein Jahr nach dem verheerenden Staudammbruch im brasilianischen Brumadinho mit 270 Toten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Mitarbeiter des Bergbaukonzerns Vale und des TÜV Süd erhoben. Insgesamt 16 Personen werde Mord vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Minas Gerais am 21. Januar mit. Gegen Vale und das deutsche Zertifizierungsunternehmen TÜV Süd wurde zudem Anklage wegen der Umweltschäden erhoben.
Bei dem Bruch eines Rückhaltebeckens in der Eisenerzmine Brumadinho waren am 25. Januar des vergangenen Jahres 270 Menschen ums Leben gekommen - davon gelten elf Personen noch als vermisst. Zahlreiche Gebäude der Mine und der angrenzenden Stadt Brumadinho wurden unter einer bis zu 15 Meter hohen Schlammmasse begraben. Das Unglück in Brumadinho war eines der schwersten in der Geschichte Brasiliens. Der TÜV Süd hatte im September 2018 in einem Gutachten die Stabilität des Damms attestiert.
TÜV Süd will kooperieren
Zu den Angeklagten gehören nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft auch der Ex-Vale Chef und der Geschäftsführer von TÜV Süd in Brasilien. Der TÜV Süd bestätigte auf epd-Anfrage, dass Anklage gegen das Unternehmen und fünf Personen, die "Mitarbeiter oder freie Mitarbeiter sind oder waren", erhoben worden sei. "TÜV Süd hat unverändert großes Interesse an der Aufklärung der Unglücksursache und bietet im Rahmen der laufenden Ermittlungen den zuständigen Behörden weiterhin seine Kooperation an", hieß es in einer Erklärung. Details wollte das Unternehmen aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens nicht nennen.
Der TÜV Süd hatte ein Gutachten ausgestellt, das Grundlage für den Weiterbetrieb der Mine war, obwohl seine Ingenieure zuvor auf die mangelnde Stabilität des 85 Meter hohen Damms hingewiesen hatten. Es gab Probleme mit dem Drainagesystem. Die Ingenieure machten klar, dass zu viel Wasser im Damm sei und deshalb die Stabilität gefährdet sei, wie brasilianische Medien unter Berufung auf polizeiliche Vernehmungsprotokolle berichteten. Ein Verantwortlicher habe erklärt, von Vale unter Druck gesetzt worden zu sein. Vorübergehend waren auch 13 Mitarbeiter des TÜV Süd festgenommen, aber wieder freigelassen worden.
Gegen beide Unternehmen laufen noch weitere Klagen. Ein Gericht im Bundesstaat Minas Gerais hat den Minenbetreiber Vale bereits verurteilt, für alle Schäden der Katastrophe aufzukommen. Der Bergbaukonzern wurde unter anderem zu Entschädigungen in Millionenhöhe für die Familien der Opfer verurteilt.
UN-Ausschuss: Klimaflüchtlinge können Asylanspruch haben

epd-bild / Melanie Stello
Genf (epd). Klimaflüchtlinge dürfen nach Auffassung des UN-Menschenrechtsausschusses nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Dabei müssten Klimaflüchtlinge nicht nachweisen, dass ihnen unmittelbar Gefahr für Leib und Leben drohe, erklärte das Gremium, in dem auch Deutschland vertreten ist, am 21. Januar in Genf. Es reiche aus, wenn die Lebensumstände durch den Klimawandel derart bedroht seien, dass das Recht auf Leben gefährdet sei. Langfristige Folgen des Klimawandels wie der Anstieg des Meeresspiegels zählten ebenso dazu wie die Gefahr plötzlicher Überflutungen oder Stürme.
Hintergrund der Entscheidung war die Beschwerde eines Bürgers des Südsee-Inselstaates Kiribati, der 2015 Asyl in Neuseeland beantragt hatte. Nach einer Ablehnung war er in seine Heimat abgeschoben worden. Seinen Asylantrag hatte er damit begründet, dass Kiribati durch den Klimawandel unbewohnbar geworden sei. So gebe es gewaltsame Konflikte um immer weniger bewohnbares Land. Auch versalze das Trinkwasser, weil der Meeresspiegel steige.
Beschwerde aus Kiribati abgewiesen
Obwohl der Menschenrechtsausschuss die Position von Klimaflüchtlingen mit seiner Entscheidung stärkt, wies er die Beschwerde des Bürgers von Kiribati dennoch ab. Die Regierung Neuseelands habe seinen Asylantrag gründlich genug geprüft, um zu dem Schluss zu kommen, dass Kiribati genügend Vorkehrungen getroffen habe, um das Leben des klagenden Bürgers und seiner Familie zu schützen. Daher werde dessen Recht auf Leben nicht verletzt, entschied der Ausschuss.
Der UN-Menschenrechtsausschuss überwacht die Einhaltung des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, den 172 Staaten ratifiziert haben. Zu den 18 rotierenden Mitgliedern im Ausschuss gehört bis Ende des Jahres auch Deutschland. Ein Zusatzprotokoll, das neben 115 anderen Staaten auch Deutschland unterzeichnet hat, ermöglicht es Einzelpersonen, Beschwerden gegen Staaten einzulegen, die im Pakt verbriefte Menschenrechte verletzt haben sollen.
Einhorn oder Zebra?

epd-bild/Nyani Quarmyne/giz
Accra (epd). Mit Landwirtschaft wollte Tabitha Nanzala Mayabi nie etwas zu tun haben: "Meine Mutter bewirtschaftet einen Hof, und ich habe sie schon früh gebeten: Wenn du dein Testament machst, hinterlasse mir bitte nicht dein Land, die Arbeit ist mir zu anstrengend." Die 30-Jährige lacht schallend, ihre Augen blitzen dabei hinter der Brille hervor. "Und bei meinen Freundinnen war das ebenso: Wer konnte, ist in die Stadt gezogen, weit weg von den Farmen." Mayabi wurde Softwareentwicklerin, zehn Jahre ist das her. Heute lebt sie in Ghanas Hauptstadt Accra - und arbeitet für die Landwirtschaft.
Das Start-up, das Mayabi gegründet hat, heißt Ghalani, auf Deutsch "Scheune". Mayabi will Afrikas Landwirtschaft fitmachen für die Zukunft - und attraktiv für die junge Bevölkerung, die in die Städte drängt. "Und das", sagt sie, "geht nur mit dem Smartphone und der passenden App." Zunächst hatte sie Software für Schulen entwickelt, dann bewarb sie sich in Accra beim Gründerzentrum "MEST", einem sogenannten Inkubator, der Start-ups aus ganz Afrika einlädt, ihre Innovationen marktreif zu machen. Und sie entdeckte die Landwirtschaft als Arbeitsfeld.
Michael von Stackelberg von der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) arbeitet in Accra in einem Projekt, das grüne Innovationen fördert, und kennt MEST gut. Grundsätzlich teilt er Mayabis Einschätzung: "Interessant wird Landwirtschaft, wenn wir etwa über digital vermittelte Dienstleistungen sprechen, und da entstehen dann auch Jobs."
Wettervorhersage und Marktpreise
Mayabis Ghalani-App ist ein Management-Tool: Ein Kalender hilft den Bauern zu planen, welche Arbeit ansteht. Die App stellt eine Wettervorhersage bereit und vergleicht Marktpreise. Außerdem verzeichnet sie Ausgaben und Einnahmen und garantiert damit eine simple Buchführung. "Wir benutzen dabei sehr einfache Begriffe, um niemanden auszuschließen: 'Geld rein' und 'Geld raus' zum Beispiel. Und diejenigen, die weder lesen noch schreiben können, bitten ihre Kinder um Hilfe." Weil nur wenige Bauern ein Smartphone haben, nehmen vielerorts Multiplikatoren die Daten der Bauern auf.
Diese Daten sind Teil des Geschäftsmodells. Denn Ghalani bedient auch die andere Seite: Händler etwa, die bestimmte Feldfrüchte suchen, oder Verkäufer von Saatgut und Pestiziden. So wird die "Scheune" zum virtuellen Marktplatz, der umso besser läuft, je mehr Bauern mitmachen. Kleinbauern, die bislang als die Abgehängten der Gesellschaft galten, sind damit auf einmal zu begehrten Kunden geworden. Und das hat ebenso wie die - infolge der neuen Technik - höheren Erträge dazu beigetragen, dass der Coolnessfaktor der Landwirtschaft steigt.
"Meine Generation sieht Landwirtschaft als ein Geschäftsfeld, nicht als Notlösung", sagt Yvette Tetteh. Sie ist groß, schlank, trägt ihr Haar kurz rasiert und einen silbernen Nasenring zur modischen Bluse. Geboren ist sie in London, ihre Jugend hat sie in Südafrika und Nigeria verbracht. Nach der Schule jobbte sie in Hawaii.
"Harte Arbeit"
Die lebenslustige Ghanaerin hätte alles machen können. Sie entschied sich für die Landwirtschaft. "In Hawaii habe ich eher zum Spaß Bananen getrocknet, weil die Ernte in dem Jahr so reichlich ausfiel - und als ich zurückkam nach Ghana, da dachte ich mir: Damit ließe sich doch auch hier etwas anstellen." Mit einem Kompagnon stellte sich Tetteh bald in eine angemietete Küche und schnitt fortan tagaus, tagein Früchte in kleine Stücke.
"Das ist harte Arbeit, und am Abend weiß man, was man getan hat", lacht sie. Tettehs Start-up ist in vielem das Gegenteil von dem, was Tabitha Nanzala Mayabi macht. "Innovation, das bedeutet doch vor allem: schnell, groß, stressig - ich aber wollte etwas Pragmatisches machen, etwas Echtes, mit einer direkten Auswirkung etwa für die Farmer, von denen ich die Früchte kaufe." Wie Mayabi will auch Tetteh Landwirtschaft für junge Leute attraktiv machen. Nach drei Jahren arbeiten neun Angestellte für Tetteh - sieben von ihnen sind Frauen und keiner ist über 35.
Dabei ist der Markt für Trockenfrüchte umkämpft. Beim Unternehmen "HPW Fresh & Dry" etwa stehen Dutzende Mitarbeiter an Fließbändern und sortieren die kleingeschnittenen Früchte auf Gitter, die auf mannshohen Wagen in den Trockenraum gefahren werden. Von der Fabrik, die zwei Autostunden von Accra entfernt liegt, wird die vakuumverpackte Ware nach Deutschland transportiert. Tetteh dagegen entschied sich bewusst gegen den Export. "Ich habe gedacht: Wenn ich schon die ganze Arbeit habe, soll zumindest mein Name auf der Packung stehen." Ihre "Yvaya Farm"-Produkte sind vorerst nur in ghanaischen Läden zu haben. Den Onlinehandel gab sie auf: "Das macht hier keiner."
Frauen bessere Unternehmerinnen
Die Träume von Tetteh und Mayabi sind verschieden: Mayabi träumt von einem "Einhorn", einer App, die derart fliegt, dass sie es an die Börse schafft oder von einem globalen Riesen aufgekauft wird. Der Begriff stammt aus der US-Finanzindustrie. Tetteh dagegen wünscht sich etwas Bodenständiges, ein "Zebra", sagt sie. Der Begriff stammt vom "EntreprenHer"-Stammtisch, wo ghanaische Unternehmerinnen ihre Erfahrungen austauschen. Die Gründerin eines erfolgreichen Foodlabels ist dabei, die Gründerin eines Programmierclubs und eine frühere UN-Chefin und Mäzenatin.
Mayabi hält Frauen für bessere Unternehmerinnen: "Landwirte investieren in Kakao, der viel Geld bringt, Frauen dagegen in weniger lukrativen Mais oder Getreide - und trotzdem haben sie mehr Geld." Denn sie teilten sich den Ernteerlös besser ein - eine Technik, die Mayabi in ihre App übersetzt hat. Tetteh setzt darauf, mit ihrer bald schon aus erneuerbaren Energien gespeisten Trockenfrucht-Produktion mehr Einkommen für andere zu schaffen. "Mit der GIZ haben wir jetzt gut 25 Farmerinnen und Farmer ausgesucht, die organischen Anbau lernen", sagt sie. "Das dauert gut drei Jahre. Aber dann haben wir dauerhaft gute Lieferanten."

