Kirchen
Der Gottesdienst-Generator

epd-bild / Jens Schulze
Stuttgart (epd). Die Digitalisierung erobert nun auch den Gottesdienst - zumindest in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Ein neues Internetangebot erleichtert Pfarrern die Vorbereitung einer Tauffeier. Namen von Täufling, Eltern und Paten eintippen, Datum des Taufsonntags eingeben - und schon spuckt eine Internetseite die komplette Liturgie aus.
Bislang mussten Pfarrer meistens auf Agenden (Gottesdienstbücher) zurückgreifen. Bei einer Taufe schrieben sie dort mit Bleistift den Namen des Täuflings hinein, um ihn im Gottesdienst richtig vorlesen und danach wieder ausradieren zu können. Da fast alle Theologen solche Feiern inzwischen am Computer vorbereiten, stieg der Wunsch nach einer digitalen Vorlage.
Datenbank für die Taufagende
Ursprünglich wollte Frank Zeeb, Kirchenrat der württembergischen Landeskirche, deshalb der gedruckten Taufagende eine DVD mit Textdateien beilegen. Er ließ sich dann aber überzeugen, dass der Fortschritt schon weiter ist, denn viele Computer besitzen kein DVD-Laufwerk mehr. Deshalb entschied man sich für eine Internetlösung. Pfarrer tragen nur noch die individuellen Daten auf einer geschützten Seite ein, den Rest erledigt eine Datenbank.
Das auszudruckende Formular enthält voreingestellt alle wichtigen Elemente, darunter den für den jeweiligen Sonntag bestimmten Predigttext, die liturgische Farbe sowie den biblischen Wochenspruch und das Wochenlied, Psalmen und Segensgebet. Das Programm unterscheidet auch zwischen männlichen und weiblichen Täuflingen und setzt bereits die richtigen Pronomen (seine/ihre) ein.
Die Seite enthält dazu weiteres Material: Tauftexte lassen sich in anderen Sprachen herunterladen, darunter englisch, arabisch, persisch und russisch. Wer auf seinem Computer das komplette Taufbuch lesen möchte, kann es sich ebenfalls auf seine Festplatte überspielen.
Vorlage kann auch für Sonntage ohne Taufe genutzt werden
Da Taufen ganz überwiegend in normalen Sonntagsgottesdiensten stattfinden, erfüllt das neue Angebot gleich einen zweiten Zweck: Die Vorlage kann auch für jeden Sonntag ohne Taufe genutzt werden, ist also für Pfarrer geradezu ein Alltagswerkzeug. Aufgrund der speziellen Gottesdienstform in Württemberg, die sich von der anderer evangelischer Kirchen unterscheidet, hätte eine Öffnung der Internetseite für Mitarbeiter anderer Landeskirchen allerdings wenig Sinn. Interessant sind allenfalls die Übersetzungen in anderen Sprachen, wonach eine pfälzische Pfarrerin, die mit Flüchtlingen arbeitet, bereits gefragt habe, berichtet Kirchenrat Zeeb.
Die Taufagende ist erst der Anfang. Im kommenden Jahr ist die Digitalisierung der Trauagende geplant, über die im Herbst die Landessynode entscheiden wird. Weitere Agenden, etwa für Bestattungen oder Konfirmationen, sollen folgen.
"Unser Projekt zeigt: Die Digitalisierung hat nun auch einen Platz im Kernbereich unserer kirchlichen Arbeit gefunden, nämlich in Gottesdienst und Wortverkündigung", erläutert Zeeb. Er denkt schon einen Schritt weiter und kann sich gut vorstellen, dass statt Ringbüchern mit ausgedruckten Liturgien immer häufiger Tabletcomputer zum Einsatz kommen, auf denen die gottesdienstlichen Texte zu lesen sind.
Die komplette Tauffeier ist mit dem Internetservice indessen noch nicht vorbereitet. Für die Predigt beispielsweise gibt es nur einen Platzhalter. Doch für deren Vorbereitung sollte durch das einfach zu handhabende Formular künftig etwas mehr Zeit sein.
Evangelische Kirche sucht Mentoren für Aufnahmeprogramm
Berlin, Bielefeld (epd). Evangelische Kirche und Sozialverbände sind noch auf der Suche nach Mentoren für ihr Programm zur Umsiedlung von Flüchtlingen nach Deutschland. 25 Mentorengruppen stünden bislang bereit, sagte Edgar Born von der Zivilgesellschaftlichen Kontaktstelle zur Schulung und Begleitung der Mentoren am Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Kirche am 24. Juli in Berlin. Würde jede Gruppe eine vierköpfige Familie aufnehmen, könnten also 100 Menschen nach Deutschland kommen. Das Programm umfasst insgesamt aber 500 Plätze.
Idee des Programms ist es, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Camps im Libanon, Jordanien, Ägypten und Äthiopien nach Deutschland zu holen, indem ihre Betreuung durch Ehrenamtliche sichergestellt ist. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine mindestens fünfköpfige Mentorengruppe, die die Finanzierung der Nettokaltmiete für zwei Jahre aufbringt und zusagt, beim Ankommen im deutschen Alltag zu helfen, etwa bei Behördengängen oder beim Deutschlernen.
Die 500 Plätze des Programms sind Teil der deutschen Zusage für das europäische Resettlement-Programm, bei dem Flüchtlinge in ein anderes Land umgesiedelt werden. 10.200 Plätze hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bis Ende 2019 zugesagt. Ausgewählt werden Flüchtlinge für das Programm vom UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR).
Fünf Gruppen geschult
Das Programm "Neustart im Team" wurde im Mai in Kooperation mit den zuständigen Stellen des Bundes, darunter das Bundesinnenministerium, gestartet. Die Evangelische Kirche von Westfalen hat das Programm maßgeblich vorangetrieben und unterstützt die Mentoren aus einem Fonds von 425.000 Euro. Unterstützung erhält das Projekt "Neustart im Team" unter anderem von den kirchlichen Sozialverbänden Diakonie und Caritas sowie der Mercator Stiftung und der Bertelsmann Stiftung.
Fünf der 25 Gruppen hätten bereits die erforderlichen Schulungen durchlaufen, sagte Pfarrer Born. Bei den Gruppen handele es sich um Ehrenamtliche aus Kirchengemeinden, Kommunen oder um private Gruppen, die Flüchtlingen eine sichere Perspektive in Deutschland eröffnen. Für viele sei es Motivation, etwas zu tun angesichts des Sterbens im Mittelmeer, sagte Born, der die Zivilgesellschaftliche Kontaktstelle zur Schulung und Begleitung der Mentoren am landeskirchlichen Institut für Kirche und Gesellschaft in Schwerte leitet.
"Legale Wege nach Europa notwendig"
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie und der Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin, Martin Dutzmann, betonten die Notwendigkeit legaler Wege nach Europa. Solange es diese nicht gebe, werde es weiter die Bilder von verzweifelten Menschen geben, die über das Mittelmeer nach Europa kommen wollen, sagte Dutzmann.
Lilie nannte es ein "Armutszeugnis für ein Europa der Menschenrechte", dass die Frage nach einem gesicherten Zugang bis heute nicht befriedigend beantwortet sei. Beide sprachen sich für eine höhere Resettlement-Quote aus. Weltweit warten den Angaben zufolge rund 1,4 Millionen besonders schutzbedürftige Flüchtlinge auf die Perspektive, in ein anderes Land in Sicherheit gebracht zu werden.
Oberkirchenrat Möller hofft auf Ausbau des Programms
Der Oberkirchenrat der westfälischen Kirche, Ulrich Möller, erklärte, er hoffe, dass das Programm noch weiter ausgebaut werde. „Neustart im Team“ habe das Potenzial, dass aus 500 Plätzen 5.000 werden, sagte er. Die westfälische Kirche schießt über einen Fonds für Gruppen von Ehrenamtlichen auch das Geld vor, das von den Mentorengruppen für die Miete aufgebracht werden muss. Die finanzielle Hürde dürfe nicht dazu führen, dass Leute sich nicht engagieren, sagte er.
Mit dem Programm gebe es nach dem Vorbild der kleinen evangelischen Kirchen in Italien nun auch nach Deutschland einen "humanitären Korridor", der den Flüchtlingen die lebensgefährliche Fahrt über das Mittelmeer erspare. Die zunächst 500 Personen in zwei Jahren seien zwar eine kleine Zahl und keine hinreichende Antwort auf das Versagen der europäischen Politik, aber "vielleicht ein Stachel gegen die Gleichgültigkeit, das Wegsehen". Die Zusammenarbeit von Staat, Kirche und engagierten Einzelnen könne andere animieren und den politisch Verantwortlichen vor Augen führen: "Wir können etwas tun - gemeinsam."
Kirchenorganisation fordert "Rückkehrrecht nach Europa"
Brüssel (epd). Migranten mit legalem Aufenthaltsstatus in der EU sollten nach Ansicht der Kommission der Kirchen für Migranten in Europa (CCME) ein "Rückkehrrecht nach Europa" erhalten. "Wenn sie hier zum Beispiel nach einigen Jahren legalen Aufenthalts ihren Job verlieren und in die Heimat zurückkehren, dürfen sie später wieder nach Europa einreisen", sagte der Generalsekretär der ökumenischen Organisation in Brüssel, Torsten Moritz, dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Das führt dazu, dass Leute sich sagen 'Da probiere ich Zuhause aus'."
Das Konzept solle mit Afrika versucht werden, wobei man mit bestimmten Berufsgruppen oder Herkunftsländern beginnen könne, warb Moritz, der seit 2003 für die CCME arbeitet und seit Mitte 2018 ihr Generalsekretär ist. Die EU selbst habe bereits im Zuge der Erweiterungen um süd- und osteuropäische Länder damit Erfahrungen gesammelt, sagte der promovierte Politikwissenschaftler aus Deutschland: "Bis in die 1980er Jahre kamen viele Spanier und Portugiesen in den Norden, dann später viele Polen in den Westen. Aber als sich nach dem jeweiligen EU-Beitritt festgesetzt hatte, dass die Freizügigkeit für sie erhalten bleibt, sind viele zurückgegangen."
Kaum europaweit gültige Regelungen
Insgesamt bemängelte Moritz, dass die EU zu wenig legale Zugangswege für arbeitssuchende Migranten anbiete. Außer der "Blue Card" für Hochqualifizierte und den Erlaubnissen für Saisonarbeiter gebe es kaum entsprechende europaweit gültige Regelungen, erklärte der Generalsekretär der 1964 gegründeten Organisation, der unter anderen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) angehört und die zu Migrantion und Asyl, Integration und Rassismus arbeitet. Diese Situation sei ein Nachteil für Europa, wo nicht zuletzt in Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Bau und dem Gesundheitswesen Migranten gebraucht würden, sagte Moritz. "Mit der 'Blue Card' können wir zwar den Computerexperten und die Ingenieurin nach Europa holen, aber nicht die dringend benötigte Krankenschwester."
Derzeit sähen zwar viele Politiker die Notwendigkeit von Migration. "Aber Maßnahmen werden durch den hochideologischen Diskurs rund um Flüchtlinge blockiert." Vor diesem Hintergrund forderte Moritz von der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), eine "mittel- und langfristige Perspektive" einzunehmen und zu fragen: "Was brauchen wir in zehn Jahren an Migration?" Ein umfassendes EU-Gesetz zur legalen Arbeitsmigration habe derzeit zwar keine politische Chance. Die EU könne aber auch kurzfristig einen Mehrwert in der Migrationspolitik bieten, erklärte der CCME-Generalsekretär: "Ein einfaches Beispiel: Die EU könnte in Entwicklungsländern gemeinsame Anlaufstellen für Arbeitsmigranten anbieten, um sie nach Europa zu vermitteln."
Bedford-Strohm erhält Nell-Breuning-Preis 2019

epd-bild/Norbert Neetz
Trier (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, bekommt in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten Oswald von Nell-Breuning-Preis der Stadt Trier. Er werde für seine wissenschaftliche Arbeit zu Fragen der Wirtschaftsethik, zum Sozialstaat und Gerechtigkeitstheorien sowie für seinen Einsatz für soziale Gerechtigkeit und eine Wirtschaftspolitik aus christlicher Perspektive ausgezeichnet, teilte die Stadt am 23. Juli mit. ZDF-Chefredakteur Peter Frey werde die Laudatio bei der Preisverleihung Mitte November in der Promotionsaula des Bischöflichen Priesterseminars halten.
"Ein Freund klarer Worte, der auch Konflikte nicht scheut"
Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) würdigte Bedford-Strohm als einen der profiliertesten Theologen in Deutschland. "In Fragen der Gerechtigkeit ist er ein Freund klarer Worte, der auch Konflikte mit der Politik nicht scheut und unbequeme Wahrheiten ausspricht", sagte der Vorsitzende der Jury, die aus Vertretern der Stadt und Wissenschaftlern besteht.
Der EKD-Ratsvorsitzende bezeichnete es als besonderen Rückenwind, dass der Preis von der Stadt Trier und damit der Bürgerschaft verliehen werde. "Sein Namensgeber Oswald von Nell-Breuning ist einer der Nestoren der Katholischen Soziallehre, die mein Denken schon früh mitgeprägt und ökumenische bereichert hat", sagte er. Kirche dürfe sich nie hinter ihre eigenen Mauern zurückziehen, sondern müsse authentische öffentliche Kirche sein.
Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Erinnerung an den in Trier geborenen Sozialethiker und Jesuitenpater Oswald von Nell-Breuning (1890-1991) verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt, der Verein TransFair und der frühere CDU-Arbeitsminister Norbert Blüm.
Interkulturelle Woche wird in Halle eröffnet
Frankfurt a.M., Halle (epd). Die bundesweite Interkulturelle Woche der Kirchen wird am 22. September in Halle eröffnet. Unter dem Motto "Zusammen leben, zusammen wachsen" finden bis zum 29. September rund 5.000 Veranstaltungen in mehr als 500 Städten und Gemeinden statt, wie der Ökumenische Vorbereitungsausschuss am 25. Juli in Frankfurt am Main mitteilte. Die Interkulturelle Woche setze "gerade in Zeiten eines erstarkenden Rechtspopulismus ein Zeichen für ein solidarisches und gleichberechtigtes Miteinander".
Den Auftakt in Halle bildet am Sonntag, 22. September, ein ökumenischer Gottesdienst von Vertretern der evangelischen, der katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche. Auch Gläubige anderer Konfessionen und Religionen sind beteiligt. Am Montag, 23. September, gibt es nachmittags auf dem Marktplatz ein Bühnenprogramm sowie Stände von Vereinen und Initiativen.
Die drei Konfessionen haben die jährlich stattfindende Woche 1975 gegründet, sie sind die Träger. Kommunen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Integrationsbeiräte und Migrantenorganisationen beteiligen sich je nach Ort. Grundanliegen sind nach eigener Darstellung Begegnung, Teilhabe und Integration. Der "Tag des Flüchtlings" am 27. September ist Teil der Woche.
Studien zu Missbrauch bei Regensburger Domspatzen veröffentlicht

epd-bild/Hanno Gutmann
Regensburg (epd). Als Teil der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen hat das Bistum Regensburg zwei Studien veröffentlicht. Die Forschergruppen sprechen in ihren Berichten von Merkmalen einer "Totalen Institution" in der Vorschule, dem Internat und dem angeschlossenen Knabenchor der Domspatzen. Die Schule habe alle Lebensbereiche der Schüler gesteuert und kontrolliert, so habe ein Klima der Gewalt entstehen können, in dem vielfacher Missbrauch passierte. "Gewalttäter konnten in den Anonymitätsfugen eines Organisationssytems agieren, das für viele nur schwer zu durchschauen war", heißt es in einer am 22. Juli vorgestellten historischen Studie der Universität Regensburg.
Die Forscher sprechen von einem System, das dauernde Überwachung bis in intimste Bereiche der Körperlichkeit bedeutete, das aber selbst kaum von außen kontrolliert wurde. "Der Chor, seine Finanzierung und sein Erfolg standen stets im Zentrum und waren wichtiger als individuelles Wohlergehen der Schüler oder eine kindgerechte Pädagogik", heißt es in der Studie, die im Herbst als Buch erscheinen soll. Sie enthält Erkenntnisse über die Gewaltgeschichte von Vorschule, Internat und angeschlossenem Knabenchor zwischen 1945 und 1995. Die zweite Studie, eine kriminologische Untersuchung des Missbrauchs, wurde von der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden veröffentlicht.
Ratzingers "Ohrfeigen"
Bereits 2017 wurde ein vom Bistum beauftragter Abschlussbericht zum Missbrauch vorgelegt. Demnach wurden insgesamt 500 Sänger Opfer von körperlicher Gewalt, 67 von sexueller Gewalt. Die Übergriffe hätten vor allem in den 60er und 70er Jahren stattgefunden. Als Täter seien 49 Menschen ausgemacht worden.
In dem Bericht zu den Misshandlungsfällen bei den Domspatzen stellte sich zudem heraus, dass der Papstbruder und frühere Domspatzen-Chorleiter Georg Ratzinger Teil des Gewaltsystems bei den Domspatzen war. Um "seine Vorstellungen von musikalischer Qualität durchzusetzen", habe der heute 95-jährige Ratzinger auch nach 1980 "körperliche Gewalt zumindest in Einzelfällen" angewendet, hieß es im Bericht. Ratzinger selbst sprach von "Ohrfeigen" und sagte, dass er sich seit 1980 strikt an das gesetzliche Züchtigungsverbot gehalten habe.
Insbesondere die historische Studie hat nun die Verstrickung Ratzingers in die Missbrauchsfälle untersucht. Seine Person sei "ambivalent", er habe Gewalt angewandt, doch sei er auch als "wohlwollend" und "väterlich" empfunden worden. Deutlich wird laut der Studie Ratzingers Rolle als stummer Mitwisser. Es sei ausgeschlossen, dass er nichts vom Prügelregime gewusst habe, wirkungsvoll eingegriffen habe er nicht.
Drei Millionen Ziegelsteine

epd-bild/Rolf Zöllner
Potsdam (epd). Rund 80 Meter hätten es sein sollen, nun sind es erst einmal gut fünf: Wenn die erste Baugenehmigung für den neuen Potsdamer Garnisonkirchturm am 29. Juli nach sechs Jahren abläuft, wird erst ein kleiner Teil des Bauwerks zu sehen sein. Fehlende Gelder und Baumängel kurz nach dem Start haben das Projekt verzögert. Inzwischen liegt eine zweite Baugenehmigung vor, der Turmbau hat nun ganz offiziell ein paar Jahre mehr Zeit. Und die Bundesregierung stellt zusätzliche Fördermittel in Aussicht.
Ein Kran transportiert Mörtelbottiche und Ziegelpakete. Arbeiter montieren am Ort der 1945 zerstörten und 1968 abgerissenen evangelischen Barockkirche Verlängerungen an Gerüste. Maurer setzen Ziegelsteine. Seit Herbst 2017 wird hier gearbeitet, inzwischen steht der Erdgeschoss-Rohbau, drei weitere Etagen im Turmsockel folgen noch. Dann soll mit dem Turmschaft begonnen werden.
Rund 40 Millionen Euro Baukosten werden derzeit für den Turm veranschlagt, gut zehn Millionen davon kommen aus Spenden, fünf Millionen von der evangelischen Kirche und ein Großteil vom Bund. Zwölf Millionen fehlen noch.
Aussichtsplattform
"Die Grundvariante mit Aussichtsplattform soll 2022 fertig sein", sagt Peter Leinemann gut gelaunt. Rund 2,8 Millionen Ziegel müssten im Turm verarbeitet werden, 400.000 mehr als zunächst angenommen, erzählt der kaufmännische Vorstand der Garnisonkirchenstiftung. Bei Bauvorhaben dieser Größenordnung seien solche Entwicklungen nicht ungewöhnlich.
Neben der Baustelle steht ein ramponiertes Kapitell der historischen Garnisonkirche. Ob der sechs Tonnen schwere Sandstein in den neuen Turm eingebaut wird, ist noch offen. Daneben wartet ein weiteres Originalteil auf den Fortgang der Bauarbeiten. Das Gittertor sei einst vor das Hauptportal gesetzt worden, um die nächtliche Nutzung des Eingangsbereichs als Abort zu verhindern, erzählt Leinemann. Wo das Tor später hinkommt, steht noch nicht fest.
Das alte DDR-Rechenzentrum direkt nebenan ist inzwischen ein Kunst- und Kreativzentrum. Ölgemälde, Fotokunst und andere Werke sind dort in Fluren, Treppenhäusern und Ateliers zu sehen. In einer Ecke hängt ein Plakat der linksalternativen Potsdamer Wählergruppe "Die Andere", auf dem der Garnisonkirchturm raketengleich ins All geschossen wird: Im Kunsthaus, das einem möglichen Wiederaufbau des Kirchenschiffs im Weg wäre und auf seinen Abriss wartet, werden die Bauarbeiten direkt vor dem Fenster mit Argwohn beobachtet.
Kritik an Projekt
Die zeitliche Begrenzung der Mietverträge sei ein großes Problem, sagt Frauke Röth, die im Kunsthaus arbeitet. "Dass das Rechenzentrum einem Kirchenschiff weichen soll, das wahrscheinlich nie gebaut werden wird, können viele hier nicht verstehen", sagt die Diplom-Ingenieurin: "Das führt dann zu einem Exodus aus einem Haus, für das ein Riesenbedarf da ist." Die Nutzung als Kreativzentrum sei nur als Zwischenlösung gedacht, der Abriss lange beschlossen, sagt Peter Leinemann dazu: "Ein Teil davon steht auf unserem Grundstück."
Auch bei anderen, darunter bei der Martin-Niemöller-Stiftung und der Initiative "Christen brauchen keine Garnisonkirche", hält die Kritik an dem Bauprojekt an, das anfangs aus Spenden finanziert werden sollte. Im Mittelpunkt steht vor allem die Geschichte der Garnisonkirche als preußische Militärkirche und ihre Nutzung zur NS-Inszenierung der Reichstagseröffnung im März 1933. Und dass so viel öffentliche Gelder in den Wiederaufbau fließen.
Dass die Bundesregierung nun statt der bereits beschlossenen zwölf Millionen Euro bis zu 18 Millionen Euro und damit fast die Hälfte der Gelder für den Turm in Aussicht stellt, könnte die aktuelle Finanzierungslücke halbieren. Die Reaktion der Bürgerinitiative "Potsdam ohne Garnisonkirche" fällt heftig aus: "Keine weiteren Steuergelder für den Wiederaufbau der Garnisonkirche", fordert sie. "Wir bauen ein öffentliches Haus für Kultur, Bildung und geistliches Leben", sagt dagegen Peter Leinemann. Dass sich die öffentliche Hand daran beteiligt, könne nicht verkehrt sein.
In der aktuellen Abstimmung zum Potsdamer Bürgerhaushalt laufen gleich mehrere Anträge zum Thema, teils dafür, überwiegend dagegen. Die Stiftung baut weiter. "Jetzt sind wir so weit gekommen", sagt Peter Leinemann: "Jetzt sollten wir den Rest auch noch schaffen."
EKD-Militärbischof Rink fordert Dienstpflicht
Frankfurt a.M. (epd). Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat sich für eine Dienstpflicht zur stärkeren Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass es unserer Gesellschaft guttun würde, wenn junge Menschen nach ihrem Schulabschluss wahlweise einen sozialen Dienst, einen Entwicklungsdienst oder einen Wehrdienst absolvieren würden", schreibt Rink im evangelischen Monatsmagazin "chrismon" (August-Ausgabe).
Rink bedauert in dem Gastbeitrag, dass die deutsche Gesellschaft kein Interesse an der fremden Welt der Bundeswehr habe. Die Soldatinnen und Soldaten seien dadurch gesellschaftlich isoliert. "Ich finde so etwas brandgefährlich", schreibt Rink. Deshalb spricht er sich dafür aus, "alle Kräfte zu stärken, die die Bundeswehr in die Gesellschaft integrieren".
Seitdem die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde, verstärke sich der Prozess der Isolierung der Bundeswehr: "Bis dahin hatten viele noch irgendwie Kontakt zur Bundeswehr, sei es über einen Onkel, der 'beim Bund' war", schreibt der Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Seitdem löst sich dieser Kontakt nach und nach auf." Eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen würde den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, ist er überzeugt.
Rink hatte die Aussetzung der Wehrpflicht in der Vergangenheit wiederholt infrage gestellt, weil er befürchtet, dass damit die Distanz zwischen Soldaten und der Bevölkerung wächst. Zudem warnte er vor "neuen Söldnern", weil immer mehr Menschen "von der ökonomischen Verliererseite" in die Bundeswehr eintreten würden.
Studientag "Friede zwischen den Völkern"
Düsseldorf (epd). Die Evangelische Akademie im Rheinland, das Evangelische Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis an Sieg und Rhein und die Ökumenische Konsultation Gerechtigkeit und Frieden laden am 14. September in Siegburg zu einem Studientag zum Thema "Frieden zwischen den Völkern" ein. Die Veranstaltung soll zur XI. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen hinführen, wie die Veranstalter erklärten. Themen sind demnach Gestaltung von Frieden, das Zusammenwirken in der Ökumene und Entwicklungsmöglichkeiten der Konfessionen in der säkularen Welt.
Im Anschluss an den Studientag findet das Netzwerktreffen der Ökumenischen Konsultation Gerechtigkeit und Frieden statt. Die Teilnahme an dem Studientag ist kostenlos. Weitere Informationen sind beim Evangelischen Erwachsenenbildungswerk im Kirchenkreis an Sieg und Rhein erhältlich, Telefon 02241/25 215 11 (Andrea Eisele).
Bingener wird neuer Präsident von Missio und Kindermissionswerk
Aachen, Bonn (epd). Dirk Bingener wird neuer Präsident des katholischen Missionswerks Missio Aachen und des Kindermissionswerks "Die Sternsinger". Seine Ämter tritt er voraussichtlich im Herbst an, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz, die "Sternsinger" und Missio am 22. Juli gemeinsam mitteilten. Bingener folgt auf Prälat Klaus Krämer, dessen Amtszeit zum 31. Juli endet.
Der 47-jährige Bingener war bis jetzt als Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) tätig. In dieser Funktion war der Pfarrer auch als Mitträger der Aktion Dreikönigssingen für das Kindermissionswerk aktiv. Zudem ist er Mitglied der Konferenz Weltkirche der Bischofskonferenz, in der alle weltkirchlichen Akteure der katholischen Kirche zusammengeschlossen sind.
Bingener erklärte, er freue sich auf die neue Aufgabe. In der Arbeit der Hilfswerke gehe es darum, weltkirchliche Solidarität konkret zu leben, um ihr so ein glaubwürdiges, den Menschen zugewandtes Gesicht zu geben. Die BDKJ-Bundesvorsitzenden Katharina Norpoth und Thomas Andonie würdigten Bingeners Einsatz, die Stimme der Jugend in der katholischen Kirche hörbar zu machen. Der amtierende Präsident der Hilfswerke, Krämer, gratulierte seinem Nachfolger und erklärte, Bingener werde aus seiner Tätigkeit beim BDKJ sehr viele Impulse zur Weiterentwicklung der beiden Hilfsorganisationen mitbringen.
Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" unterstützt nach eigenen Angaben mit jährlich rund 80 Millionen Euro weltweit rund 2.000 Kinderhilfsprojekte in den ärmeren Ländern der Welt. Missio Aachen ist eines von rund 100 Päpstlichen Missionswerken weltweit. Im vorigen Jahr standen der Hilfsorganisation rund 46,5 Millionen Euro für fast 1.200 Projekte in Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Ozeanien zur Verfügung.
Duisburg: Superintendent verurteilt Bombendrohung gegen Moschee
Duisburg (epd). Der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Duisburg, Pfarrer Armin Schneider, hat die Bombendrohung gegen die Duisburger Merkez-Moschee von 22. Juli scharf verurteilt. Damit habe "der rechte Terror nun auch in Duisburg sein Gesicht gezeigt", erklärte Schneider am 23. Juli. "Es braucht keine Explosionen, um ein Klima der Einschüchterung und Verängstigung zu erzeugen." Der Kirchenkreis betrachte solche Drohungen nicht nur als Angriffe auf Mitbürger, sondern auch auf das grundgesetzlich verankerte Menschenrecht auf freie Religionsausübung "und somit auf Grundwerte unserer ganzen Gesellschaft".
Der Vorstand der Duisburger Merkez-Moschee im Stadtteil Marxloh hatte nach Angaben der Duisburger Polizei am Montagmorgen eine Bombendrohung per E-Mail erhalten. Das Schreiben war mit "Combat 18" unterzeichnet. Die Polizei hatte daraufhin das Gebäude evakuiert und durchsucht, verdächtige Gegenstände wurden jedoch nicht gefunden. Der Staatsschutz ermittelt. Die rechtsextreme Terrororganisation "Combat 18" gilt als militanter Arm des in Deutschland verbotenen Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour".
Priester im Gemeindehaus überfallen
Bochum (epd). In Bochum ist ein katholischer Priester nach Angaben der Polizei im Gemeindehaus überfallen und schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand in der Nacht zum 28. Juli zwischen 23.50 und 00.10 Uhr, wie die Polizei in Bochum am Sonntag mitteilte. Ein bislang unbekannter Mann sei gewaltsam in das Haus der Gemeinde St. Franzikus an der Herner Straße im Stadtteil Riemke eingedrungen. Als der Pastor gegen Mitternacht nach Hause zurückkehrte, habe ihn der Einbrecher verletzt, gefesselt und eingesperrt.
Ein Passant habe die Hilferufe des 66-jährigen Theologen gehört und die Polizei informiert. Der Täter konnte demnach entkommen. Der Pastor musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben, ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei zunächst nicht machen.
Gesellschaft
Rettung dringend gesucht

epd-bild/Christian Ditsch
Rom, Berlin (epd). Auch nach dem tragischen Unglück vor der Küste Libyens mit bis zu 150 Toten rechnen Hilfsorganisationen mit einer steigenden Zahl von Bootsflüchtlingen auf dem Mittelmeer. Allein in der Nacht zum 26. Juli fing die libysche Küstenwache mindestens drei weitere Boote mit insgesamt 200 Flüchtlingen ab und brachte die Menschen zurück in die Küstenstädte Tripolis, Al-Chums und Suwara, wie das libysche Büro des UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte. Die Aufklärungsflugzeuge der privaten Seenotretter Sea-Watch entdeckten Sprecher Oliver Kulikowski zufolge zehn Boote. "Die Leute fliehen, weil sie es einfach nicht mehr in Libyen aushalten", sagt er.
Fischer hatten am 25. Juli 135 Menschen aus dem Meer gerettet, die in einem Holzboot mit bis zu 300 Menschen an Bord in Richtung Europa unterwegs waren. Offenbar war das Boot gekentert. Laut UNHCR schwammen manche an Land. Laut "Ärzte ohne Grenzen" hätten Augenzeugen mindestens 70 Leichen im Meer gezählt. Sea-Watch geht von mindestens 100 Toten aus, die UN sprachen von 115 und 150 Toten, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Die Flüchtlinge kamen überwiegend aus Eritrea und dem Sudan. Die Überlebenden seien in das Internierungslager Tadschura östlich von Tripolis gebracht worden, in dem Anfang Juli bei einem Luftangriff mindestens 50 Migranten ums Leben kamen, hieß es.
Guterres entsetzt
UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich entsetzt. «Wir brauchen sichere und legale Fluchtrouten für Migranten und Flüchtlinge», erklärte er. «Jeder Migrant, der ein besseres Leben sucht, verdient Sicherheit und Würde.» UNHCR-Chef Filippo Grandi bekräftigte seine Forderung nach einer neuen Seenotrettung und einem Ende der Internierungslager in Libyen. «Gerade hat sich die schlimmste Mittelmeer-Tragödie in diesem Jahr ereignet», schrieb er. Europa müsse jetzt handeln, bevor es für viele weitere verzweifelte Menschen zu spät sei.
Von den privaten Seenotrettungsschiffen ist aktuell keines in der Region unterwegs. Die "Alan Kurdi" des Regensburger Vereins Sea-Eye wird voraussichtlich am Dienstag ihr Einsatzgebiet vor den libyschen Gewässern erreichen. Auf dem Weg ist außerdem die «Ocean Viking», das neue Schiff von «Ärzte ohne Grenzen» und SOS Méditerranée. Der Verein Mission Lifeline plant zum 1. August ein neues Schiff zu entsenden. Damit habe sich der Vorwurf, die privaten Seenotretter würden die Bootsfluchten nach Europa überhaupt erst anheizen, "einmal mehr als realitätsfern erwiesen», schrieb Sea-Watch auf Twitter.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, betonte, die zivilen Schiffe retteten als einzige derzeit Menschen und versuchten sie, in einen sicheren Hafen zu bringen. Sie zu behindern und zu kriminalisieren müssen aufhören. Den von einigen EU-Staaten ins Auge gefasste Verteilmechanismus für Bootsflüchtlinge forderte er so schnell als möglich umzusetzen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sprach sich in der "Augsburger Allgemeinen" für eine staatlich finanziere Seenotrettung aus.
Beschluss soll im September fallen
Der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Dominik Bartsch, sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland", bei dem Verteilmechanismus müsse klar sein, wie die Schiffbrüchigen aufgenommen würden, wo ein Asylverfahren durchgeführt werde und wie jene ohne Schutzstatus zurück in die Heimat gelangten. "Wenn die Länder erstmal bewiesen haben, dass ein solcher Mechanismus funktionieren kann, dann müsse es nicht mehr zu solch schrecklichen Unglücken kommen", sagte er. Nach Angaben des deutschen Innenministeriums stehen acht Staaten bereit, ein Beschluss soll im September fallen.
Laut UN sind in diesem Jahr bislang 36.670 Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer nach Europa gekommen, rund 35 Prozent weniger als im selben Zeitraum 2018. Ums Leben kamen dabei zwischen Jahresanfang 2019 und dem 24. Juli bei der Überfahrt 686 Menschen. Bestätigen sich die Berichte über das jüngste Bootsunglück, steigt die Zahl der Toten auf über 800.
Familiennachzug aus Eritrea wird oft abgelehnt
Anerkannte Flüchtlinge dürfen Ehepartner und Kinder nachholen, wenn die nötigen Dokumente vorliegen. Die Beschaffung ist in Eritrea schwierig. Somalier leiden oft in zweiter Generation in Deutschland noch unter einer offiziell ungeklärten Identität.Berlin (epd). Eritreer, die zu ihren Angehörigen nach Deutschland wollen, scheitern in fast zwei Drittel der Fälle mit einem Antrag auf Familienzusammenführung. 2018 wurden nur in 36,5 Prozent der Fälle Visa für den Nachzug zu anerkannten Flüchtlingen aus Eritrea erteilt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Im ersten Quartal 2019 lag die Quote bei knapp 37 Prozent, wobei das Auswärtige Amt darauf verweist, dass sie wegen der geringen Fallzahlen nicht repräsentativ sei.
2018 wurden den Angaben zufolge in den dafür relevanten deutschen Botschaften in Addis Abeba, Khartum und Nairobi 634 Visa für den Familiennachzug zu Eritreern in Deutschland erteilt. Dem standen 1.120 Ablehnungen gegenüber. Elf Anträge wurden zurückgezogen. Von Januar bis März dieses Jahres wurden 140 Visa erteilt, 238 Anträge abgelehnt und vier zurückgezogen. 2017 wurde noch fast jeder zweite Antrag genehmigt. Die Quote lag damals den Angaben zufolge bei 48,5 Prozent.
Fehlende Dokumente
Das Auswärtige Amt begründet die hohe Zahl der Ablehnung mit fehlenden Dokumenten. In einer Vielzahl der Fälle stehe eine Ablehnung "im Zusammenhang mit der Nichtvorlage von anspruchsbegründenden Unterlagen", heißt es in der Antwort.
Die Linke schreibt in ihrer Anfrage, dass Eritreer Schwierigkeiten bei der Beschaffung der Dokumente hätten. In Eritrea verbliebene Angehörige von Flüchtlingen, die inzwischen in Deutschland leben, müssten mit Repressalien, Geldbußen oder sogar Haftstrafen rechnen.
Linke kritisiert lange Wartezeit
"Indem die deutschen Behörden Dokumente verlangen, die die in Deutschland lebenden Flüchtlinge und ihre Angehörigen beim besten Willen nicht beschaffen können, schaffen sie einen Vorwand, um reihenweise Anträge ablehnen zu können", kritisierte die Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Linke). Es sei ein "Unding, dass von anerkannten eritreischen Flüchtlingen erwartet wird, dass sie sich an ihren Verfolgerstaat wenden, um ihre Ehe nachregistrieren zu lassen oder anderweitige Papiere zu beschaffen". Nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Schutzsuchende haben ein Recht auf das Nachholen ihrer Kernfamilie, also Ehegatten, Eltern oder minderjährige Kinder.
Kritisch sieht die Linke auch die langen Wartezeiten in den Botschaften, bis der Antrag auf Familienzusammenführung überhaupt bearbeitet wird. Nach Angaben des Auswärtigen Amts standen im Juni in den drei Botschaften fast 6.000 Personen auf den Terminlisten, die meisten davon in Kenias Hauptstadt Nairobi (rund 3.400). Die Wartezeit beträgt demzufolge in Addis Abeba in Äthiopien 30 Wochen, in Nairobi mindestens 18 Monate. Die Visastelle im sudanesischen Khartum sei derzeit wegen der Sicherheitslage im Land geschlossen.
Ungeklärte Identität verhindert Einbürgerung
Dokumente, die von deutschen Behörden nicht anerkannt werden, machen auch Somaliern das Leben schwer - selbst hierzulande und in zweiter Generation. Deutschland erkennt seit 1991 keine somalischen Pässe mehr an. Die Betroffenen bekommen den Akteneintrag "ungeklärte Identität" - eine Einbürgerung ist damit ausgeschlossen. Betroffen sind auch Kinder, selbst wenn sie in Deutschland geboren wurden, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht.
Seit April stellt die somalische Botschaft in Berlin wieder Pässe aus. Doch eine schriftlichen Frage der Abgeordneten Jelpke von diesem Monat beantwortete das Auswärtigen Amt mit dem Hinweis, dass auch diese Reisepässe "nicht für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland anerkannt" sind. Aber: Die seit 2013 ausgestellten biometrischen somalischen Pässe würden "für die Ausreise anerkannt".
Jelpke kritisierte, dass die Pässe für die Abschiebung genügten, nicht aber als Identitätsnachweis anerkannt würden. Dies zeige einmal mehr die Prioritäten dieser Bundesregierung: "Unter Druck setzen, schikanieren und abschieben." In Deutschland lebten Ende Juni 2018 knapp 41.000 somalische Staatsbürger. Gut die Hälfte von ihnen hatte einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus.
Bundesregierung: Anschlag in Wächtersbach "abscheulich"
Berlin, Wächtersbach (epd). Bundesregierung und hessische Landesregierung haben den mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach scharf verurteilt. In Berlin sprach die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer von einer abscheulichen Tat, die nicht hingenommen werden dürfe. Die Bundesregierung nehme die Gefahr rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten "sehr ernst", sagte sie am 24. Juli in der Bundeshauptstadt.
Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier verurteilte den Anschlag auf einen 26-jährigen Mann aus Eritrea aufs Schärfste und wünschte ihm eine schnelle Genesung. "Dass ein Mensch einzig wegen seiner Hautfarbe auf offener Straße angeschossen wird, ist entsetzlich", erklärte der Regierungschef in Wiesbaden. Zugleich nannte er es "unsäglich, wenn aus rassistischer Hetze Gewalt entsteht". Bouffier versicherte, die Sicherheitsbehörden würden alles tun, um diese augenscheinlich fremdenfeindlich motivierte Straftat und ihre Hintergründe restlos aufzuklären. Ein Mann hatte am 22. Juli aus einem Auto heraus drei Schüsse auf den dunkelhäutigen Mann aus Eritrea abgegeben und ihn lebensgefährlich verletzt.
Notoperation
Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zieht ein fremdenfeindliches Motiv in Betracht. Der Eritreer war nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche 55 Jahre alte deutsche Täter konnte zunächst fliehen und erschoss sich in seinem Fahrzeug, wo er von Polizeibeamten aufgefunden wurde.
Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums ergänzte, man wisse, dass man es im rechtsextremistischen Spektrum mit Menschen zu tun habe, die waffenaffin seien. Das dürfe nicht unterschätzt werden. Gleichzeitig betonte er, bei der Bewertung der Tat sei noch Zurückhaltung geboten. Die bisherige Informationslage sei noch nicht ausreichend. Man müsse abwarten, was die Ermittlungsbehörden zutage tragen.
Ein Sprecher von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) erneuerte deren Forderung, den Verfolgsdruck auf Rechtsextremisten zu erhöhen, unter anderem durch mehr Personal bei der Justiz, eine Sensibilisierung der Behörden für rechtsextreme Motive und eine bessere Verfolgung von Hass-Straftaten im Netz.
Der Sprecher des Justizministeriums sagte unter Anspielung auf die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, es mache fassungslos, dass es innerhalb kürzester Zeit zu einer weiteren schweren, mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Tat gekommen sei. Er erinnerte zudem daran, dass die Tat am Jahrestag des rechtsextremen Anschlags von Anders Breivik erfolgte. Breivik hatte am 22. Juli 2011 in Oslo und der norwegischen Insel Utoya 77 Menschen getötet.
"Hemmschwelle gesunken"
Die Ermittlungen von Landeskriminalamt und Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft gehen unterdessen weiter. Im Mittelpunkt steht die Auswertung der Kommunikation des mutmaßlichen Täters, also sein Handy- und Mailverkehr, wie der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Alexander Badle, auf epd-Anfrage sagte. Neue Erkenntnisse gebe es noch nicht. Auch lägen bislang noch keine Anzeichen für Kontakte des 55-Jährigen in die rechtsextremistische Szene vor.
Unterdessen gab der Berliner Politikwissenschaftler Hans-Joachim Funke der AfD eine Mitschuld an der Tat. "Die Hemmschwellen sind gesunken durch die Hetze im öffentlichen Raum gegen alle größeren ethnischen und religiösen Minderheiten, nicht zuletzt von Teilen der Alternative für Deutschland, von 'Pegida' und anderen auf der einen Seite und rechtsextremen Gewaltbereiten", sagte er in der "hessenschau" des Hessischen Rundfunks.
Am Abend des 23. Juli hatten sich mehrere hundert Menschen in Wächtersbach zu einer Mahnwache für den niedergeschossenen Eritreer versammelt. Bürgermeister Andreas Weiher (SPD) sagte, ein weiteres Mal sei nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke aus Gedanken eine Tat geworden, "die uns erschüttert".
Justizministerin: Verfolgungsdruck auf Rechtsextreme erhöhen
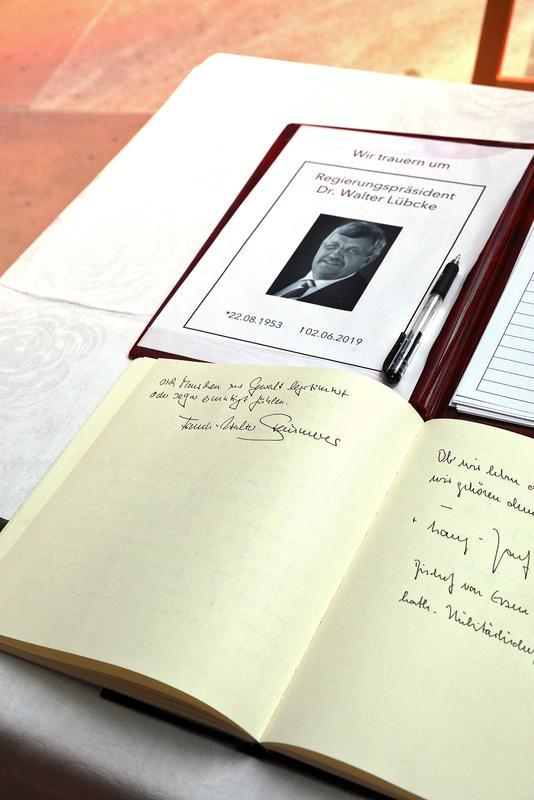
epd-bild/Andreas Fischer
Düsseldorf/Frankfurt a.M. (epd). Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und andere hochrangige Politiker setzen sich für eine stärkere Bekämpfung des Rechtsextremismus ein. "Wir müssen den Verfolgungsdruck auf Rechtsextremisten massiv erhöhen", sagte Lambrecht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ, 27. Juli) vor dem Hintergrund des Mordes an dem CDU-Politiker Walter Lübcke und des Mordversuchs an einem Eritreer in Wächtersbach. Polizei und Staatsanwaltschaften müssten alles tun, um Hasskriminalität im Internet effektiv zu verfolgen. Auch andere Politiker, darunter Grünen-Chef Robert Habeck, der frühere Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) und Ex-Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), forderten ein konsequenteres Vorgehen gegen Hassbotschaften.
Strafrechtsreformen hält das Bundesjustizministerium zur Bekämpfung von Hasskriminalität aber nicht für erforderlich. Die zahlreichen Straftatbestände müssten konsequent angewandt werden, sagte ein Sprecher.
Leutheusser-Schnarrenberger verweist auf Erfolg aktiver Gefährderansprache
Die Antisemitismus-Beauftragte in NRW Leutheusser-Schnarrenberger erklärte, Polizei und Verfassungsschutzämter müssten "endlich zeigen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und den Terror von rechts auch als solchen wahrnehmen". Sie forderte grundsätzliche Neuerungen im Kampf gegen Rechtsextremismus. So sollte der Präventionsarbeit eine bedeutend größere Rolle zukommen. "Eine aktive Gefährderansprache in der rechten Szene ist nicht nur denkbar, sondern notwendig", schrieb sie in einem Gastbeitrag für "Spiegel Online": "In der Hooligan- und Islamistenszene wird diese Methode bereits seit Jahren erfolgreich angewandt - warum nicht auch bei Rechtsextremisten?"
Ex-Bundestagspräsident Lammert forderte von der deutschen Justiz, konsequenter gegen sprachliche Verrohung insbesondere im Internet vorzugehen. Es gebe nicht nur schlimmste verbale Beleidigungen, Verleumdungen, sondern auch unmissverständliche Bedrohungen von Politikern und Journalisten. "Aber Gerichte schlagen Anzeigen fast immer nieder mit der Begründung, es handele sich um eine virtuelle Bedrohung", sagte Lammert der "Rheinischen Post" in Düsseldorf (27. Juli). Klagen der Gerichte über Personalmangel ließ er nicht gelten: Dies dürfe "kein ernsthafter Einwand sein, die deutsche Rechtsordnung nicht ernst zu nehmen".
Lammert: Ignoranz gefährdet Demokratie
Der Vorsitzende der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung warnte in diesem Zusammenhang davor, sich der Demokratie in Deutschland zu sicher zu sein. "Die Demokratie ist gefährdet, wenn wir sie für selbstverständlich halten", sagte er und erinnerte an den Zerfall des demokratischen Systems in der Weimarer Republik und die Machtergreifung der Nazis.
Wie das Justizministerium sehen auch SPD und Grüne laut FAZ keinen gesetzgeberischen Reformbedarf. Die für die Strafverfolgung zuständigen Länder müssten aber über die Justizressorts und die Generalstaatsanwaltschaften "für ein einheitliches Vorgehen und einheitliche Maßstäbe" sorgen, sagte die Netzpolitikerin Renate Künast (Grüne). Der Grünen-Vorsitzende Habeck forderte die Bundesregierung auf, den Kampf gegen Rechtsextremismus höchste Priorität einzuräumen. Die Sicherheitsbehörden müssten auch rechtsextreme Netzwerke im Internet besser im Blick haben. Sie müssten in die Lage versetzt werden, dort intensiv zu ermitteln, sagte er "Spiegel Online".
Internationales Auschwitz Komitee äußert "brennend Sorge"
Das Internationale Auschwitz Komitee äußerte seine "brennender Sorge" über "die neue Dimension und Dynamik rechtsextremer Gewalt in Deutschland". Man frage sich, ob die Mehrheit in Politik und Gesellschaft die Bedrohungssituation angesichts von "Feindeslisten", Mord und Waffengewalt realisiert habe oder immer noch in "abwiegelnden und verdrängenden Stereotypen befangen" sei.
Bei zwei Gewaltverbrechen in diesem Monat gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einem rechtsextremen beziehungsweise rassistischen Hintergrund aus: Im Falle des Mordes an dem CDU-Politiker Lübcke Anfang Juli ist ein Rechtsextremist aus Kassel dringend tatverdächtig. Von fremdenfeindlichen Motiven geht die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft im Falle der lebensgefährlichen Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersbach in Hessen aus. Im Internet haben Rechtsextreme zudem sogenannte Feindeslisten veröffentlicht, auf denen laut ARD-Recherchen die Namen von rund 200 Politikern, Journalisten und Aktivisten stehen sollen.
Landtag sagt Reise ab: Israel empfängt keine AfD-Politiker
Düsseldorf/Frankfurt (epd). Der nordrhein-westfälische Landtag hat eine Israel-Reise seines Digitalausschusses vorerst abgesagt, weil die Delegation wegen eines teilnehmenden AfD-Parlamentariers offenbar nicht empfangen worden wäre. Der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation werde noch entscheiden, "ob die Reise zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird", teilte ein Sprecher des Landtags am 26. Juli auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) mit. Die Reise sollte vom 26. bis 29. August stattfinden. Auf der Agenda stand unter anderem ein Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem.
Der Landtagspräsident André Kuper sagte dem WDR-Magazin "Westpol" am 26. Juli, dass es Hinweise darauf gegeben habe, dass die Delegation vor Ort Termine nicht hätte wahrnehmen können, weil man Mitglieder der AfD in der Reisegruppe habe. "Es scheint von israelischer Seite so zu sein, dass es dort eine entsprechende Vorgehensweise gibt", sagte Kuper. Demnach können politische Delegationen, an denen AfD-Mitglieder teilnehmen, in Israel nicht offiziell empfangen werden. Treffen, an denen israelische Regierungsvertreter beteiligt sind, können nicht stattfinden, ebenso Besuche öffentlicher Institutionen, die vom Staat gefördert werden - wie die Gedenkstätte Yad Vashem.
In dem Ausschuss sitzt nach Angaben des Landtagssprechers ein AfD-Mitglied, der Landtagsabgeordnete Sven Tritschler, der auch Sprecher des Ausschusses ist.
Bei einer Israel-Reise des Digitalisierungsausschuss des hessischen Landtags Ende Juni war ein Treffen mit Vertretern des israelischen Wirtschaftsministeriums und der Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem abgesagt worden, wie damals die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete. In der Delegation war der AfD-Landtagsabgeordnete Dimitri Schulz mitgereist, der selbst jüdischer Herkunft ist und die Gruppe "Juden in der AfD" mitgegründet hat.
Landtagspräsident begrüßt Urteil zur Landesliste der AfD Sachsen
Dresden/Leipzig (epd). Der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler (CDU) hat das Urteil über die vorläufige Zulassung von 30 Kandidaten auf der Landesliste der AfD zur kommenden Landtagswahl begrüßt. Nun könne in Sachsen ein Parlament gewählt werden, über dem nicht "von vornherein das Damoklesschwert einer Neuwahl" schwebe, sagte Rößler am 26. Juli in Dresden. Zu den obersten Prinzipien im Land gehöre, dass sich der Wählerwille auch im Parlament widerspiegele, betonte der Landtagspräsident.
Der sächsische Verfassungsgerichtshof hatte am Vorabend die ersten 30 Plätze der Kandidatenliste der AfD zur Landtagswahl am 1. September vorläufig zugelassen. Nach einer Entscheidung des Landeswahlausschusses vor drei Wochen durften zunächst nur 18 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste geführt werden. Bei einem guten Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl hätte sie so möglicherweise nicht alle Sitze im Parlament besetzen können.
Das Urteil des Gerichts hat nur vorläufigen Charakter, eine endgültige Entscheidung soll am 16. August getroffen werden. Möglich ist unter anderem, dass der AfD eine noch längere Kandidatenliste gewährt wird, denn ursprünglich waren dort 61 Namen verzeichnet. Da aber ab Listenplatz 30 das Wahlverfahren geändert wurde, hatte der Verfassungsgerichtshof in diesem Punkt Zweifel am Verfahren geäußert und ließ per einstweiliger Anordnung vorerst nur die ersten 30 Plätze zu.
Hilfen für Städte mit Zuwanderung aus Südosteuropa gefordert

epd/Friedrich Stark
Dortmund (epd). Die Dortmunder Sozialdezernentin Birgit Zoerner fordert deutlich mehr Unterstützung von Land, Bund und der Europäischen Union für Städte mit besonders vielen Zuwanderern aus Südosteuropa. Städte wie Dortmund, Duisburg oder Gelsenkirchen könnten die zusätzlichen Kosten nicht weiterhin alleine tragen, sagte die Vorsitzende der Arbeitsgruppe "Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien" des Deutschen Städtetages dem Evangelischen Pressedienst (epd). In Dortmund leben nach ihren Angaben rund 9.000 Südosteuropäer, in Gelsenkirchen 7.700 und in Duisburg 20.000.
Sozialdezernentin Zoerner: Menschen brauchen Arbeit und Bildung
Zuwanderung aus Ländern wie Rumänien oder Bulgarien stelle die Städte vor besondere Herausforderungen, betonte Zoerner. Etwa zwei Drittel der Menschen komme aus prekären Lebenssituationen in ihren Heimatländern nach Deutschland: "Ein großer Teil der Migranten bringt nicht die sprachlichen, schulischen und beruflichen Voraussetzungen mit, um hierzulande Fuß zu fassen." Eine erhebliche Zahl von schulpflichtigen Kindern habe beispielsweise noch niemals eine Schule besucht.
Eine weitere große Hürde bestehe in einem fehlenden Krankenversicherungsschutz, erläuterte die Sozialexpertin. In dieser Frage seien einheitliche europäische Standards erforderlich. "Hier muss in nächster Zeit noch erheblich nachgebessert werden", forderte Zoerner.
In Dortmund gibt es nach Angaben der Dezernentin inzwischen ein engmaschiges Netzwerk, um den Menschen zu helfen. Diakonie, Caritas sowie städtische Einrichtungen betreuen und begleiten die Zuwanderer. Aufgrund dieses gemeinsamen Engagements hätten seit 2016 rund 1.300 Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz gefunden, berichtete Zoerner.
"Sich seinen Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen, ist ganz entscheidend für die Familien, denn sie wollen in Deutschland bleiben", betonte die Sozialdezernentin. Eine feste Beschäftigung biete nicht nur den Vorteil, den Lebensstandard und damit auch die Wohnverhältnisse zu verbessern, sondern die Familien seien dann auch krankenversichert. Darüber hinaus sorge die Stadt dafür, dass Kinder eine Kita oder eine Schule besuchen und die deutsche Sprache erlernen.
Trotz vieler Erfolge bleibe aber noch erheblicher Handlungsbedarf, unterstrich Zoerner. Damit deutlich mehr Zuwanderer an den Deutschkursen teilnehmen, sei es zwingend erforderlich, dass sie nicht mehr wie bisher einen Eigenanteil zahlen müssen. Auch wenn es sich um geringe Beträge handele, "können das arme Familien nicht aufbringen". Notwendig sei für viele auch eine "passgenaue berufliche Qualifizierung", um Wege in den Arbeitsmarkt zu ebnen.
Forderung nach öffentlichem Gelöbnis stößt auf geteiltes Echo

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Die Forderung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach mehr öffentlichen Gelöbnissen von Bundeswehrsoldaten stößt auf ein geteiltes Echo. Mehr öffentliche Gelöbnisse seien durchaus geeignet, die Verantwortung der Gesellschaft für die Bundeswehr zu betonen, sagte Militärbischof Sigurd Rink dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die "Enttabuisierung der Bundeswehr" sehe er als zentrale Aufgabe der Politik an. Innerhalb der evangelischen Kirche gibt es aber auch Widerspruch. Ebenso geteilt ist die Meinung in der Politik.
"Die Anerkennung der Soldatinnen und Soldaten hängt mehr von einer glaubwürdigen Politik ab, als von öffentlichen Gelöbnissen", sagte der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Renke Brahms, dem epd. Deshalb halte er "eher wenig von mehr öffentlich inszenierten Gelöbnissen". Außerdem bedürfe es mindestens einer gleichen öffentlichen Anerkennung für Mitarbeitende in der Entwicklungszusammenarbeit oder den Friedensfachkräften, sagte Brahms, der seit Februar Direktor der Evangelischen Wittenbergstiftung ist.
Linke ermuntert zu Protesten
Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte sich in einer Rede nach ihrer Vereidigung am 24. Juli im Bundestag dafür ausgesprochen, die Bundeswehr in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen. Zum 64. Geburtstag der deutschen Armee am 12. November würde sie sich ein Gelöbnis vor dem Reichstag wünschen, sagte sie. In einem Schreiben an die Ministerpräsidenten der Bundesländer habe sie für dieses Datum auch öffentliche Gelöbnisse in der Mitte von Städten und Gemeinden vorgeschlagen. Öffentliche Gelöbnisse hatte in der Vergangenheit oft zu Demonstrationen von Friedensaktivisten geführt.
Linken-Parteichef Bernd Riexinger sagte, dass er solche Proteste auch heute erwarte. "Ich kann nur hoffen, dass es breite Demonstrationen dagegen gibt", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Solche Gelöbnisse gingen "völlig an der Bevölkerung vorbei". "Sie will keine Zurschaustellung des Militärischen, sondern dass klare friedenspolitische Positionen eingenommen werden."
Die Vizevorsitzende der schleswig-holsteinischen CDU, Karin Prien, sagte dem RND dagegen: "Öffentliche Gelöbnisse sind ein richtiger Akt." Das Thema Sicherheitspolitik müsse stärker im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden. "Und die Soldaten, die wir auch in gefährliche Einsätze schicken, haben es verdient, dass wir uns zu ihnen bekennen", sagte Prien.
Rink: Rechtfertigungsdruck reduzieren
Unterstützung für Kramp-Karrenbauers Forderung kam auch vom Deutschen Bundeswehrverband. "Wer gelobt, unsere freiheitlich demokratische Grundordnung tapfer zu verteidigen, verdient gesellschaftliche Anerkennung und Respekt. Dieses Bekenntnis der Soldatinnen und Soldaten zu unserer Werteordnung und Verfassung sollte keine geschlossene Veranstaltung hinter Polizeigittern sein", erklärte der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Görlich.
EKD-Militärbischof Rink sagte, die gesellschaftliche Akzeptanz hänge auch davon ab, welche öffentliche Rolle Politik und Gesellschaft der Parlamentsarmee zuweisen wollten. Ziel der öffentlichen Debatte solle sein, Soldatinnen und Soldaten in ihrem Dienst zu stärken und Rechtfertigungsdruck zu reduzieren.
"Nicht im Sonnenglanz des Glücks geboren"
Ein Theater in Weimar war vor 100 Jahren Geburtsort der ersten deutschen Demokratie. Die Nationalversammlung beriet dort ein halbes Jahr lang über eine neue Verfassung.Frankfurt a.M. (epd). Das Deutsche Nationaltheater in Weimar wurde vor 100 Jahren zur großen politischen Bühne: Nicht Schauspieler, sondern gewählte Volksvertreter versammelten sich dort, um über die erste demokratische Verfassung Deutschlands zu beraten. Der Zuschauerraum wurde zum Plenarsaal, in dem die Nationalversammlung von Februar bis August 1919 tagte. Mehr als 400 Presseberichterstatter verfolgten die Eröffnung am 6. Februar von den Rängen. Am 31. Juli verabschiedeten die Abgeordneten die Weimarer Reichsverfassung - sie galt damals als eine der fortschrittlichsten und liberalsten der Welt.
Auf dem Weg zur Tagungsstätte kamen die 423 Abgeordneten am Denkmal von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller vorbei, die einst in Weimar gewirkt hatten. Vom Versammlungsort sollte ein Signal ausgehen: "Es wird in der ganzen Welt angenehm empfunden werden, wenn man den Geist von Weimar mit dem Aufbau des neuen Deutschen Reiches verbindet", hoffte der am 11. Februar 1919 zum vorläufigen Reichspräsidenten gewählte Sozialdemokrat Friedrich Ebert. Tatsächlich waren aber auch die Unruhen und Straßenkämpfe in der Hauptstadt Berlin der Grund für das Ausweichen nach Weimar.
Hugo Preuß Vater der Verfassung
Die Verfassunggebende Nationalversammlung war nach dem Urteil des Historikers Robert Gerwarth ein "Meilenstein auf dem Weg in die parlamentarische Demokratie". Die Mehrheitssozialdemokraten (MSPD) waren als stärkste Partei aus den ersten wirklich demokratischen Wahlen in Deutschland am 19. Januar 1919 hervorgegangen. Sie gingen ein Bündnis mit den Parteien der bürgerlichen Mitte ein, der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP) und dem katholischen Zentrum. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs und der Ausrufung der Republik im November 1918 wollte die Regierung der "Weimarer Koalition" die Grundlagen für eine neue politische Ordnung schaffen.
Eigentlicher Schöpfer der Weimarer Verfassung war der Berliner Staatsrechtler Hugo Preuß. Die provisorische Regierung hatte den linksliberalen Gelehrten schon im November 1918 damit beauftragt, einen Verfassungsentwurf auszuarbeiten. Preuß wollte mit der Tradition des Obrigkeitsstaates brechen und mit der neuen Verfassung "Solidarität zwischen Volk und Regierung" stiften.
Die von Preuß angestrebte territoriale Neuordnung des Reichsgebiets, insbesondere die Aufteilung des übermächtigen Teilstaats Preußen, scheiterte aber am Widerstand der Länder. Bis zum 18. Juni 1919 beriet ein Verfassungsausschuss mit 28 Mitgliedern über die neue rechtliche Grundordnung. Das schließlich verabschiedete, aus 181 Artikeln bestehende Gesetzeswerk war ein Kompromiss der politischen Parteien.
Den Bürgern wurden bürgerliche Freiheitsrechte garantiert, zu denen die Gleichheit vor dem Gesetz, die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit zählten. In Artikel 109 hieß es: "Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten." Allerdings konnten die Bürger diese Rechte nicht - wie später in der Bundesrepublik vom Grundgesetz garantiert - vor Gericht einklagen. Auch Formen der direkten Demokratie wie Volksbegehren und Volksentscheid wurden eingeführt.
"Alles in allem war die Verfassung der Weimarer Republik erheblich demokratischer und liberaler als die Verfassungen der meisten anderen Länder in den 1920er Jahren", resümiert der Historiker Gerwarth. Auch umfassende soziale Rechte wurden verankert: das Recht zur Bildung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden etwa und die Verantwortung des Staates für die Arbeitslosen.
Konstruktionsfehler
Für das Scheitern der ersten deutschen Demokratie nach nur rund 14 Jahren werden immer wieder auch "Konstruktionsfehler" der Weimarer Verfassung mitverantwortlich gemacht: Die Verfassung wies den Parteien keine verantwortliche Rolle für das Funktionieren des Parlamentarismus zu. Der direkt vom Volk gewählte Reichspräsident konnte das Parlament auflösen, per Notverordnungen des Präsidenten konnte der Reichskanzler außerdem am Parlament vorbeiregieren.
Der Würzburger Staatsrechtler Horst Dreier allerdings widerspricht: "Maßgeblich zum Scheitern der Weimarer Republik haben die antidemokratischen und antirepublikanischen Kräfte in Politik und Gesellschaft beigetragen, nicht etwa die Weimarer Verfassung." Wenn es in den politischen Organen an Zustimmung zur verfassungsmäßigen Ordnung fehle, gehe das Schiff unweigerlich unter. "Dagegen hilft keine noch so gute Verfassung der Welt."
Am 31. Juli 1919 verabschiedete die Nationalversammlung mit 262 gegen 75 Stimmen die neue "Verfassung des Deutschen Reichs". Am 11. August unterzeichnete Ebert sie an seinem Urlaubsort in Schwarzburg (Thüringen), drei Tage später trat sie in Kraft.
Die Bevölkerung nahm kaum Notiz vom Abschluss der Beratungen in Weimar und der Verkündung der neuen Verfassung. Weit mehr beschäftigte die meisten Deutschen damals der kurz zuvor unterzeichnete Friedensvertrag von Versailles mit seinen harten Bedingungen. Der Vater der Verfassung, Hugo Preuß, resümierte: "Die Verfassung von Weimar ist nicht im Sonnenglanz des Glücks geboren."
Von Juden, die an Jesus glauben

epd-bild/Heike Lyding
Frankfurt a.M. (epd). Ein Hinterhof im Frankfurter Nordend. In einem weiß getünchten Raum im Souterrain feiern 30 Menschen einen Gottesdienst: Die Kerzen auf einem siebenarmigen Leuchter, der Menora, brennen - aber auf den Tischen sind Bibeln ausgelegt. Die Gläubigen singen hebräische Psalmen - und sie preisen Jesus Christus. Dimitri Gorin steht am Altar und liest erst aus dem Alten, dann aus dem Neuen Testament.
Es ist Freitagabend, die Gruppe feiert Schabbat. Die 30 Gläubigen gehören zur messianischen Gemeinde in Frankfurt. Messianische Juden glauben an Jesus, oder Jeschua, wie er auf Hebräisch heißt. Mit dem Christentum verbindet sie der Glaube an die Dreieinigkeit aus Vater, Sohn und heiligem Geist. Gleichzeitig feiern sie jüdische Feste wie Pessach und Jom Kippur und befolgen die jüdischen Speisevorschriften. Das Ehepaar Gorin und ihre Gemeinde glauben, dass Jesus wiederkommen und endgültig für Frieden sorgen wird. Juden, die an Jesus glauben, oder Christen, die nach den religiösen Vorschriften des Judentums leben - messianische Juden scheinen keiner der beiden Glaubensgruppen anzugehören. Und so sind sie Kritik sowohl von jüdischer als auch von christlicher Seite ausgesetzt.
Massive Ablehnung
Die Kritik bezieht sich vor allem auf den Missionsauftrag der Bibel, den die messianischen Juden ernst nehmen. Evangelikale Missionswerke wie "Juden für Jesus" mit Sitz in den USA sind nach eigenen Angaben weltweit aktiv. Der Heilige Geist ist für Dimitri Gorin ein Geschenk, das jeder Gläubige weitergeben kann. "Viele trauen sich aber nicht, von ihrem Glauben zu sprechen", sagt er. Die Judenmission stößt unter Juden auf massive Ablehnung. "Dass es heute Gruppen gibt, die sich Juden nennen, zugleich an Jesus als Erlöser glauben und andere Juden dazu bekehren wollen, ist völlig inakzeptabel", sagt der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster. "Messianische Juden sind keine Juden. Sie segeln unter falscher Flagge." Der Zentralrat unterhält keine Kontakte zu messianischen Gemeinden.
Die Evangelische Kirche in Deutschland lehnt in einer Stellungnahme alle Bemühungen ab, "Juden zum Religionswechsel zu bewegen". Auch der Vatikan missbilligt eine institutionelle Judenmission. "Die Kritik an den Missionstätigkeiten der messianischen Juden bezieht sich im Wesentlichen auf die jüdische Grunderfahrung, durch alle Epochen hindurch von christlichen Missionaren verfolgt zu werden", sagt der Religionswissenschaftler Nathanael Riemer vom Institut für Jüdische Studien und Religionswissenschaft der Universität Potsdam.
Weltweit gibt es nach Schätzungen der Organisation "Juden für das Judentum" etwa 350.000 messianische Juden. In Deutschland gibt es nach Angaben der EKD rund 40 messianisch-jüdische Gemeinden mit rund 2.000 Mitgliedern, viele davon sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion.
Weder christlich noch jüdisch
Auch die Gorins kamen durch Mission zur Gemeinde der messianischen Juden. Die Familie stammt aus Kasachstan und wanderte 1992 nach Deutschland aus. Dimitri Gorin kommt aus einer jüdischen Familie. Die Vorfahren seiner Frau hingegen sind Russlanddeutsche. Sie seien Mitglieder bei den Mennoniten, einer evangelischen Freikirche, gewesen, praktizierten aber nicht, erzählt Elizabeth Gorin. Sie fühle sich weder eindeutig christlich, noch jüdisch, sagt sie. Im Judentum fehle ihr Jesus, in christlichen Gottesdiensten die Tiefe der jüdischen Lehre. "Und ich verstehe nicht, warum die Christen die alten Bräuche und Feste ignorieren und durch neue ersetzt haben", sagt sie.
Das sei typisch für Gemeinden der messianischen Juden, sagt Religionswissenschaftler Reimer. Es gebe häufig sich überschneidende Identitäten. "Grundsätzlich geht das jüdische Religionsgesetz aber davon aus, dass niemand sein Jude-Sein verliert, wenn er konvertiert", sagt er.
Dimitri Gorin spricht ungern von Konversion. "Meine Verwandten beschimpften mich als Verräter, nachdem ich zum Glauben gekommen war", erzählt er. Die Reaktion habe ihn aber nicht abgehalten, mit seiner Familie über Jesus zu sprechen. Die Gorins legen die Bibel streng aus. Alle biblischen Gebote werden befolgt. Dimitri Gorin mag es genau. "Ich bin Mathematiker, vielleicht liegt es daran", sagt er. Doch spricht die Naturwissenschaft gegen das, was in der Bibel steht, vertraut er lieber der heiligen Schrift: Schöpfungsgeschichte statt darwinsche Evolutionstheorie.
Laut Gorin kommen nicht nur gebürtige Juden in die Gemeinde. "Bei uns gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Buddhisten", sagt er. Die Gemeinde trifft sich alle zwei Wochen zur Schabbatfeier am Freitagabend. Beendet wird die Zusammenkunft traditionell mit Wein, Brot mit Salz und einem herzlichen "Schabbat Schalom". Den Samstag verbringen die Gläubigen dann mit Einkehr, Gebeten und Jeschua - nicht jüdisch, nicht christlich, sondern eben messianisch.
Loveparade-Unglück: Stiftung fordert Erhalt der Gedenkstätte

epd-bild / Friedrich Stark
Duisburg (epd). Neun Jahre nach der Loveparade-Katastrophe in Duisburg haben am 24. Juli rund 150 Menschen auf einer öffentlichen Gedenkveranstaltung am Ort des Unglücks im Karl-Lehr-Tunnel der Opfer gedacht. "Die Gedenkstätte für die Opfer ist nicht nur ein Ort der Menschlichkeit, er bewahrt zudem auch die Menschenwürde der Toten und der vielen Verletzten", sagte der Sprecher des Kuratoriums der Stiftung Duisburg 24. 7. 2010, Jürgen Thiesbonenkamp, in seiner Ansprache. Die Stadtgesellschaft habe "die Verpflichtung, diesen Ort des Gedenkens zu erhalten", mahnte Thiesbonenkamp angesichts der Pläne der Stadt, auf dem Gelände ein neues Stadtquartier zu bauen.
Mit Blick auf den noch anhaltenden Strafprozess um die Loveparade-Katastrophe rief Thiesbonenkamp zu einer weiteren Aufklärung der Ursachen des Unglücks auf. "Auch wenn es am Ende des Prozesses keinen Schuldspruch gibt, schuldet das Landgericht Duisburg den Opfern, den Überlebenden und der Gesamtgesellschaft ein Höchstmaß an Aufklärung." Vor Gericht stehen inzwischen nur noch vier Angeklagte, denen die Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorwirft. Das Verfahren gegen sieben weitere Angeklagte wurde in Absprache mit Staatsanwaltschaft und Verteidigern zum Jahresbeginn 2019 eingestellt.
22 Glockenschläge
Unter den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung waren auch viele Angehörige der bei der Katastrophe ums Leben gekommenen jungen Menschen, die aus ihren Heimatländern angereist waren. Anschließend erklangen 22 Glockenschläge, 21 zum Gedenken an die 21 Menschen, die bei der Katastrophe getötet wurden, und einer für die mehreren hundert Verletzten.
Neben Hunderten von Kerzen, Blumen und Fotos der Toten lagen am 24. Juli auch wieder Kränze am Unglücksort. Bereits am 23. Juli hatte ein Gedenkgottesdienst nur für die Angehörigen der Todesopfer in der evangelischen Salvatorkirche in Duisburg stattgefunden. Danach fand wie in den Vorjahren die "Nacht der 1000 Lichter" am Unglücksort statt.
Bei der Katastrophe um das Musik-Event waren am 24. Juli 2010 nach einer Massenpanik insgesamt 21 Menschen ums Leben gekommen, mehrere hundert weitere wurden verletzt.
Staatsanwaltschaft ermittelt nach Kindstod gegen Wachdienst
Berlin (epd). Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Wachdienst eines Berliner Flüchtlingsheims aufgenommen, der einer hochschwangeren Frau Hilfe verweigert haben soll. Es werde geprüft, ob es sich bei dem Fall um unterlassene Hilfeleistung oder fahrlässige Tötung durch Unterlassen handelt, wie ein Sprecher am 24. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin mitteilte. Die Ermittlungen stünden am Anfang. Wann diese abgeschlossen sein werden, lasse sich derzeit nicht sagen.
Der Berliner Flüchtlingsrat hatte den Vorfall in dem Flüchtlingsheim im Stadtbezirk Lichtenberg am 22. Juli öffentlich gemacht. Demnach soll sich der Wachdienst einer Gemeinschaftsunterkunft Ende Juni geweigert haben, einen Rettungswagen für die Frau im neunten Monat zu rufen, die über starke Schmerzen und Blutungen klagte.
Kind verloren
Das betroffene Ehepaar stammt nach Angaben seines Anwalts Tobias Kiwitt aus Armenien. Als die hochschwangere Frau in der Nacht zum 23. Juni starke Schmerzen und Blutungen erlitt, habe ihr Ehemann die zwei Mitarbeiter des Wachdienstes gebeten, einen Rettungswagen zu rufen. Diese hätten sich jedoch geweigert, einen Krankenwagen oder ein Taxi zu holen, sagte Kiwitt dem epd.
Stattdessen hätten die Mitarbeiter des Wachdienstes dem Ehepaar eine Wegbeschreibung zum Krankenhaus gegeben, sagte der Anwalt weiter. Nachdem die hochschwangere Frau und ihr Mann die Klinik mit öffentlichen Verkehrsmitteln und einem längeren Fußmarsch erreicht hatten, habe sie ihr Kind nur noch tot entbunden.
Seit dem Verlust ihres Kindes sei seine Mandantin schwer traumatisiert und depressiv, sagte Kiwitt. Nach Aussage einer Oberärztin des "Sana-Klinikums" in Berlin-Lichtenberg hätte das Baby möglicherweise bei einem früheren Eintreffen im Krankenhaus gerettet werden können, erklärte der Anwalt.
Bonn benennt Straße nach früheren Bundeskanzler Helmut Kohl
Bonn (epd). Die Stadt Bonn benennt ein Teilstück der Bundesstraße 9 nach Altkanzler Helmut Kohl (1930-2017). Damit wolle Bonn als Bundesstadt an die politische Lebensleistung Kohls erinnern, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Am 15. August werde Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) die "Helmut-Kohl-Allee" an der Bonner Museumsmeile zwischen Genscherallee und Helmut-Schmidt-Platz einweihen. Der Hauptausschuss der Stadt hatte die Umbenennung eines Teils der Friedrich-Ebert-Allee im Mai beschlossen.
Helmut Kohl war von 1982 bis 1998 sechster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, von 1973 bis 1998 zudem Bundesvorsitzender der CDU. In seine Amtszeit fielen die deutsche Wiedervereinigung 1990 und die Gründung der Europäischen Union 1992.
Studie: Viele schauen auch im Gespräch aufs Handy
Heidelberg (epd). Im Gespräch mal kurz das Handy checken? Kein ungewöhnliches Verhalten, wie eine Studie der SRH Hochschule Heidelberg ergab. Von 1.000 beobachteten Personen in Cafés und Restaurants hätten fast 60 Prozent innerhalb von zehn Minuten mindestens einmal zum Smartphone gegriffen, hieß es. "Die Funde lassen den Schluss zu, dass auch sogenannte 'analoge Rückzugsinseln' mehr und mehr durch die digitalen Kommunikationsmedien erobert werden", sagte Studienleiter Frank Musolesi am 23. Juli. Vor allem die Messenger-Dienste ließen die Leute häufig aufs Smartphone schauen.
Auffällig sei, dass die Smartphone-Nutzung von der Gruppengröße abhänge. In Gruppen ab vier Personen greifen die Mitglieder den Angaben zufolge häufiger zum Handy als in kleineren Gruppen. Inwiefern sich diese Unterbrechungen auf das Kommunikationsverhalten und die Beziehungszufriedenheit der Gesprächspartner auswirkt, will die Hochschule in weiteren Studien untersuchen.
Negativpreis für sexistische Werbung verliehen
Berlin (epd). Auf Sexismus in der Werbung macht die Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" mit ihrem Negativpreis "Zorniger Kaktus" aufmerksam. Rund 2.700 Menschen wählten in einer Online-Abstimmung aus 50 nominierten Anzeigen die frauenverachtendste Reklame aus, wie "Terre des Femmes" am 22. Juli in Berlin mitteilte. Als "Sieger" ging ein fränkisches Unternehmen für Rohr- und Kanalreinigung hervor, das auf seinem Firmenwagen mit einer Frau wirbt, die in einem Rohr sitzt.
Das stehe nicht nur in keinem Zusammenhang mit den angebotenen Dienstleistungen, diese seien auch noch grafisch in ihrem Schritt platziert und lenkten den Blick dorthin, kritisierte "Terre des Femmes" Der Slogan "Wir… kommen immer durch!!!" suggeriere zudem, dass Frauen immer sexuell verfügbar seien oder zumindest gefügig gemacht werden könnten.
Der zweite Platz für sexistische Werbung ging an das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen in Thüringen. Das Amt warb mit der Aufschrift "Prachtregion" auf dem Hintern von Volleyball-Spielerinnen für mehr Tourismus. Die Sportlerinnen würden zu Sexobjekten degradiert, erklärte die Jury. Den dritten Negativpreis erhielt die Supermarktkette Edeka mit dem Clip "Danke Mama, dass du nicht Papa bist", der laut "Terre des Femmes" nahe legt, dass auch bemühte Männer keine guten Väter sein können.
Gewerkschaft: Polizei-Bienen könnten Drogen aufspüren
Berlin (epd). Bienen sind die neuen Hunde - zumindest was die Forschung zu neuen Ermittlungsmethoden der Polizei betrifft. Die Insekten seien dank ihres außergewöhnlichen Geruchsinns hervorragend geeignet, Substanzen wie Drogen und auch Menschen aufzuspüren, teilte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) am 26. Juli in Berlin mit. Versuche unter Laborbedingungen stimmten zuversichtlich, dass die Bienen nach weiterer Forschung und Züchtung einem Praxistest standhalten könnten.
Die Versuche ließen auf eine "mögliche Revolution für die Polizeiarbeit" hoffen, hieß es. Drogenspürhunde hätten gegenüber Bienen viele Nachteile, weil sie nur für kurze Zeit einsatzfähig seien, bevor sie eine Pause benötigen. Zudem wären die Vierbeiner sehr auf eine Bezugsperson fixiert und müssten zeitaufwendig und kostspielig ausgebildet werden.
Bienen hingegen wären nach kurzer Zeit einsatzbereit, hieß es. Dies treffe vor allem auf sogenannte Spürbienen zu, die in geschlossenen Räumen wie Fahrzeugen oder Kammern nach illegalen Substanzen suchen. Einsätze im Freie seien dagegen tages-, wetter- und jahreszeitenabhängig. Durch die Masse an Bienen, die konditioniert werden könnten, könnte zudem gewährleistet werden, dass die Tiere rund um die Uhr für Polizeieinsätze verfügbar seien.
Umwelt
Amazonas als Spielball von Wirtschaftsinteressen

epd-bild / Anja Kessler
Berlin, São Paulo (epd). Das einst dichte grüne Blätterdach des Amazonasgebiets hat Lücken bekommen. Im größten Regenwald der Welt tun sich immer mehr kahle Stellen auf. Es sind Hinterlassenschaften von Viehzüchtern, Goldschürfern und Holzfällern. Aus der Luft wird die ganze Dramatik der Abholzung am deutlichsten. Mit Labors auf einem 325 Meter hohen Turm beobachtet ein internationales Forscherteam, was sich dadurch für das Klima und in der Treibhausgasbilanz ändert. Die Abholzung sei an einem Punkt, der unumkehrbar sei, sagt der Klimawissenschaftler Paulo Artaxo aus São Paulo, einer der beteiligten Forscher. Bereits 20 Prozent des einstigen Regenwaldes sind vernichtet.
Wie in den USA Präsident Donald Trump habe Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro die Umweltgesetzgebung "praktisch außer Kraft gesetzt", sagt Artaxo. Internationaler Druck, vor allem aus Frankreich und Deutschland, sei der einzige Weg, um das Tempo der Abholzung zu bremsen. Der Klimaforscher verweist dabei auf das Freihandelsabkommen, das die EU und die Mercosur-Mitglieder Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay unterzeichnet haben.
Weiden und Plantagen statt Regenwald
Darin ist vereinbart, das Pariser Klima-Abkommen wirksam umzusetzen und die illegale Abholzung in Brasilien auf null zu reduzieren. Zudem wird Brasilien verpflichtet, die Ausdehnung der Sojaplantagen in Waldgebieten zu stoppen. Bis jetzt gibt es allerdings in der Regierung Bolsonaro überhaupt keinen politischen Willen, diese Verpflichtungen auch nur ansatzweise umzusetzen. Im Gegenteil: Aus Sicht Bolsonaros gibt es im Amazonasgebiet noch genügend Platz für Viehweiden und Sojaplantagen. Er will die grüne Lunge des Planeten für Bergbau freigeben und dafür Schutzgebiete und das Land von Ureinwohnern opfern.
Kurz vor Unterzeichnung des Freihandelsabkommens hatte der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles sogar noch angekündigt, die Mittel für Maßnahmen gegen den Klimawandel um 95 Prozent zu kürzen. Das trifft auch die Umweltbehörde Ibama, die ihre Kontrollen und Patrouillen im Amazonasgebiet extrem herunterfahren musste. Für alle illegalen Holzfäller kommt dies einem Freifahrtschein gleich.
Die Konsequenzen dieser Politik zeigen Satellitenbilder des Weltraumforschungsinstituts INPE. Im Juni wurde 60 Prozent mehr Wald im Amazonasgebiet abgeholzt als im gleichen Monat des Vorjahres. Im ersten Halbjahr 2019, in der Regierungszeit Bolsonaros, wurde soviel Wald vernichtet, wie seit drei Jahren nicht mehr.
Keine Sanktionen möglich
Die im Freihandelsabkommen vereinbarten Umweltschutzstandards sind nicht vor der Welthandelsorganisation (WTO) einklagbar wie beispielsweise Zollvergehen. Sanktionen sind nicht möglich, wenn ökologische Ziele nicht eingehalten werden. Bolsonaro hat angekündigt, dass Brasilien aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 aussteigen wird. Doch warum sollte sein Land das tun, fragt sich Klimaforscher Artaxo. "Es braucht doch die Ziele einfach nicht einzuhalten, es gibt überhaupt keine Strafe."
Dabei sei es sehr einfach, illegale Abholzung zu kontrollieren. Mit dem Satellitensystem von INPE werde seit 20 Jahren der Regenwald überwacht. "Wenn Brasilen die Abholzung stoppen will, kann das sehr schnell geschehen. Es fehlt nicht an Technologie, aber an politischem Willen", sagt Artaxo.
Auch Greenpeace sieht das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen sehr kritisch. Hinter dem Abkommen stünden große Wirtschaftsinteressen. Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele würden vernachlässigt bis ignoriert, sagt Greenpeace-Waldexperte Jannes Stoppel. So würden klimaschädliche Autos nach Südamerika transportiert, mehr Fleisch in die EU importiert und damit gleichzeitig das Klimaziel im Pariser Abkommen infrage gestellt. "Wir hoffen, dass es nicht zur Ratifizierung des Abkommens kommen wird", sagt Stoppel.
Aber auch den europäischen Verbrauchern wird nach Ansicht von Umweltorganisationen Sand in die Augen gestreut. Das Versprechen der EU, europäische Standards seien durch diverse Schutzklauseln nicht bedroht, weisen sie als unhaltbar zurück. In Brasilien sind Pestizide zugelassen, die auf dem europäischen Markt längst verboten sind. "Die damit produzierten Agrarprodukte landen auf dem europäischen Markt. Das gleiche gilt für genmanipuliertes Soja", sagt Stoppel.
BUND warnt vor "Waldsterben 2.0"

epd-bild / Stefan Arend
Berlin (epd). Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) warnt angesichts der Erderwärmung vor einem "Waldsterben 2.0". In Deutschland seien die Wälder am stärksten von der Klimakrise betroffen, sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger am 24. Juli in Berlin. In Folge der anhaltenden Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre spitze sich die Situation dramatisch zu. "Auch in den Wäldern tickt die Uhr", sagte Weiger.
Die Bäume seien durch den permanenten Eintrag von Luftschadstoffen und durch die Überdüngung aus der Luft geschwächt, der Waldboden sei ausgedorrt. "Waldbrände, Stürme und Massenvermehrungen von Borkenkäfer und Nonne lassen in der Folge ganze Waldbestände aus naturfernen Fichten- und Kiefernmonokulturen zusammenbrechen", sagte Weiger. Betroffen seien besonders die Nadelbaum-Monokulturen in Süddeutschland und Nordostdeutschland. Doch auch einige Buchenwälder seien durch den Klimastress so geschwächt, dass die Bäume ihr Laub frühzeitig abwerfen oder gar absterben.
"Wald muss vor Jagd gehen"
In einem zehn Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog fordert der Umweltverband unter anderem einen beschleunigten und finanziell geförderten Waldumbau in naturnahe Laubmischwälder, eine ökologische Bewirtschaftung, mehr Forstpersonal sowie eine stärkere Bejagung von Reh- und Rotwild. "Wald muss vor Jagd gehen", sagte Weiger. Die hohen Rehwildbestände in den Wäldern gefährdeten die Wiederaufforstung, weil das Wild die Setzlinge und Triebe fresse. Zudem sollten mittelfristig fünf und langfristig zehn Prozent der Wälder in Deutschland zu Naturwäldern deklariert werden, die nicht bewirtschaftet sind. Derzeit liege der Anteil bei 2,6 Prozent.
"Wir befinden uns in einer Situation, wie wir sie nach dem erfolgreichen Kampf gegen das Waldsterben Anfang der 80er Jahre nicht für möglich gehalten hätten", sagte Weiger. Waldbrände in den Alpen im Februar und in Brandenburg im April habe es früher nicht gegeben. Dies seien alarmierende Zeichen: "Wir befinden uns im Wettlauf mit der Zeit. Wenn wir jetzt nicht die Ursachen bekämpfen, verlieren wir unsere heutigen Wälder" - mit unabsehbaren Folgen auch für die Trinkwasserversorgung von Millionen Menschen.
Klöckner fordert Programm zur Wiederaufforstung
Die Schäden für Gesellschaft sowie Waldbesitzer durch die Klimakrise seien heute schon enorm. Die Folgekosten durch ein weiteres Aussitzen der Klimakrise durch die Politik seien deutlich höher als die Kosten für längst überfällige Klimaschutzmaßnahmen. "Die Angst vor der AfD im Osten darf nicht zur Blockade der Politik in ganz Deutschland führen", warnte Weiger.
Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) fordert ein großangelegtes Programm zur Wiederaufforstung in Deutschland. Gebraucht würden über eine halbe Milliarde Euro zur Wiederaufforstung, sagte Klöckner an die Adresse des SPD-geführten Finanzministeriums der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstag). Das Geld müsse aus dem Klimafonds bereitgestellt werden. "Bäume, die heute eingehen und die wir nicht nachpflanzen, fehlen morgen", warnte Klöckner. Ihrem Ministerium zufolge werden mehrere Millionen Bäume benötigt, um den Verlust von insgesamt 110.000 Hektar Wald auszugleichen.
Land NRW verdoppelt Mittel zur Aufforstung der Wälder
Köln, Düsseldorf (epd). Mit einem Maßnahmenpaket will die NRW-Landesregierung die klimabedingten Schäden in den heimischen Wäldern bekämpfen. Geplant ist unter anderem, die Hilfen für die Wiederaufforstung der Wälder von bislang gut vier Millionen auf zehn Millionen Euro pro Jahr zu erhöhen, wie Ministerpräsident Armin Laschet am 25. Juli erklärte. Gemeinsam mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (beide CDU) hatte er das Waldgebiet "Königsforst" bei Köln besucht, um sich ein Bild von der aktuellen Lage der Wälder zu machen. Die Bäume in dem Waldgebiet weisen Schäden auf, die durch Sturm, Trockenheit und Schädlinge verursacht wurden.
"Die Wetter- und Naturereignisse der letzten Jahre haben unseren Wäldern in Nordrhein-Westfalen stark zugesetzt", sagte Laschet. "Die Lage ist dringlich - mit massiven Folgen für die Forstwirtschaft und unsere Umwelt." Es gehe nun darum, den Kulturraum Wald für die Zukunft zu erhalten. Denn der Wald sei nicht nur Erholungsraum, sondern als nachhaltiger Speicher von Kohlendioxid "unser wichtigster Klimaschützer". Umweltministerin Heinen-Esser ergänzte: "Wir müssen noch intensiver zusammenarbeiten, um unsere Naturlandschaft in Nordrhein-Westfalen zu erhalten und die Wiederbewaldung und die Bekämpfung von Schädlingen zu bewältigen."
Sondermittel von jährlich zehn Millionen Euro
Zur Unterstützung der Waldbesitzer hat die Landesregierung schon Sondermittel in Höhe von 6,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Gefördert werden unter anderem Hilfen für die Aufarbeitung befallenen Holzes oder die Überwachung der Borkenkäferpopulation. Um die Schadflächen in den Wäldern wiederaufzuforsten, werden in den kommenden zehn Jahren 100 Millionen Euro benötigt. Die Landesregierung wolle die Mittel für die Aufforstung deshalb auf jährlich zehn Millionen Euro mehr als verdoppeln.
Für den 11. November lädt die Landesregierung zu einer Konferenz, bei der neben der Situation des Waldes auch jüngste Studien zur Bedeutung des Waldes diskutiert werden. Dabei soll auch ein "Bündnis für den Wald" ins Leben gerufen werden. Der Ort der Konferenz steht laut einem Sprecher der Staatskanzlei noch nicht fest. Die Landesregierung will sich zudem dafür einsetzen, dass langfristig der Beitrag des Ökosystems Wald als CO2-Speicher honoriert und seine Öko-Bilanz im Rahmen einer CO2-Bepreisung gewürdigt wird.
Den Angaben zufolge sind etwa 27 Prozent der NRW-Landesfläche bewaldet, über 80 Prozent der Waldfläche befinden sich in Privat- und Kommunalbesitz. Stürme, Trockenheit und Schädlinge wie der Borkenkäfer setzen dem Baumbestand zu. In der kommenden Woche startet die offizielle jährliche Waldzustandserhebung, Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen.
NRW strebt bei Kohleausstieg schnellere Verfahren an
Düsseldorf (epd). Um den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 sowie den damit zusammenhängenden Strukturwandel im Rheinischen Revier zu beschleunigen, strebt die NRW-Landesregierung "schnellere, unkomplizierte und effiziente Planungs- und Genehmigungsverfahren" an. "Was im Rheinischen Revier gelingt, kann dann Vorbild für alle Landesteile sein", sagte Wirtschafts- und Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) am 26. Juli in Düsseldorf. Die dabei entwickelten Standards sollten schrittweise auf alle Regionen übertragen werden. Die Landesregierung will deshalb im Rahmen des bereits beschlossenen "Entfesselungspakets IV" das Landesplanungsgesetz ändern.
Vorgesehen ist demnach unter anderem die Einführung einer sogenannten Experimentierklausel im Planungsrecht. Dabei seien die Regionen eingeladen, Ideen zu entwickeln, um Vorhaben der Energiewende, der Digitalisierung und der Anpassung an den Klima- und Strukturwandel planerisch zu beschleunigen und zu vereinfachen, hieß es. Zudem solle auch das Verfahrensrecht der Braunkohlenplanung – wie das Regionalplanverfahren - beschleunigt und gestrafft werden. Man wolle bewusst "Neues ausprobieren, um die Verfahren und Genehmigungen zu beschleunigen", erklärte Pinkwart.
Die Ergebnisse eines Modellversuchs zur Beschleunigung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren sollen im Rheinischen Revier zum Standard weiterentwickelt werden. Erzielt werden könnte damit eine Zeitersparnis von 40 Prozent - von sieben auf vier Monate - durch Parallelisierung, Digitalisierung und Straffung der Prozesse, hieß es. Um die Genehmigungsbehörden bei einem hohen Geschäftsanfall zu entlasten, sollen zudem schnell und bedarfsgerecht einsetzbare Teams aus pensionierten Beamtinnen und Beamten gebildet werden.
Fast 230.000 Inlandsflüge durch Bundesverwaltung und Abgeordnete
Berlin (epd). Mitarbeiter von Bundesministerien, Behörden und Institutionen des Bundes sowie Bundestagsabgeordnete haben im vergangenen Jahr fast 230.000 Mal Dienstreisen im Inland per Flugzeug absolviert. Die genaue Zahl der über das Dienstreiseportal gebuchten Inlandsflüge lag bei 229.116, bestätigte das Bundesinnenministerium einen Bericht der "Welt" (25. Juli). Das sind im Durchschnitt rund 628 Dienstflüge pro Tag. 52 Prozent der Flüge betrafen die Strecke von Berlin nach Bonn, wo nach wie vor ebenfalls Bundesministerien angesiedelt sind.
Die Zahl der Flüge sank 2018 damit gegenüber dem Vorjahr. 2017 waren es mehr als 294.000 Dienstreisen per Flug im Inland. Erfasst sind den Angaben zufolge dabei Dienstflüge aller Ressorts, Behörden und Verfassungsorgane des Bundes. Auch der Bundestag und damit die Inlandsreisen der Abgeordneten, die zwischen den Sitzungswochen in Berlin und ihrem Wahlkreis pendeln, sind davon umfasst. Daneben laufen auch die Reisen der Mitarbeiter von Institutionen wie KfW oder Bundesbank über das Portal.
Kritik der Grünen
Ein Sprecher des Ministeriums erläuterte, dass bei Dienstreisen grundsätzlich das Verkehrsmittel frei gewählt werden kann, öffentliche Verkehrsmittel aber vorrangig benutzt werden sollen. Flugreisen werden demnach dann erstattet, wenn dienstliche Gründe wie Termine oder wirtschaftliche Erwägungen dafür sprechen. Das sei etwa dann der Fall, wenn geringere Reisekosten oder ein Zeitgewinn von mindestens einem Arbeitstag entsteht.
Grünen-Chef Robert Habeck kritisierte im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" die hohe Zahl der Inlandsflüge aus dienstlichen Gründen. Die meisten seien keine Freizeitflüge. "Da treffen Sie vor allem Geschäftsleute und Beamte", sagte er. Er sprach sich für einen Ausbau der Bahnstrecken aus, um Inlandsflüge bis 2035 abzuschaffen. Zudem forderte er eine Besteuerung von Kerosin und schlug vor, die Reisekostenverordnung dahingehend zu ändern, dass jeweils die klimafreundlichste Alternative genutzt werden sollte.
Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) flogen 2018 fast 245 Millionen Passagiere von einem deutschen Flughafen ab oder kamen an, davon rund 47 Millionen Passagiere für einen Inlandsflug. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hat der Inlandsverkehr per Flugzeug nach Angaben des Verbands um drei Prozent zugenommen.
"Fridays for Future" veranstaltet Sommerkongress in Dortmund
Dortmund (epd). Die "Fridays for Future"-Bewegung lädt zu einem bundesweiten Sommerkongress nach Dortmund ein. Vom 31. Juli bis zum 4. August finden im Revierpark Wischlingen mehr als 140 Workshops rund um Klima, Aktivismus und Politik statt, wie die Organisatoren ankündigten. An den Diskussionen beteiligen sich unter anderem der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, und der Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), Otto Scharmer.
Die Veranstaltung solle ein Raum für junge Aktivisten sein, mehr über die Klimakrise und ihre Folgen zu lernen, sich zu vernetzen und Erfahrungen und Fähigkeiten auszutauschen, erklärte "Fridays for Future". Für den 2. August kündigte die Bewegung zudem einen freitäglichen Klimastreik mit den Kongressteilnehmern an.
Unter dem Motto "Fridays for Future" fordern junge Menschen seit Monaten weltweit mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Ausgangspunkt für die Proteste war der Schulstreik der schwedischen Schülerin Greta Thunberg.
Zwei politische Nachtgebete zum Thema Plastikmüll in Duisburg
Duisburg (epd). Die Kreuzeskirche in Duisburg-Marxloh beschäftigt sich im August und im September in zwei politischen Nachtgebeten mit dem Thema "Alles aus Plastik". An den Abenden solle über die Frage gesprochen werden, wie mit den Themen Plastik und Plastikmüll verantwortungsvoll umzugehen sei, teilte der Evangelische Kirchenkreis Duisburg mit.
Am 5. August ab 18 Uhr wird zunächst eine Bestandsaufnahme zum Thema Plastik gemacht. Außerdem sprechen die Teilnehmer über die Vergangenheit und Gegenwart der Verpackungen. Dafür ist Kerstin Ciesla vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) zu Gast. Am 2. September soll dann ab 18 Uhr mit Unternehmensbereichen und Umweltinitiativen über nachhaltige Lösungen diskutiert werden. Der Eintritt ist frei.
Kohlweißlinge und Distelfalter die häufigsten Schmetterlinge in NRW

epd-bild / Steffen Schellhorn
Düsseldorf (epd). Kohlweißlinge und Distelfalter sind nach Angaben der Naturschutzorganisation Nabu die häufigsten Schmetterlinge in Nordrhein-Westfalen. Das sei das Ergebnis der diesjährigen Zählaktion "Zeit der Schmetterlinge", teilte die Organisation am 24. Juli in Düsseldorf mit. Der Nabu hatte Schmetterlingsfreunde aufgerufen, in der Zeit vom 15. Juni bis einschließlich 15. Juli die Schmetterlinge zu zählen und zu melden.
Die Zahl der beobachteten und gemeldeten Tagfalter ist jedoch im Vergleich zum vergangenen Jahr drastisch zurückgegangen. Während 2018 noch 13.000 Kohlweißlinge beobachtete wurden, gab es diesmal lediglich 1.650 Meldungen. Der Distelfalter landete mit 1.200 Sichtungen auf dem zweiten Platz und legte gegenüber dem Vorjahr zu. Platz drei belegt diesmal mit 1.100 Sichtungen das Große Ochsenauge.
Auch alle anderen beobachteten und gemeldete Schmetterlinge wie etwa die Braun-Dickkopffalter, Zitronenfalter, Bläulinge und Admiral, C-Falter und Tagpfauenauge wurden deutlich seltener gesehen, als 2018. Auf dem letzten Platz liegt in diesem Jahr der Kleine Fuchs, der nur knapp 100 Mal gemeldet wurde.
Der Distelfalter ist in diesem Jahr vor allem auf eine "Masseneinwanderung" aus Saudi Arabien zurück zu führen, erklärte der Nabu. Diese Tagfalter hätten den Weg über das östliche Mittelmeer, die Türkei und den Balkan genommen.
Die Experten riefen dazu auf, Gärten und Parks wieder schmetterlingsfreundlich zu machen. "Mit der Anpflanzung von heimischen Pflanzen, die Schmetterlinge als Raupenfutter und Nektarquelle nutzen können, kann jeder seinen Beitrag dazu leisten", hieß es.
Soziales
Hitzewellen kosten Menschenleben

epd-bild/Werner Krüper
Frankfurt a.M. (epd). Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des staatlichen Robert Koch-Instituts in Deutschland Tausende Menschen aufgrund der hohen Temperaturen gestorben. Die Zahl der Todesopfer ist laut Instituts-Forscher Matthias an der Heiden mit dem Negativ-Rekord des sogenannten Jahrhundertsommers 2003 vergleichbar. Damals starben aufgrund des Wetters bundesweit etwa 7.600 Menschen, in Europa zwischen 50.000 und 70.000 Menschen. Dieses Ausmaß komme dem einer Grippewelle nahe, erklärt an der Heiden.
Die hohen Temperaturen können einen Herzinfarkt, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Nieren, der Atemwege und Stoffwechselstörungen verursachen. Bei Senioren kommt das oftmals abnehmende Durstgefühl hinzu, so dass sie zu wenig trinken.
Kalte Suppen
In Pflegeheimen wie dem Diakonie-Haus "Johann Hinrich Wichern" in Leipzig erinnern Mitarbeiter die Bewohner deshalb regelmäßig daran, einen Schluck Wasser oder Saft zu nehmen. Sie reichen kalte Suppen und eisgekühltes Wasser. Die Zimmer werden mit heruntergelassenen Außenrollos vor der Sonne geschützt. "Auf den Gängen stehen Ventilatoren und im Garten haben wir ein Badebassin zum Kühlen der Füße", sagt Heimleiterin Katharina Sachse.
Weitere Möglichkeiten, um sich vor Hitze zu schützen, sind: Feuchte Tücher auf den Körper legen, die Wohnräume nachts lüften, leichte Kleidung wählen.
Personal fehlt
Für Heime gibt es keine einheitlichen Verhaltenspläne, was an heißen Tagen zu tun ist. Es ist die Aufgabe jeder einzelnen Einrichtung, Geeignetes gegen die Hitze zu unternehmen. "Man kann das nicht standardisieren, weil es hier um Individuen geht", sagt Johanna Knüppel vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe. Auf einen Nierenkranken müsse man anders eingehen als auf einen Herzkranken. Klar sei, dass die Hitze mit Mehraufwand für die Mitarbeiter von Heimen verbunden sei. "Heiße Tage in der Haupturlaubszeit in einer Branche mit Fachkräftemangel: Es ist eine einfache Rechenaufgabe, dass Personal besonders im Sommer fehlt."
Die Betreuung in Pflegeheimen an Hitzetagen habe sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert, erläutert Chefarzt Clemens Becker von der Klinik für Geriatrische Rehabilitation des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart. Allerdings habe er bei seinen Forschungen festgestellt, dass die Sterblichkeit von Senioren, die durch ambulante Pflegedienste in den eigenen vier Wänden betreut werden, an heißen Tagen sehr hoch sei.
"Vermeidbare Todesfälle"
"Das Thema muss politisch ernster genommen werden. Wir reden von vermeidbaren Todesfällen. Dafür gibt es meiner Meinung nach keine Entschuldigung", sagt Becker. Hitzewellen müssten als Katastrophenszenario anerkannt werden. Dann könne auch der ehrenamtliche Katastrophenschutz zum Einsatz kommen, um bei der Versorgung Älterer zu helfen. Außerdem sollte jeder Hausarzt während einer Hitzewelle auf Patienten der Pflegegruppen 3, 4 und 5 besonders achten. Dafür müsse es allerdings einen Datenabgleich zwischen Hausärzten und Pflegekassen geben.
Mit gezielter Vorbeugung könnte die Zahl hitzebedingter Sterbefälle laut Robert-Koch-Institut vermutlich abgeschwächt werden. Ansonsten werde die Zahl hitzebedingter Todesopfer auch in Zukunft hoch sein oder sogar steigen. Denn aufgrund der Klimakrise müsse in Deutschland mit häufigeren und längeren Hitzewellen gerechnet werden, wie Mai und Juni 2019 bereits erahnen lassen.
Arbeitsgemeinschaft regt Hitzehilfe für Obdachlose an

epd-bild/Friedrich Stark
Berlin (epd). Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe appelliert an die Kommunen und Sozialeinrichtungen, Obdachlose bei der aktuellen Hitze mehr zu unterstützen. "Die Wohnungslosen sollten sich tagsüber in kühlen Räumen aufhalten können und nicht aus den Gemeinschaftsunterkünften morgens auf die Straße zurückgeschickt werden", sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Kühle Räume könnten ihnen Schutz vor der mitunter lebensbedrohlichen Hitze bieten.
Angesichts der wiederholt heißen Sommern sei es möglicherweise an der Zeit, nach dem Vorbild der Kältehilfe über eine organisierte Hitzehilfe für Obdachlose nachzudenken, regte Rosenke an. Dann könnten Passanten, die Obdachlose in gesundheitlicher Gefahr sähen - wie im Winter, wenn Kältetote zu befürchten seien -, gezielt unter einer bekannten Telefonnummer Hilfe holen. Außerdem sollten Kommunen Obdachlosen öffentliche Räume wie etwa Bahnhofshallen oder U-Bahn-Stationen zugänglich machen, um sie im Sommer vor extremen Außentemperaturen zu schützen.
Wasserflaschen schenken
Den Aufruf von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) an die Großstädter, Menschen ohne Dach über dem Kopf Wasserflaschen zu schenken, ergänzte Rosenke um die Aufforderung an die Kommunen, mehr öffentliche Brunnen einzurichten. Dann hätten Obdachlose die Möglichkeit, sich mit kostenlosem Trinkwasser zu versorgen und sich ein wenig abzukühlen.
"Der beste Schutz für Obdachlose ist allerdings eine eigene Wohnung", fügte Rosenke hinzu. Der Staat müsse daher die Wohnungsnot überwinden.
Statistik: Rund jeder Sechste in NRW armutsgefährdet

epd-bild / Jens Schulze
Wiesbaden, Düsseldorf (epd). Rund 2,93 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen sind einer Statistik zufolge armutsgefährdet. Im Jahr 2018 sind nach einem Vergleich mit dem landesweit mittleren Einkommen 16,6 Prozent der Menschen des Bundeslandes von Armut bedroht, wie das Landesamt für Statistik am 25. Juli in Düsseldorf mitteilte. Im bundesweiten Vergleich des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden liegt Nordrhein-Westfalen bei der Armutsgefährdungsquote an fünfter Stelle hinter Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin.
Die Armutsgefährdungsschwelle errechnen die Statistiker anhand des mittleren Einkommens (Medianeinkommens) eines Bundeslandes oder des Bundesgebietes. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens der Bevölkerung hat.
Nach der Statistik des Landesamtes lag die Armutsgefährdungsquote für 2018 mit 16,6 Prozent unter dem Höchststand des Vorjahres (17,2 Prozent). 2008 war sie mit 14,6 Prozent noch um zwei Prozentpunkte niedriger ausgefallen. Laut Landesamt waren im Jahr 2018 6,6 Prozent der einkommensarmen Bevölkerung arbeitslos. Inzwischen gelten auch immer mehr Erwerbstätige, Rentner, Pensionäre und weitere Menschen ohne Erwerb als armutsgefährdet, etwa Studierende oder Auszubildende. Die Statistiker des Landesamtes errechneten die Armutsgefährdungsschwelle anhand des mittleren Einkommens Nordrhein-Westfalens.
Über dem Durschnitt
Verglichen mit den mittleren Einkommen bundesweit fällt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Armutsquote für Nordrhein-Westfalen mit 18,1 etwas höher aus. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 15,5 Prozent. Auch nach bundesweiter Statistik ging in NRW im Vergleich zum Jahr 2017 die Armutsquote (18,7 Prozent) zwar leicht zurück. Im Jahr 2005 lag die Quote für Nordrhein-Westfalen jedoch noch bei 14,4 Prozent.
Bundesweit waren in Bayern und Baden-Württemberg im vergangenen Jahr mit weniger als zwölf Prozent die wenigsten Menschen von Armut bedroht. In Bremen und Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 20 Prozent die meisten Menschen. Die Quoten in Ost und West näherten sich jedoch demnach an. In den neuen Ländern, einschließlich Berlin, seien sie 2018 mit durchschnittlich 17,5 Prozent etwas höher als im früheren Bundesgebiet (ohne Berlin) mit 15 Prozent gewesen. Noch 2005 seien für die neuen Länder mit Berlin 20,4 Prozent verzeichnet worden, für den Westen 13,2 Prozent.
Alleinerziehende führen weiter Liste an
Von allen Haushaltstypen weisen Alleinerziehende und ihre Kinder das höchste Armutsrisiko auf. 2018 seien 40,4 Prozent der Personen in Alleinerziehenden-Haushalten im früheren Bundesgebiet und 44,5 Prozent in den neuen Ländern armutsgefährdet gewesen, heißt es in der Mitteilung.
Der Sozialverband VdK für NRW forderte mit Blick auf die Daten die Aufwertung von geringen Bezügen und die Stabilisierung der Rente insgesamt bei 50 Prozent. Allein die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter sei in den letzten sechs Jahren um knapp 14 Prozent gestiegen, auf zuletzt rund 155.000, mahnt der Vorsitzende Horst Vöge. Der Mindestlohn müsse auf 12,80 Euro angehoben und prekäre Beschäftigungsverhältnisse eingedämmt werden, forderte er.
Saarland belegt Mitte bei Armutsgefährdungsquote
Im bundesweiten Vergleich liegt das Saarland laut Statistischem Bundesamt bei der Armutsgefährdungsquote in der Mitte. Gemessen an der Armutsgefährdungsschwelle des Bundes hatte das Saarland 2018 eine Quote von 16 Prozent, wie es am 25. Juli hieß.
Den Zahlen zufolge sind Saarländerinnen (17,2 Prozent) eher armutsgefährdet als Saarländer (14,8 Prozent). Die höchste Armutsquote wiesen wiederum Alleinerziehende (42,2 Prozent) auf, gefolgt von Familien mit mindestens drei Kindern (34 Prozent) und Alleinlebenden (28 Prozent).
Erst am 24. Juli hatte die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) für September den saarländischen Aktionsplan gegen Armut angekündigt. Thematisch gehe es unter anderem um bezahlbaren Wohnraum, Stromsperren, Kinderarmut, Bildung, Mobilität, Infrastruktur und Langzeitarbeitslosigkeit.
Anfang 2017 war der erste saarländische Familienreport erschienen, der unter anderem auf die schwierige Situation von Alleinerziehenden und Familien mit vielen Kindern hinwies. Bereits im Jahr 2015 wurde der saarländische Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht, der neben den Alleinerziehenden vor allem die Armut im Alter als wichtiges Thema hervorhob. Im Sommer 2017 hatte die Ministerin ursprünglich angekündigt, bis Ende 2017 Maßnahmen zum Kampf gegen Armut erarbeiten zu lassen. Im vergangenen Jahr kündigte sie diese für den Sommer 2019 an.
Studie: Mehr Mütter gehen einem Beruf nach
Köln/Düsseldorf (epd). Mehr Mütter mit Kindern ab zehn Jahren sind erwerbstätig. Wie aus einer am 29. Juli in Köln veröffentlichten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, ist der Anteil der erwerbstätigen Mütter mit Kindern zwischen 10 und 14 Jahren von 2008 bis 2017 von 70,4 auf 78,3 Prozent gestiegen. Bei Müttern mit Kindern zwischen 15 und 17 Jahren habe er von 75,3 auf 82,8 Prozent zugenommen.
Das Institut begründete den Anstieg damit, dass fast überall in Deutschland die Betreuungsmöglichkeiten für ältere Kinder nach dem Schulunterricht besser geworden sind, wie die Düsseldorfer "Rheinische Post" (29. Juli) zuerst berichtet hatte. Zugleich sei der Anteil der Mütter von Kindern im Teenageralter mit kleinen Teilzeitjobs von 36,7 auf 28,3 Prozent gesunken.
Erfolg im Job für Frauen immer wichtiger
Frauen zwischen 45 und 64 Jahren seien zudem häufiger mit größerem Stundenumfang erwerbstätig als noch 2008: Während vor elf Jahren noch fast jede dritte (31,7 Prozent) Frau in dem Alter weniger als 21 Stunden pro Woche arbeitete, waren es 2017 nur noch 28,5 Prozent. Zugleich stiegen die Anteile der mit 21 bis 39 Stunden pro Woche Beschäftigten von 39,4 Prozent auf 42,3 Prozent, wie es hieß.
Außerdem hätten sich die Neigungen der Mütter verändert: Frauen bewerteten Erfolg im Beruf als immer wichtiger. Daher gingen sie nicht nur arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen, hieß es. Der Job habe vielmehr eine hohe emotionale Bedeutung für sie. Daher geht der Studienautor Wido Geis-Thöne davon aus, dass sich die positive Entwicklung bei den Müttern mit älteren Kindern noch weiter fortsetzen wird. Dennoch solle der Betreuungsausbau weiter vorangetrieben werden, schreibt Geis-Thöne. Zudem müsse Müttern mit längeren Auszeiten die Rückkehr in den Job erleichtert werden - etwa mit Angeboten zur Qualifizierung sowie zur Beratung und Vermittlung.
Mehr Plätze für Kindertagesbetreuung in NRW
Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen stehen zum neuen Kindergartenjahr am 1. August mehr als 710.800 Plätze in der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Das ist der bislang größte Zuwachs an Kita-Plätzen seit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) im Jahr 2008/2009, wie das NRW-Familienministerium am 25. Juli in Düsseldorf mitteilte. Die 186 Jugendämter haben demnach für das neue Kindergartenjahr knapp 26.100 Plätze mehr gemeldet als im laufenden Jahr. Auch die Zahl der Kindertageseinrichtungen sei um rund 250 auf über 10.300 gestiegen.
Die Anstrengung des Landes, mehr Betreuungsplätze für Kleinkinder zu schaffen, zeige damit Wirkung, sagte Minister Joachim Stamp (FDP): "Aber wir wissen auch, dass wir den Bedarfen der Eltern in unserem Land noch stärker gerecht werden müssen." Eltern, die trotz Anmeldung noch keine Platzzusage für ihre Kinder erhalten hätten, sollten in engem Kontakt mit dem örtlichen Jugendamt bleiben und ihren Betreuungsbedarf dort geltend machen.
Mit dem Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kibiz, das am 1. August in Kraft tritt, gewährleiste das Land zudem einen Übergang zur umfassenden Kibiz-Reform, die im Kindergartenjahr 2020/2021 in Kraft treten soll, hieß es. Ziel sei es, für ein dauerhaft auskömmlich finanziertes System der Kindertagesbetreuung zu sorgen. "Unser Ziel ist die weitere Verbesserung der Betreuungsqualität und des Platzangebots", erklärte Stamp. Deswegen stelle das Land mit dem Pakt für Kinder und Familien ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 jährlich zusätzlich rund 1,3 Milliarden Euro bereit.
Hintergrund für den deutlichen Anstieg der Anmeldungen sind eine höhere Inanspruchnahme der Kindertagesbetreuung sowie steigende Geburtenzahlen und Zuwanderung. Für Kinder im Alter von unter drei Jahren stehen im kommenden Kindergartenjahr über 202.500 Betreuungsplätze zur Verfügung. Für die überdreijährigen Kinder in Nordrhein-Westfalen gibt es im anstehenden Kindergartenjahr fast 508.300 Plätze.
Trend bei Kitas geht zu vegetarischem Essen

epd-bild/Norbert Neetz
Leipzig/Berlin (epd). Der Verband Deutscher Schul- und Kitacaterer (VDSKC) kann die jüngste Aufregung über den Verzicht von Schweinefleisch in Kindertagesstätten nicht nachvollziehen. "Bei einem Preis von - je nach Bundesland - zwei bis vier Euro für ein Kita-Essen kann nur minderwertiges Fleisch angeboten werden", sagte der VDSKC-Vorsitzende, Rolf Hoppe, am 23. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Es sei für die Kinder besser, für diesen Preis "lieber vernünftiges Gemüse in Bioqualität, als billiges Fleisch" zu verwenden.
Seit Jahren sei zudem ein wachsender Trend zu vegetarischem Essen an Kitas und Schulen zu verspüren. "Die Eltern wollen sichergehen, dass ihre Kinder ein vernünftiges Essen bekommen", begründete Hoppe die Entwicklung. Zudem müsse "kein Kind täglich Fleisch essen". So empfehle die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Kinder maximal zwei Mal Fleisch pro Woche.
Auch religiöse Vielfalt könne eine Rolle spielen beim Fleischverzicht. So könne es sein, dass Kitas und Schulen mit Rücksicht auf jüdische und muslimische Kinder kein Essen mit Schweinefleisch anbieten wollen. Hinzu kämen immer mehr Kinder, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Es sei deshalb nachvollziehbar, wenn "auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner" gekocht werde.
"Fleisch zuhause servieren"
Allein in Berlin sei mittlerweile bei einem Viertel bis einem Drittel aller Kitas das vorherrschende Essen vegetarisch, betonte der Verbandsvorsitzende weiter. Kinder, die dennoch mehr Fleisch essen wollen, könnten dies auch außerhalb der Kita oder Schule tun. Schließlich würden die Kinder in Kita und Schule nur fünf von vielleicht 20 Mahlzeiten in der Woche einnehmen. "Fleisch können die Eltern ihren Kindern zu Hause servieren", sagte Hoppe.
Der VDSKC reagierte damit auf einen Bericht der "Bild"-Zeitung, die von zwei Leipziger Kitas in freier Trägerschaft berichtet hatte, die "aus Respekt vor einer sich verändernden Welt" nur noch Speisen ohne Schweinefleisch ausgegeben würden. Nach einer heftigen Kontroverse ruderte der Träger einem Medienbericht zufolge zurück. «Wir haben festgestellt, dass unsere Entscheidung, in unseren beiden Kindergärten auf Schweinefleisch zu verzichten, viel Öffentlichkeit erzeugt hat», zitiert die Zeitung aus einem Schreiben der Kita-Leitung an die Eltern. Aus diesem Grund werde diese Entscheidung zunächst ausgesetzt.
Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes Deutscher Schul- und Kitacaterer liefern den Angaben zufolge bundesweit über 100.000 Essensportionen pro Tag aus.
"Stück zum Glück": Projektleiterin über inklusive Spielplätze
Bonn (epd). Die Initiative "Stück zum Glück" baut seit 2018 in ganz Deutschland inklusive Spielplätze. 40 sollen es insgesamt werden, 17 gibt es schon, unter anderem in Dortmund und Bielefeld, wie Projektleiterin Ulrike Jansen von der Aktion Mensch dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Bonn sagte. Inklusive Spielplätze förderten den selbstverständlichen Austausch zwischen den Kindern: "Beim Spiel zählt nicht die Behinderung, sondern es geht um das gemeinsame Erlebnis. Hürden entstehen da gar nicht erst."
"Beim gemeinsamen Spielen entstehen Hürden gar nicht erst"
Für Kinder mit Behinderung seien bisher viel zu wenige Spielplätze nutzbar, beklagte Jansen. "Inklusive Spielplätze zu bauen, ist teuer. Und Entscheider denken Inklusion häufig nicht mit." Der erste "Stück zum Glück"-Spielplatz wurde im vergangenen Sommer in Köln eröffnet. Inzwischen sind bereits 17 inklusive Spielplätze fertig, drei weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.
Ein inklusiver Spielplatz unterscheidet sich nach Jansens Worten vor allem durch die Zugänglichkeit von einem gewöhnlichen Spielplatz. "Kinder und Eltern im Rollstuhl kommen meistens gar nicht erst auf normale Spielplätze. Sand oder Kies stoppt sie." Auf inklusiven Spielplätzen sei dagegen kaum Sand zu finden - und wenn doch, dann auf einem Hochtisch, so dass Kinder im Rollstuhl auch mitspielen können. Der Boden sei stattdessen mit Fallschutzflächen ausgelegt, die glatt und eben seien, damit Kinder und Eltern im Rollstuhl problemlos auf die Spielplätze fahren können.
Starke Farben, Klangspiele, barrierefrei
Auch auf die Auswahl der Geräte werde besonderen Wert gelegt, erläuterte die Projektleiterin. Starke Farben und Klangspiele sollten auch Kinder mit geistigen Behinderungen anregen. Bei Klettergerüsten werde dagegen darauf geachtet, dass sie auch Kinder im Rollstuhl nutzen können. Die könnten dann unter das Gerüst fahren und sich alleine hochziehen. "Das ist ein großer Schritt für die Kinder", sagte Jansen. Insgesamt sollten die verschiedenen Geräte für die Kinder jeweils unterschiedlich nutzbar sein.
Das Projekt soll auch ein Umdenken in den Städten anstoßen. Bei der Auswahl der Standorte sei es sinnvoll, dass in der Nähe eine inklusive Schule oder ein inklusiver Kindergarten oder ähnliches sei. "Die Kinder dort wollen ja auch mitspielen", betonte Jansen.
Der Handelskonzern Rewe und ein Waschmittel- und Kosmetikhersteller finanzieren "Stück zum Glück" mit einer Spendenaktion. So soll eine Million Euro gesammelt werden. Mehr als die Hälfte der Summe ist den Angaben zufolge schon erreicht.
Rahmenvertrag soll Teilhabe von Menschen mit Behinderung stärken
Mehr Selbstbestimmung und Teilhabe für behinderte Menschen: Die Erwartungen an die Reform der Eingliederungshilfe in NRW sind groß. Die nun unterzeichnete Vereinbarung für NRW erhält viel Zustimmung von Wohlfahrtsverbänden und Kommunen.Düsseldorf (epd). Für eine Stärkung der Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen ist am 23. Juli im NRW-Sozialministerium ein neuer Landesrahmenvertrag unterschrieben worden. Gemeinsam mit den Partnern sei ein Vertragswerk erarbeitet worden, das den individuellen Bedarf der Menschen mit Behinderungen noch stärker in den Fokus rücke, erklärten der Direktor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), Matthias Löb, und die Direktorin des Landschaftsverbands Rheinland (LVR), Ulrike Lubek. Wohlfahrtsverbände begrüßten die Vereinbarung, mit der das Bundesteilhabegesetz in Nordrhein-Westfalen umgesetzt wird.
Der neue Vertrag über die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen regelt den Rahmen für die Unterstützungsleistungen von etwa 250.000 Menschen mit wesentlichen Behinderungen im Land ab 2020. Der Unterstützungsbedarf für behinderte Menschen wird künftig individuell ermittelt und nach einem einheitlichen System unabhängig von der Wohnform finanziert. Vor allem für Menschen, die in Wohneinrichtungen leben und unterstützt werden, soll dies einen Zugewinn an Selbstbestimmung und eine stärker am individuellen Bedarf und Wunsch ausgerichtete Leistung bringen. Weitere Neuerungen sind die Regelungen zu Qualitätsprüfungen etwa in Werkstätten, die einem besseren Schutz der behinderten Menschen dienen.
Diakonie RWL: Angemessene Fachkraftquote sicherstellen
Bislang werden über 4,9 Milliarden Euro pro Jahr in NRW unter anderem für die Schulbegleitung, die Unterstützung in Werkstätten und Wohneinrichtungen oder im ambulant betreuten Wohnen aufgewendet. Die Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und (LWL) und Rheinland (LVR), die kommunalen Spitzenverbände, die Wohlfahrtsverbände sowie die öffentlichen und privaten Leistungsanbieter haben das 200 Seiten starke Vertragswerk unterzeichnet.
Der Chef der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in NRW, Christian Heine-Göttelmann, verwies darauf, dass es mit dem neuen Landesrahmenvertrag gelungen sei, die bestehenden Tarifregelungen von AWO, Caritas, den Mitgliedsorganisationen des Paritätischen, dem Deutschen Roten Kreuz und der Diakonie zur Grundlage für die Kalkulation der Leistungen zu machen. "Damit können wir eine angemessene Fachkraftquote sicherstellen und können dem Einsatz des Personals in den Diensten und Einrichtungen gerecht werden." Das sei auch eine "Anerkennung für das berufliche Engagement der Beschäftigten", sagte Heine-Göttelmann, der auch Vorstand der Diakonie RWL ist.
Andreas Johnsen von der AWO NRW bezeichnete den Vertrag als solide Grundlage. Es sei gelungen, "ein leistungsfähiges, ortnahes und wirtschaftlich effektives Leistungssystem für Menschen mit Behinderungen weiterzuentwickeln". Der Landesvorsitzende der Lebenshilfe NRW, Gerd Ascheid, lobte die Vereinbarung, appellierte aber auch an alle Beteiligten, Änderungen am Vertrag zügig vorzunehmen, sollten sich bei der Umsetzung Punkte zulasten von Menschen mit Behinderung ergeben. "Die Zeit, dass Menschen mit Behinderung als Bittsteller wahrgenommen werden, ist vorbei", betonte er.
NRW-Sozialminister würdigt Vereinbarungen als "Meilenstein"
Das Bundesteilhabegesetz bringt NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) zufolge für Menschen mit Behinderungen viele Veränderungen. Die in dem Landesrahmenvertrag erzielten Regelungen bezeichnete der Minister als "Meilenstein".
Die neue Vereinbarung war notwendig geworden, weil zum 1. Januar 2020 die Reform der Eingliederungshilfe als dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft tritt. Hintergrund des Gesetzes ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die mehr Selbstbestimmung und Teilhabe sowie das Recht auf individuelle Leistungen für Menschen mit Behinderungen vorsieht.
Heftiges Knirschen im Reformprozess

epd-bild/Jürgen Blume
Frankfurt a.M. (epd). Es ist die größte Sozialreform seit Jahrzehnten. Seit Dezember 2016 vollzieht sie sich weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit: die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Das Gesetz soll Menschen mit Behinderung eine selbstbestimmtere Lebensführung ermöglichen. Doch ob das überall funktioniert, ist fraglich. Der Zeitdruck bis zum Start der nächsten Reformstufe 2020 steigt.
Das BTHG will die Unterstützung allein an den individuellen Bedürfnissen ausrichten (Personenzentrierung). Dazu können künftig Einzelbausteine aus Hilfs- und Betreuungsangeboten ausgewählt werden. Die Vorwerker Diakonie in Lübeck nutzt dazu ein anschauliches Bild: "Die Grundidee gleicht der einer Reisebuchung: Neben All-inclusive-Pauschalurlaub gibt es auch individuelle Angebote, bei denen Flug, Unterkunft, Essen, Sport- oder Wellnessangebote je nach Bedarf und Verfügbarkeit individuell gebucht werden können."
Teilhabeplan
Für jede betroffene Person mit Handicap muss ein sogenannter Teilhabeplan erstellt werden. Künftig werden alle verfügbaren Leistungen in zwei Hilfearten unterteilt, und - auch das ist neu - getrennt finanziert. Unterschieden werden die Hilfe zum Lebensunterhalt und die Fachleistungen zum Bewältigen des Lebens - bei freier Wahl der Wohnform. Zu den Fachleistungen gehören therapeutische Angebote wie Ergotherapie oder eine pädagogische Assistenz. Wer welche Unterstützung finanziert bekommt, hängt vom persönlichen Bedarf ab.
Ein gewaltiges Reformprojekt, wie allein die Zahlen für Nordrhein-Westfalen zeigen: Zu regeln sind die Vertragsdetails für weit über 100.000 Menschen, die Unterstützung beim Wohnen benötigen, und für 70.000 Personen, die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bekommen sollen. Geschätztes Finanzvolumen jährlich: vier Milliarden Euro.
Was am grünen Tisch noch machbar erscheint, hat erhebliche Tücken in der Praxis. So müssen etwa bei behinderten Menschen in Wohngruppen die reinen Wohnkosten von den anderen Leistungen der Eingliederungshilfe akribisch getrennt werden. Das klingt bürokratisch - und ist es auch.
Paradigmenwechsel
Uwe Mletzko, Vorsitzender des Bundesverbandes evangelischer Behindertenhilfe (BeB), sagt, für diesen Paradigmenwechsel müssten "ganz neue Instrumente der Bedarfserhebung und ihr Einsatz im Teilhabe- und Gesamtplanverfahren geschaffen werden" - jenem Kernbereicht der Reform, der die Kooperation von Fachdiensten und Betroffenen exakt regelt.
Heinz-Josef Kessmann, Diözesancaritasdirektor aus Münster, betont, viel werde davon abhängen, "dass die Bedarfserhebung und die Teilhabeplanung durch die Landschaftsverbände tatsächlich im Interesse der betroffenen Menschen mit Behinderung ablaufen". Und er verweist darauf, dass im Juni erst drei Bundesländer die für die Reform nötigen rechtlichen Voraussetzungen, die Landesrahmenverträge, geschaffen haben. Für NRW ist die Vertragsunterzeichnung für den 23. Juli vorgesehen.
"Was kann der Mensch, und was braucht er? Das sind die Leitfragen, die ein neues System erforderlich machen. Und am Anfang macht eine Umstellung Arbeit beim Einführen", erklärt der Sozialdezernent des Kommunalverbandes LWL, Matthias Münning. Er sei aber zuversichtlich, dass das Ziel der Reformen pünktlich ereicht wird. "Es gibt viel Arbeit, und es gibt viele Detailfragen. Von Problemen kann man deshalb aber nicht sprechen."
Pessimismus
Eine Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Curacon (Münster) kommt zu einem anderen Schluss. Bei den Trägern der Eingliederungshilfe herrsche verbreitet Pessimismus: "Spät verabschiedete Ausführungsgesetze, ausstehende Landesrahmenverträge, hohe Aufwände im Vorbereitungsprozess und Zweifel an der Erreichung der kommunizierten Ziele des BTHG führen zu Verstimmungen unter den Studienteilnehmern." Im Vergleich zur Befragung 2018 habe "sich die Bewertung des BTHG nochmals verschlechtert", urteilen die Autoren.
Wolfram Teschner, Geschäftsführer der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein (CWWN), beklagt, dass das BTHG zu einem Übermaß an Bürokratie führe. Der eigentlich gute Ansatz, mehr Teilhabe zu ermöglichen, verkehre sich in sein Gegenteil.
"Die Umstellung wird auf jede Fall einen erhöhten Verwaltungsaufwand bedeuten", ist auch Uwe Mletzko überzeugt. Viele Kollegen hätten die Sorge, dass den Betroffenen "der große Aufwand real keine Verbesserung der Lebenssituation" bringe. Manche Kritiker befürchteten sogar Verschlechterungen.
Freie Wohlfahrtspflege fordert Nachbesserungen bei Pflegegesetz
Düsseldorf (epd). Die Freie Wohlfahrtspflege NRW fordert Nachbesserungen beim Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. Nötig sei eine unbürokratische Umsetzung und eine Senkung der Hürden für die Anstellung von Arbeitskräften, erklärte der Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege NRW, Christian Heine-Göttelmann, in Düsseldorf. Auch rund acht Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes seien nur wenige konkrete Anträge gestellt worden. Auch die die Zahl der bereits erfolgten Bewilligungen sei gering. Ein Grund dafür sei, dass das Gesetz bis auf wenige Ausnahmen nur die Einstellung von Fachkräften zulasse, und einen enormen bürokratischen Aufwand verursache.
Es sei ein guter Ansatz, mehr Stellen in den vollstationären Pflegeeinrichtungen zu schaffen ohne die Bewohner finanziell zu belasten, erklärte Heine-Göttelmann. Allerdings sei davon auszugehen, dass zahlreiche Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen auf die Beantragung dieser Stellen verzichten werden. Das Gesetz gehe an der Praxis vorbei.
Ziel des von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf den Weg gebrachten Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes ist es, den Einrichtungen 13.000 zusätzliche Pflegekräfte zu bringen. Die Landesarbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von Caritas, Diakonie, AWO, DRK, Paritätischen und der Jüdischen Kultusgemeinde. Die Verbände vertreten nach eigenen Angaben mehr als 1.400 stationäre Pflegeeinrichtungen in NRW.
Diakonisches Werk RWL baut Freiwilligendienste aus
Düsseldorf (epd). Das Diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe baut seine Freiwilligendienste aus. Unter anderem sei die Plätze im MOVE-Programm für sozial benachteiligte Jugendliche auf 40 verdoppelt worden, teilte die Diakonie RWL am 24. Juli in Düsseldorf mit. Auch die Zahl der Plätze für Flüchtlinge im Freiwilligendienst werde erhöht, obwohl die Bundesmittel für dieses Programm gekürzt worden seien. "Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge, die bei uns einen Bundesfreiwilligendienst machen, beginnen danach ihre Pflegeausbildung in der Altenhilfe oder im Krankenhaus", erklärt Jürgen Thor, Leiter der Freiwilligendienste bei der Diakonie RWL.
Insgesamt beginnen den Angaben zufolge im August und September rund 1.500 junge Menschen ihren Freiwilligendienst in den Einrichtungen des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie arbeiten in Schulen, Krankenhäusern, Kitas oder Altenheimen.
Die Freiwilligen werden mit rund 400 Euro im Monat unterstützt. "Gerne hätten wir ihnen in diesem Jahr mehr Taschengeld, vor allem aber einen höheren Fahrtkostenzuschuss bezahlt", erklärte Diakonie-Vorstand Christian Heine-Göttelmann. Das sei jedoch angesichts der bundesweiten Kürzung von Fördergeldern nicht möglich.
Nordrhein-Westfalen verdienen etwas mehr Geld
Düsseldorf (epd). Steuerpflichtige in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr 2015 im Durchschnitt 38.560 Euro vor Steuern verdient. Das entspricht einem Anstieg von 3,2 Prozent, wie das statistische Landesamt am 26. Juli in Düsseldorf unter Berufung auf die Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2015 mitteilte. Das höchste Durchschnittseinkommen verzeichnete dabei wie bereits im Vorjahr das rheinische Meerbusch mit 62.570 Euro pro Einkommenssteuerpflichtigem. Rheinländer verdienten mit 39.510 Euro insgesamt im Durchschnitt rund 2.000 Euro mehr als die Westfalen.
Unter den Großstädten lag Bergisch Gladbach mit durchschnittlich 47.498 Euro vorn, gefolgt von Düsseldorf (47.288 Euro). Am wenigsten verdienten der Statistik zufolge die Steuerpflichtigen in Gelsenkirchen (30.020 Euro), Duisburg (29.668 Euro) und Weeze (28.225 Euro). Insgesamt waren 2015 8,55 Millionen Menschen in NRW einkommenssteuerpflichtig. Sie erzielten Gesamteinkünfte in Höhe von fast 330 Milliarden Euro.
Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2015 wurde den Angaben nach erst jetzt veröffentlicht, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für Statistiken zur Verfügung gestellt werden. Damit seien die Daten die aktuellsten, die derzeit verfügbar seien, erklärte das Landesamt. Die Statistiker wiesen darauf hin, dass zusammen veranlagte Ehepartner bei der Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt wurden.
Medien & Kultur
Der "Bruderkuss" im Pop-Art-Stil

epd-bild/Peter Endig
Leipzig (epd). Zwei Männer mit wenig Haaren, eine feste Umarmung und gespitzte Lippen: Im Jahr 1989 schuf der damals in Ostberlin lebende Maler Hans Ticha mit seinem Werk "Der Kuß" im für die DDR seltenen Pop-Art-Stil eine ganz eigene Version des "Bruderkusses". Es ist eine der mehr als 300 Arbeiten, die das Museum der bildenden Künste in Leipzig seit dem 23. Juli auf fast 2.000 Quadratmeter Fläche zeigt. Zusammengetragen haben die Kuratoren eine spannungsreiche Sonderausstellung über die Zeit am Ende der Diktatur, den Umbruch und den Neubeginn in künstlerischer Auseinandersetzung.
Zu sehen sind unter dem Titel "Point of No Return" Werke von 106 Männern und Frauen. Darunter sind Prominente wie Werner Tübke, Willi Sitte oder Neo Rauch, aber auch unbekanntere oder vergessene Namen. Es sind Bilder, Skulpturen und Installationen, die nicht chronologisch zusammenhängen, kaum eine gemeinsame Geschichte erzählen und sich nicht immer auf den ersten Blick erschließen.
Denn es war den Kuratoren Alfred Weidinger, Paul Kaiser und Christoph Tannert wichtig, sich der Thematik über die individuellen Künstlerpersönlichkeiten zu nähern, die jeweilige Biografie und eigene schöpferische Verarbeitung der Zeit herauszustellen. So stehen auch Arbeiten von im Staat geschätzten Künstlern neben jenen von Dissidenten, Rebellen, Reformern und Geflüchteten.
Umbruch verschieden wahrgenommen
Ticha konnte einige seiner Bilder nur im Verborgenen behalten und der in Jena geborene Künstler Frank Rub wurde 1983 wegen seiner Tätigkeit sogar sechs Wochen inhaftiert. Für sie bedeutete das Ende der DDR etwas fundamental anderes als beispielsweise für Sitte, den langjährigen Präsidenten des Verbandes Bildender Künstler in der DDR. So fiel auch die künstlerische Bearbeitung anders aus: Sitte malte 1990 das programmatische Gemälde "Erdgeister", in dem er die Arbeiter kopfüber in Schlamm steckt. Er habe es der Arbeiterklasse übelgenommen, dass sie dem Kapitalismus fast vorbehaltlos Tür und Tor geöffnet habe, erklärt Kurator Tannert.
Wie die Ausstellung zeigt, sahen viele Künstler den Umbruch aber als Befreiung. Oftmals war ihre Kunst schon vor der friedlichen Revolution von Sehnsucht nach Öffnung und Veränderung geprägt. Die Hoffnung, die die Männer und Frauen in ihre Werke gelegt hätten, seien natürlich keine Vorwegnahme des Mauerfalls, meint Tannert. Aber dennoch griffen sie eine Kritik der Gegenwart und die Projektion einer offeneren Zukunft auf.
Besonders eindrucksvoll sind die Arbeiten, die in einem Werkzyklus sowohl vor, als auch nach der friedlichen Revolution entstanden sind, wie die den Angaben zufolge erstmals in Gänze gezeigte "Passagen"-Serie (1988-1994) der früheren Leipziger Kunstprofessorin Doris Ziegler. In mehreren Bildern zeigt sie den Wandel der Leipziger Innenstadtpassagen von einem kulturellen, aber dennoch melancholischen Rückzugsort zum Schauplatz turbulenter und radikal veränderter Verhältnisse.
Diskussion über Auseinandersetzung mit ostdeutscher Kunst
Die Schau "Point of No Return" verharrt aber nicht in der Kunst der unmittelbaren Nachwendezeit, sondern bezieht auch Arbeiten mit von Künstlerinnen und Künstlern ein, die zwar noch in der DDR geboren wurden, aber keine eigenen Erfahrungen mit dem Sozialismus gemacht haben. Diese Generation beschreibt oftmals aus dem Blickwinkel der Kinder die Zerrissenheit der Eltern und der Gesellschaft nach dem Umbruch, aber auch die heutigen Probleme, wie etwa die Fotoserie "Auslage" (2014) der 1975 geborenen Künstlerin Frenzy Höhne, die vor geschlossenen Ladengeschäften Menschen mit Werbesprüchen platziert.
Viele der Arbeiten sind wenig bekannt und bisher kaum gezeigt worden. Mit der Ausstellung will das Museum auch deshalb eine Diskussion über die bisherige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ostdeutscher Kunst anregen. Nach Einschätzung der Kuratoren ist die Forschung unzureichend, oftmals fehle schon ein Überblick über die Bestände. Eine umfassende Aufarbeitung sei nur in den seltensten Fällen vorhanden. Wahrscheinlich brauche es doch 30 Jahre, so meint Museumsdirektor Weidinger, den "ideologischen Rucksack" auszuleeren und sich auf die Kunst in und aus der DDR einzulassen.
Kunststreit um "Reformationsfenster" kommt vor Gericht

epd-bild/Harald Koch
Hannover (epd). Der Streit um das geplante "Reformationsfenster" des Künstlers Markus Lüpertz (78) für die Marktkirche in Hannover geht vor Gericht. Der Erbe des Architekten Dieter Oesterlen (1911-1994) hat Klage beim Landgericht Hannover gegen den Einbau des 13 Meter hohen Buntglasfensters eingelegt, wie ein Gerichtssprecher am 25. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte. Der Erbe mache als Inhaber der Urheberrechte geltend, dass das Fenster nicht in den Innenraum der gotischen Kirche passe, die von Oesterlen nach dem Krieg wiederaufgebaut und neu gestaltet wurde.
Marktkirchen-Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann sagte auf epd-Anfrage, der Kirchenvorstand wolle auf jeden Fall am geplanten Einbau des Fensters festhalten. Das Glaskunstwerk zeigt eine große weiße Figur, die Martin Luther darstellen soll, sowie Motive mit Bezug zur Reformation. Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), ein Freund von Lüpertz, will es der Kirche als Ehrenbürger von Hannover schenken.
Fünf schwarze Fliegen
Kreisel-Liebermann sagte, die Marktkirche müsse nun innerhalb von zwei Wochen erklären, ob sie sich gegen die Klage verteidigen wolle. Bis zum 3. September sei dann Zeit für eine schriftliche Erwiderung. "Wir halten es für richtig, dass wir das Reformationsfenster in unserer wiederaufgebauten Kirche nach so vielen Jahren bekommen können", betonte sie. Eine Kirche sei kein Museum. Der Kirchenvorstand hat bereits eine Berliner Kanzlei, die auf Urheberrechte spezialisiert ist, mit der Verteidigung beauftragt.
Der Entwurf von Lüpertz sorgt vor allem wegen fünf großer schwarzer Fliegen auf dem Bild für kontroverse Diskussionen. Sie stehen für das Böse und die Vergänglichkeit. Die Urheberrechte an der Neugestaltung der Marktkirche werden von dem in Tokio lebenden Rechtsanwalt Georg Bissen verwaltet, einem Stiefsohn von Dieter Oesterlen.
Altkanzler Schröder (75) hatte vor zwei Jahren die Idee, der Marktkirche ein Reformationsfenster zu stiften. Anlass waren die Feiern zum 500. Reformationsjubiläum. Zur Finanzierung will Schröder Vortragshonorare von Verbänden und Unternehmen in Deutschland weitergeben. Die Kosten für Material, Herstellung und Einbau werden auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die im 14. Jahrhundert aus Backstein errichtete Marktkirche ist die größte und zentralste Kirche in Hannover. Sie gilt als ein Wahrzeichen der Stadt.
Clemens Sels Museum beleuchtet Geschichte der Süßwaren

epd-West/Hans-Jürgen Bauer
Neuss (epd). Das Highlight ist zweifellos die mehrere Meter lange Rekonstruktion eines "Zuckerbanketts" aus dem Jahre 1585: Zwei Burganlagen samt Park, Bäumen, bunten Pfauen und anderen Tieren, großen Kerzenleuchtern, Tellern, Bestecken, Tischdekoration und weiteren Utensilien - alles aus geblasenem und modelliertem Zucker. Das Neusser Clemens Sels Museum präsentiert das Werk der Konditorenkunst in einer Ausstellung. Die Nachbildung hat der Düsseldorfer Zuckerbäcker Georg Maushagen angefertigt.
Das Original war vor über 400 Jahren zur Hochzeit von Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg (1562-1609) mit der Markgräfin Jacobe von Baden (1558-1597) aus dem damals sündhaft teuren Rohstoff Zucker erstellt worden, wie Kurator Carl Pause erläutert. Süßes habe früher nie in großen Mengen zur Verfügung gestanden und sei bis ins 19. Jahrhundert vor allem den Reichen, zumeist Adligen vorbehalten gewesen.
Von teurem Zuckerwerk und Schokolade als Medizin
"Süßkram - Naschen in Neuss" heißt die große Themenschau, die das Clemens Sels Museum bis 13. Oktober zeigt. Die weit über 300 Exponate sind laut Carl Pause ein "süßer Spiegel der Kulturgeschichte". Nach Angaben des Kurators waren es die Römer, die vor etwa 2.000 Jahren den Obstanbau bekanntmachten. Äpfel, Pflaumen oder Trauben konnten zu Gelee gekocht und zum Süßen von Speisen verwendet werden.
Im Hochmittelalter dann brachten Kaufleute Rohrzucker aus dem Orient nach Europa. Zucker war zu dieser Zeit ein Luxusgut. Die, die sich diesen Luxus leisten konnten, aßen kandierte Früchte und Nüsse als "Confect" nach einem meist opulenten Festmahl. Auch der Kakao kam durch Entdeckungsreisen der Seefahrer zunächst nach Portugal und dann in andere europäische Länder. Es waren im 19. Jahrhundert vor allem die Apotheker, die Kakao und Schokolade zubereiteten, die auch als Medizin genutzt wurde.
Einem Niederländer namens van Houten gelang es später, die Kakaobutter zu separieren, so dass man Kakao-Pulver herstellen konnte, das nicht mehr so fetthaltig war. In den 1880er Jahren kamen dann erstmals Schokoladentafeln und Schoko-Formen auf den Markt, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind. Künstlerisch gestaltete Dosen für das Kakao-Pulver sind ebenso ausgestellt wie zahlreiche unterschiedliche Schokoladen-Verpackungen und Pralinen-Dosen.
Namen wie die 1860 in Neuss gegründete Firma Novesia, zu deren bekanntesten Produkten die "Novesia Goldnuss-Schokolade" mit garantiert 27 ganzen Haselnüssen gehörte, aber auch die Kölner Firma Stollwerck und andere Hersteller sind in der Schau vertreten. Dazu zählt auch die Firma Münster's, die seit 1931 Kaubonbons mit dem Namen Maoam produziert.
Die Römer bucken flache Kuchen
Automaten, Vitrinen, ganze Theken alter Süßwarengeschäfte, alte Werbefilme, Plakate, Gussformen, auch Porzellanfiguren oder alte Holzmodelle zum Backen wurden für die Ausstellung zusammengetragen. So erfährt der Besucher, dass die Römer in ihrem Neusser Lager für religiöse Feste einen flachen Kuchen mit geriebenem Käse herstellten, der Gottheiten zeigte. Die runden, etwa einen Zentimeter dicken Fladen der Römer hat das Museum mit einer nachgefertigten Form durch einen Neusser Bäcker und Konditor nachbacken lassen. Modelle für süße Opferbrote aus dem 15. Jahrhundert zeigen eine Abendmahlszene oder das Gesicht Christi.
Auch über die Geschichte der Bonbons informiert die Schau. Im Jahr 1572 bot demnach der französische König Heinrich IV. die kleinen Köstlichkeiten zu seiner Hochzeit den Gästen an, wie Pause erzählt. Die Kinder riefen daraufhin begeistert "Bon! Bon!", was auf deutsch "Gut! Gut!" bedeutet. In Neuss gibt es nun für die Besucherinnen und Besucher eigens für die Ausstellung gefertigte Lutscher mit dem Logo des Museums.
Judith Burger erhält Gustav-Heinemann-Friedenspreis
Düsseldorf (epd). Die Leipziger Autorin Judith Burger bekommt den diesjährigen Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Die in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) geborene Schriftstellerin erhält den mit 7.500 Euro dotierten Preis für ihr Buch "Gertrude grenzenlos", wie NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am 23. Juli in Düsseldorf mitteilte. Die Geschichte über die ungewöhnlichen Freundschaft zweier Mädchen in der damaligen DDR überzeuge durch eine literarisch gelungene Erzählweise, die ohne Pathos auskomme, sagte Pfeiffer-Poensgen. "Gleichwohl verströmt das Buch auch bei der Schilderung schwieriger Lebenssituationen einen ansteckenden Optimismus."
Die 1972 in Halberstadt geborene Judith Burger studierte Kultur- und Theaterwissenschaften. Seit über zwanzig Jahren lebt sie in Leipzig, seit 2012 ist sie redaktionelle Mitarbeiterin bei MDR Kultur. "Gertrude grenzenlos" ist ihr Debütroman.
Mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher erinnert die Landesregierung an das friedenspolitische Engagement des früheren Bundespräsidenten. Der Preis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher und wird in diesem Jahr zum 36. Mal vergeben. Preisverleihung ist am 3. Dezember im Haus der Geschichte in Bonn.
Vor 100 Jahren wurde der Schriftsteller Primo Levi geboren
Er war Zeuge und Chronist der abgründigen Unmenschlichkeit: Der Turiner Chemiker Primo Levi überlebte als einer von wenigen das Konzentrationslager Auschwitz. Nach der Befreiung beschrieb er das Grauen mit dem Blick des Naturwissenschaftlers. Vor 100 Jahren wurde er geboren.Rom (epd). Rund 30 Jahre nach seinem Tod gilt der italienische Schriftsteller Primo Levi (1919-1987) mit seinen Schilderungen über das Leben im Konzentrationslager Auschwitz noch immer als unermüdlicher Mahner, engagiert gegen Faschismus und Nationalsozialismus. Sein autobiografischer Bericht "Ist das ein Mensch?" zählt heute zur Weltliteratur. Er warnte bereits in den 70er Jahren vor einem Wiederaufleben des Faschismus in Italien als "Anerkennung des Privilegs der Ungleichheit". Vor 100 Jahren, am 31. Juli 1919, kam er in Turin zur Welt.
Im Konzentrationslager überlebte der "Schriftsteller wider Willen", weil die Kenntnisse des Chemikers in der Chemie-Fabrik der I.G. Farben nützlich waren. Dort musste er Zwangsarbeit leisten. Bereits unmittelbar nach der Befreiung im Januar 1945 begann Levi, seine Erfahrungen aufzuschreiben. Sein erstes Buch "Ist das ein Mensch?" erschien zunächst in einem kleinen Verlag und stieß trotz positiver Kritiken auf wenig Resonanz.
Ohne Pathos, mit Genauigkeit
Levi schildert darin die - für ihn bis dahin unvorstellbare - systematische Entwürdigung der Häftlinge: durch Kälte, Hunger, Entzug von Schlaf und Hygiene, Sklavenarbeit, schwerste körperliche Leiden. Das alles beschreibt er ohne Pathos, aber um äußerste Genauigkeit bemüht.
Sein persönliches Schicksal sei weit davon entfernt, typisch für die Gefangenen von Auschwitz zu sein, bekannte Levi nüchtern. "Der typische Gefangene starb im Lauf weniger Wochen oder Monate an Erschöpfung oder an durch Hunger und Vitaminmangel verursachten Krankheiten", stellte er Ende der 70er Jahre in einem Brief fest. "Jeder von uns Überlebenden ist ein vom Glück Begünstigter."
Als Partisane wird der 24-Jährige 1943 im norditalienischen Aostatal festgenommen. Faschistische Milizen bringen ihn in ein Gefangenenlager, wo er sich als Jude bekennt, in der Hoffnung auf einen milderen Umgang. Anfang 1944 wird er nach Auschwitz deportiert.
Bei seiner Festnahme besaß Levi nach eigenem Bekunden "wenig Einsicht, keine Erfahrung". Hinzugekommen sei ein "ausgeprägter Hang, bestärkt durch die Absonderung, zu der mich seit nunmehr vier Jahren die Rassengesetze verurteilt hatten, mich in meine eigene, recht wenig reale Welt zu verschließen."
Als ihm in Auschwitz jegliche Habe bis hin zu Kleidung und Schuhen genommen wird, fragt Levi mit kahl rasiertem Schädel, ob ihm wenigstens die Zahnbürste wiedergegeben würde. Daraufhin lacht sein Gegenüber nicht einmal, wie er später berichtet. Wenige Tage später habe er über seine eigene Naivität gestaunt. Nach nur einer Woche sei sein "Reinigungsinstinkt" vollständig verschwunden, heißt es in "Ist das ein Mensch?". Auf die Frage, warum ihm selbst ein vor dem Fenster hängender Eiszapfen entrissen wird, mit dem er den heftigen Durst stillen wollte, heißt es nur: "Hier ist kein Warum".
Tod im Treppenhaus
Akribisch genau schildert Levi die systematische Entrechtung und Erniedrigung im Lager. Er beschreibt auch den Schwarzmarkt, der Teil der Lagerstruktur ist und bei der selbst Löffel begehrtes Diebesgut werden. Nach der Befreiung gelangt er erst nach einer monatelangen Irrfahrt nach Turin zurück. Diese Zeit beschreibt er in "Die Atempause", rund 15 Jahre nach "Ist das ein Mensch".
Während er seine Erlebnisse notiert, um sie für die Nachwelt in Erinnerung zu halten und die Motive der Täter zu ergründen, führt Levi gleichzeitig das Leben eines Angestellten in einer Chemiefabrik. Gemeinsam mit seiner Frau lebt er in Turin in dem Haus am Corso Re Umberto 75, in dem er geboren wurde. Erst 1977 zieht sich der Schriftsteller aus dem Berufsleben zurück, er war zuletzt Direktor einer Lackfabrik.
Mittlerweile weltberühmt lehnt er kurz vor seinem Tod das Angebot ab, den renommierten Turiner Einaudi-Verlag zu leiten. Am 11. April 1987 stürzt er im Treppenhaus vor seiner Wohnung in den Tod. Ob es Suizid war oder Folge seiner häufigen Schwindelanfälle ist bis heute Gegenstand von Mutmaßungen, meist wird von Suizid ausgegangen.
Ein Böllerschuss zur Mittagszeit

epd-bild/Dieter Sell
Bremen (epd). Sie schmücken Böden und Fassaden, stehen in Gärten und Parks und können sogar auf Reisen mitgenommen werden: Bremen ist voller Sonnenuhren. "Es ist die Stadt mit der höchsten Sonnenuhren-Dichte in Deutschland", sagt Dieter Vornholz, Physiker und langjähriger Leiter des Planetariums der Hansestadt. Von wegen wolkiger Norden - der Experte kennt mindestens 125 ortsfeste Sonnenuhren, die über die ganze Stadt verteilt sind. "Dazu kommt eine große Zahl von Reisesonnenuhren in Museen und in Privatbesitz", ergänzt der 73-Jährige.
Ein besonders skurriles Exemplar ist die "Mittagskanone". Sie gehört zu den Prunkstücken unter den Sonnenuhren im Schaumagazin des Bremer Focke-Museums und unterscheidet sich in einer entscheidenden Eigenschaft von den anderen: Man kann nicht von einem stummen Zeugen der Zeit ausgehen. "Im Gegenteil", sagt Vornholz. "Die Sonnenuhr hat eigentlich nur die Funktion, den Mittag mit einem Böllerschuss zu melden."
Schon in der Bibel erwähnt
Das Wesentliche an der Konstruktion aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine Linse, die das Licht wie ein Brennglas auf den Zünder einer kleinen Kanone bündelt. Richtig ausgerichtet, löst das Gerät dann mittags den Schuss aus. "Es ist nicht ganz klar, ob diese Sonnenuhren mehr zur Zierde und zur Belustigung eingesetzt wurden, oder dazu, den Arbeitenden auf dem Feld die Mittagspause anzuzeigen", erklärt Vornholz.
Die Sonnenuhr dürfte wohl zu den ältesten Erfindungen der Menschheit zählen. Schon in der Antike wurde mit ihrer Hilfe der Tag vermessen. Selbst in der Bibel wird sie erwähnt, denn im Alten Testament wird beim Propheten Jesaja im 38. Kapitel, Vers 8, ein Schatten beschrieben, der nach Gottes Wille - ein Wunder - rückwärts läuft: "Siehe, ich will den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas zehn Striche zurückziehen, über die er gelaufen ist."
Wie kompliziert die Wissenschaft der Sonnenuhren ist, wird schnell deutlich, wenn Dieter Vornholz einige bestimmende Elemente beschreibt. Der Physiker spricht von Hyperbeln, Datumslinien, temporalen Stunden, Zeitgleichung, Tagbögen, äquidistanter Einteilung, Polhöhe, Vertikal- und Horizontaluhren.
Eines wird schnell klar: Eine für Bremen gebaute stationäre Uhr funktioniert nur für Bremen. Denn der Winkel des Schattenstabes - die Fachleute sagen "Gnomon" - muss je nach geografischer Breite ausgerichtet werden. "Hier sind das 53 Grad", erläutert Vornholz. Auf diese Weise zeigen Sonnenuhren Grad für Grad und Ort für Ort die richtige Zeit an.
Warum gibt es aber nun gerade in Bremen so viele Sonnenuhren? Vornholz erklärt das mit den seefahrerischen Traditionen in der alten Hansestadt: "Die Kapitäne mussten immer die Zeit wissen. Außerdem gab es in Bremen eine ganze Reihe von Bildhauern, die Sonnenuhren gestaltet haben. Und schließlich sind im Krieg weniger Häuser mit Sonnenuhren an der Fassade zerstört worden als zum Beispiel in Berlin."
Zeit und Datum
Als wahres Meisterstück beschreibt der Sonnenuhren-Liebhaber ein Exemplar, das an der Südfassade des Bremer St.-Petri-Domes hängt und aus dem Jahr 1619 stammt. "Die Uhr zeigt drei verschiedene Liniennetze - eine Rarität", schwärmt Vornholz. So dokumentiert sie nicht nur Stunden, sondern auch das Datum in Form der Anzahl der lichten Stunden des Tages und die richtige Zeit für Gebete.
Als im 13. Jahrhundert die ersten mechanischen Zeitmesser im heutigen Sinne aufkamen, war die Ära der Sonnenuhren noch längst nicht vorbei. Denn Taschenuhren waren zunächst teuer und störanfällig. "Klapp- und Tischsonnenuhren waren deshalb noch lange als Zeitmesser für den Alltag unverzichtbar - auch, um mechanische Uhren richtig zu stellen", sagt Vornholz.
Heute werden Sonnenuhren vor allem zum Schmuck gebaut. Goldschmied Malte Groh aus Wildeshausen bei Bremen fertigt gebrauchsfähige tragbare Schmuckstücke und dekorative Sonnenuhren für Gärten und Hauswände. "Es ist auch die Faszination an den Gestirnen, die sich in den Sonnenuhren widerspiegelt", begründet der Kunsthandwerker die anhaltende Nachfrage.
Früher hätten die Astronomen mit ihren Sonnenuhren die Regie über die Zeit geführt, sagt Vornholz, der sich im Bremer Olbers-Planetarium engagiert. Heute definierten Physiker mit ihrer Atomuhr in Braunschweig die Zeit. Und trotzdem werde die Bedeutung der Gestirne und ihr Einfluss auf das Leben auf der Erde bleiben, glaubt der Experte: "Trotz aller Hochtechnologie zwingt uns die Sonne mit ihrem Lauf ihre Einheit der Zeit auf."
Nur ein Drittel der Senioren fühlt sich im Internet sicher

epd-bild / Jens Schulze
Gütersloh (epd). Nur jeder dritte der über 70-Jährigen (36 Prozent) fühlt sich laut einer aktuellen Studie im Umgang mit dem Internet sicher. Von den 60- bis 69-Jährigen sind es 41 Prozent, wie die Bertelsmann Stiftung bei der Vorstellung der Studie am 24. Juli in Gütersloh erklärte. Die ältere Generation habe bei den digitalen Kompetenzen einen großen Bedarf an Unterstützung, mahnte die Stiftung. Bei den 14- bis 29-Jährigen gaben fast 80 Prozent an, sich im Internet sicher zu fühlen. Insgesamt sehen sich 63 Prozent der Befragten gut gewappnet für das Internet.
Bei der Selbsteinschätzung der eigenen Kenntnisse im Bereich digitaler Technologien, Anwendungen und Gefahren kennt sich der Studie zufolge ebenfalls lediglich rund jeder dritte der über 70-Jährigen gut aus (36 Prozent). Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 89 Prozent, bei den 60- bis 69-Jährigen 50 Prozent. Insgesamt erklärten 64 Prozent der Befragten, sich im digitalen Bereich gut auszukennen.
"Silver Surfer"
Digitale Angebote böten besonders der Generation "Silver Surfer" große Chancen, erklärte die Stiftung. So könnten sie dazu beitragen, dass Ältere so lange wie möglich selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben können, auch auf dem Land. Die Senioren könnten die notwendigen Dinge des täglichen Lebens online bestellen, wenn sie nicht mehr mobil seien. Auch könnten sie mit der Familie und Freunden per Smartphone kommunizieren. Wichtige Voraussetzung dafür sei, souverän mit digitalen Angeboten umgehen zu können.
Auch die ältere Generation benötige digitale Kompetenzen, um sich im Alltag selbstständig zurechtzufinden und möglichst lange autonom in der vertrauten Umgebung zu leben, erklärte Brigitte Mohn vom Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Ältere benötigten niedrigschwellige Angebote, um digitale Kompetenz zu erwerben. Hier seien auch die Kommunen gefordert, Assistenzinfrastrukturen aufzubauen und zu unterstützen.
Aufs Internet angewiesen
Senioren seien bei der Vermittlung von digitaler Kompetenz auch als Akteure wichtig, heißt es in der Studie. Sie könnten aufgrund ihrer Lebenserfahrung wichtige Kompetenzen vermitteln, an Innovationsprojekten teilnehmen oder helfen, durch Open Data den gesellschaftlich nutzbaren Datenfundus zu erweitern.
Insgesamt gab ein Großteil der Bevölkerung an, auf das Internet angewiesen zu sein. 76 Prozent der Befragten erklärten, dass sie bei der Suche nach Informationen stark darauf angewiesen sind. 68 Prozent halten das Internet für die Kommunikation mit Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern für wichtig. Bei behördlichen Angeboten erklärten hingegen nur 27 Prozent, auf digitale Kanäle angewiesen zu sein.
Die Studie "Digital souverän? Kompetenzen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter" wurde im Auftrag der Bertelsmann Stiftung vom Institut für Innovation und Technik (iit) erstellt. Für die Studie wurden zwischen dem 26. April und dem 3. Mai rund 1.000 Menschen ab 14 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland telefonisch befragt.
Robert-Geisendörfer-Sonderpreis für Funk-Programmgeschäftsführer
Frankfurt a.M. (epd). Mit dem Robert-Geisendörfer-Sonderpreis wird in diesem Jahr das gemeinsame Online-Angebot von ARD und ZDF, Funk, ausgezeichnet. Die Ehrung geht an Florian Hager, Programmgeschäftsführer von Funk, und seine Stellvertreterin Sophie Burkhardt, wie das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 25. Juli in Frankfurt am Main mitteilte. Gewürdigt werden solle insbesondere die Leistung der beiden für die Konzeption und den Aufbau des gemeinsamen Content-Netzwerkes.
Sophie Burkhardt und Florian Hager hätten beherzt die Chance ergriffen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf neue Weise für die Jugend anschlussfähig zu machen, heißt es in der Begründung der Jury, die von dem hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung geleitet wird. Funk habe sich der Digitalisierung konsequent gestellt und es geschafft, prominent auf allen relevanten Onlineplattformen vertreten zu sein.
Mit Geschick und Überzeugungskraft hätten Burkhardt und Hager gemeinsam mit ihrem Team trotz mancher Widerstände die Landesrundfunkanstalten und das ZDF als gleichberechtigte Partner bei Funk eingebunden, erklärte die Jury. Mit Experimentierfreude und frischem Mut habe Funk inzwischen mehr als 100 neue und sehenswerte Formate hervorgebracht. Damit leiste das junge Angebot von ARD und ZDF einen herausragenden Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs und trage zur Zukunftsfähigkeit und Plausibilität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überzeugend bei.
Verleihung im September in Berlin
Der Robert Geisendörfer Preis wird seit 1983 jährlich im Gedenken an den christlichen Publizisten Robert Geisendörfer (1910-1976) verliehen. Ausgezeichnet werden Hörfunk- und Fernsehsendungen aus allen Programmsparten, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen. Mit dem Sonderpreis wird jeweils eine exemplarische publizistische oder künstlerische Leistung gewürdigt.
Die Verleihung des Medienpreises der evangelischen Kirche findet am 26. September in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) in Berlin statt. Dann werden auch die Gewinner der weiteren Preise bekanntgegeben.
Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), dem die organisatorische Betreuung des Preises obliegt, ist die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Zum GEP gehört unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd).
Sprechendes Geschlechtsteil in der Klosterbibliothek
Mainz (epd). Mittelalter-Spezialisten aus Deutschland und Österreich sind in der Stiftsbibliothek Melk (Niederösterreich) auf einen schmalen Streifen Pergament gestoßen, der es bei genauerer Untersuchung in sich hat. Der sogenannte "Rosendorn" berichte davon, wie sich eine Jungfrau mit ihrer sprechenden Vulva darüber entzweit, wer von ihnen bei Männern den Vorzug genießt, teilte die Akademie der Wissenschaften und der Literatur am 24. Juli in Mainz mit.
Bislang habe man angenommen, dass ein solch freier Umgang mit der eigenen Sexualität im deutschsprachigen Raum erst zum Ende des Mittelalters aufgekommen ist, also etwa in der städtischen Kultur des 15. Jahrhunderts. Der Melker Fund sei jedoch bereits um 1300 getextet worden und revidiere damit die bisherige Forschung.
Nach den Angaben der Mainzer Akademie wurde das Fragment von Christine Glaßner von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien entdeckt. Identifiziert wurde es von Nathanael Busch von der Universität Siegen. Beschrieben wird es im Rahmen des Akademievorhabens "Handschriftencensus" der Mainzer Akademie, das an der Philipps-Universität-Marburg angesiedelt ist.
Entwicklung
Tee gegen die Armut

epd-bild/Opmeer Reports
Kigali (epd). Plick, plick, plick - mit bloßen Fingern knipst Everena Mukazigira die frischen Triebe der Teepflanzen ab. Zusammen mit ihrem Mann arbeitet sie sich im kühlen Wind durch einen halben Hektar Teesträucher an einem smaragdgrünen Berghang in 2.300 Metern Höhe im Westen Ruandas. Im Tee-Anbau sehen sie Zukunft, auch für einige ihrer neun Kinder. 25 Jahre nach dem Völkermord an den Tutsi schauen sie nach vorn, unterstützt durch die internationale Kreditgenossenschaft Oikocredit.
Drei Kinder hat das Kleinbauernpaar auf Universitäten geschickt. "Ohne den Tee hätten wir das nicht gekonnt", sagt der Vater Rawbeni Rubyogo. Im Monat verdienen sie mit dem Tee umgerechnet 60 Euro, das Pro-Kopf-Einkommen in Ruanda liegt bei zwei Euro am Tag. Die Wirtschaft wächst stetig, im vergangenen Jahr um 8,6 Prozent.
Die Eheleute sind Hutu. Die Karongi-Teefabrik, die sie beliefern, gehört Tutsi. 25 Jahre nach dem Völkermord gibt es die Unterscheidung in die beiden Volksgruppen offiziell nicht mehr. Teebauer Rubyogo sagt, auch seine Hutu-Familie sei in den Bürgerkriegswirren 1994 in Gefahr gewesen. "Wir mussten rennen und fliehen", sagt er über die Zeit, als Hutu-Extremisten Hunderttausende Tutsi und gemäßigte Hutu ermordeten und die Tutsi-Rebellenarmee des heutigen Präsidenten Paul Kagame vorrückte.
Gräueltaten in idyllischer Landschaft
Unten im Tal, in der Stadt Karongi, die früher Kibuye hieß, kündet eine neu errichtete Gedenkstätte von den damaligen Gräueltaten inmitten der idyllischen Landschaft: Auf dem Fußballplatz Gatwara wurden im April 1994 etwa 15.000 Tutsi zusammengepfercht, ohne Essen, ohne Wasser. Nach und nach wurden die Männer, Frauen und Kinder erschossen, mit Granaten in die Luft gesprengt oder mit Macheten niedergemetzelt. Das Tutsi-Mädchen Elyse war erst acht Jahre alt, als sie starb. Ein Foto im Mausoleum zeigt sie mit verschmitztem Lächeln.
Die Teebäuerin Agnès Mukamumana (54) denkt jeden Tag an ihre Lieben. Sie ist Hutu und floh 1994 nach dem Völkermord in den Kongo. Denn Hutu-Extremisten warnten damals vor Rache-Akten der Tutsi. Im Kongo starben ihr Mann und ihre vier Kinder. "Durch Hunger, Krankheit und Krieg", sagt sie und wendet den Blick ab. Sie ist froh über den regelmäßigen Verdienst von ihren Teepflanzen. Sonntags besucht sie den Gottesdienst in der evangelischen Kirche weiter oben auf dem Hang: "Wir sprechen viel über Versöhnung", sagt sie. "Das Verhältnis zwischen Hutu und Tutsi ist kein Problem mehr."
Bis 13 Uhr müssen die Teeblätter an der Sammelstelle sein, von wo die Kooperative der Teebauern sie mit Lastwagen zur Fabrik transportiert. Teepflücken will gelernt sein, und dafür finanziert Oikocredit Kurse in der Kooperative. In jungen, gesunden, hellgrünen Trieben steckt das beste Tee-Aroma: Zwei Blätter und eine Blattknospe will die Karongi-Teefabrik haben, die Qualität wird kontrolliert und entscheidet mit über den Kilopreis.
Die Regierung schreibe vor, dass er 40 Prozent des Erlöses an die Kleinbauern weitergeben müsse, sagt David Mutangana (45), Leiter der Teefabrik, die dem Unternehmen seiner Familie gehört. Zurzeit erzielt sein Tee auf den wöchentlichen Auktionen im kenianischen Mombasa einen Durchschnittspreis von drei US-Dollar je Kilo.
Exporte in den Nahen Osten
Vor allem im Nahen und Mittleren Osten sowie in Pakistan ist der kräftige ruandische Tee beliebt. Die Fabrik verarbeitet nicht nur Tee von rund 2.000 Kleinbauern, sondern hat auch selbst rund 200 Beschäftigte auf einer eigenen Plantage, die laut Mutangana den gesetzlichen Mindestlohn von rund einem Euro pro Tag erhalten.
In der Fabrikhalle duftet es nach Heu und ganz leicht nach Tee. Die frisch gepflückten grünen Blätter werden 8 bis 16 Stunden lang getrocknet und belüftet, am nächsten Tag kleingeschnitten, bei 26 bis 28 Grad geschüttelt und umgewälzt. In wenigen Stunden ist ein Teepulver fertig - ideal, um in Teebeutel gemischt zu werden.
Die Kooperative lobt, dass die Fabrik den Kleinbauern als Starthilfe zwei Jahre lang höhere Preise gezahlt hat, in Aufforstung und Erosionsschutz investiert. Die Einhaltung der sozialen Standards wird laut Oikocredit zwei Mal im Jahr vor Ort überprüft: Aktueller Wunsch ist, dass die Teefabrik mehr Waschräume für die Teepflückerinnen baut.
Sein Vater, der erfolgreiche Self-Made Unternehmer Jean-Baptiste Mutangana (80), stieg vor Jahren ins Teegeschäft ein, um Überlebenden des Völkermords eine Perspektive zu bieten. Die Tutsi-Familie Mutangana selbst hatte 1994 im Nachbarland Burundi im Exil überlebt. Doch die in der Heimat gebliebenen Angehörigen wurden alle getötet. Heute ist für den Senior-Chef, der mit seiner aufrechten Haltung Würde ausstrahlt, nicht das Trennende wichtig: "Wir stammen alle von denselben Vorfahren ab."
Ein Jahr Ebola im Kongo: Gewalt als Nährboden für die Epidemie
Vor einem Jahr gab die kongolesische Regierung den Ausbruch von Ebola im umkämpften Osten des Landes bekannt. Mit mehr als 1.700 Toten ist es eine der schwersten Ebola-Epidemien in der Geschichte. Gestoppt ist sie noch längst nicht.Frankfurt a.M., Goma (epd). In Zeiten von Ebola trifft auch die Kirche Vorsichtsmaßnahmen. Vor der Messe ist Händewaschen Pflicht. Dafür sollen Gläubige die bereitgestellten Becken mit Chlorwasser verwenden, verfügte die katholischen Diözese Goma Mitte Juli. Zudem wird jetzt im Gottesdienst darauf verzichtet, die Hand zum Friedensgruß zu reichen.
Nur wenige Tage vor dem Schreiben war in der ostkongolesischen Metropole Goma mit rund einer Million Einwohnern der erste Ebola-Fall aufgetaucht. Nach Goma hatte die Krankheit ein Pfarrer gebracht, der in der weiter nördlich gelegenen Region Butembo, dem Krisenherd der Epidemie, seine Hände auf mehrere Kranke gelegt hatte. Obwohl er bereits Symptome entwickelte, stieg er in einen Bus und fuhr nach Goma. Wenig später starb er. Auf der Fahrt wurden die Passagiere zwar an drei Checkpoints kontrolliert, mit denen eine Ausbreitung der Krankheit verhindert werden soll. Die Erkrankung des Mannes war aber offenbar nicht erkennbar - und er soll bei jeder Kontrolle einen anderen Namen genannt haben.
"Goma könnte Wendepunkt sein"
Der Fall in Goma gilt als einschneidendes Ereignis, seit die kongolesische Regierung am 1. August 2018 den Ausbruch von Ebola verkündete. Seither wurden mehr als 2.600 Fälle bekannt. Rund 1.750 Menschen sind bislang gestorben. Während die meisten Erkrankungen zunächst in abgelegenen, ländlichen Gebieten auftraten, werden nun auch mehr Fälle von der Grenze mit Uganda und dem Südsudan gemeldet.
"Die Feststellung des Falls in Goma könnte möglicherweise ein Wendepunkt in der Epidemie sein", sagte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Denn die Stadt an der Grenze zu Ruanda sei ein Tor zur Region und zur Welt. Von Goma führen Straßen, Fährverbindungen und Flüge in alle Richtungen. Deshalb befürchten Experten, die Epidemie könnte sich schneller und weiter ausbreiten.
Die WHO rief inzwischen einen internationalen Gesundheitsnotstand aus. Damit erkennt sie die Schwere der Krise und ermöglicht unter anderem einen schnelleren Einsatz von Finanzmitteln. Die Epidemie ist bereits der zehnte Ebola-Ausbruch im Kongo. Anders als in der Vergangenheit gelingt es jedoch bisher nicht, die Verbreitung des Virus unter Kontrolle zu bekommen. Laut WHO sind dafür die starken Wanderbewegungen der Menschen, schlechte Ausrüstung der Gesundheitszentren und vor allem Misstrauen in der Bevölkerung und die anhaltende Gewalt in der Region verantwortlich.
Kämpfe von Milizen und Banden
Verschiedene Milizen und Banden kämpfen im rohstoffreichen Ostkongo um Einfluss und Pfründe. Kranke wagen sich so oft nicht zum Arzt, Helfern wird der Zugang in Dörfer verwehrt. Anfang des Jahres musste die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" die Arbeit in mehreren Gebieten einstellen, weil es zu Angriffen auf Ebola-Behandlungszentren kam. Seit Januar registrierten die Behörden rund 200 Attacken auf Gesundheitseinrichtungen und medizinisches Personal.
Auch Skepsis und Widerstand in der Bevölkerung erschweren den Einsatz der Helfer und verhindern möglicherweise lebensrettende Impfungen. Viele misstrauen der Impfung. Manche meinen gar, Ebola sei eine Erfindung der Regierung, um sich Hilfsgelder zu sichern.
Dies führe zu einem großen Widerspruch, sagte Joanna Liu, internationale Präsidentin von "Ärzte ohne Grenzen": Auf der einen Seite stünden alle nötigen Mittel, wie zum Beispiel ein effektiver Impfstoff, zur Verfügung. "Auf der anderen Seite sterben die Menschen zuhause, weil sie den Ebola-Bekämpfungsstrategien misstrauen und nicht in die Behandlungszentren kommen."
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, ist dennoch zuversichtlich, dass es noch gelingt, die Epidemie in den Griff zu bekommen. "Wir haben sehr viel dazugelernt bei dem schweren Ausbruch in Westafrika", sagte Wieler. Zwischen 2013 und 2016 erkrankten dort mehr als 28.000 Menschen, von denen rund 11.300 starben. Die Reaktion der Behörden und der internationalen Gemeinschaft sei jetzt "schneller und überzeugter".
"Brot für die Welt" fordert Rechtsstatus für Klimaflüchtlinge
Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme - der Klimawandel macht sich vielerorts mit Wetterextremen bemerkbar. Wer bei solchen Katastrophen in ein anderes Land flieht, braucht besseren Schutz, fordert "Brot für die Welt".Berlin (epd). Angesichts zunehmender Umweltkatastrophen durch den Klimawandel fordert "Brot für die Welt" einen internationalen Rechtsstatus für Klimaflüchtlinge. Ein solcher Schritt sei mehr als dringend. "Die Zahl der Klimaflüchtlinge wird alles in den Schatten stellen, was wir bislang hatten", sagte die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks, Cornelia Füllkrug-Weitzel, am 25. Juli bei der Vorstellung der Jahresbilanz in Berlin.
Der Klimawandel sei neben bewaffneten Konflikten die Hauptursache für Hunger. Zugleich fresse er die Entwicklungsfortschritte auf, die in einigen Regionen erreicht worden seien. Von der Bundesregierung forderte sie ein Klimaschutz-Sofortprogramm und eine schnelle Senkung der CO2-Emissionen.
Jüngst hatte die Kapitänin des Seenotrettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung gefordert, dass Deutschland auch Klimaflüchtlinge aufnehmen müsse. Sie argumentierte: "In der Debatte soll immer unterschieden werden zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten, aber wir kommen jetzt zu einem Punkt, wo es 'forced migration' gibt, also eine durch äußere Umstände wie Klima erzwungene Migration."
Initiative von Norwegen und Schweiz
Füllkrug-Weitzel verwies auf die 2012 von Norwegen und der Schweiz gestartete "Nansen Initiative", deren Nachfolgeorganisation "Plattform zur Vertreibung durch Katastrophen" über das Thema diskutiert. Denn Klimaflüchtlinge fallen nicht unter den Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention. Mehr als hundert Staaten - darunter auch Deutschland - haben sich daher dafür ausgesprochen, deren Rechte zu stärken. Es geht darum, Schutz- und Hilfsmechanismen zu schaffen für Menschen, die wegen Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürmen, des Anstiegs des Meeresspiegels oder auch Erdbeben und Tsunamis ihre Heimat verlassen und in ein anderes Land fliehen müssen.
"Brot für die Welt" beobachtet in vielen der 90 Länder, in denen Partnerorganisationen engagiert sind, einen schleichenden Prozess der Verschlechterung durch den Klimawandel. Dürren oder Überflutungen nähmen immer weiter zu. Es sei ein dramatischer Prozess, der in Deutschland aber nicht wahrgenommen werde, kritisierte Füllkrug-Weitzel: "Die Folgen des Klimawandels treffen vor allem die Menschen, die den Klimawandel am wenigsten verursacht haben, und sie treffen sie in ihrer Existenz." Internationale Unterstützung von den Verursachern des Klimawandels bekämen sie aber nur ungenügend. Die reichen Länder zeigten "wenig Intention, diejenigen Menschen wie Regierungen, denen sie unwiederbringliche Schäden und Verluste beigefügt haben, zu entschädigen".
64 Millionen Euro Spenden und Kollekten
Zugleich würden Entwicklungsgelder verwendet für eine Art "Flüchtlingsabwehrarbeit", für Pakte, die mit Anrainerstaaten auf Fluchtrouten geschlossen würden und die unter anderem auch die Aufrüstung von Polizei und Grenzschutz vorsähen. Als Beispiel nannte sie den Niger. Das bitterarme Land liegt auf einer stark genutzten Migrationsroute und ist daher ein wichtiger Partner der Europäischen Union in der Flüchtlings- und Migrationspolitik.
Laut dem Jahresbericht steigerte "Brot für die Welt" 2018 seine Einnahmen aus Spenden und Kollekten um 1,8 Millionen Euro oder 2,9 Prozent auf 63,6 Millionen Euro. Das sei zum Jubiläum das viertbeste Spendenergebnis seit der Gründung des evangelischen Hilfswerks vor 60 Jahren, hieß es. Ferner erhielt die Hilfsorganisation der evangelischen Landes- und Freikirchen unter anderem Mittel des kirchlichen Entwicklungsdiensts (55,7 Millionen Euro) sowie staatliche Mittel vom Entwicklungsministerium (168,3 Millionen Euro). Insgesamt hatte "Brot für die Welt" 307 Millionen Euro zur Verfügung - knapp neun Prozent mehr als ein Jahr zuvor (282 Millionen). Im vergangenen Jahr wurden mehr als 1.500 Projekte gefördert.
Nach Foltervorwürfen: KfW stoppt Zahlungen an WWF-Wildhüter im Kongo
Deutschland setzt Zahlungen an den WWF für ein Projekt im Kongo vorübergehend aus. Grund sind schwere Vorwürfe gegen Wildhüter: Sie hätten Menschen im Gebiet eines Nationalparks misshandelt, heißt es.Frankfurt a.M./Berlin (epd). Nach Misshandlungsvorwürfen gegen Wildhüter im Kongo hat die KfW Entwicklungsbank Zahlungen an die Umweltstiftung WWF für die Arbeit in Nationalparks ausgesetzt. "Die KfW nimmt die schweren Menschenrechtsvorwürfe sehr ernst und kümmert sich um die Aufklärung", teilte die staatliche Bank am 25. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Die Überweisungen seien in Absprache mit dem Entwicklungsministerium gestoppt worden. "Eine mögliche Wiederaufnahme der Zahlungen wird im Einzelfall geprüft und abgestimmt."
Die britische Stiftung Rainforest Foundation und das Online-Magazin "Buzzfeed" hatten berichtet, vom WWF bezahlte Wildhüter hätten Menschen im Gebiet des Salonga-Nationalparks zwischen 2002 und 2015 misshandelt, gefoltert oder gar ermordet. KfW-Vorstandsmitglied Joachim Nagel hatte Anfang Juli eine eingehende Prüfung zugesagt, auch durch unabhängige Experten. "Wir hatten mit dem WWF bisher eine sehr gute professionelle Zusammenarbeit", bekräftigte er. Seit 2009 habe die KfW bei 29 Vorhaben mit der Organisation kooperiert.
Bislang Millionenunterstützung
Die KfW unterstützt nach eigenen Angaben die kongolesische Naturschutzbehörde seit 2008 mit bisher 46 Millionen Euro. Dazu gehöre der Schutz des Salonga-Parks seit 2016, für den rund 5,4 Millionen Euro zugesagt wurden. Der WWF selbst hat Anfang Mai einen besseren Schutz der Menschenrechte durch Schulungen, neue Stellen und bessere Beschwerdeverfahren angekündigt. In einem vom WWF in Auftrag gegebenen Zwischenbericht hatte der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte und einstige FDP-Parlamentarier Markus Löning Lücken beim Schutz der Menschenrechte in WWF-Projekten moniert. Allerdings hätten es die Ranger mit schwer militärisch ausgerüsteten Wilderern zu tun.
Das Bundesentwicklungsministerium erklärte, der WWF habe die Umsetzung der von Löning ausgearbeiteten Empfehlungen zugesagt. Dies sei Voraussetzung für die weitere Finanzierung von WWF-Schutzgebietsprojekten, sagte ein Sprecher. Darüber hinaus müssten die Vorwürfe über Straftaten kongolesischer Parkwächter von den Behörden restlos aufgeklärt werden. Zugleich stellte der Ministeriumssprecher klar, dass die Zahlungen an den WWF nicht komplett eingestellt seien. Bis zur vollständigen Aufklärung würden aber für die Arbeit in den betroffenen kongolesischen Schutzgebieten keine Mittel an die Organisation ausgezahlt - das betreffe derzeit die für die Jahre 2019 bis 2021 für den Salonga Nationalpark vorgesehene Unterstützung in Höhe von 1,35 Millionen Euro.
WWF will aufklären
Nach Angaben des WWF wurden die Zahlungen zum Ende einer Projektphase und vor Beginn einer neuen Phase gestoppt. "Wir sind im Moment dabei, eine Menschenrechtsorganisation zu suchen, die an der Aufklärung der Vorwürfe mitarbeitet", sagte WWF-Sprecher Roland Gramling dem epd. Die Organisation sollte dann auch in der nächsten Projektphase mitarbeiten und helfen, die problematische Menschenrechtssituation zu verbessern. Am liebsten wäre dem WWF eine lokale Organisation, die Ausschreibung laufe. Die Salonga-Region sei das schlimmste Gebiet, in dem man arbeiten könne. Es gebe keine Justiz und keine Infrastruktur.
Welthungerhilfe: Lage in Nordkorea sehr angespannt
Bonn (epd). Während Nordkorea mit neuen Raketentests Schlagzeilen macht, muss das kommunistisch regierte Land die schlechteste Ernte seit einem Jahrzehnt verkraften. "Die Ernährungslage in Nordkorea ist enorm angespannt", sagte Simone Pott von der Deutschen Welthungerhilfe in Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd). Rund zehn Millionen Menschen, 40 Prozent der Nordkoreaner, seien auf Hilfe angewiesen.
Lange Trockenzeiten, hohe Temperaturen und Überschwemmungen führten laut Pott im vergangenen Jahr zu großen Ernteausfällen. "Es fehlen 1,36 Millionen Tonnen Getreide", sagte sie unter Berufung auf einen UN-Bericht. Auch in diesem Jahr habe es im Juni zu wenig geregnet. Die nächste Ernte werde im September in Nordkorea erwartet, bis dahin sei die Ernährungslage besonders kritisch. Die Welthungerhilfe und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen verteilten Lebensmittel.
Bereits im Januar hatte das Regime von Staatschef Kim Jong Un die täglichen Rationen von Reis, Mais und Kartoffeln von 380 auf 300 Gramm pro Person verringert, Frauen und Kinder blieben von der Reduktion aber ausgenommen. "Optimal wären Rationen von 576 Gramm", sagte Pott: "Mahlzeiten werden verkleinert oder fallen aus." Stadtbewohner könnten sich auch nicht mehr durch Angehörige auf dem Land Nahrungsmittel besorgen, weil auch dort Knappheit herrsche.
Soldat sagt aus: Regime in Gambia ließ afrikanische Migranten töten
Frankfurt a.M., Banjul (epd). Mit seinem Geständnis vor der Wahrheitskommission im westafrikanischen Gambia hat ein Soldat Vorwürfe gegen Ex-Präsident Yahya Jammeh bekräftigt, rund 50 afrikanische Migranten auf dem Weg nach Europa ermordet zu haben. Der Leutnant gab nach Berichten des britischen Senders BBC vom 24. Juli zu, an der Tötungsaktion im Jahr 2005 beteiligt gewesen zu sein. Diese sei von Jammeh angeordnet worden.
Menschenrechtsorganisationen hatten diese Vorwürfe bereits seit längerem erhoben. Die Migranten aus Ghana, Nigeria und anderen westafrikanischen Staaten seien verdächtigt worden, Söldner zu sein, die Jammehs Regime stürzen wollten, hieß es in einem Bericht von Human Rights Watch und Trial International aus dem vergangenen Jahr. Die paramilitärische Einheit "Junglers", die ihre Befehle direkt vom Präsidenten bekommen haben soll, habe die Menschen dann auf der Durchreise gestoppt und getötet.
Die Wahrheitskommission TRRC untersucht Verbrechen während Jammehs 22-jähriger Herrschaft. Jammeh regierte Gambia nach einem Putsch 1994 mit harter Hand. In dieser Zeit wurden schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Oppositionelle, Journalisten und andere Kritiker beklagt. Seine überraschende Wahlniederlage Ende 2016 erkannte Jammeh nur unter massivem internationalen Druck an. Erst am 19. Januar 2017 konnte der gewählte Nachfolger Adama Barrow das Präsidentenamt antreten. Jammeh lebt mit seiner Familie im Exil in Äquatorialguinea.

