Kirchen
"Echte Identität gründet nicht auf Abgrenzung"

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat darauf gedrungen, die Kriminalisierung der Seenotretter zu beenden. "Das, was da passiert, ist ein moralischer Skandal", sagte Bedford-Strohm am 26. Juni in Berlin anlässlich des traditionellen Johannisempfangs der EKD. Die italienische Regierung hatte in den vergangenen Wochen verhindert, dass das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" der privaten Seenotrettungsorganisation Sea-Watch mit ursprünglich über 50 Flüchtlingen an Bord in einen Hafen einlaufen konnte.
Bedford-Strohm: Seenotretter dürfen nicht kriminalisiert werden
Italien hatte gedroht, das Schiff zu beschlagnahmen und die Besatzung strafrechtlich zu verfolgen, sollte die "Sea-Watch 3" das Verbot ignorieren. Dennoch entschied die Kapitänin des Schiffs am, den Notfall auszurufen und den Hafen von Lampedusa ansteuern.
Der Ratsvorsitzende hielt am Abend den Festvortrag in der Französischen Friedrichsstadtkirche zum Thema "Identität und Heimat - eine christliche Ortsbestimmung". "Echte Identität gründe sich nicht aus der Abgrenzung gegenüber den Anderen oder gar aus ihrer Herabsetzung", sagte Bedford-Strohm. Es sei richtig, Heimat und Identitäten zu schätzen. Menschen brauchten das. "Aber schief wird es, wenn wir einen bestimmten Zustand von Heimat und Identität verabsolutieren, als wäre nicht auch er aus vielen Quellen entstanden und als müsse nicht auch er sich mit der Zeit verändern", betonte der oberste Repräsentant von knapp 21,5 Millionen Protestanten in Deutschland.
"Dringliches Bewährungsfeld"
"Mit einem engen und homogenen Heimatbegriff, dessen Horizont nur bis zum Gartenzaun des Nachbarn reicht, hat das mit einem offenen Heimatverständnis, das wir heute brauchen, nichts zu tun", sagte Bedford-Strohm, der auch bayerischer Landesbischof ist. Das Thema Seenotrettung sei für diesen offenen Heimatbegriff ein "dringliches Bewährungsfeld", sagte er. "Verbrecherische Schlepperbanden darf man nicht dadurch bekämpfen, dass man unterlassene Hilfe beim Ertrinken von Menschen als Abschreckungsmittel einsetzt."
An dem Empfang, der vom Bevollmächtigten des Rates der EKD ausgerichtet wird, nahmen hochrangige Religionsvertreter und führende Bundespolitiker teil, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Rund 500 Gäste kamen bei tropischen Temperaturen auf den Gendarmenmarkt, darunter Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sowie der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek.
Der Sommerempfang der EKD findet traditionell in der Französischen Friedrichstadtkirche statt. An dem zentralen Berliner Platz hat der EKD-Bevollmächtigte bei Bundesregierung, Bundestag und Europäischer Union, Martin Dutzmann, seinen Dienstsitz. Er vertritt die Interessen der evangelischen Kirche gegenüber der Politik.
EKD: Festnahme der "Sea-Watch"-Kapitänin Schande für Europa

epd-bild/Christian Ditsch
Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat die Festnahme der Kapitänin der Rettungsschiffes "See-Watch 3", Carola Rackete, scharf kritisiert. Dass Rackete in der Nacht beim Anlegen in Lampedusa festgenommen wurde, mache ihn "traurig und zornig", erklärte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm am 29. Juni in Hannover. "Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa!"
Die Kapitänin hatte das Schiff trotz des Verbots Italiens in den Hafen der Insel gebracht, wo sie sogleich festgenommen und unter Hausarrest gestellt wurde. Ihr droht wegen Verstoßes gegen die Schifffahrtsordnung eine Haftstrafe zwischen drei und zehn Jahren. Die "Sea-Watch 3" wurde von Polizei und Zollbehörden beschlagnahmt. Die 40 verbliebenen Flüchtlinge, die seit mehr als zwei Wochen auf der "Sea-Watch" waren, sind an Land gegangen.
Seine Gedanken und Gebete seien an diesem Morgen bei Carola Rackete, erklärte Bedford-Strohm und erinnerte an das Bibelwort "Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten". Dies sei eine Ermutigung für viele Menschen, allen voran die "Sea-Watch"-Crew, die sich für Humanität einsetzen.
Die Besatzung des Rettungsschiffes hatte am 12. Juni insgesamt 53 Flüchtlinge in Seenot vor Libyen gerettet. Einige der Flüchtlinge durften in den vergangenen Tagen als Notfälle an Land gehen. Eine Rückkehr nach Libyen hatte die Organisation Sea-Watch wegen des Bürgerkriegs und der Menschenrechtsverletzungen dort ausgeschlossen.
Leyendecker ruft zu Solidarität mit "Sea-Watch"-Kapitänin auf

epd-bild / Stefan Arend
Düsseldorf, Rom (epd). Kirchentagspräsident Hans Leyendecker hat angesichts der Festnahme der Kapitänin des Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, zur "Solidarität der Anständigen" aufgerufen. "Wer die mutige Kapitänin Rackete festnehmen lässt, wer Helfer wie Carola Rackete verfolgt, erschlägt die Menschlichkeit", sagte Leyendecker am 29. Juni dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Düsseldorf. Der Journalist verurteilte das Vorgehen von Italiens Innenminister Matteo Salvini als "Schande für Europa".
Leyendecker äußerte Bewunderung für Racketes Mut. "Sie weiß, dass in Italien Unrecht derzeit Recht ist und setzt sich dennoch mit aller Kraft für die Geretteten ein." Die Rettungsschiffe würden von der italienischen Politik behandelt, als hätten sie nicht Menschen, sondern Pest und Cholera an Bord. "Die Flüchtlinge sind geflohen, weil sie nicht krepieren wollten, und man tut so, als handele es sich um Einbrecher oder Terroristen." Der Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund habe vor einer Woche ein Zeichen gesetzt, dass Unmenschlichkeit ein Ende haben müsse. "Es braucht jetzt die Solidarität der Anständigen", betonte Leyendecker.
Rackete war in der Nacht beim Anlegen in Lampedusa festgenommen worden. Die Kapitänin hatte das Schiff trotz des Verbots Italiens in den Hafen der Insel gebracht, wo sie sogleich festgenommen wurde. Ihr droht wegen Verstoßes gegen die Schifffahrtsordnung eine Haftstrafe zwischen drei und zehn Jahren. Die Besatzung des Rettungsschiffes hatte am 12. Juni insgesamt 53 Flüchtlinge in Seenot vor Libyen gerettet, von denen einige in den vergangenen Tagen als Notfälle an Land gehen durften. Eine Rückkehr nach Libyen hatte die Organisation "Sea-Watch" wegen des Bürgerkriegs und der Menschenrechtsverletzungen dort ausgeschlossen. Das Schiff "Sea-Watch 3" wurde in Italien beschlagnahmt. Die 40 verbliebenen Flüchtlinge sind nach italienischen Medienberichten an Land gegangen.
Bedford-Strohm wird Ehrenbürger von Palermo

epd-bild/Thomas Lohnes
Hannover (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt Palermo (Sizilien). "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, weil sie mir von einem Kämpfer für Humanität, Recht und Ordnung verliehen worden ist", sagte Bedford-Strohm am Rande der EKD-Ratstagung in Berlin. Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando hatte am 27. Juni mitgeteilt, dass er Bedford-Strohm und die private Seenotrettungsorganisation Sea-Watch auszeichnen möchte.
Bedford-Strohm hatte Lampedusa und Palermo Anfang Juni besucht, um auf das Problem der Kriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer aufmerksam zu machen. Einen Unterstützer für sein Anliegen fand er in Leoluca Orlando, der kurzfristig zum Kirchentag in Dortmund kam. Auf dem Kirchentag wurde eine Resolution verabschiedet, die von der EKD fordert, ein eigenes Seenotrettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Initiator ist unter anderem der EU-Abgeordnete Sven Giegold (Grüne).
Die Resolution sei von der der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) positiv aufgenommen worden, sagte ein Sprecher am Rande der Ratstagung in Berlin. "Ein Konzept, in welcher Weise die EKD sich in einem von einem breiten Bündnis getragenen Verein daran beteiligen kann, ein neues Schiff auf den Weg zu bringen, soll dem Rat in der kommenden Ratssitzung im September vorgelegt werden", sagte er. Dem Bündnis sollen sich Kirchen, Organisationen, Kommunen und Einzelpersonen anschließen können. Die EKD lege größten Wert auf eine breite zivilgesellschaftliche Verankerung des Vereins, vor allem auch auf die Einbindung der in der Tradition "christlicher Seefahrt" stehenden deutschen Reeder.
Auf Weg des Westfälischen Friedens: Mit Flüchtlingen pilgern
Münster/Osnabrück (epd). Die evangelische Kirche ruft zur Teilnahme am ersten Westfälischen Pilgerweg mit Flüchtlingen von Osnabrück nach Münster auf. Vom 30. August bis 1. September wollen sich Menschen aus der Region und den Niederlanden zusammen mit Migranten auf die historischen Spuren des Westfälischen Friedens begeben, wie das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der westfälischen Kirche am 26. Juni mitteilte. Auf der 74 Kilometer lange Route macht die interreligiöse Wandergruppe Zwischenstopps in Lengerich und Ladbergen, wo vor 370 Jahren wichtige Verhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges stattfanden.
Mit dem Projekt solle für ein friedliches Miteinander und neue Friedensgeschichten heute geworben werden, hieß es. Die Pilger starten demnach am 30. August, um 10 Uhr am Rathaus Osnabrück. Über Hasbergen geht es zur Stadtkirche Lengerich und am 29. Juni weiter nach Ladbergen, wo ein Begegnungsfest zwischen Flüchtlingen und Einheimischen geplant ist. Die Etappe am 31. August endet in Schmedehausen bei Greven. Die letzte Wanderstrecke am Antikriegstag, dem 1. September, führt dann mit Zwischenhalten an Gedenkorten zum historischen Rathaus Münster, Ankunft ist voraussichtlich 16 Uhr.
Stuttgarter Pfarrer macht Front gegen AfD-Anfrage
Stuttgart (epd). Matthias Vosseler, Pfarrer an der Stuttgarter Stiftskirche, protestiert mit einem ungewöhnlichen Facebook-Beitrag gegen eine Anfrage der AfD zum Ausländeranteil an staatlichen Bühnen in Baden-Württemberg. Vosseler listet darin eine Analyse seiner eigenen DNA auf, die ihn zu 36 Prozent als Skandinavier, 28 Prozent als Italiener, knapp 10 Prozent als Deutscher und zu 1,3 Prozent als Nigerianer ausweise. "Als 'schwedischer Italiener' erkläre ich mich solidarisch mit den vielen Menschen aus so vielen verschiedenen Herkunftsländern, die hier auf den Bühnen des Landes Kultur zum Blühen bringen", schreibt der Pfarrer.
Der evangelische Theologe empfiehlt auch AfD-Politikern, eine solche DNA-Analyse machen zu lassen. "Die Ergebnisse werden euch sicher nicht begeistern, aber vielleicht die Augen öffnen", schreibt er. "Dann könnt ihr in Zukunft solch unsinnige und im letzten menschenverachtende Anfragen unterlassen." Die AfD-Anfrage hat auch bei den anderen im Landtag vertretenen Parteien Empörung ausgelöst.
Berufung gegen "Judensau"-Urteil eingelegt
Naumburg (epd). Der Rechtsstreit um den Verbleib der Spottplastik "Judensau" an der Fassade der Wittenberger Stadtkirche geht in die nächste Instanz. Er habe gegen das Urteil des Landgerichts Dessau-Roßlau von Ende Mai Berufung eingelegt, teilte der Anwalt des Klägers, Hubertus Benecke, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 25. Juni mit. Damit werde der Prozess am Oberlandesgericht Naumburg fortgesetzt. Kläger Michael Düllmann ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Berlin. Er sieht sich durch die Plastik in seiner Ehre verletzt.
Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte Ende Mai entschieden, dass die Plastik vorerst an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg hängen bleiben darf. Das Vorhandensein des rund 700 Jahre alten Reliefs könne nicht als Kundgabe der Nichtachtung oder Missachtung gegenüber Juden in Deutschland verstanden werden, urteilte das Gericht. Es bestehe kein Beseitigungsanspruch seitens des jüdischen Klägers. Auch liege keine von der evangelischen Stadtkirchengemeinde ausgehende Beleidigung im Sinne des Paragrafen 185 im Strafgesetzbuch vor. Das mittelalterliche Relief sei Teil eines historischen Baudenkmals, erklärte das Gericht.
Stadtrat für Erhalt des Reliefs
Das Sandsteinrelief war um das Jahr 1300 an der Südfassade der Stadtkirche angebracht worden. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen sich Menschen laben, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After. Schweine gelten im Judentum als unrein. Mit solchen Darstellungen sollten Juden im Mittelalter unter anderem davon abgeschreckt werden, sich in der jeweiligen Stadt niederzulassen. Ähnliche Spottplastiken finden sich an mehreren Dutzend weiteren Kirchen in Deutschland.
Die Stadtkirchengemeinde ließ 1988 eine Bodenplatte unterhalb des Reliefs anbringen. Ihre Inschrift nimmt Bezug auf den Völkermord an den Juden im Dritten Reich, die Plastik selbst findet jedoch keine Erwähnung. Der Wittenberger Stadtrat sprach sich Mitte 2017 für den Erhalt der Plastik aus. Er wertete die Bodenplatte als Mahnmal und ließ in Absprache mit der Gemeinde eine Stele mit Erklärtexten auf Deutsch und Englisch errichten.
Düllmann hatte seine Klage 2018 zunächst vor dem Amtsgericht Wittenberg eingereicht. Wegen des hohen Streitwerts von mehr als 10.000 Euro hatte der Richter den Fall vor gut einem Jahr an das Landgericht überwiesen.
Katholische Kirche veröffentlicht Arbeitshilfe zum Populismus
Berlin (epd). Die katholische Kirche in Deutschland hat eine Arbeitshilfe veröffentlicht, die Gemeinden die Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen Positionen erleichtern soll. Auch in den eigenen Gemeinden gebe es Menschen, die Angst davor haben, "überfremdet" zu werden, sagte der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode bei der Präsentation am 25. Juni in Berlin. Die Fragen tauchten auch in katholischen Kitas und Schulen auf. Die Autoren des Papiers werben für den Dialog auch mit Menschen, die Meinungen vertreten, die schwer mit kirchlichen Positionen zu vereinbaren sind.
"Es gibt keinen Weg außerhalb des Dialogs", sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, der auch Vorsitzender der Migrationskonferenz der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist. "Die Kirche würde ihre Sendung verraten, wenn sie diese Aufgabe nicht annähme", sagte Bode.
"So weit sind wir noch nicht"
Für das "Dilemma" bei der Frage eines Dialogs mit der AfD, wie es der Trierer Bischof Stephan Ackermann bezeichnete, gibt die Arbeitshilfe keine klare Empfehlung. Der gerade zu Ende gegangene evangelische Kirchentag hatte keinen AfD-Vertreter zu Podien eingeladen. Das habe der AfD viel Aufmerksamkeit verschafft, sagte Ackermann und ergänzte: Das habe ihr "zu viel Ehre" angetan. Der letzte Katholikentag in Münster hatte einen AfD-Vertreter auf einem Podium. Ackermann räumte aber ein, den "goldenen Mittelweg" zu finden, sei schwer.
Grenzen hat das Dialogische auch beim direkten Kontakt zwischen Bischofskonferenz und AfD. Auf Landesebene gebe es Kontakte zu einzelnen katholischen Abgeordneten, sagte Sprecher Matthias Kopp. Auf die Frage, ob offizielle Gespräche zwischen AfD-Vertretern und Bischofskonferenz möglich würden, sagte Heße: "So weit sind wir noch nicht."
Keine offiziellen Gespräche
Auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) führt keine offiziellen Gespräche mit der AfD, wie es sich mit anderen Parteien etabliert hat. In beiden Kirchen gibt es eine intensive Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus. In evangelischen Landeskirchen wurden ebenfalls Handreichungen und Empfehlungen erarbeitet. Zuletzt veröffentlichte die Diakonie konkrete Empfehlungen für den Umgang mit rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Positionen in eigenen Einrichtungen sowie Angriffen und Instrumentalisierungsversuchen durch Rechtspopulisten.
Die Arbeitshilfe der katholischen Bischofskonferenz setzt sich vor allem mit Grundsatzpositionen zum Islam, Flüchtlingen oder Geschlechterfragen auseinander, weil sie beliebte Themenfelder von Populisten sind. Am Ende stehen vier Empfehlungen: Engagierte unter anderem in der Flüchtlingsarbeit weiter stärken, Dialog ermöglichen, unterscheiden zwischen legitimen und ausgrenzenden Positionen sowie den Umgang mit negativen Emotionen lernen.
Papst ermutigt deutsche Katholiken auf "synodalem Weg"
Rom, Bonn (epd). Papst Franziskus hat in einem Brief an die deutschen Katholiken auf die kirchliche Reformdebatte in Deutschland reagiert. In dem am 29. Juni veröffentlichten Schreiben "An das pilgernde Volk Gottes in Deutschland" ermutigt Franziskus zum geplanten "synodalen Weg" bei der Erneuerung der Ortskirche, die sich nach Missbrauchskandalen mit einem erheblichen Vertrauensverlust konfrontiert sieht. Zugleich ruft der Papst zu einer Evangelisierung auf. Die Deutschen Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) begrüßten das Schreiben als "Zeichen der Wertschätzung des kirchlichen Lebens in unserem Land".
Franziskus lobt die Reformanstrengungen der deutschen Katholiken angesichts "zunehmender Erosion" und "Verfall des Glaubens". Er warnt zugleich vor rein strukturellen und verwaltungstechnischen Veränderungen, vor einem "'Zurechtflicken', um so das kirchliche Leben zu ordnen und zu glätten". Verlangt werde vielmehr eine "pastorale Bekehrung", eine Haltung, die darauf abziele, das Evangelium zu leben und transparent zu machen. Den Skandal um sexuellen Missbrauch durch Kirchenvertreter als Auslöser der Reformbestrebungen erwähnt er nicht.
Evangelisierung sei "keine Taktik kirchlicher Neupositionierung in der Welt von heute" und auch "kein Akt der Eroberung", sondern führe zur Freude am Christsein, schreibt Franziskus. Er ruft dazu auf, offen auf Menschen am Rande der Gesellschaft zuzugehen, die "auf den Straßen, in den Gefängnissen, in den Krankenhäusern, auf den Plätzen und in den Städten zu finden sind".
Betonung der Einheit der Kirche
Auf konkrete strittige Themen wie die Priesterweihe für verheiratete Männer ging der Papst in seinem Brief nicht ein. Er unterstrich aber die Bedeutung einer weltkirchlichen Perspektive. Weltkirche und einzelne Ortskirchen seien aufeinander angewiesen und lebten voneinander. Der Blick auf die Einheit der Kirche könne verhindern, dass man sich in den Ortskirchen in einzelnen Fragen "verstricke" und den Weitblick verliere.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und ZdK-Präsident Thomas Sternberg dankten dem Papst "für seine orientierenden und ermutigenden Worte". Sie sähen sich ermutigt, den angestoßenen Reformprozess weiterzugehen. Der päpstliche Brief solle auf dem "synodalen Weg" intensiv bedacht werden.
Nachdem die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche in Deutschland in den vergangenen Jahren erschüttert worden sei, müsse es nun darum gehen, Vertrauen neu zu gewinnen, erklärten Marx und Sternberg in Bonn. Dabei sei eine geistlichen Ausrichtung notwendig, "die sich nicht in Strukturdebatten erschöpfen darf".
Die deutschen katholischen Bischöfe hatten im März Reformvorstellungen formuliert. In einem als "synodaler Weg" bezeichneten Beratungsprozess mit dem Zdk, also den kirchlichen Laien, sowie außerkirchlichen Experten soll es um Themen wie Machtstrukturen und Sexualmoral sowie das Zölibat der Priester gehen. Bereits am 5. Juli wollen Vertreter der Bischofskonferenz und des ZdK weitere Schritte beraten.
Auch andere katholische Bischöfe äußerte sich erfreut über den Brief des Papstes. Franziskus erkenne an, dass die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Themen der deutschen Katholiken berechtigt und notwendig sei, und dass es gut sei, diese gemeinsam zu gestalten, erklärte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Dankbar für dieses "starke Zeichen des Papstes" äußerte sich der Limburger Bischof Georg Bätzing. Er teilte die Auffassung des Papstes, nichts zu verschleiern und sich "den Themen zu stellen". Die Präsidentin der Limburger Diözesanversammlung, Ingeborg Schillai, nannte den Brief ein "klares Votum, einen gemeinsamen Prozess von Amtsträgern und Volk Gottes zu gestalten".
Die Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche" unterstrich, dass der "verbindliche synodale Weg" die einzige Möglichkeit sei, die "existenzielle Kirchenkrise in Deutschland zu überwinden". Zugleich warnte die Initiative kritischer Katholiken davor, zu viel Hoffnung in den Prozess zu setzen, solange nicht kirchenrechtlich geklärt sei, wer am Zustandekommen von Beschlüssen beteiligt sei und welche Verbindlichkeit diese hätten.
Rekowski sieht in Kirchen-Krise Chance für Ökumene
Oberhausen (epd). Der rheinische Präses Manfred Rekowski hat evangelische und katholische Kirche zu mehr gemeinsamem Handeln ermutigt. Beide großen Kirchen seien "im Umbruch" und spürten die Auswirkungen des demografischen Wandels und der nachlassenden Kirchenverbundenheit, sagte Rekowski am 30. Juni im Festgottesdienst zum 700-jährigen Bestehen der evangelischen Kirche Oberhausen-Holten. "Diese Krise schließt uns über die Konfessionsgrenzen hinweg zusammen."
Sowohl in der evangelischen wie auch in der katholischen Kirche fange es an manchen Stellen an zu bröckeln, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland in seiner Predigt laut Redetext. "Die Relevanz unserer Botschaft leuchtet vielen Menschen nicht mehr ein. Wegen der schwindenden Finanzmittel müssen wir Standorte aufgeben und drohen die Nähe zu den Menschen zu verlieren."
"Nicht vergangenen Zeiten nachtrauern"
Rekowski verwies auf eine Prognose, nach der die Kirchen im Jahr 2060 nur noch halb so viele Mitglieder haben werden wie heute. Er rief dazu auf, "nicht vergangenen Zeiten nachzutrauern". Diese Entwicklung könnte vielmehr auch eine Chance sein, "miteinander nach dem Willen Gottes zu fragen und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für die Menschen", sagte der rheinische Präses.
Die Evangelische Kirche Holten wurde 1319 als katholische Kirche St. Johann errichtet und wurde kurz nach der Reformation lutherisch. Im 17. Jahrhundert wurde sie zum Gotteshaus der reformierten Gemeinde. Das 700-jährige Jubiläum feiert die Evangelische Kirchengemeinde Holten-Sterkrade deshalb mit einer ganzen Festwoche gemeinsam mit der katholischen Nachbargemeinde St. Johann Holten.
Kirchlicher Aktionstag gegen Atomwaffen in Büchel
Büchel, Bonn (epd). Mit einem Aktionstag am Fliegerhorst Büchel in der Eifel wollen Christen aus evangelischen Landeskirchen und der katholischen Friedensorganisation Pax Christi am 7. Juli ein Zeichen gegen Atomwaffen setzen. Ein Gottesdienst mit der evangelischen Theologin Margot Käßmann sowie Konzerte, Redebeiträge und eine Performance sollten ein Signal für Frieden und nukleare Abrüstung an Politik, Kirche und Gesellschaft aussenden, teilte der Verein für Friedensarbeit im Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Bonn mit. Im vergangenen Jahr haben den Angaben zufolge am ersten kirchlichen Aktionstag in Büchel, wo die letzten Atomwaffen in Deutschland lagern sollen, mehr als 500 Christinnen und Christen teilgenommen.
Gottesdienst mit Margot Käßmann und Performance
Auf dem Programm des Aktionstags stehen neben Konzerten auch Redebeiträge unter anderem von Roland Blach, Koordinator der bundesweiten Kampagne "Atomwaffenfrei.jetzt - Büchel ist überall", und Mitgliedern einer US-Friedensdelegation. In einem ökumenischen Gottesdienst predigt die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann. Mitgestaltet wird der Gottesdienst von der rheinischen Kirchenrätin Anja Vollendorf, dem geistlichen Beirat von Pax Christi, Horst Peter Rauguth, sowie dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Südwest, Pastor Jochen Wagner. Den Abschluss des Aktionstags bildet eine Performance "Bombengeheimnis lüften. Keine neuen Atomwaffen in Deutschland!" von der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN. Dabei sollten 20 aufblasbare "Atombomben" über den Köpfen der Menschen die im Fliegerhorst gelagerten Atomwaffen sichtbar machen, hieß es.
Die Projektgruppe "Kirchen gegen Atomwaffen" hat sich den Angaben zufolge im Dezember 2017 auf Initiative des badischen Forums Friedensethik gebildet. Ihr gehören Christinnen und Christen aus den evangelischen Landeskirchen in Baden, Bayern, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck, der Pfalz, dem Rheinland und Württemberg an. Zudem nehmen Mitglieder der katholischen Friedensbewegung Pax Christi an den Treffen teil.
Schwimmender Altar vor der Loreley

epd-bild/Lothar Stein
St. Goarshausen (epd). Als die "Loreley IV" auf die Sekunde genau um halb elf morgens ablegt, schmettert eine Blechblasgruppe den Gospel "Let my people go" ins Mittelrheintal. Zehn Minuten später, als das Schiff erneut am rechten Ufer anlegt, sind die Musiker gerade bei der dritten Strophe des Chorals "Großer Gott, wir loben dich" angekommen. Die Radler, die langsam vom Anleger auf das Fährschiff herunterrollen, schauen verwundert auf das Geschehen an Bord. Einen Gottesdienst auf einer Fähre - das hat es am Rhein noch nicht gegeben.
Idee der Fährbetreiber
Eine Dreiviertelstunde lang pendelt die evangelische Kirchengemeinde von St. Goarshausen auf dem Schiff zwischen den beiden Ufern hin- und her - mit Pfarrerin, Musikern und Altar an Bord. Da das komplette Mittelrheintal wegen des Aktionstags "Tal Total" an diesem 30. Juni ohnehin für Autos tabu bleibt, hat die Kirche kurzerhand die halbe Fähre in Beschlag genommen, mit Flatterband abgesperrt und Plastik-Gartenstühle aufgestellt. Die Idee dazu hatten die Fährbetreiber selbst. Helferinnen verteilen Liedblättchen an die Passagiere, und wer will, darf mitsingen. Die meisten Ausflügler beschränken sich jedoch darauf, das Geschehen mit ihrem Smartphone festzuhalten.
"Wussten Sie, dass auch Jesus Fähre gefahren ist?" begrüßt Janina Franz ihre Gemeinde. Weil es zwischen Mainz und Koblenz auf knapp 100 Kilometern Länge keine einzige Brücke über den Fluss gibt, spielen Fähren dort bis heute eine zentrale Rolle im Leben der Menschen. "Ich mag das, mit der Fähre zu fahren", sagt die Pfarrerin, "weil es entschleunigt." In ihrer Predigt schlägt sie den Bogen von Jesus, der laut biblischer Überlieferung den Sturm auf dem See Genezareth stillte, bis hin zum Leben im Rheintal, wo der ohrenbetäubende Lärm der Güterzüge seit Jahren viele Menschen um den Verstand bringt.
"Kirche aus dem Häuschen"
Die evangelische Gemeinde der Kleinstadt am Loreley-Felsen zieht es regelmäßig aus ihrer am Flussufer gelegenen Kirche hinaus zu ungewöhnlichen Gottesdienstorten. "Kirche aus dem Häuschen" heißt die Reihe, bei der der Altar auch schon einmal hinauf auf die Loreley gebracht oder in den kühlen Lagerräume einer Weinkellerei aufgebaut wird. Den Besuchern gefällt diese unkonventionelle Art von Kirche. "Wir dachten gleich: cool, da sind wir dabei", sagt Karina May aus einem Nachbardorf von St. Goarshausen. "Das ist auch nicht so steif, wie sonst manchmal in den Kirchen."
Nach sechs Überfahrten endet der ungewöhnliche Gottesdienst wieder am Fähranleger von St. Goarshausen. Auch manche Radler, die keine Kirchgänger sind, loben die Idee. Und bevor alle von Bord gehen, wird noch eine Kollekte gesammelt - für die Seenotretter im Mittelmeer, die nicht nur gegen den Sturm, sondern auch gegen die Ignoranz der europäischen Politik ankämpfen müssen.
De Maizière: Kirchen sind in der Vertrauenskrise
Leipzig (epd). Der langjährige Bundesminister Thomas de Maizière (CDU) hat den christlichen Kirchen mangelnde Akzeptanz in der Gesellschaft attestiert. Evangelische und katholische Kirche befänden sich in einer ebenso großen Vertrauenskrise wie Gewerkschaften, Medien, politische Parteien und andere große Organisationen, sagte de Maizière am 25. Juni in Leipzig.
Das verstärke sich noch, wenn kein Problembewusstsein vorhanden sei, fügte der frühere Innen- und Verteidigungsminister hinzu. "Ich bin mir bei den Kirchen nicht so sicher, ob sie den Ernst der Lage schon erkannt haben", betonte er. Dabei halte er eine Institution, die in den letzten Dingen wie dem Beginn und dem Ende des Lebens oder den Grenzen der Forschung kritische Fragen stelle, für unverzichtbar für die Gesellschaft, sagte de Maizière, der dem Präsidium des Deutschen Evangelischen Kirchentages angehört.
De Maizière debattierte in der Aula und Universitätskirche St. Pauli der Leipziger Universität mit dem langjährigen Fraktionsvorsitzenden der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, zum Thema "Mit Religion Staat machen". Gysi erklärte, die Gesellschaft wisse heute gar nicht mehr, wie sehr sie durch das Christentum geprägt sei. Zwar nehme die Zahl der Kirchenmitglieder ab, sagte Gysi: "Das heißt aber nicht, dass die Zahl der Gläubigen abnimmt."
"Keine allgemeinverbindliche Moral" ohne Bergpredigt
Der Linken-Politiker würdigte die wertebildende Kraft der Kirche. "Ohne die Bergpredigt hätten wir überhaupt keine allgemeinverbindliche Moral", erklärte er. Er fürchte sich vor einer gottlosen Gesellschaft, auch wenn er selbst nicht gläubig sei. "Eine religionsfreie Gesellschaft möchte ich nicht erleben", erklärte Gysi.
Zugleich plädierte er für eine striktere Trennung von Kirche und Staat. Gysi sagte, anstelle des Staates sollten die Kirchen die Kirchensteuer selbst einziehen. Auch sei es an der Zeit, staatliche Entschädigungszahlungen an die Kirchen wegen Enteignungen vor rund 200 Jahren auslaufen zu lassen. Auf der andere Seite sollte der Staat den Kirchen Zuschüsse etwa zum Erhalt von Kirchen zahlen, erklärte Gysi. Schließlich sei es der Staat, der viele Gebäude unter Denkmalschutz stelle.
De Maizière erklärte, eine gewisse Zuneigung zwischen Staat und Kirche sei zwar rechtlich nicht geboten und auch nicht zwingend erforderlich. "Aber ich finde sie schön und würde dafür plädieren, dass es dabei bleibt", sagte er.
Militärpfarrer kritisiert Merz-Aussage zur AfD-Nähe von Soldaten
Berlin (epd). Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat den Aussagen des CDU-Politikers Friedrich Merz über einen Rechtsruck von Soldaten hin zur AfD widersprochen. "Die Bundeswehr kenne ich als verlässliche Parlamentsarmee", sagte Rink der "Bild am Sonntag" in Berlin. "Eine generell größere Nähe der Soldaten und Soldatinnen zu rechten Parteien wie der AfD, die ich persönlich völlig ablehne, kann ich nicht erkennen."
Merz hatte derselben Zeitung eine Woche zuvor gesagt: "Wir verlieren Teile der Bundeswehr und der Bundespolizei an die AfD." Diesen Eindruck hätten Abgeordnete aus dem Innen- und Verteidigungsausschuss sowie Freunde bestätigt, die bei der Bundeswehr und der Polizei arbeiteten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wiesen dies zurück und kritisierten Merz scharf.
Rink (58) ist seit August 2014 der erste hauptamtliche Militärbischof der evangelischen Kirche und damit für die Seelsorge protestantischer Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr verantwortlich. An fast 100 Bundeswehr-Standorten gibt es evangelische Militärpfarrer.
Kirchenkreis Münster warnt vor Kriminalisierung des Kirchenasyls
Münster (epd). Der Kirchenkreis Münster hat vor einer Kriminalisierung des Kirchenasyls gewarnt. Die Kreissynode des Kirchenkreises forderte die Kirchenleitung der westfälischen Kirche auf, gegenüber der Innenministerkonferenz und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) einer Kriminalisierung des Kirchenasyls entgegenzutreten, wie der Kirchenkreis mitteilte. Vielmehr sei zurückzukehren zu einer 2015 gemeinsam beschlossenen Vereinbarung zwischen Kirche und Staat zum Umgang mit Kirchenasyl, die einseitig vonseiten des Bamf aufgekündigt worden sei.
Die Synode kritisierte auch die Überprüfung der Aufrichtigkeit der Taufe von Geflüchteten im Rahmen von Asylverfahren. Die Beschäftigung mit der Hauptvorlage der westfälischen Landeskirche zu Kirche und Migration war eines der Schwerpunktthemen der Synode.
Auch beim landeskirchlichen Stellungnahmeverfahrens zum Thema Ehe und Trauung votierte die Kreissynode dafür, in der westfälischen Kirche künftig unterschiedslos für alle verheirateten Paare die Trauung zu vollziehen, wie der Kirchenkreis mitteilte. Bisher gibt es für gleichgeschlechtliche Paare statt einer Trauung eine Segnung. Auf der Tagesordnung standen zudem Stellungnahmen gegenüber der Landeskirche zu Themen wie Abendmahl, Pfarrstellenbesetzungsgesetz und Verwaltungsorganisationsgesetz.
Kirchenkreis Siegen verabschiedet "Appell gegen Rechts"
Wilnsdorf/Siegen (epd). Der evangelische Kirchenkreis Siegen hat zu Engagement gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aufgerufen. Auf der Kreissynode am 26. Juni in Wilnsdorf verabschiedeten die Delegierten einstimmig einen "Appell gegen Rechts", wie eine Sprecherin des Kirchenkreises mitteilte. Darin wenden sie sich gegen eine Haltung rechter Parteien, "die Migranten und Asylbewerber ihre Rechte beschneiden will und in ihnen eine Bedrohung für die Zukunft des deutschen Volkes sieht". Die Kreissynodalen fordern stattdessen eine Kultur der Barmherzigkeit gegenüber allen notleidenden Menschen. Anlass war eine für 26. Juni genehmigte Kundgebung einer rechtsextremen Partei in Siegen.
Bürger in der Region sollten sich einzeln oder gemeinsam dafür einsetzen, das die Bundesrepublik eine offene und tolerante Gesellschaft bleibe, "in der die Würde keines Menschen angetastet wird", heißt es in dem Appell der Kreissynodalen. Mit Blick auf den rechtsmotivierten Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) mahnen sie zudem den Schutz des Rechtsstaats und der Demokratievertreter an. Man solle sich Bestrebungen entgegenstellen, "die Deutschland in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht aus völkerrechtlichen Kooperationen lösen wollen".
Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein prüfen Vereinigung
Siegen (epd). Die Evangelischen Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein prüfen eine Vereinigung. Die Kreissynode Siegen beschloss bei ihrer Tagung in Wilgersdorf mit großer Mehrheit, dass zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt wird, die Optionen zur Gründung eines neuen Kirchenkreises auslotet, wie der Kirchenkreis mitteilte. Die Studie soll auf der Sommersynode 2020 vorgestellt und anschließend in den Kirchengemeinden erörtert werden. Auch die zeitgleich tagende Kreissynode Wittgenstein stimmte den Angaben nach dem Plan zu.
Der Siegener Superintendent Peter-Thomas Stuberg unterstrich, es gehe nicht um eine spontane Vereinigung, sondern um den ersten Schritt auf einem Weg, auf dem noch viele Details zu klären seien. Der Plan für einen möglichen Zusammenschluss solle offen und gemeinsam entwickelt werden, nachdem die Machbarkeitsstudie die Rahmenbedingungen aufgezeigt habe. Seit geraumer Zeit habe der Kirchenkreis Wittgenstein seine absehbare Schwierigkeit signalisiert, ein eigenständiger Kirchenkreis auf der Basis von rund 32.000 Gemeindegliedern zu bleiben. Auch der Kirchenkreis Siegen mit rund 114.000 Mitgliedern werde allmählich kleiner. Aktuell haben die Nachbarkirchenkreise bereits ein gemeinsames Kreiskirchenamt und Schulreferat.
Fonds für innovative, missionarische und diakonische Projekte
Um bei längerfristig unbesetzten Pfarrstellen die pastorale Grundversorgung zu sichern, beschloss die Kreissynode, dass Gemeindepädagogen oder Diakone eingestellt werden können, wenn für eine vakante Pfarrstelle länger als ein Jahr kein ordinierter Theologe gefunden wird. Der Kirchenkreis Siegen müsse sich bis zum Jahr 2025 auf zahlreiche Ruhestandsabgänge bei seinen Pfarrern einstellen, hieß es. Es sei bereits heute schwierig, für Pfarrstellen Interessenten zu finden.
Nach einem Beschluss der Synode fördert der Kirchenkreis künftig innovative Projekte mit einer Art Start-up-Finanzierung: Der Fonds für innovative, missionarische und diakonische Projekte soll einmalig mit 300.000 Euro bestückt werden. Einen Antrag auf Förderung stellen können Kirchengemeinden, kreiskirchliche Einrichtungen, freie Werke sowie nicht institutionell verankerte Initiativgruppen oder Vereine. Die geförderten Projekte sollen innovativ sein und Menschen ansprechen, die bisher von kirchlichen Angeboten noch nicht erreicht wurden. Ein Auswahlgremium des Kirchenkreises prüft und begleitet die Projektanträge.
Die Kreissynode beschäftigte sich zudem mit der Hauptvorlage "Kirche und Migration" der Evangelischen Kirche von Westfalen, die die Landeskirche zur Diskussion in die Kirchenkreise, Gemeinden und Arbeitsbereiche gegeben hatte. Die Siegener Synodalen baten unter anderem die Landeskirche, weiterhin dafür zu sorgen, dass geflüchteten Menschen auf deren Wunsch hin der christliche Glaube in Glaubenskursen nahegebracht und Taufe ermöglicht werde. Zudem solle die Landeskirche deutlicher als bisher die Interessen des Kirchenasyls als "ultima ratio" gegenüber staatlichen Einrichtungen vertreten. Nach intensiver Diskussion stimmte das Leitungsgremium auch den Plänen der Landeskirche zu, künftig auch gleichgeschlechtliche Paare kirchlich zu trauen.
Bielefelder Kreissynode würdigt "Fridays for Future"
Bielefeld (epd). Die Kreissynode Bielefeld hat das Engagement junger Klimaschützer von "Fridays for Future" zum Thema gemacht. Vertreter der Initiative warben vor der Kreissynode um Unterstützung von den Kirchen, um die Artenvielfalt und die Zivilisation nachhaltig zu sichern, wie der Kirchenkreis am 30. Juni mitteilte. Superintendent Christian Bald bekräftigte den Angaben zufolge unter großem Applaus der Synode die Forderungen der Aktivisten mit Bezug auf das jahrzehntelange Engagement der evangelischen Kirche um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.
Das Kirchenparlament stimmte zudem dafür, dass künftig alle Paare, die nach deutschem Recht eine Ehe eingegangen sind, auch kirchlich heiraten können sollen. Bislang ist in der evangelischen Kirche von Westfalen eine kirchliche Trauung lediglich für heterosexuelle Paare möglich, für alle anderen eine Segenshandlung. Die Gleichstellung aller Paare - eine Trauung für alle - soll auf der Landessynode der westfälischen Kirche im November beschlossen werden. Die Kreissynode votierte auch dafür, dass in der westfälischen Kirche künftig alle Menschen zum Abendmahl zugelassen werden sollen. Die Formulierung geht weiter als der Vorschlag der westfälischen Kirche, zum Abendmahl künftig alle Getauften, also auch Kinder zuzulassen.
Kreissynode Unna beschließt Konzept für Seelsorge alter Menschen
Kamen/Bergkamen (epd). Die Sommersynode des Evangelischen Kirchenkreises Unna stand unter dem Thema "Kirche in der Zuwanderungsgesellschaft". In seiner Predigt im Eröffnungsgottesdienst in der Auferstehungskirche Bergkamen dankte Pfarrer Volker Jeck den Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit: "Wegen euch können wir am Ende sagen: wir haben es geschafft", erklärte er mit Blick auf die Entwicklung in Deutschland und der Region seit der Flüchtlingskrise 2015. Auch die städtische Sozialdezernentin Christine Busch dankte für das Engagement der Kirche. In der Nachbarschaft war die Erstaufnahmeeinrichtung Bergkamens in Form einer Zeltstadt mit Unterstützung der Kirchengemeinde entstanden. Ksenja Sakelsek, Vorsitzende des Integrationsrates der Kreisstadt Unna, mahnte auf einem Podium mehr Anstrengungen von Kommunen und Bürgern bei der Integration der von Flüchtlingen an.
Auf der Kreissynode wurden dann in acht Themengruppen Vorschläge für eine Kirche erarbeitet, "die achtsam und bewusst auf die sich in der Zuwanderungsgesellschaft ergebenden Fragen reagiert", wie es hieß. Vorgeschlagen wurde etwa, Räume für Austausch und Begegnung zu schaffen und die Partnerschaftsarbeit - sowohl international wie auf örtlicher ökumenischer Basis - zu unterstützen.
Konkret beschlossen wurde demnach ein Konzept für die Seelsorge für alte Menschen. Dafür sollen sich künftig in den vier Regionen je einer der jetzt tätigen Pfarrer oder Pfarrerinnen mit je einer viertel Stelle kümmern. Zusätzlich ist eine Netzwerkstelle mit einem Diakon oder einer Diakonin, um die seelsorgliche Versorgung sowohl in Senioreneinrichtungen als auch im Gemeindealltag sicherzustellen.
Pfarrerinnen und Pfarrer künftig mit E-Bikes unterwegs
Angeschafft werden soll darüber hinaus E-Bikes für die Pfarrerinnen und Pfarrer, finanziert von westfälischer Landeskirche und Kirchenkreis. Ein Konzept für eine bessere interne Kommunikation wurde ebenfalls beschlossen, wie es hieß.
Die Kreissynodalen sprachen sich zudem dafür aus, dass homosexuelle Paare künftig genauso in einem Gottesdienst getraut werden können wie heterosexuelle. Der Kirchenkreis Unna befürwortet die vorgesehene Neuregelung der Evangelischen Kirche von Westfalen, eine kirchliche Trauung für alle Personen zu ermöglichen, die nach staatlichem Recht die Ehe eingegangen sind. Auch der Vorschlag, dass Kinder schon vor der Konfirmation zum Abendmahl zugelassen werden sollen, stimmten die Synodalen zu.
Viele Menschen gehen gar nicht mehr in Kirchen
Frankfurt a.M. (epd). Zwei von fünf Deutschen haben im vergangenen Jahr kein einziges Mal eine Kirche betreten. 40 Prozent gaben bei einer einer Umfrage des evangelischen Magazins "chrismon" (Juli-Ausgabe) an, in den letzten zwölf Monaten keine Kirche besucht zu haben. Die regionalen Unterschiede sind groß: In Bayern waren drei Viertel der Menschen in einem Gotteshaus, in Berlin nicht mal jeder dritte Befragte. Auf die Frage, warum sie in den vergangenen zwölf Monaten in einer Kirche waren, antworteten 39 Prozent, sie seien auf einer Hochzeit, Taufe oder Beerdigung eingeladen gewesen.
Etwa ein Drittel (34 Prozent) aller Befragten nahm an einem Gottesdienst teil, 31 Prozent waren zu Weihnachten in der Kirche. Auch um zu beten (26 Prozent), eine Kerze anzuzünden (23 Prozent), zur Besichtigung (22 Prozent) oder um sich still hinzusetzen (21 Prozent) fanden Menschen den Weg in ein Gotteshaus. Lediglich 13 Prozent gaben an, für ein Konzert eine Kirche besucht zu haben.
Für die Erhebung befragte das Kantar-Emnid-Institut im Auftrag von "chrismon" 1.009 Menschen in Deutschland. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Privathaushalten.
Festgottesdienst für neue Glocken der Leipziger Nikolaikirche

epd-bild/Uwe Winkler
Leipzig (epd). Die neuen Glocken der Leipziger Nikolaikirche sind mit einem Festgottesdienst eingeweiht worden. An der Feier am 29. Juni nahm auch Altbundespräsident Joachim Gauck teil. Der Gottesdienst war Höhepunkt des Festwochenendes zur Glockenweihe, das am Abend zuvor mit einem Festumzug der Glocken durch die Stadt begonnen hatte. Ab dem Mittag des 30. Juni sollten die insgesamt acht Glocken dann nach und nach in die beiden Kirchtürme aufgezogen werden. Sechs der Glocken wurden neu geschaffen, zwei Glocken wurden restauriert.
Für die nächsten Wochen ist den Angaben zufolge mehrfaches Probeläuten geplant. Erstmals vollständig erklingen soll das neue Geläut dann zum Friedensgebet anlässlich des 30. Jahrestags der entscheidenden Leipziger Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989 während der friedlichen Revolution in der DDR.
Die bisher drei Glocken der Nikolaikirche waren Anfang April aus dem Turm gehoben worden. Zwei davon wurden saniert, die dritte wurde ausrangiert. Dafür wird das Geläut um sechs neue Glocken ergänzt, darunter die große Osanna, die 1917 verloren gegangen war. Zudem werden die zwei Glockenstühle saniert und teilweise neu errichtet.
Die Gesamtkosten für die Arbeiten betragen rund 600.000 Euro. Über eine Aktion der Sparkasse Leipzig und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung unter der Schirmherrschaft Joachim Gaucks wurden gut zwei Drittel davon durch Spenden eingenommen. Den Rest finanzieren die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Kirchentag als Video-Clip
Dortmund, Fulda (epd). Der evangelische Kirchentag in Dortmund ist als Videoclip noch einmal nachzuerleben. In dem gut vierminütigen Video auf der Internetseite des Kirchentages könnten einige Stationen der Tage noch einmal nachgefühlt werden, erklärte der Kirchentag am 1. Juli in Fulda. Der diesjährige Kirchentag fand unter dem Motto "Was für ein Vertrauen!" vom 19. bis 23. Juni in Dortmund statt. Das Programm zählte rund 2.400 Veranstaltungen an 200 Orten. Rund 121.000 Teilnehmer waren an den fünf Tagen zusammengekommen.
Das Christentreffen ist alle zwei Jahre in einer anderen Stadt zu Gast. Für 2021 ist zum dritten Mal ein Ökumenischer Kirchentag geplant, der vom 12. bis 16. Mai 2021 in Frankfurt am Main stattfindet.
Gesellschaft
Seehofer will "Feinde des Rechtsstaats" aus dem Verkehr ziehen

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lässt nach der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ein Verbot rechtsextremistischer Gruppierungen prüfen. Der "politische Mord" an Lübcke sei eine Zäsur, ein Alarmsignal, weil er sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte, sagte Seehofer am 27. Juni bei der Vorstellung des Jahresberichtes des Bundesamts für Verfassungsschutz in Berlin. Er werde daher alle Optionen prüfen lassen, um dem Rechtsstaat "mehr Biss" zu verleihen. Dazu gehöre auch eine Stärkung des Verfassungsschutzes. Im Herbst werde er eine Debatte in der großen Koalition über ein solches Gesetz anstoßen.
Feinde des Rechtsstaats müssten aus dem Verkehr gezogen werden, "gerade wenn sie so brandgefährlich sind", sagte der Innenminister. Welche Gruppierungen er für ein Verbot im Auge hat, sagte Seehofer nicht. Der Verfassungsschutz stuft derzeit 24.100 Personen in Deutschland als rechtsextremistisch ein, davon seien 12.700 gewaltbereit. "Ein neuer Höchststand" bei einer seit 2014 steigenden Zahl. Der Minister sprach von einer "hohen Gefährdungslage". Die Zahlen "in Verbindung mit der hohen Waffenaffinität" dieser Szene seien besorgniserregend.
Mehr rechte Gewalt
Die rechtsextremistisch motivierte Gewalt hat dem Verfassungsschutz zufolge im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Demnach gab es 1.088 Gewalttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund. 2017 waren es noch 1.054. Dabei stieg die Zahl der versuchten Tötungsdelikte von vier auf sechs.
Als "geistige Brandstifter" bezeichnete Seehofer derweil die Mitglieder der "Identitären Bewegung Deutschland" (IBD). Diese seien nicht minder gefährlich als gewaltbereite Rechtsextremisten: "Sie sind jung, modern und geben sich als die Hüter der Verfassung aus," sagte er. Große Teile ihrer Ideologie seien aber nichts als Rassismus.
Im Fall Lübcke wird dem Innenminister zufolge der Frage nachgegangen, ob der Tatverdächtige ein Unterstützerumfeld hatte. Die Bundesanwaltschaft beantragte am Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord gegen zwei deutsche Staatsangehörige: Einem 64-Jährigen wird vorgeworfen, dem mutmaßlichen Mörder Stephan E. die Tatwaffe verkauft zu haben. Ein 43-jähriger Mann soll den Kontakt zwischen den beiden hergestellt haben. Beide sind am Mittwoch festgenommen worden.
Lübcke war Anfang Juni vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der CDU-Politiker war in rechten Kreisen verhasst, weil er eine humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen befürwortete. Der Tatverdächtige ist laut Verfassungsschutz seit Jahrzehnten in der rechten Szene aktiv.
"Jahrzehntelange Verharmlosung"
Der Bundestag beriet bei einer Aktuellen Stunde über den Fall. Politiker von SPD, Grünen, FDP und Linken wiesen auf mögliche Verbindungen zu den Morden des rechtsradikalen NSU hin. Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel, forderte, die Akten aus dem NSU-Verfahren müssten ausgewertet werden, statt sie für 40 Jahre unter Verschluss zu stellen. Denn darin seien Hinweise auf Verbindungen in den rechten Netzwerken zu finden.
Der Bundesverband Mobile Beratung, zu dem mehr als 40 Beratungsteams gegen Rechtsextremismus gehören, forderte mehr Unterstützung für diejenigen, die vor Ort gegen rechte Bedrohungen ankämpften. Existierende Beratungsstrukturen müssten besser ausgestattet werden, um zu gewährleisten, dass Menschen weiterhin angstfrei Position beziehen könnten, erklärte Sprecherin Bianca Klose.
Die gemeinnützige Amadeu Antonio Stiftung kritisierte, die rechtsextremen Strukturen und Netzwerke seien Ergebnis jahrzehntelanger Verharmlosung. Der Verfassungsschutz habe seine Glaubwürdigkeit verspielt. Die Vorsitzende Anetta Kahane forderte, statt mehr Mittel zum Rechtsextremismus bei dieser Behörde einzusetzen, brauche es dringend mehr Gelder für Demokratieprojekte und Opferberatungen.
Tausende demonstrieren in Kassel gegen Hass und Hetze

epd-bild/Andreas Fischer
Kassel (epd). Rund 8.000 Menschen haben nach Polizeiangaben am 27. Juni vor dem Regierungspräsidium Kassel an einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus teilgenommen. Der Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Martin Hein, rief dazu auf, gegenüber rechtsradikaler Intoleranz keine Toleranz mehr zu zeigen. Anlass für die von der Stadt und zahlreichen anderen Organisationen und Institutionen organisierte Kundgebung war die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni durch einen Rechtsextremisten.
Die Kirchen seien bereit, sich mit allen demokratischen Kräften zu verbünden, die sich für den Rechtsstaat und das freiheitliche Gemeinwesen einsetzten, sagte Bischof Hein. Dem Treiben der rechtsradikalen Szene in Kassel sei viel zu lange zugeschaut worden. Es sei erschreckend, dass 13 Jahre nach dem Mord an Halit Yozgat durch den NSU nun erneut ein politischer Mord in Kassel stattgefunden habe.
Der gewaltsame Tod von Walter Lübcke aber habe die Stadtgesellschaft aufgerüttelt, geeint Widerstand gegen alle Formen rechtsradikaler Gewalt zu zeigen. "Die Würde des Menschen zu schützen ist unser aller Aufgabe! Wer sie missachtet - sei es gewaltsam oder mit Worten -, stellt sich außerhalb unseres demokratischen Gemeinwesens. Da gibt es kein Wenn und Aber!", betonte Hein.
"Kultur der Wertschätzung"
Der katholische Fuldaer Bischof Michael Gerber rief angesichts der Hasstiraden in den sozialen Netzwerken vor und nach dem Tod Lübckes zu einer "Kultur der Wertschätzung" auf. Walter Lübcke sei für eine solche Kultur des aufrichtigen Respekts und der unbedingten Achtung voreinander ein bleibendes Vorbild, sagte er.
Zuvor hatte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) angesichts der vielen Teilnehmer von einem beeindruckenden Signal aus Kassel gesprochen. "Wir sind nicht der braune Sumpf der Nation", erklärte er. Der Mord an Lübcke habe ihn traurig, sprachlos und wütend gemacht.
Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) rief die Anwesenden dazu auf, dem Hass und der rechten Hetze im Netz persönlich entgegenzutreten. "Denn aus Worten können Taten werden", mahnte sie. Walter Lübcke sei mutig für die demokratische Grundordnung eingetreten.
Hassmails verlesen
Der Intendant des Kasseler Staatstheaters, Thomas Bockelmann, las aus anonymen Hassmails, die den Tod Lübckes betrafen, Passagen vor. "Das sind Zitate von Menschen, die sich in der Anonymität des Netzes einmal mächtig fühlen wollen." Es sei sehr wahrscheinlich, dass Walter Lübcke ohne diese rechte Hetze noch leben würde, folgerte er.
Während der Veranstaltung wurde von den Anwesenden unter anderem auch das Lied "Imagine" von John Lennon gemeinsam gesungen. Am Ende der Veranstaltung, die unter dem Motto "Zusammen sind wir stark" stand, ließen Mitarbeiter des Regierungspräsidiums 99 bunte Luftballons zum Gedenken an Lübcke in den Himmel steigen.
Laschet: Mit Hetze gegen Demokraten beginnt die Gefahr

epd/Hans-Jürgen Bauer
Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Hetze gegen Demokratievertreter, Kommunalpolitiker und ehrenamtlich Engagierte als Angriff und Gefahr für die Demokratie bezeichnet. Nicht erst mit einem Schuss oder gar Mord, sondern bereits mit dem Bedrohen von Menschen, die aus Angst ihr Engagement für Politik und Gesellschaft aufkündigten, setze die Gefahr für die Demokratie ein, sagte Laschet am 26. Juni im Düsseldorfer Landtag. Die Fraktionen der Grünen, von CDU und FDP sowie der SPD hatten eine parlamentarische Aussprache über Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus in einer Aktuellen Stunde beantragt.
Der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, "der erste politische Mord seit 1945 in Deutschland muss uns wachrütteln", sagte Laschet. Der Ermordung sei eine jahrelange Hetze gegen den CDU-Politiker vorangegangen. Mit eine solchen Hetze entstehe ein Klima, das von Rechtsextremisten und Rechtsterroristen als vermeintliche Legitimation aufgegriffen werde. "Und dann ist irgendwann einer da, der auf die Terrasse geht und jemanden erschießt."
Extremistische Szene in Dortmund gerät ins Blickfeld
Auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Verena Schäffer, unterstrich, dass die Ermordung Lübckes am 2. Juni vor seinem Haus ein direkter Angriff auf die Demokratie und Gesellschaft sei. Mit dem Mord sollten Demokraten eingeschüchtert werden, sagte sie.
Mögliche Kontakte des geständigen Tatverdächtigen zu "Combat 18", dem militanten Arm des Neonazi-Netzwerks "Blood & Honour", machten deutlich, dass extremistische Szenen wie in Dortmund und Kassel in den Blick genommen werden müssten. "Combat 18" müsse verboten werden, betonte Schäffer. Mit den Anschlägen und Morddrohungen gegen andere Politiker werde deutlich, dass es nicht um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem gehe.
SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty erinnerte an Migranten, Flüchtlinge, Helfer und Kommunalpolitiker. Sie seien besonders gefährdet, Opfer von rechter Gewalt und Hetze zu werden. "Aber wie viele haben wir bereits verloren, weil sie die Bedrohungen nicht mehr aushalten?", fragte er und sprach von ungezählten Bürgern, die sich aus Angst nicht mehr für andere einsetzten. "Wir dürfen keinen einzigen Demokraten mehr in diesem Land verlieren, mahnte er. Die Anforderungen an Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden, den Rechtsstaat zu schützen, seien deutlich höher geworden.
Markus Wagner von der AfD, der in der Aussprache unter anderem beklagt hatte, dass noch vor einer endgültigen Mordaufklärung im Fall Lübcke bereits "parteipolitische Ausschlachter" am Werk seien und der Fall instrumentalisiert werde, wurde von den Vertretern aller übrigen Fraktionen scharf kritisiert. Sie betonten, gemeinsam gegen Terror und Extremismus einzutreten.
"Revolution Chemnitz": Bundesanwaltschaft erhebt Anklage
Karlsruhe/Chemnitz (epd). Die Bundesanwaltschaft hat gegen acht mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Revolution Chemnitz" Anklage erhoben. Den Männern im Alter von 21 bis 31 Jahren werde vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, teilte der Generalbundesanwalt am 28. Juni in Karlsruhe mit. Den Ermittlern zufolge habe die Gruppierung den gewaltsamen Sturz der Regierung angestrebt. Dabei sei der 31-jährige Christian K. Rädelsführer gewesen.
Er habe die zentrale Führungsposition eingenommen, die Ausrichtung der Gruppe bestimmt und Planungen koordiniert, hieß es. Die Anklage wurde den Angaben zufolge am 18. Juni vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Dresden erhoben. Bereits am 25. Juni hatten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.
Die Angeschuldigten gehören der Anklage zufolge der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und verstanden sich als führende Personen in der rechtsextremen Szene Sachsens. Spätestens am 10. September 2018 hätten sie sich zur Gruppierung "Revolution Chemnitz" zusammengeschlossen. Zuvor hatte es nach dem gewaltsamen Tod eines Chemnitzers Ende August am Rande des Stadtfestes Unruhen in der Stadt gegeben.
"Probelauf" für Tag der Deutschen Einheit
Die Angeschuldigten hätten auf der Grundlage ihrer rechtsextremen und bisweilen offen nationalsozialistischen Gesinnung ein "revolutionäres", auf die Überwindung des demokratischen Rechtsstaates gerichtetes Ziel verfolgt, hieß es weiter. Zu diesem Zweck beabsichtigten sie der Bundesanwaltschaft zufolge gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge auf ausländische Mitbürger und politisch Andersdenkende. Zu ihren erklärten Gegnern hätten zudem Politiker und Angehörige des sogenannten gesellschaftlichen Establishments gehört.
Die rechtsextreme "Revolution" und "Systemwende" sollte der Anklage zufolge mit einem symbolträchtigen Geschehen am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2018 eingeleitet werden. Dafür führten die Angeschuldigten der Bundesanwaltschaft zufolge am 14. September 2018 auf der Schlossteichinsel in Chemnitz einen "Probelauf" durch.
Sämtliche Angeschuldigten befinden sich in Haft. Christian K. war bereits am 14. September festgenommen worden, die übrigen Angeschuldigten am 1. Oktober auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft.
Regierung verschärft Richtlinien zum Export von Kleinwaffen
Berlin (epd). Die Bundesregierung will den Export von Kleinwaffen weiter einschränken und hat dafür seit 20 Jahren geltende Richtlinien verschärft. Das Kabinett beschloss nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums am 26. Juni in Berlin, dass der Export von Kleinwaffen in sogenannte Drittländer grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden soll. Bei Drittstaaten handelt es sich um Länder außerhalb von Nato und Europäischer Union (EU) mit Ausnahme der gleichgestellten Länder wie beispielsweise die Schweiz.
Die Lieferung von Kleinwaffen ist besonders umstritten, da diese insbesondere in bürgerkriegsähnlichen Konflikten eingesetzt werden. In dem Segment belief sich der Gesamtwert der Genehmigungen im vergangenen Jahr laut Rüstungsexportbericht 2018 auf knapp 39 Millionen Euro, der Anteil des Wertes bei Genehmigungen an Drittländer lag hierbei bei rund einem Prozent. Unter anderem wurden Teile für Maschinengewehre an die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert. Menschenrechtsgruppen kritisieren solche Rüstungslieferungen wegen der Beteiligung des Golfstaates am Krieg im Jemen.
Im Zweifel Ablehnung
Die Bundesregierung betont in ihrem aktuellen Beschluss aber gleichzeitig auch die politische Unterstützung für Rüstungskooperationen auf europäischer Ebene und die Stärkung der "europäischen verteidigungsindustriellen Basis". Dieses Bekenntnis zu den gemeinsamen Projekten fließt den Angaben nach auch in die Abwägungen bei Rüstungsexportentscheidungen ein. Im vergangenen Jahr hatte zum Beispiel der deutsche Exportstopp nach Saudi-Arabien wegen gemeinsamer Rüstungsprojekte für Unmut in Frankreich und Großbritannien gesorgt.
Neben den strikteren Regeln für Kleinwaffen sollen auch bei den Ausfuhrgenehmigungen für Technologie geprüft werden, "ob hierdurch der Aufbau von ausländischer Rüstungsproduktion ermöglicht wird", die nicht im Einklang mit der restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung stehe. Außerdem sollen der Endverbleib der Rüstungsgüter konsequenter überprüft werden und bei Zweifeln Ausfuhranträge abgelehnt werden.
Kabinett billigt Modernisierung des Entschädigungsrechts
Die klassische Kriegsopferfürsorge und das bisherige Opferentschädigungsgesetz werden durch das soziale Entschädigungsrecht abgelöst. Es sieht schnelle und gezielte Hilfen für Gewalt- und Terroropfer sowie höhere Leistungen vor.Berlin (epd). Opfern von Gewalttaten soll in Zukunft schneller und besser geholfen werden. Das Bundeskabinett billigte am 26. Juni eine Modernisierung des Entschädigungsrechts. Der Gesetzentwurf von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) sieht höhere Geldleistungen für Hinterbliebene und Geschädigte vor. Der Zugang zu beruflichen Wiedereingliederungsmaßnahmen oder Hilfen im Alltag wird erleichtert. Trauma-Ambulanzen, die sich schnell und gezielt um die Opfer kümmern, sollen künftig flächendeckend zur Verfügung stehen.
Heil erklärte nach dem Kabinettsbeschluss, es sei der Koalition ein wichtiges Anliegen, die soziale Entschädigung so zu verbessern, dass sich die Betroffenen mit ihrem Schicksal nicht mehr alleingelassen fühlten. Mit dem Gesetzentwurf reagiert die Bundesregierung auch auf Kritik am Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 in Berlin.
Ansprüche auch für Opfer psychischer Gewalt
Eine grundlegende Reform des sozialen Entschädigungsrechts steht aber schon seit Jahren auf der politischen Agenda. Das künftige Sozialgesetzbuch XIV löst das bisherige Opferentschädigungsgesetz und das Bundesversorgungsgesetz ab, das für die Versorgung der Kriegsopfer geschaffen worden war. Künftig liegt der Fokus neben der Versorgung dauerhaft geschädigter Menschen auf schnellen Hilfen und Unterstützung bei der Überwindung der Tatfolgen.
In den zuständigen Ämtern soll es Fallmanager geben, die Terror- oder Gewaltopfern helfen, Anträge zu stellen. Auch erlittene psychische Gewalt wie Stalking oder passive Gewalt wie die Vernachlässigung eines Kindes können künftig zu Entschädigungsansprüchen führen. Die Zahlbeträge, die sich nach dem Grad der Schädigung richten, werden deutlich erhöht, zum Teil mehr als verdoppelt. Auch die Entschädigungszahlungen für Witwen, Witwer und Waisen steigen. Ob ein Opfer Deutscher ist oder nicht, spielt künftig keine Rolle mehr.
Hohe Hürden für Betroffene sexueller Gewalt
Auch sogenannte Schockschadens-Opfer, also Menschen, die beispielsweise einen Terroranschlag miterleben, können Anträge auf Entschädigungsleistungen stellen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie eine persönliche Beziehung zu einem Opfer haben. Die meisten Regelungen werden erst 2024 wirksam. Einige Verbesserungen sollen rückwirkend zum 1. Juli 2018 in Kraft treten, darunter die Gleichbehandlung der Opfer unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und die Erhöhung der Zahlungen an Waisen.
Opfern sexueller Gewalt soll das modernisierte Entschädigungsrecht ebenfalls zugutekommen. In der Praxis werde es sich aber insbesondere bei Missbrauchsopfern kaum auswirken, bemängelte der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. Er sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die Hürden seien für Betroffene sexueller Gewalt in vielen Fällen zu hoch. Dann bleibe die Tür zur Entschädigung verschlossen. Für diese Gruppe sei "keine gute Lösung" gefunden worden, bilanzierte Rörig.
Die Grünen begrüßten, dass die Reform schnelle Hilfen, ein Fallmanagement und Hilfen für die Opfer psychischer Gewalt vorsehe. Neues dürfe aber nicht auf Kosten der klassischen Versorgung von Gewaltopfern gehen, mahnten die Sprecher für Sozial- und Rechtspolitik, Sven Lehmann und Katja Keul. Der Bundestag muss das Gesetz noch beraten. Auch der Bundesrat muss zustimmen.
Flüchtlingsbürgen auch von Forderungen der Sozialämter entlastet
Bürgen für Flüchtlinge aus Syrien können aufatmen. Auch die kommunalen Sozialämter sollen auf ihre Forderungen verzichten. Das hat das Bundessozialministerium nun klargestellt.Berlin, Minden (epd). Menschen, die für syrische Flüchtlinge gebürgt haben, werden nun auch von kommunalen Sozialämtern in der Regel nicht mehr zur Kasse gebeten. Das geht aus einem Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales an die Sozialministerien der Bundesländer hervor, das dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Im März hatte die Bundesagentur für Arbeit die Jobcenter angewiesen, von Forderungen abzusehen. Für die kommunalen Sozialämter stand eine Lösung bislang noch aus. Flüchtlingsinitiativen und Kirchengemeinden begrüßten die Entscheidung.
Es sei davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Bürgen sich bei der Abgabe ihrer Kostenübernahmeerklärung über deren Tragweite nicht bewusst gewesen sei, sagte ein Sprecher des Bundessozialministeriums. Die bisher bestehende Rechtsunsicherheit sei nun beseitigt. Die dem Bundessozialministerium unterstehende Bundesagentur für Arbeit hatte im März durch eine Weisung an die Jobcenter Flüchtlingsbürgen entlastet, die sich Rückforderungen von an syrische Bürgerkriegsflüchtlinge gezahlter Arbeitslosenhilfe gegenübersahen.
Von Erstattungsforderungen freigestellt
Laut dem Brief des Bundessozialministeriums sind die im Blick auf die Forderungen der Jobcenter an Flüchtlingsbürgen getroffenen Anordnungen auf die Sozialämter "inhaltlich übertragbar". Demnach sind Verpflichtungsgeber aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz durchweg von Erstattungsforderungen der Sozialämter über Hilfe zur Grundsicherung im Alter freigestellt.
Von der Zahlungspflicht ausgenommen werden außerdem Bürgen, die ihre Erklärung auf einem bundeseinheitlich verwendeten Formular abgegeben hatten, das eine Haftung "bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels zu einem anderen Aufenthaltszweck" vorsah. Gleiches gilt, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Bürgschaft "finanziell nicht ausreichend leistungsfähig" waren. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bürgen sei durch die Behörden "nicht durchgängig und ausreichend" geprüft worden, sagte der Sprecher.
Ein Bündnis aus Initiativen und evangelischer Kirche in Minden äußerte sich erleichtert, dass nun in der Regel alle Flüchtlingsbürgen entlastet würden: "Für das bürgerschaftliche Engagement und den sozialen Zusammenhalt fatale Fehlentscheidungen können auch wieder korrigiert werden", erklärten Vertreter des Welthauses Minden, des Kirchenkreises und des Vereins Minden für Demokratie und Vielfalt.
21 Millionen Euro
Mit seinem Brief reagierte das Ministerium nach eigenen Angaben auf Anfragen der Bundesländer Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Das Schreiben, das auf den 13. Juni datiert ist, betrifft alle Verpflichtungserklärungen, die vor dem Inkrafttreten des Integrationsgesetzes am 6. August 2016 im Zusammenhang mit Landesaufnahmeprogrammen abgegeben wurden. Bei der Überprüfung der Erstattungsforderungen sollen die Sozialämter in der Regel nach Aktenlage entscheiden. Bürgen, die bereits gezahlt haben, müssen dafür allerdings einen Antrag stellen.
Seit 2017 hatten Jobcenter und Sozialämter Rechnungen an Einzelpersonen, Initiativen und Kirchengemeinden verschickt, die sich von 2013 bis 2015 zur Übernahme des Unterhalts für syrische Flüchtlinge verpflichtet hatten. Die Bürgen waren davon ausgegangen, nur so lange für die Syrer aufkommen zu müssen, bis die Asylverfahren positiv beschieden sind. Diese Auffassung vertraten damals unter anderem die Länder NRW, Hessen und Niedersachsen, während der Bund von einer Fortgeltung der Haftung ausging. Mit dem Integrationsgesetz setzte der Bund seine Position durch.
Laut einer Statistik der Bundesregierung betrugen allein die Forderungen der von Bundesagentur und Kommunen zusammen getragenen Jobcenter an Flüchtlingsbürgen mindestens 21 Millionen Euro.
Bundesrat billigt Migrationspaket der Koalition
Der Bundesrat hat dem Migrationspaket grünes Licht gegeben. Es sieht Öffnungen für ausländische Fachkräfte und Verschärfungen vor allem für abgelehnte Asylbewerber vor. "Herz und Härte" würden Gesetz, sagte der baden-württembergische Innenminister.Berlin (epd). Mehr Fachkräfteeinwanderung, mehr Abschiebung: Das Migrationspaket der großen Koalition kann inkraft treten. Der Bundesrat billigte am 28. Juni in Berlin die Großvorhaben von Union und SPD, darunter das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Verschärfungen im Asylrecht, die für höhere Abschiebezahlen sorgen sollen. Es hatte zuvor viel Rumoren aus den Ländern gegeben. Am Ende wurde aber keinem der sieben Gesetze die Zustimmung verweigert oder der Vermittlungsausschuss angerufen.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll ermöglichen, dass mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland nach Deutschland kommen können. Bislang ist das auf Akademiker und Mangelberufe beschränkt. Außerdem soll gut integrierten Flüchtlingen ermöglicht werden, durch Arbeit ein langfristiges Bleiberecht zu bekommen. Für diese sogenannte Beschäftigungsduldung hatten die Länder großzügigere Regelungen angemahnt, weil sie befürchten, dass für viele Betroffenen die Hürden zu hoch sind. Der Bundesrat hat am Freitag nochmals eine entsprechende Entschließung verabschiedet, das Gesetz aber nicht aufgehalten.
Abschieberegeln verschärft
Das sogenannte Geordnete-Rückkehr-Gesetz verschärft die Regeln zur Abschiebung, unter anderem durch die Ausweitung der Abschiebehaft und die Einführung eines neuen Duldungsstatus für Menschen mit ungeklärter Identität. Die Regelungen sollen dafür sorgen, dass künftig weniger Abschiebungen scheitern. Die Verschärfungen hatten zuvor vor allem für Kritik im Rechtsausschuss der Länderkammer gesorgt. Die erforderliche Mehrheit, um das Gesetz aufzuhalten, kam im Plenum aber nicht zustande.
Ebenfalls passierte auch die lange zwischen Bund und Ländern umstrittene Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes die Länderkammer. Damit werden die Sachleistungen für Asylbewerber zwar teilweise erhöht. Die Geldleistungen werden aber gekürzt, so dass für viele Gruppen unter dem Strich eine Kürzung der Leistungen steht. Die monatlichen Zuwendungen für alleinstehende Asylbewerber betragen künftig 344 Euro, zehn Euro weniger als aktuell. Für Kinder im Schulalter steigen die Leistungen im Zuge der geplanten Reform des Asylbewerberleistungsgesetzes. Eine früher von der Koalition geplante drastischere Kürzung scheiterte 2016 im Bundesrat.
Zum Gesamtpaket gehört auch die Entfristung des Integrationsgesetzes, mit der die Wohnsitzauflage für Flüchtlinge dauerhaft verlängert wird. Auch die Erweiterung für den Zugang zu Sprachkursen wurde vom Bundesrat gebilligt.
Linke und Grüne dagegen
Vertreter von Union und SPD verteidigten das Migrationspaket, dessen Verschärfungen für Asylbewerber bei Nichtregierungsorganisationen für scharfen Protest gesorgt hatten. Menschen ohne Bleiberecht müssten auch in ihre Heimatländer zurückgeführt werden, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD). Das sei "eine Frage der Glaubwürdigkeit". Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte: "Herz und Härte - beides wird heute Gesetz." Vertreter von Linken und Grünen kritisierten die Verschärfungen. Sie hatten angekündigt, gegen das Gesetz zu stimmen.
Keinen Einspruch erhob der Bundesrat auch gegen das Gesetz, mit dem Terrorkämpfern mit doppelter Staatsbürgerschaft der deutsche Pass entzogen werden kann, die Frist zur Rücknahme der deutschen Staatsbürgerschaft verlängert und die Vergabe des Passes an die Einordnung "in die deutschen Lebensverhältnisse" geknüpft wird. Das Gesetz war erst am Donnerstagabend vom Bundestag verabschiedet und besonders kurzfristig auf die Tagesordnung der Länderkammer gesetzt worden.
Andere Welten: Bamf-Chef trifft erstmals Flüchtlingshelfer
Einmal im Jahr treffen sich Experten und Engagierte aus der Flüchtlingshilfe zu einem Symposium in Berlin. Erstmals war in diesem Jahr Bamf-Chef Sommer für eine Diskussion zu Gast. Das Gespräch war kontrovers, Sommer will trotzdem wiederkommen.Berlin (epd). Dem Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf), Hans-Eckhard Sommer, geht der Ruf eines Hardliners voraus. Das weiß er selbst und sagte das auch gleich zu Beginn seiner Rede beim Flüchtlingsschutzsymposium am 25. Juni in Berlin. Er bestehe darauf, Recht einzuhalten, sagte er. Wenn ihn das zum Hardliner mache, widerspreche er dem Ausdruck nicht. Flüchtlingsschutz sei wichtiger denn je, sagte Sommer mit Verweis auf die aktuellen UN-Zahlen, wonach mehr als 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Es sei aber nicht jeder ein Flüchtling, "der illegal die Grenzen unseres Landes überquert", schickte er hinterher. Der Ton war gesetzt.
Erstmals traf Sommer, der als Bamf-Präsident nun rund ein Jahr im Amt ist, in dieser Breite auf die Aktiven und Experten aus der Flüchtlingshilfe von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen. Sie hatten in den vergangenen Monaten viel Kritik an der Asylpolitik von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und auch am Bamf geübt. Die Verschärfung der Asylgesetze, finden sie, schlägt sich auch in den Verfahren nieder. Die Kirchen merken es nicht zuletzt am Kirchenasyl. Nachdem die Innenminister von Bund und Ländern im vergangenen Jahr die Regeln verschärft hatten, gibt es vom Bamf kaum noch nachträgliche Anerkennungen für die Menschen, die von Gemeinden als Härtefälle angesehen wurden.
Kein Applaus
Bis Ende April wurde in diesem Jahr nur in zwei Fällen dem Ersuchen der Gemeinden stattgegeben, 145 weitere Anträge wurden abgelehnt, wie Mitte Juni eine Anfrage der Linken an die Bundesregierung ergab. Den Vorwurf, das Bamf höhle das Kirchenasyl aus, will sich Sommer dennoch nicht gefallen lassen. Den Rückgang der Anerkennungen begründet er damit, dass die Dublin-Verfahren in seiner Behörde deutlich besser geworden seien. Früher habe es Härtefälle gegeben, die seinem Amt "durch die Lappen" gegangen seien. "Heute erkennen wir die Härtefälle selbst", sagte Sommer: "Ich kann hier beim besten Willen keine Unmenschlichkeit erkennen."
In den Reihen des Publikums entsteht ungläubiges Murmeln. Einmal im Jahr, dieses Jahr zum 19. Mal, treffen sich hier Haupt- und Ehrenamtler der Flüchtlingshilfe von Kirchen, Diakonie und Caritas, Organisationen wie Pro Asyl und Amnesty International. Es ist ein Publikum, bei dem Sommer für seine strikte Auslegung des Asylrechts kaum Applaus erwarten kann. Er bekommt auch keinen.
Protest aus dem Publikum
An einigen Stellen sind es Buh-Rufe, die das angespannte Zuhören in der Friedrichstadtkirche auf dem Gendarmenmarkt unterbrechen. Protest gibt es etwa, als Sommer sagt, nur 36,2 Prozent aller Asylverfahren endeten mit der Anerkennung eines Schutzgrundes - gehört doch zur vollständigen Darstellung immerhin, dass es auch nur in etwa einem Drittel Ablehnungen gibt und bei einem weiteren Drittel - den Dublin-Fällen - keine Schutzüberprüfung, sondern nur das Bemühen um die Überstellung in einen anderen EU-Staat erfolgt.
Vehementen Protest gibt es für die Aussage Sommers, mit dem Anstieg der Antragszahlen von Nigerianern mache sich die Polizei auch Sorgen über "damit importierte Kriminalität". "Das finde ich eine unglaublich rassistische Aussage", hält eine Teilnehmerin Sommer entgegen. Sie macht auch deutlich, dass sie bei den Schutzquoten die Dinge völlig anders sieht. In ihren Augen habe jeder einen Schutzgrund und sei es aus humanitären Gründen, sagt sie.
Bei dieser sehr grundsätzlichen Kritik wird letztlich auch Sommer grundsätzlich: "Da leben wir in anderen Welten", sagte der Behördenchef. Trotzdem versprach er am Anfang seiner Rede, im nächsten Jahr wiederzukommen.
Pro-Asyl-Menschenrechtspreis für Rechtsanwalt Fahlbusch
Frankfurt a.M. (epd). Der Menschenrechtspreis der Stiftung Pro Asyl geht in diesem Jahr an den Rechtsanwalt Peter Fahlbusch aus Hannover. Damit werde sein "Einsatz gegen rechtswidrige Abschiebungshaft" gewürdigt, teilte die Stiftung am 28. Juni in Frankfurt am Main mit. Die Auszeichnung wird am 31. August in Frankfurt verliehen. Sie ist mit einem Preisgeld von 5.000 Euro und der von dem Darmstädter Kunstprofessor Ariel Auslender gestalteten "Pro Asyl-Hand" verbunden.
Peter Fahlbusch habe seit 2001 bundesweit mehr als 1.800 Menschen in Abschiebungshaft vertreten, würdigte die Stiftung. Rund die Hälfte von ihnen sei zu Unrecht inhaftiert gewesen, im Durchschnitt jede Person knapp vier Wochen lang. Zudem habe er das wegweisende Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 17. Juli 2014 zur Abschiebungshaft erstritten, wonach abgelehnte Asylbewerber nicht in einem normalen Gefängnis untergebracht werden dürfen.
"Es wird künftig noch mehr auf Juristen wie Peter Fahlbusch ankommen, um Menschen aus rechtswidriger Haft zu befreien", sagt Günter Burkhardt, Vorstand der Stiftung Pro Asyl und Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. "Freiheitsentziehung darf nicht willkürlich und uferlos erfolgen."
Nordrhein-Westfalen regelt islamischen Religionsunterricht neu
Düsseldorf (epd). Nordrhein-Westfalen regelt den islamischen Religionsunterricht neu und bindet weitere Vertreter der Muslime ein. Ab August sollen mehr Islamverbände als bisher auf die Inhalte Einfluss nehmen können. Das sieht eine Novelle des Schulgesetzes vor, die der Landtag am 26. Juni in Düsseldorf mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der Opposition von SPD und Grünen verabschiedete. Die AfD stimmte dagegen.
Nach der Novelle soll nun mit einzelnen Islamverbänden ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen werden. Auf dieser Grundlage entsendet jede Einzelorganisation einen Vertreter in eine Kommission, die mit Mehrheit über Unterrichtsinhalte und Lehrerauswahl befindet. Bislang war dafür ein Beirat zuständig, der vom Schulministerium berufen wurde. Dieses Modell läuft aber zum 31. Juli aus.
Übergangslösung
In dem Beirat waren nur vier Organisationen vertreten: der Islamrat (IR), der Verband der Islamischen Kulturzentren (VIKZ), der Zentralrat der Muslime (ZMD) und der deutsch-türkische Moscheeverband Ditib, dessen Mitgliedschaft aber wegen Kritik an seiner Nähe zum türkischen Staat zuletzt ruhte. In das neue Gremium entsendet die Landesregierung zudem keine eigenen Vertreter mehr.
Die Novelle ist eine Übergangslösung, die bis 2025 gelten soll. Hintergrund ist eine ausstehende juristische Entscheidung um die Frage, ob die Islamverbände beim Religionsunterricht vergleichbare Rechte erhalten sollen wie die katholische und die evangelische Kirche und als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden. Eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster, das die Islamverbände solche Rechte nicht haben, hatte das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben und zur Prüfung an das OVG zurückverwiesen.
Die Novelle schreibt nun fest, dass das Schulministerium übergangsweise mit islamischen Organisationen zusammenarbeiten kann, die "auf absehbare Zeit" als "Ansprechpartner" zur Verfügung stehen - vorausgesetzt, dass sie die im Grundgesetz festgeschriebenen Prinzipien wie Demokratie und Rechtsstaat achten.
Mazyek fordert Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit

epd-bild/Philipp Reiss
Dresden/Köln (epd). Zehn Jahre nach dem rassistisch motivierten Mord an der Ägypterin Marwa El-Sherbini in Dresden sieht er eine enorme Verschlechterung des gesellschaftlichen Klimas. "Die ständige Unterschätzung von Rassismus und Menschenfeindlichkeit führt immer wieder dazu, dass Rechtsextremisten jedes Mal eine Schippe drauflegen können", sagte Mazyek dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Der Tod von Marwa El-Sherbini sei nicht ausreichend aufgearbeitet worden. Die Anerkennung der Religionen sei zwar in großen Teilen der Gesellschaft da. Aber es fehle der Aufstand der Anständigen gegen die demokratiefeindliche und menschenfeindliche Ideologie einer radikalen Minderheit. "Die Gefahr ist die Schweigsamkeit", sagte Mazyek. Dabei müssten alle Demokraten sich erheben, aufstehen, aktiv werden. Das sei das Gebot der Stunde. Es dürfe keine Mehrheit für rassistische Positionen geben.
"Wir haben es hier mit einer braunen RAF zu tun"
"Auch wir stehen auf der sogenannten schwarzen Liste von Rechtsextremen", sagte der Zentralratsvorsitzende der Muslime, "wir müssen das sehr ernst nehmen." Spätestens nach dem NSU und allerspätestens nach dem politischen Mord an Walter Lübcke, müsse allen klar sein, "dass wir es hier mit einer braunen RAF zu tun haben, die keine versprengte Zelle ist, sondern einen rechtes Terrorphänomen, dem wir uns als Gesellschaft und vor allem als Staat endlich wehrhaft entgegen stellen müssen", betonte er.
Marwa El-Sherbini wurde am 1. Juli 2009 am Dresdner Landgericht brutal niedergestochen. Das Motiv des zu lebenslanger Haft verurteilten Täters war Hass auf Muslime. Der Mord an der schwangeren Frau geschah vor den Augen ihres Ehemannes und ihres gemeinsamen Kindes. Die Tat löste weltweit Entsetzen und Proteste aus.
Mazyek fordert einen Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit. Dieser müsste mit Nachdruck auf einen wachsenden Rassismus hinweisen, der nicht selten mit Körperverletzungen verbunden sei, sagte er dem epd.
Aus den Anschlägen auf die Moscheen in Christchurch (Neuseeland) folgt nach Ansicht von Mazyek eine klare Botschaft: "Die islamischen Einrichtungen müssen geschützt werden." Polizeilicher Schutz diene einerseits als Abschreckung und andererseits als Schutz selber.
Selbstverständlich gehöre der Islam zu Deutschland, sagte Mazyek. Aber eine wesentlich kleinere, laute und radikale Gruppe von Antidemokraten trage Verunsicherung und einen vehementen Vertrauensverlust in staatliche Institutionen in die Gesellschaft hinein. "Und sie schüren Hass gegen Minderheiten", betonte er. Das sei "der Treibsand, mit dem sie arbeiten".
Geschäftsführer Jüdischer Gemeinde zieht deprimierende Bilanz

epd-bild/Barbara Frommann
Düsseldorf (epd). Der Verwaltungsdirektor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Michael Szentei-Heise, zieht nach 33 Jahren im Amt deprimiert Bilanz. Er fühle sich wie die ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis und Paul Spiegel, am Ende ihrer Amtszeit, sagte Szentei-Heise der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (24. Juni). "Ich stehe nach 33 Jahren da und habe das Gefühl, ich habe nichts erreicht." Im Frühjahr kommenden Jahres scheidet Szentei-Heise aus dem Amt.
Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf sei immer eine offene Gemeinde gewesen, die eng mit der Stadtgesellschaft zusammengearbeitet habe, sagte der Jurist. Nun aber erhalte er immer mehr antisemitische Briefe, die sogar mit Klarnamen versehen seien. Zuletzt war in Düsseldorf ein Rabbiner auf offener Straße beleidigt worden. Dies sei kein Einzelfall, sagte Szentei-Heise. Auch wenn ihm noch kein Fall einer Ausreise bekannt sei, so werde doch zunehmend unter Gemeindemitgliedern über eine Ausreise nach Israel diskutiert.
Gemeindemitgliedern diskutieren über Ausreise nach Israel
Szentei-Heise unterstrich, dass Düsseldorf das Glück habe, einen Polizeipräsidenten zu haben, der "auf diesem Auge nicht blind ist". Auf der anderen Seite sei er überzeugt, "dass es ebenso wie bei der Bundeswehr in jeder Polizeibehörde eine gewissen Anzahl von rechten Sympathisanten gibt, die, wenn es darum geht, rechte Antisemiten zu schützen, ganz schnell abbiegen", sagte der Verwaltungsvorstand.
Mit Blick auf offen ausgetragenen Antisemitismus bewertet der Leiter der Düsseldorfer Mahn- und Gedenkstätte, Bastian Fleermann, den Sommer 2014 als Zäsur, als der Gaza-Konflikt eskalierte und auch in europäischen Städten auf die Straße getragen wurde. Auf einer Demonstration in Essen sei Juden der Tod gewünscht worden, sagte er in dem Gespräch mit der Zeitung. Der Historiker verwies darauf, dass zwar laut Studien in der Bundesrepublik relativ konstant 15 bis 20 Prozent der Menschen ansprechbar seien für antisemitische Stereotypen. Geändert hätten sich jedoch die medialen Möglichkeiten, Antisemitismus zu verbreiten und gezielt einzusetzen.
Fleermann begrüßte, dass der Düsseldorfer Stadtrat beschlossen habe, dauerhaft eine halbe Stelle an der vor zwei Jahren eingerichteten Antirassismus- und Antidiskriminierungsstelle zu finanzieren. Zudem seien die Besucherzahlen der Düsseldorfer Mahn- und Gedenkstätte in seiner Amtszeit von anfänglich 12.000 vor zwölf Jahren auf deutlich über 30.000 jährlich gestiegen. "Das ist auch eine Abstimmung mit den Füßen und zeigt, dass sich die Menschen für die NS-Geschichte in ihrer Stadt interessieren."
Verein zu jüdischem Leben in Deutschland richtet Geschäftsstelle ein
Köln (epd). Der Verein "321-2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" treibt seine Vorbereitungen für das Jubiläum im kommenden Jahr voran. Zum 1. Juli hat die Geschäftsstelle ihre Arbeit aufgenommen, wie der Verein in Köln mitteilte. Sie ist in der Synagogengemeinde Köln untergebracht und mit einer Historikerin und einem Kulturwissenschaftler besetzt.
Der Verein plant nach den Worten seines Vorsitzenden Matthias Schreiber bundesweit "Veranstaltungen, die den Reichtum jüdischen Lebens in Geschichte, Gegenwart und Zukunft deutlich machen sollen". Jeder Beitrag sei auch ein Zeichen gegen Antisemitismus, betonte er. Verbände, Kirchen, Organisationen, Unternehmen und staatliche Einrichtungen seien eingeladen, sich am Jubiläumsprogramm zu beteiligen und den Verein zu unterstützen. Mit dem Bund und den Bundesländern liefen derzeit Gespräche über eine finanzielle Förderung.
Die Erwähnung der jüdischen Gemeinde Köln in einem Edikt des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321 gilt als ältester Beleg jüdischen Lebens in Europa nördlich der Alpen. Sie jährt sich im kommenden Jahr zum 1.700. Mal. Zu den Gründungsmitgliedern und Unterstützern des Vereins zählen unter anderen der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sein Vize Abraham Lehrer sowie der Präsident des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Auch der Journalist und Kirchentagspräsident Hans Leyendecker, der frühere NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) und die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gehören dazu.
Stipendien für 38 bedrohte Wissenschaftler
Bonn (epd). In Deutschland sollen weitere 38 gefährdete Wissenschaftler aus anderen Ländern aufgenommen und mit Stipendien unterstützt werden, darunter 26 Forscher aus der Türkei. In der aktuellen Runde der Philipp-Schwartz-Initiative seien dafür 28 Forschungseinrichtungen ausgewählt worden, teilte die Alexander-von-Humboldt-Stiftung am 24. Juni in Bonn mit. Die Wissenschaftler, denen in ihren Heimatländern Krieg oder Verfolgung drohen, werden ab Oktober zwei Jahre lang finanziell unterstützt.
Die 28 Gasteinrichtungen seien aus 56 Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausgewählt worden, die gefährdete Wissenschaftler aufnehmen wollten, hieß es. Insgesamt seien 96 Forscher nominiert worden. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien unter anderem die Qualifikationen dieser Menschen und ihre Perspektiven für einen erfolgreichen beruflichen Neustart gewesen.
Forscher arbeiten in NRW-Hochschulen
Neben den Stipendien für die Forscher aus der Türkei werden sieben Stipendien an syrische Wissenschaftler vergeben, zwei Stipendien gehen an Forscher aus Kamerun sowie jeweils eines an Wissenschaftler aus dem Iran, der Ukraine und Simbabwe. Die Stipendiaten werden unter anderem in Aachen, Köln und Bochum arbeiten.
Die Philipp-Schwartz-Initiative wurde von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und dem Auswärtigen Amt 2016 ins Leben gerufen. Inzwischen stehe fest, dass sie dauerhaft vom Auswärtigen Amt finanziert werde, hieß es. Außerdem seien Stiftungen im In- und Ausland an der Finanzierung der Initiative beteiligt. Jährlich könnten so bis 50 Philipp-Schwartz-Stipendien gefördert werden.
Die Initiative ist nach Philipp Schwartz (1894-1977), einem Pathologen jüdischer Abstammung, benannt. Er musste 1933 vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen und gründete die "Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland".
Die Alexander-von-Humboldt-Stiftung ermöglicht nach eigenen Angaben jährlich mehr als 2.000 Forschern aus aller Welt einen wissenschaftlichen Aufenthalt in Deutschland. Die Stiftung pflege ein Netzwerk von weltweit mehr als 29.000 Humboldtianern aller Fachgebiete in mehr als 140 Ländern. Unter ihnen seien auch 55 Nobelpreisträger.
Landtag macht Weg zu G9-Rückkehr in NRW frei
Düsseldorf (epd). Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Rückkehr der Gymnasien in NRW zum neunjährigen Bildungsgang (G9) sind jetzt geschaffen. Der Landtag in Düsseldorf verabschiedete das Gesetz für den G9-Belastungsausgleich ohne Gegenstimme, wie das Ministerium für Schule und Bildung am 27. Juni in Düsseldorf mitteilte. Das Gesetz sieht die Erstattung von Investitionen, die vor allem durch die Schaffung zusätzlichen Schulraums entstehen, wie auch jährlich wiederkehrende Kosten unter anderem für Lernmittel und Schülerfahrkosten vor. Für die sogenannten investiven Kosten wird das Land demnach den Kommunen von 2022 bis 2026 rund 518 Millionen Euro erstatten.
Ministerin lobt "moderne Lehrpläne"
Bereits Mitte Juli 2018 hatte der Landtag das 13. Schulrechtsänderungsgesetz (G9-Gesetz) beschlossen. In der vergangenen Woche billigte zudem der Schulausschuss die überarbeitete Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I.
Die Umstellung auf das neue G9 werde die Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen nachhaltig verändern, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). "Es ist gut, dass dies nicht im politischen Streit geschieht wie bei einigen bildungspolitischen Reformen in der Vergangenheit, sondern mit breiter politischer Basis." Bei der inhaltlichen Ausgestaltung des neuen G9-Bildungsganges habe man "eng und vertrauensvoll" mit den Schüler-, Eltern- und Lehrerverbänden zusammengearbeitet. "Das Ergebnis sind moderne Lehrpläne und eine ausgewogene Stundentafel", betonte die Ministerin.
Zum Beginn des Schuljahres 2019/20 erfolgt die Umstellung auf das neue G9 an nahezu allen öffentlichen und privaten Gymnasien in Nordrhein-Westfalen mit den Klassen 5 und 6. Drei Schulen haben sich zu Beginn dieses Jahres mit einer Zweidrittelmehrheit der Schulkonferenz dazu entschieden, den bisherigen achtjährigen Bildungsgang (G8) zu erhalten: das Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld, die Georg-Müller-Schule Gymnasium in Bielefeld sowie das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden.
Jedem dritten Jugendlichen fehlt es an Gemeinsinn
Leverkusen, Bielefeld (epd). Einem Fünftel der Kinder und einem Drittel der Jugendlichen in Deutschland fehlt es einer Umfrage zufolge an Gemeinschaftssinn. Dazu gehörten Kompetenzen wie Empathie, Solidarität, Respekt, Hilfsbereitschaft und soziale Integration, hieß es in der am 25. Juni in Leverkusen veröffentlichten Studie der Universität Bielefeld im Auftrag der Bepanten-Kinderförderung. Zwar verfüge ein großer Teil der Heranwachsenden über einem positiven Sinn für das menschliche Miteinander, aber 22 Prozent der Sechs- bis Elfjährigen und 33 Prozent der Zwölf- bis 16-Jährigen zeigten hier Defizite, erklärte die Einrichtung des Leverkusener Pharmakonzerns Bayer.
Die Forscher befragten Kinder und Jugendliche den Angaben zufolge zu verschiedenen Aspekten von Gemeinschaftssinn wie Empathie und Solidarität, aber auch zur Abwertung von Schwächeren. Gemessen an ihrer Selbsteinschätzung zu Aussagen wie "Es macht mich traurig, wenn es anderen Kindern schlecht geht" zeigten der Studie zufolge 21 Prozent der Kinder nur ein geringes Empathievermögen. 49 Prozent der Sechs- bis Elfjährigen sind dagegen sehr mitfühlend. Dabei hätten 61 Prozent der Mädchen, aber nur 37 Prozent der Jungen überdurchschnittliches Mitgefühl, hieß es.
Unterschied zwischen den Geschlechtern
Unter den Jugendlichen sei sogar bei mehr als der Hälfte der Befragten (54 Prozent) die Empathie unterdurchschnittlich ausgeprägt. Dabei sei der Unterschied zwischen den Geschlechtern noch deutlicher, hieß es: 76 Prozent der männlichen, aber nur 31 Prozent der weiblichen Zwölf- bis 16-Jährigen seien unterdurchschnittlich empathisch.
Fast drei Viertel aller befragten Kinder (70 Prozent) seien zumindest teilweise gleichgültig gegenüber Leidtragenden, erklärten die Studienautoren weiter. Bei mehr als einem Viertel der Jungen und 16 Prozent der Mädchen fänden Aussagen wie: "Wenn ein anderes Kind Probleme in der Schule hat, ist es meistens selber schuld" sogar starke Zustimmung.
Von den Jugendlichen stimmen den Angaben zufolge 29 Prozent Aussagen zu wie: "Es gibt Gruppen in der Bevölkerung, die weniger wert sind als andere" und "Es ist ekelhaft, wenn Schwule sich in der Öffentlichkeit küssen". Allerdings lehnt eine Mehrheit von 78 Prozent der Mädchen und 64 Prozent der Jungen eine solche Haltung ab. Dabei neigten Jugendliche mit niedrigem sozioökonomischen Status mit 50 Prozent eher dazu, Randgruppen abzuwerten, als ihre Altersgenossen aus ökonomisch besser gestellten Haushalten (16 Prozent), hieß es. Zudem habe auch die Einstellung der Eltern einen signifikanten Einfluss auf die Haltung ihrer Kinder gegenüber Minderheiten.
Studienleiter Holger Ziegler von der Universität Bielefeld warnte vor den Folgen eines geringen Gemeinschaftssinns. "Wenn Jugendliche hier Defizite entwickeln und diese weitertragen, kann sich das verheerend auf das gesellschaftliche Klima auswirken", sagte der Professor für Erziehungswissenschaften. Die Daten deuteten darauf hin, dass es um kein Randphänomen, sondern einen potenziellen Flächenbrand gehe. "Das Prinzip der Solidargemeinschaft als Grundlage für eine gelingende Gesellschaft läuft Gefahr zu kippen", mahnte Ziegler.
Studie: Nur noch wenige Familien haben drei und mehr Kinder
Berlin (epd). Kinderreichtum ist in Deutschland selten geworden. Lediglich etwa 16 Prozent der Frauen hierzulande bringen drei oder mehr Kinder zur Welt, wie aus einer am 26. Juni in Berlin vorgestellten Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervorgeht. Zu Beginn der 1970er Jahre lag der Anteil noch bei etwa 30 Prozent. Insgesamt leben in Deutschland rund sieben Millionen Menschen in einem Haushalt mit drei oder mehr Kindern. Das entspricht rund 1,4 Millionen Familien. Mehrkindfamilien stießen häufig auf Vorbehalte in der Gesellschaft, heißt es in der Untersuchung der Wiesbadener Forschungseinrichtung weiter.
Die Mehrheit der kinderreichen Frauen hat laut Erhebung drei Kinder, nur vier Prozent haben vier oder mehr Kinder. Der Rückgang von Familien mit drei oder mehr Kindern sei - mehr noch als die Kinderlosigkeit vieler Paare - "der maßgebliche demografische Treiber" für den Geburtenrückgang in Deutschland und des niedrigen Niveaus der Geburtenrate, hieß es.
"Asozial"
Bei der Verbreitung kinderreicher Familien gibt es der Studie zufolge erhebliche regionale Unterschiede. So sei der Anteil kinderreicher Familien in ländlichen Gegenden höher als in Großstädten und in Westdeutschland höher als im Osten. Den niedrigen Anteil an kinderreichen Familien im Osten Deutschlands erklären die Bevölkerungsforscher vor allem historisch: Die Anforderungen an die Erwerbstätigkeit von Frauen in der ehemaligen DDR senkte deren Bereitschaft, mehr als zwei Kinder zu bekommen. Der niedrige Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund sei eine weitere Ursache.
Jeder Zehnte ist der Ansicht, Kinderreiche seien "asozial", wie es in der Studie hieß. 80 Prozent glauben, dass Kinderreiche von der Gesellschaft als "asozial" angesehen werden.
Moraltheologe: Fleischeslust im männlichen Rollenbild angelegt
Berlin (epd). Aus Sicht des Moraltheologen Michael Rosenberger müssen Rollenbilder aufgebrochen werden, um Männern Fleischverzicht schmackhaft zu machen. Allein mit moralischen Appellen seien Menschen nicht dazu zu bringen, weniger Fleisch zu essen, sagte Rosenberger der Zeitschrift "zeitzeichen" (Juli-Ausgabe). In Deutschland wie in den meisten Industrieländern äßen Männer doppelt so viel Fleisch wie Frauen.
Rosenberger hält es für ethisch geboten, den Konsum von Fleisch drastisch zu reduzieren, um unter anderem Tiere verantwortlich halten zu können, die Gesundheit der Menschen zu schützen und den Effekt der Tierhaltung auf den Treibhauseffekt zu begrenzen. Dazu sei es aber notwendig, Verhaltensmuster zu ändern, die schon in der Kindheit eingeübt würden. "Der kleine Bub bekommt die größere Fleischportion als das kleine Mädchen und wird auch mehr ermutigt, diese große Fleischportion zu essen", sagte der Professor von der Katholischen Privat-Universität Linz.
"Kann ein starker Mann vegetarisch leben?"
Rosenberger sagte: "Wir müssen Rollenbilder hinterfragen: Kann ein starker, gestandener Mann vegetarisch oder fleischarm leben?" Eine Umfrage habe gezeigt, dass es selbstbewussten Männern wesentlich leichter falle, auf Fleisch zu verzichten als denen, die sich minderwertig fühlen. "Sie wollen wie die germanischen Götter beweisen, dass sie stark und mächtig sind, indem sie beim Fleischverzehr ganz vorne dabei sind", sagte er.
Umwelt
Wenn Fliegen uncool wird

epd-bild / Gustavo Alabiso
Wuppertal, Dortmund (epd). "Flugscham" heißt das Gefühl, das in diesem Sommer etliche Menschen beschleicht, wenn sie in den Flieger steigen. So wie die von der Schwedin Greta Thunberg initiierten "Fridays-for-Future"-Proteste hat sich auch der Begriff - schwedisch: flygskam - nach Deutschland ausgebreitet. Denn: Schon allein ein Hin- und Rückflug von Berlin nach Malaga schlägt nach Angaben von "atmosfair" mit durchschnittlich 1,2 Tonnen Kohlendioxidausstoß im CO2-Fußabdruck zu Buche. Dieser liegt in Deutschland statistisch bei rund neun Tonnen pro Kopf.
Das schlechte Gewissen - eben "Flugscham" - bringt natürlich erst mal nichts: Für die Umwelt ist es egal, ob jemand mit schlechtem Gewissen oder begeistert in den Flieger steigt. Es kommt darauf an, das eigene Verhalten auch wirklich zu ändern. Aber andere an den Pranger zu stellen, wenn sie fliegen? "Meine Erfahrung ist, dass das in der Regel nicht funktioniert", sagt Michael Kopatz vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Die Lösung könne nicht darin liegen, Menschen zum Verzicht aufzufordern. "Das ist kein politisches Konzept."
"Schluss mit der Öko-Moral"
Zwar sei es richtig, so wenig wie möglich zu fliegen, sagte Kopatz, Autor eines Buches mit dem Titel "Schluss mit der Öko-Moral". Nur mit persönlichem Verzicht sei jedoch kein grundlegender Wandel zu erreichen. Entscheidend sei es vielmehr, politische Signale zu setzen, zum Beispiel durch Proteste gegen den Ausbau von Flughäfen wie den in Frankfurt am Main, sagte Kopatz. "Wenn alle die, die im Flugzeug sitzen und ein schlechtes Gewissen haben, nur einmal im Jahr zur Demo nach Frankfurt fahren würden, dann würde es ja schon viel schwerer fallen, den Flughafen auszubauen."
Kopatz findet auch die Häme gegenüber Umwelt-Aktivisten, die selbst Fernflüge antreten, nicht gerechtfertigt. "Man kann Selbstbegrenzung fordern, ohne sich selbst zu begrenzen", ist seine Meinung. Denn Menschen, die sich für den Klimaschutz einsetzen, wollten die Politik ermuntern, die Strukturen zu verändern. Das könnte etwa durch die Begrenzung der Flugkapazitäten oder durch die Verteuerung von Flügen durch Kerosin- oder CO2-Steuern geschehen. "Und am Ende betrifft mich das ja auch selbst, wenn ich dann nicht mehr so viel fliegen kann."
"Reisen ist das neue Fernsehen"
Eine Begrenzung des klimaschädlichen Flugverkehrs, etwa durch Verteuerung von Flügen sei notwendig, sagt auch der Umweltpsychologe Marcel Hunecke von der Fachhochschule Dortmund. Für eine echte Trendwende reiche das allerdings nicht aus. Vielmehr brauche es einen echten Bewusstseins- und Kulturwandel. "Wir sind derzeit eine Konsum-Erlebnis-Gesellschaft. Reisen ist das neue Fernsehen", sagt Hunecke. Viele Menschen wollten immer schneller immer mehr Reiseziele erreichen, um sich neue Erlebnisse zu verschaffen. "Wenn wir diese Anspruchshaltung nicht in den Griff kriegen, wie soll das dann funktionieren mit einer nachhaltigen Entwicklung?"
Tatsächlich deutet bislang nichts auf eine sinkende Fluglust der Deutschen hin: In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Flugpassagiere laut Statistischem Bundesamt um rund ein Drittel von 166,3 auf 222,5 Millionen. Das Wissen über die Ursachen des Klimawandels und ein allgemeines Umweltbewusstsein scheinen Menschen wenig vom Fliegen abzuhalten. Darauf deutet eine Erhebung des Bundesumweltamtes hin. Danach ist der Energieverbrauch für Urlaubsreisen gerade bei finanziell gut gestellten und kritisch-kreativen Menschen besonders hoch. Insgesamt zeige sich sogar, "dass der Energieverbrauch umso höher ist, je positiver die Umwelteinstellungen sind", heißt es in der Studie.
"Ablass" für das Fliegen?
Das spricht für Huneckes These, dass eine Verteuerung von Flügen allein keinen grundlegenden Wandel herbeiführen kann. Denn wohlhabende Menschen, die bereits jetzt für einen Großteil des CO2-Ausstoßes durch Flüge verantwortlich sind, könnten sich Preissteigerungen auch am ehesten leisten. Höhere Preise etwa durch eine CO2-Steuer oder durch Kompensationszahlungen an Umweltprojekte könnten dann auch als eine Art "Ablass" für das Fliegen betrachtet werden.
Vor diesem Hintergrund sieht Hunecke "Flugscham" durchaus auch positiv: als einen ersten Schritt hin zu einem allgemeinen Bewusstseinswandel, der dann auch zu einer Verhaltensänderung führen kann. Die jungen Leute der "Fridays-for-Future"-Bewegung hätten die von der Wissenschaft schon lange prognostizierte Dramatik der Situation auf die Straße getragen, sagt der Umweltpsychologe: "Im Moment sieht es wirklich gut aus, dass so ein kultureller Wandel startet. Auch weil immer mehr Menschen in der Mitte der Gesellschaft von dem 'immer mehr, immer schneller' genug haben."
Klimapilger übergeben Resolution zum Klimaschutz
Bonn (epd). Der diesjährige ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ist am 1. Juli in Bonn zu Ende gegangen. Die Klimapilger übergaben zum Abschluss Vertretern des Bundesumweltministerium eine Resolution des evangelischen Kirchentags zur Klimagerechtigkeit, wie die Veranstalter des 4. Ökumenischen Pilgerwegs für Klimagerechtigkeit erklärten. Der Kirchentag hatte die von den Klimapilgern eingebrachte Resolution "Die Ziele des Pariser Klimaabkommens konsequent umsetzen" am 21. Juni in Dortmund mit großer Mehrheit verabschiedet.
Die Klimapilger fordern in der Resolution von der Politik unter anderem ein strenges Klimaschutzgesetz zur Einhaltung des 1,5-Grad-Zieles, eine Bepreisung aller Treibhausgasemissionen sowie die Aufstockung der internationalen Klimaschutz- und Entschädigungsfinanzierung. Die Kirchen und Gemeinden werden aufgerufen, ihre Gemeinden zu einem Ort des Aufbruchs zu machen, in denen Klimaschutz und Nachhaltigkeit praktisch umgesetzt werden soll.
Auf dem vor zwei Wochen in Münster gestarteten ökumenischen Pilgerweg hatten sich den Angaben nach rund 30 Langzeitpilger sowie mehrere Tagespilger auf den Weg gemacht. Im vergangenen Jahr führte der Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit von Bonn zur Weltklimakonferenz nach Kattowitz. Unterstützt wurde er unter anderem von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) sowie zahlreichen Organisationen und Initiativen.
BUND zählt mehr Mitglieder als SPD und CDU
Monatelange Dürre, ausgetrocknete Flüsse, verdorrte Ernten: Das Hitzejahr 2018 hat dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) eine Rekordmitgliederzahl beschert. Das Thema Klimaschutz sei in der Bevölkerung angekommen, heißt es.Berlin (epd). Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat erstmals in der Verbandsgeschichte mehr als 600.000 regelmäßige Spender. Davon seien mehr als 440.000 Mitglieder, ein Plus von knapp 28.000 gegenüber dem Vorjahr. "Das ist der höchste Mitgliederstand seit unserer Gründung vor 44 Jahren", sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2018 am 25. Juni in Berlin. Damit seien 2018 mehr Menschen im BUND Mitglied gewesen als in der SPD oder der CDU.
Bundesweit verfügt der Verband über rund 2.000 Ortsgruppen. Für seine Arbeit standen ihm im vergangenen Jahr rund 32,2 Millionen Euro zur Verfügung, ein Zuwachs von 2,2 Millionen Euro. 76 Prozent der Einnahmen waren den Angaben zufolge Mitgliedsbeiträge und Spenden.
"Klimawendejahr 2018"
Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern sei der Umweltverband mit rund 20 Prozent mehr Mitgliedern "außerordentlich stark" gewachsen, sagte Weiger. Der BUND-Vorsitzende spricht von einem "Klimawendejahr 2018", durch das die Klima- und Umweltbewegung einen "großen Sympathieschub in weiten Teilen der Bevölkerung" bekommen habe.
Monatelang kein Regen, ausgetrocknete Flüsse und eine verdorrte Ernte hätten bei vielen Menschen ein "zunehmendes Erschrecken" über den Klimawandel ausgelöst. Das gebe der naturschutz- und umweltpolitischen Arbeit des Verbandes "erheblichen Rückenwind", sagte Weiger. Umso bedauerlicher sei es, dass sich alle weitreichenden politischen Entscheidungen für mehr Klimaschutz wie etwa eine reformierte Agrarpolitik durch die Blockade der Bauernverbände weiterhin in der Warteschleife befänden.
Die Landwirtschaft sei "Verursacher und Hauptbetroffener" des Klimawandels zugleich, sagte Weiger. Die Subventionsmechanismen der EU-Agrarpolitik seien "bauernfeindlich" und hätten eine "weltweit verheerende Wirkung". Trotzdem beharre Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf dem Konservieren des Vorhandenen, kritisierte Weiger. Dazu kämen "intransparente Lobbystrukturen" in Berlin und Brüssel.
Präsenz in Brüssel
Weiger kündigte an, dass der BUND seine Präsenz in Brüssel ausbauen will. Zudem hoffe er, dass der "Druck von unten weiter wächst", sagte der BUND-Vorsitzende: "Wir setzen dabei auf die Bevölkerung."
Gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat veranstaltet der Umweltverband ab September vier Konferenzen zum Thema "Heimat und Nachhaltigkeit". Auftakt ist in Leipzig, weitere Veranstaltungen sind unter anderem in Heidelberg und im bayerischen Wunsiedel geplant. Die Konferenzen sollen zeigen, dass die aktuelle Debatte über den Begriff "Heimat" keine rückwärtsgewandte Diskussion sei, sondern sich um die Zukunftsfrage drehe, in was für einem Land wir leben wollen, sagte Weiger.
Nach Angaben des BUND-Vorsitzenden sahen sich in den vergangenen Jahren besonders die ostdeutschen Landesverbände wiederholt mit Vereinnahmungsversuchen von rechten Öko-Anhängern konfrontiert. Deshalb seien in der Satzung des Verbandes fremdenfeindliche und rassistische Positionen explizit ausgeschlossen worden. So habe es beispielsweise immer wieder Anfragen für Veranstaltungen gegeben, hinter denen rechtspopulistische Gentechnik-Gegner stehen, sagte BUND-Geschäftsführer Olaf Bandt: "Da müssen wir wachsam sein." Auch eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es nicht geben. Ausschlussverfahren für Verbandsmitglieder seien aber noch nicht notwendig gewesen.
Umweltverband fordert mehr Schutz für Gewässer in NRW
Düsseldorf (epd). Angesichts des Klimawandels und der Häufung langer Trockenperioden hat der NRW-Landesverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) von der Landesregierung mehr Einsatz für die nachhaltige Bewirtschaftung des Grund- und Oberflächenwassers gefordert. Der Umweltverband sprach sich am 27. Juni unter anderem dafür aus, die anstehenden Verlängerungen der wasserrechtlichen Erlaubnisse zur Entnahme und Ableitung von Grundwasser für die Entwässerung der Tagebaue Hambach und Garzweiler nicht zu erteilen. Allein zur Trockenlegung der Braunkohlentagebaue im Rheinischen Revier werden den Angaben zufolge pro Jahr etwa 509,6 Millionen Kubikmeter Grundwasser gefördert.
"Die Landesregierung tut viel zu wenig in Sachen Klimaschutz und droht auch bei der Bewältigung der durch den Klimawandel bedingten Folgen zu scheitern", mahnte der BUND-Landesvorsitzende Holger Sticht. "Es darf nicht sein, dass durch den fortgesetzten Raubbau an der Ressource Wasser die natürlichen Lebensgrundlagen zerstört werden." Notwendig sei deshalb "eine restriktivere Gewässerbewirtschaftung".
BUND-Gewässerschutzexpertin Monika Raschke ergänzte, immer mehr Oberflächengewässer trockneten im Sommer aus, auch wegen der gesunkenen Grundwasserstände. "Illegale Entnahmen - auch der Landwirtschaft - verschärfen die Situation zusätzlich", unterstrich Raschke. Wasserentnahmen für die intensive landwirtschaftliche Bewässerung oder zur Tränkung großer Viehbestände müssten grundsätzlich genehmigungs- und kostenpflichtig werden.
Ministerium: Hitzwelle 2018 senkte Leistung von Kraftwerken

epd-bild / Udo Gottschalk
Düsseldorf, Berlin (epd). Der Hitzesommer vor einem Jahr hat nach Angaben der Bundesumweltministeriums zu Problemen bei der Stromgewinnung in deutschen Kohle- und Atomkraftwerken geführt. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.
Demnach führten die Flüsse Rhein und Neckar aufgrund der anhaltenden Trockenheit im vergangenen Jahr Niedrigwasser, was zu Einschränkungen bei der Kühlwasserentnahme in Kraftwerken geführt hatte. Dadurch hätten 1,3 Gigawatt Kraftwerkskapazitäten weniger zur Verfügung gestanden als sonst. Allerdings liege dieser Wert nur "geringfügig" über dem Durchschnitt der Einschränkungen, die jedes Jahr in den Sommermonaten Juni und Juli auftreten, erklärte das Ministerium. Zuerst hatte die "Rheinische Post" (27. Juni) darüber berichtet.
"Die anhaltende Hitzeperiode im Sommer 2018 hatte dazu geführt, dass sich die Temperaturen in Rhein und Neckar der Grenze von 28 Grad genähert haben, die aus Gründen des Gewässerschutzes ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung für den Kraftwerksbetrieb nicht überschritten werden darf", hieß es in der Antwort weiter. Die Stromversorgung sei jedoch zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Auswirkungen auf den Strom-Großhandelspreis seien bislang ebenfalls nicht zu erkennen. Allerdings sei es wegen des Niedrigwassers zu "Einschränkungen des Kohletransports zu süddeutschen Kraftwerken" über den Schiffsverkehr gekommen, erklärte das Ministerium. Im Gegenzug sei die Belieferung durch die Bahn "so weit wie möglich erhöht" worden.
Laut dem Ministerium hat die Bundesnetzagentur die Betreiber der überregionalen Stromnetze nun gebeten, ein Konzept für eine präventive Kohlebevorratung zu entwickeln. In diesem Zusammenhang solle unter anderem geprüft werden, inwieweit zusätzliche Lagerkapazitäten für Steinkohle an den Standorten süddeutscher Kraftwerke notwendig seien.
Da der aktuelle Sommer und auch künftige Sommer ähnlich heiß werden können, warnen die Grünen vor Verzögerungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. "Deutschlands bisherige fossile und atomare Stromversorgung ist nicht nur klimaschädlich und gefährlich, sie ist auch alles andere als wetterfest", sagte die Grünen-Politikerin Julia Verlinden.
Polizei zieht gemischte Einsatzbilanz nach Klimademos
Aachen (epd). Die Polizei hat eine gemischte Einsatzbilanz nach den Klimademonstrationen vor rund einer Woche gezogen. Am 21. Juni hätten in Aachen Tausende junger Menschen der Bewegung "Fridays for Future" friedlich demonstriert und an Veranstaltungen teilgenommen, erklärte die Polizei am 26. Juni in Aachen. Sie warf allerdings Klimaaktivisten, die am 22. Juni an Demonstrationen am Tagebau Garzweiler beteiligt waren, gewalttätige Übergriffe vor. Dadurch seien mehrere Beamte verletzt worden. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände", das zu den Protesten aufgerufen hatte, wies die Vorwürfe zurück warf seinerseits der Polizei massive Gewalt vor.
Lob für "Fridays for Future"-Bewegung
Die Aachener Polizei würdigte, dass die Demonstranten von "Fridays for Future", die aus ganz Deutschland und aus dem Ausland kamen, mit ihrem friedlichen Protest am 21. Juni im Stadtgebiet ein eindrucksvolles Zeichen für den Klimaschutz gesetzt hätten. Weitere Veranstaltungen von "Fridays for Future" am 22. Juni in der Nähe des Tagebaus Garzweiler seien ebenfalls störungsfrei verlaufen.
Allerdings seien bei den Veranstaltungen von "Ende Gelände" am 22. Juni Polizeibeamte, die ein lebensgefährliches Eindringen über die Abbruchkante in den Tagebau verhindern wollten, teils massiv angegangen und überrannt worden. Tatverdächtige hätten bei ihren Festnahmen Widerstand geleistet. Bei Identitätsfeststellungen sei es zu Gefangenenbefreiungen gekommen. Insgesamt seien 16 Beamte verletzt worden, elf Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden.
Mehr als 500 Klimaaktivisten transportierte die Polizei nach eigenen Angaben mit Bussen zur Verhinderung von Straftaten wieder zurück nach Viersen. 18 Menschen wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Bislang 26. Juni lagen dem Polizeipräsidium 75 Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Nötigung vor.
Ende Gelände spricht von massiver Polizeigewalt
Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" erklärte, der eigene Konsens fordere ein ruhiges und besonnenes Verhalten von Aktionsteilnehmern. Der Protest mit Köpereinsatz sei aber "legitim und angesichts der Klimakrise dringend notwendig". Das Bündnis warf den Einsatzbeamten wiederholte "massive Polizeigewalt" gegenüber Klimaaktivisten vor. Mindestens fünf durch Polizeigewalt schwer verletzte Aktivisten seien mit Brüchen und Gehirnerschütterungen ins Krankenhaus gebracht worden. Andere Aktivisten seien durch Schlagstockeinsätze, Schläge und Tritte sowie Pfefferspray verletzt worden. Weil über Stunden hinweg kein Wasser im Polizeikessel durchgelassen worden sei, seien einige Aktionsteilnehmer dehydriert zusammengebrochen.
Etwa 35.000 Menschen hatten laut "Fridays for Future" am 21. Juni in Aachen für mehr Klimaschutz demonstriert. An den Anti-Braunkohleprotesten im Tagebau Garzweiler tags darauf waren rund 8.000 Menschen beteiligt. Neben einer Fahrrad-Demo und einer Kundgebung in dem von Abbaggerung bedrohten Dorf Keyenberg gab es auch illegale Aktionen. So drangen Aktivisten des Bündnisses "Ende Gelände" in den Bereich des Tagebaus ein. Zudem blockierten etwa 800 Aktivisten zwei Bahnstrecken für den Kohletransport.
Landtagsdebatte über gewalttätige Proteste bei Klima-Demo
Die Proteste gegen die Braunkohle rund um den Tagebau Garzweiler vor rund einer Woche haben auch den Düsseldorfer Landtag beschäftigt.Düsseldorf (epd). Die AfD warf am 27. Juni in einer von ihr beantragten aktuellen Stunde Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) "Autoritätsverlust" vor. Sie habe einen "Schulterschluss" der Schüler-Bewegung "Fridays for Future" mit der Gruppierung "Ende Gelände" hingenommen.
Rund 1.000 Umweltaktivisten waren am 22. Juni in den Tagebau eingedrungen. Dabei wurden laut Polizei, die diese Proteste als gesetzeswidrig bezeichnete, 16 Beamte verletzt. Unter den Aktivisten waren überwiegend Anhänger der Anti-Braunkohle-Bewegung "Ende Gelände", die mit Aktionen des zivilen Ungehorsams für einen sofortigen Kohleausstieg in Deutschland und für Klimagerechtigkeit weltweit eintritt.
Die Polizei schließt nicht aus, dass darunter auch einige wenige "Fridays for Future"-Anhänger gewesen sein könnten. Beide Bewegungen hatten sich im Vorfeld gegenseitig eine ideelle Unterstützung beim Demonstrieren für mehr Klimaschutz zugesichert. Am 21. Juni hatten in Aachen rund 36.000 Teilnehmer bei "Fridays for Future" friedlich protestiert, ohne dass es zu Zwischenfällen kam.
Gebauer weist AfD-Kritik zurück
Gebauer wies die Kritik der AfD als "abwegig und absurd" zurück. Sie sei sich ihrer Fürsorgepflicht für die Schüler bewusst, weshalb sie auch einer Bitte der Polizei nachgekommen sei, im Vorfeld über die Bezirksregierung Köln eine E-Mail an die Schulen weiterzuleiten. Darin habe die Polizei darum gebeten, die Schüler dafür zu sensibilisieren, sich von gewaltbereiten Gruppierungen fernzuhalten.
Das Verhalten der Schüler außerhalb der Schule unterliege aber nicht der Verantwortung der Schulpolitik, machte die Ministerin deutlich und betonte: "Gewalt bei Demonstrationen ist falsch und abzulehnen." Es sei aber nicht Aufgabe der Schulministerin, Einschätzungen zu Demonstrationen vorzunehmen. Auch sei es nicht Aufgabe der Schulen, politisches Engagement zu lenken.
Lehrergewerkschaft: Minsterin nicht "Mutter der Nation"
Die Gewerkschaft Lehrer NRW stellte sich an die Seite der Ministerin. Diese sei nicht die "Mutter der Nation" und habe den Kindern nicht vorzuschreiben, was sie zu denken und wie sie sich zu verhalten hätten, betonte deren Vorsitzende Brigitte Balbach. Die Gesellschaft müsse Kindern die Bildung einer eigenen Haltung und freien Meinung ermöglichen und ihnen eigene Entscheidungen zubilligen.
"Zu diesem Prozess gehört auch zu erkennen, welche Form des Protests legitim ist und wo sich Schüler womöglich von einer Gruppierung wie Ende Gelände vereinnahmen lassen", sagte Balbach weiter. Die große Mehrheit der "Fridays for Future"-Demonstranten scheine mit dieser Herausforderung verantwortungsvoll umzugehen.
Soziales
Organspende: Bundestag debattiert über "Systemwechsel"

epd-bild / Annette Zoepf
Berlin (epd). Ist Organspender, wer zustimmt - oder der, der nicht widerspricht: Der Bundestag steht vor einer schwierigen Grundsatzfrage. Seit Jahren geht die Zahl der Organspender in Deutschland zurück, vor allem seit den Manipulationsskandalen in einzelnen Kliniken. Für einige Abgeordnete ist das Anlass, über den Grundsatz der Organspende in Deutschland nachzudenken. Bislang ist jeder Organspender, der einen entsprechenden Ausweis ausgefüllt, sich also ausdrücklich dafür entschieden hat. Zwei Vorschläge für Gesetzesänderungen sollen die Bürger - in jeweils unterschiedlichem Maß - stärker in die Pflicht nehmen. Am 26. Juni debattierte das Parlament in Berlin in erster Lesung über die Entwürfe.
Erster Redner war der CSU-Politiker Georg Nüßlein, der den Vorschlag der Gruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den SPD-Politiker Karl Lauterbach unterstützt. Sie wollen die Einführung der sogenannten Widerspruchsregelung, nach der jeder zum Organspender wird, der dem zu Lebzeiten nicht widersprochen hat. Dieser Widerspruch, den auch noch die Angehörigen einlegen können, wenn ihnen der Wille des Verstorbenen bekannt ist, soll in einem Register hinterlegt werden.
"Zeit läuft davon"
Wenn eine Mehrheit der Deutschen bereit sei, ein Organ anzunehmen, müsse auch die Mehrheit bereit sein, zu spenden, sagte Nüßlein. Es gebe nichts Christlicheres, als im Tod einem Menschen das Leben zu retten, sagte er. Zentrales Argument der Befürworter der Widerspruchsregelung war im Bundestag die in ihren Augen drängende Zeit.
"Den Leuten auf der Warteliste läuft die Zeit davon", sagte die SPD-Politikerin Sabine Dittmar. 9.000 Menschen warten in Deutschland auf ein lebensrettendes Organ. Wenn man nichts Grundlegendes ändere, werde man in zwei, drei Jahren die gleiche Diskussion wieder führen müssen. Gesundheitsminister Spahn, der sich auf der Rednerliste der mehr als zweistündigen Debatte weit hinten als Abgeordneter einreihte, sagte: "Der Weg hat bis hierhin nichts gebracht."
Die Unterstützer des zweiten Entwurfs sehen das anders. Eine Gruppe um die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock (Grüne) und Katja Kipping (Linke) will daran festhalten, dass die Entscheidung zur Organspende freiwillig bleibt, sie aber in Richtung einer Zustimmungslösung erweitern. In regelmäßigen Abständen sollen die Bürger auf dem Amt, beim Erste-Hilfe-Kurs und beim Hausarzt über Organspende aufgeklärt und darum gebeten werden, eine Entscheidung in einem Online-Register zu hinterlegen, wie die SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis erläuterte. Die Aufforderung zur Entscheidung wäre damit verbindlicher als jetzt, aber keine Pflicht.
"Selbstbestimmungsrecht ein hohes Gut"
Das Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung sei ein hohes Gut, sagte Mattheis. Damit argumentierten auch andere Unterstützer des Baerbock-Vorschlags. Die Initiatorin selbst warnte davor, mit den Beratungen zu suggerieren, es könne jedem geholfen werden, der ein Spenderorgan braucht. Voraussetzung für eine Organspende in Deutschland sei der Hirntod, sagte Baerbock. 2018 seien 1.416 Menschen in Deutschland am Hirntod gestorben, während 9.000 auf ein Organ warteten, sagte Baerbock. Diese Diskrepanz werde man auch mit einer Neuregelung nicht ändern.
Hinter beiden Entwürfen stehen Unterstützer aus unterschiedlichen Parteien. Abgestimmt wird voraussichtlich im Herbst ohne Fraktionszwang. Allerdings hat die AfD kurz vor der ersten Beratung einen weiteren Antrag als Fraktion ins Parlament eingebracht. Sie will an der bisherigen Regelung festhalten, schlägt aber kleinere Änderungen im Transplantationsgesetz vor.
Hinter welchem der beiden Gesetzentwürfe sich am Ende mehr Unterstützer versammeln, ist bislang nicht absehbar. In der ersten Beratung war die Redezeit gleichmäßig unter den jeweiligen Befürwortern verteilt.
Deutscher Ethikrat warnt vor einer allgemeinen Impfpflicht

epd-bild / Gustavo Alàbiso
Berlin (epd). Der Deutsche Ethikrat lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab, fordert aber ein Maßnahmenbündel zur Erhöhung der Impfquoten. Das Wissenschaftler-Gremium stellte am 27. Juni in Berlin seine einvernehmlich beschlossene Stellungnahme "Impfen als Pflicht?" vor. Der Vorsitzende Peter Dabrock warnte, eine Impfpflicht berge den Erkenntnissen des Gremiums zufolge sogar die Gefahr, die Ablehnung in der Bevölkerung zu steigern und das Gegenteil zu bewirken: "Das Ziel mit der Brechstange erreichen zu wollen, wird nicht wirksam sein", sagte Dabrock.
Eine Impfpflicht empfiehlt der Ethikrat allein für das Personal im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen, weil für Ärzte, Lehrer und Pflegekräfte die Ansteckungsgefahr höher ist. Diese müsse konsequent durchgesetzt werden, auch mit einem Beschäftigungsverbot.
Gegen Bußgelder
Insbesondere für Klein- und Schulkinder lasse sich eine Impfpflicht hingegen nicht rechtfertigen, weil in dieser Gruppe die Impfquoten am höchsten seien, argumentiert der Ethikrat. Damit widerspricht er der Linie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Spahn will eine Verpflichtung zur Masern-Schutzimpfung für Kita- und Schulkinder durchsetzen. Ungeimpfte Kleinkinder sollen keine Kita besuchen dürfen, Eltern von Schulkindern sollen Bußgelder bis 2.500 Euro zahlen.
Der Ethikrat meint hingegen, Ausschlüsse aus Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sollten nur in Ausnahmefällen möglich sein. Bußgelder lehnt das Gremium ab. Es empfiehlt stattdessen Kontrollen des Impfstatus' der Kinder, die gezielte Ansprache der Eltern und Impftage in Kitas und Schulen. Das Gremium plädiert auch für eine Gesetzesänderung: Eltern sollten mit der Anmeldung zur Kita nicht mehr nur nachweisen müssen, dass sie sich zu Impfungen haben beraten lassen, sondern den tatsächlichen Impfschutz ihres Kindes dokumentieren.
Gesundheitsminister Spahn ging auf die Warnung vor einer Impfpflicht nicht ein, erklärte aber, die Stellungnahme helfe in der Debatte. Anders als der Ethikrat halte er es für notwendig, die moralische Verpflichtung zur Impfung gegen Masern "verbindlicher zu gestalten". Sein Ziel sei, so Spahn, "dass zumindest Kinder und deren Betreuer sowie medizinisches Personal geimpft werden".
Höhere Impfquote
Anlass der Impfpflicht-Debatte waren eine Masernausbruch an einer Schule im niedersächsischen Hildesheim und Warnungen der Weltgesundheitsorganisation, die zunehmende Impfmüdigkeit gehöre zu den großen Gesundheitsrisiken. Ebenfalls am 27. Juni veröffentlichten die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ein Diskussionspapier, in dem sie einen leichteren Zugang zu Schutzimpfungen fordern. Die dafür erforderlichen Änderungen könnten unabhängig von der derzeit diskutierten Impfpflicht umgesetzt werden, erklären die Autoren.
Völlig einig sind sich die Wissenschaftler in dem Ziel, die Impfquoten zu erhöhen. Der Ethikrat sieht eine moralische Verpflichtung, sich selbst und die eigenen Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Die Impfung sei "keine reine Privatangelegenheit", heißt es in seiner Stellungnahme. Masern seien eine gefährliche Infektionskrankheit, die sich mit einer nebenwirkungsarmen Impfung vermeiden lasse. Jeder sei daher mitverantwortlich für die Menschen, die sich nicht impfen lassen können, bei denen die Krankheit aber unter Umständen einen besonders schweren Verlauf nehme. Um einen Gemeinschaftsschutz zu erreichen, müssen 95 Prozent der Bevölkerung immunisiert sein.
In Deutschland haben 97 Prozent der Kinder die erste und 93 Prozent auch die zweite Impfung gegen Masern. Große Lücken gibt es aber bei den Erwachsenen. Um sie zu schließen, raten die Wissenschaftler dringend zu gezielten Aufklärungs- und Impfkampagnen. Die Politik solle sich auf diese Gruppe konzentrieren, nicht auf die kleine Gruppe der Impfgegner, erklärte der Leiter der Arbeitsgruppe für die Impf-Stellungnahme, der Humangenetiker Wolfram Henn. Nur zwei Prozent der Erwachsenen seien erklärte Impfgegner und mit Argumenten nicht zu erreichen. Für Ärzte, die Fehlinformationen über die angeblichen Gefahren von Impfungen verbreiten, fordert der Ethikrat berufsrechtliche Sanktionen.
Zehntausende demonstrieren für sozialen und ökologischen Wandel
"Digitalisierung und Klimaschutz krempeln alles um", hieß es im Aufruf. Mehr als 50.000 Menschen kamen zum Aktionstag in Berlin, um Antworten einzufordern auf die Frage: Schaffen wir die digitale und ökologische Wende oder fahren wir vor die Wand?Berlin (epd). Klimaprotest vor der Vertretung der Europäischen Kommission, eine Pappmauer-Aktion gegen unterschiedliche Arbeitsbedingungen in Ost und West, Reden, Transparente, Luftballons und Musik: In Berlin haben am 29. Juni mehrere zehntausend Menschen für eine soziale und ökologische Umgestaltung von Industrie und Arbeitswelt demonstriert. An dem Aktionstag der Gewerkschaft IG Metall unter dem Motto "#FairWandel" beteiligten sich auch der Sozialverband Diakonie Deutschland der evangelischen Kirche, der Umweltverband Nabu und der Sozialverband VdK.
Die Pariser Klimaschutzziele seien nicht verhandelbar, betonte der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann: "Wir wollen unseren Planeten unseren Kindern in einem lebenswerten Zustand überlassen." Industrie und Beschäftigte müssten deshalb nun den Beweis antreten, dass Ökologie und gute Arbeit kein Widerspruch seien. "Fairer Wandel verträgt keine Ausgrenzung, keine Diskriminierung", betonte der Gewerkschafter: "Und daher sagen wir auch hier deutlich: Keinen Platz für rechte Hetzer, Rassisten und Faschisten!"
Rede des Diakoniepräsidenten
Diakoniepräsident Ulrich Lilie rief dazu auf, technischen Fortschritt und gesellschaftliche Veränderungen sozial gerecht und ökologisch zu gestalten. Dafür müssten auch "Allianzen für Menschlichkeit vor Ort" gebildet werden. Die Zukunft dürfe nicht "den Rattenfängern und Menschenfeinden und auch nicht den furchtbaren Vereinfachern überlassen" werden, betonte der evangelische Theologe. Für neue Fragen, wie sie Digitalisierung, Klimawandel, globale Machtverschiebungen, Migration und demografische Entwicklung mit sich brächten, müssten neue Antworten gefunden werden. Ziel müsse sein, das Land zu "fairwandeln", damit Deutschland gerecht und lebenswert, ökologisch und demokratisch für Alte und Junge bleibe.
"Die Arbeitszeitmauer muss weg" hieß es bei einer Jugenddemonstration am Aktionstag, bei der eine symbolische Mauer aus Pappkartons durchbrochen werden sollte. Vor der Vertretung der EU-Kommission am Brandenburger Tor stieg Qualm aus einem selbstgebastelten "Hochofen" auf. Mit der Aktion für eine umweltfreundliche Zukunft wurde eine Anpassung der weltweiten Kohlendioxidemissionen an europäische und deutsche Standards gefordert. Mit einem symbolischen Hürdenlauf vor der Humboldt-Universität protestierten junge Leute gegen Schwierigkeiten beim dualen Studium mit betrieblicher Ausbildung.
"Wir sind der Wandel, auf den wir gewartet haben", hieß es auf einem Transparent. Mit mehreren Sonderzügen und 800 Bussen sind nach Gewerkschaftsangaben Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet nach Berlin gereist, um sich an dem Aktionstag zu beteiligen. Rund 45.000 Teilnehmer waren laut Polizei für die Kundgebung am Brandenburger Tor angekündigt. Die IG Metall sprach am Samstagnachmittag von mehr als 50.000 Menschen.
Deutschland brauche "endlich massive Investitionen" in die Energie- und Mobilitätswende, in Zukunftsprodukte, Stromnetze und den öffentlichen Nahverkehr, hieß es im Aufruf zu dem Aktionstag. Soziales und Ökologie dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Der digitale und ökologische Wandel müsse den Beschäftigten Chancen auf gute Arbeit geben, forderte Hofmann: "Die Transformation muss sozial, ökologisch und demokratisch gestaltet werden."
Bank für Kirche und Diakonie steigert Kreditgeschäft
Eine stabile Bilanzsumme und ein großes Wachstum bei der Vergabe neuer Kredite: Die evangelische KD-Bank legt auch 2018 gute Zahlen vor. Ein Hauptaugenmerk will die Kirchenbank weiter auf nachhaltige Geldanlage richten.Dortmund (epd). Die Bank für Kirche und Diakonie (KD-Bank) hat ihr Kreditgeschäft deutlich ausgebaut. Sie sagte im Geschäftsjahr 2018 über 363 Millionen Euro an neuen Krediten zu, 45 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Vorstandschef Ekkehard Thiesler am 25. Juni vor der Generalversammlung in Dortmund mitteilte. Die Bilanzsumme sank minimal um 0,3 Prozent auf 5,64 Milliarden Euro und soll auch 2019 nahezu konstant bleiben. Der Jahresüberschuss betrug 8,9 Millionen Euro, die Mitglieder der Genossenschaftsbank werden daran wie im Vorjahr mit vier Prozent Dividende beteiligt.
Bilanzsumme leicht rückläufig
Insgesamt legten die Kredite der evangelischen Kirchenbank um 4,4 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro zu, für dieses Jahr wird angesichts notwendiger Investitionen im Krankenhaus- und Pflegesektor sowie niedriger Zinsen mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Die Kredite werden überwiegend für die Finanzierung kirchlicher und diakonischer Projekte wie Alten- und Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Kindergärten sowie für den privaten Wohnungsbau bereitgestellt.
Die Kundeneinlagen der KD-Bank gingen 2018 um 2,7 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro zurück, zusammen mit den Wertpapieranlagen der Kunden ergab sich aber insgesamt ein Anstieg um knapp ein Prozent auf 8,2 Milliarden Euro. Grund für diese Entwicklung sei die verstärkte Nachfrage nach Wertpapieren und Investmentfonds, heißt es im Bericht des Vorstands. Für das laufende Jahr wird ein Zuwachs insbesondere bei den Wertpapieren, aber auch bei Bankeinlagen erwartet.
Thiesler hob in seinem Bericht das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip hervor, das soziale Verantwortung und ethisches Handeln verlange - das gelte auch für Banken und Unternehmen. Am Recht auf Eigentum sollte aber "nicht gerüttelt werden, die schlimmen Erfahrungen aus der DDR-Zeit oder aktuell aus Venezuela dürfen keiner Sozialromantik weichen", warnte der Bankenchef und lehnte mit Blick auf aktuelle Debatten eine Verstaatlichung von Wohnungsbaugesellschaften oder großen Unternehmen ab.
Nachhaltigkeitsfilter
Großen Wert legte Thiesler auf den Nachhaltigkeitsfilter der KD-Bank bei der Anlage von Kundengeldern. "So stehen zum Beispiel Unternehmen auf unserer Tabuliste, die Atomstrom erzeugen, Waffen produzieren oder die ihre Produkte mit Hilfe von Kinderarbeit herstellen lassen", sagte er. Es bleibe Ziel der Bank, "einen verantwortungsvollen Mittelweg zwischen Renditeorientierung und sozial und ökologisch ausgerichtetem Vorgehen zu finden".
Der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, rief angesichts einer "aus den Fugen geratenen" Welt zu einer Kultur der Unterbrechung auf. Es gebe viele bedrohliche Entwicklungen, sagte der Theologe in einer Andacht. Als Beispiele nannte er unter anderem Klimawandel, Digitalisierung, Flucht und Migration, soziale Ungleichheit, Rechtspopulismus und ein "schwankendes Europa". In Zeiten wachsenden Misstrauens zwischen den Menschen sei Vertrauen ein besonderes Gut, betonte Lilie und erinnerte an die Losung des am 25. Juni zu Ende gegangenen evangelischen Kirchentages in Dortmund, "Was für ein Vertrauen".
Es wäre heilsam, Aufregung, Misstrauenskultur und sich hochschaukelnde Empörung zu unterbrechen, sagte der Diakonie-Präsident: "Einfach mal die Klappe halten, nicht twittern, liken, posten und kommentieren und das Seine treu verrichten - das wäre doch mal ein Anfang." Es sei kein Weglaufen vor Problemen und Ängsten, wenn man innehalte, um sich an Gott zu wenden und auf ihn zu hören, sondern ein nötiger Schritt, um Verantwortung übernehmen und die Grenzen des Machbaren erkennen zu können.
Die KD-Bank gehört zu den 20 größten deutschen Genossenschaftsbanken. Mitglieder sind über 4.200 kirchliche und diakonische Institutionen. Die Bank betreut rund 7.000 Einrichtungen in Kirche und Diakonie sowie mehr als 30.000 Privatkunden.
Herforder Superintendent wechselt zu Bethel im Norden
Herford/Hannover (epd). Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Herford, Michael Krause, übernimmt 2020 bei den v. Bodelschwingschen Stiftungen die Geschäftsführung des Unternehmensbereichs Bethel im Norden. Der 51-jährige Theologe wird Ende kommenden Jahres in Hannover die Nachfolge von Pastor Christian Sundermann antreten, der in den Ruhestand geht, wie die Stiftungen am 25. Juni in Bielefeld mitteilten. Bethel-Vorstandsmitglied Johanna Will-Armstrong erklärte, sie freue sich auf die künftige Zusammenarbeit.
Zu Bethel im Norden gehören den Angaben nach Einrichtungen und Dienste vor allem der Jugendhilfe, Altenhilfe und Behindertenhilfe sowie Förderschulen und Ausbildungsstätten in Niedersachsen. Der Bereich hat rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Krause ist seit zehn Jahren Superintendent des westfälischen Kirchenkreises Herford mit 25 dazu gehörenden Kirchengemeinden. Der verheiratete Vater von drei Kindern ist zudem Aufsichtsratsvorsitzender des kreiskirchlichen diakonischen Werks und hat als Verwaltungsrat die Fusion der diakonischen Werke Rheinland-Westfalen-Lippe mitgestaltet, wie es hieß. Des Weiteren ist der gebürtige Herforder Mitglied mehrerer kirchlicher Gremien auf kreiskirchlicher, landeskirchlicher und EKD-Ebene. Er engagiert sich auch ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen und Stiftungen.
Überregional bekannt wurde Krause, als er kurz nach seinem Amtsantritt als Superintendent einen "Geheimfonds" des Kirchenkreises Herford von fast 50 Millionen Euro offenlegte. Die Sonderkasse war seit den 19960er Jahren an den Leitungsgremien vorbei aufgebaut worden und bis dahin nur dem jeweiligen Superintendenten und einem kleinen Kreis Eingeweihter bekannt. Mit Offenheit und einer transparenter Leitung habe sich Krause seitdem für die Überwindung der daraus entstandenen Vertrauenskrise im Kirchenkreis eingesetzt, hieß es. Die kirchliche Rechnungsprüfung und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, dass sich niemand persönlich bereichert hatte.
Ethikrat zu Pflege-Robotern: Mensch muss im Mittelpunkt stehen

epd-bild/Guido Schiefer
Berlin (epd). Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, hat dazu aufgerufen, die Sorgen der Menschen vor dem Einsatz von Robotern in der Pflege ernst zu nehmen. Die zentrale ethische Frage sei, ob die Zukunft mit Maschinen menschenfreundlich gestaltet werden könne, sagte Dabrock am 26. Juni bei der Jahrestagung des Ethikrats in Berlin. Nur dann könne Vertrauen in neue Technologien wachsen. Der Mensch müsse weiterhin im Mittelpunkt stehen, forderte Dabrock.
Der Ethikrat beschäftigt sich auf seiner diesjährigen Tagung mit den ethischen Herausforderungen der Technisierung der Pflege, insbesondere dem Einsatz von Robotern. Dabrock sagte, es gehe um die Frage, ob und wie die beiden gesellschaftlichen Megatrends, die Alterung der Gesellschaft und die Digitalisierung, zusammenkommen könnten. Im Jahr 2050 werde es fast zwei Millionen mehr Pflegebedürftige geben als heute. Die Frage sei, ob Roboter einen Beitrag zu guter Pflege leisten könnten.
Sorge in Bevölkerung
Die Mehrheit der Bevölkerung befürchte, dass Zuwendung und Nähe verloren gingen und sich die soziale Spaltung der Gesellschaft durch Pflegeroboter verstärke. Nur Wohlhabende könnten sich menschliche Zuwendung künftig noch leisten, sei die überwiegende Sorge, sagte Dabrock.
An der Jahrestagung des Ethikrats nahmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin, der Informatik, Psychologie, Rechtswissenschaft und Anthropologie teil. Der Münchner Informatiker und Experte für Künstliche Intelligenz, Sami Haddadin, sagte, es sei erst seit wenigen Jahren möglich, dass Mensch und Maschine wirklich interagieren könnten. Voraussetzung dafür sei die Entwicklung der Motorik bei den Robotern und deren Lernfähigkeit. Haddadin stellte Projekte vor, die testen, wie alten Menschen durch die Assistenz von Robotern länger ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden kann.
Die Informatikerin Elisabeth André von der Universität Augsburg erklärte, sozial agierende Roboter in der Pflege könnten als Zuhörer, Gedächtnistrainer, Sprachmittler und in vielen anderen Funktionen eingesetzt werden. Auch Zuwendung sei eine mögliche Funktion. So könnten sie etwa zur Stimmungsaufhellung beitragen.
Gegen sinnlosen Einsatz moderner Medizin am Lebensende

epd-bild/Friedrich Stark
Dortmund (epd). Bevor sie antwortet, nestelt sie mit dem Finger an ihrer Halskette herum, tastet Stein für Stein ab, kontrolliert, ob sich etwas daran verdreht hat. Die 78-jährige Stefanie M. (Name geändert) ist vor ihrem Beratungstermin im Büro der Deutschen Stiftung Patientenschutz in Dortmund sichtlich aufgeregt. In gut zwei Stunden wird die alte Dame entschieden haben, dass sie nicht künstlich ernährt werden will, sollte sie eines Tages ins Wachkoma fallen. Und bei einer schweren Hirnschädigung will sie nicht beatmet werden.
Stiftungsmitarbeiterin Claudia Lesner notiert die Sterbenswünsche der "Kundin". Die gelernte Krankenschwester wird für die 78-Jährige die Verfügung verfassen, in der Ärzte im Notfall erfahren sollen, wie lange medizinische Geräte die Seniorin am Leben erhalten sollen.
Dass der Termin reine Vorsorge ist, wiederholen Stefanie M. und ihre Tochter, die sie begleitet, während der Beratung mehrfach. "Das heißt ja nicht, dass wir dich jetzt loswerden. Mama, du hast uns versprochen, du wirst 120 Jahre alt", sagt die Tochter und schmunzelt. Man wisse ja nie, sagt Stefanie M. Sie will sich wappnen - gegen den Einsatz moderner Technik, der ihr Leben sinnlos verlängert. "Wenn ich nicht mehr entscheiden kann, ist es sowieso aus. Dann können die Ärzte alles abschalten."
Notizen zu "Sterbenswünschen"
Drei Mal sei sie schon an Gürtelrose erkrankt, erzählt sie Beraterin Lesner. Einmal seien ihre Schmerzen so stark gewesen, dass sie sogar Angst hatte zu sterben. Also füllte sie eine Vorlage einer Patientenverfügung aus dem Internet aus, kreuzte Textbausteine an und unterschrieb - allerdings hatte sie dabei kein gutes Gefühl. Denn sie verstand nicht so richtig, was die Formulierungen bedeuteten. Also entschied sie sich für ein Beratungsgespräch bei der Stiftung Patientenschutz.
Mit der Beratung zu den Patientenverfügungen hilft die Stiftung Menschen bei der Vorsorge. Sie setzt sich aber auch für die Rechte von Pflegebedürftigen ein und versteht sich als Interessenvertretung für Schwerstkranke und Sterbende. "Die Menschen sind mit der Situation oft so überfordert, dass sie sich nicht mehr selbst organisieren und für ihre Rechte eintreten können", sagt Elke Simon, die dienstälteste Mitarbeiterin der Stiftung.
Seit ihrer Gründung als "Deutsche Hospiz Stiftung" im Jahr 1995 rechnet sich die Stiftung zwei große Erfolge zu: 2007 legte der Bundestag fest, dass jeder Versicherte am Lebensende einen Rechtanspruch auf Palliativversorgung hat. Für das Patientenverfügungsgesetz, das der Bundestag im Juni 2009 beschloss, hatte die Stiftung ebenfalls jahrelang gekämpft. Das verabschiedete Gesetz habe allerdings einen Haken, sagt Simon. Die Patientenverfügung ist gültig, sobald sie eine Unterschrift enthält. Die Stiftung plädiert jedoch dafür, eine vorherige Beratung zur Pflicht zu machen. Denn sie bezweifelt, dass ein Großteil der selbst erstellten Dokumente im Ernstfall tatsächlich greift - und damit hilft.
Spenden von Pharma-Industrie werden nicht angenommen
Deshalb bietet die Stiftung in ihren Büros in Dortmund, Berlin und München mit rund 20 Mitarbeitern persönliche und telefonische Beratung an. Die Gespräche sind zwar kostenlos, aber wer sie in Anspruch nehmen will, muss Mitglied im Förderverein der Stiftung sein und einen jährlichen Mindestbeitrag von 48 Euro bezahlen. Die Stiftung zählt nach eigenen Angaben rund 55.000 Mitglieder.
Die Stiftung betont, dass sie unabhängig, überkonfessionell und überparteilich sei. Für ihre Arbeit sei das unverzichtbar. Spenden von Firmen und Unternehmen nimmt die Stiftung nicht an. Nicht mehr, seit sie 2014 in die Kritik geraten war, nachdem sie 40.000 Euro von der Pharmafirma Grünenthal erhalten hatte. Die Stiftung finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, private Spenden und Erträgen aus Testamenten. Im Jahr 2017 erhielt sie nach eigenen Angaben rund 3,6 Millionen Euro.
Nach der zweistündigen Beratung ist die Luft im Büro von Claudia Lesner verbraucht. Als die Beraterin der Stiftung Patientenschutz die 78-Jährige nach ihren Wünschen für ihr Lebensende fragt, winkt Stefanie M. ab: "Ich bin genügsam." Lesner notiert schließlich, dass die Dame in ihren letzten Stunden vermutlich noch gerne einen Sahnelikör nehmen wird. Und außerdem gerne WDR4 im Radio hört. Einen Wunsch darf Lesner nicht in die Patientenverfügung aufnehmen - die Bitte um aktive Sterbehilfe. Dagegen hat sich die Stiftung klar positioniert.
Saar-Arbeitskammer listet Maßnahmen zur Verbesserung der Pflege auf
Saarbrücken (epd). Die Arbeitskammer des Saarlandes fordert in ihrem diesjährigen Jahresbericht mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Pflegekräfte, der zu Pflegenden und der Angehörigen im Saarland. "Die Probleme sind so vielfältig, dass sie nur gemeinsam mit allen Akteuren im Saarland angegangen werden können", erklärte der Vorstandsvorsitzende Jörg Casper am 26. Juni in Saarbrücken. "Nur so können wir dem enormen Personal- und Fachkräftemangel mittel- und langfristig entgegen wirken."
So soll unter anderem der Bund der Arbeitskammer zufolge die Kosten für Heimpflege deckeln, um die Betroffenen und die Kommunen zu entlasten. Die Landesregierung müsse wiederum die nachgewiesenen und notwendigen Investitionskosten der Krankenhäuser in vollem Umfang erstatten.
Mit Blick auf die Pflegekräfte müssten Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für Weiterbildungen freistellen. Außerdem brauche es eine Bedarfsanalyse im Bereich der Fort- und Weiterbildungen, da die Angebotslage zurzeit unübersichtlich sei, hieß es.
Des Weiteren fordert die Saar-Arbeitskammer einen bundesweit allgemeinverbindlich gültigen Tarifvertrag und eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Dazu gehörten unter anderem der Abbau psychischer sowie körperlicher Belastungen, verlässliche Dienstpläne oder das Einhalten von Pausen.
Die Arbeitskammer-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger kritisierte zudem, dass Beschäftigte häufig aus freien Tagen wieder zum Dienst gerufen werden, weil Personal fehle. "Das ist eine der größten Belastungen für unsere Pflegefachkräfte", betonte sie. "Das Rufen aus dem Frei muss dringend reduziert werden, um das Personal zu entlasten und um bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen Schritt voranzukommen."
In der Arbeitskammer des Saarlandes sind alle sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer sowie Minijobber, Arbeitssuchende und Auszubildende automatisch Mitglied. Die Kammer berät und bildet nach eigenen Angaben ihre Mitglieder und forscht für deren Interessen.
Verbände werben für Präventionskonzepte an Kinderkliniken
Nach mutmaßlichen sexuellen Übergriffen am Klinikum des Saarlandes sind sich Experten einig: Es braucht dringend Schutzkonzepte - nicht nur in Kitas, auch in Kliniken. Prävention könne schon ab der Geburt anfangen, erklärt eine Psychotherapeutin.Homburg, Düsseldorf (epd). Der saarländische Kinderschutzbund und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordern Präventionskonzepte an Kinderkliniken im Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Die jüngst bekannt gewordenen Missbrauchsvorwürfe gegen einen inzwischen gestorbenen Arzt am Universitätsklinikum des Saarlandes belegten die Notwendigkeit, an allen Häusern klare Verhaltensregeln und Ablaufstrukturen zu installieren, sagte Berufverbandssprecher Hermann Josef Kahl am 25. Juni dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Düsseldorf. Das gelte sowohl für die Vermeidung von sexuellen Übergriffen auf junge Patienten als auch für den Umgang mit Verdachtsfällen.
Die Vorkommnisse an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Homburg seien eine "Katastrophe", sagte der Düsseldorfer Kinder- und Jugendarzt. "Kinder müssen geschützt sein." Es gebe fachliche Beratungen und Qualifizierungen speziell für Krankenhäuser, betonte Kahl. Mit den eigenen Strukturen, Mängeln und möglichem Fehlverhalten müsse sich das saarländische Klinikum nun offensiv und transparent befassen.
Nur ein Fünftel der Kliniken verfügt über Schutzkonzept
Dem stimmte der saarländische Landesverband des Deutschen Kinderschutzbundes zu. "Es ist skandalös, dass bundesweit noch immer lediglich ein Fünftel aller Kliniken über ein solches Schutzkonzept verfügen." Es sei zudem nicht nachvollziehbar, dass nur Kitas und Jugendhilfeeinrichtungen eine gesetzliche Verpflichtung zur Erststellung solcher Konzepte hätten. "Schutzkonzepte beinhalten klare Verhaltenskodizes, regelmäßige Fortbildungen, ein wirksames Beschwerdemanagement, Regeln bei der Personalauswahl und Interventionspläne bei Verdachtsfällen", teilte der Verband mit. Sie seien unverzichtbar, wo die Gefahr von Übergriffen bestehe.
Die Düsseldorfer Kinderpsychotherapeutin Christina Lenders-Felske betonte die Bedeutung von Prävention ab der Geburt eines Kindes. Und zwar indem "Eltern ihren Kindern von vornherein mit Gesten und Worten klar machen, dass sie ihre Grenzen setzen können und nicht zu körperlicher Nähe gezwungen werden", sagte sie dem epd. Es gehe darum, Kinder zum Widerspruch zu erziehen: "Du hast ein Recht zu widersprechen. Du darfst Nein sagen."
Das Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg hatte am 24. Juni angekündigt, acht Jahre nach einem ersten Missbrauchsverdacht gegen einen Arzt der Kinderpsychiatrie nun mögliche Opfer und deren Eltern zu informieren. Zwischen 2010 und 2014 soll der Assistenzarzt medizinisch nicht notwendige Untersuchungen im Intimbereich vorgenommen haben. Das Universitätsklinikum erstattete Ende 2014 Strafanzeige und kündigte dem Arzt fristlos. Da der mutmaßliche Täter 2016 starb, mussten die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen eingestellt werden.
Staatskanzlei in Saarbrücken nicht informiert
Das Universitätsklinikum und die Staatsanwaltschaft hatten damals entschieden, möglicherweise betroffene Patienten nicht über den Verdacht zu informieren. Der Landesverband des Kinderschutzbundes kritisierte dieses Vorgehen: "Der Versuch der Klinikleitung, ihr jahrelanges Schweigen nun als Opferschutz zu verkaufen, ist abwegig und zynisch." Den mutmaßlich Geschädigten sei viel zu lange keinerlei Unterstützung zuteilgeworden.
Das Homburger Klinikum hatte damals auch die Staatskanzlei in Saarbrücken als Rechtsaufsicht nicht informiert. Das sei nur nötig, wenn es um einen Beamten gehe, erklärte die Abteilungsleiterin Wissenschaft, Hochschulen und Technologie, Annette Groh. Dennoch wäre es wünschenswert gewesen, darüber informiert zu werden. Nachdem die Staatskanzlei im April von dem Fall erfahren habe, sei ein Gutachter hinzugezogen worden. Dieser habe dann empfohlen, die möglichen Opfer zu informieren und an die Öffentlichkeit zu gehen. Regierungssprecherin Anne Funk kündigte an, regelmäßig über das weitere Vorgehen zu informieren. Der Justizausschuss im saarländischen Landtag wird sich am 27. Juni zu dem Sachverhalt berichten lassen.
Weniger Kinder in Obhut genommen
Düsseldorf (epd). Knapp 15.000 Jungen und Mädchen sind im vergangenen Jahr von nordrhein-westfälischen Jugendämtern in Obhut genommen worden. Das seien 9,1 Prozent weniger als im Jahr 2017, teilte das statistische Landesamt am 25. Juni in Düsseldorf mit. Die insgesamt 14.502 Inobhutnahmen seien von Jugendämtern durchgeführt worden, wenn in Eil- und Notfällen ein unmittelbares Handeln zum Schutz der Kinder und Jugendlichen nötig gewesen sei.
Der Rückgang liegt nach Angaben der Statistiker maßgeblich daran, dass weniger unbegleitete Minderjährige aus dem Ausland eingereist sind, die von Jugendämtern in Obhut genommen werden mussten. Ihre Zahl sei um 39,1 Prozent zurückgegangen, hieß es: Seien 2017 noch 5.346 Kinder und Jugendliche ohne Eltern eingereist, seien es 2018 noch 3.257 gewesen.
61 Prozent der Kinder, die 2018 unter den Schutz des Jugendamtes gestellt wurden, waren 14 Jahre und älter, 39 Prozent waren unter 14. Neben der unbegleiteten Einreise aus dem Ausland seien eine Überforderung der Eltern beziehungsweise eines Elternteils (4.450) sowie Beziehungsprobleme der Eltern (1.418) die häufigsten Gründe für die Schutzmaßnahmen, erklärte das Landesamt. 2.462 Inobhutnahmen geschahen auf eigenen Wunsch der Jungen und Mädchen, in 12.040 Fällen lag eine Kindeswohlgefährdung vor.
Zahl der nach NRW gezogenen Menschen leicht gesunken
Düsseldorf (epd). Die Zahl der nach Nordrhein-Westfalen gezogenen Menschen ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt am 28. Juni in Düsseldorf mitteilte, zogen 2018 fast 448.500 Menschen nach NRW. Das waren 0,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Da zugleich aber auch weniger Menschen das bevölkerungsreichste Bundesland verließen (396.000, 0,6 Prozent weniger als 2017), kamen 2018 per saldo fast 52.500 Menschen mehr nach NRW als wegzogen. Der Wanderungsgewinn war damit höher als 2017 (plus 51.600).
Etwa 306.250 Menschen zogen 2018 aus dem Ausland nach NRW - das war ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten Zuwanderer kamen aus Rumänien, Polen und Bulgarien. Aus anderen deutschen Bundesländern waren im Jahr 2018 weitere 142.250 Menschen (plus 1,1 Prozent) nach NRW gezogen. Am häufigsten kamen Zuwanderer aus Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen.
Medien & Kultur
Rebellische Rentner

epd-bild/Dieter Sell
Bremen (epd). Manche streicheln die Bronzefigur, andere berühren Beine und Schnauze des Esels eher flüchtig: Menschen aus aller Welt versammeln sich tagtäglich an der Skulptur der Stadtmusikanten, die etwas versteckt an der westlichen Seite des Bremer Rathauses steht. Vorderbeine und Schnauze des Esels sind längst blank gerieben, denn sie zu umfassen soll Glück bringen. So lässt sich vielleicht eine Brücke schlagen zu dem, wofür die Tiere aus dem weltbekannten Märchen der Brüder Grimm stehen.
In Solidarität etwas Großes schaffen, das drückt der wohl berühmteste Satz aus dem Märchen aus: "Zieh lieber mit uns fort nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall." Seit der ersten Veröffentlichung der "Bremer Stadtmusikanten" in der zweiten Auflage der "Kinder- und Hausmärchen" von Jacob und Wilhelm Grimm 1819 sind am 3. Juli 200 Jahre vergangen. Das würdigt Bremen mit einem "Stadtmusikantensommer". Die zentrale Festwoche startet am kommenden Mittwoch (3. Juli) - natürlich mit viel Musik.
Nie in Bremen angekommen
Dass es so weit kommen konnte, ist durchaus bemerkenswert. Denn die vier Märchenfiguren sind ja bekanntlich nie in der Hansestadt angekommen, sondern haben unterwegs eine Räuberbande aus deren Haus vertrieben und sind dort geblieben.
Trotzdem sind die Bremer heute stolz auf das Quartett. Die Bronzeskulptur neben dem Rathaus wurde vom Bildhauer Gerhard Marcks (1889-1981) geschaffen und 1953 zunächst als Leihgabe aufgestellt, später dann mit Spenden und einem Darlehen gekauft.
"Die Brüder Grimm haben sich intensiv mit Tierepen befasst", sagt der Kasseler Germanist und Grimm-Experte Holger Ehrhardt. Die Geschichte von den Stadtmusikanten sei ihnen "aus dem Paderbörnischen" von der Familie der Freiherren von Haxthausen zugetragen worden. Dabei sei es Jacob und Wilhelm Grimm vor allem darum gegangen, eine spannende Geschichte in ihre Sammlung aufzunehmen: "Ausgediente alte Figuren, denen Ungerechtigkeit widerfährt, kommen zu neuem Lebensglück."
Das Thema selbst sei uralt, erläutert Bernhard Lauer, Geschäftsführer der Brüder-Grimm-Gesellschaft in Kassel. Wie Menschen handelnde Tiere, die durch Klugheit und Kooperation ihr Ziel erreichten, seien schon in antiken Fabelwerken belegt, etwa im sogenannten "Froschmäusekrieg". Und dass es nach Bremen gehen sollte, ist Lauer zufolge auch kein Zufall: "Bremen war die Stadt hanseatischer Freiheiten, ein Sehnsuchtsort, von dem viele mit großer Hoffnung auf ein besseres Leben in die Neue Welt auswanderten."
Dass sich die Geschichte der rebellischen Rentner bis heute sozialutopisch ausdeuten lässt, betont der Bremer Stadtmusikanten-Experte Dieter Brand-Ruth. Er hat 2017 als Doktorarbeit eine soziokulturelle Studie über die Märchentiere und ihre Symbolik vorgelegt. Ein echter Wälzer, knapp 450 Seiten stark. "Die Tiere lehren uns die Ehrfurcht vor dem Leben und die Notwendigkeit von Bedingungen, die körperliche Unversehrtheit gewährleisten", bilanziert er.
Sympathieträger mit optimistischer Botschaft
Sie zeigten, was wirklich wichtig sei für das Leben, führt der Märchenexperte und Gymnasiallehrer für Deutsch und Biologie aus: "Genügend zu essen, ein trockener Platz zum Schlafen und jemand, der einem Geborgenheit und Schutz gibt." Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse fasst Brand-Ruth in einem neuen und populär geschriebenen Buch zusammen, das zum Start der Festwoche am 3. Juli unter dem Titel "Auf nach Bremen" erscheint.
Das Tierquartett ist ein echter Sympathieträger. Ein Grund für die ungetrübte Strahlkraft liegt wohl darin, dass die Vier eine optimistische Botschaft verbreiten. "Bei den Stadtmusikanten geht es nicht um etwas Altmodisches, sondern um etwas Zeitloses, das für Bremen steht, das wir weitergeben wollen - um Aufbruch, Mut, Teamgeist", sagt Peter Siemering, Geschäftsführer Marketing und Tourismus der Bremer Wirtschaftsförderung.
Längst sind die Esel, Hund, Katze und Hahn zu inoffiziellen Wahrzeichen der Hansestadt avanciert, sind als Souvenirs und auf Postkarten in allen Andenkenläden der Stadt präsent. Sie gehören zur bremischen DNA wie Weser, Dom, Bier, Kaffee und der Hafen.
"De musicis Bremensibus"
Und auch das Märchen selbst hat Furore gemacht. Auf der Webseite der Kasseler Grimm-Welt kann man sich die Erzählung in 13 Sprachen vorlesen lassen - unter anderem in Dari, Paschtu, Tigrinya und Urdu. Und gerade ist unter dem Titel "De musicis Bremensibus" eine Latein-Ausgabe in der eigenwilligen Erzählweise von Janosch im Bremer Temmen-Verlag erschienen.
Symbolisch schließt sich auch mit dem Bremer Solidaritätspreis ein Kreis: Mit der Auszeichnung, die alle zwei Jahre verliehen wird, ehrt der Senat der Hansestadt Menschen, die sich für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen und gegen Kolonialismus und Rassismus kämpfen. Neben dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird eine Skulptur des Bremer Künstlers Bernd Altenstein verliehen - sie zeigt die Bremer Stadtmusikanten und steht für die Kraft des solidarischen Handelns. Erste Preisträger waren 1988 Nelson und Winnie Mandela.
Luke Skywalker und gefälschtes Viagra
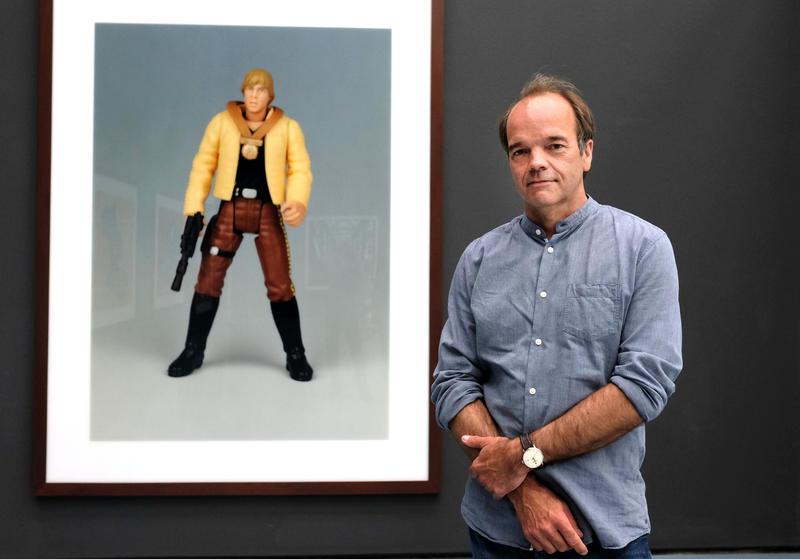
epd-bild/Bernd Schaller
Düsseldorf (epd). Der Fotokünstler Boris Becker hat in seinen Aufnahmen teilweise skurrile Formen von Drogenschmuggel und Produktpiraterie dokumentiert. Auf der "Großen Kunstausstellung NRW", die am 29. Juni im Düsseldorfer Kunstpalast eröffnet wurde, ist unter anderem die Fotografie eines Ölbildes zu sehen, das unter Beimischung von Kokain gemalt worden ist. "Das Rauschgift kann aus der Farbe auch wieder zurückgewonnen werden", erläuterte Becker bei der Präsentation der Ausstellung vor der Presse. Ein anderes Bild seiner Werkreihe "Konstruktion" zeigt eine aus Kokain gebaute "Computerfestplatte", die einer echten täuschend ähnlich sieht.
Zu sehen sind außerdem Aufnahmen einer illegal produzierten Spielfigur des "Star Wars"-Helden Luke Skywalker sowie Bilder von gefälschten hellblauen, potenzsteigernden Viagra-Pillen, bei denen es sich in Wirklichkeit um blaubemalte Lutschpastillen des Herstellers "Fisherman's Friend" handelt. Der 1961 in Köln geborene Becker ist in diesem Jahr Preisträger des mit 5.000 Euro dotierten Kunstpreises der Künstler, der im Rahmen der "Großen" vergeben wird.
Den Förderpreis und ein Preisgeld von ebenfalls 5.000 Euro erhält der 1984 in Aalen geborene Bildhauer Philipp Röcker. Auch er ist mit Arbeiten in der Ausstellung vertreten, die bis zum 4. August insgesamt mehrere Hundert Werke von 121 Künstlerinnen und Künstlern vorstellt. Um die Teilnahme an der seit über 115 Jahren stattfindenden deutschlandweit größten von Künstlern organisierten Ausstellung hatten sich über 700 Künstlerinnen und Künstler beworben, wie Ausstellungsleiter Michael Kortländer sagte.
"Die Große" zeigt sich erstmals im Sommer
Die sonst immer im Winter stattfindende Schau ist in diesem Jahr erstmals im Sommer zu sehen. Außerdem wurde die Ausstellungsdauer von drei auf fünf Wochen verlängert, wie der Düsseldorfer Kulturdezernent Hans-Georg Lohe erläuterte. Nach seinen Worten fördert die Stadt Düsseldorf die traditionsreiche Schau diesmal mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 140.000 Euro und einem Ankaufsetat für die städtischen Museen in Höhe von 87.000 Euro.
Die Schau vereine aktuelle Strömungen und Positionen zeitgenössischer Künstler, die im Vorfeld von einer Jury ausgewählt wurden, hieß es. Sie zeige, was in den Ateliers der Landeshauptstadt und der Region in jüngerer Zeit an Kunst entstanden ist. Präsentiert werden Werke aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie, Grafik, Installation, und Video. Erstmals in der Geschichte der traditionsreichen Schau würden auch im Außenbereich des Museums einige Installationen und Objekte ausgestellt, sagte Museumsdirektor Felix Krämer.
Rund 15.000 Besucher erwartet
Er freue sich darüber, "dass Künstler und Künstlerinnen einer Region den Kunstplast besetzen und zu ihrem Haus" machten, betonte der Museumschef. "Die Große" sei für ihn "ein Riesenschatz und ein Glücksfall". Den erwarteten mindestens 15.000 Besucherinnen und Besuchern versprach Krämer, sie könnten in der Ausstellung "viele, viele Entdeckungen über das Kunstschaffen von hier und heute" machen.
Alle Kunstwerke, die im Rahmen der Ausstellung präsentiert werden, sind laut Kortländer käuflich zu erwerben. Das teuerste Werk - eine Wandinstallation bestehend aus rund 350 Einzelbildern - stammt von dem Künstler Dirk Pleyer und kostet 48.000 Euro. Das preiswerteste ist ein Video von Stacey Blatt mit dem Titel "Erasing Trump", das bereits für 100 Euro zu haben ist.
Veranstalter der Kunstausstellung "Die Große" ist der 1898 gegründete Verein zur Veranstaltung von Kunstausstellungen. Seit 1902 findet die Schau ohne Unterbrechungen jährlich statt.
Frankfurter Städel zeigt Holz-Arbeiten von "Brücke"-Künstlern

epd-bild/Thomas Rohnke
Frankfurt a.M. (epd). Kein Material ist mit der Kunst des deutschen Expressionismus stärker verbunden als Holz. Für die drei Gründungsmitglieder der Künstlervereinigung "Brücke" Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938), Erich Heckel (1883-1970) und Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) begann die Auseinandersetzung mit diesem ältesten Werkstoff der Menschheitsgeschichte mit dem Holzschnitt, einem drucktechnischen Verfahren, bei dem die Darstellung wie ein Relief in eine meist dünne Holzplatte geschnitten wird. Etwa zeitgleich entstanden erste Holzskulpturen, die in ihrer Bearbeitung formal und inhaltlich auf den Holzschnitt zurückwirkten - und umgekehrt.
Mit der Ausstellung "Geheimnis der Materie. Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff" will das Frankfurter Städel-Museum bis zum 13. Oktober den Wechselbeziehungen zwischen den beiden Medien Holzschnitt und Holzskulptur und dem natürlichen Werkstoff Holz nachspüren, wie Direktor Philipp Demandt hervorhebt. Holz schätzten die Künstler vor allem wegen der Unebenheiten und Maserungen, der unterschiedlichen Faserstruktur und Härte.
"Streben nach Unmittelbarkeit"
Zu sehen sind 98 Holzschnitte, zwölf Skulpturen und fünf Druckstöcke. Der Großteil der gezeigten Werke stammt aus eigenem Bestand, der Sammlung Carl Hagemann. Hinzu kommen Leihgaben unter anderem aus dem Brücke-Museum Berlin, dem Stedelijk-Museum in Amsterdam, der Albertina Wien und aus Privatbesitz.
"Die drei Brücke-Vertreter strebten nach künstlerischer Erneuerung, nach mehr Authentizität und Unmittelbarkeit", erläutert die Ausstellungs-Kuratorin Regina Freyberger. Sie hätten gleichsam mit ihrem Rückgriff auf das ursprünglichste aller Materialien gegen die wilhelminische Bürgerlichkeit und den etablierten Kunstbetrieb rebelliert. Dem Holz sei dabei eine "katalytische Rolle" zugekommen, "denn die drei Künstler schufen ihre Holzschnitte ganz bewusst im Dialog mit dem Material und schälten ihre Skulpturen aus zum Teil gefundenen Holzstämmen geradezu heraus."
Der in Aschaffenburg geborene Kirchner testete bei seinen Farbholzschnitten die Grenzen und Möglichkeiten der Technik aus: Er arbeitete mit mehreren, teils zersägten Druckstöcken, variierte die Druckreihenfolge der Farben und benutzte statt der Walze oftmals den Pinsel. Seine Motive fand Kirchner wie auch Heckel und Schmidt-Rottluff in der unmittelbaren Umgebung. Wiederkehrendes Thema war der Mensch, oftmals der weibliche, stehend, sitzend, kniend und in Bewegung. Die Ausstellung zeigt etwa die Arbeit "Badende Frauen" aus dem Jahr 1909, die Skulptur "Mutter und Kind" (1924) und den Holzschnitt-Zyklus "Schlemihl" (1915) nach der Erzählung von Adelbert von Chamisso. Zu sehen ist auch der Holzschnitt "Farbentanz" aus dem Jahr 1933 mit den noch erhaltenen drei Druckstöcken.
Maserung als Stilmittel
Der im sächsischen Döbeln geborene Heckel gilt unter den Brücke-Künstlern als der Lyrische, der In-sich-Gekehrte. Knapp 15 Jahre beschäftigte sich der Autodidakt mit dem Holzschnitt und der Holzbildhauerei. In Frankfurt sind etwa eine ganze Reihe Mädchen- und Frauenakte versammelt sowie die großen Skulpturen "Trägerin" (1907), "Frau mit Tuch" (1912), "Frau" und "Stehende mit aufgestütztem Kinn" (beide 1913), die aus Erlen-, Akazien- und Ahornholz herausgearbeitet sind.
Der bei Chemnitz geborene Schmidt-Rottluff arbeitete im Holzschnitt fast ausschließlich in Schwarz und in großer Flächigkeit. Dafür setzte er die Maserung des Holzes gezielt als eigenes Stilmittel ein, wie das Blatt "Köpfe" (1911) anschaulich macht. Die Druckstöcke bearbeitete er vereinzelt als Reliefs weiter und sägte sie später wie Stempel auf das zu druckende Motiv zu. Anders als Kirchner und Heckel konnte er jedoch der Aktdarstellung nicht viel abgewinnen. Seine Themen sind Landschaften und verfremdete Gesichter und Köpfe aus den Jahren während und nach dem Ersten Weltkrieg, wie das Bildnis seiner Mutter aus dem Jahr 1916.
Museum Ludwig zeigt Mahnmal-Modell für Kölner NSU-Opfer
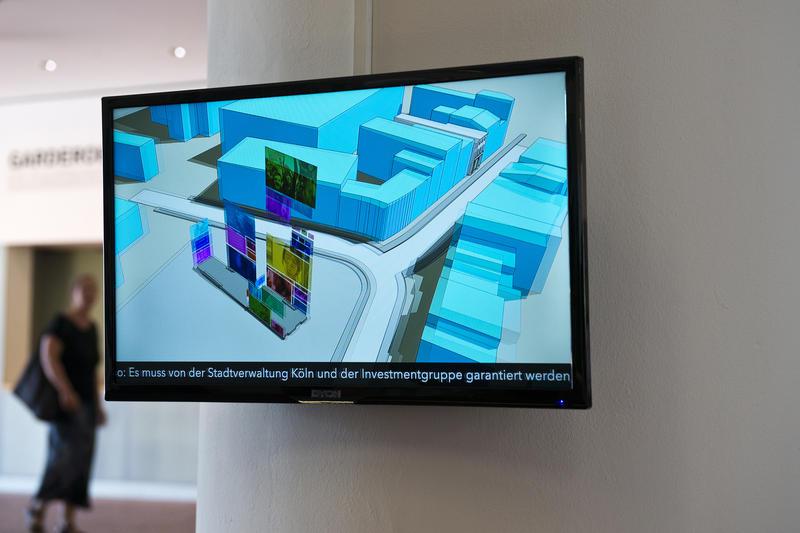
epd/Dörthe Boxberg
Köln (epd). Anlässlich des 15. Jahrestages des rassistischen Anschlages in der Kölner Keupstraße hat der Künstler Ulf Aminde sein Modell für ein Mahnmal für die Opfer der rechten Terrorzelle NSU im Foyer des Museum Ludwig präsentiert. Das Mahnmal solle ein Zeichen setzen, dass die Bewohner der Kölner Keupstraße ein fester Bestandteil der Stadt seien, sagte Aminde am 27. Juni in Köln. Gleichzeitig solle damit ein Ort entstehen, der von Neonazis nicht angegriffen werden könne. Das Modell ist bis zum 28. Juli im Foyer des Museums zu besichtigen.
Aminde stellte den Entwurf zusammen mit Vertretern des Integrationsrates der Stadt Köln, der Initiative "Herkesin Meydani - Platz Für Alle" und der Interessengemeinschaft Keupstraße der Öffentlichkeit vor. Die Idee sei, die sechs mal 24 Meter große Betonbodenplatte des Friseursalons, der 2004 von der Terrorzelle NSU zerstört worden sei, eins zu eins zu imitieren, sagte Aminde. Durch eine App, die über ein freies Wlan-Netz vor Ort herunterzuladen ist, können Besucher auf der Bodenplatte virtuelle Hauswände entstehen lassen.
Die Wände bestehen aus Filmbeiträgen zu den Anschlägen und zur Keupstraße, die von Besuchern auf ihren Smartphones angesehen werden können. Zudem seien alle Besucher dazu eingeladen, selbst Filme zu produzieren und hochzuladen, so Aminde: "Dies soll eine Gesellschaft der Vielen repräsentieren, die sich ständig erweitert und verändert."
Der Sprecher des Integrationsrats der Stadt Köln, Ahmet Edis, kritisierte, dass die Frage des Standorts des Mahnmals noch immer nicht geklärt sei. Ursprünglich hatte man sich mit der Stadt auf einen Standort an der Ecke Keupstraße/Schanzenstraße geeinigt. Dies wäre in Sichtweite des Friseursalons, in dem vor 15 Jahren eine Nagelbombe der Neonazi-Terrorzelle NSU explodierte. Dabei wurden 22 Menschen verletzt, vier davon schwer.
Doch der von Aminde und den Keupstraßen-Bewohnern favorisierte Standort befindet sich auf einem privaten Grundstück, auf das die Stadt Köln keinen Zugriff hat. "Wir möchten gemeinsam mit den Eigentümern eine Lösung finden und stehen für konstruktive Gespräche bereit", sagte Edis. Der Integrationsrat hoffe darauf, dass die Eigentümer das Grundstück an die Stadt abträten.
"Es geht hier um so viel mehr als nur ein Mahnmal", sagte Edis. Durch die NSU-Morde und das Versagen der Behörden bei der Aufklärung sei das Vertrauen in die Institutionen tief erschüttert worden. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir eine würdige Erinnerungskultur schaffen."
Zentralrat weist Vorwurf der Einflussnahme Israels zurück
Berlin (epd). Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat im Zusammenhang mit dem Rücktritt des Direktors des Jüdischen Museum Berlin, Peter Schäfer, den Vorwurf zurückgewiesen, der verlängerte Arm der israelischen Regierung zu sein. Wer dies behaupte, irre, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der Wochenzeitung "Jüdische Allgemeine" (Online). Er habe zu keinem Zeitpunkt den Rücktritt Schäfers gefordert. Es habe allerdings bereits vor dem vom Zentralrat kritisierten Tweet, der letztlich zum Rücktritt Schäfers führte, Entwicklungen im Jüdischen Museum gegeben, die ihn besorgt hätten, sagte Schuster weiter.
Zugleich warf Schuster dem Museum vor, sich einseitig politisch positioniert zu haben, "wie zum BDS‐Beschluss des Bundestages". Dafür habe er kein Verständnis, sagte der Zentralratspräsident.
Auch der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, wies Vorwürfe von Einflussnahme der israelischen Regierung zurück. Zuletzt sei der falsche Eindruck erweckt worden, Israel versuche, deutsche kulturelle Institutionen zu zensieren und die künstlerische und intellektuelle Autonomie des Jüdischen Museums Berlin einzuschränken, schrieb Issacharoff in einem Beitrag für den Berliner "Tagesspiegel" (26. Juni).
"Das Maß ist voll"
Der bisherige Museumsdirektor Schäfer war vor zwei Wochen nach harscher Kritik des Zentralrates zurückgetreten. Aktueller Auslöser der Kritik von Zentralratspräsident Schuster am Museum war eine Leseempfehlung der Museums-Pressestelle über Twitter. Darin wurde auf einen Zeitungsartikel über eine Erklärung israelischer und jüdischer Wissenschaftler verwiesen, die einen Beschluss des Bundestages kritisierten, in dem das Parlament die israelkritische BDS-Bewegung als antisemitisch bezeichnet. BDS fordert den Boykott Israels sowie Sanktionen wegen der Besatzungspolitik. Das Jüdische Museum Berlin soll nun bis Frühjahr 2020 eine neue Leitung bekommen.
Schuster hatte am 11. Juni in einer Reaktion auf die per Twitter verbreitete Leseempfehlung selbst in einem Tweet geschrieben, "das Maß ist voll. Das Jüdische Museum Berlin scheint gänzlich außer Kontrolle geraten zu sein." Es dränge sich die Frage auf, ob Direktor Schäfer seiner Aufgabe noch gewachsen sei und wer eigentlich die Leitlinien des Jüdischen Museums vorgebe.
Issacharoff erklärte, "in demokratischen Gesellschaften sind Museen dazu da, Besucher mit kulturellem Wissen auszustatten, und nicht dazu, Menschen politisch zu indoktrinieren". Schuster unterstrich, "was ich als problematisch erachte, ist die politische Haltung, die durch das Jüdische Museum vertreten wurde". Selbstverständlich dürfe und soll ein Museum Ort des Austauschs und der Debatte sein. Weiter betonte er, er habe zu keinem Zeitpunkt Schäfer Antisemitismus vorgeworfen.
"Großer Freund Israels"
Der Präsident des Goethe-Institutes, Klaus-Dieter Lehmann, äußerte Bedauern über den Rücktritt Schäfers. Dieser sei "ein großer Freund Israels", ein "Judaist von internationaler Reputation" und ein profunder Kenner der jüdischen Geschichte. Schäfer habe im Judentum "nicht nur den Geist des Glaubens, sondern auch den der Kritik" gesehen und das Museum "als Ort einer liberalen, manchmal auch kontroversen Diskussion" begriffen. Damit habe Schäfer ein ideales Forum geschaffen, "um über aktuelle Fragen von Religion, Kultur und Politik zu reflektieren". Zuvor hatten sich schon zahlreiche Museumsdirektoren, Wissenschaftler und Kulturschaffende aus Israel, Europa und den USA mit Schäfer solidarisiert.
Türkisches Verfassungsgericht: Inhaftierung Yücels rechtswidrig

epd-bild/Christian Ditsch
Frankfurt a.M., Ankara (epd). Die Inhaftierung von Deniz Yücel war rechtswidrig. Zu diesem Schluss kommt das türkische Verfassungsgericht in Ankara in einer am Freitag im Amtsblatt der Regierung veröffentlichten Entscheidung. Die rechtswidrige Untersuchungshaft habe Yücels Recht auf persönliche Sicherheit, Freiheit und Meinungsfreiheit verletzt, heißt es in dem auf den 28. Mai datierten Urteil. Das Gericht sprach dem früheren Türkei-Korrespondenten der "Welt" außerdem einen Schadensersatz von 25.000 Türkischen Lira (umgerechnet rund 3.800 Euro) zu.
Einen Verstoß gegen das Folterverbot, den Yücel vor dem Verfassungsgericht ebenfalls geltend gemacht hatte, erkannten die Richter jedoch nicht an. "Leider kommt dieses Urteil sehr spät; es hätte ganz andere Folgen haben können, wenn sich das Verfassungsgericht mit unserer Beschwerde befasst hätte, als mein Mandant noch in Haft war", sagte Yücels Anwalt Veysel Ok der "Welt". Das Gericht habe nun bestätigt, dass sich Yücel "nichts außer Journalismus" zuschulden kommen lassen habe, erklärte Ok.
Tritte, Schläge, Drohungen
Yücel saß ab Februar 2017 knapp ein Jahr lang ohne Anklageschrift in türkischer Untersuchungshaft, davon neun Monate in strenger Einzelhaft. Nachdem die Staatsanwaltschaft schließlich eine Anklage vorgelegt hatte, wurde er aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Silivri bei Istanbul entlassen und verließ die Türkei. Seit Juni 2018 wird ihm in Istanbul in Abwesenheit der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Journalisten Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor. In seiner Verteidigungsschrift in dem Verfahren, die Yücel im Mai dem Berliner Amtsgericht Tiergarten vorlegte, berichtete er von wiederholten Tritten, Schlägen und Drohungen in der Haft.
Yücel wird ab Juli erstmals seit seiner Inhaftierung wieder regelmäßig für die "Welt" berichten. Von Dresden aus wird der 45-Jährige die kommenden Landtagswahlen in Ostdeutschland begleiten, wie Ulf Poschardt, Chefredakteur der Welt-Gruppe, am Donnerstag ankündigte.
Ermordung von Jamal Khashoggi: Verlobte will Aufklärung

epd-bild/Marc Engelhardt
Genf (epd). Als sie sich an den 2. Oktober 2018 erinnert, stockt Hatice Cengiz erstmals die Stimme. Auf einmal ist ihre feste Miene dahin, sie scheint Tränen zurückzuhalten. Es ist der Morgen, an dem sie ihren Verlobten Jamal Khashoggi zum letzten Mal gesehen hat: "Wir haben über die geplante Hochzeit gesprochen, über unsere Pläne - und wer hätte sich ausmalen können, wie das Ende aussieht."
Khashoggi kehrte nie zurück. 17 lange Tage hoffte Cengiz, dass der Journalist, der die Regierung in Saudi-Arabien so oft kritisiert hatte, doch noch lebt. Dann gab die Regierung in Riad zu, er sei im Konsulat in Istanbul getötet worden. Er war wegen Papieren für die Hochzeit dorthin gekommen.
Die UN-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard geht nach einer monatelangen Untersuchung davon aus, dass es sich um einen geplanten Mord gehandelt hat. Sie macht Saudi-Arabien als Staat dafür verantwortlich und sieht belastbare Beweise dafür, dass hochrangige Vertreter des Königreichs und auch der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman in den Mord verwickelt waren. Saudi-Arabien weist das zurück. Ihren seit einer Woche schriftlich vorliegenden Bericht stellte Callamard am 26. Juni im UN-Menschenrechtsrat vor.
Angstzustände
Cengiz ist nach Genf gekommen, um Callamard zu unterstützen. Und um ihre Forderung an die Vereinten Nationen zu bekräftigen, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten. Callamards Bericht hält Cengiz für absolut glaubwürdig. "Ich fordere alle Staaten auf, Sanktionen gegen Saudi-Arabien zu verhängen", sagte sie - um Druck aufzubauen und die Aufklärung voranzutreiben.
In der kommenden Woche ist es neun Monate her, dass ihr Verlobter ermordet wurde. Sie leide bis heute unter Angstzuständen. Und doch ist klar: Sie will kämpfen. "Ich habe keinen exakten Plan, sondern werde spontan entscheiden, was ich tue." Etwa, ob sie nach Brüssel oder Berlin reist, um für Druck auf Riad zu werben. In Washington war sie bereits. Der Kongress habe ihr Hilfe zugesagt, und das sei besonders wichtig, da Khashoggi zuletzt im US-Exil gelebt hatte.
Ihr Gegner ist mächtig, das weiß Cengiz. Saudi-Arabien sitzt nicht nur im Menschenrechtsrat, der als erstes über den Callamard-Bericht befinden muss. Das Königreich übernimmt bald die Präsidentschaft der G20 - obwohl nach Angaben von Amnesty International noch mindestens 30 Journalisten in saudischen Gefängnissen sitzen. "Das saudische Regime hat schon viele Kritiker ermordet, Jamal ist nur einer davon", betont Cengiz. Sie kämpft gegen das saudische Narrativ, es habe sich um einen bedauerlichen Einzelfall gehandelt.
Cengiz ist nicht alleine nach Genf gekommen. Da ist etwa die Südafrikanerin Yumna Desai, die in Saudi-Arabien Englisch unterrichtete. Bis sie 2015 verhaftet und für drei Jahre ins berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis von Dhahban gesteckt wurde. Warum, das weiß sie bis heute nicht. "95 Prozent derjenigen, die ich in Dhaban getroffen habe, hatten nichts getan", sagt die Frau im Niqab. "Es sind einfache Leute, über ihre Fälle berichtet niemand, sie werden einfach verhaftet." Vielleicht haben sie etwas Falsches gesagt, vielleicht wurden sie denunziert. Vielleicht diente ihre Festnahme nur der Abschreckung. Niemand weiß es.
Blut an den Wänden
Huda Mohammad ging es ganz ähnlich. Sie berichtet, wie sie von zwei Wärterinnen in ihre Einzelzelle geschleift wurde, an deren Wänden Blut klebte: "Das Schreien der Gefangenen, Tag und Nacht, das höre ich heute noch."
Cengiz hofft, dass Khashoggis Tod den Blick auf die Opfer eines brutalen Gewaltregimes lenkt. Womöglich ist es die Angst vor diesem Regime, die Khashoggis Familie zum Schweigen zwingt. Das deutet Cengiz nur an, denn für andere will sie nicht sprechen. Hat die saudische Regierung Geld angeboten gegen Schweigen? Ihr nicht, sagt sie. Überhaupt hätten saudische Stellen sie bis heute nicht kontaktiert.
Irgendwann will Cengiz ein Buch über Khashoggi schreiben. Aber im Moment sei sie noch zu sehr mit der juristischen und politischen Aufarbeitung beschäftigt. Wie die nun vorankommt, ist ungewiss. UN-Generalsekretär António Guterres ließ seinen Sprecher verkünden, er sehe sich nicht befugt, die geforderte Untersuchung ohne Auftrag eines Mitgliedsstaats oder eines UN-Gremiums einzuleiten. Womöglich wird es der oft als zahnlos geschmähte Menschenrechtsrat sein, der diesen Auftrag erteilt. Hatice Cengiz jedenfalls hofft darauf.
Sechs Journalisten mit Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet
Berlin (epd). Sechs Journalisten sind am 26. Juni mit dem Theodor-Wolff-Preis der deutschen Zeitungen ausgezeichnet worden. In der Kategorie "Meinung überregional" ging der Preis an Daniel Schulz von der "tageszeitung" (taz), wie der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Berlin mitteilte. Schulz' Stück "Wir waren Brüder" über seine Jugend in Ostdeutschland und rechte Strukturen in der Gesellschaft sei ein "relevanter, tiefgründig archäologischer Text unserer Zeit", befand die Jury. Der Autor und Biograf Michael Jürgs (74) wurde für sein Lebenswerk geehrt.
Der schwer erkrankte Jürgs konnte den Preis nicht persönlich entgegennehmen. "Die Umschreibung unseres geliebten Berufes als vierte Macht war mir stets zu martialisch", erklärte der frühere Chefredakteur von "Stern" und "Tempo" in seiner von BDZV-Präsident Mathias Döpfner verlesenen Dankesbotschaft: "Jetzt aber, in Zeiten, da Barbaren unsere Zivilgesellschaft attackieren und vor Mord nicht zurückschrecken, ist es der passende Begriff."
Anwalt der Menschen in der Provinz
In der Kategorie "Meinung lokal" ging der Preis an Gregor Peter Schmitz von der "Augsburger Allgemeinen". In seinem Beitrag "Heimat-Schutz" habe sich der Autor zum Anwalt der Menschen in der Provinz gemacht. In der Kategorie "Reportage lokal" zeichnete die Jury Maris Hubschmid aus. Die "Tagesspiegel"-Redakteurin erhielt den Preis für ihre Reportage "Bis zum letzten Tropfen" über ein Heim für alkoholkranke Männer in Berlin.
Marius Buhl vom Magazin der "Süddeutschen Zeitung" wurde in der Kategorie "Reportage überregional" ausgezeichnet. Sein Text "Bis zum Letzten" über die langsamsten Mitläufer eines Marathons habe "die Perspektive genial umgedreht", würdigte die Jury unter Vorsitz des stellvertretenden "Bild"-Chefredakteurs Nikolaus Blome.
Preisträger beim Jury-Thema des Jahres "Welt im Umbruch - Demokratie in Gefahr" ist Andrian Kreye von der "Süddeutschen Zeitung". An seinem Text "Berührungspunkte" gefiel der Jury ein betont unaufgeregter Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz.
Disput über "Zeit"-Beitrag
Die Auszeichnungen sind in den Standardkategorien je Preisträger mit 6.000 Euro dotiert. Der Preis wird seit 1962 verliehen und erinnert an Theodor Wolff (1868-1943), den langjährigen Chefredakteur des "Berliner Tageblatts". Wolff musste 1933 vor den Nazis ins französische Exil fliehen, dort wurde er verhaftet und der Gestapo ausgeliefert. 1943 starb er im Jüdischen Krankenhaus in Berlin.
Zu den Nominierten für den diesjährigen Preis hatten ursprünglich auch die beiden "Zeit"-Redakteurinnen Mariam Lau und Caterina Lobenstein gehört. Sie hatten für die Wochenzeitung im Juli 2018 einen umstrittenen Beitrag über das Für und Wider privater Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer verfasst. Lobenstein, die in dem Beitrag die Pro-Position vertreten hatte, wollte für diesen Beitrag jedoch nicht nominiert werden. Der "Zeit-Artikel hatte vor allem wegen der Überschrift "Oder soll man es lassen?" für Empörung gesorgt. Die Chefredaktion der Wochenzeitung hatte im Nachgang Fehler bei der Aufmachung des Artikels eingeräumt.
Zentrum für verfolgte Künste zeigt "Spirit of the Poet"
Solingen (epd). Das Zentrum für verfolgte Künste lenkt den Blick auf zeitgenössische Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit Verfolgung, Flucht und Vertreibung auseinandersetzen. Unter dem Titel "The Spirit of the Poet" zeigen vom 5. Juli bis zum 25. August die irakischen Künstlerinnen Hanaa Malallah und Hayv Kahraman, die in Berlin und Istanbul lebende Azade Köker sowie Maja Bajevic, Esref Yildirim, Eyal Segal aus Israel und Simon Wachsmuth ihre Arbeiten, wie das Museum ankündigte. Das Zentrum für verfolgte Künste würdigt mit der Ausstellung die jüdische und deutsche Dichterin und Künstlerin Else Lasker-Schüler zu ihrem 150. Geburtstag. Präsentiert werden auch Originale von Lasker-Schüler selbst.
Freie Wohlfahrtspflege NRW lobt Sozialpreis für Lokalfunk aus
Düsseldorf (epd). Die Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen suchen wieder herausragende redaktionelle Beiträge zu Gesundheits- und Sozialthemen im Lokalfunk NRW. Die Wohlfahrtsverbände zeichnen in diesem Jahr zum dritten Mal Beiträge der Lokalradios aus, die sich mit Problemen benachteiligter und notleidender Menschen befassen und auf Beratungs- und Hilfeangebote verweisen, teilte die Landesarbeitsgemeinschaft am 1. Juli in Düsseldorf mit. Für den Sonderpreis "Sozialpreis NRW" können Beiträge bis 2. August eingereicht werden.
Die Lokalradios seien nah bei den Menschen wie auch die Angebote und Projekte der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, erklärte der Vorsitzende Christian Heine-Göttelmann. "Auf ihre jeweils eigene Art tragen die Sender wie auch unsere Einrichtungen und Initiativen dazu bei, dass in Nordrhein-Westfalen ein lebendiges, offenes Miteinander gelebt wird." In der Freien Wohlfahrtspflege NRW haben sich die Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Der Paritätische, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonischen Werke und Jüdischen Gemeinden mit ihren 16 Spitzenverbänden zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen.
Die Preisverleihung findet am 15. November in Düsseldorf im Rahmen der Verleihung der NRW-Hörfunkpreise der Landesanstalt für Medien statt, die jährlich den LfM-Hörfunkpreis ausschreibt. Ausgezeichnet werden Mitarbeiter der Lokalradios sowie Akteure aus dem Bereich der Radio-Werbung in verschiedenen Kategorien. Ein weiterer Sonderpreis neben dem Sozialpreis ist der Medienethische Sonderpreis, der von den evangelischen Kirchen und der katholischen Kirche in NRW gestiftet wird.
"Orgel des Jahres 2019" steht in der Stadtkirche Gronau
Gronau, Hannover (epd). Die Stadtkirche Gronau beherbergt die "Orgel des Jahres 2019" der Stiftung Orgelklang. "Die im Jahr 1904 erbaute Sauer-Orgel gilt als das bedeutendste spätromantische Instrument seiner Größe im Westen Deutschland", teilte die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am 27. Juni in Hannover mit. An der Orgelabstimmung nahmen den Angaben zufolge 1.344 Menschen teil. Auf den weiteren Plätzen folgten die Orgel der Dorfkirche im rheinland-pfälzischen Flonheim-Uffhofen und das Instrument in St. Laurentius im bayrischen Steinkirchen.
Die Orgel der Stadtkirche Gronau hatte sich den Angaben zufolge ursprünglich in der stillgelegten evangelischen Kirche in Dortmund-Dorstfeld befunden, wo sie immer weiter verfallen wäre. Vor ihrem Umzug nach Gronau musste das Instrument umfassend saniert werden, wie die EKD mitteilte. Die von der EKD gegründete Stiftung Orgelklang habe dieses Unterfangen 2018 mit 5.000 Euro gefördert.
Religio-Museum erhält Sammlung eines evangelischen Pastors
Telgte (epd). Das Westfälische Museum für religiöse Kultur in Telgte präsentiert ab 21. Juli in einer Ausstellung Bilder und Objekte bedeutender Künstler wie Joan Miró, Joseph Beuys, Katharina Grosse, Gerhard Richter und Josef Albers. Die Werke stammen aus der vielseitigen Sammlung des evangelischen Pastors Diethelm Röhnisch aus Wesel, die er nun dem Museum überlässt, wie das Religio-Museum am 26. Juni mitteilte. In den vergangenen 60 Jahre habe der Theologe Motive zusammengetragen, die einen sakralen Bezug zu seinem Leben und seiner früheren Arbeit als Pfarrer hätten. Die Sonderschau "Ein Leben mit der Kunst" solle Einblick geben in die Sammlung eines gläubigen und zugleich von der Kunst inspirierten Menschen, hieß es.
Nach Worten von Röhnisch geht es ihm als Sammler nicht um großen Namen und den Wert der Werke. Es sei vielmehr die Neugier darüber, "was würde dieses Werk bei mir bewirken", erläuterte er. Auch spielten häufig persönliche Begegnungen mit den Künstlern eine große Rolle.
Die Sammlung umfasst den Angaben nach Gemälde, Kollagen, Grafiken und Buchobjekte sowie Dokumentationen von Aktionskunst aus fast allen Kunstgattungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Relio-Museum zeigt bis 1. September eine Auswahl davon.
Davor macht ab 5. Juli das Ausstellungsprojekt "Saligia" in Telgte Station, das sich mit den sieben Todsünden beschäftigt. Die Wanderausstellung mit Werken von sieben deutschen Künstlern - darunter Ottmar Hörl und Katharina Krenkel - reist derzeit durch Westfalen. In Telgte werden die mobilen Kunstwerke zu Wollust, Hochmut, Faulheit, Neid, Zorn sowie Geiz und Völlerei sieben Wochen lang im Außengelände zwischen Stadtkirche und Wallfahrtskapelle geparkt.
Entwicklung
Gegen die Armut: Laufschuhe "Made in Kenya"

epd-bild/Bettina Rühl
Nairobi (epd). 2018 stellten zwei Kenianer Weltrekorde bei Langstrecken auf. Eliud Kipchoge lief den Marathon in Berlin in 2:01:39 Stunden. Abraham Kiptum brauchte für den Halbmarathon im spanischen Valencia 58:18 Minuten. International erfolgreiche Athleten wie diese beiden trainieren und laufen in Schuhen aus westlicher Produktion, meist aus den USA.
Daniel Simiyu hingegen trägt "Enda", die ersten Laufschuhe "Made in Kenya", ersonnen von der kenianischen Juristin Navalayo Osembo und dem US-Kommunikationsexperten Weldon Kennedy. Der 20-jährige Simiyu trabt darin leichtfüßig über die rotbraune Lehmpiste in der Stadt Iten. Hier im Hochland ist es frisch, was Simiyu recht ist, denn er läuft jede Woche etwa 160 Kilometer. "Ich träume davon, bei internationalen Wettkämpfen für mein Heimatland zu starten", sagt der drahtige junge Mann.
"Im Sport wirklich gut"
Das wird nicht leicht. Im Läuferland Kenia, das zurzeit auch wegen Dopings Schlagzeilen macht, ist die Konkurrenz stark. Dass Simiyu einer der beiden Athleten ist, die "Enda"-Schuhe testen, könnte ihn seinem Ziel näher bringen. Denn sonst sind gute Laufschuhe für ihn, der ganz am Anfang seiner Karriere steht, fast unerschwingliche Luxusgüter. Ein Schuh von "Enda" kostet wie andere hochwertige Laufschuhe rund 100 US-Dollar.
"Enda" bedeutet "Lauf!" in der Landessprache Kisuaheli - der Ruf, mit dem Fans ihre Athleten anfeuern. Osembo und Kennedy haben das Unternehmen 2016 gegründet. Sie habe sich lange gefragt, "wie wir erreichen können, dass Sport den größtmöglichen gesellschaftlichen Einfluss hat", erklärt die 33-jährige Wirtschafsprüferin. "Denn im Sport sind Kenianer wirklich gut." Bei einem Forum für Unternehmensgründer traf sie Kennedy, ein Experten für soziale Kampagnen.
Arbeitsplätze und Chancen schaffen
Die beiden überlegten, wie Kenia auch wirtschaftlich vom Erfolg seiner Läufer profitieren könnte. Sie wollten Arbeitsplätze und Chancen schaffen, damit mehr Menschen etwas aus ihrem Leben und für die Zukunft ihrer Kinder machen könnten, erklärt Osembo.
So entstand die Idee, einen Laufschuh in Kenia zu produzieren. Das Geld für ihr erstes Modell sammelten die jungen Unternehmensgründer durch eine Kampagne auf der Online-Plattform Kickstarter. Sie bekamen fast das Doppelte der Summe, auf die sie gehofft hatten: 140.000 US-Dollar. Ihre Schuhe entwickelten sie zusammen mit Athleten. "Wenn unsere Schuhe bei kenianischen Läufern ankommen sollen, müssen wir sie als Experten fragen", sagt Osembo.
Laufen einzige Hoffnung
Daniel Simiyu testet gerade den Prototyp des zweiten "Enda"-Modells, "Lapatet". Für den jungen Mann ist das Laufen die einzige Hoffnung. Er gehört zum Hirtenvolk der Rendile und verlor seine Eltern 2002 bei einem bewaffneten Raubüberfall, der dem Vieh der Familie galt. Weil Geld immer knapp war, hat Simiyu nur die Grundschule besucht. Derzeit kann er sich nur dank des Großmuts eines Kollegen, der ihn bei sich wohnen und essen lässt, auf den Sport konzentrieren. Auch bei den Startgebühren ist Simiyu auf Sponsoren angewiesen, bisweilen übernimmt "Enda" die Kosten.
Die 28-jährige Joan Cherop Massah, die ebenfalls für Enda testet und startet, kann bereits von ihren Preisgeldern leben. Sie ist schon in Deutschland, Korea, Peru und den USA gelaufen. Auch für sie gab es keine Alternative zum Laufen: Sie ist Angehörige der Pokot, ebenfalls ein Hirtenvolk. "Ich bin kaum in die Schule gegangen, weil mein Vater das nicht wollte", erzählt sie. Ihr Vater sah in seinen Töchtern vor allem den Gegenwert: den Brautpreis, der in Rindern gezahlt wird.
Ziel fest vor Augen
Zwei Mal lief Massah von zu Hause fort: zuerst, um ihrer Beschneidung zu entgehen. Ein zweites Mal und dann endgültig, um nicht schon als Mädchen verheiratet zu werden. Erst vor fünf Jahren kehrte sie für einen Besuch zurück und ließ ihren Eltern ein Haus aus Stein bauen, das sie von Preisgeld bezahlte. "Ich wollte ihnen zeigen, dass auch Mädchen etwas leisten können."
Beide Athleten träumen davon, eines Tages genug Geld zu haben, um anderen helfen zu können: Simiyu möchte ein Waisenhaus gründen, Massah ein Trainingsheim für Sportlerinnen und Sportler. Außerdem möchte sie in ihrer Gesellschaft gegen Beschneidung und gegen Zwangsheiraten werben.
Auch die "Enda"-Gründer haben ihr Ziel fest vor Augen. Zwar werden ihre Schuhe bisher erst zu einem guten Drittel in Kenia produziert, weil Wissen und Produktionskapazitäten noch nicht reichen. "Aber wir sind sicher, dass wir eines Tages zu 100 Prozent 'Made in Kenya' sind", meint Osembo. Das bedeutete noch mehr Arbeitsplätze, und weitere Sponsorenprogramme für Athleten.
Eritrea verteidigt Enteignung katholischer Krankenhäuser
Genf (epd). Eritrea hat die Enteignung katholischer Krankenhäuser als rechtmäßig verteidigt. Mit der Beschlagnahme von 40 Hospitälern und Krankenstationen im kirchlichen Besitz setze der Staat ein Gesetz um, das Glaubensgemeinschaften den Betrieb solcher Einrichtungen verbiete, hieß es in einer am 27. Juni verbreiteten Erklärung der eritreischen UN-Botschaft in Genf. Damit solle vermieden werden, dass in dem säkularen Staat Anhänger einer der vier offiziell anerkannten Religionen bevorzugt würden. Kliniken dürften nur vom Staat betrieben werden.
Die eritreische Botschaft reagierte damit auf die jüngste Kritik der für die Menschenrechtslage in Eritrea zuständigen UN-Sonderberichterstatterin Daniela Kravetz, die zur Freiheit von Religion und Kirche in dem Land am Horn von Afrika aufgerufen hatte. Aus Kravetz' Sicht zeigt die Beschlagnahme, dass die Menschenrechtslage in Eritrea trotz des jüngst geschlossenen Friedensvertrags mit Äthiopien unverändert schlecht sei. Sie kritisierte zudem die Festnahme zahlreicher Christen. Seit Anfang Mai seien mehr als 170 von ihnen in Gewahrsam genommen worden, nur weil sie ihrem Glauben nachgingen.
Mandantsverlängerung unklar
Auf diese Vorwürfe ging die Botschaft in ihrem Statement nicht ein, sondern warf Kravetz generell Stimmungsmache vor. In der kommenden Woche diskutiert der UN-Menschenrechtsrat in Genf über ihren Bericht zur Lage der Menschenrechte in Eritrea. Ob das Mandat der Chilenin Kravetz verlängert wird, ist noch unklar. Bisher hat kein Mitgliedsland einen entsprechenden Antrag vorgelegt. Eritrea gehört dem Rat ebenfalls an, der 47 Mitglieder hat.
Welthungerhilfe: "Wir brauchen endlich Taten"
Die Welthungerhilfe rechnet in Zukunft mit weniger Ernte infolge des Klimawandels. Die Haushaltsmittel für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dürften deshalb nicht stagnieren oder gar sinken, betont die Organisation.Berlin (epd). Die Deutsche Welthungerhilfe hat die internationale Staatengemeinschaft aufgerufen, beim G20-Gipfel in Japan dringend Maßnahmen für eine klimagerechte Politik zu vereinbaren. "Wir brauchen endlich Taten", sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, am 26. Juni in Berlin bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2018. Der Konsum und der Lebensstandard der Industrieländer verursachten ökologische und wirtschaftliche Kosten. Und die Welthungerhilfe spüre "die fatale Verbindung zwischen Klimawandel und Welternährung" zunehmend in ihrer Arbeit, sagte Thieme.
An die Adresse der Bundesregierung richtete Thieme die Forderung, die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag einzuhalten und die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit im gleichen Verhältnis steigen zu lassen wie die Verteidigungsausgaben. Die Hilfsorganisation verfügte im vergangenen Jahr über rund 213,6 Millionen Euro, knapp 50 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Grund seien etwa Verträge mit Projektpartnern wie dem Welternährungsprogramm, die Ende 2018 abgeschlossen wurden und erst in die Bilanz für 2019 einfließen, sagte Generalsekretär Mathias Mogge.
Weniger private Spenden
Fast drei Viertel der Erträge (155,4 Millionen Euro) waren 2018 sogenannte institutionelle Zuschüsse, etwa vom Bundesentwicklungsministerium (38,6 Millionen Euro), dem Auswärtigen Amt (20,3 Millionen Euro) oder dem Welternährungsprogramm (16,9 Millionen Euro). 54,9 Millionen Euro kamen aus privaten Spenden, knapp neun Millionen weniger als im Jahr davor. Zur Begründung hieß es, 2018 habe es keine medial präsenten Katastrophen gegeben, die die Spendenbereitschaft in der Regel mitbeeinflussen.
Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 404 Projekte im Ausland finanziert. Die höchsten Förderungen gingen nach Burundi, Liberia und Syrien/Türkei. Die schlechte Sicherheitslage in vielen Projektländern erschwere den Zugang zu Menschen in Not und stelle die Welthungerhilfe vor große Herausforderungen, sagte Mogge. "Ganze Regionen sind bei Kämpfen von der Außenwelt abgeschnitten und Kriegsparteien verhindern die Einfuhr und den Transport von Hilfsgütern."
Im Mittelpunkt der Arbeit des vergangenen Jahres standen nach Angaben Thiemes die Folgen von Kriegen und Klimawandel. Wegen steigender Temperaturen müsse in den kommenden Jahren mit drastischen Ernterückgängen, der Ausdehnung von Trockengebieten und abnehmenden Fischbeständen gerechnet werden, sagte die Präsidentin der Welthungerhilfe, die auch Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung bei der Bundesregierung ist. So sei die Zahl der Hungernden wieder auf 821 Millionen Menschen weltweit angestiegen.
"Landimportierende Staaten"
Die Folgen des Klimawandels träfen am stärksten die Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, sagte Thieme: "Die Ärmsten des Südens tragen die Hauptlast eines Problems, das die reichen Länder des Nordens ausgelöst haben."
Deutschland gehöre aktuell zu den zehn größten "landimportierenden" Staaten: "22 Millionen Hektar Ackerland müssen für unseren Konsum bewirtschaftet werden. Davon werden nur zwölf Millionen Hektar durch die Produktion im eigenen Land gedeckt." Den Rest müssten Flächen im Ausland bereitstellen etwa für Futtermittel aus Brasilien und Argentinien oder Palmöl aus Indonesien und Malaysia.

