Kirchen
Kirchen verlieren 2017 mehr als 600.000 Mitglieder
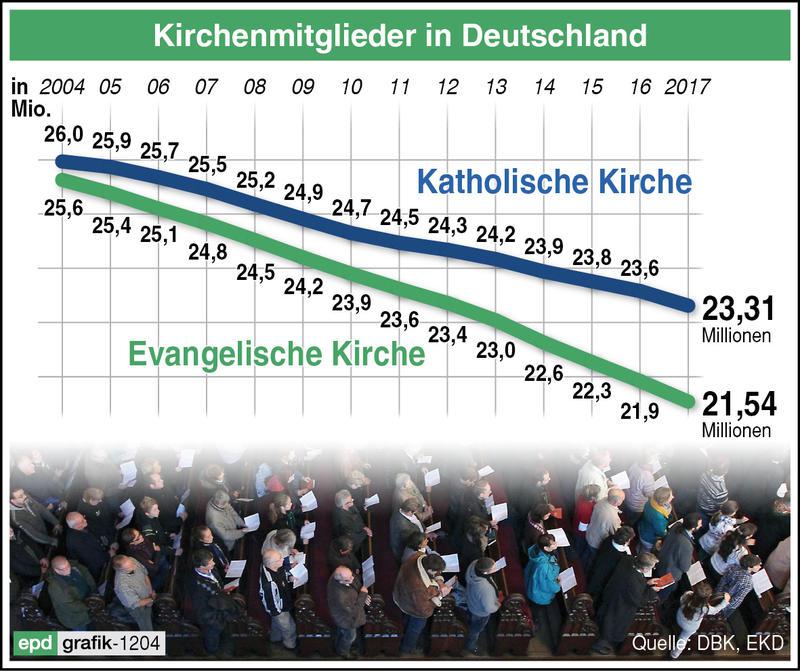
epd-bild/Oliver Hauptstock
Hannover, Bonn (epd). Die großen christlichen Kirchen in Deutschland verlieren weiter Mitglieder. 2017 sank die Zahl der Mitglieder der evangelischen Kirche auf 21,5 Millionen. 23,3 Millionen Menschen gehörten der katholischen Kirche an, wie aus den am 20. Juli von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Statistiken hervorgeht. Die 20 protestantischen Landeskirchen haben dabei mehr Mitglieder (390.000) verloren als die 27 katholischen Bistümer (270.000).
Der Mitgliederschwund summierte sich damit bei beiden Kirchen auf 660.000. 2016 waren es insgesamt rund 530.000 verlorene Mitglieder. Dennoch gehört noch mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Bevölkerung einer der beiden großen Kirche an. Hinzu kommen Christen aus orthodoxen oder Freikirchen.
Demografischer Wandel gibt den Ausschlag
Ursache des Mitgliederschwundes ist vor allem der demografische Wandel. 350.000 Mitglieder der evangelischen Kirche starben 2017. Die katholische Kirche zählte rund 240.000 Bestattungen. Gleichzeitig stieg im vergangenen Jahr, in dem die Protestanten das 500. Reformationsjubiläum feierten, die Zahl der Kirchenaustritte. Rund 200.000 Menschen kehrten der evangelischen Kirche den Rücken, 2016 waren es etwa 10.000 weniger. Auch die katholische Kirche verzeichnete 2017 mehr Austritte - rund 168.000 (2016: 162.000).
Zugleich lag die Zahl neu oder wieder gewonnener Mitglieder höher als die der Austritte. Rund 205.000 Menschen wurden den Angaben zufolge 2017 in der evangelischen Kirche getauft oder aufgenommen, etwa so viele wie im Vorjahr. Die katholische Kirche gewann durch Taufe, Eintritt oder Wiederaufnahme rund 180.000 Mitglieder. Die Differenz zum Gesamtverlust ergibt sich nach Angaben der EKD unter anderem aus Wegzügen aus Deutschland und Ungenauigkeiten durch Rundungen und Hochrechnungen, weil noch nicht alle Landeskirchen zum Stichtag 31. Dezember 2017 endgültige amtliche Daten vorlegen konnten.
Der Sekretär der katholischen Bischofskonferenz, Hans Langendörfer, erklärte, die Zahl der Austritte schmerze. Er ermunterte dazu, nach Gründen für den Kirchenaustritt zu fragen. Man wolle verstehen, warum Menschen in der Kirchen keinen Ort für Orientierung fänden und fragen, welche Veränderungen möglich seien "auch hinsichtlich einer Glaubwürdigkeit, die heute mehr als früher erwartet wird", sagte er.
Kirchensteuer-Einnahmen noch stabil
Der Mitgliederschwund wirkte sich 2017 nicht auf die Einnahmen durch Kirchensteuern aus. Das Aufkommen wuchs in der evangelischen Kirche nach deren Angaben auf 5,67 Milliarden Euro. Die katholische Kirche machte in ihrer Statistik dazu keine Angaben. Mittelfristig rechnen die Kirchen aber mit Einbußen durch den demografischen Wandel und das Ausscheiden der sogenannten Babyboomer-Jahrgänge von 1955 bis 1969 aus dem Berufsleben. Ein großer Teil der Kirchensteuern wird den Angaben zufolge von ihnen aufgebracht.
Die Erträge der evangelischen Kirche, zu denen auch Zuschüsse, Fördermittel und Einnahmen gehören, summierten sich laut letzter Datenerhebung von 2014 auf rund 12,3 Milliarden Euro. Davon entfällt fast ein Drittel (3,8 Milliarden Euro) auf die Arbeit in den knapp 14.000 Kirchengemeinden inklusive der Personalkosten der Pfarrer. Ein gutes Viertel (3,3 Milliarden Euro) wird für gemeindediakonische Aufgaben aufgewendet. In diesen Bereich fallen die kirchlich betriebenen Kindertagesstätten, deren Anzahl der Statistik zufolge 2017 auf 8.800 mit rund 43.000 Plätzen gestiegen ist.
Rechnet man die Einrichtungen des Wohlfahrtverbandes Diakonie hinzu, summiert sich die Zahl der Plätze in Kitas und Horten der evangelischen Kirche auf eine halbe Million. Die Zahlen verdeutlichten, welche gesellschaftliche Aufgabe die Kirche erfülle, schreibt der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im Vorwort der am Freitag veröffentlichten neuen Statistik-Broschüre seiner Kirche.
In der katholischen Kirche setzte sich 2017 der Strukturwandel fort. Die Zahl der Pfarreien sank bundesweit um etwa 90 auf 10.200, die der Priester auf rund 13.600 (2016: 13.900). Die Zahl der Diakone sowie Gemeinde- und Pastoralreferenten blieb auf dem Niveau des Vorjahres.
Landeskirchen und Bistümer in NRW werden kleiner

epd-bild / Jens Schulze
Düsseldorf, Bielefeld (epd). Die Zahl der neuen Gemeindemitglieder wiegt jedoch die hohe Zahl an Sterbefällen nicht auf, wie aus am 20. Juli veröffentlichten neuen Zahlen hervorgeht. Auch bundesweit werden die Mitglieder der großen christlichen Kirchen weniger.
In der Evangelischen Kirche im Rheinland sank die Zahl der Gemeindemitglieder binnen Jahresfrist um 36.700 (1,4 Prozent) auf 2,54 Millionen am 1. Januar dieses Jahres. In der Evangelischen Kirche von Westfalen ging die Zahl der Gläubigen im gleichen Zeitraum um rund 39.000 (1,7 Prozent) auf 2,24 Millionen zurück. Die Lippische Landeskirche verzeichnete einen Rückgang um rund zwei Prozent auf 159.320 Mitglieder.
Die Zahl der Taufen lag in der rheinischen Kirche 2017 mit 19.092 leicht unter dem Vorjahr (20.629). Zudem traten rund 3.530 Menschen in die Kirche ein. Im gleichen Zeitraum kehrten 20.130 Menschen der Landeskirche den Rücken (Vorjahr: 19.332). Die Zahl der gestorbenen Mitglieder war mit rund 38.820 fast doppelt so hoch.
Auch in der westfälischen Kirche sank die Zahl der Taufen leicht auf 15.012 (Vorjahr: 15.816). Mit Aufnahmen und Erwachsenentaufen kamen rund 19.000 Gemeindemitglieder hinzu. Dem standen 14.000 Austritte (Vorjahr 13.830) und 34.000 gestorbene Gemeindemitglieder gegenüber.
In der Lippischen Landeskirche sank die Zahl der Taufen im vergangenen Jahr ebenfalls von 1.210 im Vorjahr auf 1.015. Es gab 129 Wiedereintritte (Vorjahr: 162). Die Zahl der Austritte war mit rund 1.080 (Vorjahr: 1.210) leicht rückläufig. Rund 2.810 Mitglieder starben.
In den katholischen Bistümern in NRW verlief die Entwicklung ähnlich. Im Erzbistum Köln, dem mitgliederstärksten deutschen Bistum, lag die Zahl der Gläubigen nach einem Rückgang um rund 21.140 Menschen zu Jahresbeginn bei rund 1,97 Millionen. Im Bistum Münster sank die Mitgliederzahl um 18.000 auf 1,87 Millionen, im Erzbistum Paderborn von 1,53 auf 1,52 Millionen. Zum Bistum Aachen gehörten 1,04 Millionen Katholiken, im Vorjahr waren es 1,05. Im Ruhrbistum Essen sank die Mitgliederzahl um 10.456 auf gut 772.000.
Hauptursache des Mitgliederschwunds blieb auch bundesweit der demografische Wandel: Im vergangenen Jahr starben 350.000 Mitglieder der evangelischen und 240.000 der katholischen Kirche. Zugleich stieg im Bundesdurchschnitt die Zahl der Kirchenaustritte: Rund 200.000 Menschen kehrten der evangelischen Kirche den Rücken, 2016 waren es etwa 10.000 weniger. Aus der katholischen Kirche traten etwa 168.000 Menschen aus, das waren 6.000 mehr als im Vorjahr.
Religionssoziologe: Kirchen spielen eine Nebenrolle
Leipzig (epd). Nur wenige Menschen treten nach Ansicht des Religionssoziologen Gert Pickel aus Unzufriedenheit aus den christlichen Kirchen aus. Stattdessen wirke sich der Säkularisierungsprozess in der Gesellschaft auf die Austrittszahlen der Kirchen aus, sagte der Leipziger Professor für Kirchensoziologie dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Religion und Kirche spielen für viele Menschen maximal noch eine Nebenrolle im Leben", sagte Pickel. Rund 200.000 Protestanten und 168.000 Katholiken kehrten im vergangenen Jahr ihrer Kirche den Rücken.
Wie aus den am 20. Juli von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Statistiken hervorgeht, sind 2017 die Kirchenaustritte im Vergleich zu 2016 leicht gestiegen. "Das muss die Kirchen noch betroffener machen: Es gab nichts, was man konkret falsch gemacht hat", sagte Pickel. Anders als in Jahren zuvor habe es in den Kirchen keine Skandale wie etwa um Finanzen gegeben, die die höheren Austrittszahlen erklären könnten.
Dass sich das 500. Reformationsjubiläum, das die Protestanten 2017 feierten, nicht positiv auf die Mitgliederzahl der evangelischen Kirche ausgewirkt hat, überrascht Pickel nicht. "Junge oder nicht gläubige Menschen sind der Kirche so fern, dass sie das Jubiläum höchstens am Rande wahrgenommen haben", erklärte er. Mit der Feier habe die EKD allerdings die Beziehung zu den Menschen gestärkt, die bereits mit der Kirche verbunden gewesen seien.
Langfristige gesellschaftliche Prozesse
Die Gläubigen in der Kirche zu halten, ist laut Pickel für die Kirchen enorm wichtig. Denn es seien vor allem langfristige gesellschaftliche Prozesse, die sich ungünstig auf die Kirchenbindung der Menschen auswirkten. Als Beispiel nannte Pickel den zunehmenden Wohnortwechsel der Menschen, der für viele der "erste Bruch" mit der Kirche sei. Zudem bemühten sich Eltern weniger um eine religiöse Erziehung ihrer getauften Kinder. Sie wollten ihren Kindern die Intensität ihrer Beziehung zur Kirche selbst überlassen.
Die Kirchen müssen laut Pickel auch in Zukunft mit ähnlich hohen Austrittszahlen rechnen. Eine Möglichkeit, jüngere Menschen wieder für sich zu gewinnen, sieht der Experte bei kirchlichen Angeboten im sozialen Bereich: Etwa in der Flüchtlingshilfe gebe es derzeit die Situation, dass sich eher kirchenferne Jugendliche als Helfer bei kirchlichen Angeboten engagierten, erklärte der Wissenschaftler.
Flüchtlingspolitik: Bedford-Strohm wirft CSU Einseitigkeit vor
Berlin (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, wirft der CSU eine einseitige Positionierung in der Flüchtlingspolitik vor. "In den letzten Monaten hat man aus der CSU im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik immer nur davon gehört, wie man Flüchtlinge von uns fernhalten kann", sagte Bedford-Strohm der "Welt" (20. Juli). "Davon, dass wir auch eine humanitäre Verpflichtung zur Aufnahme haben, war wenig die Rede."
Hierüber sei es zwischen der Kirche und der Partei zu Auseinandersetzungen gekommen: "Es hat kontroverse Gespräche mit CSU-Politikern über die Art gegeben, in der mit dem Thema Migration in der Öffentlichkeit umgegangen wurde", sagte der bayerische Landesbischof. Manche Äußerungen hätten Anlass zu der Sorge gegeben, dass die Empathie verloren geht. Bedford-Strohm betonte: "Es darf nie aus dem Blick geraten, dass es sich bei den Flüchtlingen um Menschen handelt, von denen wir als Christen sagen, dass sie zum Bilde Gottes geschaffen sind."
Auch innerhalb der CSU, insbesondere in kirchlich engagierten Kreisen, sei zu Recht beklagt worden, dass in den vergangenen Monaten der Grundton in der öffentlichen Debatte verändert worden sei, um Wähler der AfD zurückzugewinnen, fügte Bedford-Strohm hinzu. "Das aber hat sich nicht nur als erfolglos erwiesen, sondern war auch inhaltlich unangemessen."
Der EKD-Ratsvorsitzende betonte, er bejahe "die Notwendigkeit zur Steuerung der Migration". Aber diese entbinde nicht von der Verantwortung für die Menschen, die sich in Not befinden. "Daher geht es nicht, dass man die Menschen an den Grenzen abweist, ohne klare Regelungen vereinbart zu haben, was mit ihnen dann passiert."
Seehofer wehrt sich gegen Kritik der Kirchen
München (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) setzt sich gegen Kritik der Kirchen an der Flüchtlingspolitik seiner Partei zur Wehr. Es werde immer ein Gegensatz zwischen Humanität und Sicherheit hergestellt, sagte der CSU-Chef dem "Münchner Merkur" (21. Juli). "Ist es unchristlich, Gefährder und Straftäter außer Landes zu bringen?" Ohne Ordnung im Land und den Schutz der einheimischen Bevölkerung werde es auf Dauer keine Humanität geben.
Seehofer kündigte an, dass er mit beiden großen christlichen Kirchen das Gespräch suchen werde, um ihnen die Beweggründe seiner Politik zu erläutern. Der Vorsitzende katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, hatte die Wortwahl der CSU in der Flüchtlingspolitik als "höchst unangemessen" kritisiert. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hatte der Partei vorgeworfen, ihr sei es zuletzt nur darum gegangen, Flüchtlinge fernzuhalten. Von der humanitären Verpflichtung zur Aufnahme sei wenig die Rede gewesen.
Mit Blick auf die Sicherheit in Deutschland sagte Seehofer der Zeitung: "Wir haben längst noch nicht alles im Griff." Man werde nie absolute Sicherheit garantieren können, aber die Politik habe auch noch nicht alles Menschenmögliche getan, um Sicherheit zu gewähren.
Westfälische Präses: Fluchtgründe nicht gottgegeben

epd-bild/Oliver Krato
Bielefeld/Düsseldorf (epd). Die westfälische Präses Annette Kurschus hat das politische Engagement der Kirche für Flüchtlinge verteidigt. "Manche Debatte wird hierzulande über den rechtlichen Status von Flüchtlingen geführt, als seien Flüchtlinge Sondermüll", sagte Kurschus der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (17. Juli). Dabei werde davon abgelenkt, dass die Fluchtgründe nicht gottgegeben, sondern menschengemacht seien. Diese Unterschiede und Zusammenhänge zu benennen, sei biblisches Kernanliegen und ecke politisch an. "Kein Mensch darf über andere Menschen verfügen, und kein Mensch politischer Willkür ausgeliefert werden."
Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen wies zudem erneut pauschale Kritik am Kirchenasyl zurück und betonte dessen humanitäre Bedeutung. Menschlichkeit, Menschenwürde und Menschenrechte seien in jedem Einzelfall zu respektieren, sagte Kurschus, die auch stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende ist. "Das Kirchenasyl als ultima ratio ist eine immer sorgfältig geprüfte und verantwortlich abgewogene Möglichkeit." Das dadurch eröffnete Zeitfenster, dessen Regeln sehr klar definiert seien, stärke den Rechtsstaat sogar. "Weil es in den meisten Fällen dem Recht zum Durchbruch verhilft", unterstrich die Präses. Im Bereich der westfälischen Kirche gibt es aktuell 28 Fälle von Kirchenasyl mit insgesamt 42 Personen.
Scharf kritisierte Kurschus die "verbale Aufrüstung" in der deutschen Politik seit Einzug der AfD in den Bundestag. "Was lange selbstverständlich war, scheint zu bröckeln: Zivile Umgangsformen. Ein fairer Diskurs. Gegenseitiger Respekt, auch bei abweichenden Meinungen", beklagte die leitende Theologin. Die Hemmschwelle für Beleidigungen und Verleumdungen sei gesunken. "Es besteht die Gefahr, dass populistische Tendenzen mit ebensolchen Mitteln bekämpft werden." Als Beispiel für eine menschenverachtende Sprache nannte Kurschus den Begriff "Asyltourismus", den Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) über die Zuwanderung von Flüchtlingen gebraucht hatte.
Die Kirche sollte sich nach Ansicht der Präses der Diskussion mit AfD-Wählern per se nicht verschließen, aber kritisch hinterfragen. So müsse deutlich gemacht werden, dass das Programm der rechtspopulistischen Partei und der christliche Glaube im Widerspruch zueinander ständen. "Wo Toleranz keine Rolle mehr spielt in der Begegnung mit Andersgläubigen, wo Humanität, Barmherzigkeit und Hilfeleistung in ihr Gegenteil verkehrt werden im Umgang mit Geflüchteten, wird der Kern des Evangeliums verraten", betonte Kurschus.
EKD-Migrationsexperte fordert humanitäre Korridore

epd-bild/Heiko Kantar/EKiR
Valletta, Düsseldorf (epd). Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, appelliert an die Politik, humanitäre Korridore nach Europa einzurichten. "Es geht nicht um ein vorübergehendes Phänomen, sondern um das Weltproblem Flucht, von dem aktuell 70 Millionen Menschen betroffen sind", sagte der Theologe am 18. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Valletta. Nach Gesprächen mit Mitarbeitern der Hilfsorganisation Sea-Watch, dem Besuch ankernder Rettungsschiffe und des Aufklärungsflugzeuges "Moonbird" auf der Insel Malta kritisierte der Theologe erneut das Aus der zivilen Seenotrettungsaktionen für Flüchtlinge aus dem Mittelmeer.
Dreitägige Aufklärungsreise
"Solange es so ist, dass Menschen mit Booten flüchten, müssen wir dafür sorgen, dass diese nicht zu Tode kommen", betonte Rekowski, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Umso deprimierender sei es nun zu erleben, dass die zivilen Seenotrettungsaktionen auf Malta durch die Behörden zum Erliegen gekommen seien und die Schiffscrews, die Flugzeugbesatzung und die Mitarbeiter im Büro zur Untätigkeit verdammt seien. Auch die Maschine "Moonbird", die die EKD finanziell allein 2018 mit bis zu 100.000 Euro unterstützt, darf derzeit maltesisches Hoheitsgebiet nicht verlassen.
Rekowski forderte zum Abschluss seiner dreitägigen Malta-Reise von Regierungen und politisch Verantwortlichen in Europa, internationales Recht nicht weiter zu brechen, die Kriminalisierung der zivilen Seenotretter zu beenden und das tausendfache Sterben an der südlichen Grenze Europas als humanitäre Katastrophe und politische Aufgabe zu begreifen. Neben der unverzüglichen Wiederaufnahme der zivilen Seenotrettung müsse darüber hinaus auch eine staatliche europäische Seenotrettung aufgebaut werden.
Auf Dauer werde sich die europäische und auch die Weltpolitik neben der Bekämpfung von Fluchtursachen mit sicheren Fluchtrouten befassen müssen, mahnte Rekowski. "Als Friedensnobelpreisträgerin muss die EU hier ihren Beitrag leisten", betonte er. Die Menschen flüchteten weiterhin über das Mittelmeer, auch wenn von Malta aus keine zivile Rettung erfolge. Auch die jüngsten Bilder einer spanischen Hilfsorganisation von einem Bootswrack und Leichen im Meer machten klar, dass es um Menschen gehe, die sich in ihrer Verzweiflung auf den Weg machten.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland werde er in den entsprechenden EKD-Gremien beraten, wie die Rettungseinsätze weiter unterstützt werden können und welche weiteren Schritte die Kirche ergreifen kann, sagte Rekowski. "Als Christinnen und Christen, die in Jesus Christus den Bedürftigen, den Flüchtling, den Menschen erkennen, werden wir auch weiter konsequent für Menschlichkeit einstehen."
Reformierter Bund ruft zu Spenden für Ungarn auf
Hannover/Detmold (epd). Der evangelische Reformierte Bund in Deutschland ruft zu Spenden für die Flüchtlingshilfe der Reformierten Kirche in Ungarn auf. Durch die dortige Flüchtlingspolitik seien der Flüchtlingshilfsaktion "Kalunba" zum 1. Juli mehr als eine Million Euro Fördermittel weggebrochen, teilte der Bund am 19. Juli in Hannover mit. Der Vorsitzende des Bundes, Martin Engels, sagte, die Kirche dürfe sich nicht "mit nationalen Verengungen abfinden". Die Reformierte Kirche in Ungarn unterstützt mit "Kalunba" die Integration anerkannter Flüchtlinge in die Gesellschaft.
Ein Großteil der Projekte werde aus EU-Mitteln des sogenannten Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gefördert, hieß es. Eine Neuausschreibung war von der ungarischen Regierung zurückgezogen worden. Rund 1,1 Millionen Euro fehlten seitdem allein für "Kalunba". Es seien verschiedene Sprach- und Schulungsprojekte gefährdet. Bis Ende Juni habe die Organisation überdies eine Unterkunft für 200 Flüchtlinge finanziert. Sie wolle die Aufgaben soweit wie möglich mit reduziertem Personal weiterführen.
Der Reformierte Bund versteht sich als konfessioneller Dachverband. Ihm gehören als Hauptträger die Evangelisch-reformierte Kirche sowie die Lippische Landeskirche an. Zudem sind auch unierte Kirchen sowie reformierte Gemeinden, Zusammenschlüsse und Einzelpersonen Mitglieder. Der Reformierte Bund mit Sitz in Hannover vertritt rund 1,5 Millionen reformierte Christen in Deutschland.
Westfälische Kirche will kritischen Dialog mit Islam
Bielefeld (epd). Die Evangelische Kirche von Westfalen hat sich für einen kritischen Dialog mit muslimischen Organisationen ausgesprochen. Der Dialog solle als kritisches Gespräch auch kontroverse Themen und Missstände ansprechen, erklärte die Evangelische Kirche von Westfalen am 18. Juli in Bielefeld. Die westfälische Kirche suche den Kontakt und das Gespräch mit unterschiedlichen muslimischen Institutionen und Organisationen, ohne eine von ihnen zu bevorzugen, betonte der Islambeauftragte der westfälischen Kirche, Ralf Lange-Sonntag.
Begegnungen seien sowohl mit der der türkischen Regierung nahe stehenden Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (Ditib) erwünscht als auch mit der Gülen-Bewegung, hieß es weiter. Die Ditib habe einerseits den Anspruch, in Deutschland als Religionsgemeinschaft anerkannt zu werden. Andererseits sei sie abhängig vom türkischen Staat. Das sei ein Widerspruch, erklärte der Islambeauftragte. Die westfälische Kirche würdigte zugleich die Integrationsleistung und den jahrelangen Beitrag zum interreligiösen Dialog vieler Ditib-Moscheevereine.
Den westfälischen Kirchengemeinden rät Lange-Sonntag als Beauftragter für den interreligiösen Dialog, den Kontakt zu den Ditib-Moscheegemeinden nicht abreißen zu lassen. Deutsch-türkische Muslime sollten nicht vorschnell mit der Politik der türkischen Regierung gleichgesetzt werden. Probleme müssten jedoch in kritischen Gesprächen klar benannt werden. Dazu gehöre auch, auf die Diskriminierung von Christen und christlichen Kirchen in der Türkei hinzuweisen.
Die Ditib ist mit 900 Moscheegemeinden der größte muslimische Dachverband in Deutschland. Sie ist eng verbunden mit der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet. Einigen Imamen in Ditib-Gemeinden wurde Spitzeltätigkeit für den türkischen Staat vorgeworfen. Die Gülen-Bewegung wird in der Türkei verfolgt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die Gülen-Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich.
Bernhard Vogel: Priesterweihe von verheirateten Männern erreichbar

epd-bild/Thomas Lohnes
Speyer (epd). Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel (CDU), rechnet mit innerkirchlichen Reformen in der katholischen Kirche unter Papst Franziskus. Die seit langem geforderte Weihe von "viri probati", von in Glauben und Lebensführung bewährten Männern zu Priestern, "scheint mir erreichbar", sagte der ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (1972-1976) dem Evangelischen Pressdienst (epd) in Speyer. Auch die Weihe von Frauen zu Diakoninnen wird laut Vogel "früher oder später" möglich werden.
Es ermutige ihn, dass Papst Franziskus mehr Eigenständigkeit der regionalen Bischofskonferenzen fordere, erklärte der frühere CDU-Politiker. "Ich hoffe, dass auch die deutschen Bischöfe sich dazu durchringen."
Das Zölibat stelle er mit der Priesterweihe für "viri probati" ("bewährte Männer") nicht infrage, betonte Vogel. "Aber es sollte in Zukunft auch verheiratete Priester geben." Papst Franziskus hatte 2017 in einem "Zeit"-Interview gesagt, über die Öffnung des Priesteramtes für sogenannte "viri probati" müsse man angesichts des Priestermangels nachdenken.
Dass die innerkirchlichen Reformen bis zur Öffnung der kirchlichen Ehe für homosexuelle Paare reichen, glaubt der 85-Jährige allerdings nicht. "An der Ehe als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau wird die katholische Kirche dagegen festhalten", sagte er. Die Aussagen des Neuen Testaments seien eindeutig.
Über die Kompromisslösung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz im Streit über die Öffnung der Eucharistie für evangelische Ehepartner äußerte sich Vogel enttäuscht. Er bedauere, dass sich die Bischöfe nicht auf eine gemeinsame Aussage einigen konnten. "Der jetzt gefundene Kompromiss ist - wie häufig bei Kompromissen - nur die zweitbeste Lösung."
Vor 50 Jahren veröffentlichte der Vatikan die «Pillen-Enzyklika»

epd-bild / Nicola O`Sullivan
Rom (epd). Wohl kein anderes päpstliches Lehrschreiben hat bei Gläubigen so großes Unverständnis ausgelöst wie die sogenannte Pillen-Enzyklika "Humanae vitae". Papst Paul VI. verbot Verhütungsmittel wie die Antibabypille, zugleich verlangte er von römisch-katholischen Christen "Selbstzucht", "Askese" und die "Beherrschung ihres Trieblebens". 50 Jahre nach Veröffentlichung der Enzyklika am 25. Juli 1968 könnte das Thema Verhütung und der Umgang der katholischen Kirche mit modernen Familien zeigen, wie ernst es Papst Franziskus mit der ins Zentrum seines Pontifikats gestellten Barmherzigkeit wirklich meint.
Körperliche Liebe sei nur dann wahr, wenn sie der Zeugung menschlichen Lebens dient, unterstrich der 1978 verstorbene Papst Paul VI. - einzig die Beschränkung sexueller Handlungen auf die natürlichen Zyklen der "empfängisfreien Zeiten" sei dann gerechtfertigt, wenn schwerwiegende Gründe dafür sprechen, "Abstände in der Reihenfolge der Geburten" einzuhalten.
Ohne ein Verbot von Verhütungsmitteln tendierten Ehepartner nach Ansicht von Paul VI. zur Untreue. Auch Forderungen nach einer Eindämmung der "Bevölkerungsexplosion" in Entwicklungsländern durch Geburtenkontrolle erteilte Papst Paul VI. eine klare Absage. Andernfalls drohe ein gefährlicher Sittenverfall.
Das heutige Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, änderte den bisherigen Kurs seiner Kirche zum Thema Geburtenplanung bislang nicht. Allerdings ließ eine Äußerung auf dem Rückflug seiner Reise auf die Philippinen im Januar 2015 viele aufhorchen: Katholiken sollten sich nicht "wie Karnickel" vermehren, sagte er. Im gleichen Atemzug würdigte er jedoch die umstrittene Enzyklika seines Vorgängers als "prophetisch", da sie sich einer zwangsweisen Geburtenkontrolle entgegenstemme. Im Oktober will Papst Franziskus seinen Vorgänger Papst Paul VI. heiligsprechen.
Entstehung von "Humanae vitae" wird rekonstruiert
Mittlerweile arbeitet eine Kommission im Auftrag des Papstes daran, in den Archiven der Glaubenskongregation die Entstehung von "Humanae vitae" zu rekonstruieren. Paul VI. hatte sie damals entgegen der Empfehlungen einer Expertenkommission und einer Mehrheit von Bischöfen veröffentlicht, die er zuvor beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) zum Thema Verhütungsmittel hatte befragen lassen.
Das Arbeitspapier der Bischofssynode zu Fragen von Ehe und Familie von 2014 betonte noch uneingeschränkt die Gültigkeit des Verbots von Verhütungsmitteln. Mit Blick auf die Nutzung von Präservativen zur Vorbeugung gegen Aids beklagen die Urheber darin "karikierende Medienberichte". Dagegen gelte es, "die Position der Kirche besser zu erklären".
Auch das Arbeitspapier für die in diesem Herbst geplante Jugendsynode beharrt auf der geltenden Sexualmoral. Diese müsse nur besser verständlich gemacht werden, heißt es.
Unter Benedikt XVI. waren vorsichtige Versuche unternommen worden, die Ächtung von Kondomen bei verheirateten Paaren zu lockern, um so zumindest die Ansteckung durch einen HIV-positiven Ehegatten zu verhindern. Ein entsprechender Bericht einer Vatikankommission wurde allerdings nie veröffentlicht. Im Interviewbuch "Licht der Welt" mit dem Journalisten Peter Seewald von 2010 fasste Benedikt seine Haltung zum Pillenverbot unmissverständlich zusammen: "Die Perspektiven von 'Humanae vitae' bleiben richtig."
Nicht nur ein Großteil der deutschen Jugendlichen, die an der für Herbst im Vatikan geplanten Bischofssynode über Jugend und Kirche teilnehmen werden, dürften das anders sehen. Einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Tradition und Moderne bei der Familienplanung scheint Franziskus in einer neuen Wertung der Inhalte von "Humanae vitae" zu suchen. In seiner Enzyklika "Amoris laetitia" fordert er, die Botschaft des Schreibens seines Vorgängers wiederzuentdecken, der zufolge "bei der moralischen Bewertung der Methoden der Geburtenregelung die Würde der Person respektiert werden muss".
Eine vollständige Aufhebung des Verbots von Verhütungsmitteln würde Öl ins Feuer der konservativen Papstgegner gießen, deren Vorwürfe bis hin zur Häresie reichen. So dürfte Franziskus sich wie bei der Frage der Zulassung nichtkatholischer Ehepartner zur Kommunion vorsichtig über Entscheidungen im Einzelfall vorantasten.
Papst taucht überraschend bei Hochzeit auf und traut junges Paar
Rom (epd). Papst Franziskus hat zur Überraschung der Hochzeitsgäste in einer frühchristlichen Kirche im Vatikan ein junges Paar getraut. Das Kirchenoberhaupt sei ohne Absprache mit dem vorgesehenen Priester an dessen Stelle getreten und habe die Ehe zwischen einem jungen Schweizergardisten und einer Brasilianerin, die in den Vatikanischen Museen arbeitet, geschlossen, berichtete der Nachrichtendienst Vaticannews am 16. Juli. Einzig das Paar war demnach eingeweiht, bewahrte jedoch gegenüber dem Priester und den Gästen Stillschweigen.
Die kirchliche Trauung fand in der Kirche des heiligen Stefan von Abessinien statt, einer frühmittelalterlichen Kirche hinter der Apsis des Petersdoms, wenige Meter vom Gästehaus Santa Marta entfernt, in dem der Papst wohnt.
Päpste nehmen selten Trauungen vor. Franziskus hatte auf dem Rückflug von seiner Chilereise im vergangenen Januar in 10.000 Metern Höhe spontan eine Ehe zwischen zwei Flugbegleitern geschlossen. Sie hatten ihm von ihren Heiratsplänen erzählt, die sie nach längerem Zusammenleben geschmiedet hatten. Zuvor hatte Franziskus 2014 im Petersdom mehrere römische Paare getraut.
Würzburger Bistums-Finanzdirektor zurückgetreten
Würzburg (epd). Der Finanzdirektor des Bistums Würzburg, Albrecht Siedler, hat am 20. Juli seinen sofortigen Rücktritt von allen Ämtern erklärt. Bischof Franz Jung habe die Amtsniederlegung angenommen, teilte das Bistum mit. Siedler wolle mit diesem Schritt Schaden vom Amt des Finanzdirektors abwenden, hieß es. Zuvor war bekanntgeworden, das ein Strafbefehl wegen "Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt" gegen Siedler vorliegt. Der Strafbefehl sei im Zusammenhang mit nicht abgeführten Beiträgen an die Sozialversicherung ergangen. Zuerst hatte die Würzburger "Main-Post" (20. Juli) über den Strafbefehl berichtet.
Erst vor kurzem waren mögliche Unregelmäßigkeiten bei einer bistumseigenen Immobilienfirma bekanntgeworden. Die Würzburger Staatsanwaltschaft ermittelt, nachdem sie vom Bistum eingeschaltet wurde. Noch ist nicht klar, ob die Vorgänge bei der SBW-Bauträger- und Verwaltungs-GmbH strafrechtlich relevant sind.
Die SBW ist eine Schwesterfirma des St. Bruno Werks, dem Wohnungsunternehmen der Diözese. In diesem Zusammenhang waren SBW-Geschäftsführer Otmar Finger, zugleich Leiter der Liegenschaftsabteilung des Ordinariats, sowie der komplette Aufsichtsrat, dem Siedler vorsaß, abgesetzt worden.
Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Pastor
Hannover, Hildesheim (epd). Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat Anklage gegen einen evangelischen Pastor wegen "gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung" erhoben. Der 58-Jährige soll beim Kirchenamt Hildesheim fingierte Quittungen oder Rechnungen über angebliche Anschaffungen oder Dienstleistungen für die Gemeinde eingereicht haben, mit der Behauptung, diese seien von ihm bereits ausgeglichen worden, sagte Oberstaatsanwaltschaft Christian Gottfriedsen am 18. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd). Tatsächlich habe es diese Käufe aber nicht gegeben. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 52.000 Euro.
Der zuletzt in der Region Hannover tätige Theologe ist bereits seit dem vergangenen Jahr von der hannoverschen Landeskirche vom Dienst suspendiert worden. Das landeskirchliche Rechnungsprüfungsamt habe die Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Beschuldigte habe in einer ersten Stellungnahme rund 20 Taten eingeräumt mit der Begründung, die Gelder für ärztliche Behandlungskosten benötigt zu haben.
Derzeit prüfe das Landgericht Hildesheim, ob es zu einem Verfahren komme, hieß es. Die Anklage der Staatsanwaltschaft sieht ein Strafmaß zwischen einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Die Landeskirche habe ihr laufendes Disziplinarverfahren gegen den Theologen ausgesetzt, solange ein mögliches Verfahren andauere, hieß es. Werde der Mann zu einer Strafe von mehr als einem Jahr verurteilt, werde er aus dem Dienst entfernt. Bei einem geringeren Strafmaß nehme die Landeskirche das Disziplinarverfahren wieder auf.
Umstrittene Glocke aus NS-Zeit bleibt hängen
Speyer (epd). Die mit einer umstrittenen Inschrift aus der Zeit des Nationalsozialismus versehene Glocke im Turm der protestantischen Friedenskirche im saarländischen Homburg bleibt hängen. Der Vorstand der Friedenskirchengemeinde Homburg-Beeden habe diesen Beschluss nach eingehenden Beratungen einstimmig gefasst, teilte die Gemeinde am 18. Juli mit. Die Glocke ist den Angaben zufolge mit dem Zusatz "Gegossen im Jahr der Saarbefreiung 1935" versehen. Eine Namenswidmung oder ein nationalsozialistisches Symbol befinde sich nicht auf der Glocke.
Die drei 1935 gegossenen Glocken der Friedenskirche tragen laut Gemeinde die Aufschrift "Friede", "Freude" und "Freiheit". Dies bringe die Hoffnung der damaligen saarländischen Bevölkerung zum Ausdruck, die mit dem Ergebnis der Volksabstimmung verbunden war und von der Bevölkerung als Befreiung empfunden worden sei, hieß es. 90,5 Prozent hatten sich damals für die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich ausgesprochen, 0,4 Prozent für die Zugehörigkeit zu Frankreich und 8,9 Prozent für den Status Quo als Mandatsgebiet des Völkerbundes. Die Glocken mit der Aufschrift "Friede" und "Freude" tragen keinen weiteren Zusatz in der Beschriftung.
In etwa zwei Dutzend deutschen Kirchen hängen nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" vom April noch heute Glocken mit Bezug zum Nationalsozialismus. Vor allem eine Glocke im Turm der protestantischen Kirche in Herxheim am Berg im rheinland-pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim hat die heftigen Diskussionen um Glocken aus der Zeit des Nationalsozialismus ausgelöst.
Die 1934 gegossene Glocke in Herxheim ist mit einem Hakenkreuz und der Aufschrift "Alles fuer's Vaterland - Adolf Hitler" versehen. Presbyterium und Ortsgemeinderat haben sich für einen Verbleib der Glocke im Turm ausgesprochen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, kritisierte diese Entscheidung scharf. Sie zeuge von einer tiefen Respektlosigkeit gegenüber allen Opfern des Nationalsozialismus.
Superintendent Hermes: Christen müssen Stimme erheben
Dickenschied (epd). Christen müssen nach den Worten des Superintendenten des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Hans-Joachim Hermes, wachsam sein und ihre Stimme erheben. Dies sei ein Vermächtnis von Pfarrer Paul Schneider, betonte er bei der Gedenkfeier in Dickenschied zum 79. Jahrestag der Ermordung des "Predigers von Buchenwald". Rund 60 Menschen kamen den Angaben zufolge zu der Gedenkfeier auf den Friedhof von Dickenschied, darunter auch die drei noch lebenden Kinder von Paul Schneider.
Gedenkfeier für Paul Schneider in Dickenschied
Der evangelische Pfarrer Paul Schneider (1897-1939) wurde am 18. Juli 1939 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Buchenwald als eines der ersten Mitglieder der Bekennenden Kirche ermordet. Der Pfarrerssohn stammte aus Pferdsfeld bei Bad Kreuznach. Wegen seiner konsequenten Ablehnung der Nazi-Diktatur wurde er mehrmals festgenommen und kam 1937 in das KZ Buchenwald bei Weimar. Mitgefangenen hatte er aus der Zelle heraus als "Prediger von Buchenwald" das Evangelium verkündet. Nach Folter und Misshandlung tötete ihn der Lagerarzt Erwin Ding mit einer Überdosis des Herzmittels Strophanthin.
Schneider sei ein Prediger des einen Gottes gewesen, eines Gottes, dem man im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen habe, betonte Superintendent Hermes. "Darum wandte sich Pfarrer Schneider gegen andere Heilsbringer, andere Fundamente und Wahrheiten."
"Wir leben heute in einer anderen Zeit", erklärte Hermes. Doch die Botschaft des Evangeliums sei geblieben. "Und darum gilt es auch heute wachsam zu sein gegenüber den anderen Mächten, die Ansprüche an unser Leben stellen, die sich anmaßen, Richtmaß zu sein für unser Handeln im privaten wie im politischen Bereich", unterstrich der Theologe. Freiheit werde nicht mit Mauern, Zöllen, Abschottung und Ausgrenzung erkauft.
Gott habe den Menschen mit Wert sowie Würde beschenkt und darauf dürfe man Stolz sein. "Wenn daraus aber ein 'ich zuerst' oder 'wir zuerst' wird, dann ist das ein Missbrauch der uns unverdient zugekommenen Gnade Gottes", warnte der Superintendent. Die Gnade Gottes gelte allen Menschen. Zudem dürfe nicht hingenommen werden, wenn der Begriff von der christlich-abendländischen Kultur zum Abschotten und zur Sicherung des eigenen Lebensstils missbraucht werde.
Gottesdienst von Bibelgesellschaft mit Präses Kurschus
Lemgo (epd). Die Lippische Bibelgesellschaft veranstaltet am 6. Oktober in Lemgo einen Gottesdienst mit der westfälischen Präses Annette Kurschus und dem lippischen Landessuperintendenten Dietmar Arends. Die Predigt hält Präses Kurschus, die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deutschen Bibelgesellschaft ist, wie die Lippische Bibelgesellschaft in Detmold mitteilte. Die Liturgie hält der Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche, Dietmar Arends, gemeinsam mit anderen Mitgliedern des Vorstandes. Der Gottesdienst in der Kirche St. Nicolai steht unter dem Motto "Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen".
Gesellschaft
Zehntausende Teilnehmer bei #ausgehetzt-Demo in München

epd-bild/Theo Klein
München (epd). Gegen eine "Politik der Angst" sind am 22. Juli bei der Demonstration #ausgehetzt in München nach Veranstalterangaben insgesamt rund 50.000 Menschen auf die Straße gegangen, die Polizei sprach von 20.000 Demonstranten. Zu den rund 130 Unterstützern von #ausgehetzt gehören neben Organisationen wie Pro Asyl, ver.di, Attac und zahlreichen Flüchtlingshelferkreisen auch das Münchner Volkstheater und die Münchner Kammerspiele.
Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte bei der Abschlusskundgebung, der soziale Frieden in München, Bayern und Deutschland sei durch Verrohung der Sprache, Scheindiskussionen und eine völlig falsche Prioritätensetzung "hochgradig gefährdet".
Zu einer Plakataktion der CSU, die sich gegen die Demonstration richtete, sagte Reiter: "Es ist sinnvoller, im täglichen politischen Sprechen und Tun den politischen Anstand zu wahren, anstatt ihn nur zu plakatieren." In der Nacht zum 22. Juli hatte die Partei Plakate mit der Aufschrift "JA zum politischen Anstand, NEIN zu ausgehetzt, Bayern lässt sich nicht verhetzen!" entlang der Route der Demonstration aufhängen lassen.
Thomas Lechner von der Initiative "Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie" sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), es könne "nicht sein, dass verantwortliche Politiker den rassistischen Diskurs nur zum eigenen Machterhalt bedienen". Immer mehr Parteien ließen sich ihre Agenda "von AfD und Co" vorgeben. Dabei sei es die Aufgabe von Politikern, "die Gesellschaft zu heilen und zusammenzuführen, nicht zu spalten", so Lechner.
Das Bündnis von #ausgehetzt forderte in seinem Aufruf zur Demonstration wahlkämpfende Politiker und insbesondere die bayerische Regierung auf, die Gesellschaft nicht weiter "durch eine eskalierende und verrohende Sprache" zu verunsichern. Eine Politik der Angst komme allein Rechtspopulisten zu Gute und löse mit ihren Scheindebatten keinerlei Probleme. Der Münchner CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl hatte "dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen" gegen Kammerspiel-Intendant Matthias Lilienthal gefordert, weil dieser durch seinen Aufruf zur Demo die "parteipolitische Neutralitätspflicht" des Theaters verletze.
Merkel erneuert Plädoyer für internationale Lösungen
Vor ihrem Sommerurlaub stellte sich Angela Merkel der Hauptstadtpresse. Die erlebte vor dem Hintergrund vieler internationaler Krisen eine nachdenkliche Kanzlerin. Man könne jetzt zeigen, dass man aus der Geschichte gelernt hat, sagte Merkel.Berlin (epd). Es ist der 20. Juli, der Jahrestag des gescheiterten Hitler-Attentats 1944: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tritt an diesem Tag vor ihrem Sommerurlaub vor die Hauptstadtpresse. Vor den versammelten Journalisten stellt sie eine grundsätzliche Frage: "Haben wir aus der Geschichte gelernt?" 74 Jahre nach dem Attentat, das den Zweiten Weltkrieg beenden sollte, wird um eine lange als sicher geglaubte Weltordnung gerungen. Das Verhältnis zwischen den USA und Europa verschlechtert sich, die EU steht zwischen Abschottung und Humanität gegenüber Flüchtlingen und auch in Deutschland scheint die Asylpolitik zu spalten.
Es sei eine Phase, sagte Merkel, in der viele Zeitzeugen nicht mehr lebten und die Nachfolgegeneration vor der Verantwortung stehe, wichtige Entscheidungen zu treffen: Beschließe man Alleingänge "aus Verzweiflung darüber", dass alles so langsam oder anders als gewünscht verlaufe, oder "fühlen wir uns, auch wenn es für uns schwierig ist, Europa verpflichtet"? Merkel gibt die Antwort dann teilweise selbst: "Wir können jetzt zeigen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben."
Ritt durch viele Themen
Die eineinhalbstündige Fragerunde ist ein Ritt durch viele Themen des Regierungshandelns: Pflege, Klima, die Konsequenzen aus dem rechten Terror des NSU. Am häufigsten wird Merkel zu ihrem Verhältnis zu den USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump, zu ihrer Haltung in der Flüchtlingspolitik und zum erst kürzlich beigelegten Streit mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gefragt. Merkels Antworten haben oft einen Kern: ein Plädoyer für die Zusammenarbeit Europas und der internationalen Gemeinschaft.
So plädiert sie auch für eine gesamteuropäische Lösung in der Frage der Seenotrettung im Mittelmeer. Am 20. Juli wurde bekannt, dass Italien nach der Blockade ziviler Rettungsorganisationen offenbar auch keine Flüchtlinge mehr aufnehmen will, die von Schiffen der EU-Marinemission "Sophia" gerettet werden.
Italien habe in den EU-Gremien eine Diskussion darüber angestoßen, wie Solidarität Europas auch bei diesem Thema durchgesetzt werden könne, sagte Merkel. Das Land wolle nicht allein zuständig für alle ankommenden Geretteten sein. Es gehe also um eine Gesamtlösung, die es europäisch geben müsse. Merkel betonte zugleich, sie schätze die Arbeit ziviler Seenotretter. Gleichzeitig sei es wichtig, "dass Nichtregierungsorganisationen, die sich an Rettungen beteiligen, die Territorialgewässer Libyens respektieren". Wegen dieser Frage sehen private Retter in Malta derzeit Gerichtsverfahren entgegen.
Wie schwierig europäische Antworten in der Migrations- und Asylpolitik sind, zeigte aber nicht zuletzt auch der in Deutschland ausgelöste Streit um den Umgang mit Flüchtlingen, die in ein anderes als für sie zuständiges EU-Land weiterziehen. Zurückweisung an der Grenze - so sollte die Antwort der CSU und ihres Innenministers Seehofer aussehen. Merkel widersprach und machte noch einmal deutlich, dass das für sie eine Frage ist, die ihre Richtlinienkompetenz als Kanzlerin tangiere. Minister könne nur jemand sein, "der diese Richtlinienkompetenz auch akzeptiert", sagt sie.
Merkel: Sprache kann zu Spaltung beitragen
Merkel betont, der Streit in der Union sei "grundsätzlich" gewesen. Die Tonlage der Debatte, bei der auch von "Asyltourismus" die Rede war, kritisiert sie: "Die Tonalität war oft sehr schroff." Sprache könne zur Spaltung beitragen: "Ich glaube, dass es zwischen Denken, Sprechen und Handeln einen ziemlich engen Zusammenhang gibt."
Die Kanzlerin hat jetzt erst einmal Urlaub. "Die Zeiten sind fordernd", sagt Merkel. Sie könne nicht verhehlen, sich darüber zu freuen, jetzt etwas länger schlafen zu können. Ein müdes Lächeln erhält von ihr die Frage, wen sie lieber in den Urlaub mitnehmen wolle - US-Präsident Donald Trump, Seehofer oder den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Frage stelle sich nicht, sagt sie: "Urlaub ist Urlaub."
Maghreb-Staaten und Georgien sollen als sicher eingestuft werden
Die Bundesregierung will die Maghreb-Staaten und Georgien als sicher einstufen und damit ein abschreckendes Signal an potenzielle Asylbewerber senden. Aus Tunesien, Marokko und Algerien kommen aber schon jetzt nicht mehr viele Menschen.Berlin (epd). Die Bundesregierung startet einen neuen Anlauf, die Maghreb-Staaten auf die Liste sicherer Herkunftsländer zu setzen. Das Kabinett beschloss am 18. Juli in Berlin einen Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), mit dem Tunesien, Marokko und Algerien sowie die Kaukasusrepublik Georgien als sicher bewertet werden sollen. Bundestag und Bundesrat müssen noch zustimmen. Im vergangenen Jahr scheiterte die Einstufung der Maghreb-Staaten am Widerstand der Länder. Auch heute ist die Zustimmung des Bundesrats unsicher. Seehofer sagte, er rechne mit einer Entscheidung im Herbst. Bis dahin will er eine weitere Regelung vorlegen, die noch mehr Länder als sicher einstuft.
Länder haben in Asylstatistik geringe Bedeutung
Bei Staaten, die als sicher eingestuft sind, wird in der Regel angenommen, dass Asylantragsteller dort keiner politischen Verfolgung ausgesetzt sind. Die Einstufung soll ein schnelleres Asylverfahren ermöglichen. Zudem soll eine abschreckende Wirkung davon ausgehen. Durch die "Signalwirkung" werde mit einem Rückgang der Zahl der Asylbewerber aus diesen Ländern gerechnet, hieß es aus dem Innenministerium. Asylbewerber und Geduldete aus diesen Staaten, die spätestens am Tag des Kabinettsbeschlusses eine Ausbildung begonnen oder sicher hatten oder einer Beschäftigung nachgingen, sollen dies dem Entwurf zufolge auch fortsetzen können.
Im Vergleich zu Syrien, Irak oder Afghanistan, woher die meisten Asylbewerber in Deutschland stammen, spielen die vier Länder in der Asylstatistik eine untergeordnete Rolle. Nur Georgien stand im ersten Halbjahr 2018 auf der Liste der zehn Hauptherkunftsländern von Asylsuchenden. 2.260 Asylsuchende aus diesem Land wurden registriert. Aus den Maghreb-Staaten kamen insgesamt rund 1.750 Menschen. In diesem Jahr wären also rund 4.000 Menschen unter die Regelung gefallen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum stellten mehr als 22.000 Syrer einen Asylantrag.
Seehofer: Nur ein erster Schritt
Seehofer zufolge ist die Einstufung der Maghreb-Staaten und Georgien nur ein erster Schritt. Er kündigte an, bis zum Herbst einen weiteren Gesetzentwurf vorzulegen, um alle Länder mit einer Anerkennungsquote von unter fünf Prozent als sicher einzustufen. Dies ist im Koalitionsvertrag vereinbart. Wie viele und welche Länder dies sein werden, konnte Seehofer nicht sagen. Es seien sorgfältige Prüfungen auch durch das Auswärtige Amt erforderlich, erklärte er. Man könne sich nicht allein auf die Asylstatistik stützen.
Diese Statistik ergab für die vier aktuell in Rede stehenden Länder jeweils eine sogenannte Gesamtschutzquote von unter fünf Prozent. Die höchste Quote hatte Marokko mit 4,6 Prozent, so viele Asylanträge wurden also positiv beschieden. Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke verwies allerdings auf die bereinigte Schutzquote, bei der Ablehnungen aus formellen Gründen wie etwa bei den sogenannten Dublin-Fällen herausgerechnet sind. Dann liege die Schutzquote bei allen Maghreb-Staaten bei mehr als fünf Prozent, bei Marokko sogar bei mehr als zehn Prozent, teilte Jelpke mit. In den Maghreb-Staaten seien die Rechte von Minderheiten und politischen Gegnern nicht gewährleistet, sagte sie.
Zustimmung im Bundesrat fraglich
Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck erklärte, Journalisten, Minderheiten und Homosexuelle seien dort nicht sicher vor Verfolgung und Haft. Er warnte davor, in der Regelung eine Hilfe für konsequentere Abschiebungen zu sehen. Dafür brauche man funktionierende Rückführungsabkommen, sagte er. Zustimmung zu Seehofers Plänen kam dagegen von der FDP. Die Regelung sei ein "überfälliger Schritt", sagte die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg (FDP).
Am Widerstand der von den Grünen mitregierten Länder war die Einstufung der Maghreb-Staaten im März 2017 im Bundesrat gescheitert. Gemeinsam mit dem von Linken mitregierten Brandenburg haben die Skeptiker der Regelung immer noch eine Mehrheit von 41 der 69 Stimmen im Bundesrat. Allein die Zustimmung des grün-schwarz regierten Baden-Württembergs, wo die Einstufung der Maghreb-Staaten im dortigen Koalitionsvertrag vereinbart wurde, würde damit nicht für ein Passieren des Gesetzes reichen.
Seehofer bereut Aussage über Afghanistan-Abschiebung nicht
Berlin (epd). Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat seine umstrittene Aussage über die Abschiebung von 69 Afghanen am Tag seines 69. Geburtstags gerechtfertigt. Er habe auf eine Frage nach Abschiebungen differenziert geantwortet, sagte Seehofer am 18. Juli in Berlin. Aus der Antwort seien zwei Sätze herausgefiltert worden. Er habe an keiner Stelle von einem Geburtstagsgeschenk gesprochen. Auf die Frage bei der Pressekonferenz, ob er die Äußerung bereue, antwortete Seehofer am 18. Juli knapp: "Nein."
Bei der Vorstellung seines "Masterplans Migration" am 10. Juli hatte Seehofer vor Journalisten gesagt: "Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69 - das war von mir nicht so bestellt - Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden." Seehofer war davor auf Schwierigkeiten bei Abschiebungen angesprochen worden. Er wollte mit dem Zahlenbeispiel auf Fortschritte aufmerksam machen. Bei vergleichbaren Sammelabschiebungen zuvor waren wesentlich weniger Menschen an Bord des Flugzeuges. Seehofer ergänzte nach dem umstrittenen Satz, dies liege "weit über dem, was bisher üblich ist".
Gemeinsam mit einem augenscheinlich amüsiert wirkenden Gesichtsausdruck des Ministers sorgte die Äußerung für Empörung. In sozialen Netzwerken wurde ein Videoausschnitt mit der umstrittenen Aussage vielfach geteilt und mit der Einschätzung versehen, Seehofer betrachte die Abschiebung als eine Art Geburtstagsgeschenk.
Habeck: Würde des Menschen scheint nicht mehr unantastbar

epd-bild/Norbert Neetz
Frankfurt a.M. (epd). Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fürchtet eine politische Verrohung und die Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien in Deutschland. Derzeit verrohe bereits die Sprache. Und wenn von "Asyltourismus" und "Anti-Abschiebe-Industrie" die Rede sei, "kann das schnell in eine politische Verrohung münden", warnte Habeck. "Die Würde des Menschen scheint eben nicht mehr unantastbar", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Frankfurt am Main.
Als Beispiel für eine Erosion des Rechtsstaates nannte Habeck die Abschiebung von Sami A. "Nun habe ich wirklich keine Sympathien für den mutmaßlichen Leibwächter von Osama bin Laden. Aber ich halte es für extrem fragwürdig, wenn offensichtlich eine Abschiebung vollstreckt wurde, obwohl klar war, dass das Verwaltungsgericht noch über die Rechtmäßigkeit entscheidet", sagte er. In einem Rechtsstaat gebe es geordnete Verfahren. "Es muss geklärt werden, ob die hier gebrochen wurden, um ein Exempel zu statuieren", sagte der Grünen-Chef.
Er könne sich nur schwer vorstellen, "dass so eine Entscheidung ohne Billigung des Innenministers getroffen wird". Horst Seehofer (CSU) wiederum habe aus seinem politischen Willen keinen Hehl gemacht. "Wenn wir anfangen, mit dem Rechtsstaat zu spielen, bricht das ohnehin dünne Eis", warnte Habeck.
Derzeit verändere sich das Parteiensystem im Land. "Es kann passieren, dass die Union zerbricht. Kleine Parteien können groß werden", sagte Habeck. Der Ausgang sei ungewiss. Jetzt gehe es darum, "die Prinzipien der Republik durch diese Phase der Neujustierung zu bringen". "Wir müssen dem Ansturm des Populismus auf das Grundgesetz etwas entgegensetzen", forderte der Grünen-Vorsitzende.
Inzwischen sei die politische Mitte in Deutschland ein leerer Ort. "Wir als Grüne reißen uns nicht darum, aber wenn wir da eine Aufgabe haben und Liberalität und Rechtsstaatlichkeit verteidigen können, dann kümmern wir uns drum", sagte Habeck.
NRW-Minister Stamp verteidigt Abschiebung von Sami A.
In einer eilig einberaumten Sitzung hat sich Integrationsminister Stamp (FDP) gerechtfertigt: Die Behörden hätten sich in der Abschiebung von Sami A. ans Recht gehalten. SPD und Grüne zeigten sich enttäuscht und forderten die Aufklärung des Falls.Düsseldorf (epd). Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat die Abschiebung des als Gefährders eingestuften Tunesiers Sami A. verteidigt. "Der Rückführung standen keine Abschiebeverbote entgegen", sagte Stamp am 20. Juli im Düsseldorfer Landtag in einer kurzfristig zum Thema einberufenen, gemeinsamen Sondersitzung des Rechts- und des Integrationsausschusses. Sami A. sei nachvollziehbar ausreisepflichtig gewesen. Grüne und SPD kritisierten Stamp scharf und zweifelten die Rechtmäßigkeit der Abschiebung an.
Der als Gefährder geltende Sami A., der Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein soll und seit Jahren in Bochum gelebt hatte, war nach Tunesien abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte allerdings kurz zuvor geurteilt, dass er wegen möglicher Foltergefahr nicht in das nordafrikanische Land abgeschoben werden dürfe. Dieser Beschluss wurde jedoch erst übermittelt, als das Flugzeug mit A. bereits unterwegs war. Das Gericht fordert nun, dass A. nach Deutschland zurückgeholt wird. NRW will den Rückholbeschluss nicht akzeptieren.
Gericht entscheidet über Rückholung
Stamp räumte in der Anhörung ein, dass die Umstände der Abschiebung "an der Stelle sehr unglücklich gelaufen" seien. "Wir haben uns an Recht und Gesetz gehalten", betonte er. Die Vorbereitung einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts sei der Landesregierung nicht bekannt gewesen. Man habe in der Sache nur mit Stellen wie der Bundespolizei gesprochen, die zwingend rechtlich informiert werden müssten. Das Gericht gehöre nicht dazu.
Nach dem Land vorliegenden Erkenntnissen drohe A. in Tunesien keine Folter. Auch habe die tunesische Regierung ein "ureigenes Interesse", die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Europa zu demonstrieren, erklärte er. Ob Sami A. nun aus Tunesien zurückgeholt werden muss, prüft nun das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster.
SPD und Grüne pochen weiter auf Aufklärung
Die Opposition von SPD und Grünen warf Stamp vor, das Land in eine Vertrauenskrise geführt zu haben. "Er hat die Grundsätze der Gewaltenteilung bewusst missachtet, um seinen politischen Willen durchzusetzen", kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Sven Wolf. Der rechtspolitische Sprecher der Grünen, Stefan Engstfeld, zeigte sich enttäuscht von der Sitzung. "Viele Fragen sind ignoriert, unbeantwortet oder weggeschwafelt worden", erklärte er. Von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) forderte Engstfeld eine klare Positionierung zu Stamps und Ministerpräsident Armin Laschets (CDU) Äußerungen. Beide hatten die Abschiebung als rechtmäßig bezeichnet. Biesenbach widersprach den Vorwürfen und warf der Opposition vor, zu versuchen, den Vorfall "politisch zu instrumentalisieren".
Die Initiative für die Sitzung zu dem Thema war ursprünglich von den Fraktionen der SPD und Grünen ausgegangen. Sie hatten zunächst eine Sitzung des Rechtsausschusses beantragt. Die Fraktionen von CDU und FDP hatten daraufhin auf eine gemeinsame Sitzung der beiden Ausschüsse gedrungen, weil auch das Integrationsministerium in dem Fall betroffen ist.
Flüchtlingsbürgen: NRW drängt auf bundeseinheitliche Lösung
Düsseldorf (epd). Im Streit um die Zahlungsaufforderungen an Flüchtlingsbürgen drängt das NRW-Integrationsministerium weiter auf eine bundeseinheitliche Lösung. Derzeit werde bundesweit ermittelt, wie viele Fälle es gebe und wie hoch die zurückgeforderten Beträge seien, sagte die Sprecherin des Ministeriums, Wibke Op den Akker, am 20. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd). Jobcenter und Sozialämter verschicken nach Angaben von Initiativen seit vergangenem Jahr Zahlungsbescheide an Bürgen in Höhe von 3.000 bis 60.000 Euro.
Die Integrationsminister der Bundesländer hätten die Bundesregierung gebeten, Möglichkeiten zu finden, die Inanspruchnahme von Bürgen für die Zeit nach der Asylanerkennung auszuschließen, erklärte die Sprecherin. Seit März gilt für die Zahlungsaufforderungen ein Moratorium: Behörden verschicken zwar weiter Bescheide, ziehen die Gelder aber bis auf weiteres nicht ein. Eine Fortsetzung dieser sogenannten "befristeten Niederschlagung" sei Sache des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, erklärte das NRW-Sozialministerium.
Gespräche zwischen Innenministerkonferenz und Bundesregierung
Die Gespräche zwischen der Innenministerkonferenz und Bundesregierung zu dem Thema seien fortgesetzt worden, bestätigte das nordrhein-westfälische Innenministerium auf die Anfrage des epd. Auch bei der Tagung der Länderinnenminister im Juni sei das Thema erörtert worden. Bislang gebe es jedoch keine Fortschritte. Initiativen von Betroffenen drängen auf eine politische Einigung von Bund und Ländern zur Entlastung der Flüchtlingsbürgen und raten zur Klage gegen Zahlungsbescheide.
Schätzungsweise haben allein 2013 und 2014 rund 7.000 Menschen in Deutschland Verpflichtungserklärungen abgegeben, durch die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien auf sicherem Weg einreisen konnten. Die Bürgen waren davon ausgegangen, dass sie nur so lange für den Lebensunterhalt der Flüchtlinge aufkommen müssen, bis die Asylverfahren positiv beschieden sind. Diese Position wurde damals unter anderem von den Ländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen vertreten.
Aus Sicht der Bundesregierung galten die Erklärungen aber auch nach der Anerkennung der Flüchtlinge fort. Erst das Integrationsgesetz bestimmte 2016 eine Fünf-Jahres-Frist, die für "Altfälle" auf drei Jahre reduziert wurde.
Deutschland nimmt gerettete Weißhelme auf

epd-bild/Syria-Civil-Defence
Berlin (epd). Deutschland wird acht der geretteten syrischen Weißhelme und ihre Familien aufnehmen. Das erklärten das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium am 22. Juli gemeinsam in Berlin. Die Aufnahme, über die Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) entschieden habe, sei ein humanitärer Akt und erfolge nach Paragraf 22 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung werden insgesamt rund 50 Gerettete nach Deutschland geholt.
Die israelische Armee hatte die Mitglieder der syrischen Hilfsorganisation und ihre Angehörigen zuvor aus dem Kampfgebiet im Süden Syriens in Sicherheit gebracht. Die Armee teilte am Sonntag auf Twitter mit, die humanitäre Aktion sei auf Bitten der USA und mehrerer europäischer Länder erfolgt. Das Leben der Geretteten sei unmittelbar bedroht gewesen. Jordaniens amtliche Nachrichtenagentur Petra meldete, das Königreich habe den vorübergehenden Verbleib der rund 800 syrischen Zivilisten im Land genehmigt. Großbritannien, Deutschland und Kanada hätten zugesagt, sie binnen drei Monaten aufzunehmen.
Maas spricht von "Gebot der Menschlichkeit"
Seehofer erklärte, die andauernde Militäroffensive und zunehmende Geländegewinne des syrischen Regimes in Süd-Syrien hätten eine akute Gefahr für die Weißhelme und ihre Familien mit sich gebracht. "Diese Menschen, die ihr Leben zur Rettung und Hilfe und zur Linderung der Kriegsleiden der Zivilbevölkerung eingesetzt haben", bedürften nun selbst der Hilfe. "Ihnen Schutz zu gewähren, ist für mich eine humanitäre Verpflichtung und Ausdruck meiner Politik, für Humanität und Ordnung in der Migrationspolitik zu sorgen", sagte der Bundesinnenminister.
Zuerst hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) der "Bild"-Zeitung die Aufnahme der Weißhelm-Retter bestätigt. "Die Weißhelme haben seit Beginn des Syrien-Konflikts mehr als 100.000 Menschen gerettet", sagte er dem Blatt. Es sei "ein Gebot der Menschlichkeit, dass viele dieser mutigen Ersthelfer nun Schutz und Zuflucht finden, einige davon auch in Deutschland".
Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, lobte Israel für die Rettung der Weißhelm-Mitarbeiter und ihrer Familien. "Den Israelis kann man nur dankbar sein, dass sie Menschen gerettet haben, die in Syrien unter Gefahr für Leib und Leben Großartiges geleistet haben", sagte Roth der "Welt" (Online-Ausgabe). Das Auswärtige Amt förderte die Weißhelme seit 2016 nach eigenen Angaben mit insgesamt zwölf Millionen Euro.
Die Weißhelme sind auch bekannt als Syrischer Zivilschutz. Der Freiwilligen-Organisation haben sich mehr als 3.000 Frauen und Männer angeschlossen. Sie arbeiten als humanitäre Feuerwehr: In vielen Teilen Syriens, die in Rebellen-Hand sind, gelten die Weißhelme als der Inbegriff des selbstlosen Helfers. In den Gebieten, die das Regime von Präsident Baschar al-Assad beherrscht, dürfen sie nicht operieren. 2016 wurden die Weißhelme mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet.
Syriens Machthaber gewann in den vergangenen Jahren mit militärischer Unterstützung Russlands, des Irans und verschiedener Milizen große Teile des Landes von Aufständischen und Terrorgruppen zurück. Seit Beginn des Konflikts 2011 wurden Hunderttausende Menschen getötet.
Familiennachzug: Tappen im Dunkeln
1.000 Plätze pro Monat, 28.000 Anfragen: Wer als Flüchtling mit subsidiärem Schutz Angehörige in Sicherheit bringen will, braucht vor allem Geduld. Zwar ist der Nachzug ab August wieder möglich - allerdings begrenzt und die Abläufe sind unklar.Berlin (epd). Viele Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus in Deutschland fiebern dem 1. August entgegen. Dann können sie versuchen, ihre engsten Angehörigen nachziehen zu lassen. Doch die Abläufe sind noch unklar. Auch die Sozialverbände tappen im Dunklen. Sie bezweifeln ohnehin, dass die Zusammenführung der meist aus Syrien und dem Irak stammenden Flüchtlinge reibungslos funktioniert.
Ab dem 1. August dürfen bis zu 1.000 Personen pro Monat nachziehen, maximal 12.000 pro Jahr: Ehegatten, minderjährige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern. Wie die Konsulate, Ausländerbehörden und das Bundesverwaltungsamt über die Anträge entscheiden, soll eine Verwaltungsvereinbarung regeln. Die, so ist im Bundesinnenministerium zu erfahren, "steht kurz vor der Zeichnung".
In inhaltlichen Fragen hält sich die Behörde bedeckt. Sie verweist auf das Verfahren gemäß Aufenthaltsgesetz, das die humanitären Gründe umreißt. Berücksichtigt werden demnach bei Antragstellern die Dauer der Trennung der Familie, das Vorhandensein minderjähriger lediger Kinder, bestehende Gefahren für Leib und Leben sowie schwere Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.
Und: Integrationsaspekte sollen besonders ins Gewicht fallen. Bemühungen, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, würden positiv berücksichtigt, heißt es seitens des Ministeriums: "Das ist der Fall, wenn der Lebensunterhalt und/oder der Wohnraum gesichert werden können oder besondere Fortschritte beim Erwerb von Deutschkenntnissen oder ein Studium in Deutschland nachgewiesen werden." Doch in welchem Verhältnis stehen nachgewiesene Härtefälle zu diesen Aspekten der Integration?
Kritik von Pro Asyl
Die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl bezweifelt, dass der Familiennachzug rechtlich sauber erfolgen wird. "Ich kann nicht erkennen, wie eine juristisch haltbare Einzelfallprüfung stattfinden soll", sagte die rechtspolitische Referentin Bellinda Bartolucci dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Gründe lägen im Gesetz, dem präzise Verfahrensregeln fehlten. Dadurch sei "das Prinzip der Rechtssicherheit nicht gewährleistet", moniert die Juristin.
"Das gilt besonders, wenn das Kontingent von 1.000 Personen voll ist", sagte die Expertin. Die absolute Grenze, die vom Gesetzgeber aus politischen Gründen gezogen wurde, sei aus ihrer Sicht verfassungswidrig.
Völlig ungeklärt sei auch, wie mit jenen Fällen verfahren wird, die über das 1.000-Personen-Kontingent hinausgehen. "Aus dem Gesetz ergibt sich nicht, ob diese schon bewilligten Personen dann automatisch im Pool für den nächsten Monat sind." Auch die Verwaltungsvereinbarung werde nicht mehr Klarheit bringen. Es sei unwahrscheinlich, dass das Papier klare Priorisierungen zwischen einzelnen humanitären Gründen festlegt: "Das wird relativ offen bleiben."
Ulrike Schwarz vom Bundesverband unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge übt ebenfalls Kritik: "Das Familiennachzugsneuregelungsgesetz strotzt vor Widersprüchen. Es bestehen erhebliche rechtliche Unsicherheiten." Denn weder im Gesetz noch in der Begründung stehe, wie der Familiennachzug genau funktionieren soll. "Das ist absurd."
Der Expertin zufolge ist weder geregelt, was genau die humanitären Gründe sind, die den Nachzug ermöglichen, noch wer entscheidet, ob und was ausreichende Integrationsleistungen in Deutschland sind. Schwarz: "Darf die Ausländerbehörde selber bestimmen, was ein humanitärer Härtefall ist? Fragen über Fragen, aber es gibt keine Antworten."
Beim Deutschen Roten Kreuz spricht man von relativ aufwendigen Verfahrensabläufen zwischen Auswärtigem Amt, Bundesverwaltungsamt und Ausländerbehörden, "die sehr gut koordiniert werden müssen, um eine zügige Bearbeitung der Anträge sicherzustellen". Eine Herausforderung stelle vielfach der verlangte Nachweis über das Vorliegen von humanitären Gründen dar. "Das gilt zum Beispiel, wenn Atteste für Krankheiten direkt in Syrien beschafft werden müssen", sagte Sprecher Dieter Schütz dem epd.
Wann die ersten Nachzügler tatsächlich in Deutschland eintreffen, ist offen. Sie müssen sich gedulden, denn die Wartelisten bei der Antragstellung sind lang. Vor allem in der deutschen Botschaft in Beirut, der Hauptanlaufstelle der Syrer. Bislang liegen insgesamt rund 28.000 Terminanfragen vor.
Aktionsbündnis mahnt sichere Häfen im Mittelmehr an

epd-bild/Heiko Kantar
Düsseldorf (epd). Mehrere hundert Menschen haben am 21. Juli in Düsseldorf friedlich für sichere Fluchtwege nach Europa demonstriert. Unter dem Motto "Seebrücke - Schafft sichere Häfen" forderten sie unter anderem, dass private Seenotretter mit ihren Flüchtlingsschiffen straffrei europäische Häfen ansteuern dürfen. Zudem mahnten sie eine menschenwürdige Aufnahme der Geflüchteten an.
"Europa darf die Werte Solidarität und Menschenwürde nicht verraten", sagte eine Sprecherin bei der Abschlusskundgebung. Die Abweisung von Rettungsbooten im Mittelmeer kritisierte sie als "unterlassene Hilfeleistung".
Zur Demonstration hatte ein breites Bündnis von Parteien, Organisationen und Gewerkschaften aufgerufen. Auch das Bündnis "Düsseldorf stellt sich quer" gegen Rechtsextremismus gehörte zu den Unterstützern. Viele der Demonstranten hatten sich - ähnlich wie die Seenotretter - orangefarbene Kleidung angezogen.
Nach Veranstalterangaben nahmen 300 Menschen an dem Protestzug durch die Düsseldorfer Innenstadt teil, die Polizei sprach von einigen hundert Demonstranten. Ähnliche Demonstranten gab am 21. Juli auch in Bielefeld mit 2.000 Teilnehmern, in Mainz und Offenbach. Bereits am 20. Juli hatte es eine Demo in Bonn unter dem Aufruf "Stoppt das Sterben im Mittelmeer" gegeben. Mit dabei waren unter anderem Nichtregierungsorganisationen und Kirchengemeinden.
In den vergangen Wochen hatte es bundesweit Solidaritätskundgebungen für die Seenotrettung auf dem Mittelmeer gegeben. Auslöser war eine tagelang Irrfahrt des Rettungsschiffs "Lifeline" über das Mittelmeer, weil EU-Staaten sich weigerten, die Flüchtlinge an Bord aufzunehmen. Es durfte schließlich in Malta anlegen. Die Behörden beschlagnahmten jedoch Ende Juni zwei Schiffe der privaten Organisation "Sea-Watch". Außerdem wurde ein Flugverbot verhängt. Neuesten Medienberichten zufolge will Italien nun offenbar auch keine Flüchtlinge mehr aufnehmen, die von Schiffen der EU-Marinemission "Sophia" aus dem Mittelmeer gerettet werden.
Der Migrationsexperte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), der rheinische Präses Manfred Rekowski, hatte vergangene die Woche die Crew auf Malta besucht und das drohende Aus der Seenotrettungsmission als "Amputation der humanitären Hilfe" kritisiert.
Studie: Nur Minderheit komplett gegen Flüchtlingsaufnahme

epd-bild/Christian Ditsch
Bochum (epd). Nur eine Minderheit der Deutschen lehnt einer Studie zufolge den Zuzug von Flüchtlingen komplett ab. Wie eine am 18. Juli von der Ruhr-Universität Bochum veröffentlichte Studie ergab, haben zwar viele Deutsche gemischte Gefühle gegenüber Flüchtlingen, aber nur sieben Prozent sind gegen jegliche Aufnahme von Asylsuchenden. Dagegen befürworten 70 Prozent eine geregelte Aufnahme und 23 Prozent einen uneingeschränkten Zuzug. Während Mitleid und Sympathie mit Flüchtlingen sowie eine Zufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen eher zu einer positiven Einstellung führten, sei Islamfeindlichkeit der wichtigste Grund für eine Ablehnung, hieß es.
Kulturelle Bereicherung erwünscht, doch Vorbehalte gegenüber Islam
Für seine Masterarbeit wertete der Bochumer Soziologiestudent Esra Eichener Daten der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (Allbus) des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften aus dem Jahr 2016 aus. Er analysierte Angaben von insgesamt 3.240 Befragten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Demnach begegnen 78 Prozent Flüchtlingen mit Mitleid. Allerdings finden 57 Prozent Flüchtlinge nicht besonders sympathisch. In ökonomischer Hinsicht sehe ein Großteil der Befragten Flüchtlinge zudem als Risiko, hieß es. 64 Prozent betrachten Flüchtlinge aber als kulturelle Bereicherung.
"Obwohl die Emotionen gegenüber Flüchtlingen im Mittel nicht besonders positiv ausfallen, ist nur eine kleine Minderheit der Deutschen radikal ablehnend eingestellt", erklärte Eichener. Wichtigster Einflussfaktor für eine negative Einstellung sind der Studie zufolge Vorbehalte gegenüber dem Islam. Dagegen seien die wichtigsten Einflussfaktoren für eine positive Einstellung Mitleid und Sympathie. Auch Menschen, die ihre eigene Lebenslage positiv bewerten, seien offener für die Aufnahme von Asylsuchenden. Keinen Einfluss auf die Einstellung hatten dagegen der Studie zufolge Bildung, Einkommen, Alter, Geschlecht, eigener Migrationshintergrund und ein Wohnort in Ost- oder Westdeutschland.
"Um das Dilemma zwischen der Notwendigkeit, humanitär zu helfen, und den als negativ angenommenen gesellschaftlichen Folgen zu lösen, muss die Politik aktiv werden", betonte Eichener. Er sprach sich für ein modernes Einwanderungssystem aus, um Bürgern das Gefühl von Kontrolle zu vermitteln. "Derzeit entsteht der Eindruck, als stände die Politik den globalen Migrationsbewegungen ohne Konzept und hilflos gegenüber", warnte der Soziologiestudent.
800 demonstrieren gegen Antisemitismus im Rheinland

epd-bild/Barbara Frommann
Bonn, Düsseldorf (epd). Im Rheinland sind am 19. Juli rund 800 Menschen gegen Judenfeindlichkeit auf die Straße gegangen. Nach antisemitischen Übergriffen in Bonn und Düsseldorf versammelten sich in Bonn nach Angaben der Polizei rund 500 Menschen zum "Tag der Kippa". In Düsseldorf demonstrierten am 19. Juli 300 Menschen gegen Antisemitismus. Nachdem unter anderem auch in Berlin antisemitische Übergriffe stattfanden, rief die evangelische Theologin Petra Bahr zum konsequenten Protest im Alltag auf.
In Bonn war ein jüdischer Gastprofessor 11. Juli im Hofgarten in der Nähe der Universität von einem Deutschen mit palästinensischen Wurzeln attackiert und antisemitisch beschimpft worden. Dabei hatte der Angreifer dem US-Wissenschaftler mehrfach die Kippa vom Kopf geschlagen. Eine zur Hilfe gerufene Polizeistreife verwechselte den Professor mit dem Angreifer und schlug ihn nach Angaben des Professors und nach Berichten von Augenzeugen brutal zu Boden. Der Angreifer wurde wenig später gefasst.
Weitere Diskriminierung in Düsseldorf
In der Düsseldorfer Altstadt hatte sich ebenfalls ein offenbar antisemitischer Übergriff auf einen jungen Mann ereignet. Am 13. Juli war ein 17-Jähriger mit Kippa offenbar aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit von einer etwa zehnköpfigen Gruppe junger Männer beleidigt und angerempelt worden.
Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU), der zu der Solidaritätskundgebung mit der jüdischen Gemeinde auf dem Marktplatz eingeladen hatte, sagte, er schäme sich für die Geschehnisse. Er forderte zudem die lückenlose Untersuchung des Polizeieinsatzes. Der Gastprofessor hatte die unverhältnismäßige Brutalität des Einsatzes kritisiert. Die Bonner Polizei hatte am 16. Juli Disziplinarverfahren gegen die vier beteiligten Beamten eingeleitet.
"Angstfrei die Kippa tragen"
Die Vorsitzende der Synagogengemeinde Bonn, Margaret Traub, sagte: "Es ist genug. Wir können es nicht mehr ertragen, dass wir angefeindet werden, nur weil wir Juden sind." Der Vorfall in Bonn reihe sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle in Deutschland in der jüngsten Zeit. "Ich erwarte von der Politik, dass unsere Kinder hier angstfrei die Kippa tragen können."
Am Düsseldorfer Heinrich-Heine-Platz verurteilte Volker Neupert vom Bündnis "Respekt und Mut" die Tat in der Altstadt als "feigen und widerwärtigen antisemitischen Übergriff". Mit der Mahnversammlung, bei der die meisten männlichen Teilnehmer eine bereitliegende Kippa aufsetzten, forderte Neupert, "Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft der Welt" zu zeigen und gegen solche antisemitischen Übergriffe Stellung zu beziehen.
Der Düsseldorfer Oberrabbiner Raphael Evers bedauerte bei der Veranstaltung, mit dem Übergriff auf den jüdischen Jugendlichen sei "eine rote Linie verschoben" worden. Die Tat sei zugleich ein Zeichen dafür, "dass die Angst und das Misstrauen vor dem anderen noch nie so groß gewesen ist, wie heute".
Die Theologin Bahr sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle in Deutschland, es würde helfen, wenn alle Menschen auf judenfeindliche Äußerungen achten und widersprechen, statt sich auf die Zunge zu beißen. "Denn das Fatale ist, dass es nicht beim Sprechen bleibt, sondern dass daraus ein Handeln folgt", sagte die hannoversche Landessuperintendentin und frühere Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Studie sieht starke Zunahme von Antisemitismus im Netz
Eine Studie belegt eine starke Zunahme von Antisemitismus im Internet. Die Forscher werteten seit 2014 insgesamt 300.000 Texte aus dem Netz aus.Berlin (epd). Antisemitische Äußerungen im Internet haben einer Studie der Technischen Universität (TU) Berlin zufolge in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Der Fachbereich Allgemeine Linguistik untersuchte mehrere Hunderttausend Texte und Kommentare im Netz mit Bezug zu Judentum und Israel. Dabei wurde eine Zunahme von antisemitischen Äußerungen von 7,51 Prozent im Jahr 2007 auf mehr als 30 Prozent im Jahr 2017 festgestellt.
Sprache wird radikaler
Zugleich habe sich die Sprache radikalisiert, sagte Studienautorin Monika Schwarz-Friesel am 18. Juli bei der Vorstellung der Untersuchung. Seit 2009 hätten sich NS-Vergleiche, Gewaltfantasien und drastische, Juden dämonisierende und das Menschsein absprechende Zuschreibungen verdoppelt.
Juden würden häufiger in den sozialen Netzwerken, in den Kommentarbereichen der Online-Qualitätsmedien oder in E-Mails als "Krebs", "Unrat" oder "Pest" bezeichnet, die das "größte Elend der Menschheit sind". Zu finden seien antisemitische Stereotype und judenfeindliche Verschwörungsfantasien praktisch auf allen Portalen wie Facebook, Twitter, YouTube, Online-Buchläden, Kommentarbereichen der Online-Nachrichtenseiten einschließlich Fanforen oder Verbraucher-, Ratgeber- und Spaßportalen.
So stehe seit 2011 ungelöscht auf dem Portal gutefrage.net die Frage "Wieso sind Juden immer so böse". Selbst über Twitter, Instagram oder Facebook verbreitete Aufrufe, gegen Judenhass zu demonstrieren, würden "innerhalb weniger Stunden infiltriert durch Text mit zahlreichen Antisemitismen und Abwehrreaktionen", sagte Schwarz-Friesel. Ein Beispiel ist der Fall des Berliner Gastronomen Yorai Feinberg, der nach Veröffentlichung einer antisemitischen Anfeindung in Netz mit Hasskommentaren- und E-Mails überzogen wird.
Für die Langzeitstudie "Antisemitismus 2.0 und die Netzkultur des Hasses" wertete ein Team von Wissenschaftlern um die Linguistin und Antisemitismusforscherin Schwarz-Friesel zwischen 2014 und 2018 mit einem eigens entwickelten Computerprogramm über 300.000 Texte aus dem Netz aus, darunter über 265.400 Kommentare in den sozialen Netzwerken und 20.000 E-Mails an die Israelische Botschaft und den Zentralrat der Juden.
Über die Hälfte der judenfeindlichen Äußerungen (54 Prozent) sind dabei Stereotype des klassischen Antisemitismus, ein Drittel betrifft den Hass auf Israel (33,35 Prozent) und in über zwölf Prozent der Fälle wird der Holocaust relativiert oder angezweifelt. "Antisemitismus ist integraler Bestandteil der Netzkultur und ein gesamtgesellschaftliche Phänomen", sagte Schwarz-Friesel. Die Absender der Kommentare seien gleichermaßen Rechte und Linke oder kämen aus der Mitte der Gesellschaft, seien ganz "normale User", die dem alten Phantasma des "Ewigen Juden" anhängen, so die Forscherin. Selbst der muslimische Antisemitismus sei stärker von klassischen Stereotypen des Judenhasses geprägt als von israelbezogenen Feindbildkonzepten.
Zentralratspräsident: Worten folgen irgendwann auch Taten
Zentralratspräsident Josef Schuster sagte am Mittwoch, die Studie belege empirisch "was wir schon lange empfinden": Der Antisemitismus in den sozialen Medien werde aggressiver und enthemmter. Das erfülle die Juden in Deutschland mit tiefer Sorge: "Denn Worten folgen irgendwann auch Taten." Das Internationale Auschwitz Komitee sprach von "verheerenden" Ergebnissen der Studie. Als Ursache für die steigende Akzeptanz von Antisemitismus sieht auch Forscherin Schwarz-Friesel zu wenig "Härte und Entschlossenheit" von Politik, Justiz und Zivilgesellschaft, dagegen vorzugehen.
Debatte über Integration nach Özil-Rückzug aus Nationalelf
Frankfurt a.M. (epd). Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalelf hat eine neue Debatte über die Akzeptanz von Menschen mit Migrationshintergrund entfacht. Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) twitterte am 22. Juli, es sei ein "Alarmzeichen", wenn ein großer deutscher Fußballer wie Özil sich in seinem Land wegen Rassismus nicht mehr gewollt und vom DFB nicht repräsentiert fühle. Die Integrationsbeauftragte des Bundes, Annette Widmann-Mauz (CDU), erklärte via Twitter, bei allem Verständnis für die familiären Wurzeln "müssen sich Nationalspieler Kritik gefallen lassen, wenn sie sich für Wahlkampfzwecke hergeben." Zugleich dürfe diese berechtigte Kritik nicht in pauschale Abwertung von Spielern mit Migrationshintergrund umschlagen.
"Bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Einwanderer, wenn wir verlieren"
Der türkischstämmige deutsche Profi von Arsenal London war wegen eines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor der Weltmeisterschaft in die Kritik geraten. Nach wochenlangen Debatten um seine Person erklärte er, die Begegnung mit Erdogan habe keinen politischen Hintergrund. Er habe lediglich seinen Respekt gegenüber dem höchsten Amt des Herkunftslandes seiner Familie zum Ausdruck bringen wollen. Gleichzeitig beklagte er rassistische Angriffe und erhob Vorwürfe gegen deutsche Medien, den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel: "In den Augen von Grindel und seiner Unterstützer bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, aber Einwanderer, wenn wir verlieren."
Der Grünen-Politiker Cem Özdemir erklärte, er finde die Erklärung Özils zu den Erdogan-Fotos falsch, aber auch den Rücktritt aus der Nationalmannschaft. "Es ist fatal, wenn junge Deutsch-Türken jetzt den Eindruck bekommen, sie hätten keinen Platz in der deutschen Nationalelf", sagte der Bundestagsabgeordnete der "Berliner Zeitung" (23. Juli). "Leistung gibt es nur in Vielfalt, nicht in Einfalt. So sind wir 2014 Weltmeister geworden. Und Frankreich jetzt."
Uni Osnabrück beendet Weiterbildung von Imamen
Osnabrück (epd). Die Universität Osnabrück beendet die Weiterbildung von Imamen in Niederachsen. Das Projekt laufe nach acht Jahren Ende September aus, sagte der Direktor des Instituts für Islamische Theologie, Bülent Ucar, am 16. Juli dem Evangelischen Pressedienst (epd). Damit gebe es in ganz Deutschland für die Islamischen Theologen nach der akademischen Ausbildung keine Möglichkeit der praktischen Weiterbildung für den Dienst in den Gemeinden mehr. Als erste hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" über das voraussichtliche Ende des Projektes berichtet.
Ucar unterstrich, dass die vor acht Jahren begonnene Weiterbildung stets nur als Provisorium geplant gewesen sei. "Nun sind die Drittmittel aufgebraucht, und das Projekt wird automatisch beendet." Mit dem bundesweit beachteten Projekt sei Pionierarbeit geleistet worden, betonte der Professor. "Diese Arbeit muss nun von anderen fortgesetzt werden." Am Institut für Islamische Theologie der Universität wurden seither rund 150 Imame weitergebildet.
Anders als bei der evangelischen oder katholischen Theologie oder der Ausbildung jüdischer Rabbiner gebe es bisher noch keine "zweite Phase" in der Ausbildung von Imamen nach Abschluss ihres Theologiestudiums, sagte Ucar. So wie die Prediger- und Priesterseminare von den Kirchen verantwortet werden, müsste ein "Imam-Seminar" nach Ansicht Ucars aus grundsätzlichen und pragmatischen Erwägungen unter Beteiligung der Islamverbände aufgebaut und organisiert werden. "Als Experten sind wir von der Universität bereit, dies zu unterstützen."
Die niedersächsische Landesregierung von SPD und CDU hatte bereits im Koalitionsvertrag die Absicht erklärt, an der Universität Osnabrück eine grundständige Imam-Ausbildung einzurichten, die auf den Weiterbildungsangeboten aufbaut. Ucar sagte, die Landesregierung und die Islamischen Verbände müssten in dieser Frage zueinander finden. "Wir brauchen dringend eine solche Einrichtung, um die Integration zu verbessern und um den Studierenden eine Berufsoption zu verschaffen", betonte Ucar.
Die Landtagsfraktion der Grünen hat nach dem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" Gespräche der rot-schwarzen Landesregierung mit den islamischen Dachverbänden über Ausbildungskonzepte gefordert. Nötig seien Geistliche, die Land und Leute kennen, sagte die religionspolitische Sprecherin Eva Viehoff. Aus dem Ausland finanzierte Imame des türkisch-islamischen Verbandes Ditib bräuchten eine Alternative zur Ausbildung und später auch zur Finanzierung.
Das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur zeigte sich der Zeitung gegenüber offen für Verhandlungen. Ausgangspunkt und Grundlage dafür müssten jedoch Überlegungen und Vorstellungen der islamischen Verbände sein.
Ditib-Landesgeschäftsführerin Emine Oguz sagte der Zeitung, die islamischen Gemeinschaften müssten als Träger des Vorhabens federführend mitwirken, weil sonst das "Vertrauen der Community" nicht gewährleistet sei. Allerdings müssten die politischen Akteure den Religionsgemeinschaften auch verfassungsrechtliche Zuständigkeit zusprechen.
Baden-Württemberg will Islam-Unterricht neu organisieren
Das Angebot eines islamischen Religionsunterrichts stellt die Bundesländer vor organisatorische und juristische Probleme. Baden-Württemberg erwägt jetzt die Gründung einer Stiftung, die den Unterricht tragen soll.Stuttgart (epd). Die grün-schwarze Landesregierung von Baden-Württemberg will den islamischen Religionsunterricht neu organisieren und dafür eine bundesweit einzigartige Stiftung gründen. Ihm fehle der verbindliche Ansprechpartner, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (18. Juli). "Wir brauchen Provisorien, damit wir einen Religionsunterricht mit einer provisorischen Trägerschaft anbieten können. Die Verbände, mit denen wir im Moment verhandeln, sind türkisch dominiert", fügte der Grünen-Politiker hinzu.
Wie das Kultusministerium in Stuttgart dem epd auf Anfrage bestätigte, könnte eine solche Stiftung eine Alternative zum auslaufenden Modellprojekt sein. "Das vorgeschlagene Stiftungsmodell böte sich als eine denkbare Weiterentwicklung an, deshalb nehmen wir nun die Verhandlungen dazu auf. Unser Ziel ist es, muslimischen Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg weiterhin eine fundierte, kritische und werteorientierte Auseinandersetzung mit ihrer Religion zu ermöglichen", erklärte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).
Christlicher Religionsunterricht an Schulen wird in Verantwortung der Kirchen erteilt. Beim islamischen Religionsunterricht gestaltet sich dieser Anspruch schwierig, weil die muslimischen Verbände anders als die christlichen Kirchen nicht als Körperschaften öffentlichen Rechts anerkannt sind. Weil es daher an einem einheitlichen Gegenüber fehlt, kooperieren die Bundesländer beim islamischen Unterricht teilweise auch über Beiratsmodelle, bei denen staatliche Akteure die Inhalte mitbestimmen, mit den vor Ort verfügbaren Verbänden oder Vereinen. Jedes Bundesland regelt den Unterricht in eigener Regie.
Rund 6.000 Schüler bekommen islamischen Religionsunterricht
In Baden-Württemberg erhalten rund 6.000 Schüler islamischen Religionsunterricht in Modellprojekten mit muslimischen Partnern, wie der Mediendienst Integration im April mitteilte. Ursprüngliches Ziel des Modellprojekts war es laut Kultusministerium, dass sich die wichtigen islamischen Verbände in Baden-Württemberg so organisieren und verständigen, dass eine gemeinsame Trägerschaft für den islamischen Religionsunterricht in Baden-Württemberg möglich wird. Das Modellprojekt war aufgrund eines Beschlusses der damaligen Landesregierung aus dem Jahr 2014 bis zum Ende des aktuellen Schuljahres 2017/18 befristet, so das Ministerium.
Eine Übergabe der Trägerschaft des Religionsunterrichts an die Verbände sei aus rechtlichen Gründen bis auf weiteres nicht möglich, hieß es weiter. Zur Sicherung der Kontinuität des Angebots sei eine Verlängerung um ein Jahr, also bis zum Ende des Schuljahres 2018/19 erforderlich: "Diese Verlängerung hat die Landesregierung am 19. Juni 2018 beschlossen. In Zwischenzeit soll auf politischer Ebene das weitere Vorgehen erörtert und über die künftige Trägerschaft des islamischen Religionsunterrichts beraten und entschieden werden."
Die "Südwest Presse" (18. Juli) berichtet unter Berufung auf Koalitionskreise, dass das Land einen sunnitischen Schulrat als Stiftung des öffentlichen Rechts einrichten will mit Geschäftsstelle, Vorstand und Schiedsstelle. Der Schulrat könnte auf Basis eines Grundlagenvertrags arbeiten, den das Land mit den Verbänden abschließen müsste. Verbandsvertreter würden demnach im Vorstand sitzen, aber auch andere Islamexperten; die Geschäftsstelle würden Landesbeamte betreiben, die Schiedsstelle würde mit unabhängigen Experten besetzt.
"Wir haben Verbände, die meinen, sie seien Religionsgemeinschaften. Das sind sie aber nicht. Da es in den islamischen Staaten keine Trennung von Staat und Moschee gibt, ist der Islam nicht zivilgesellschaftlich institutionalisiert", sagte Kretschmann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Die Lösung ist, dass wir ein verfassungsfestes Provisorium installieren, das dann den Religionsunterricht für Muslime trägt. Das Problem ist jedoch, dass wir die Trennung von Staat und Kirche einhalten müssen. Aber nur dieser Religionsunterricht findet im öffentlichen Raum und nicht in der Hinterhofmoschee statt. Er muss kontrollierbar sein. Das ist uns wichtig", unterstrich Kretschmann.
Gedenkstunde erinnert an 20. Juli 1944
Im Berliner Bendlerblock ist an die Hitler-Attentäter vom 20. Juli 1944 erinnert worden. Dabei distanzierten sich die Familienangehörigen deutlich von einer Vereinnahmung durch Rechtspopulisten.Berlin (epd). Bei einer Gedenkstunde der Bundesregierung zum gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 haben sich in Berlin die Familienangehörigen der NS-Widerständler "aufs Schärfste" von der Vereinnahmung und Instrumentalisierung des deutschen Widerstandes durch Rechtspopulisten distanziert. "Das ist nichts anderes als Missbrauch", sagte der Vorsitzende der Stiftung 20. Juli 1944, Robert von Steinau-Steinrück, zum Auftakt der Feierstunde in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Berliner Bendlerblock. Deren Agieren und deren Sprache sei totalitär, "der Widerstand aber war gerade antitotalitär".
Bereits zuvor hatten die 400 Nachfahren in einem im Berliner "Tagesspiegel" (20. Juli) veröffentlichten Appell vor nationalen Alleingängen und der Gefährdung eines geeinten Europas gewarnt. "Wir möchten an diesem Tag an den Mut und die visionäre Kraft unserer Eltern, Urgroß- und Großeltern, Onkel und Tanten erinnern und hoffen, dass nationale Alleingänge nicht das geeinte, starke, friedliche Europa gefährden, das sie für sich, uns und unsere Kinder erhofft hatten", hieß es.
Statt gemeinsam an den Herausforderungen der Zukunft zu arbeiten, erhielten Populisten mehr und mehr Zulauf, rüsteten Politiker verbal auf und setzten auf Abschottung. Das sei nicht das Vermächtnis, das die NS-Widerständler im Sinn hatten, heißt es in dem Appell.
Michael Müller: Botschaft kommt zum richtigen Zeitpunkt
Der amtierende Bundesratspräsident, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, und Außenminister Heiko Maas (beide SPD) dankten den Angehörigen bei dem Gedanken am 20. Juli für die deutlichen Worte. "Ihre Botschaft kommt zum richtigen Zeitpunkt", sagte Müller: "Danke, dass Sie das Gedenken an ihre Lieben mit dem Aufruf für ein geeintes Europa verbinden." Der wichtigste Schlüssel zur Mobilisierung der eigenen Widerstandskräfte sei das Wissen um die Geschehnisse, die Mechanismen der Diktatur und ihre Motive.
Außenminister Maas sagte, heute beriefen sich ausgerechnet diejenigen auf ihr "Recht zum Widerstand", die Volksvertreter lautstark als "Volksverräter" schmähten, die Erinnerung als "Schuldkult" abtäten und freie Medien als "Lügenpresse" diffamierten. "Ich finde das beschämend", sagte Maas.
Für ihn sei es unerträglich, dass die vom 1944 von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpfer Josef Wirmer entworfene Fahne des 20. Juli auf Kundgebungen von Neonazis missbraucht werde. Dieses Symbol - ein Kreuz in den demokratischen Farben Schwarz, Rot und Gold - sollte über dem vom Nationalsozialismus befreiten Deutschland wehen und die Ideale verkörpern, für die die Frauen und Männer des 20. Juli ihr Leben gaben.
Beide würdigten die Widerstandskämpfer um den Wehrmachtsoberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg, deren Wille zur Freiheit eines der Motive für ihr Attentat auf Hitler gewesen sei. "Wir stehen heute hier voller Ehrfurcht vor der Tat dieser Männer", sagte Müller.
Der damalige Aufstand der Anständigen sei nicht vergebens gewesen, sagte Maas. "Die Saat ist aufgegangen in unserem Grundgesetz, das die Würde des Menschen über alles andere stellt. Ihre Früchte sind unsere offene Gesellschaft und Deutschlands Ansehen in Europa und der Welt."
An der Feierstunde nahmen zahlreiche Politiker und Vertreter des öffentlichen Lebens teil, unter anderem Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD), Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, und Vertreter von Berliner Senat und Abgeordnetenhaus.
Am 20. Juli 1944 scheiterte das Attentat einer Gruppe um Stauffenberg auf Adolf Hitler. Er und vier Mitverschwörer wurden noch in der Nacht hingerichtet, weitere 140 Mitwisser traf es in den folgenden Tagen.
Gedenken an "Operation Gomorrha" im Hamburger Michel
Hamburg (epd). Spitzenvertreter von Stadt und Kirchen haben am 22. Juli im Hamburger Michel in einer offiziellen Gedenkfeier an den "Hamburger Feuersturm" vor 75 Jahren erinnert. Bei der "Operation Gomorrha" vom 24. Juli bis 3. August hatten alliierte Bomber weite Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt. 35.000 Menschen starben, 125.000 wurden verletzt, 900.000 flüchteten aus der Stadt.
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte, die Erinnerung an die "Operation Gomorrha" und die nationalsozialistische Zivilisationszerstörung diene immer auch als Mahnung und Aufforderung, sich heute für Demokratie und Menschenrechte sowie für die freiheitlich demokratische Grundordnung stark zu machen. "Das ist unsere eigene historische Verantwortung für den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, der sich in den Sommertagen des Jahres 1943 mit der Operation Gomorrha in besonderer Härte gegen die Freie und Hansestadt Hamburg gerichtet hat."
Dabei werde an diesem Tag aber nicht nur der Opfer der "Operation Gomorrha", sondern auch der Opfer von Bombardierungen der Alliierten in Lübeck und Rostock, Köln, Dresden und weiteren Städten in Deutschland gedacht, so Tschentscher. Das Gedenken gelte auch den Opfern deutscher Angriffe auf Coventry, Rotterdam, Belgrad, Warschau und auf viele andere Städte in Europa, in Polen, Russland, Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern.
Nordkirchen-Bischöfin Kirsten Fehrs erinnerte an den Schmerz, die Verzweiflung und Todesnot der Opfer. Es sei wichtig, im Friedensmahnmal St. Nikolai "ein sichtbares Zeichen für diese Erinnerungskultur" zu haben. Es gelte, sich immer wieder dafür einzusetzen, dass "nie wieder Gotteshäuser und Wohnhäuser zerbombt werden und nie wieder Menschen im Feuersturm zu Asche werden". Blicke auf Syrien zeigten, dass diese Mahnung "immer wieder nicht gehört wird". Umso dringlicher sei es, gemeinsam mit Menschen aller Religionen zu betonen, "dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein darf".
Der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße erinnerte daran, dass es das nationalsozialistische Deutschland gewesen sei, das diesen furchtbaren Krieg ausgelöst habe. Dies habe letztlich auch den Feuersturm über Hamburg hereinbrechen lassen. "Wir müssen die Vergangenheit erinnern, um Menschen mit Zukunft zu sein", sagte er.
Vor der Gedenkfeier war am Mahnmal St. Nikolai ein Kranz niedergelegt worden. Wenige Tag zuvor wurde dort auch eine Ausstellung eröffnet, die über den Einsatz von KZ-Häftlingen nach den Bombardierungen informiert. Die Ausstellung im Mahnmal ist bis zum 29. September zu sehen.
Der Name "Operation Gomorrha" erinnert an das biblische Gottesgericht aus dem 1. Buch Mose. Dort heißt es: "Der Herr ließ Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorrha und vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war."
Gericht: Sänger Naidoo darf nicht Antisemit genannt werden
Regensburg (epd). Der Sänger Xavier Naidoo hat sich vor Gericht erfolgreich gegen Antisemitismus-Vorwürfe gewehrt. Das Landgericht Regensburg untersagte es einer Referentin der Amadeu Antonio Stiftung, den Sänger als Antisemiten zu bezeichnen. Die Beklagte habe diesen Vorwurf nicht ausreichend belegen können, sagte Landgerichtssprecher Thomas Polnik dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 17. Juli (AZ: 62 O 1925/17). Der Zentralrat der Juden zeigte sich von dem Urteil überrascht. "Jetzt ist es wichtig, dass Politik und zivilgesellschaftliche Gruppen deutlich machen, dass dieses Urteil kein Freibrief für Antisemitismus ist", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster.
Die Referentin hatte bei einer Veranstaltung vor einem Jahr im niederbayerischen Straubing vor Publikum gesagt: "Er ist Antisemit. Das ist strukturell nachweisbar." Der Sänger der Band "Söhne Mannheims" hatte sich in einer mündlichen Verhandlung vor drei Wochen in Regensburg auf seine Kunstfreiheit berufen und dargelegt, dass er unter Antisemitismus explizit "antijüdisches Verhalten" verstehe. Den Vorwurf antisemitischer Vorurteile wies er zurück. Er sei kein Rassist. Die Beklagte berief sich dagegen auf Liedtexte des Sängers, in denen antisemitische Codes und Chiffren zu finden seien.
Die Kammer begründete ihr Urteil damit, dass es sich zwar um eine Meinungsäußerung der Beklagten handelt, "diese aber angesichts der Schwere der Anschuldigung hinter den Persönlichkeitsrechten des Sängers zurückstehen muss". Das Urteil hat noch keine Rechtskraft. Die Beklagte plant nach eigenen Worten, in Berufung zu gehen.
Zentralratspräsident Schuster erklärte : "Egal, in welcher Form alte judenfeindliche Stereotype transportiert werden, darf es dafür keine Toleranz geben." Gerade in der Musikszene müssten viel strengere Maßstäbe angelegt werden, als es bisher der Fall sei. "Die Kunstfreiheit darf nicht als Deckmäntelchen für Menschenfeindlichkeit missbraucht werden."
Die frühere Zentralratspräsidentin Charlotte Knobloch erklärte via Twitter, die Gerichtsentscheidung sei zu akzeptieren - wirklich zu verstehen sei sie aber nicht. "Hass ist keine Meinung, und die Verwendung einer codierten Ausdrucksweise, die sich leicht als antisemitisch verstehen lässt, vergiftet unsere Sprache und unsere Gesellschaft."
Die Beklagte bezeichnete die Entscheidung laut Stiftungsmitteilung als "enttäuschend", sie greife in die Meinungsfreiheit ein. "Das Urteil ist ein fatales Signal für die politische Bildung." Die Amadeu Antonio Stiftung halte es für unerlässlich, antisemitische Äußerungen und Verschwörungserzählungen auch als solche zu bezeichnen.
Polizisten dürfen nicht kiffen
Berlin (epd). Cannabis-Konsumenten haben nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin keinen Anspruch auf Einstellung in den mittleren Polizeidienst. Die Einstellung in den Polizeivollzugsdienst setze die umfassende Eignung eines Bewerbers voraus, heißt es in einer am 17. Juli veröffentlichten Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts. Wer aber Cannabis konsumiere oder vor kurzem konsumiert habe, sei etwa beim Führen von Kraftfahrzeugen beeinträchtigt. Er könne somit nicht uneingeschränkt polizeidienstfähig sein. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden. (VG 26 L 130.18)
Im zugrundeliegenden Fall hatte sich ein 40-Jähriger im Jahre 2017 um Einstellung in den Polizeivollzugsdienst beworben. Eine Blutuntersuchung legte jedoch die Existenz von Cannabis-Abbauprodukten offen. Deshalb lehnte der Polizeipräsident die Einstellung ab.
Der Antragsteller wandte sich mit einem Eilantrag dagegen. Er konsumiere keine Drogen und sei deshalb gesundheitlich für den Dienst geeignet. Das Gericht stufte diese Argumentation angesichts der festgestellten Blutwerte als nicht glaubhaft ein. Im konkreten Fall habe die Behörde eine umfassende Eignung des Bewerbers zurecht verneint.
Umwelt
Versteckspiel am Himmel

epd-bild / Gustavo Alabiso
Hamburg (epd). Sie wird 103 Minuten lang dauern und in ganz Deutschland sichtbar sein: Für den 27. Juli steht die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts in den Kalendern. Ab 21.30 Uhr wird der Mond sich im Kernschatten der Erde aufhalten und durch ihn hindurch wandern. Auf dem Mond findet zeitgleich eine totale Sonnenfinsternis statt, die von der Erde verursacht wird.
"Mofis" sind selten
Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben - und wenn Mond, Erde und Sonne genau auf einer Linie stehen. "Mofis" sind selten, obwohl alle 29,5 Tage Vollmond ist. Meistens läuft der Mond über den Erdschatten hinweg oder unter ihm hindurch.
Knapp 1,4 Millionen Kilometer reicht der Erdschatten ins All hinaus - genug also, dass er den rund 384.000 Kilometer entfernten Mond überdecken kann. Allerdings ist selbst der Kernschatten der Erde nicht vollständig schwarz: Weil die Sonne die Erdatmosphäre wie ein Scheinwerfer durchleuchtet, wird Licht in den Schatten gelenkt.
Effekt des "Blutmondes"
Das blaue Licht wird dabei komplett gestreut, und das rote Licht bleibt übrig - wie bei Auf- und Untergängen der Sonne. Auf diese Weise kann der Effekt des "Blutmondes" entstehen. Wenn viel Staub in der Lufthülle ist - zum Beispiel durch Vulkanausbrüche - kann der Farbton allerdings auch aschgrau aussehen.
"Von der Vorderseite des Mondes aus könnte man während der Finsternis einen hauchzarten rötlichen Lichtsaum um die komplett dunkle Erde sehen", sagt der Hamburger Astronom Bernd Loibl. Dieser rote Ring sei allerdings "außerordentlich dünn". Die Lüfthülle der Erde sei maximal 20 Kilometer dick - bei einem Erddurchmesser von 6.731 Kilometern. Dennoch müsse dieses Schauspiel "ein höchst spektakuläres Erlebnis" sein, sagt Loibl. Allerdings habe es noch nie ein Mensch live gesehen: Als die insgesamt zwölf US-Astronauten zwischen 1969 und 1972 auf dem Mond waren, habe es keine Finsternisse gegeben, so der Experte.
Vom Mond aus gesehen erscheint die Sonne ungefähr so groß wie am irdischen Himmel. Die Erde dagegen wirkt wie eine Riesenkugel, viermal so groß wie die Sonne. Überdies steht die Erde "wie festgenagelt" in der Schwärze des Alls - nur ihre Eigendrehung lässt sich wahrnehmen. Die Sonne dagegen scheint sich zu bewegen - weil der Mond sich um die Erde dreht. "Von links" schiebt sich die kleine Sonne für 103 Minuten hinter den großen "Blauen Planeten", der dann - bis auf seinen roten Ring - völlig schwarz aussieht.
Von Deutschland aus gesehen beginnt die Mondfinsternis faktisch schon mit dem Aufgang des Mondes. Dieser Aufgang am Osthimmel ist zeitlich jedoch an verschiedenen Orten unterschiedlich. In Hamburg um 21.17 Uhr, in Berlin schon um 20.58 Uhr, in Stuttgart um 21.01 Uhr.
Wetter muss mitspielen
Der Eintritt des Mondes in den Kernschatten beginnt schon um 20.24 Uhr, also vor seinem Aufgang und ist daher hierzulande nicht sichtbar. Die totale Phase - wenn sich also der Mond komplett im Erdschatten befindet - beginnt um 21.30 Uhr, erreicht ihr Maximum um 22.22 Uhr und endet um 23.13 Uhr. Erst über eine weitere Stunde später wird der Erdtrabant den Kernschatten wieder komplett verlassen haben.
Sichtbar ist die Finsternis in Mittel, West- und Osteuropa sowie zusätzlich noch in Afrika, im westlichen Asien, in Indien und im Indischen Ozean. Grundvoraussetzung ist allerdings, dass das Wetter mitmacht: Wolken würden das Schauspiel verbergen wie der Vorhang die Kulisse auf einer Theaterbühne.
Mehr Plastikmüll und weniger Mehrweg bei Getränken

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). In Deutschland werden immer weniger Getränke in Mehrwegverpackungen verkauft. Stattdessen sind umweltschädliche Einwegverpackungen aus Plastik auf dem Vormarsch. Die sogenannte Mehrwegquote sank nach Angaben der sogenannten Mehrweg-Allianz in den vergangenen knapp 20 Jahren von 70 auf aktuell nur noch 43 Prozent. Verantwortlich dafür seien internationale Getränkekonzerne wie Coca-Cola, Pepsi und Danone Waters, aber auch Handelsdiscounter wie Aldi und Lidl. Diese hätten sich in den vergangenen Jahren aus dem Mehrwegsystem verabschiedet, sagte der Leiter Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe, Thomas Fischer, am 18. Juli in Berlin.
Laut Fischer werden jährlich 16 Milliarden Einweg-Getränkeverpackungen in Deutschland verkauft. Der daraus resultierende Plastikmüll entspreche dem Gewicht von 1.600 Airbus-Flugzeugen des Typs A380. Der Trend zu Einweg sei eine enorme Verschwendung von Ressourcen wie etwa Erdöl und habe fatale Umweltverschmutzungen zur Folge. Mehrwegflaschen dagegen könnten bis zu 50 Mal wiederbefüllt werden, sagte der Kreislaufwirtschaftsexperte.
Hälfte der Verbraucher kann Einweg nicht von Mehrweg unterscheiden
Eine erschreckend hohe Zahl von etwa 50 Prozent der Verbraucher könne allerdings Einweg- und Mehrwegverpackungen nicht auseinanderhalten, erläuterten Vertreter der Mehrweg-Allianz in Berlin. Viele Kunden glaubten auch bei Einwegverpackungen an einen positiven ökologischen Effekt, da sie die Plastikflaschen ja zurückbringen und dafür Pfand zurückbekommen. Einwegverpackungen hätten jedoch enorme negative Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Statistisch gesehen verursacht nach den Worten der Geschäftsführerin der Stiftung Initiative Mehrweg, Martina Gehrmann, jeder Bundesbürger pro Jahr 213 Kilogramm Abfall. Das sei ein Spitzenwert in Europa.
Die "Mehrweg-Allianz" besteht aus der Deutschen Umwelthilfe (DUH), der Stiftung Initiative Mehrweg (SIM), dem Verband des deutschen Getränkefachgroßhandels (GFGH), dem Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandels (EHV), dem Verband Private Brauereien Deutschland und dem Verband Pro Mehrweg. Sie fordert von der Bundesregierung die Vorlage eines konkreten Maßnahmenplans, wie die im neuen Verpackungsgesetz vorgeschriebene gesetzliche Mehrwegquote von 70 Prozent erreicht werden soll.
Nötig dafür sei ein Stufenplan. Dazu gehöre auch eine frühzeitige Sanktionierung des absehbaren Unterschreitens der Mehrwegquote durch eine Abgabe auf Einwegplastikflaschen und Dosen in Höhe von 20 Cent zusätzlich zum Pfand. Zur Flankierung ihrer vor allem an die Bundesregierung gerichteten Forderungen startete die Mehrweg-Allianz ihre neue Kampagne. Die nunmehr zwölfte Auflage steht unter der Überschrift "Mehrweg ist Klimaschutz". Daran beteiligt sind über 5.000 Getränkehändler, Brauereien, Mineralbrunnen und Fruchtsaftabfüller.
Umwelthilfe klagt wegen Nitrat im Grundwasser

epd-bild/Rolf K. Wegst
Berlin, Düsseldorf (epd). Nach ihrer Kampagne für saubere Luft in den Innenstädten klagt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) jetzt auch auf sauberes Grundwasser. Beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg sei eine 75-seitige Klageschrift wegen der Überschreitung der Grenzwerte für die Nitratbelastung des Grundwassers eingereicht worden, erklärten Vertreter der Umweltorganisation am 17. Juli in Berlin. Konkret richtet sich die Klage nach den Worten von Rechtsanwalt Remo Klinger gegen die Bundesrepublik, vertreten durch das Bundeslandwirtschaftsministerium. Klinger hält eine erste Gerichtsentscheidung in der zweiten Jahreshälfte 2019 für realistisch.
Höchste Belastungen in Regionen mit viel Tierhaltung
Deutschland hat nach den Worten von Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner nach Malta die zweithöchsten Messwerte unter allen 28 EU-Staaten. Hauptverursacher der Nitrateinträge sei die industrielle Landwirtschaft durch Düngung und Gülle. Am meisten mit Nitrat belastet ist das Grundwasser nach seinen Worten in Regionen mit viel Tierhaltung. Müller-Kraenner nannte konkret Schleswig-Holstein, Niedersachsen, das nördliche Nordrhein-Westfalen sowie Teile Bayerns.
Krebsrisiko steigt
Zu hohe Nitratwerte im Trinkwasser seien vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich. Auch steige das Krebsrisiko. Hinzu kämen erhebliche Auswirkungen auf das Ökosystem, also etwa die Insektenwelt. Für die Nitratbelastung des Grund- und Trinkwassers gilt ein Grenzwert von 50 Milligramm je Liter. Dieser werde an knapp 28 Prozent der Messstellen teilweise deutlich überschritten. Die Klage richte sich konkret gegen das 2017 novellierte, geltende "Nationale Aktionsprogramm zum Schutz von Gewässern vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen".
Nach Ansicht der DUH ist das geltende Düngerecht auch nach dieser Novelle ungeeignet, die zu hohe Nitratbelastung des Grundwassers und der Gewässer schnellstmöglich so weit zu reduzieren, dass der Grenzwert eingehalten wird. Der Europäische Gerichtshof habe durch sein Urteil vom 21. Juni bestätigt, dass Deutschland seinen Verpflichtungen zur Nitratminderung nicht gerecht werde.
Umwelthilfe-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch hofft darauf, mit dieser und eventuell weiteren Klagen auf kommunaler oder regionaler Ebene einen Wandel von der industriellen zu einer nachhaltigen Landwirtschaft einleiten zu können: Mit beispielsweise 2,99 Euro je Kilogramm Schweinefleisch habe Deutschland die niedrigsten Lebensmittelpreise in Europa. Angesichts dieses Preisniveaus lasse sich keine Hoffnung schöpfen, dass sich etwas an der aktuellen Situation ändert.
Rüge vom EuGH
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hatte die Bundesregierung am 21. Juni wegen Verstoßes gegen die EU-Nitratrichtlinie verklagt. Dem Urteil zufolge versäumte Deutschland unter anderem, das Ausbringen von nitrathaltigen Düngemitteln zu begrenzen. Die EU-Richtlinie, gegen die Deutschland verstoßen hat, soll Gewässer vor zu viel Nitrat aus der Landwirtschaft schützen, beispielsweise durch das Düngen mit Gülle. Das 1991 erlassene und 2008 geänderte Gesetz sieht vor, dass die EU-Länder Aktionsprogramme für gefährdete Gebiete aufstellen. Zugleich müssen die Mitgliedstaaten Daten zur Wasserqualität nach Brüssel melden.
Eine direkte Strafe in Verbindung mit dem EuGH-Urteil gab es nicht. Deutschland muss aber mit seiner Gesetzgebung und deren Umsetzung dem Urteil entsprechen - ansonsten könnte die Kommission erneut klagen und dann auch finanzielle Sanktionen beantragen. Die Deutsche Umwelthilfe will allerdings nicht erst den nächsten Nitratbericht der Bundesregierung im Jahre 2020 abwarten, sondern schon jetzt Verbesserungen erreichen.
Jährliche Untersuchung der Wälder in NRW hat begonnen

epd-bild / Steffen Schellhorn
Schermbeck, Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen werden jetzt wieder die Wälder unter die Lupe genommen. Im niederrheinischen Schermbeck (Kreis Wesel) haben am 19. Juli die Geländeaufnahmen zum diesjährigen Waldzustand im Land begonnen, wie das NRW-Umweltministerium in Düsseldorf mitteilte. "Der Schutz und die nachhaltige Nutzung unserer Wälder ist unsere vordringliche Aufgabe", sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), die den Start der Erfassung vor Ort begleitete.
Stürme und lang anhaltende Trockenheit setzen Bäumen zu
Um langfristige Trends zu erkennen, wird der Gesundheitszustand der Wälder in NRW seit über 30 Jahren untersucht. In diesem Jahr waren die Wälder zu Jahresbeginn den Stürmen "Burglind" und "Friederike" ausgesetzt, aktuell setzt die Trockenheit den Bäumen zu. "Nur möglichst gesunde und widerstandsfähige Wälder gewährleisten die vielfältigen ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leistungen des Waldes", erklärte die Ministerin. Deswegen sei es wichtig, jährlich den Gesundheitszustand der Wälder zu bewerten
Nach Angaben des Inventurleiters für die Waldzustandserhebung beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Lutz Falkenried, lässt sich die Vitalität von Bäumen am Zustand ihrer Kronen ablesen. "Für die gesamte Waldfläche in Nordrhein-Westfalen werden im Sommer an 560 Stichprobepunkten mehr als 10.300 Einzelbäume aufgenommen", betonte er. Die dabei gesammelten Daten sollten auch Informationen zu den möglichen Auswirkungen des Klimawandels liefern. Die Ergebnisse der aktuellen Waldzustandserhebung will das Ministerium im Spätherbst vorstellen.
Waldsterben in den 80ern
Die Untersuchungen zum Waldzustand in NRW begannen in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit der Diskussion um das Waldsterben. Die Waldzustandserhebung ist heute Teil des forstlichen Umweltmonitorings in Nordrhein-Westfalen. Seit 2014 gibt es die Waldzustandserhebung auch in ganz Deutschland.
Anti-Atomkraft-Initiativen fordern neues Tihange/Doel-Gutachten
Aachen, Köln (epd). Anti-Atomkraft-Initiativen in Deutschland fordern ein neues Gutachten zum Zustand der belgischen Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3. Gemeinsam mit der Ärzteorganisation IPPNW kritisierten am 18. Juli unter anderem das Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie, das Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen und AntiAtom Bonn, dass Mitglieder der Reaktorsicherheitskommission (RSK) beruflich befangen seien. Mehrere leitende Angestellte ausgerechnet des Atomkonzerns EDF-Framatome in Erlangen - seinerzeit beteiligt am Bau der Kraftwerksblöcke - hätten an der umstrittenen Stellungnahme zur angeblichen Sicherheit der Reaktoren im federführenden Ausschuss der RSK mitgewirkt.
"Befangenheit einiger Mitglieder der Reaktorsicherheitskommission"
Neben einem neuen Gutachten durch unabhängige Wissenschaftler fordern die Anti-Atom-Gruppen auch den Rücktritt von RSK-Chef Rudolf Wieland. Die Gruppen werfen ihm vor, Angaben zur Befangenheit einiger Kommissionsmitglieder bislang verschwiegen zu haben. Es sei unglaublich, dass in der Reaktorsicherheitskommission leitende Mitarbeiter von Firmen über Reaktoren gutachten dürfen, deren Weiterbetrieb für die eigene Firma wirtschaftlich von erheblicher Bedeutung sei, kritisierten die Organisationen. Das Bundesumweltministerium müsse nun die Stellungnahme der RSK offiziell zurückweisen und die RSK grundlegend neu besetzen, also mit kritischen und vor allem zweifelsfrei unabhängigen Wissenschaftlern, forderte Jörg Schellenberg vom Aachener Aktionsbündnis.
Der WDR berichtete am 18. Juli, dass nach Recherchen des Senders zwei Mitarbeiter des Atomkonzerns Framatome, ehemals Areva, an der Ausarbeitung der jüngsten Gutachtens der Reaktorsicherheitskommission zu Tihange 2 und Doel 3 beteiligt waren. Die Anti-Atomkraft-Gruppen sprechen sogar davon, dass in der 16-köpfigen Gesamt-RSK drei aktuelle beziehungsweise ehemalige Mitarbeiter von Framatome beziehungsweise Areva sitzen. Die RSK ist das wichtigste Beratungsgremium der Bundesregierung in Sachen Atomkraft. Die in der vergangenen Woche veröffentlichte Stellungnahme zu den belgischen Reaktoren kommt zu dem Ergebnis, dass Tihange 2 und Doel 3 trotz zahlreicher Risse in den Druckbehältern weitgehend unbedenklich sind.
Laut WDR war Framatome damals am Bau der Kraftwerksblöcke in Belgien beteiligt. Bis heute bestünden enge geschäftliche Kontakte zum Betreiber der belgischen Kraftwerke, berichtete der Sender. So liefere die Framatome-Tochter im niedersächsischen Lingen seit Jahren Brennelemente nach Belgien. Die Niederlassung in Erlangen habe erst kürzlich einen Millionenauftrag zur Erneuerung der Sicherheitsleittechnik des AKW Doel erhalten. Über den Mutterkonzern EDF sei Framatome zudem Miteigentümer der Reaktoren Tihange 2 und Doel 3, erläuterte der WDR.
Soziales
Merkel: Pflege ist Aufgabe der gesamten Regierung

epd-bild/Friso Gentsch/dpa-Pool
Paderborn (epd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich bei ihrem Besuch eines Altenheims in Paderborn für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege ausgesprochen. "Wir müssen über die Ausbildung und Vergütung sprechen", sagte Merkel am 16. Juli bei ihrem Besuch der evangelischen Altenhilfe St. Johannisstift. Der Pfleger Ferdi Cebi, der die Kanzlerin eingeladen hatte, mahnte, dass der Pflegeberuf für junge Menschen attraktiver gemacht werden müsse. Der Vorstandssprecher des St. Johannesstifts, Martin Wolf, unterstrich, dass Pflege gut bezahlt werden müsse.
Merkel erklärte, Pflegekräfte dürften nicht überfordert werden. Verbesserungen bei der Ausbildung und Bezahlung seien auch Ziel der "Konzertierten Aktion Pflege" von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), sagte Merkel bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Senioren der Einrichtung. "Wir müssen versuchen, das nicht ganz einfache System zu ordnen und die Vielfalt zu einer Einheit zu machen." Bundesweit solle ein vergleichbares Niveau von Ausbildung und Bezahlung erreicht werden, sagte die CDU-Chefin. Für die Pflege sei nicht nur der Fachminister verantwortlich, sie sei Aufgabe der gesamten Regierung.
T-Shirt mit Aufdruck "Ich bin ein Pfleger mit Herz"
Der 36-jährige Pfleger Cebi erklärte, es habe sich zwar schon manches im Pflegebereich getan, es müsse jedoch noch mehr passieren. Nötig seien flächendeckende Tarifverträge und eine Fünf-Tage-Woche in allen Pflegeinrichtungen, sage Cebi, der ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Ich bin ein Pfleger mit Herz" trug. Pflegekräfte sollten nicht mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten. Zudem bräuchten sie mehr Freizeit und Erholungszeit.
Cebi mahnte zugleich, dass nicht nur das Negative in der Pflege gezeigt werden dürfe. "Die positiven Seiten gehen ein bisschen unter, und das finde ich schade", hatte der Altenpfleger am Morgen im RBB-Radio gesagt. Der Beruf habe viel mehr schöne als negative Seiten. "Wir sind auch Köche, Hausmeister, Ratgeber und Seelsorger."
Der Vorstandssprecher des St. Johannesstifts, Martin Wolf, betonte, dass Pflege ein anspruchsvoller Beruf sei, der auch gut bezahlt werden müsse. Wolf kritisierte, dass zwar allerorts gute Pflege gefordert werde, die Pflegeversicherung dann aber Einrichtungen wie dem St. Johannesstift vorhielten, dass sie teurer als andere Einrichtungen seien. Der kirchlich-diakonische Tarifvertrag stehe an der Spitze aller deutschen Tarifverträge. "Gute Pflege kostet Geld", unterstrich Wolf.
Der Altenpfleger Cebi hatte Merkel im vergangenen September in der ZDF-Wahlsendung "Klartext, Frau Merkel" nach Paderborn eingeladen. Die Bundeskanzlerin hatte daraufhin versprochen, sich vor Ort zu informieren. Cebi, der das Thema Pflege auch in seinem Online-Blog und in seiner Rap-Musik behandelt, hatte in der Sendung mit Merkel kritisiert, dass immer mehr am Personal gespart werde und ein Altenheimplatz für viele Senioren nahezu unbezahlbar sei.
Das St. Johannisstift wurde 1862 vom Paderborner Kirchenkreis als "Armen- und Versorgungsanstalt" gegründet, um hilfsbedürftige evangelische Gemeindemitglieder in der Paderborner Diaspora zu unterstützen. Heute gehören zu der Stiftung vier Geschäftsbereiche: das evangelische Krankenhaus St. Johannesstift sowie Alten-, Kinder- und Jugendhilfe. Die Zahl der Mitarbeiter beläuft sich den Angaben nach auf rund 1.500.
Experten gegen Gebühr für Patienten in Notaufnahmen
Berlin (epd). Gesundheitsexperten haben den Vorstoß der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die Einführung einer Patientengebühr in Notaufnahmen zurückgewiesen. Der Medizinethiker Eckhard Nagel sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), eine solche Eintrittsgebühr sei unsozial. Auch der SPD-Politiker Karl Lauterbach und die Grünen-Expertin Kirsten Kappert-Gonther gingen auf Distanz zu der Idee, 50 Euro von Patienten zu kassieren, die eine Klinikambulanz mit Bagatell-Beschwerden aufsuchen. Eine solche Gebühr hatten die Kassenärzte jüngst ins Gespräch gebracht, um die Ambulanzen vor allem an den Wochenenden zu entlasten.
Medizinethiker Nagel: sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), eine solche Eintrittsgebühr sei unsozial.
"In dem Moment, wo bestimmte Gruppen der Bevölkerung es sich nicht mehr leisten können, wenn sie unsicher sind, zu einer Notfallambulanz oder Notaufnahme zu gehen, riskieren wir einen Grundpfeiler unseres solidarisch organisiertem Gesundheitssystems", erklärte Nagel. Diese schlichte ökonomische Sichtweise sei "zu banal" und werde dem Thema nicht gerecht.
Für den Teils gravierenden Anstieg von Patientenzahlen in Notaufnahmen gebe es viele Gründe, führte der Professor am Institut für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften der Universität Bayreuth aus. "Es ist eine komplexe Gemengelage und nicht eine neue Bequemlichkeit unserer Bevölkerung."
Sinnvoll sei der Vorschlag, Notarztpraxen als eine Art kassenärztlichen Bereitschaftsdienst in die Nähe von Notfallambulanzen in Krankenhäusern zu legen, sagte Nagel. Diese könnten eine erste Anlaufstelle sein und im Zweifelsfall entscheiden, wer in die Notaufnahme weitergeleitet werde.
Lauterbach sagte der "Passauer Neuen Presse" (17. Juli): "Der Ruf nach einer Rettungsstellengebühr für Notfallpatienten ist abwegig." Das Problem sei, dass man bei Fachärzten viel zu lange auf eine akute Behandlung warten müsse. Anstelle dieses Problem endlich zu lösen, wolle die Kassenärztliche Vereinigung die Patienten bestrafen.
Zur Lösung des Problems schlug der SPD-Politiker vor, dass in den Notfallzentren der Kliniken auch niedergelassene Ärzte arbeiten sollten. Sie könnten dann die Fälle übernehmen, die nicht der Notfallbehandlung bedürften.
Kirsten Kappert-Gonther, Sprecherin für Gesundheitsförderung der Grünen, forderte, die Notfallversorgung in Deutschland zu reformieren. "Kein Mensch setzt sich aus Langeweile in die Notaufnahme. Gebühren sind der falsche Weg, weil sie Menschen aus finanziellen Gründen davon abhalten können, sich nötige Hilfe zu suchen."
Statt Eintrittsgelder zu verlangen, müsse die Notfallversorgung verbessert werden. "Viele der Probleme in den Notaufnahmen lassen sich lösen, wenn es ein klar verständliches Angebot aus einer Hand gibt: eine Notrufnummer, eine Anlaufstelle, eine einheitliche Ersteinschätzung", sagte Kappert-Gonther. Hierfür müssten Krankenhäuser und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte besser als bislang zusammen arbeiten.
Gedenken am achten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe

epd-bild / Friedrich Stark
Duisburg (epd). Zum achten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg wird am 23. Juli und 24. Juli der Opfer gedacht. Bei der öffentlichen Veranstaltung am 24. Juli an der Gedenkstätte wird unter anderem der Vorsitzende der "Stiftung-Duisburg 24.7.2010", Jürgen Thiesbonenkamp, eine kurze Ansprache halten und an die Geschehnisse vor acht Jahren erinnern, erklärte die Stiftung am 19. Juli. Der Unglückstunnel wird vom 23. Juli bis 24. Juli für den Autoverkehr gesperrt.
Bei der Gedenkveranstaltung wird es wieder 21 Glockenschläge für die Todesopfer der Katastrophe und einen Glockenschlag für die verletzten Überlebenden geben, wie die Stiftung mitteilte. Erwartet wird auch die frühere NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD), die inzwischen Mitglied im Kuratorium der Stiftung ist.
Gedenkgottesdienst für Angehörige
Am Vorabend findet bereits in der evangelischen Salvatorkirche in Duisburg ein nichtöffentlicher Gedenkgottesdienst für die Eltern und Angehörigen der Toten statt, wie die Stiftung weiter ankündigte. Nach dem Gottesdienst ist für den Unglücksort eine "Nacht der tausend Lichter" angekündigt, die öffentlich ist. Der Veranstalter der "Nacht der der tausend Lichter", der Verein "Bürger für Bürger", erwartet dazu bis zu 500 Teilnehmer.
Eltern und Angehörige der Opfer hätten sich im vergangenen Jahr von einer starken Medienpräsenz bei der Gedenkveranstaltung gestört gefühlt, erklärte Ombudsmann Jürgen Widera. Deshalb sind in diesem Jahr während der 30-minütigen Veranstaltung keine Foto- und Filmaufnahmen erlaubt. Inzwischen wird die Gedenkstätte am Unglücksort nach den Worten von Widera von einem Sozial-Unternehmen insoweit betreut, dass notwendige Reparaturen- und Aufräumarbeiten an der Gedenkstätte zeitnah ausgeführt und beseitigt werden können.
Verein weist Kritik zurück
Der Verein Lopa2010, der mehrere der Verletzten oder Traumatisierten vertritt, erklärte unterdessen, er werde "in diesem Jahr keine Unterstützung bei der offiziellen Veranstaltung der Stadt anbieten". Kritik des Vereins Lopa2010 an der "Stiftung Duisburg 24.7.2010" wies Thiesbonenkamp zurück. Bei den Vorwürfen sei pauschal von "Lügen" und "nicht eingehaltenen Versprechungen" die Rede, die aber nicht konkretisiert würden. Auch von einem "im Stich lassen" könne keine Rede sein. Thiesbonenkamp erklärte, es gebe Erwartungen, "die wir nicht unentwegt kommentieren können".
Bei der Katastrophe um das Musik-Event waren am 24. Juli 2010 nach einer Massenpanik insgesamt 21 Menschen ums Leben gekommen, mehrere hundert weitere Personen wurden verletzt. Der Strafprozess um die Loveparade-Katastrophe findet seit dem 8. Dezember vergangenen Jahres vor dem Duisburger Landgericht statt.
Sozialer Arbeitsmarkt soll Chancen für Langzeitarbeitslose verbessern

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Mit einer Förderung in Milliardenhöhe will die Bundesregierung die Jobchancen von Langzeitarbeitslosen verbessern. Den Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums für einen sozialen Arbeitsmarkt brachte das Kabinett am 18. Juli in Berlin auf den Weg. Menschen, die schon seit mehreren Jahren arbeitslos sind, sollen demnach bis zu fünf Jahre mit Lohnkostenzuschüssen gefördert werden. Voraussetzung ist, dass sie sozialversicherungspflichtig bei privaten Unternehmen, Kommunen oder gemeinnützigen Trägern beschäftigt werden.
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist das Ziel
Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erklärte: "Insbesondere diejenigen, die schon lange vergeblich nach Arbeit suchen, haben ohne Unterstützung absehbar keine realistische Chance auf einen regulären Arbeitsplatz." Ihnen solle mit dem Teilhabechancengesetz eine neue Perspektive eröffnet und der Weg in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung geebnet werden.
Die volle Förderung sollen dem Regelwerk zufolge Menschen erhalten, die mindestens sieben Jahre Arbeitslosengeld II bezogen haben. Im Referentenentwurf vom Juni war zunächst von mindestens sechs Jahren die Rede gewesen. Diese Schwelle wurde aber bei der Abstimmung mit den anderen Ministerien laut einer Sprecherin des Arbeitsministeriums angehoben. So hätten nach dem alten Referentenentwurf rund 1,1 Millionen Menschen zur potenziellen Zielgruppe gehört. Bei einem Mindestbezug von sieben Jahren sind es laut dem aktuellen Regierungsentwurf noch rund 800.000 Personen. Das letzte Wort über die Förderung hat aber das Jobcenter.
Für den geförderten Personenkreis sollen für zwei Jahre die Lohnkosten in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns komplett von der öffentlichen Hand übernommen werden. Danach sollen die Zuschüsse um zehn Prozent pro Jahr gekürzt und vom Arbeitgeber übernommen werden. Die Förderung läuft nach spätestens fünf Jahren aus.
Eine weitere Gruppe von Arbeitslosen, die gefördert werden soll, sind jene, die mindestens zwei Jahre Arbeitslosengeld II bekommen haben. Hier sieht der Entwurf eine Unterstützung für zwei Jahre vor. Dabei sollen im ersten Jahr 75 Prozent, im zweiten Jahr 50 Prozent zu den Lohnkosten hinzugeschossen werden. Bei dieser Zwei-Jahres-Förderung sind die Arbeitgeber verpflichtet, die Beschäftigung danach für mindestens ein halbes Jahr fortzusetzen. Die Lohnkostenzuschüsse sollen durch eine neue Regelung im Sozialgesetzbuch II ermöglich werden.
Vier Milliarden Euro eingeplant
Weiterbildungen sowie ein begleitendes Coaching sollen ebenfalls finanziert werden, damit die Geförderten möglichst langfristig in Arbeit bleiben. Vom Bund sind für die Maßnahmen bis zum Jahr 2022 vier Milliarden Euro eingeplant. Das Gesetz muss noch von Bundestag und Bundesrat gebilligt werden. Es soll im Januar 2019 in Kraft treten.
Sozialverbände begrüßten die Pläne, forderten jedoch Nachbesserungen. Die Arbeiterwohlfahrt lehnt die Orientierung an der Höhe des Mindestlohns ab. Der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler betonte, auch ein sozialer Arbeitsmarkt müsse "auf einer fairen und gerechten Bezahlung basieren, dessen Grundlage der Tarifvertrag" sei. Ähnlich äußerte sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Von der Diakonie hob Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik, die Sorge hervor, die Orientierung am Mindestlohn könnte auch eine "Einladung" sein, Mindestlohn statt Tariflohn zu zahlen.
Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert, erklärte, die geplante Regelung mache es tarifgebundenen Unternehmen, Kommunen und Wohlfahrtsverbänden schwerer, Arbeitsplätze bereitzustellen. Denn die Finanzierungslücke zwischen Mindestlohn und Tariflohn könnten sie oft nicht mit eigenen Mitteln schließen.
Der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte, dass Arbeitslose nicht erst nach sieben Jahren von der Maximalförderung profitieren dürften. Auch der Deutsche Caritasverband monierte, dass die Zielgruppe im Gesetz "eng gefasst" sei.
EKD setzt verstärkt auf Betreuungsangebote für Kleinkinder
Hannover, Münster (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat in den vergangenen Jahren ihre Betreuungsangebote für Kleinkinder ausgebaut. Die Zahl der Kindertagesstätten sei von 2011 bis 2015 um mehr als zwei Prozent gestiegen, teilte die EKD am 18. Juli in Hannover mit. Die EKD beruft sich auf Ergebnisse eines neuen Bildungsberichts, den sie zum zweiten Mal beim erziehungswissenschaftlichen Comenius-Institut in Münster in Auftrag gegeben hat.
Erste Datenauswertungen des Instituts aus dem Jahr 2008 hatten ergeben, dass evangelische Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren sowie der Ausbau ganztägiger Angebote im Vergleich zu öffentlichen oder nichtkonfessionellen Trägern unterrepräsentiert waren. Der Bericht zeige, "welchen Beitrag evangelische und katholische Einrichtungen zur frühkindlichen Bildung leisten", erklärte Thomas Böhme, stellvertretender Direktor des Comenius-Instituts.
Neben der Familie komme der Kindertagesbetreuung ein hohes Gewicht zu, sagte Böhm. Der Bericht "Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder" gibt laut EKD einen Überblick über strukturelle Entwicklungen, die Bildungsbeteiligung von Kindern und über das Personal. Er basiert auf einer Auswertung der Kinder- und Jugendhilfestatistik durch die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Technischen Universität Dortmund. Das Institut erinnert mit seinem Namen an den Pädagogen, Theologen und Philosophen Johann Amos Comenius (1592-1670) aus Mähren, der als Begründer der neuzeitlichen Erziehungslehre gilt.
"Jetzt bin ich frei" - Entschädigung für früheren Förderschüler

epd-bild/Claudia Rometsch
Köln (epd). Nenad M. strahlt über das ganze Gesicht. "Jetzt bin ich frei", kommentiert der 21-Jährige das Urteil des Landgerichts Köln, das ihm am 17. Juli Schadensersatz wegen jahrelanger falscher Beschulung auf der Förderschule zusprach. "Es ist ein bisschen das Gefühl wie letzter Schultag." Das wichtigste an der Gerichtsentscheidung sei für ihn die offizielle Bestätigung, dass er nicht geistig behindert ist.
Elf Jahre lang besuchte Nenad M. Förderschulen für Kinder mit geistiger Behinderung. "Gesunder Menschenverstand hätte ausgereicht, um zu sehen, dass er keine geistige Behinderung hat", sagt seine Rechtsanwältin Anne Quack. Nenad M. selbst hatte seine Lehrer immer wieder vergeblich darum gebeten, auf eine Regelschule gehen zu dürfen.
Falsche Berteilung von Grundschule
"Was ich erlebt habe, das wünsche ich keinem", sagt der junge Mann. Er habe auf der Förderschule nichts gelernt. Es sei nur darum gegangen, tägliche Abläufe wie Essen Vorbereiten oder Tische Abwischen zu erlernen. "Irgendwann bin ich dann nicht mehr hingegangen." Dass er ständig die Schule schwänzte, sei dann auch als Ausdruck seiner vermeintlichen Behinderung ausgelegt worden. "Ich habe mich dann irgendwann nicht mehr gekümmert", berichtet Nenad M.
Angefangen hatte seine Leidensgeschichte in Bayern, wo er als Grundschüler bei einem nonverbalen Einstufungstest gnadenlos durchfiel. Das Problem sei jedoch gewesen, dass er damals kein Deutsch verstanden habe, sagt Nenad M. Er habe einfach nicht gewusst, was man von ihm gewollt habe. Die Folge war eine elfjährige Förderschulkarriere.
Unterstützung von Kölner Elternverein Mittendrin
Eine Wende zum Besseren stellte sich für Nenad M. erst ein, als er in die Beratungsstelle des Kölner Elternvereins Mittendrin fand. Kurz vor seinem 18. Geburtstag setzte er mit Hilfe des Vereins durch, eine Berufsschule besuchen zu dürfen. Ein von seiner Rechtsanwältin veranlasster Intelligenztest ergab, dass er normal begabt ist. Er habe als Jahrgangsbester seinen Hauptschulabschluss erlangt, berichtet Quack.
"Das Lernen hat mir großen Spaß gemacht"
"Als ich dort Arbeitsblätter vorgelegt bekommen habe, war das für mich völlig neu", erinnert sich der junge Mann. "Aber ich habe mich da reingefunden. Das Lernen hat mir großen Spaß gemacht." Immer noch leidet Nenad M. allerdings unter den Folgen der jahrelangen falschen Beschulung. "Es verfolgt mich manchmal in meinen Träumen", sagt er. Und er habe teilweise immer noch große Angst, tatsächlich geistig behindert zu sein. Wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung ist Nenad M. in psychotherapeutischer Behandlung. "Das hat mir auch schon geholfen", sagt er.
Seinen größten Wunsch, eine Ausbildung als Automobilkaufmann zu machen, kann er vorerst nicht verwirklichen. "Dafür hätte ich einen Realschulabschluss gebraucht." Sein Ziel ist nun, einen Ausbildungsplatz als Einzelhandelskaufmann zu bekommen. Derzeit arbeitet er als Aushilfe in einem Supermarkt und hofft, dort in eine Ausbildung übernommen zu werden. Die Arbeit helfe ihm, sagt Nenad M. "Ich lerne jetzt langsam, die Vergangenheit ruhen zu lassen."
Der Ball ist rund und laut beim Blindentennis

epd-bild/Christa Roth
Berlin (epd). "Nun mach schon!", sagen sie und lachen. Es ist der Geburtstag von Dennis Scherers Mutter, als der damals 17-Jährige beim Fotografieren der Partygäste den Nebel auf seinem rechten Auge bemerkt. "Bis dahin war mir gar nicht klar gewesen, dass etwas nicht stimmt", erinnert er sich. "Mein linkes Auge hatte die Sehschwäche einfach ausgeglichen."
Wenig später fahren beide von Berlin nach Tübingen, zu einer Spezialistin. Es stellt sich heraus, dass Scherer wohl an einer Erbkrankheit leidet. Seine Mutter hatte mit Anfang 30 ihr Augenlicht verloren. Warum, das wird auch ihr erst jetzt offenkundig.
Es sind düstere Tage in diesem Oktober 2002. Zwischen Mitte und Ende Dezember verschlechtert sich Scherers Sicht auch auf dem linken Auge derart, dass er kaum noch etwas erkennen kann. Er ist jetzt auf beiden Augen fast blind. Fast zehn Jahre lang hatte der junge Mann mit dem dichten rotblonden Haar zu diesem Zeitpunkt Tennis gespielt. Die präzise Hand-Augen-Koordination, die nötig ist, um auf dem Feld gegen seinen Gegner zu bestehen, beherrschte der ehrgeizige Athlet in ihm nicht nur, sondern genau das schätzte er an diesem Sport so sehr.
"Mit der Diagnose war das erst mal vorbei. Mein neuer 'Sport'", ergänzt er leicht zynisch, "bestand darin, mich in dieser ungewohnten Situation zurechtzufinden." Bald wird klar, dass eine plötzliche Unterversorgung des Sehnervs Ursache und unlösbares Problem zugleich ist.
Heute zittern eine Art rot-grün flackernde Lichtimpulse auf dunklem Hintergrund, wo einst die Mitte von Scherers Blickpunkt war. Am Rand lassen sich vage Szenen ausmachen, sagt er, "aber nur wenn sie sehr kontrastreich sind und ich nah dran bin." Unterteilt in winzige Momentaufnahmen flimmert das bildhafte Geschehen an ihm vorbei, bevor er es wirklich erfassen kann.
Erfindung eines Japaners
Aber er spielt wieder Tennis - Blindentennis. Möglich gemacht hat dies Miyoshi Takei. Als blinder, aber sportbegeisteter Teenager kreierte der Japaner 1984 einen schaumstoffüberzogenen Tennisball, in den ein mit metallischen Kügelchen gefüllter Golfball eingenäht wurde. Dank des rasselnden Geräuschs bei der Bodenberührung konnte Takei den Ball verorten und returnieren. Geboren war das Blindentennis.
Der rasselnde Ball fliegt etwas langsamer und darf bei blinden Spielern dreimal im eigenen Feld aufspringen, bei hochgradig Sehbehinderten zweimal, ehe er wieder zurück übers Netz geschlagen werden muss. Das kleinere Feld entspricht einem Junioren-Court, bei dem die Begrenzungen mit einer starken Schnur nachgezogen und von einem rauem Band überklebt sind, um mit den Füßen ertastet werden zu können. Kürzere Juniorenschläger erhöhen die Trefferquote. 2016 fand in Köln das erste deutsche Blindentenniscamp statt, seitdem breitet sich der Sport zunehmend auch in Deutschland aus.
In Berlin-Steglitz liefern sich der blinde Dennis Scherer und der sehende Victor Borchers einen Schlagabtausch, als dort Mitte Mai ein internationales Blindentenniscamp stattfindet. Das Tempo ist enorm, laut peitscht der Ball durch die Luft. Am anderen Ende der Halle hält Monika Dubiel inne und horcht. "Wow, das klingt ja gefährlich!", sagt die 30-jährige Polin, lacht kurz unsicher auf. Vorsichtig geht sie an der Wand entlang, dem Ballgeräusch entgegen.
Neues Körpergefühl
Für Vollblinde wie Dubiel eröffnet sich mit dem Blindentennis ein vollkommen neues Körpergefühl, wie sie sagt. "Die Orientierung auf dem Spielfeld nicht zu verlieren, während man sich gleichzeitig auf Haltung, Gegner und Ball konzentrieren muss, ist schon eine Herausforderung." Dass sie ohne Sehsinn unterwegs ist, kennt sie nicht anders. Neu ist ihr das Spiel an sich. "In Warschau trainieren wir, ohne wirklich gegeneinander anzutreten."
Wie ihr geht es auch den anderen zehn Teilnehmern des Blindentenniscamps: Sie kommen aus Polen, Großbritannien und Italien, wollen Neues ausprobieren, Orientierung und Sportlichkeit verbessern. Ihre eingeschränkte, verlorene oder nie dagewesene Sehkraft durch flinke Bewegungen und ein aufmerksames Ohr wettmachen. Nebenbei beweisen sie sich und anderen, was alles möglich ist.
Gespielt wird nicht nach Kompetenz oder Altersklasse, sondern auf Basis des nicht oder noch vorhandenen Sehvermögens. "Wir wollen mit diesem Workshop nicht nur zum Zeitvertreib an den Sport heranführen", erklärt Dennis Scherer. "Langfristig wollen wir eine Community aufbauen."
Scherer hat an der Freien Universität Politik studiert und widmet sich heute als Trainer wieder ganz seinem Sport. Während des Workshops ist er "Betreuer, Spieler und Coach in einer Person", sagt er und klingt so stolz wie müde dabei. Daneben versuchen zwei weitere sehende Tennistrainer, sehbehinderten und blinden Sportlern das richtige Ballgefühl zu vermitteln. "Aber der Zugang ist natürlich ein anderer", sagt Scherer.
Philipp Deininger, Inhaber der Tennisschule Netzroller, kümmert sich beim Tennisklub Blau-Gold Steglitz hauptamtlich um Kinder, Jugendliche und Erwachsene - alle in der Regel sehend. Mit Scherer gemeinsam Übungen für blinde Spieler zu konzipieren, ist für ihn eine Herausforderung, die er gern annimmt, wie er sagt: "Da ich durch eine Pigmentstörung als Baby fast blind war und erst nach und nach sehen gelernt habe, ist mir das Ganze ein persönliches Anliegen."
Und Scherer? Es gibt immer wieder Momente, in denen der Berliner kurz mit seinem Schicksal hadert, sagt er. Doch statt seine Energie in Frustration zu ertränken, will er lieber dafür kämpfen, in Deutschland einen normalen Tennisbetrieb für blinde Sportler mit aufzubauen. Das bringe langfristig allen mehr Lebensqualität, sagt er, auch wenn der Weg dorthin noch weit sei.
Internationale Konferenz befasst sich mit Prader-Willi-Syndrom
Bad Oeynhausen, München (epd). Die seltene geistige Behinderung und Esssucht Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist Thema einer internationalen Fachtagung vom 28. bis 30. August in München. Es gebe bereits mehr als 120 Anmeldungen aus 26 Ländern, wie die Diakonische Stiftung Wittekindshof am 17. Juli in Bad Oeynhausen mitteilte. Die internationalen Experten kommen demnach unter anderem aus Australien, Holland, den USA und Chile sowie aus Vietnam, Katar, dem Irak und verschiedenen osteuropäischen Ländern.
Auf dem Programm stehen Vorträge zum aktuellen Forschungsstand, zur Elternarbeit und Motivation von Mitarbeitern sowie Workshops zur spezifischen Frühförderung sowie über die Bedürfnisse von älter werdenden Menschen mit dem Prader-Willi-Syndrom. Zu dem mittlerweile fünften Kongress sind den Angaben nach Mitarbeiter aus Wohnangeboten, Kindertagesstätten und Schulen, Reha-Einrichtungen und aus dem Gesundheitswesen eingeladen. Veranstalter ist die Internationale PWS-Vereinigung mit Unterstützung unter anderem des PWS-Instituts Deutschland und der Diakonischen Stiftung Wittekindshof.
Das Prader-Willi-Syndrom, benannt nach zwei Schweizer Wissenschaftlern, beruht auf einer seltenen Chromosomenveränderung, die zu Stoffwechselveränderungen führt. Die Betroffen sind süchtig nach Essen. Typische Merkmale sind extremes Übergewicht, spontane Stimmungsschwankungen bis hin zu aggressivem Verhalten und eine leichte Intelligenzminderung.
Merkel besucht das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"
Köln (epd). Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das bundesweite Hilfe- und Beratungstelefon "Gewalt gegen Frauen" als eine "ganz wichtige und hervorragende Einrichtung" gewürdigt. "Diese Nummer kann gar nicht bekannt genug sein", sagte die CDU-Politikerin am 18. Juli in Köln. Das sei eine sehr wichtige Nummer für Frauen, die sich hier melden könnten. Das Hilfetelefon ist täglich kostenfrei erreichbar. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) lobte das Beratungsangebot als einen "ersten Einstieg zur Befreiung aus der Gewalt". Seit 2013 seien bereits 150.000 Beratungen durchgeführt worden.
Merkel würdigte den Einsatz der Beraterinnen und Berater: "Das ist eine Facette der Menschlichkeit unserer Gesellschaft." Nach Angaben des Bundesamts ist jede dritte Frau in Deutschland von sexueller oder körperlicher Gewalt betroffen. Ein Viertel aller Frauen erleben diese Gewalt in ihrer Partnerschaft. Allerdings nutzen nur 20 Prozent aller Frauen, die Gewalt erfahren, die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote.
Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" startete im März 2013 und ist bundesweit das erste 24-Stunden-Beratungsangebot, das vertraulich und kostenfrei Hilfe und Unterstützung für Betroffene bietet. Das Angebot ist mehrsprachig und steht in 17 Fremdsprachen zur Verfügung. Das Hilfetelefon ist eine Einrichtung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln.
Förderanträge aus Soziallotterie können ab August gestellt werden
Essen (epd). Für die neue Soziallotterie "Bildungs-Chancen" können ab dem 1. August Förderanträge eingereicht werden. Mit den Einnahmen aus der Essener Lotterie sollen gemeinnützige Projekte aus dem Bildungsbereich unterstützt werden, wie der Stifterverband, die SOS-Kinderdörfer sowie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am 19. Juli in Essen mitteilten. Die geförderten Projekte sollen dazu beitragen, dass Menschen jeden Alters unabhängig von ihrer Herkunft oder sozialen Situation ihr Potenzial erkennen und sich entfalten können - das Spektrum reiche von Initiativen aus der frühkindlichen Erziehung bis zur Erwachsenenbildung, hieß es.
Die "Bildungs-Chancen-Lotterie" ist den Angaben zufolge die erste Soziallotterie, die ihren Fokus auf die Förderung von Bildungsprojekten legt. Etwa 30 Prozent der Einnahmen der Lotterie sollen in entsprechende Projekte fließen. Davon sollen ebenso Vorhaben der drei Initiatoren wie auch externe Initiativen profitieren.
Bei der "Bildungs-Chancen-Lotterie" gibt es zwei Losarten und die Chance auf einen Hauptgewinn in Höhe von zwei Millionen Euro. Die Lotterie kann zunächst ausschließlich online gespielt werden, ab dem dritten Quartal dieses Jahres sollen Lose auch über die Filialen der Drogeriekette Rossmann angeboten werden. Die Ziehungen finden jeweils dienstags statt - Premiere war am 3. Juli.
Medien & Kultur
"Was, Orgel? Warum?"

epd-bild/Andrea Enderlein
Nierstein (epd). Auf diesen Morgen hatte sich Vanessa Roth ein halbes Jahr lang vorbereitet. Um Punkt zehn Uhr hören im rheinland-pfälzischen Nierstein die Glocken der evangelischen Kirche auf zu läuten. Unten in den Bänken ist es still, und für die Gymnasiastin oben auf der Orgelempore wird es jetzt ernst. Die 18-Jährige hat sich wieder die dunklen Herren-Tanzschuhe angezogen, weil sie mit denen am besten die Fußpedale drücken kann. Zum ersten Mal spielt sie an diesem sonnigen Sonntag an der Kirchenorgel einen kompletten Gottesdienst - mit einem Bach-Präludium zum Einzug des Pfarrers, allen Gemeindeliedern und einem Nachspiel.
Kirchenmusik ohne Orgel ist in evangelischen und katholischen Kirchen nach wie vor kaum vorstellbar, jedenfalls in Deutschland nicht. Da oft aber nur an bedeutenden Kirchen professionelle Kirchenmusiker angestellt sind, bleiben viele Gemeinden auf das Engagement ihrer nebenamtlichen Organisten angewiesen - und darauf, dass sich immer genügend Nachwuchs-Musiker finden, die sonntags verlässlich in die Kirche kommen und vorher regelmäßig üben. Aber genau das ist vielerorts ein Problem.
"Meine Eltern waren erst einmal etwas perplex"
Vanessa Roth hat völlig unverhofft ihre neue Leidenschaft entdeckt. Im Konfirmandenunterricht gab es eine "Orgelführung" für die Gruppe. Kurze Zeit später, das war vor mittlerweile knapp drei Jahren, fragte der Gemeindepfarrer, ob jemand von den Konfirmanden Orgel lernen wolle, und die Schülerin sagte sofort zu: "Meine Eltern waren erst einmal etwas perplex, manche Freunde fragten: 'Was, Orgel? Warum?'" Früher hatte Vanessa Roth eine Zeit lang Klavierunterricht gehabt, aber den hatte sie damals bereits wieder aufgegeben.
Die Niersteiner Orgelschülerin hört - "wie jeder normale Jugendliche" - auch moderne Musik, mag aber ebenso Klassik und Werke aus der Romantik. Vor allem die Vielfalt der Orgelklänge fasziniert sie an ihrem neuen Instrument. Mit seinen teils meterhohen Pfeifen ist es um ein Vielfaches größer als sie selbst. "Man kann etwas Ruhiges, Melancholisches spielen, oder etwas Festliches und Triumphales." In den Wochen vor ihrem ersten kompletten Gottesdienst hat sie so manche Verabredung mit Freundinnen abgesagt, denn fast täglich kam sie zum Üben in die Kirche ihres Heimatstädtchens südlich von Mainz.
Die Kirchen könnten noch weitaus mehr junge Leute mit Interesse am Orgelspielen gebrauchen. "Wir haben massive Probleme, weil immer weniger Menschen sich verpflichten wollen", räumt die Landeskirchenmusikdirektorin der hessen-nassauischen Landeskirche, Christa Kirschbaum, ein. Insbesondere in der Weihnachtszeit werde es immer schwieriger, noch genügend Vertretungskräfte für alle Gottesdienste zu rekrutieren.
Solides Taschengeld
Dabei hätten Organisten nicht nur ein wunderbares Hobby, sondern auch interessante Möglichkeiten für einen Nebenverdienst, wirbt sie. Schon Jugendliche könnten sich mit dem Orgelspielen ein solides Taschengeld verdienen: "Und das ist sicherlich schöner, als abends zu kellnern."
Carsten Wiebusch, Professor für Orgelmusik und Organist in Karlsruhe, bedauert das Bild, das in der Öffentlichkeit gelegentlich von Kirchenmusikern gezeichnet werde. Wer glaube, Kirchenorgeln seien für junge Menschen nicht attraktiv, liege völlig falsch: "Ich konnte mir schon als Jugendlicher den Schlüssel von einer großen Kirche holen und in einem großen dunklen Raum 'Krach' machen. Für Jungs und Mädchen mit 15 oder 16 ist das eigentlich eine tolle Sache." Und dann sei die Orgel eben im Unterschied zum Klavier auch noch ein äußerst komplizierter Mechanismus mit all den Schaltern und Knöpfen, deren Funktionen es zu entdecken gelte.
Wiebusch fordert eine aktivere Nachwuchswerbung in den Kirchen. "Viele denken, dass sie nie an die Orgel ihrer Kirche herangelassen würden", sagt er, "dabei ist das ein ganz normales Instrument, das nicht nur Auserwählte spielen."
Auch die Berufschancen für hauptamtliche Organisten seien angesichts bevorstehender Pensionierungswellen längst wieder gut. Noch vor einigen Jahren hätten nicht einmal alle Kirchenmusik-Studienplätze besetzt werden können. Es habe so wenige Interessenten gegeben, dass das hohe Niveau der Ausbildung gefährdet gewesen sei. Inzwischen habe sich die Situation wieder entspannt.
Entspannung nach dem Schlussakkord
Vanessa Roth sieht ihre Zukunft nicht als Berufsmusikerin, sondern denkt an ein Jura-Studium oder vielleicht sogar an eine Laufbahn bei der Polizei. Eine Prüfung will sie trotzdem ablegen, um künftig häufiger als nebenamtliche Vertretungs-Organistin spielen zu können.
Das Debüt in der Martinskirche von Nierstein am Rhein hat sie in der Entscheidung bestätigt. Mehrfach gibt es an diesem Morgen zwischendurch Applaus von der Gemeinde. Aber erst nach ihrem langgezogenen Schlussakkord atmet sie hörbar auf und kann entspannt lächeln. Ziemlich aufregend war die Premiere nämlich trotz aller Vorbereitung doch.
Orgel des Monats zieht von Dortmund nach Gronau um
Gronau/Hannover (epd). Die Orgel des Monats Juli der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) erklingt künftig im westfälischen Gronau. Die ursprünglich in einer inzwischen stillgelegten Kirche in Dortmund beheimatete historische Sauer-Orgel werde derzeit umfassend saniert, teilte die EKD am 16. Juli in Hannover mit. Anschließend werde das 1904 von dem berühmten Orgelbauer Wilhelm Sauer (1831-1916) errichtete Instrument in der Stadtkirche Gronau seinen Platz finden. Die von der EKD gegründete Stiftung Orgelklang fördert das Projekt mit 5.000 Euro.
Die 13 Tonnen schwere Orgel gilt den Angaben nach als das bedeutendste spätromantische Instrument seiner Größe im Westen Deutschlands. Ein Sachverständiger habe der fast vollständig original erhaltenen Orgel noch 2016 eine "einzigartige historische Klangsubstanz" bescheinigt, erklärte die EKD.
Außer der Renovierung der Orgel ist den Angaben zufolge auch eine Verstärkung der Empore der Stadtkirche nötig, damit diese künftig das Instrument tragen kann. Insgesamt werden für dessen Umzug von Dortmund nach Gronau 650.000 Euro aufgewendet. Neben staatlichen und kirchlichen Zuschüssen haben demnach auch 1.300 Bürger für die Sauer-Orgel gespendet, darunter auch der Sänger Udo Lindenberg, der in der Stadtkirche Gronau getauft wurde.
Die Stiftung Orgelklang fördert die Erhaltung und Wiederherstellung historischer Orgeln in evangelischen Kirchen und stellt jeden Monat eine "Orgel des Monats" vor. In diesem Jahr sollen insgesamt 14 Projekte in einem Gesamtumfang von 64.000 Euro gefördert werden. Seit 2010 hat die Stiftung nach eigenen Angaben 173 Förderzusagen über insgesamt mehr als 1,3 Millionen Euro gegeben.
Leipziger Bachpreisträger 2018 ausgezeichnet
Leipzig (epd). Im internationalen Leipziger Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb sind Auszeichnungen in drei Instrumentenkategorien an neun junge Musiker vergeben worden. Der erste Preis ging im Fach Klavier an Rachel Naomi Kudo aus den USA, im Fach Cembalo an Avinoam Shalev aus Israel und im Fach Violine an Maria Wloszczowska aus Polen, teilte das Bach-Archiv Leipzig zur Preisverleihung am 21. Juli mit. In allen Fächern wurden jeweils auch zwei weitere Bachpreisträger geehrt.
Die Hauptpreise sind mit jeweils 10.000 Euro, die zweiten Preise mit je 7.500 Euro und die dritten Preise mit je 5.000 Euro dotiert. Zusätzlich wurden verschiedene Sonderpreise vergeben, darunter Publikumspreise und ein Sonderpreis des Leipziger Barockorchesters. Zum Abschluss des elftägigen Wettbewerbs stand am Samstag ein Preisträgerkonzert auf dem Programm.
Die 31-jährige Rachel Naomi Kudo studierte an der Juilliard School und dem Mannes College of Music in New York. Der 29-jährige Avinoam Shalev wurde an der Buchmann-Mehta School of Music in Tel Aviv und der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ausgebildet. Die 26-jährige Maria Wloszczowska studierte an der Musikuniversität Warschau, am Conservatoire Royal de Bruxelles sowie an der Royal Academy of Music und der Guildhall School of Music and Drama in London.
An dem Wettbewerb nahmen den Angaben zufolge 105 junge Musikerinnen und Musiker aus 34 Ländern teil. 18 von ihnen gingen am 20. Juli ins Finale. Der internationale Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb wird seit 1950 in der Regel alle zwei Jahre ausgerichtet und fand zum 21. Mal in Leipzig statt. Er gilt als eine der bedeutendsten Plattformen für Musikerinnen und Musiker. Der Jury gehören aktuell 21 Interpreten aus zwölf Ländern an.
Beworben hatten sich nach Angaben der Veranstalter 228 Musiker. Ausgesucht wurden für den Wettbewerb 44 Pianisten, 37 Cembalisten und 24 Violinisten.
Römisch-Germanisches Museum zeigt seine "BodenSchätze"

epd-bild/Jörn Neumann
Köln (epd). Schon immer war es so, dass die Kölner, sobald sie ein paar Spatenstiche taten, auf Relikte untergegangener Zivilisationen stießen. Einige besonders beeindruckende Funde stehen jetzt im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung im Römisch-Germanischen Museum. Die Sonderschau "BodenSchätze" widmet sich bis zum 31. Dezember der Stadtarchäologie.
Es geht unter anderem um die erste vollständig ausgegrabene jungsteinzeitliche Siedlung Deutschlands in Köln-Lindenthal, die bedeutendste römische Marinebasis nördlich der Alpen in Köln-Alteburg und um die römische Stadt: In ihren Anfangstagen, als sie noch Oppidum Ubiorum hieß, die Siedlung der Ubier, und zu ihrer Blütezeit, als sie sich Colonia Claudia Ara Agrippinensium nannte. Thema sind auch das spätrömische Kastell Divitia-Deutz und die mittelalterliche Wirtschaftsmetropole.
2.000-jährige Stadtgeschichte
"Köln ist die einzige Millionenstadt Deutschlands, die auf eine zweitausendjährige Stadtgeschichte blickt", sagt Museumsdirektor Marcus Trier. Neben Geschosskugeln als Schleudermaterial, römischen Tonkrügen und Resten von Wandmalereien ist etwa auch ein frei stehendes Porträtmedaillon aus der Zeit um 40 n. Chr. zu sehen, das erst im Frühjahr bei Ausgrabungen in der Severinstraße geborgen wurde und Teil eines Grabmals war.
Aus der Römerzeit ist in Köln überirdisch nicht allzu viel stehen geblieben, denn in ihrer langen Geschichte ist die Stadt immer wieder abgerissen und neu gebaut worden. "Schon die Römer haben Baumaterial recycelt und aus alten Gebäuden neue gemacht. Denn Stein war kostbar", so Trier. Jedes Köln steht auf einem älteren Köln. Wer etwas über die früheren Inkarnationen Kölns erfahren will, muss deshalb unter der Erde suchen. So tauchte 1941, mitten im Krieg, beim Ausheben eines Luftschutzbunkers, ein riesiger römischer Fußboden auf, das Dionysosmosaik. Darüber wurde Anfang der 1970er Jahre das Römisch-Germanische Museum errichtet, am 4. März 1974 war die Eröffnung.
Letzte große Ausstellung vor Sanierung
Nach 44 Jahren ist das Museum nun selbst ein Denkmal - und im Übrigen sanierungsbedürftig. "BodenSchätze" sei die letzte große Ausstellung vor dem Umzug ins Ausweichquartier, erklärt die Kölner Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach. Nach dieser Abschiedsschau zieht das Museum zum 1. Januar für mehrere Jahre im Belgischen Haus gegenüber dem Rautenstrauch-Joest-Museum ein. Die Ausstellungsfläche wird sich dadurch stark verkleinern. Nach derzeitiger Planung wird die Sanierung bis 2024/25 dauern, also bis zu sechs Jahre. "Aber das RGM wird auch im Interim weiter gut funktionieren", so Laugwitz-Aulbach.
Von "Musentempeln" zu Orten der Begegnung
Am bewährten Konzept des früheren Generaldirektors der Kölner Museen, Hugo Borger (1925-2004), solle aber auch im sanierten Museum festgehalten werden, kündigte Trier an. Es habe schließlich für zahllose Museen im In- und Ausland Pate gestanden. Borger wollte Schwellenangst abbauen und durch draußen aufgestellte Denkmäler Neugier wecken und Passanten in das Museum hineinziehen. Er wollte den Museen ihre andächtige Stille nehmen und sie von "Musentempeln" zu Orten der Begegnung und des Diskurses machen. Auch ging es ihm darum zu zeigen, dass die Antike noch heute im Alltag eines jeden Kölners präsent ist - allein schon in der Straßenführung der Innenstadt, die immer noch auf die Römer zurückgeht.
Das Foyer des Museums soll künftig erheblich größer werden, außerdem entsteht ein größerer Raum für Sonderausstellungen. Das Spektrum der Sammlung wird bis in die ottonische Zeit im 10. Jahrhundert ausgeweitet. Geplant sind weiter ein Bereich "Alltagsleben" und eine Gräberstraße. Bisher fehlende Themen wie das römische Flottenlager, der römische Hafen, das Kastell Deutz oder das Handwerk im frühen Mittelalter sollen angemessene Berücksichtigung finden. Insofern gibt die Ausstellung "BodenSchätze" schon einen Vorgeschmack auf das künftige, sanierte Museum.
Ausstellung zeigt Bauhaus-Klassiker aus Bethel
Bielefeld (epd). Die Historische Sammlung Bethel in Bielefeld stimmt in ihrer aktuellen Ausstellung auf das anstehende 100-jährige Gründungsjubiläum des Bauhauses 2019 ein. Unter dem Titel "Auf der Suche nach neuem Design - Die Bauhausidee und die Folgen" werden bis 13. September Arbeiten und Entwürfe der Textildesignerin Benita Koch-Otte (1892-1976) gezeigt, die nach ihrer Zeit am Bauhaus über 20 Jahre die Handweberei der v. Bodelschwinghschen Stiftungen leitete, wie die Stiftungen mitteilten. Daneben sind Sach- und Porträtaufnahmen ihres Ehemannes, des Fotografen Heinrich Koch (1896-1934), aus den Jahren 1929 bis 1933 zu sehen.
Vervollständigt wird die Sonderschau mit Bauhaus-Klassikern aus dem Fundus der Brockensammlung, der Sammel- und Wiederverwertungsstelle Bethels in Bielefeld, wie es hieß. Der Bestand reicht von Stühlen und Leuchten über Porzellangeschirr bis hin zu Teppichen. Hintergrundtexte zu den Exponaten informieren über das Wirken des Bauhauses, das vor 100 Jahren in nur 14 Jahren seines Bestehens mit sachlichen und funktionalem Objekten die Designwelt revolutionierte.
Julia v. Bodelschwingh wollte es modern
Es sei vor allem Julia v. Bodelschwingh und ihrem Einfluss als Ehefrau des damaligen Bethel-Leiters Fritz v. Bodelschwingh zu verdanken, dass der moderne Stil in den 1930er Jahren im eher konservativen Bethel Einzug hielt, sagte die Leiterin der Historischen Sammlung, Bärbel Bitter. Sie habe Benita Koch-Otte 1934 nach Bielefeld geholt, damit die Künstlerin in der kurz zuvor gegründeten Handweberei mit Bethel-Bewohnerinnen und - Bewohnern arbeiten sollte. "Julia v. Bodelschwingh wollte weg von den dunklen Farben und verschnörkelten Formen der Zeit."
Handweberei arbeitet noch heute nach Entwürfen von Benita Koch-Otte
Der Betrieb sei nicht groß gewesen, habe der Textildesignerin aber die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen auch nach Machtergreifung der Nationalsozialisten weiter umzusetzen, erzählte die Bethel-Historikerin. Auch heute noch würden im Betheler Textilhaus Wandteppiche und Geschirrtücher nach Entwürfen der Designerin, die bis zu ihrem Tod in Bielefeld lebte, handgewebt.
Im kommendenen Jahr wird der 100. Geburtstag des Bauhauses deutschlandweit gefeiert. Der Berliner Architekt Walter Gropius hatte das Bauhaus 1919 als interdisziplinär arbeitende Hochschule für Gestaltung in Weimar gegründet. Sie galt als innovative Ideenschmiede und als Experimentierfeld für Kreative. 1925 zog die Kunstschule nach Dessau, 1932 nach Berlin, wo sie 1933 von den Nationalsozialisten geschlossen wurde. Das Bauhaus gilt als einflussreichste Stilepoche in den Bereichen Architektur, Kunst und Design im 20. Jahrhundert.
Vom Riesen Hüklüt bis zur Künstlerkolonie

epd-bild / Alasdair Jardine
Worpswede (epd). Was wäre Worpswede ohne die Maler, die dort vor fast 130 Jahren eine Künstlerkolonie gegründet haben? Wahrscheinlich ein verschlafenes Dorf wie viele andere in der Nähe von Bremen, idyllisch am Weyerberg gelegen, umgeben vom Teufelsmoor. So aber machte der Ort Karriere und ist heute die wohl bekannteste Künstlerkolonie Deutschlands, was besonders an Wochenenden viele Touristen anlockt. Doch es gibt ein Leben vor der Künstlerkolonie, denn Worpswede wurde vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnt.
Wer sich auf die Suche nach den ersten Siedlungsspuren machen will, sollte am Fuß des Weyerbergs beginnen, in der Bauernreihe, wie die Straße heute heißt. Hier siedelten acht große Höfe mit 300 bis 400 Hektar Grund, die 1218 unter dem Namen "Worpensweede" dokumentiert wurden. "Das waren ziemlich reiche Bauern, der Ort war gut gewählt", erzählt Hans-Hermann Hubert, Fremdenführer, Ortsarchivar und Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins. "Quellen lieferten frisches Wasser, sandige Böden am Hang des Weyerbergs erlaubten Ackerbau, den das umliegende Moor nicht zuließ."
Auch der Abstand zum nächstgelegenen Fluss war wichtig. Einerseits war er klein genug, um die Hamme als Fischrevier und Verkehrsader nutzen zu können. Andererseits aber auch groß genug, um vor Hochwasser geschützt zu sein. "Insellage und geistliche Grundherrschaft, die ab 1550 lutherisch ausgerichtet war, boten relativen Schutz vor adeligen Fehden und Plünderungen, so dass die bäuerliche Dorfgemeinschaft lange in Frieden wirtschaften konnte", erläutert Hubert.
Wer nach den Gründungsgeschichten des Dorfes forscht, stößt auch unweigerlich auf die alte Volkssage vom Riesen Hüklüt. Der Menschenfresser soll durch eine List ins Teufelsmoor gelockt worden sein und warf mit Sand um sich, der sich heute noch als Weyerberg knapp 55 Meter über die umliegende Moorlandschaft erhebt - mit einer grünen Waldkuppe gekrönt.
Eigentlich gehört auch die letzte große Eiszeit zu den Meilensteinen der Worpsweder Entstehungsgeschichte. Denn in Wahrheit war sie es, die mit ihren Schmelzwassern eine Insel aus Sand, Lehm und Ton formte. Viel später waren es dann der einigermaßen glimpflich überstandene Dreißigjährige Krieg und vor allem die Moorkolonisation unter Jürgen Christian Findorff (1720-1792), die die Region prägten. Und dann natürlich das Jahr 1889, die Stunde null für die Künstlerkolonie, Sehnsuchtsort der Freilichtmalerei außerhalb von Akademien und Ateliers.
"Das Dorf und die Kunst gehören zusammen"
Die Maler waren von Menschen, Licht und Farben fasziniert, die sie hier trafen. So schwärmte Fritz Mackensen, Pionier der Künstlerkolonie, über die Wolken: "Die köstlichsten Gebilde leuchtendster Glut in zahllosen Formenhaufen gebannt, darunter dunkler Acker mit krapprotem Buchweizenstoppel und in dunkler Weite satte Formen goldumrändert, blitzende Wasserläufe, auf denen schwarze Segel ihre Bahnen zogen." Er war es auch, der über Worpswede sagte: "Es gibt viele Weltstädte, aber nur ein Weltdorf."
"Das Dorf und die Kunst gehören zusammen", betont Bürgermeister Stefan Schwenke, kommunales Oberhaupt des 5.400-Seelen-Ortes und ein waschechter "Weyerbarger Jung". Die Worpsweder Mühle, heute eines der Wahrzeichen des Ortes, wurde 1888 von seinem Ururgroßvater gekauft und von seinem Vater als letztem Windmüller Worpswedes betrieben.
1895 feierten die Worpsweder Maler mit ihrer Ausstellung im Münchner Glaspalast den künstlerischen Durchbruch und begründeten den Mythos der Kolonie, dem Kunsttouristen in den Galerien und Museen des Ortes seither nachspüren. Knapp vier Jahrzehnte später kam der Nationalsozialismus, der die Dorfgemeinschaft wie andernorts auch in Täter, Mitläufer und Opfer teilte, wie Hubert formuliert. "Prominentestes Mitglied der NSDAP war der Mitbegründer der Künstlerkolonie, Fritz Mackensen."
Mittlerweile ist das Dorf staatlich anerkannter Erholungsort und bietet immer noch die Chance, das berühmte Licht über dem Weyerberg zu entdecken. "Aber Vorsicht", rät Hubert und schmunzelt: "Wer sich nur ins Café setzt und Kaffeepreise vergleicht, hat von der Schönheit Worpswedes und der ruhigen Landschaft drumherum nichts gesehen."
Karlsruhe bestätigt Rundfunkbeitrag weitgehend

epd-bild/Norbert Neetz
Karlsruhe (epd). Das Bundesverfassungsgericht hat den Ländern am 18. Juli nur eine kleine Nachbesserung beim Rundfunkbeitrag aufgegeben. Grundsätzlich hält das oberste Gericht die Abgabe für ARD, ZDF und Deutschlandradio - 17,50 Euro pro Monat und Haushalt - für verfassungskonform. Wer zwei Wohnungen hat, darf allerdings nicht doppelt belastet werden. Das müssen die Bundesländer neu regeln.
Für die meisten Beitragszahler wie auch für Unternehmen bleibt bei der Beitragspflicht nach dem Karlsruher Urteil nun alles wie gehabt. Das oberste deutsche Gericht gab den insgesamt vier Verfassungsbeschwerden gegen den Rundfunkbeitrag damit in lediglich einem Punkt recht.
Kläger Bernhard Wietschorke, der gegen die Zahlungspflicht für Zweitwohnungen geklagt hatte, zeigte sich unzufrieden mit dem Richterspruch. Alleinlebende würden nach dem Richterspruch grundsätzlich weiterhin benachteiligt, weil sie genauso viel zahlen müssen wie Familien oder Wohngemeinschaften, sagte Wietschorke, der als Berufspendler an zwei Orten alleine wohnt. "Eine Erhebung pro Kopf, die das Gericht ja auch als ausdrücklich verfassungskonform bezeichnet hat, finde ich nach wie vor gerechter", sagte er. Und entziehen könne man sich der Beitragspflicht auch weiterhin nicht, kritisierte Wietschorke.
Richter: Keine verkappte Steuer
Grundsätzlich muss der Beitrag nicht - wie die frühere "GEZ-Gebühr" - an den Besitz von Empfangsgeräten geknüpft sein, entschieden die Richter. Das von den Ländern gewählte Modell der Haushaltsabgabe ist verfassungsgemäß, stellten sie klar. Für die Beitragspflicht komme es auch nicht darauf an, ob der Haushalt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk "teilnehmen" wolle, wie es im Juristenjargon heißt. Der Rundfunkbeitrag sei außerdem auch keine verkappte Steuer, wie die Beschwerdeführer argumentiert hatten.
Grundsätzlich wären aber auch andere Modelle, den Beitrag zu erheben, mit dem Grundgesetz in Einklang, führten die Richter aus - zum Beispiel eben eine Pro-Kopf-Abgabe. Bei der mündlichen Verhandlung im Mai hatten die Richter an dieser Stelle besonders genau nachgefragt und von Ländern und Sendern wissen wollen, warum der Beitrag nicht einzeln von jedem Bürger erhoben wird. In Kreisen der öffentlich-rechtlichen Sender war deswegen befürchtet worden, dass die Richter das Haushaltsmodell kippen könnten. Im Ergebnis hielten sie nun jedoch die Haushaltsabgabe für vereinbar mit dem Gleichheitsgebot im Grundgesetz.
Sender sind erleichtert
ARD und ZDF reagierten entsprechend erleichtert auf die Entscheidung aus Karlsruhe. Die Bundesländer haben nun bis zum 30. Juni 2020 Zeit, eine neue Regelung für die Zweitwohnungen gesetzlich festzuschreiben. Wer bislang doppelt zahlt, muss aber nicht so lange warten: Die Sender müssten Betroffene schon jetzt auf Antrag von der doppelten Zahlungspflicht befreien, legten die Richter fest. Der Rundfunkbeitrag ist in einem Staatsvertrag zwischen den Ländern festgeschrieben, die in Deutschland für Rundfunkpolitik zuständig sind.
Unternehmen müssen den Beitrag weiter wie bisher zahlen. Der Einzug nach Zahl der Betriebsstätten, Mitarbeiter und Dienstwagen ist verfassungskonform. Auch für Mietwagen muss weiter bezahlt werden - dagegen hatte sich der Autoverleiher Sixt gewehrt. Doch der Rundfunk biete im gewerblichen Bereich einen "preisbildenden Vorteil", argumentierten die Richter - heißt im konkreten Fall: Wer ein Auto mit Radio vermietet, kann dafür mehr verlangen als für einen Wagen ohne Empfang.
Ganz in der Tradition seiner bisherigen Rundfunkurteile unterstrich das Bundesverfassungsgericht den wichtigen Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen für die Gesellschaft. Der Beitrag von 17,50 Euro sei angesichts des großen Angebots der Sender auch nicht zu hoch, führte der Vizepräsident des obersten deutschen Gerichts, Ferdinand Kirchhof, aus.
Verfahren am Europäischen Gerichtshof
Seit ihrer Einführung vor fünf Jahren hatte die Abgabe zahlreiche Gerichte beschäftigt. Unzählige Klagen wurden von Bürgern wie Unternehmen eingereicht. Neben dem Bundesverwaltungsgericht hatten auch der bayerische und der rheinland-pfälzische Verfassungsgerichtshof den Rundfunkbeitrag für rechtmäßig erklärt.
Ganz "durch" ist der Beitrag juristisch gesehen mit dem Verfassungsgerichtsurteil dennoch nicht: Derzeit beschäftigt er noch den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die Luxemburger Richter prüfen auf Anfrage des Landgerichts Tübingens unter anderem, ob es sich beim Rundfunkbeitrag um eine europarechtlich unzulässige Beihilfe handelt, also um eine rechtswidrige Subvention der Sender. Ein Urteil wird im Spätherbst erwartet.
Mord an Kreml-Kritikerin Politkowskaja unzureichend aufgeklärt
Die Richter am Straßburger Menschenrechtsgerichtshof äußerten keinen Zweifel: Die russischen Behörden sind nicht allen Hinweisen nachgegangen, die zur Festnahme der Hintermänner des Auftragsmords an Politkowskaja hätten führen können.Straßburg (epd). Russland hat den Auftragsmord an der kremlkritischen Journalistin Anna Politkowskaja im Jahr 2006 nach einem Urteil des Straßburger Menschenrechtsgerichtshofs unzureichend aufgeklärt. Ein Staat habe die Pflicht, bei einem Mord allen Hinweisen nachzugehen, erklärte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in einem am 17. Juli verkündeten Urteil. Dies sei nicht geschehen. Den Beschwerdeführern - Mutter, Schwester und die zwei Kinder der Enthüllungsjournalistin - sprach das Gericht eine Entschädigung in Höhe von insgesamt 20.000 Euro zu. (AZ 15086/07)
Politkowskaja hatte in der kremlkritischen Zeitung "Nowaja Gaseta" regelmäßig über Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien berichtet und den russischen Präsidenten Wladimir Putin kritisiert. Am 7. Oktober 2006, Putins Geburtstag, wurde sie im Treppenhaus ihres Moskauer Wohnhauses erschossen.
Vor Gericht mussten sich schließlich fünf Männer verantworten, zwei Brüder, die als Polizeibeamter beziehungsweise als Beamter beim russischen Inlandsgeheimdienst FSB tätig waren, sowie drei weitere Tatverdächtige. Im Mai 2014 verurteilte ein Moskauer Gericht die Männer wegen des Mordes zu langen Haftstrafen, zwei davon lebenslänglich. In einem separaten Verfahren wurde zudem ein hoher Beamter des Moskauer Innenministeriums zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.
Auftraggeber blieben im Dunkeln
Die eigentlichen Auftraggeber des Mordes blieben indes im Dunkeln. Die Angehörigen verwiesen auf Spuren zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB und zur tschetschenischen Regierung. Diese wurden von den Behörden aber nicht verfolgt.
Russland hat den Fall damit unzureichend aufgeklärt, urteilte der Menschenrechtsgerichtshof. Die Behörden hätten auch versäumt, Zusammenhänge zwischen der journalistischen Arbeit Politkowskajas und dem Mord zu untersuchen. Sie hätten nur den im März 2013 in Großbritannien unter ungeklärten Umständen gestorbenen früheren russischen Oligarchen und Putin-Kritiker Boris Beresowski als Auftraggeber verdächtigt.
Dokumente, die diesen Verdacht bestätigen, seien aber nicht vorgelegt worden. Spuren, die zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB oder zur tschetschenischen Regierung führten, seien außer Acht gelassen worden. Wegen der unzureichenden Aufklärung und weil das Verfahren viel zu lange gedauert habe, stehe den Angehörigen die Entschädigung zu.
Amnesty begrüßt Urteil
"Wir freuen uns über dieses Urteil, auch wenn es wenig daran ändern wird, dass im Kreml der politische Wille fehlt, den Mord an Politkowskaja wirklich aufzuklären", sagte Christian Mihr, Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen": "Es ist ein immenses Problem für kritische Journalisten in Russland, dass nach Gewalttaten in den seltensten Fällen die Täter bestraft, geschweige denn Auftraggeber ausfindig gemacht werden."
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte ebenfalls die EGMR-Entscheidung. Die Ermordung von Anna Politkowskaja zeige, welcher Gefahr diejenigen ausgesetzt seien, die in Russland Menschenrechtsverletzungen und Korruption aufdeckten. "Journalisten und Menschenrechtler sind in Russland heute weiterhin Angriffen, Repressalien und Drohungen auch von staatlicher Seite ausgesetzt", sagte Janine Uhlmannsiek, Expertin für Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland.
"Zeit" räumt Fehler bei Kommentaren zur Seenotrettung ein
Hamburg (epd). Nach scharfer Kritik an ihrem "Pro und Contra" zur Seenotrettung im Mittelmeer hat die Wochenzeitung "Die Zeit" Fehler eingeräumt. Es sei heikel gewesen, ein solches "Pro und Contra" zu einer Zeit zu bringen, "da es bei der staatlichen Seenotrettung politisch gewollte Lücken gibt", erklärte die Chefredaktion in einem Editorial (Ausgabe vom 19. Juli). Es sei der Eindruck entstanden, die "Zeit" vertrete die Meinung, es sei diskutabel, dass Seenotrettung überhaupt stattfinde.
Die Überschrift "Oder soll man es lassen?" habe dies verstärkt, zumal erst in der Unterzeile deutlich geworden sei, dass es um private Seenothilfe ging. Tatsächlich vertrete niemand bei der "Zeit", auch die Autorin des Contra-Artikels nicht, die Auffassung, dass man Menschen ertrinken lassen sollte. "Solche inhumane Logik lehnen wir ab. Dass ein anderer Eindruck entstehen konnte, tut uns von Herzen leid", schreibt die Chefredaktion.
In dem Contra-Text von Mariam Lau sei zudem nicht genügend zum Ausdruck gekommen, dass die Zeitung und auch die Autorin großen Respekt vor den Helfern hätten, die Freizeit und Geld einsetzten, um Menschen zu retten, und sich oft auch selbst in Gefahr brächten. "Unabhängig davon, aus welcher Motivation und mit welchem Weltbild die Retter handeln, sind sie erst einmal zu bewundern. Was nicht bedeutet, dass die politischen Folgen ihres humanitären Handelns nicht auch kritisch gesehen werden können", so die "Zeit".
Miriam Lau hatte in ihrem Beitrag unterstrichen, dass die Seenotretter "Teil des Geschäftsmodells der Schlepper" seien und darauf verwiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nähe der Rettungsschiffe und der Zahl und Qualität der Flüchtlingsboote gebe. "Je mehr gerettet wird, desto mehr Boote kommen - so einfach ist das, und so fatal", schrieb Lau. Zugleich stellte sie infrage, dass die Rettung, die eine Aufgabe von Staaten sein solle, von Privaten übernommen werden müsse.
Viele Leser äußerten sich daraufhin empört und kritisierten die "Zeit" nach eigenen Angaben massiv. In Online-Kommentaren wurde der Zeitung Rechtspolulismus vorgeworfen. In sozialen Netzwerken ergoss sich ein Shitstorm über die Autorin. Die "Zeit" versprach, "es in Zukunft wieder besser zu machen".
Uwe-Johnson-Preis für Ralf Rothmann
Neubrandenburg (epd). Der Schriftsteller Ralf Rothmann wird mit dem diesjährigen Uwe-Johnson-Literaturpreis geehrt. Der 65-Jährige erhält die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman "Der Gott jenes Sommers", wie die Mecklenburgische Literaturgesellschaft am 20. Juli in Neubrandenburg mitteilte. Die Preisverleihung findet während der Uwe-Johnson-Tage am 21. September in Berlin statt.
Die Stifter verleihen den Preis an einen Autor, "in dessen Gesamtwerk die unbestechliche Erinnerungsarbeit eine zentrale Rolle spielt". In seinem neuen Roman zeige Rothmann aus der Sicht eines 13-jährigen Mädchens, dass Krieg nicht allein Tod und Verletzung, Entbehrung und Angst oder die Sorge um die Angehörigen bedeuten. Der in Berlin lebende Autor beschreibe "eindrucksvoll, wie der Krieg die Seele angreift und die ethische Sicherheit des einzelnen bedroht."
Stifter der Auszeichnung ist die Mecklenburgische Literaturgesellschaft gemeinsam mit der Kanzlei Gentz und Partner Rechtsanwälte und dem Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg. Der Uwe-Johnson-Preis erinnert an den Autor Uwe Johnson (1934-1974), der zu den großen deutschen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts gezählt wird. Frühere Preisträger waren unter anderem Christa Wolf, Walter Kempowski, Uwe Tellkamp, Lutz Seiler und zuletzt 2016 Jan Koneffke.
Rafik Schami erhält Gustav-Heinemann-Friedenspreis 2018
Düsseldorf, Köln (epd). Der syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami erhält den diesjährigen Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher. Der 72-jährige Autor bekomme den mit 7.500 Euro dotierten Preis für sein Buch "Sami und der Wunsch nach Freiheit", teilte das NRW-Kulturministerium am 19. Juli in Düsseldorf mit. "Das prämierte Buch zeigt, was es bedeutet, in einer Diktatur zu leben, und wie es trotzdem gelingt, sich für ein demokratisches und friedliches Zusammenleben einzusetzen", sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos). Das Werk vermittele "mit literarischer Erzählkunst zwischen verschiedenen Kulturen".
Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und floh mit 25 Jahren nach Deutschland. In seinem im vergangenen Jahr veröffentlichten Buch erzählt er von den Abenteuern des syrischen Jugendlichen Sami und seines besten Freundes Sharif in den Gassen von Damaskus. Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund des syrischen Aufstandes von 2011 und schneidet Themen wie Freiheit, Liebe, Mut und Güte an.
Mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher erinnert die Landesregierung an das friedenspolitische Engagement des früheren Bundespräsidenten. Der Preis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher und wird in diesem Jahr zum 35. Mal vergeben. Preisverleihung ist am 23. November im Literaturhaus in Köln.
Stadt Bonn bekommt Stadtschreiber
Bonn (epd). Die Stadt Bonn bekommt in diesem Jahr ihren ersten Stadtschreiber. Das Literaturstipendium sei bundesweit ausgeschrieben, erklärte Barbara Ter-Nedden, Vorsitzende des Vereins Lese-Kultur Godesberg, dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 18. Juli. "Damit wollen wir erstmals einem Schriftsteller oder Publizisten die Möglichkeit geben, am Rhein drei Monate zu leben und zu arbeiten." Möglich wurde das Projekt durch den mit 5.000 Euro dotierten Ferdinande-Boxberger-Preis, der dem Verein Lese-Kultur 2018 verliehen wurde.
Der Stadtschreiber oder die Stadtschreiberin erhält ein monatliches Honorar von 1.200 Euro und ein kostenloses Quartier. Dort könne er oder sie ungestört schriftstellerisch tätig sein, sagte Ter-Nedden. Im Gegenzug wünscht sich der Verein Lesungen des Autors aus eigenen Texten unter anderem in Schulen sowie einen Schreibworkshop im Rahmen des jährlich vom Verein ausgeschriebenen Bad Godesberger Literaturpreises. "Wir wollen Bonn als Stadt bekannt machen, in der Literatur entsteht", sagte Ter-Nedden, die im Stadtteil Bad Godesberg eine Buchhandlung betreibt. Am 1. August soll der Preisträger bekanntgegeben werden, der möglichst bald danach seine Tätigkeit als Stadtschreiber antreten soll.
Glas Martin Luthers gehört zu den Heimatschätzen Bayerns
Coburg (epd). Ein Glas des Reformators Martin Luther (1483-1546) aus den Kunstsammlungen der Veste Coburg steht auf der Liste der 100 Heimatschätze Bayerns. Das Glas sei eines der wenigen Besitztümer, die von Luther überliefert sind, teilten die Kunstsammlungen am 20. Juli mit.
Bei einem Wettbewerb von Heimatministerium, Kunstministerium und Bayerischem Landesverein für Heimatpflege wurde das sogenannte Hedwigsglas als eines von 100 ausgewählten Exponaten aus den nichtstaatlichen Museen des Freistaates prämiert, die symbolhaft für die Kultur Bayerns stehen. Der Reformator verbrachte 1530 mehrere Monate auf der Veste Coburg.
Das Hedwigsglas entstand vermutlich im 11. Jahrhundert in Syrien. Der Name geht auf die Heilige Hedwig (1174-1243) zurück, Herzogin und Landespatronin von Schlesien und Polen. Einer Legende zufolge soll sich in ihrer Gegenwart in einem solchen Glas Wasser zu Wein gewandelt haben. Nach alter Überlieferung gehörte das Hedwigsglas der Heiligen Elisabeth von Thüringen (1207-1231), der Nichte der Heiligen Hedwig. Nach der Ausbreitung der Reformation soll das Glas als Geschenk von Kurfürst Johann dem Beständigen an Luther gelangt sein.
Entwicklung
Deutsche kaufen öfter fair

epd-bild/Jutta Ulmer
Berlin (epd). Immer mehr Menschen greifen zu fair gehandelten Produkten. Im vergangenen Jahr gaben die Verbraucher in Deutschland 1,473 Milliarden Euro für Produkte aus fairem Handel aus, wie der Dachverband Forum Fairer Handel am 17. Juli in Berlin mitteilte. Das sei eine Steigerung zum Vorjahr um 13 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Umsatz im fairen Handel damit verfünffacht, sagte Geschäftsführer Manuel Blendin.
Gut 18 Euro pro Kopf gaben die deutschen Verbraucher 2017 durchschnittlich für fair gehandelte Nahrungsmittel, Textilien und Handwerksprodukte aus, zwei Euro mehr als im Vorjahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch fairer Produkte in der Schweiz ist laut dem Dachverband etwa viermal so hoch. Laut einer aktuellen Umfrage von 2018 kaufen mittlerweile 69 Prozent der Verbraucher fair gehandelte Produkte, davon 23 Prozent regelmäßig. Noch 2009 griffen nur 44 Prozent der Befragten zu fairen Produkten, davon neun Prozent regelmäßig. Trotzdem liegt der Anteil des fairen Handels am deutschen Gesamthandelsumsatz laut Blendin weiterhin bei unter einem Prozent.
Mit 1,18 Milliarden Euro habe das Fairtrade-Produktsiegel den größten Anteil zum Gesamtumsatz des fairen Handels beigetragen (2016: 1,05 Milliarden Euro), sagte Blendin. Die anerkannten Fair-Handels-Importeure vertrieben im vergangenen Jahr Waren im Wert von 193 Millionen Euro. In den Weltläden und Weltgruppen wurden faire Waren im Wert von 77 Millionen Euro verkauft. Fair gehandelte Produkte aus Europa, wie Naturland Fair zertifizierte Milch und Brot, erreichten einen Umsatz von 101 Millionen Euro (2016: 67 Millionen Euro).
Mit 80 Prozent machen nach Angaben des Geschäftsführers Lebensmittel den größten Anteil am fairen Handel aus. Spitzenreiter unter allen fair gehandelten Produkten ist weiterhin Kaffee mit einem Umsatzanteil von 34,3 Prozent am fairen Handel. Das ist ein Zuwachs von acht Prozent zum Vorjahr und entspricht rund 21.500 Tonnen. Gemessen am Gesamtabsatz von Röstkaffee in Deutschland liege der Marktanteil allerdings nur bei 4,8 Prozent, sagte Blendin.
Südfrüchte auf dem ersten Platz
Mengenmäßig liegen dagegen mit einem Absatz von 94.256 Tonnen Südfrüchte auf dem ersten Platz der fair gehandelten Produkte. Der Verkauf von Bananen, Mangos, Ananas und Orangen wuchs 2017 um 22 Prozent. Die größte Menge an Bananen wurde in Discountern verkauft, sagte Blendin. Mittlerweile seien zudem 95 Prozent der Südfrüchte auch Bio. Bei den Bananen seien es sogar 100 Prozent.
Auch bei der fairen Schokolade wuchs der Absatz um 21 Prozent auf 2.719 Tonnen. Am Gesamtumsatz des fairen Handels hat die Schokolade einen Anteil von knapp vier Prozent. Höhere Umsätze erzielten unter anderem sonstige Lebensmittel (14,7 Prozent), Textilien (neun Prozent), Schnittblumen (8,3 Prozent) oder Eiscreme (7,3 Prozent).
Die Vorstandsvorsitzende des Forums Fairer Handel, Andrea Fütterer, sprach von einer erfreulichen Entwicklung und appellierte zugleich, noch stärker gegen die Ursachen des ungerechten Welthandels zu wirken. So benötigen Kaffeebauern angesichts von sinkenden realen Einkommen und den Folgen des Klimawandels mehr Unterstützung - durch fairen Konsum, aber auch durch gesetzliche Regelungen wie einer Steuerbefreiung für fairen Kaffee. Unternehmen, die hohe soziale Standards einhalten, faire Preise an die Erzeuger zahlen, Investitionen vorfinanzieren und sich für externe Überprüfungen öffnen, sollten steuerlich entlastet werden.
KfW-Zusagen für Entwicklungsprojekte auf Höchststand
Wenn die Finanzierung eines Kraftwerks ansteht, sollen künftig ökologische und soziale Risiken stärker geprüft werden: Die KfW Entwicklungsbank will Transparenz großschreiben. "Wir haben nichts zu verstecken", sagt Vorstandsmitglied Joachim Nagel.Frankfurt a.M. (epd). Die staatliche Förderbank KfW hat bei der Finanzierung von Entwicklungsprojekten erneut zugelegt. Im vergangenen Jahr sagten die KfW Entwicklungsbank und ihre Tochter DEG insgesamt 9,7 Milliarden Euro für Entwicklungs- und Flüchtlingsprojekte zu. Damit erreichten die Neuzusagen für Afrika, Asien, Lateinamerika und den Nahen Osten eine Höchststand, wie aus dem am 18. Juli in Frankfurt vorgestellten Jahresbericht hervorgeht. 2016 waren es 8,8 Milliarden Euro. KfW-Vorstandsmitglied Joachim Nagel bezeichnete 2017 als ein sehr intensives und gutes Jahr.
Viele Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz
Von den Neuzusagen 2017 vergab die KfW Entwicklungsbank 8,2 Milliarden Euro (2016: 7,3), während die Tochter DEG wie im Vorjahr 1,6 Milliarden Euro an Finanzierungen für private Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern zusagte. Rund 55 Prozent der Neuzusagen erfolgten für Projekte im Bereich Klima- und Umweltschutz. Das sei eine sehr gute Zahl, sagte Nagel und fügte hinzu: "Die KfW strebt einen weiteren Ausbau ihrer Klimafinanzierungen an."
Die KfW setzte wieder einen Großteil an eigenen Mitteln (4,9 Milliarden Euro) zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten ein. 2,9 Milliarden Euro stammten aus dem Bundeshaushalt, vor allem vom Entwicklungsministerium. Knapp 40 Prozent der neu zugesagten Mittel flossen nach Afrika und den Nahen Osten.
1,2 Milliarden Euro gingen an Projekte mit Bezug zu Flüchtlingen, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Nagel nannte als Beispiele Bildungsprogramme für syrische Flüchtlinge in der Türkei und im Libanon sowie eine Solaranlage im Flüchtlingslager Sataari in Jordanien. Die von der KfW insgesamt betreuten Projekte erreichten elf Millionen Flüchtlinge, sagte Nagel, der seit November 2017 Mitglied im KfW-Vorstand ist. Für Hilfen in sogenannten fragilen Staaten, die etwa von Unruhen erschüttert werden, wolle die KfW ein besseres Instrumentarium schaffen, um schneller agieren zu können.
Bemühen um Transparenz
Knapp vier Milliarden Euro vergab die KfW Entwicklungsbank in den Bereichen Energie, Banken und Wasserversorgung. Manche Projekte zogen in der Vergangenheit Kritik von Umweltschützern und Menschenrechtlern auf sich. Nagel räumte ein, dass die KfW auf schwierigem Terrain arbeite und kündigte stärkere Bemühungen der KfW um Transparenz und Nachhaltigkeit an. "Wir wollen mit dem Thema offensiv umgehen", sagte er. Die Bank werde Umwelt- und Sozialrisiken noch intensiver prüfen und dafür mehr Personal einsetzen."Wir haben nichts zu verstecken." So werde auch der Dialog zu Nichtregierungsorganisationen gesucht.
Als wichtiges Anliegen nannte die Vorstandssprecherin der DEG, Christiane Laibach, die Mobilisierung von privatem Kapital für Entwicklungsziele. Konsumgüter wie Fruchtsaft im eigenen Land herzustellen und dafür Kredite zu bekommen, sei für viele Regionen in Afrika noch nicht selbstverständlich. Mit unterschiedlichen Finanzinstrumenten würden Firmen dort befähigt, gute und faire Beschäftigung zu schaffen. Insgesamt arbeiteten rund 1,5 Millionen Menschen in DEG-geförderten Unternehmen.
Mit großem Erfolg ist nach ihren Worten das Projekt "German Desk" gestartet: Anlaufstellen mit einem deutschsprachigen Mitarbeiter für Geschäftskontakte, die bislang in Peru, Kenia, Nigeria, Bangladesch und Indonesien errichtet wurden. Da gehe es etwa um kleine pragmatische Hilfen bei der Eröffnung eines Kontos bis hin zur Vermittlung von Leasing-Partnern. Für Digitalisierung sieht die KfW einen wachsenden Bedarf, denn viele arme Länder überspringen Entwicklungsstufen. Bisher werden etwa Projekte zur Blockchain-Technologie in Burkina Faso und Telemedizin in Afghanistan unterstützt.
Jubiläum: Nigeria fordert Stärkung des Weltstrafgerichts
Den Haag/Berlin (epd). Der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari fordert eine Stärkung des Internationalen Strafgerichtshofs. "Angesichts einer Zunahme von Gewalt ist das Gericht von wachsender Bedeutung", sagte Buhari bei einem Festakt zum 20-jährigen Bestehen des Strafgerichtshofs am 17. Juli in Den Haag. Am 17. Juli 1998 hatten 120 Staaten in Rom das sogenannte Römische Statut verabschiedet, den Gründungsvertrag des Gerichts. Heute wird das Tribunal von 123 Staaten getragen.
Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler (SPD), würdigte in Berlin das Römische Statut als Durchbruch für das Völkerstrafrecht. Sie sicherte dem Gerichtshof die weitere intensive Unterstützung Deutschlands zu. Der Strafgerichtshof kann Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verfolgen. Ebenfalls am Dienstag traten Vertragsänderungen in Kraft, die das Verbrechen der Aggression in den Gründungsvertrag aufnehmen und damit das Führen eines Angriffskriegs unter Strafe stellen.
Das Römische Statut trat am 1. Juli 2002 in Kraft, als das Gericht seine Arbeit aufnahm. Es können nur Verbrechen geahndet werden, die nach diesem Tag in einem Mitgliedsstaat verübt wurden. Der Weltsicherheitsrat kann auch Ermittlungen in Ländern anordnen, die keine Mitglieder sind.
Der nigerianische Präsident sagte bei der Feier in Den Haag, ein starker und effizienter Strafgerichtshof könne zu einem Katalysator für die Verfolgung auch anderer schwerer Verbrechen werden und die vorherrschende Kultur der Straflosigkeit beenden. Buhari nannte Korruption als Beispiel für Straftaten, die von einem internationalen Gericht verfolgt werden müssten. Buhari trat 2015 als Präsident mit dem Versprechen an, die weit verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft in Nigeria zu bekämpfen.
Erst fünf Urteile
Überschattet wurden die Feiern vom überraschenden Freispruch des früheren kongolesischen Vizepräsidenten Jean-Pierre Bemba in zweiter Instanz Mitte Juni. Bemba war 2016 zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil nach Überzeugung des Gerichts Rebellen unter seiner Kontrolle in der Zentralafrikanischen Republik gemordet, vergewaltigt und geplündert hatten.
Der Strafgerichtshof steht wegen seiner als schwach empfundenen Bilanz und dem starken Fokus auf afrikanische Konflikte in der Kritik. Bisher ergingen erst fünf Urteile, darunter zwei Freisprüche. Zugleich wurden bislang ausschließlich Afrikaner angeklagt. Mehrere afrikanische Regierungen drohten mit Austritt, weil sie dem Gericht Neokolonialismus vorwerfen. Burundi ist im vergangenen Jahr ausgetreten.
Länder wie die USA, Russland, Israel, Syrien, Indien und China bleiben dem Strafgerichtshof bislang fern. Buhari appellierte an diese Staaten, ebenfalls dem Tribunal beizutreten. Auch die Menschenrechtsbeauftragte Kofler setzte sich dafür ein. "Gemeinsam mit ihren EU-Partnern wird die Bundesregierung nicht darin nachlassen, für die Beitritte weiterer Staaten zum Römischen Statut zu werben", erklärte sie in Berlin. Den gravierendsten Verstößen gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht müsse mit der Macht des Rechts begegnet werden.
Ausharren im Wüstenstaat

epd-bild/Sebastian Backhaus
Niamey (epd). Die Familie Diallo sitzt in ihrer Basthütte unter einem Plastikdach, das auf Metallpfeilern ruht. Die Temperaturen steigen an diesem Nachmittag in Niamey auf über 40 Grad. Ein paar Schafe knabbern an dürrem Gras, Bonbons werden zum Verkauf angeboten. Vor sechs Jahren floh die Familie vor der Gewalt von Dschihadisten aus Mali und fand wie 57.000 andere Landsleute Zuflucht im Wüstenstaat Niger. Das arme westafrikanische Land mit 19 Millionen Einwohnern ist zum Zufluchts- und Transitland für über Hunderttausend Flüchtlinge geworden. Sie kommen auch aus Libyen.
Der Niger nimmt jene Flüchtlinge auf, die das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) aus Libyen evakuiert. Seit dem Sturz des Gaddafi-Regimes und dem Zusammenbruch der staatlichen Ordnung 2011 herrschen in Libyen schlimme Verhältnisse. Migranten und Flüchtlinge riskieren Willkür, Gewalt aller Art, Erpressung und Versklavung.
Bisher haben 1.536 Flüchtlinge - viele Somalier, Eritreer und Sudanesen - Platz in den humanitären Flügen der UN nach Niger gefunden. Aber noch weitere 50.000 stecken weiter in Libyen fest. Dass Flüchtlinge aus Libyen nach Niger evakuiert werden, ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen dem UNHCR, einigen europäischen Staaten und Kanada sowie der Regierung Nigers. Anstatt ihr Leben bei der Überquerung des Mittelmeers zu riskieren, sollen besonders schutzwürdige Flüchtlinge eine sichere Aufnahme finden.
Niger hat seine Bereitschaft erklärt, Flüchtlinge aus Libyen zu beherbergen, wenn die europäischen Länder bereit sind sie aufzunehmen. So haben Frankreich, die Niederlande, Schweiz und Schweden bereits Flüchtlinge aufgenommen. Deutschland hat 300 Plätze zugesichert, 100 Fälle wurden schon an die deutschen Behörden zur Untersuchung übergeben. Das Verfahren ist erst angelaufen.
"Das ärmste, aber großzügigste Land der Welt"
Alessandra Morelli, die Chefin des UNHCR in Niger, bekräftigt ihren Dank an die Regierung des wesfafrikanischen Staates: "das ärmste, aber großzügigste Land der Welt". Im Durchschnitt muss ein Nigrer von einem US-Dollar am Tag leben, was kaum zum Leben reicht. Im UN-Ranking der Lebensqualität steht das Land ganz unten auf Platz 187 von 188 Staaten.
Die Herausforderungen sind denn auch groß, zumal auch etwa 108.000 Nigerianer sind in den Niger geflüchtet sind, aus Angst vor den Angriffen der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram. Aber islamistische Milizen verüben auch Attentate im Niger selbst, 140.000 Menschen gelten als Flüchtlinge im eigenen Land. Um für Sicherheit und in der Sahelregion zu sorgen, gibt Niger 21 Prozent seines Staatshaushaltes für Verteidigung aus.
"Das Engagement für die Sicherheit ist groß," sagt Morelli, "aber das Geld für Schulen und Gesundheit fehlt, dabei sind das wichtige Schlüssel für die Entwicklung." Es sind nicht nur Flüchtlinge, der Niger ist auch ein Transitland für arbeitsuchende Migranten, die Richtung Algerien und Libyen ziehen - oder zurückkommen. Migranten flüchten vor Misshandlungen in Libyen oder werden aus Algerien ausgewiesen. Bei manchen Menschen im Niger regt sich Unmut über die Zuwanderer.
Sieben Wochen lang hatte die Regierung Nigers im Frühjahr die humanitären Flüge der UNHCR in den Niger gestoppt. "Das wichtigste zur Zeit ist, dass der Fluss läuft: Wenn Flüchtlinge kommen, muss die Umsiedlung der Flüchtlinge auch stattfinden", sagt Morelli entschieden. Elf Länder haben insgesamt 3.781 Plätze für Flüchtlinge zugesagt. Aber das Prozedere in den Aufnahmestaaten ist langwierig. Bisher fanden erst 385 besonders schutzwürdige Flüchtlinge Aufnahme in Nordamerika oder Europa.
Mehr als 1.300 Menschen müssen noch im Transit ausharren. "Unsere Kapazitäten im Niger sind begrenzt. Wir haben in Niamey 22 Häuser, die zwischen 60 bis 80 Personen aufnehmen können, und sie sind alle voll," sagt sie besorgt.
Sogwirkung auf Flüchtlinge befürchtet
Der Niger sorgt sich auch, dass die Präsenz internationaler Organisationen eine Sogwirkung auf Flüchtlinge entfalten könnte. So leben schon fast 2.000 Menschen aus dem ostafrikanischen Sudan in der Stadt Agadez im Norden. Einige stammen aus der sudanesischen Konfliktregion Darfur, andere aus Camps im Tschad. "Sie haben die Flüchtlingslager verlassen, weil sie dort keine Perspektive sahen", sagt Morelli. Der Unmut in Agadez hat die Regierung Nigers veranlasst, im Mai 100 Sudanesen nach Libyen auszuweisen.
Der Niger allein kann nicht alle 50.000 Flüchtlinge, die in Libyen feststecken, aufnehmen. "Wir diskutieren mit weiteren Ländern, unter anderem mit Burkina Faso, um dort Aufnahmezentren zu eröffnen," versichert Morelli. "Es bleibt eine dringliche Aufgabe, die Evakuierung aus Libyen voranzutreiben." Und es müssten auch Lösungen für die Flüchtlinge gefunden werden, die keine Chance auf Aufnahme in Nordamerika oder Europa haben.
Früherer EKD-Ratsvorsitzender Huber würdigt Mandela
Berlin (epd). Zum 100. Geburtstag des südafrikanischen Anti-Apartheid-Kämpfers und Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela (1918-2013) hat der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, zu mehr Verantwortung in der Politik aufgerufen. Die Welt sei heute eher hinter Mandela zurückgefallen, als über ihn hinausgewachsen, sagte Huber am 18. Juli im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Deshalb seien wieder mehr Stimmen für eine andere Form der Politik nötig als die, die "zwischen Populismus und Machtorientierung hin und her pendelt".
Mandela stehe für die "Einheit von Biografie und Grundüberzeugung", betonte der Theologe, der von 2003 bis 2009 Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) war und seit 2013 eine Honorarprofessur im südafrikanischen Stellenbosch innehat. Mandela habe politische Weitsicht mit festen Grundüberzeugungen und Nähe zu den Menschen verbunden, zugleich Fähigkeit zum Pragmatismus bewiesen und die Botschaft von Versöhnung und Gerechtigkeit gelebt.
Die Welt dürfe jedoch nicht einfach auf die "nächste große Lichtgestalt wie Mandela" warten. Es sei Aufgabe aller, für eine verantwortungsbewusste und menschliche Politik einzutreten, betonte Huber: "Jeder kann seinen Beitrag dazu leisten."
Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 in Mvezo in Südafrika geboren und saß wegen seines Engagements gegen die Apartheid, die Schwarzen die gleichen Rechte wie Weißen verwehrte, von 1963 bis 1990 als politischer Häftling im Gefängnis. 1993 wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Von 1994 bis 1999 war Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas. Er starb am 5. Dezember 2013 mit 95 Jahren in Johannesburg.
Ortega greift katholische Kirche in Nicaragua als Putschisten an
São Paulo/Genf (epd). Nicaraguas Staatspräsident Daniel Ortega hat die katholische Kirche als Putschisten beschimpft. Die Geistlichen fühlten sich den Putschisten verpflichtet und unterstützten sie dabei, ihn zu stürzen, sagte Ortega bei einer Feier zum 39. Jahrestag der Revolution gegen die Somoza-Diktatur, wie die Tageszeitung "La Prensa" am 19. Juli berichtete. Kirchengebäude seien als Waffenlager und für Angriffe genutzt worden, sagte Ortega.
Der Präsident steht wegen seines autoritären Regierungsstils und des harten Vorgehens gegen Demonstranten in der Kritik. In den vergangenen Wochen hatten regierungsnahe Gangs zunehmend Angriffe auf Geistliche und Anschläge auf Kirchen verübt. Die katholische Kirche agiert als Vermittler bei Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition, die aber ausgesetzt sind. Ziel war die Beilegung der seit Monaten anhaltenden blutigen Zusammenstöße.
Die katholische Kirche habe sich durch ihre Handlungen als Vermittlerin disqualifiziert, sagte Ortega. "Ich dachte, sie wären Mediatoren, aber sie sind den Putschisten verpflichtet. Sie sind ein Teil des Putschplanes", sagte der sandinistische Staatschef. In Nicaragua finde eine bewaffnete Verschwörung statt, die aus dem In- und Ausland finanziert werde.
Ortega ging mit keinem Wort auf die mit großer Mehrheit verabschiedete Erklärung der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) ein, die seine Regierung und von ihr finanzierte paramilitärische Einheiten für Menschenrechtsverletzungen und Repression in Nicaragua verantwortlich macht. Ortega kündigte jedoch an, "neue Einheiten der Selbstverteidigung zum Schutz der Familien" zu schaffen. Bewaffnete regierungsnahe Motorradgangs werden für einen Großteil der Morde bei den Protesten verantwortlich gemacht.
Weihbischof Silvio Báez, der als Vermittler den Dialog zwischen Regierung und Opposition leitete, antwortete via Kurznachrichtendienst Twitter auf Ortegas Attacken: "Die Kirche leidet nicht dafür, dass sie verleumdet, angegriffen und verfolgt wird." Sie leide mit denjenigen, die ermordet wurden, für die trauernden Familien, für die zu Unrecht Inhaftierten, betonte er.
Bei den seit drei Monaten andauernden Unruhen wurden nach Angaben der nicaraguanischen Menschenrechtskommission ANPDH bereits mehr als 360 Menschen getötet. Bürgerrechtler fordern Ortegeas Rücktritt und vorgezogene Neuwahlen. Ortega lehnt dies ab.
Die katholischen Bischöfe in Lateinamerika riefen zu Gebeten für Nicaragua auf. Auch der Weltkirchenrat, dem protestantische, anglikanische und orthodoxe Kirchen angehören, äußerte sich sehr besorgt um die Menschenrechte und den Rechtsstaat in Nicaragua. "Wir fordern die Regierung von Präsident Daniel Ortega auf, die entsetzliche Gewalt zu beenden und die Bevölkerung zu schützen", sagte der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Olav Fyske Tveit, am 20. Juli in Genf.
UN: Rückschläge im Kampf gegen Aids
Paris, Genf (epd). Im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids sind nach Angaben der Vereinten Nationen Rückschläge zu verzeichnen. In rund 50 Ländern steige die Zahl der neuen Infektionen mit dem HI-Virus an, teilte das Hilfsprogramm Unaids am 18. Juli in Paris mit. "Ganze Regionen fallen zurück", sagte der Exekutiv-Direktor von Unaids, Michel Sidibé.
In Osteuropa und Zentralasien habe sich die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 20 Jahren verdoppelt, im Nahen Osten und in Nordafrika sei sie um ein Viertel gestiegen. Weltweit hätten sich 2017 rund 1,8 Millionen Menschen neu mit HIV angesteckt. Sidibé forderte höhere finanzielle Zuwendungen der Länder für den Kampf gegen Aids.
Derzeit sind laut Unaids noch viele Menschen von einer lebensverlängernden Therapie ausgeschlossen. So hätten in West- und Zentralafrika nur rund ein Viertel der Kinder und rund 40 Prozent der Erwachsenen, die HIV-positiv seien, einen Zugang zu einer antiretroviralen Therapie. Die antiretrovirale Behandlung bremst die Ausbreitung des Virus' im Körper.
Unaids beklagte zudem, dass weltweit nur etwas mehr als die Hälfte aller HIV-infizierten Kinder eine lebensverlängernde Therapie erhielten. Knapp 22 Millionen der insgesamt knapp 37 Millionen HIV-Infizierten hätten 2017 eine lebensverlängernde Behandlung erhalten.
Rund 180.000 Jungen und Mädchen hätten sich 2017 während der Geburt oder beim Stillen mit dem Virus infiziert. Rund 110.000 Kinder seien 2017 im Zusammenhang mit Aids gestorben, erklärte Unaids. Die Weltgemeinschaft werde sehr wahrscheinlich verschiedene Ziele im Kampf gegen Aids, die sie sich selbst gesteckt habe, nicht erreichen.
Das Hilfsprogramm wies jedoch auch auf Erfolge hin. So sei die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Aids 2017 weiter auf 940.000 gesunken. Das sei der niedrigste Wert in diesem Jahrhundert.
Ausland
Das erste Retortenbaby der Welt wird 40 Jahre alt
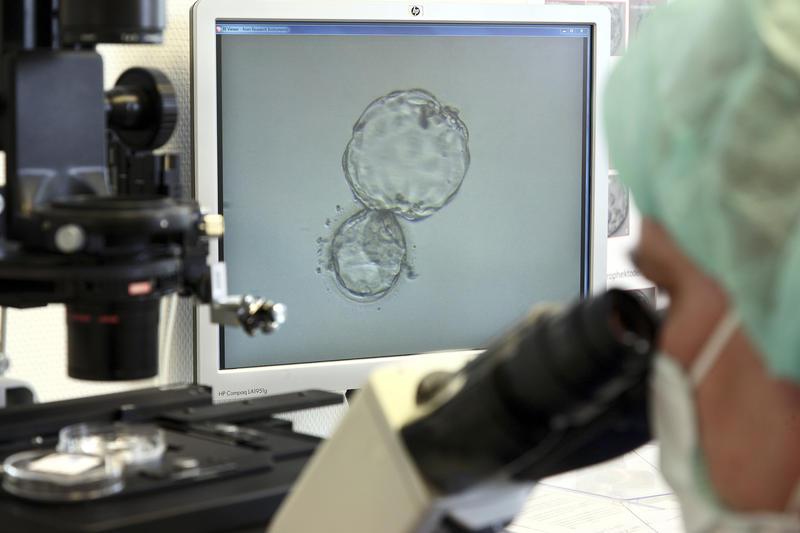
epd-bild / Jürgen Blume
London (epd). Ihre Geburt war eine Sensation und eröffnete vielen Paaren die Möglichkeit, selbst Eltern zu werden: Vor 40 Jahren wurde Louise Brown geboren, das erste Retortenbaby der Welt. Die Engländerin kam dank künstlicher Befruchtung außerhalb des Mutterleibs, der sogenannten In-Vitro-Fertilisation, zur Welt.
Louise Brown wurde am 25. Juli 1978 im englischen Oldham, in der Nähe von Manchester, geboren. Zuvor hatten ihre Eltern neun Jahre erfolglos versucht, ein Kind zu bekommen. Ihre Geburt sollte der Durchbruch sein, um ungewollt kinderlosen Paaren zu einem Kind zu verhelfen. Mittels Befruchtung in der Petrischalte wurde Louise Brown gezeugt. Die beiden Ärzte Patrick Steptoe und Robert Edwards hatten das Verfahren entwickelt. Edwards erhielt 2010 den Nobelpreis für Medizin dafür.
In den vergangenen 40 Jahren wurden mehr als sechs Millionen Kinder mittels dieses Verfahrens gezeugt. "Es ist ein bisschen unheimlich, sich vorzustellen, dass dadurch mehr als sechs Millionen Menschen geboren wurden und alles mit einem selbst angefangen hat", sagte Louise Brown ihrer lokalen Zeitung im vergangenen Jahr.
Sie arbeitet heute als Sachbearbeiterin in einem Logistikunternehmen und ist verheiratet. Die Engländerin hat selbst zwei Kinder, beide sind auf natürlichem Wege gezeugt worden. Über ihr Leben als erstes Retortenbaby hat sie vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben. Sie wird immer noch oft eingeladen, über ihre Erfahrungen zu berichten und zur künstlichen Befruchtung Stellung zu beziehen.
Geburt war ein Medienereignis
Die Geburt von Louise Brown war eine Sensation. Obwohl sie in der Petrischale und nicht im Reagenzglas gezeugt wurde, ist die als "Reagenzglas-Baby" bis heute bekannt. Ihre Geburt war ein Medienereignis. Scharen von Journalisten warteten vor dem Krankenhaus, als sie per Kaiserschnitt geboren wurde. Ihre Geburt wurde gefilmt, denn man wollte zeigen, dass das Kind durch diese Art der Befruchtung keinen Schaden genommen hat. Mehr als 60 Tests musste das Baby damals über sich ergehen lassen. Schon die Befruchtung selbst im November des Jahres zuvor machte weltweit Schlagzeilen. Nach Louises Geburt gingen ihre Eltern mit ihr auf USA-Tour.
Post aus aller Welt, darunter auch Drohungen
Die Familie wurde mit Post aus der ganzen Welt überhäuft. Dabei waren nicht alle Zuschriften positiv, wie sich Louise Brown erinnert. Denn das Verfahren hat bis heute Kritiker, nicht zuletzt aus kirchlichen Kreisen. Sie warfen Louise Browns Eltern vor, sie wollten Gott ins Handwerk pfuschen. Die Familie bekam unter anderem in rote Farbe getränkte Briefe geschickt und wurde bedroht. Doch die Mehrheit der Briefeschreiber gratulierte den Eltern. Andere waren selbst ungewollt kinderlos und hatten plötzlich Hoffnung, doch noch Eltern werden zu können.
Bis heute bekommt Louise Brown Post, ist aber auch zunehmend Ziel von Hasskommentaren im Internet. "Diese Leute haben ihre Meinung, und die können sie gerne haben. Die meisten Menschen mit Fertilitätsproblemen haben ein medizinisches Problem, und wenn die medizinische Wissenschaft das lösen kann, sehe ich keinen Unterschied darin, sie wie andere medizinische Probleme zu lösen", sagte sie in einem Interview.
Louise Browns Mutter entschied sich nach vier Jahren dafür, ein weiteres Kind per künstlicher Befruchtung zu bekommen, und so hat Louise Brown eine jüngere Schwester. Auch diese ist bereits selbst Mutter.
Sterbehilfe-Zahl in Belgien steigt um 300 Fälle
Brüssel, Dortmund (epd). In Belgien sind im vergangenen Jahr 2.309 Fälle von Sterbehilfe registriert worden, knapp 300 mehr als im Jahr 2016 mit 2.028 Fällen. In beiden Jahren waren es mit 50,1 Prozent etwas mehr Männer als Frauen (49,9 Prozent), wie aus dem am 17. Juli in Brüssel vorgelegten Zweijahres-Bericht der Föderalen Kontroll- und Prüfungskommission zur Euthanasie hervorgeht.
Gut die Hälfte der Menschen, die von der Statistik registriert durch Sterbehilfe aus dem Leben schieden, entfiel in beiden Jahren auf die Gruppe der 70- bis 90-Jährigen. Sowohl in Richtung höheres Alter als auch jüngeres Alter nehmen die Zahlen jeweils ab. 2016 wurden dem Bericht zufolge in Belgien zwei und 2017 ein Fall von Sterbehilfe bei Minderjährigen registriert. Diese ist seit 2014 mit Einschränkungen erlaubt, unter anderem müssen die Betroffenen unheilbar krank sein und den Schritt selbst verlangen. Sterbehilfe für Erwachsene ist in Belgien seit 2002 erlaubt.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz äußerte sich über die allgemeine Entwicklung in Belgien besorgt. „Mittlerweile sterben viermal so viele Menschen durch aktive Sterbehilfe als im Straßenverkehr", erklärte Vorstand Eugen Brysch in Dortmund. "Unter dem Deckmantel der Selbstbestimmung werden so auch Kinder, psychisch Kranke und Demenzpatienten getötet."

