Kirchen
Millioneneinbußen der Kirchen durch Corona-Krise
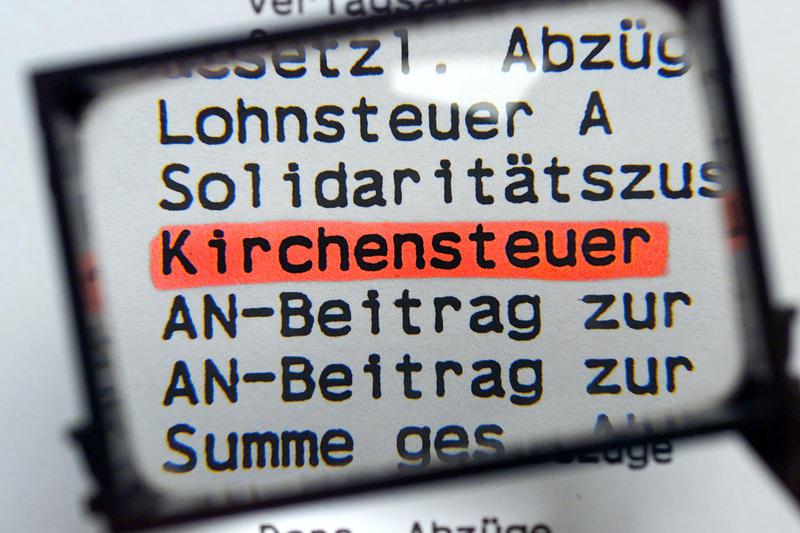
epd-bild / Norbert Neetz
Düsseldorf, Bielefeld (epd). Die beiden großen Kirchen in Nordrhein-Westfalen rechnen wegen der Corona-Krise für das laufende Jahr mit deutlichen Einnahmeverlusten. Die Evangelische Kirche im Rheinland schätzt den Kirchensteuer-Rückgang auf mindestens 12,5 Prozent gegenüber 2019, die Evangelische Kirche von Westfalen prognostiziert je nach wirtschaftlicher Entwicklung ein Minus zwischen zehn und 25 Prozent. Das Erzbistum Köln kalkuliert mit einem Rückgang von bis zu zehn Prozent, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) bei den drei Landeskirchen und fünf Bistümern in NRW ergab. Die Entwicklung entspricht dem bundesweiten Trend. Die Reaktionen der Kirchen reichen von Sparmaßnahmen bis zu Strukturreformen.
Das größte deutsche Bistum in Köln beziffert das erwartete Kirchensteuer-Minus in diesem Jahr auf bis zu 50 Millionen Euro. Damit ergebe sich finanziell eine Situation, die nach bisherigen Prognosen erst in einigen Jahren zu erwarten gewesen wäre. Das Erzbistum kündigte an, nun die Aufgaben zu priorisieren. Durch eine sparsame Finanzplanung könnten derzeit Maßnahmen wie Haushaltssperren vermieden werden. Die anderen Bistümer in NRW nannten keine konkreten Zahlen.
Pesonaleinsparungen angekündigt
In der rheinischen Kirche gibt es einen Stellenbesetzungsstopp auf landeskirchlicher Ebene, es werde auch zu Personaleinsparungen kommen müssen, hieß es. Kompensiert werden könne die Finanzlücke nur durch einen Rückgriff auf Reserven und die Konsolidierung des Haushalts durch deutliche Einsparungen. Für Präses Manfred Rekowski bedeutet die Entwicklung, "dass wir jetzt schneller und konsequenter als gedacht die großen Strukturen, die wir immer noch haben, an die kleiner werdenden Zahlen anpassen müssen". Es gelte, Mehrfachstrukturen bei den Landeskirchen in Deutschland abzubauen, Kompetenzen zu bündeln und innovative Formen kirchlichen Lebens zu entwickeln.
Die westfälische Kirche erklärte, zwar komme der mittelfristig erwartete Einnahmerückgang durch die Corona-Krise nun unvermittelt. Wegen einer vorsichtigen Haushaltspolitik könnten die Anpassungen jedoch voraussichtlich moderat ausfallen. Nicht erst seit der Corona-Krise würden sämtliche Arbeitsbereiche auf den Prüfstand gestellt, sagte ein Sprecher dem epd. Der aktuellen Situation begegne die Landeskirche mit einer restriktiven Ausgabenpolitik. Die Lippische Landeskirche will nach der Sommerpause die finanzielle Lage bewerten und nötige Maßnahmen ergreifen.
Auf Rücklagen zurückgreifen
Auch im Erzbistum Paderborn sollen die erwarteten Defizite durch eine strikte Haushaltsdisziplin und eine Überprüfung der Investitionen vermindert werden. Im Bistum Münster werde ein Haushaltsausgleich nur "durch einen tiefen Griff in die Rücklagen möglich sein", sagte ein Sprecher dem epd. Falls der Abwärtstrend anhalte, sei das Bistum auch zu kurzfristigen Maßnahmen gezwungen.
Das Bistum Aachen kann die krisenbedingten Defizite aktuell ebenfalls noch durch Rücklagen aus wirtschaftlich besseren Jahren decken. Das Ruhrbistum Essen verwies darauf, dass bereits in den vergangenen Jahren umfangreiche Umstrukturierungs- und Veränderungsprozesse eingeleitet worden seien. Die Reaktionen auf die aktuelle Krise würden noch in den zuständigen Gremien beraten.
Hauptgrund für den Rückgang der Kirchensteuer, die an die Lohn- und Einkommenssteuer gekoppelt ist, ist die Kurzarbeit im Zuge der Corona-Pandemie - auf das Kurzarbeitergeld wird keine Kirchensteuer erhoben. In den vergangenen Jahren war das Kirchensteueraufkommen trotz sinkender Mitgliederzahlen noch gestiegen, ermöglicht wurde dies durch die gute Konjunktur.
Die evangelischen Kirchen meldeten für das Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von zusammen 5,9 Milliarden Euro. Die katholische Kirche nahm 2008 insgesamt 6,7 Milliarden Euro durch Kirchensteuern ein, aktuellere Zahlen liege noch nicht vor.
Rekowski: Kirchenstrukturen schneller an sinkende Zahlen anpassen
Düsseldorf (epd). Der Einnahmerückgang durch die Corona-Krise beschleunigt nach Einschätzung des rheinischen Präses Manfred Rekowski nötige Strukturveränderungen in den Kirchen. Dank der guten Wirtschaftsentwicklung sei bislang trotz des Mitgliederschwunds erst in einigen Jahren mit sinkenden Kirchensteuereinnahmen zu rechnen gewesen, sagte Rekowski dem Evangelischen Pressedienst (epd). Diesen Puffer gebe es durch die Corona-Krise nicht mehr: "Das bedeutet, dass wir jetzt schneller und konsequenter als gedacht die großen Strukturen, die wir immer noch haben, an die kleiner werdenden Zahlen anpassen müssen."
Neben bestehenden Formen kirchlicher Arbeit müssten auch neue Initiativen gefördert werden, von denen manche vielleicht Vorbildcharakter entwickeln könnten, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland. "Auf der anderen Seite kann es sein, dass wir uns von manchem verabschieden, das keine Resonanz mehr findet."
Kompetenzen bündeln
Rekowski unterstützt auch Bestrebungen, Mehrfachstrukturen in den 20 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) abzubauen und Kompetenzen bei der EKD oder einzelnen Landeskirchen zu bündeln. "Von der Idee, dass jeder alles macht, werden wir uns verabschieden müssen", sagte er. "Muss sich beispielsweise wirklich jede Landeskirche einzeln um kirchliches Arbeitsrecht kümmern?" Durch die Corona-Krise scheine es so zu sein, dass der finanzielle Druck alle Landeskirchen gleichzeitig treffe, dadurch werde die Kooperationsbereitschaft steigen.
Die rheinische Landeskirche, mit 2,45 Millionen Mitgliedern die zweitgrößte in der EKD, beziffert den Corona-bedingten Rückgang der Kirchensteuereinnahmen für das laufende Jahr gegenüber 2019 auf mindestens 12,5 Prozent. Kompensiert werden könne dies nur durch Rückgriff auf vorhandene Reserven und die Konsolidierung des Haushalts durch deutliche Einsparungen. Auf landeskirchlicher Ebene besteht ein Stellenbesetzungsstopp.
Bundesweit rechnet nach einer epd-Umfrage eine Mehrheit der Landeskirchen und Bistümer in Deutschland für das Jahr 2020 mit Einnahmeverlusten bei der Kirchensteuer von mindestens zehn Prozent. Hauptgrund ist die Kurzarbeit im Zuge der Corona-Pandemie - auf das Kurzarbeitergeld wird keine Kirchensteuer erhoben.
EKD will Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt besser vernetzen
Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) geht weitere Schritte bei der Aufarbeitung und der Prävention in Fällen sexualisierter Gewalt. Eine neu zusammengesetzte Fachstelle "Sexualisierte Gewalt" habe Ihre Arbeit im Juli aufgenommen, teilte die EKD am 15. Juli in Hannover mit. Die Stelle solle mit den Landeskirchen und diakonischen Einrichtungen dafür sorgen, "dass bestehende Maßnahmen verstärkt, noch umfassender vernetzt und auf Dauer verlässliche Vorkehrungen und Strukturen gegen sexualisierte Gewalt geschaffen werden", erklärte Hans Ulrich Anke, Präsident des Kirchenamts der EKD.
Aufgabe der neuen Fachstelle sei auch, die weitere Umsetzung des Elf-Punkte-Handlungsplans zu begleiten. Die EKD hatte den Elf-Punkte-Plan zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der Kirche im Herbst 2018 beschlossen. Der Plan sieht etwa neben einer umfassenden wissenschaftlichen Studie auch die Beteiligung von Betroffenen vor. Im Juni hatte die EKD bekanntgegeben, dass von Oktober an drei Jahre lang in mehreren Teilstudien Ursachen und Strukturen sexualisierter Gewalt untersucht werden. Auch ein Betroffenenbeirat soll im Laufe des Sommers berufen werden. Im vergangenen Jahr hatte die EKD bereits die Zentrale Anlaufstelle "help" eingerichtet.
"Impulse der Landeskirchen zusammenführen"
Leiter der Fachstelle sei der 31-jährige promovierte Politikwissenschaftler Helge Staff, der an der TU Kaiserslautern zu Fragen der inneren Sicherheit und Reformen der Strafgesetzgebung geforscht habe. Nicole Toms (36) werde laut EKD im Fachstellenteam mit dem Schwerpunkt institutionelle und individuelle Aufarbeitung weiterhin tätig sein und Nicole Segert (28) bei der EKD den zukünftigen Betroffenenbeirat begleiten. Beide Kriminologinnen blickten auf mehrjährige Erfahrungen in der Bearbeitung von Fragen sexualisierter Gewalt in kirchlichen Kontexten zurück, hieß es.
Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs, Sprecherin des Beauftragtenrats der EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, erklärte: "Gerade für die dezentral organisierte EKD ist es wichtig, die Impulse der Landeskirchen zusammenzuführen und so umzusetzen, dass von sexualisierter Gewalt betroffene Menschen sich gehört und gewürdigt wissen." Diese sollten erkennen, dass die EKD und die in ihr zusammengeschlossenen Landeskirchen die Themen Prävention, Intervention in aktuellen Fällen und die Aufarbeitung des Geschehenen professionell verankerten.
Dazu sei eine strukturierte und zugleich sensible Betroffenenbeteiligung konstitutiv. Fehrs: "Ich bin überzeugt: Nur so und durch klare Qualitätsstandards lässt sich verhindern, dass das Leid der Missbrauchserfahrungen durch einen unangemessenen Umgang in der Aufarbeitung noch verstärkt wird."
Vatikan veröffentlicht Handbuch für Umgang mit Missbrauchsfällen
Rom (epd). Die vatikanische Glaubenskongregation hat ein Handbuch mit praktischen Anweisungen zum Umgang mit Missbrauchsfällen herausgegeben. Der Leitfaden sei eine "Gebrauchsanweisung" für Bischöfe und Kirchenrechtler, der diejenigen "an der Hand nehmen" wolle, die mit Missbrauchsfällen zu tun haben, betonte der Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Luis Ladaria, am 16. Juli nach Angaben des Vatikans.
Der 16-seitige Text definiert unterschiedliche Formen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbedürftige und schließt auch den Besitz kinderpornografischen Materials mit ein. Bei der in der zuständigen Diözese zu veranlassenden Voruntersuchung sei auch anonymen Hinweisen nachzugehen, heißt es in dem Dokument. Das Handbuch betont, dass allen Hinweisen nachgegangen muss und dabei die jeweils geltenden staatlichen Gesetze beachtet werden müssen.
Die Kirchenbehörden sollen Verdachtsfälle den staatlichen Behörden anzeigen, wenn sie überzeugt sind, dass dies für den Schutz des Opfers oder anderer Minderjähriger nötig sei - auch wenn keine Anzeigenpflicht existiert. Informationen über Missbrauchsfälle, die im Rahmen einer Beichte übermittelt werden, dürfen aber nicht verfolgt werden.
Nicht auf Deutsch
Vor allem mit Blick auf Länder, in denen das Bewusstsein für Missbrauch in der Kirche nicht ausgeprägt ist, erläutert das Handbuch das nach dem geltenden Kirchenrecht und päpstlichen Erlassen gebotene Vorgehen. Im Bezug auf die Entlassung von Tätern aus dem Priesterstand betont es, dies sei "keine Strafe sondern ein administrativer Akt". Das Handbuch warnt vor der früher gängigen Praxis, Missbrauchstäter in andere Diözesen zu versetzen in der Annahme, die "Entfernung des Geistlichen sei eine befriedigende Lösung des Falles".
Der Leitfaden wurde in sechs Sprachen veröffentlicht, darunter Spanisch, Portugiesisch und Polnisch. Im Unterschied zu früheren Dokumenten liegt es nicht in deutscher Sprache vor.
Präses Rekowski hofft auf humane EU-Flüchtlingspolitik

epd-bild/Stefan Arend
Düsseldorf, Berlin (epd). Der evangelische Migrationsexperte Manfred Rekowski hofft auf neuen Schwung in der festgefahrenen europäischen Flüchtlingspolitik. "Dass die deutsche Ratspräsidentschaft hier Bewegung erzeugen will, die humanitäre Lösungen erleichtert und ermöglicht, ist ein sehr positives Vorzeichen", sagte der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im Blick auf die Lage der Menschen in den überfüllten griechischen Flüchtlingscamps sei jeder kleine Schritt und jede Einzelfall-Lösung wichtig und gut.
Der Arzt und Flüchtlingshelfer Christoph Zenses bezeichnet die Zustände im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos als katastrophal. "Hier hinzuvegetieren, das kann man sich nicht vorstellen", sagte der Internist aus Solingen am 14. Juli im WDR. Er sei sprachlos, wütend und frustriert, dass in Moria keine Hilfe ankomme, sagte Zenses, der den Verein "Solingen hilft" gegründet hat und aktuell in dem Camp arbeitet. Trotz anderer Aussagen sei das Camp noch größer geworden. Sein Team schätze, dass in Moria 23.000 statt 16.000 Menschen leben.
Corona-Beschränkungen
Die Flüchtlinge hätten oft Schmerzen und posttraumatische Belastungsstörungen, auch Vergewaltigungen kämen häufig vor. Viele litten unter Problemen beim Wasserlassen, weil sie sich nachts nicht im Stockdunklen auf die Toilette trauten. Oft trete auch Krätze auf, weil die Menschen sehr nah beieinander lebten und schliefen, und es kaum Waschmöglichkeiten gebe. Zusammenarbeit mit Ärzten und dem Krankenhaus auf Lesbos gebe es nicht. Die Versorgung der Menschen finde allein in dem kleinen Container-Hospital im Camp statt. Bis 19. Juli gelten nach Zenses' Worten Corona-Beschränkungen, so dass die Menschen regelrecht eingesperrt seien.
Um die Flüchtlingscamps zu entlasten, drohen die griechischen Behörden nach Angaben von "Ärzte ohne Grenzen" Flüchtlingen mit der Vertreibung aus ihren Unterkünften. Menschen mit schwerwiegenden gesundheitlichen oder psychischen Problemen würden inmitten der Corona-Pandemie gezielt in die die Obdachlosigkeit gedrängt und von finanzieller Unterstützung abgeschnitten, kritisierte die Hilfsorganisation. Auch die medizinische Versorgung sei gefährdet. "Auf dem Viktoria-Platz im Zentrum Athens müssen bereits Hunderte von Geflüchteten unter freiem Himmel kampieren, unter ihnen auch Hochschwangere", erklärte Marine Berthet, medizinische Koordinatorin von "Ärzte ohne Grenzen" in Griechenland.
Ausweisungen
Die Behörden hätten begonnen, mehr als 11.000 Flüchtlinge aus ihren Unterkünften auszuweisen, sowohl auf dem griechischen Festland als auch auf den griechischen Inseln. "Viele dieser Menschen sind äußerst schutzbedürftig", betonte "Ärzte ohne Grenzen". Zu ihnen zählten Opfer von sexueller Gewalt, Folter und Misshandlung, ältere und chronisch kranke Menschen. "Ärzte ohne Grenzen" forderte die griechische Regierung dazu auf, die Räumungsmaßnahmen auszusetzen und mehr Unterkünfte für Flüchtlinge zu schaffen. Im Februar habe die griechische Regierung dafür Mittel der Europäischen Union erhalten.
Militärbischof Rink fordert mehr Wertschätzung für Soldaten

epd-bild/Jürgen Blume
Berlin (epd). Der scheidende evangelische Militärbischof Sigurd Rink fordert mehr Wertschätzung für Soldaten und Polizisten. Man könne ihnen nicht pauschal die Wertschätzung entziehen, sondern müsse im Gegenteil auch dankbar sein, sagte Rink am 14. Juli bei seiner Abschiedspressekonferenz in Berlin. Dieses Thema sei ihm in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, denn schließlich hätten Soldaten und Polizisten ihre Mandatierung durch den Rechtsstaat.
Rink war 2014 als erster hauptamtlicher Militärbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) eingeführt worden. Davor war das höchste Amt der evangelischen Militärseelsorge in Deutschland ein Nebenamt. Der Militärbischof leitet die Seelsorge an den Militärstandorten. Im Oktober wird der frühere EKD-Bevollmächtigte Bernhard Felmberg Rinks Nachfolger in diesem Amt. Rink wechselt nach sechsjähriger Amtszeit auf eine Stelle im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung. Am 22. Juli wird er in der St. Louis-Kirche der Julius-Leber-Kaserne in Berlin - unter Corona-Hygienebedingungen - verabschiedet.
Freiwilligendienst stärken
Der Militärbischof sprach sich dafür aus, den Freiwilligendienst bei der Bundeswehr zu stärken und sich auch grundlegend Gedanken über eine mögliche Dienstpflicht zu machen. Deutschland müsse aufpassen, dass die Streitkräfte immer in der Mitte der Gesellschaft verankert seien und nicht wie in der Weimarer Republik zu einem Staat im Staate würden. Zu Zeiten der Wehrpflicht sei es anders gewesen. "In jeder Großfamilie war jemand mit der Bundeswehr verbunden", sagte Rink. Es brauche solche integrierenden Momente. In anderen Ländern wie Südafrika oder teilweise auch in den USA hätten viele gesellschaftliche Gruppierungen nichts mehr miteinander zu tun. Dabei sei Anteilnahme an der Lebenswirklichkeit anderer Menschen ausgesprochen wichtig für den Zusammenhalt.
Von den mehr als 180.000 Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr sind gut 53.000 evangelisch (rund 29 Prozent) und knapp 41.000 römisch-katholisch (etwa 22 Prozent). Es gibt 105 evangelische und 80 katholische Militärgeistliche.
Kretschmann: Kirchenaustritte senken "soziale Temperatur"

epd-bild/Gerhard Bäuerle
Stuttgart (epd). Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht den Mitgliederschwund der großen Kirchen mit Sorge. Fortgesetzte Austritte könnten die "soziale Temperatur" im Land senken, sagte Kretschmann dem Evangelischen Pressedienst (epd). Menschliche Zuwendung lasse sich nicht gesetzlich regeln. So sei etwa die Hospizbewegung im kirchlichen Raum entstanden - "so was kann der Staat nicht einfach hervorbringen", betonte der Grünen-Politiker.
Eine Entchristlichung der Gesellschaft beobachtet Kretschmann, der auch kirchenpolitischer Sprecher der Landesregierung ist, derzeit aber nicht. Die Verfassung schütze die Menschenwürde, sozial Schwache und den Sonntag. Die Menschen im Land lebten christliche Werte: "Schauen Sie auf die mehrheitliche Einstellung zu Flüchtlingen, Minderheiten, Rassismus: Wann war eine Gesellschaft jemals so christlich wie unsere heute? Nie."
Den Kirchen Reformen empfohlen
Für die Kirchen ist es nach Kretschmanns Einschätzung ein Problem, mit der sich verändernden Welt zurechtzukommen. "Von einem Gottesbild, das immer noch glaubt, Gott lenke die Welt, indem er alles steuert, muss man sich vielleicht mal radikal verabschieden", sagte der Katholik. Um das Entstehen eines Tsunamis oder der Corona-Krise zu erklären, brauche man keine überirdische Macht.
Der Ministerpräsident empfiehlt den Kirchen Reformen, die den Kern des christlichen Glaubens wieder freilegen. Die evangelische Kirche halte sich schon für reformiert, obwohl dieses Ereignis 500 Jahre zurückliege. In der katholischen Kirche gebe es Diskussionsverbote etwa zum Zölibat. Der christliche Glaube müsse jedoch jederzeit säkularen Menschen darstellbar sein.
Seelsorge mit "PFARR-RAD" und Strandkorb

epd-bild/Jörg Nielsen
Harlesiel (epd). Gut gelaunt schiebt Karola Wehmeier ihr leuchtend rotes Fahrrad durch den weißen Sand und lehnt es an den Strandkorb mit der Nummer 77. Rasch noch den Sand vom Sitz gefegt und die Kirchenfahne an dem daneben stehenden Mast aufgezogen. Dann setzt sie sich in den Strandkorb - Füße ausgestreckt mit Blick über die Nordsee auf die Insel Wangerooge. Für die nächsten Stunden ist dies der Arbeitsplatz der Pastorin: "Ich bin schon zu beneiden", sagt sie mit einem Lachen und schlägt die Beine übereinander.
Karola Wehmeier ist Urlauberseelsorgerin am Strand von Harlesiel und in der evangelischen Kirchengemeinde in Carolinensiel - zumindest vorübergehend. Ihre eigentliche Gemeinde ist im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim. Doch seit neun Jahren folgt sie jeden Sommer einem Aufruf der Evangelischen Kirche in Deutschland für den Dienst in der Kurseelsorge. So wie die 53-Jährige unterstützen Hunderte Theologen zwischen der Nordseeküste und dem Allgäu in den Ferien die Ortspastorinnen und -pastoren an beliebten Urlaubszielen.
Urlaub "mit Erwartungen überfrachtet"
Üblicherweise nehmen sie dann die Hälfte der Zeit ihren privaten Erholungsurlaub, für die andere Hälfte werden sie von ihren normalen Diensten freigestellt. Häufig gibt es in den Einsatzorten Ferienwohnungen, die für die Kurseelsorger reserviert sind.
"Viele Menschen leben das ganze Jahr auf den Urlaub hin, der dann auch mit Erwartungen überfrachtet wird", sagt Wehmeier. Doch wenn sie dann zur Ruhe kämen, ploppten die Probleme auf, die im Alltag verdrängt werden. "Dann sprechen mich die Leute hier im Strandkorb oder nach einer Andacht in der Kirche an und fragen, ob ich etwas Zeit für sie habe."
Meist gehe es um Sorgen wegen der Kinder oder Probleme in der Partnerschaft. Um den Corona-Abstand einzuhalten, steht dem Kirchen-Strandkorb in diesem Jahr noch ein weiterer gegenüber. Ein wenig bedauert die Pastorin, dass die Gäste nicht neben ihr Platz nehmen können. "Üblicherweise guckt man sich nicht die ganze Zeit an, sondern schaut meistens auf das Meer und die Inseln", sagt sie. Dann lasse sich vieles leichter von der Seele reden, fast wie in einem Beichtstuhl.
"Keine Therapeutin"
Oft genüge es zuzuhören und vielleicht einen Impuls zum weiteren Nachdenken zu geben, sagt Wehmeier. "Wenn es um größere Probleme geht, verabreden wir uns in der Kirche oder in meiner Ferienwohnung." Dabei kenne sie klar ihre Grenzen. "Ich bin keine Therapeutin. Bei schwerwiegenden Problemen empfehle ich dringend den Weg zum Psychologen."
Auch die Feriengäste verhielten sich in diesem Jahr anders, hat Wehmeier beobachtet. "Der Urlaub hat sich durch Corona verändert." Bei Kirchenführungen sei es stiller als sonst - "da sabbelt sonst eigentlich immer jemand rum". Die Restaurants seien deutlich weniger frequentiert, die Menschen stünden einerseits geduldig und mit gebührendem Abstand an. Zugleich seien sie leichter gereizt: "Ein Paar aus Bayern hat sich bei mir über die laxe Einhaltung der Abstandsregeln beschwert und eine Familie aus Mainz über die allgegenwärtige Maskenpflicht."
"Reden über Gott und die Welt"
Viele Gäste und Einheimische kennen Karola Wehmeier seit Jahren. "Wenn ich wieder im Norden bin, miete ich mir als erstes ein Fahrrad." Daran befestigt sie dann ein Schild mit der Aufschrift "PFARR-RAD" und ihrer Handynummer. Dazu der Hinweis: "Zeit für Dich - Reden über Gott und die Welt oder das, was Dir am Herzen liegt." Einen weiteren laminierten Zettel mit ihrer Nummer legt sie in den Kirchen-Strandkorb. "Viele Menschen nutzen das Angebot."
Demnächst wird sie von einem Kollegen abgelöst, der dann die Seelsorge im Strandkorb 77 für die nächsten zwei bis drei Wochen übernimmt. Ob sie im nächsten Jahr wiederkommt? "Bestimmt", sagt sie und verrät, dass sie eine gebürtige Ostfriesin aus Völlenerkönigsfehn ist: "Das Heimweh zieht mich immer wieder zurück ans Meer."
Kurze Sätze, klare Sprache: EKD wirbt für "BasisBibel"
Hannover (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat die Anfang nächsten Jahres erscheinende "BasisBibel" für die kirchliche Arbeit empfohlen. Die neue Übersetzung mit Altem und Neuem Testament sei in Ergänzung zur Lutherbibel vor allem für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie für die "Erstbegegnung mit der Bibel" geeignet, teilte die EKD am 13. Juli in Hannover mit. Die "BasisBibel" soll am 21. Januar 2021 gedruckt und digital erscheinen. Das Neue Testament der "BasisBibel" ist seit 2010 im Handel. Seit 2012 liegen auch die Psalmen in der neuen Übersetzung vor. Die "BasisBibel" mit dem Neuen Testament und den Psalmen gibt es laut Deutscher Bibelgesellschaft bisher als gedrucktes Buch, in der Reihe "bibeldigital", als Hörbuch sowie kostenlos im Internet und als App für Smartphones und Tablets.
Urtextnah und prägnant
"Wir wollen in unseren Kirchen eine verständliche Sprache sprechen. Das gilt bei aller nötigen Fremdheit auch für die Texte der Bibel", erklärte Annette Kurschus, stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen: "Die BasisBibel leistet einen entscheidenden Beitrag, um Menschen neugierig zu machen auf das Buch der Bücher." Vielen sei die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers lieb und vertraut. Insbesondere jungen Menschen fehle dazu jedoch häufig ein Zugang, so Kurschus, die auch Vorsitzende des Aufsichtsrats der Deutschen Bibelgesellschaft ist.
"Kurze Sätze, eine klare Sprache und Erklärungen zentraler Begriffe am Rand sind die Markenzeichen der BasisBibel", sagte der Generalsekretär der Deutschen Bibelgesellschaft, Christoph Rösel. Sie sei zugleich den Prinzipien des Bibelübersetzers Martin Luther verbunden: urtextnah und prägnant in der Sprache. Unterstützt haben das Übersetzungsprojekt die EKD, Landeskirchen, Gemeinden, Bibelgesellschaften, Verbände, Werke und Einzelpersonen. Die "BasisBibel" orientiere sich nah am griechischen und hebräischen Urtext, und die Sätze umfassen in der Regel nicht mehr als 16 Wörter.
Katholischer Moraltheologe Schockenhoff gestorben
Bonn, Freiburg (epd). Der katholische Moraltheologe Eberhard Schockenhoff ist im Alter von 67 Jahren überraschend gestorben. Die katholische Deutsche Bischofskonferenz würdigte den Bio- und Friedensethiker am 19. Juli für seine visionäre Kraft im theologischen Forschen und Reden. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, attestierte Schockenhoff "eine bemerkenswerte analytische Brillanz in seinem Fachgebet der Moraltheologie aber auch bei Fragen von Kirche und Gesellschaft".
Schockenhoff veröffentlichte 2007 die Studie "Theologie der Freiheit" und unterzeichnete später das Memorandum "Kirche 2011: ein notwendiger Aufbruch". Er setzte sich für stärkere Beteiligung von Laien und Frauen in der katholischen Kirche ein sowie für die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion. Von 2008 bis 2016 gehörte Schockenhoff dem Deutschen Ethikrat an, bis 2012 als stellvertretender Vorsitzender.
Nie mit erhobenem Zeigefinger
Schockenhoff starb am 18. Juli an den Folgen eines Unfalls, wie Medien unter Berufung auf die Universität Freiburg berichteten. Bischof Bätzing erklärte, Schockenhoff habe Moraltheologie nie mit erhobenem Zeigefinger vertreten und nie in Verbotskategorien gedacht. Vielmehr habe er Moral und Ethik für den Menschen und die Kirche verstehbar und lebbar machen wollen.
Der gebürtige Stuttgarter Schockenhoff hat Theologie in Tübingen und Rom studiert und wurde 1978 zum Priester geweiht. Nach Promotion und Vikariat in Ellwangen und Stuttgart kam er an die Theologische Fakultät der Universität Freiburg. 1989 bekam er einen Lehrstuhl in Regensburg. 1994 folgte er einem Ruf als Professor für Moraltheologie nach Freiburg.
Kritik an Umwidmung der Hagia Sophia in Moschee verstummt nicht
Berlin, Hannover (epd). Die Empörung über die Umwidmung der Istanbuler Hagia Sophia in eine Moschee ist nach wie vor groß. Die Evangelische Mittelost-Kommission rief die türkische Zivilgesellschaft am 17. Juli auf, sich für den Schutz religiöser Minderheiten im Land einzusetzen. Die von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angeordnete Umwidmung sei ein "rückwärtsgewandter Schritt", der den christlich-islamischen Beziehungen weltweit großen Schaden zufüge. Der "aus politischem Kalkül getroffene Beschluss" sei ein Ausdruck der Intoleranz gegenüber dem Christentum, heißt es in einer in Hannover veröffentlichten Stellungnahme.
Auch der evangelische Theologe und Altbischof Wolfgang Huber sieht durch die Entscheidung den "Traum von einem friedlichen Zusammenleben der Religionen in der Türkei" am Ende. Die Politisierung des Islam durch Erdogan sei ein Rückschlag für die Türkei und für das Miteinander der Religionen, sagte Huber der Wochenzeitung "Zeit" (online).
"Bruch mit Rücksichtnahme auf christliche Tradition"
Weiter sagte Huber, der von 2003 bis 2009 an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) stand: "Was Erdogan tut, ist ein endgültiger Bruch mit der Rücksichtnahme auf die Jahrtausende alte christliche Tradition in der Region, für die er verantwortlich ist." Für diesen Bruch auch mit dem laizistischen Erbe des Republikgründers Atatürk habe Erdogan kein größeres Symbol als die Hagia Sophia finden können.
Vergangene Woche hatte das türkische Oberste Verwaltungsgericht entschieden, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt werden darf. Daraufhin hatte Staatspräsident Erdogan bekanntgegeben, dass das erste muslimische Freitagsgebet in der Hagia Sophia am 24. Juli stattfinden soll. Auf die Hagia Sophia erheben Muslime und Christen gleichermaßen Anspruch. Denn der prägnante Kuppelbau, ein Wahrzeichen der Istanbuler Altstadt, wurde im Jahr 537 als Kirche geweiht. Danach war sie fast ein Jahrtausend lang die Hauptkirche des byzantinischen Reichs. Dort wurden auch die byzantinischen Kaiser gewählt. Als die Osmanen 1453 die Stadt eroberten, wurde sie zur Moschee umfunktioniert. 1935 wurde sie in ein Museum umgewandelt.
Die Evangelische Mittelost-Kommission bedauerte, dass die Hagia Sophia durch den Beschluss nun zu einem "Symbol der Kontroverse und Konfrontation" gemacht worden sei. Orthodoxe Christen seien durch diesen Schritt "tief verletzt" worden.
"Fanal"
Die gewaltsame Entwidmung durch die muslimischen Eroberer habe damals als Mittel gedient, die Herrschaft des Islam zu demonstrieren, sagte Huber. "Dass Atatürk darunter einen Schlussstrich gezogen und die christliche Ausgestaltung im Innern der Kathedrale wieder sichtbar gemacht hat, nicht nur museal, sondern so, dass man sie als Ort des Gottesdienstes wiedererkannte, war eine große Leistung."
Ihm gehe es nicht darum, eine Moschee abzulehnen oder den Laizismus der Kemalisten zu idealisieren, unterstrich der Theologe. Die Rückwandlung sei "ein Fanal", dessen Gefährlichkeit man nicht überschätzen könne. "Als Christ und Bischof betrübt mich zudem, dass diese Art von Religionspolitik das Vertrauen in den guten Lebenssinn jeglicher Religion beschädigt."
US-Megakirche: Wegen Covid-19 in diesem Jahr keine Gottesdienste mehr
Washington (epd). Eine der größten Megakirchen der USA will wegen der Corona-Pandemie frühestens im Jahr 2021 wieder Gottesdienste mit direkter Teilnahme feiern. In einem Online-Video an seine Gemeinde erklärte "North Point Ministries"-Pastor Andy Stanley am 15. Juli, bei Präsenzgottesdiensten könne er die Sicherheit der Gläubigen nicht garantieren. Zu den North-Point-Gottesdiensten kommen nach Angaben der Freikirche in Alpharetta im US-Staat Georgia in der Regel mehr als 30.000 Menschen. Die 1995 gegründete Gemeinde hat sieben Niederlassungen in Georgia und nach eigenen Angaben weltweit mehr als 90 Partnerkirchen. Die Kirche will jetzt ihre digitale Präsenz ausbauen.
Im Mai sei er noch davon ausgegangen, dass die Kirche im August wieder öffnen werde, sagte Stanley. Damals seien die Infektionszahlen nach unten gegangen. Das sei nicht mehr der Fall. In Georgia und weiteren Südstaaten geht die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen stark nach oben.
Gesellschaft
"Das war Terror"

epd-bild/Georg Wittmann
Magdeburg (epd). 9. Oktober 2019: Vor der Synagoge in Halle fallen Schüsse. Der heute 28-jährige Stephan B. ist dabei, seinen unfassbaren, grausamen Plan auszuführen und in dieser Synagoge der Jüdischen Gemeinde in der Saalestadt ein Massaker anzurichten. Weil er jedoch die abgeschlossene Tür vor dem Gebäude nicht überwinden kann, erschießt er schließlich willkürlich zwei Menschen auf offener Straße. Dieser offenkundig rechtsextreme und antisemitische Anschlag erschütterte die Öffentlichkeit weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Wegen Mordes in zwei Fällen und versuchten Mordes in 68 Fällen muss sich der Attentäter vom 21. Juli an vor Gericht verantworten.
Der Generalbundesanwalt hatte kurz nach der Tat die Ermittlungen übernommen, schnell schien klar: "Das war Terror." Ende April erhob die Bundesanwaltschaft Anklage gegen Stephan B., der sich neben den Mordvorwürfen auch für gefährliche Körperverletzung, versuchte räuberische Erpressung mit Todesfolge, besonders schwere räuberische Erpressung, Volksverhetzung und fahrlässige Körperverletzung verantworten muss. Bis Mitte Oktober sind vorerst 18 Verhandlungstage am Magdeburger Landgericht geplant. Die Verhandlung führt der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichtes Naumburg. 40 Nebenkläger sind zugelassen, darunter Angehörige der Opfer und Mitglieder der Jüdischen Gemeinde.
Tat im Internet gestreamt
In der Anklageschrift heißt es: "Stephan B. plante aus einer antisemitischen, rassistischen und fremdenfeindlichen Gesinnung heraus einen Mordanschlag auf Mitbürgerinnen und Mitbürger jüdischen Glaubens." Dazu habe er sich mit acht Schusswaffen, mehreren Sprengsätzen, Helm und Schutzweste ausgerüstet und sei am 9. Oktober 2019 zur Synagoge in der Humboldtstraße in Halle gefahren. Zum Zeitpunkt des Attentats hielten sich in der Synagoge zum höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur 52 Gläubige auf, darunter viele Gäste von außerhalb. Der Attentäter filmte seine Tat mit einer Helmkamera und verbreitete die Aufnahmen im Internet. In den sozialen Netzwerken leugnete er laut Anklage auch den Holocaust.
Eine fast unscheinbare Holztür in einer Steinmauer verhindert am 9. Oktober 2019 das Eindringen des Attentäters auf das Synagogengelände. Stephan B. erschießt dann vor der Synagoge eine 40 Jahre alte Passantin, die zufällig vorbeikommt und ihn offenbar angesprochen hat. Er soll der Frau mehrfach in den Rücken geschossen haben. In einem nahe gelegenen Döner-Imbiss erschießt Stephan B. dann einen weiteren Menschen: Der 20 Jahre alte Mann verbrachte in dem Imbiss seine Mittagspause. Später, auf der Flucht, feuert der Täter in Landsberg-Wiedersdorf auf einen Anwohner und seine Lebensgefährtin und verletzt sie schwer. Den Tod der beiden nahm er dabei laut Anklageschrift billigend in Kauf.
Fluchtversuch
Seit seiner Festnahme sitzt Stephan B. in Untersuchungshaft, nach einem gescheiterten Fluchtversuch wurde er von der JVA Halle in das Hochsicherheitsgefängnis nach Burg verlegt. Laut einem "Spiegel"-Bericht vom 18. Juli attestiert der forensische Psychiater Norbert Leygraf dem Attentäter in einem Gutachten für den Prozess eine komplexe Persönlichkeitsstörung mit autistischen Zügen. Seine Schuldfähigkeit sei dennoch nicht beeinträchtigt gewesen. Der Täter habe nicht im Wahn gehandelt, das Unrecht seiner Taten sei ihm bewusst gewesen.
Aus Platzgründen findet der Prozess am Magdeburger Landgericht statt, nicht in Naumburg. Das Medieninteresse ist groß. Im Sitzungssaal selbst können 44 Medienvertreter und 50 Zuschauer den Prozess verfolgen. Die Plätze wurden ausgelost. Weitere 29 Presseplätze gibt es in einem Raum mit Tonübertragung. Neben strengen Sicherheitsvorkehrungen gibt es auch Corona-Maßnahmen. Ein Mund-Nasenschutz ist vorgeschrieben.
Auch Deniz Yücel von Rechtsextremisten bedroht
Die Affäre um rechtsextremistische Drohmails zieht weitere Kreise. Am Wochenende berichteten Medien über weitere 15 Adressaten, darunter den Journalisten Yücel. Unterdessen werden Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt gefordert.Frankfurt a.M., Berlin (epd). Die Drohmails gegen Politikerinnen, Künstlerinnen und andere Prominente reißen nicht ab. Auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel ist einem Zeitungsbericht zufolge Ziel eines rechtsextremistisches Drohschreibens, das mit "NSU 2.0" unterzeichnet wurde. Ein anonymer Verfasser habe am 17. Juli mindestens zwei E-Mails mit identischem Inhalt an insgesamt 15 Adressaten geschickt, berichtete die "Welt am Sonntag". In dem ihr vorliegenden Schreiben tauche erstmals der Name Deniz Yücel auf.
Zu den Empfängern gehörten neben dem hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU) erneut die Linken-Fraktionschefin im Wiesbadener Landtag, Janine Wissler, und die Berliner Kabarettistin Idil Baydar. Der aus Flörsheim am Main stammende Yücel sagte der Zeitung: "Ich finde es verstörend, dass ich erst durch die Recherchen meiner 'Welt'-Kollegen von diesem Drohschreiben erfahren habe." Weder die Polizei in Hessen noch in Berlin, wo Yücel lebt, habe sich bislang mit ihm in Verbindung gesetzt. Ein Sprecher des hessischen Innenministeriums bestätigte der Zeitung, dass man die neuen Drohschreiben kenne.
Offenbar nicht von der Polizei unterrichtet
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte die Ermittlungsbehörden auf, die Serie der Morddrohungen ernst zu nehmen und mit Hochdruck aufzuklären. "Wenn einzelne Betroffene, darunter 'Welt'- Korrespondent Deniz Yücel, von der Polizei nicht über eine gegen sie gerichtete Morddrohung informiert werden, stimmt etwas nicht mit der Sorgfalt der Ermittlungen", erklärte DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall.
Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtete, dass zwei weitere Frauen Drohmails erhalten hätten. Es handle sich um eine Berliner Kolumnistin und eine Strafverteidigerin aus München. Sie hätten der Zeitung gesagt, die hessische Polizei habe sie im vergangenen Jahr informiert, dass Briefe abgefangen worden seien, die derselben Quelle zugerechnet würden. Beide Frauen wollten jedoch zu ihrem Schutz anonym bleiben.
Erstmals waren die Drohschreiben 2018 an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz geschickt worden. Im Februar kam die Linken-Politikerin Wissler hinzu. Persönliche Daten über die beiden und auch die seit 2019 bedrohte Kabarettistin Baydar waren zuvor von Polizeicomputern aus Frankfurt und Wiesbaden abgerufen worden. Die Ermittlungen verliefen bisher im Sande. Dadurch geriet Innenminister Beuth gehörig unter Druck. Er berief einen Sonderermittler und versetzte Hessens Polizeichef Udo Münch in den vorzeitigen Ruhestand. Zugleich machte er deutlich, dass er auch Zweifel an der Informationsweitergabe durch das Landeskriminalamt habe.
Ruft nach Bundesanwaltschaft
Der hessische Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Dirk Pegelow, bezeichnete diese öffentliche Kritik in einem Gespräch mit der Tageszeitung "Die Welt" (20. Juli) als "verfrüht und vor allem in der Sache und auch im Ton nicht angebracht". Zur Aufklärung der Affäre schlug er noch eine externe Person vor, "zum Beispiel eine Richterin oder ein Richter im Ruhestand".
Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle verlangte, die Ermittlungen auf Bundesebene zu ziehen. Dem Täter gehe es darum, Personen mit wichtigen Funktionen in der pluralistischen Gesellschaft einzuschüchtern, sagte er der "Welt". "Um dem Staatsschutz-Charakter der Vorfälle Rechnung zu tragen, sollte deshalb der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernehmen."
Künast: Drohmails sind große Gefahr für Frauen - und das ganze Land

epd-bild/Thomas Lohnes
Berlin (epd). Die Grünen-Politikerin Renate Künast sieht in den Drohmails in Hessen eine Steigerung der Hass-Attacken im Netz. Künast sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin, insbesondere Frauen, die aktiv sind, würden massiv bedroht. Für einige in der rechtsextremen Szene, aus der die Mails kommen, seien solche Frauen eine Zumutung: "Wir erleben aktuell, dass sie zur nächsten Stufe übergegangen sind, nämlich Frauen mit dem Tod zu drohen."
Mit Blick auf Abfragen persönlicher Daten von hessischen Polizeicomputern, die den Mails vorausgingen, sprach Künast von einer "wahnsinnigen Gefahr für die Frauen". Die Vorgänge gefährdeten aber auch eine der Grundfesten der Gesellschaft, dass Sicherheitsbehörden sich an Recht und Gesetz hielten. "Wenn aus diesen Institutionen so agiert wird, ist das eine Gefahr für das ganze Land und nicht nur für die betroffenen Personen", betonte Künast.
Kritik an Ermittlern
Die frühere Verbraucherministerin und Juristin Künast, die vor Berliner Gerichten gegen Hass-Attacken aus dem Netz gegen sie selbst vorgegangen ist, sieht vor dem Hintergrund der digitalen Verbreitung den Umgang der Justiz mit Beleidigungen und Drohungen kritisch. Sie hat in Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde eingereicht mit dem Ziel, die rechtliche Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten in Hinblick auf die schwerwiegenden Folgen durch die Digitalisierung zu schärfen.
"Im analogen Zeitalter war die Reichweite von solchen Beleidigungen und Drohungen begrenzt, und die Erinnerung verblasste auch irgendwann. Im digitalen Zeitalter verblasst gar nichts", sagte Künast: "Deshalb brauchen diejenigen, die solchen Bedrohungen ausgesetzt sind, eine andere rechtliche Unterstützung." In bisherigen Verfahren sei vielfach nicht richtig ermittelt oder zu schnell eingestellt worden, kritisierte Künast: "Viele Staatsanwaltschaften haben offenbar keine Vorstellung davon, was Politiker und Personen des öffentlichen Lebens oder auch Ehrenamtler und Kommunalbeamte so aushalten müssen."
Es gebe inzwischen Hinweise, dass eine Mehrheit der Frauen ihre Meinung im Internet nicht äußere, weil sie die Reaktionen fürchte, sagte Künast. Das dürfe man nicht zulassen und das müsse auch in der Rechtsprechung eine Rolle spielen.
Neuer Corona-Ausbruch in Geflügel-Schlachthof in Niedersachsen
Nach einem erneuten Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb geht die Diskussion über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie weiter. Die Bundesregierung will ein Verbot von Werkverträgen auf den Weg bringen. NRW kündigt mehr Kontrollen an.Vechta, Düsseldorf (epd). Bund und Länder wollen bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie mehr Tempo machen. Laut einem Zeitungsbericht will die Bundesregierung offenbar noch im Juli einen Gesetzentwurf zum Verbot von Werkverträgen beschließen. NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kündigte einen Ausbau der Arbeitsschutzbehörden an. Niedersachsen will höhere Standards für die Unterbringung von Werkvertragsarbeitern einführen. Unterdessen gibt es erneut einen Corona-Ausbruch in einem Geflügel-Schlachtbetrieb.
In einem "Wiesenhof"-Betrieb im niedersächsischen Lohne haben sich 66 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, wie der Landkreis Vechta mitteilte. Das Gesundheitsamt habe alle Infizierten bereits in Quarantäne geschickt, hieß es. Die engen Kontaktpersonen seien zum Großteil ermittelt und befänden sich ebenfalls in Quarantäne. Die restlichen Kontakte würden derzeit nachverfolgt.
Kossen: "Moderne Sklaverei" beenden
Angesichts dieses aktuellen Falls erneuerte der katholische Pfarrer Peter Kossen am Sonntag seine Kritik an den Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Die "moderne Sklaverei" mit Werkverträgen, Subunternehmen und maroden Sammelunterkünften müsse beendet werden, forderte der Gemeindepfarrer aus Lengerich, das zum Bistum Münster gehört. Nur gesetzlich erzwungene Mindeststandards könnten die Wende herbeiführen.
Die Bundesregierung will das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigte Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie offenbar schon in diesem Monat auf den Weg bringen. Das Gesetz könnte dann im September oder Oktober den Bundestag passieren und spätestens zum neuen Jahr gelten, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". "Ausbeutung darf in Europa nicht Geschäftsmodell sein", sagte Heil der Zeitung.
In Niedersachsen sollen für die Unterbringung von Tausenden Werkvertragsarbeitern künftig offenbar höhere Standards gelten, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (18. Juli) berichtete. So sollen jedem Arbeiter unter anderem mindestens zehn Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung stehen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Pläne von SPD und CDU.
Laumann will Arbeitsschutz stärken
NRW-Arbeitsminister Laumann kündigte eine Verstärkung des Arbeitsschutzes in seinem Bundesland an. Unter anderem solle künftig dauerhaft in jedem der großen Schlachthöfe ein Mitarbeiter des Arbeitsschutzes direkt im Betrieb sitzen, "um Missstände rechtzeitig zu erkennen", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".
In den vergangenen Wochen war es in mehreren Fleischfabriken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu teils massiven Corona-Ausbrüchen gekommen, unter anderem bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, im ebenfalls zu "Wiesenhof" gehörenden Putenschlachthof Geestland in Wildeshausen bei Oldenburg und bei Westfleisch in Coesfeld.
Gegen Tönnies ermittelt die Bielefelder Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Konzernchef Clemens Tönnies kündigte im "Westfalen-Blatt" (18. Juli) an, die über Werkverträge beschäftigten Mitarbeiter in Tochterfirmen des Unternehmens fest anzustellen und ihre Wohnsituation zu verbessern.
Tönnies will Werkvertragsarbeiter fest anstellen
Nach dem Schlachtbetrieb hat auch die Fleischzerlegung bei Tönnies nach der Corona-Schließung die Arbeit wieder aufgenommen - begleitet von Protesten von Tierschützern. Konzernchef Tönnies kündigt die Übernahme von Werkvertragsarbeitern an.Bielefeld (epd). Gut vier Wochen nach dem massenhaften Corona-Ausbruch haben mehr als 2.700 Mitarbeiter der Fleischzerlegung beim Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück am Freitag unter Sicherheitsmaßnahmen wieder ihre Arbeit aufgenommen. Zuvor war bereits der Schlachtbetrieb gestartet. Tierschützer und Globalisierungskritiker demonstrierten vor dem Betrieb. Konzernchef Clemens Tönnies kündigte unterdessen eine Übernahme der Werkvertragsarbeiter in Tochtergesellschaften des Unternehmens an.
Bereits bis September sollten die ersten 1.000 Werkvertragsarbeiter direkt bei Firmen der Gruppe angestellt werden, sagte Tönnies dem in Bielefeld erscheinenden "Westfalen-Blatt" (Samstag). Die Bundesregierung plant zum Jahreswechsel ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in der Fleischindustrie.
Änderungen der Unterbringung geplant
Zugleich kündigte der Unternehmenschef Veränderungen bei der Wohnsituation der Beschäftigten an: "Wir wollen, dass die 30 Prozent der Mitarbeiter, die heute nicht privat wohnen, zu einem vorgegebenen Standard wohnen können." Tönnies sprach sich zudem für eine Erhöhung des Mindestlohns für die Fleischwirtschaft aus. Das könne er aber nicht alleine machen, "da muss die Branche insgesamt mitziehen".
Die gegen ihn und das Unternehmen erhobenen Vorwürfe nach dem massiven Corona-Ausbruch im Fleischwerk in Rheda-Wiedenbrück wies der Konzernchef zurück. "Wir haben uns immer an Recht und Gesetz gehalten", sagt er der Zeitung. Im laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegen die Geschäftsführung des Konzerns wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz kooperiere das Unternehmen vollumfänglich.
Nach dem Corona-Ausbruch in dem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies Mitte Juni waren rund 1.500 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden. Nach mehrwöchiger Schließung hatte die Stadt Rheda-Wiedenbrück bereits am Mittwoch den schrittweisen Beginn der Schlachtung wieder erlaubt. Am Freitag startete der Zerlegebetrieb unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen.
Demonstrationen zum Produktionsbeginn
Das erhöhte Infektionsrisiko sei etwa durch Trennelemente aus Plexiglas und zusätzliche Luftfiltersysteme minimiert worden, erklärte die Stadt. Zudem dürften zunächst nicht mehr als 10.000 Tiere geschlachtet und verarbeitet werden. Alle Beschäftigten werden zweimal wöchentlich auf Corona getestet. In allen Betriebsgebäuden müssen die Beschäftigten einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Arbeitskräfte müssen untereinander den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
Die globalisierungskritische Initiative Attac kritisierte bei ihrer Protestaktion am 17. Juli eine maximale Ausbeutung mit brutaler Tierquälerei und Zerstörung der Natur in der Fleischindustrie. Zum Protest gegen eine umweltvernichtende Tierindustrie hatte unter anderem ein Bündnis von Organisationen wie Fridays for Future, Peta und Extinction Rebellion aufgerufen. Ebenfalls am Werksgelände veranstalteten Landwirte eine Gegendemo. Die beiden Demonstrationen mit insgesamt 400 Teilnehmern verliefen nach Angaben der Polizei friedlich. Anschließend habe es noch eine Sitzblockade gegeben. Gegen 15 Personen, die der Aufforderung, die Straße zu verlassen, nicht nachkamen, sei ein Strafverfahren wegen Nötigung eingeleitet worden.
Neonaziopfer Noël Martin gestorben
Potsdam, Birmingham (epd). Rund 24 Jahre nach einem rassistischen Anschlag in Brandenburg ist der dabei schwer verletzte Brite Noël Martin am 14. Juli in seiner Heimatstadt Birmingham gestorben. Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bekundete seine Trauer und rief zum Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus auf. Seit dem Angriff im Juni 1996 in Mahlow bei Berlin war Noël Martin vom Hals abwärts gelähmt und pflegebedürftig. Der gebürtige Jamaikaner wurde 60 Jahre alt.
Noël Martin habe "nach dieser schrecklichen Tat die Kraft gefunden, vor allem Jugendliche vor Rassismus und Rechtsextremismus zu warnen und für Toleranz und Verständigung einzutreten", erklärte Woidke am 15. Juli in Potsdam: "Durch seinen unerschütterlichen Willen und seine klare Haltung, sich für ein gewaltfreies Miteinander einzusetzen, ist er für viele zu einem Vorbild geworden."
"Sein Schicksal ist uns Verpflichtung"
Der Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, betonte Woidke. Die jüngsten Ereignisse etwa in Halle und Hanau zeigten eindrücklich, wie wichtig und notwendig dieses Engagement sei. "Wir können nicht ungeschehen machen, was Noël Martin in unserem Bundesland passiert ist", sagte der Ministerpräsident: "Aber sein Schicksal ist uns Verpflichtung, diesen Kampf in seinem Sinne fortzusetzen."
Noël Martin sei vor rund einer Woche in Birmingham ins Krankenhaus gekommen und später auch auf der Intensivstation behandelt worden, sagte Michael Ferguson, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Noël-und-Jacqueline-Martin-Stiftung, dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Ab dem 13. Juli habe er dort auch wieder Besuch empfangen dürfen und hätte so beim Sterben begleitet werden können. Ein Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.
"Er wird uns fehlen, als Vorbild, als Mensch", sagte Ferguson. Er hoffe, dass die Arbeit der Stiftung in Martins Sinne fortgeführt werde. Die Stiftung steht seit 2008 unter der treuhänderischen Verwaltung der Stiftung "Großes Waisenhaus zu Potsdam". Weitere Trauerbekundungen kamen unter anderem von der Linken und den Grünen.
Stein ins Auto geschleudert
Noël Martin wurde am 23. Juli 1959 in St. Thomas auf Jamaika geboren und hat seit seinem zehnten Lebensjahr in England gelebt. Am 16. Juni 1996 wurde er Opfer eines rassistischen Angriffs in Mahlow am südlichen Berliner Stadtrand. Die beiden Täter, damals 17 und 24 Jahre alt, hatten ihn und zwei Kollegen verfolgt und dann einen Stein gezielt in das Auto geschleudert. Martin verlor die Kontrolle über seinen Wagen und brach sich bei dem anschließenden Unfall zwei Halswirbel. Das Landgericht Potsdam verurteilte die Täter im Dezember 1996 zu Haftstrafen von fünf und acht Jahren.
Im Sommer 2001 kehrte Noël Martin nach Mahlow zurück, um eine Demonstration gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anzuführen. Damals regte er den Angaben zufolge Begegnungen zwischen Jugendlichen aus der Region und Birmingham an. Aus diesem Austausch hat sich die Noël- und Jacqueline-Martin-Stiftung entwickelt, die den Jugendaustausch weiterführt.
Bundesregierung verteidigt Ermittlungen zum Migrationshintergrund
Die Debatte um Ermittlungen zum Migrationshintergrund von Tatverdächtigen nach den Krawallen in Stuttgart geht weiter. Die Bundesregierung verteidigt das Vorgehen, ein Kriminalpsychologe widerspricht.Berlin (epd). Die Bundesregierung hat die Ermittlungen der Stuttgarter Polizei zum Migrationshintergrund von Tatverdächtigen nach den Krawallen von Ende Juni verteidigt. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte am 13. Juli in Berlin, dass es in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni in Stuttgart einen Gewaltexzess gegeben habe, "wie er in dieser Form bisher unbekannt war". Die Polizei forsche dieses "Phänomen" nun unter allen möglichen Perspektiven aus, um Straftaten zur Anzeige zu bringen sowie um zu prüfen, ob künftig Präventionsstrategien entwickelt werden zu können. Unterstützt wurde diese Position von der Polizeigewerkschaft, Einwände kamen hingegen von einem Kriminalpsychologen.
Der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz hatte angekündigt, dass bei den Ermittlungen zu den Ausschreitungen von 400 bis 500 meist jungen Männern auch bei den Tatverdächtigen mit deutschem Pass die Abstammung recherchiert werde. Daran gab es heftige Kritik von SPD-Politikern, Grünen und Linken.
"Standardvorgehen"
Der Innenministeriumssprecher betonte, dass bei Jugendlichen und Heranwachsenden Präventionsaspekte von besonderer Bedeutung seien. Deshalb sei es "polizeiliches Standardvorgehen", dass auch das soziologische Umfeld miteinbezogen werde. Es mache einen deutlichen Unterschied, ob jemand erst seit einigen Wochen im Land sei oder hierzulande geboren worden sei und eine starke Bindung an die Gesellschaft habe.
Regierungssprecher Steffen Seibert kritisierte den Begriff "Stammbaumforschung" in der Debatte. Dieses historisch belastete Wort verbiete sich in dem Zusammenhang, sagte er.
Der Kriminalpsychologen Thomas Bliesener erklärte, Ermittlungen zum Migrationshintergrund von Tatverdächtigen wie in Stuttgart taugten aus seiner Sicht nicht zur Prävention. "Den Migrationshintergrund der Eltern bei den Standesämtern abfragen, bringt da nichts", sagte der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen in Hannover dem epd.
Damit polizeiliche Präventionsmaßnahmen wirken können, müsse vielmehr auf die Motivation von Straftätern und die konkreten Lebensumstände geschaut werden und nicht darauf, welchen Pass die Täter oder ihre Eltern hätten, betonte Bliesener. So spiele beispielsweise bei Flüchtlingen deren Bleibeperspektive in Deutschland eine Rolle dafür, ob sie strafrechtlich eher in Erscheinung treten, und nicht die Frage, woher sie stammen. Auch Faktoren wie beengte Wohnverhältnisse, der Umgang innerhalb der Familie und die Reaktion von Angehörigen auf Straftaten könnten für die polizeiliche Präventionsarbeit wichtig sein.
"Wichtige Dinge"
Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Baden-Württemberg, Hans-Jürgen Kirstein, bezeichnete die Herkunftsrecherche dagegen als sinnvoll. Polizeiliche Arbeit enthalte immer das Erstellen von Täterprofilen. "Wenn wir einen Dunkelhäutigen suchen, dann weil die Täterbeschreibung so ist und nicht, weil wir Spaß daran hätten, anders Aussehende zu kontrollieren", sagte er dem SWR.
Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte Ende Juni ebenfalls detaillierte Informationen zum Hintergrund der Täter der Stuttgarter Krawallnacht verlangt. "Wenn das bestimmte Milieus sind, die jetzt aus Migranten-Communitys oder so kommen - das sind wichtige Dinge, mit denen kann man dann was anfangen", sagte er.
Innenministerium verteidigt Zusammenarbeit mit Zentralrat der Muslime
Berlin (epd). Das Bundesinnenministerium hat die Zusammenarbeit der Bundesregierung mit dem Zentralrat der Muslime verteidigt. Eine Sprecherin teilte am 16. Juli in Berlin mit, für Minister Horst Seehofer (CSU) "ist es in gesellschafts- und integrationspolitischer Hinsicht unverzichtbar, zu den Religionsgemeinschaften in Deutschland gute Kontakte aufzubauen und zu pflegen". Die sei auch in Hinblick auf muslimische Religionsvertreter "geradezu ein Muss".
Union und Linke hatten zuvor die Zusammenarbeit der Regierung mit dem Zentralrat der Muslime kritisiert, nachdem der Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht den dem Zentralrat angehörenden Verband Atib ("Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine in Europa") der türkisch-rechtsextremistischen Bewegung der Grauen Wölfe zugerechnet hat. Atib ist Gründungsmitglied im Zentralrat der Muslime in Deutschland.
Keine Schirmherrschaft
Die Ministeriumssprecherin erklärte dazu, es sei seit langem bekannt, dass zu den Mitgliedsvereinen des Zentralrats "in einem beträchtlichen Umfang" auch Organisationen gehörten, die von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder beobachtet werden. Dennoch sei der Zentralrat aufgrund der Vielfalt der Verbände unter seinem Dach Teil von Dialogformaten der Bundesregierung. Das Bundesinnenministerium verfolge zugleich die Entwicklung des Zentralrats und, "nicht ohne Sorge", auch die seiner Mitgliedsverbände. Es stehe zudem im laufenden Austausch mit dem Zentralrat der Muslime.
Das Ministerium stellte außerdem klar, dass Seehofer nicht die Schirmherrschaft für einen vom Zentralrat verliehenen Preis übernommen hat. Er habe in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Zentralrats Anfang Juli 2020 lediglich eine Teilnahme des Ministeriums an der Verleihung des Marwa-El-Sherbini-Preises für Zivilcourage zugesagt. Die Preisträgerin ist Mevlüde Genc, die beim rechtsextremistisch motivierten Brandanschlag in Solingen 1993 fünf Familienmitglieder verloren hat. Sie wird für ihren Einsatz für Versöhnung und Verständigung geehrt.
"Überhöhung der türkischen Ethnie"
Zur Einordnung der Atib erklärte das Ministerium in Übereinstimmung mit dem Verfassungsschutzbericht, der Verband sei der türkisch-rechtsextremistischen "Ülkücü"-Bewegung zuzurechnen, deren Ideologie eine "Überhöhung der türkischen Ethnie, Sprache, Kultur und Nation" zugrunde liege. Dies widerspreche der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Deutschlands. Die als "Graue Wölfe" bezeichneten Anhänger der "Ülkücü"-Bewegung seien in Deutschland in der Regel "nach außen hin um ein friedliches und gesetzeskonformes Verhalten bemüht". Jedoch propagierten insbesondere über das Internet vernetzte Jugendliche teilweise ihren Rassismus offen und riefen zu Gewalt auf.
Steinmeier und EKD gratulieren Zentralrat zum 70. Geburtstag

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat den Zentralrat der Juden als "wichtige Stimme" der deutschen Zivilgesellschaft gewürdigt. Immer wieder habe der Zentralrat die Bedeutung einer Erinnerungskultur in Deutschland hervorgehoben, sagte der Theologe. Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist am 19. Juli 70 Jahre alt geworden.
Wie sehr die jüdische Stimme ein unverzichtbarer Beitrag zur öffentlichen Diskussion in Deutschland geworden sei, zeige das hohe Ansehen, das der derzeitige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, genieße. Schuster ist auch neues Mitglied des Deutschen Ethikrats.
100.000 Mitglieder
Das Jubiläum wurde wegen der Corona-Pandemie digital mit verschiedenen Online-Formaten begangen. Derzeit gehören dem am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründeten Zentralrat nach eigenen Angaben 105 jüdische Gemeinden mit rund 100.000 Mitgliedern an.
"Was nach der Schoa als Provisorium startete, ist heute integraler Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Das jüdische Leben gehört dazu", erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster: "Wir sind in Deutschland zu Hause. Zugleich beobachten wir aufmerksam die politische und gesellschaftliche Entwicklung des Landes."
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den Zentralrat der Juden ebenfalls als bedeutsame Stimme, "die gebraucht und gehört wird". Er dankte dem Rat für seinen Beitrag zur Entwicklung, Verankerung und öffentlichen Wahrnehmung jüdischen Lebens in Deutschland. "Ich bin sehr dankbar, dass sich jüdisches Leben in Deutschland in seiner ganzen Vielfalt in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat", betonte er.
Aufschwung mit Zuwanderung aus Sowjetunion
Der Zentralrat der Juden in Deutschland sollte nach seiner Gründung zunächst nur eine Interessenvertretung während einer Übergangszeit bis zur endgültigen Ausreise sein. Zu den Überlebenden des Holocaust kamen die Rückkehrer aus dem Exil und Juden aus Osteuropa. In den Nachkriegsjahren blieb die Zahl der jüdischen Gemeinden in der Bundesrepublik relativ konstant. Etwa 26.000 Gemeindemitglieder bildeten rund 50 Gemeinden. In der DDR lebten nach offiziellen Angaben rund 500 Juden in fünf Gemeinden, die 1990 in den Zentralrat aufgenommen wurden. Seit den 90er Jahren sind die Gemeinden durch Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion stark gewachsen.
Bundesregierung bedauert Umwandlung der Hagia Sophia in Moschee

epd-bild / Agata Skowronek
Berlin, Wien (epd). Die Bundesregierung hat ihr Bedauern über die geplante Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee zum Ausdruck gebracht. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am 13. Juli in Berlin, Deutschland messe dem interreligiösen Dialog einen hohen Wert bei. Die Hagia Sophia habe große kulturhistorische und religiöse Bedeutung sowohl für das Christentum als auch für den Islam.
Der Status der ausschließlichen Nutzung des Bauwerks als Museum habe Menschen aller Glaubensrichtungen zu jedem Zeitpunkt freien Zugang "zu diesem Meisterwerk" ermöglicht, sagte der Regierungssprecher. Nun gelte es abzuwarten, wie die Ausgestaltung der Nutzung erfolgen werde. Am Freitag hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei die Umwandlung der Moschee in ein Museum annulliert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte im Anschluss verfügt, dass am 24. Juli erstmals offiziell islamische Gebete in der Hagia Sophia abgehalten werden sollen.
"Historischer Fehler"
Ein Außenamtssprecher äußerte sein Bedauern darüber, dass die Unesco bezüglich einer Umnutzung des Welterbes nicht konsultiert worden sei. Es sei derzeit noch unklar, wann die wegen der Corona-Pandemie abgesagte Sitzung der UN-Organisation nachgeholt werde, aber die Hagia Sophia werde dann mit Sicherheit auf die Tagesordnung kommen.
Die Hagia Sophia ist als Teil der Altstadt von Istanbul seit 1985 Unesco-Weltkulturerbe. Sowohl Christen als auch Muslime erheben Anspruch auf die ehemalige Kirche.
Der Osnabrücker Religionssoziologe Rauf Ceylan nannte die Entscheidung einen "historischen Fehler" und auch in theologischer Hinsicht fragwürdig. "Christliche Gotteshäuser sind im Islam geschützt. Für die christlich-orthodoxe Welt ist die Hagia Sophia immer noch wichtig", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Tausende Gläubige pilgern jedes Jahr dorthin. Das ist ein Stich ins Herz der orthodoxen Welt."
Rein funktional sei die Entscheidung Erdogans nicht nachvollziehbar, sagte der stellvertretende Leiter des Instituts für Islamische Theologie der Universität Osnabrück: "Niemand braucht diese Moschee. Direkt gegenüber befindet sich die Blaue Moschee." Zudem habe auch die Hagia Sophia Räume, die für muslimische Gebete offen stehen. Ceylan äußerte zudem die Befürchtung zudem, dass Erdogans Anweisung den Dialog von Muslimen und Christen in Deutschland belasten könnte.
Religiöser Bildschmuck
Der Ostkirchen-Experte Erich Leitenberger bezeichnete die geplante Umwandlung als "traurigen Vorgang". Diese Maßnahme trage nicht dazu bei, den interreligiösen Dialog zu stärken und Vertrauen zu schaffen. Es sei jetzt eindeutig klar, dass die Hagia Sophia jetzt eine Moschee sei wie alle anderen, sagte er dem epd.
Es sei kein Zufall, dass die Verwaltung der Hagia Sophia sofort dem Diyanet, dem Präsidium für Religionsangelegenheiten in der Türkei, übergeben worden sei, erklärte Leitenberger. Man könne die Hagia Sophia zwar wie die Blaue Moschee außerhalb der Gebetszeiten besuchen. Aber nur muslimische religiöse Handlungen seien in Zukunft darin erlaubt. Leitenberger äußerte die Hoffnung, dass der religiöse Bildschmuck der Hagia Sophia erhalten bleibt und nicht abgedeckt wird.
Die Hagia Sophia wurde als "Kirche der göttlichen Weisheit" im Jahr 537 geweiht und war fast ein Jahrtausend lang die christliche Hauptkirche Konstantinopels. Als die Osmanen 1453 die Stadt eroberten, wurde sie zur Moschee umfunktioniert. 1935 wurde sie in ein Museum umgewandelt.
Weniger Abschiebungen wegen Corona-Pandemie
Unter Corona-Bedingungen ist die Zahl der Abschiebungen im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen. Der Bund will vor allem erreichen, dass Straftäter und Gefährder wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden können.Berlin (epd). Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern um rund die Hälfte gesunken. Das Bundesinnenministerium bestätigte am 14. Juli in Berlin, dass sich die Zahl der Abschiebungen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 10.951 auf 5.022 reduziert hat.
Die Gesamtzahl der Ausreisepflichtigen ist den Angaben zufolge bis Ende Mai innerhalb eines Jahres von 245.597 auf 266.605 gestiegen. Von diesen Menschen hatten aktuell 215.613 und im vorigen Jahr zum selben Zeitraum 189.690 eine Duldung. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte zu den Zahlen, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verweigerten zahlreiche Staaten weiterhin die Einreise ausländischer Staatsangehöriger oder beschränkten diese auf unabdingbare, wenige Fälle.
Ampelsystem für Zielstaaten
Die zuständigen Bundes- und Landesbehörden arbeiteten intensiv daran, dass trotz widriger Umstände vor allem Gefährder und Intensivstraftäter in ihr Heimatland zurückgeführt werden könnten. Das Innenministerium dringe bei den Herkunftsstaaten "auf eine baldige Wiederaufnahme von Rückführungen", erklärte der Sprecher. Zunächst sollten Rückführungen in Regionen aufgenommen werden, wo praktische Hindernisse keine entscheidende Rolle spielten, wie beispielsweise in Westbalkan-Länder.
Einem Bericht der Funke Zeitungen zufolge führt die Bundespolizei eine Liste mit 121 Zielstaaten, die nach einem Ampelsystem aufgebaut ist. Grün bedeute, dass Abschiebungen möglich sind, bei Gelb nur im Einzelfall und bei Rot seien sie untersagt. Nach Funke-Informationen wird derzeit kein Staat auf der Liste unter Grün eingestuft.
"Konsequent umsetzen"
"Angesichts der stetig wachsenden Asylzugangszahlen sollten die Länder auch das Thema Abschiebung ausreisepflichtiger Ausländer wieder aufnehmen und forcieren", sagte der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster den Funke-Zeitungen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärte, ihm sei wichtig, "dass wir entsprechend dem Rückgang der Infektionszahlen auch wieder zur Normalität bei den Abschiebungen zurückkehren". Er sei fest davon überzeugt, "dass ein Asylsystem auf die Dauer nur dann akzeptiert wird, wenn der Rechtsstaat seine positiven wie negativen Entscheidungen auch konsequent umsetzt."
Die AfD forderte, die versäumten Abschiebungen zügig nachzuholen und die Zahl der Abschiebungen insgesamt deutlich zu erhöhen. Der stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Tino Chrupalla, erklärte, es müsse zur vorrangigen Aufgabe der deutschen Diplomatie werden, auf die Heimatländer der Ausreisepflichtigen einzuwirken und deren zügige Rückkehr zu ermöglichen.
"Die Tomaten - ein Fest"

epd-bild/Dieter Sell
Oldendorf, Bremen (epd). Neben dem Porree steht der Kohlrabi. Zwischendrin ranken Tomatenpflanzen in die Höhe, begleitet von Süßkartoffeln, Basilikum und Stangensellerie: Biogärtner Jan Bera liebt die Mischkultur. "Wir versuchen, das Beet nie leer werden zu lassen. Denn dann würde die Fläche verarmen und wäre anfälliger für Krankheiten und Schädlinge", sagt der Demeter-Gärtner. In Oldendorf bei Bremen arbeitet er nach dem Prinzip der "solidarischen Landwirtschaft" - ein Konzept, das in Deutschland immer mehr Anhänger findet.
Es verbindet Erzeuger und Verbraucher: Die Mitglieder einer "Solawi" zahlen die Kosten der Landwirtschaft inklusive der Löhne und bekommen dafür die Ernte, die untereinander aufgeteilt wird. Was erzeugt wird, geht also nicht auf den Markt, sondern an die "Solawisten", die sich ihre Ernteanteile meist in Depots abholen. Finanziert wird somit nicht das einzelne Produkt, sondern die gesamte landwirtschaftliche Tätigkeit nach den geplanten und zuvor in einer jährlichen Mitgliederversammlung vorgestellten Betriebskosten.
Schutzschild für die Bauern
Sicher sind es das gestiegene Umweltbewusstsein, Lebensmittelskandale und ganz aktuell Diskussionen über Fleischerzeugung und Tierwohl, die dazu beitragen, dass die Zahl der Solawis kontinuierlich steigt. "Auf unserer Website haben wir derzeit 285 Projekte gelistet", bilanziert Stephanie Wild vom bundesweiten Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Als Jan Bera 2012 den Gärtnerhof gepachtet hat, war die Zahl noch im zweistelligen Bereich.
Bera erzeugt auf knapp drei Hektar Freiland und auf 2.000 Quadratmetern Gewächshausfläche 110 Ernteanteile mit derzeit wöchentlich je drei Kilo Gemüse. 95 Euro kostet bei ihm monatlich ein ganzer Ernteanteil, die Hälfte ist auch möglich. In der Hochsaison ist ein Anteil größer, im Winter kleiner. "Das Solidarische daran ist, dass auch Ernteausfälle oder Produktionsrisiken von den Verbrauchern mit getragen werden", verdeutlicht Netzwerk-Sprecherin Stephanie Wild.
Solawis funktionieren also wie ein Schutzschild für die Bauern: Die Städter helfen den Landwirten - und umgekehrt natürlich auch. Die regional und saisonal ausgerichteten Höfe werden durch das Modell der Kooperative vom marktwirtschaftlichen Ertragsdruck entlastet. Und die Verbraucher wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen - auch durch Hilfsaktionen beim Jäten und Ernten.
Flexibler Speiseplan
Dass die Ernteanteile immer saisonal ausgerichtet sind, empfindet die Bremer Gärtnerhof-"Solawistin" Rike Fischer als Geschenk "und auch ein wenig als Abenteuer". Wer mitmache, müsse mit seinem Speisezettel flexibel sein und das verarbeiten, was in den Depots angeliefert werde. "Das sind jetzt unter anderem Salate, Zucchini, Möhren, Blumenkohl, Auberginen und Tomaten", zählt Fischer auf und kommt noch mal auf die Tomaten zu sprechen. Die habe es lange nicht gegeben, "jetzt sind sie ein echtes Fest". Bei den Solawis sei eben nicht wie im Supermarkt alles zu jeder Zeit verfügbar.
Durch das Solidar-Prinzip sind Erzeuger wie Bera abgesichert und können mehr in eine nachhaltige Landwirtschaft mit Humusaufbau, Artenschutz und einer eigenen Saatzucht investieren. "Mir ist wichtig, dass wir uns von dem Land ernähren, auf dem wir leben, weg vom globalisierten Markt mit seinen Unwägbarkeiten und dem Gemüse zu Dumpingpreisen", sagt Bera.
Ganz ähnlich funktioniert mit wöchentlich 200 Ernteanteilen auch der "Sophienhof" nur etwa 600 Meter entfernt. Allerdings hat Betriebsleiter Marc Schweighöfer die Landwirtschaft gekauft und bietet neben Gemüse auch Rindfleisch und Gänse an. "50 Rinder und 250 Gänse - ich möchte überschaubare Tiergruppen haben", sagt der Solawi-Bauer, der mit einer kleinen Landschlachterei zusammenarbeitet.
Wurzeln in Japan
International gesehen haben die Solawis ihre Wurzeln in den japanischen "Teikei"-Höfen, über die nach Angaben von Stephanie Wild mittlerweile mehrere Millionen Menschen versorgt werden. In den USA entstand in den 1980er Jahren die CSA-Bewegung - "Community Supported Agriculture".
In Europa sei Frankreich Vorreiter gewesen, ergänzt Wild. "Heute gibt es in 40 Ländern Projekte der solidarischen Landwirtschaft, Deutschland war da ziemlich Nachzügler." Bundesweit, schätzt sie, werden zwischen 35.000 und 50.000 Haushalte mit Solawi-Erzeugnissen versorgt. 60 Prozent der Betriebe seien rein auf Gemüse ausgerichtet, der Rest halte auch Vieh und baue Getreide an.
Die älteste deutsche Solawi ist der Buschberghof in Fuhlenhagen bei Hamburg, die größte das Münchner "Kartoffelkombinat". Mit einer genossenschaftlich organisierten Gärtnerei versorgt es seine Mitglieder mit wöchentlich etwa 1.800 Ernteanteilen Biogemüse. Sie alle verbindet wohl das, was Jan Bera in Oldendorf tagtäglich antreibt, wenn er sagt: "Ich mach das aus Überzeugung."
Beauftragter Rörig: Masterplan der Länder gegen Kindesmissbrauch
Dass gegen sexuellen Missbrauch von Kindern mehr getan werden muss, ist in der Politik und der Gesellschaft unstrittig. Konkret gehandelt wird nach Einschätzung des Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung jedoch nach wie vor zu wenig.Essen, Saarbrücken (epd). Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig drängt auf mehr Engagement von Bund und den Länder im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Rörig plädierte für einen ressortübergreifenden Masterplan der Bundesländer gegen sexuelle Gewalt. Das Saarland fordert die dauerhafte Aufnahme von Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs im erweiterten Führungszeugnis. In Nordrhein-Westfalen stieg unterdessen im vergangenen Jahr die Zahl der Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Vorjahr deutlich an.
"Der politische Wille, sexuelle Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen, ist bisher viel zu schwach", sagte Rörig den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Montag). Jedes Bundesland brauche einen ressortübergreifenden "Masterplan" gegen sexuelle Gewalt an Minderjährigen. An die Parteien appellierte Rörig in einem Brief, den Kampf gegen Missbrauch in ihren Wahlprogrammen zu einem Schwerpunktthema zu machen.
Strafrechtsverschärfung allein reiche nicht
Rörig bekräftigte seine Überzeugung, dass die von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) geplante Verschärfung des Strafrechts nicht ausreiche, um Missbrauch zu verhindern. Wichtiger seien verbesserte Aufklärungs- und Präventionsarbeit, bessere polizeiliche Ermittlungsmöglichkeiten und eine enge Zusammenarbeit vor allem von Jugendämtern und Familiengerichten.
Das Saarland macht sich für die dauerhafte Aufnahme von Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen im erweiterten Führungszeugnis stark. Bisher könne sich jemand, der etwa zu einem Jahr Haft verurteilt wurde, nach elf Jahren ohne Vermerk im erweiterten Führungszeugnis wieder in einer Kita bewerben, sagte Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU) am Montag in Saarbrücken. Das Saarland habe bereits im Februar gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern über den Bundesrat das Ende der Löschungsfristen eingebracht.
Mehr Verfahren zur Kindeswohlgefährdung
Der bisherige Plan des Bundesjustizministeriums für ein Reformpaket sieht nur eine Verlängerung der Fristen vor. Wenn sich jemand im Alter von 18 Jahren eines solchen Delikts schuldig gemacht habe, müsse dies zum Schutz der Kinder auch noch aufgelistet sein, wenn der Täter bereits 88 Jahre alt sei, sagte Theis. Nach dem von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) Anfang Juli vorgelegten Reformpaket zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt soll Missbrauch demnach unter anderem als Verbrechen und nicht länger als Vergehen eingestuft werden. Theis warb dafür, den länderübergreifenden Vorschlag im laufenden Verfahren aufzugreifen.
In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr 2019 deutlich mehr Verfahren zur Einschätzung von Kindeswohlgefährdung geführt als im Vorjahr. Die Jugendämter hätten in rund 49.700 Fällen eine solche Einschätzung vornehmen müssen, erklärte das statistische Landesamt am 13. Juli in Düsseldorf. Die Zahl stieg um gut 14 Prozent. Im Jahr 2018 waren es rund 43.600 Verfahren.
Den Statistikern zufolge wurde im vergangenen Jahr in 14,3 Prozent der Fälle (7.094) eine akute Gefährdung des Kindeswohls festgestellt. Die häufigsten Gründe dafür waren Anzeichen von Vernachlässigung (3.623) sowie körperliche (2.631) und psychische Misshandlungen (2.239). Eine latente Gefährdung stellten die Jugendämter in 6.718 Fällen fest (13,5 Prozent).
Ausstellung zum 10. Jahrestag der Loveparade in Duisburg
Bilder, die unter die Haut gehen, sind seit dem 19. Juli in der Salvatorkirche in Duisburg zu sehen. Die düsteren Arbeiten thematisieren die Loveparade-Katastrophe vor zehn Jahren.Duisburg (epd). In dunklen Acrylfarben auf insgesamt elf, meist großformatigen Gemälden erinnert seit dem 19. Juli eine neue Ausstellung in Duisburg an die Loveparade-Tragödie vor zehn Jahren. Unter der Überschrift "Entzogen" geht der Künstler Walter Maria Padao in der evangelischen Salvatorkirche im Zentrum der Ruhrgebietsstadt dem Grauen, dem Unglück und Fragen zur Verantwortung für die Katastrophe vom 24. Juli 2010 nach, bei der 21 junge Menschen ums Leben kamen und rund 500 teils schwer verletzt wurden. Bis zum 9. August lassen die Arbeiten die Enge, die Ängste, den Schmerz und das Grauen des ursprünglich als Musikspektakel gedachten Events kurz vor dem 10. Jahrestag der Katastrophe wieder lebendig werden.
Der Künstler war vor zehn Jahren nicht in Duisburg, als das Musikspektakel im Gedränge der Fans so fürchterlich zu Ende ging. "Ich war im Atelier. Doch die Bilder, die ich schon einen Tag nach der Katastrophe in den Medien zu sehen bekam, haben mich nicht mehr losgelassen", sagte Padao dem epd. Der 1965 in Darmstadt geborene Padao lebt und arbeitet inzwischen in Düsseldorf.
Bilder erinnern an zentrale Momente der Tragödie
Seine Bilder im Altarraum und im Kirchenschiff des Gotteshauses erinnern an zentrale Momente der Loveparade-Tragödie. Im Zentrum steht eine von Padao gemalte, 2,80 mal zwei Meter große Kopie des Bildes "Die Kreuzabnahme" des Künstlers Peter Paul Rubens (1577-1640) aus dem Jahr 1612 aus der Liebfrauenkathedrale im belgischen Antwerpen. Wie ein Triptychon hängen links und rechts von dem Bild zwei weitere Arbeiten, die an Pressebilder von der Loveparade-Katastrophe erinnern. Auf einem wird eine junge Frau von Helfern auf eine Art Container gezogen, auf dem zweiten Bild reichen Helfer einen fast leblosen Körper an Menschen auf einer schmalen Treppe am Ort der Loveparade-Katastrophe weiter.
Manche Bilder in der Salvatorkirche zeigen den Tunnel, in dem sich Zehntausende junger Menschen bei der Katastrophe aufhielten. Andere Gemälde scheinen verschwommen Hilfskräfte oder Medienvertreter zu zeigen. Entstanden sind die Bilder schon vor einigen Jahren nach Gesprächen mit Polizeiseelsorgern und Psychologen, die 2010 bei der Katastrophe als Helfer vor Ort waren. Der Titel für die Ausstellung thematisiert dabei nach den Worten des Künstlers das "Entziehen aus dem Leben, der Menge, der Verantwortung, dem Vergessen und der Zeit".
Die Katastrophe von Duisburg gilt als eines der schlimmsten Unglücke in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Der Prozess um die juristische Aufarbeitung war am 4. Mai dieses Jahres ohne ein Urteil eingestellt worden. Zur Einstellung des Loveparade-Verfahrens hatte das Gericht erklärt, dass am Ende "das Zusammenwirken einer Vielzahl von Umständen" zu "dem Gedränge mit dem tödlichen Verlauf" geführt hatte.
Weimarer Menschenrechtspreis würdigt Einsatz gegen moderne Sklaverei
Weimar (epd). Der diesjährige Weimar Menschrechtspreis geht an den katholischen Missionar Frater Jozef Jan Michel Kuppens aus den Niederlanden und die Menschenrechtlerin Felicia K Monjeza aus Malawi. Das habe der Stadtrat in seiner Sitzung am 15. Juli beschlossen, sagte Weimars Pressesprecher Andy Faupel am 17. Juli. Beide setzten sich gegen massive Menschenrechtsverletzungen und für die Beendigung von moderner Sklaverei auf Tabakplantagen in Malawi ein.
Frater Jos Kuppens (Jahrgang 1942) setze sich als Gründer der Menschenrechtsorganisation "Center of Social Concern" gegen die Ausbeutung insbesondere der Tabakarbeiter und ihrer Familien in Malawi ein, hieß es. Die 1996 geborene Felicia K Monjeza von der Catholic Women Organisation weise auf die Gefahren für Mädchen und Frauen durch sexuelle Ausbeutung in den Plantagen hin, leiste Aufklärungsarbeit und organisiere Kampagnen gegen Gewalt.
Vorschlag von missio
Nominiert habe das Duo das katholische Hilfswerk missio, das die gemeinsamen Projekte in Malawi begleite, erklärte Faupel. Der Preis werde am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, unter der Schirmherrschaft von ZDF-Moderatorin Gundula Gause verliehen. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro stamme aus Spenden.
Für eine Vielzahl der Menschen in dem südostafrikanischen Malawi sei die Arbeit auf den Tabakplantagen die einzige Chance, überleben zu können, hieß es. Arbeiter und Familien würden sklavenähnlich ausgebeutet. Etwa 78.000 Kinder arbeiteten auf den Feldern. Etwa 50 Prozent der Frauen und Mädchen seien während ihrer Arbeit auf den Plantagen sexueller Gewalt ausgesetzt.
Klöckner will Kükentöten bis Ende 2021 per Gesetz verbieten

epd-bild/Dieter Sell
Berlin (epd). Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will das Töten männlicher Küken bis Ende 2021 beenden. Die Ministerin werde zeitnah einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums am 14. Juli in Berlin. Die von der Branche vorgelegte Vereinbarung zum Ausstieg aus dem Kükentöten erfülle Klöckners Erwartung nicht.
Klöckner hatte ihre Absicht in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" angekündigt und die Geflügelbranche kritisiert: "Da ich bislang nicht erkennen konnte, dass die Branche die bestehenden Alternativen nutzt, um das Kükentöten bis Ende 2021 flächendeckend zu beenden, lege ich ein Gesetz vor." Damit werde sie "das Töten männlicher Eintagsküken stufenübergreifend und flächendeckend verbieten".
Branche wehrt sich
Die Ministerin verwies auf Alternativen. Dazu gehören etwa die vom Landwirtschaftsministerium mit Millionenbeträgen geförderte Geschlechtsbestimmung im Ei, damit männliche Küken gar nicht erst ausgebrütet werden, oder das sogenannte Zweinutzungshuhn, bei dem männliche Tiere gemästet werden. Bislang werden jährlich Millionen männliche Küken aus Legehennen-Linien direkt nach dem Schlupf vergast, weil sich ihre Aufzucht nicht lohnt.
Der Präsident des Zentralverbandes der Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, warnte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vor einem Verbot. Dieses ließe sich durch einen Import von Legehennen aus dem Ausland leicht umgehen. Klöckner würde mit einem Gesetz "falsche Tatsachen vortäuschen, und das Kükentöten für in Deutschland genutzte Jung- und Legehennen würde im Ausland weitergehen", sagte Ripke. Zudem sei ein Verbot rechtlich nur mit einer Übergangsfrist möglich.
Ripke warb stattdessen für eine Branchenvereinbarung, an der sein Verband und der Handel arbeiten. Darin soll festgehalten werden, dass Alternativen genutzt werden, um auf das Kükentöten zu verzichten. 2023 würden dann nur noch Legehennen in Ställen leben, bei deren Aufzucht keine männlichen Tiere getötet wurden.
"Überfällig"
Der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff, und die frühere Landwirtschaftsministerin Renate Künast (Grüne) forderten ein schnelles Verbot. Ein Gesetz könne noch in diesem Herbst verabschiedet werden, erklärten sie. Zu dem Thema sei "alles gesagt und besprochen". Das Verbot des Kükenschredderns sei überfällig. Das Bundesverwaltungsgericht habe bereits 2019 geurteilt, dass eine solche Praxis aus rein wirtschaftlichen Interessen nicht zulässig sei. Die Grünen-Politiker forderten eine verpflichtende Haltungskennzeichnung, um verantwortungsvollen Tierhaltern einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen.
Ruhr-Uni legt keine Prüfungen mehr auf religiöse Feiertage
Bochum (epd). An der Ruhr-Universität Bochum sollen künftig keine Prüfungen mehr an religiösen Feiertagen stattfinden. Das habe der Senat in einer einstimmig verabschiedeten Resolution beschlossen, teilte die Hochschule am 15. Juli mit. "Die Ruhr-Uni geht damit als religionssensible und Diversität achtende Universität bundesweit vorbildhaft voran", erklärte die evangelische Theologieprofessorin Isolde Karle, die die Resolution initiiert hat.
Mit dem Beschluss verpflichte sich die Universität, künftig Prüfungstermine so festzulegen, dass sie nicht mit religiösem Arbeitsverbot oder hohen Feiertagen kollidieren, hieß es. Sollte dies dennoch nicht vermeidbar sein, müssten Betroffene einen zeitnahen Ersatztermin bekommen. Der Beschluss gelte für alle Religionsgemeinschaften.
Relevant werden könne die neue Regelung beispielsweise für orthodoxe Jüdinnen und Juden aufgrund des Schreibverbots am Schabbat, erklärte Karle. "Christen sind nicht betroffen, da ihre Feiertage grundsätzlich gesetzlich geschützt sind, und Muslime kennen keine solch strikten Verbote, freuen sich aber natürlich, wenn man auf sie im Hinblick auf das Ramadanfest oder Opferfest Rücksicht nimmt."
Saarland erhöht Zahl der Corona-Tests
Saarbrücken (epd). Die saarländische Landesregierung will mit einer erweiterten, zweistufigen Teststrategie neue Corona-Infektionen im Land rechtzeitig identifizieren und so Infektionen und lokale Ausbrüche verhindern. Dabei lege sie ihren Fokus auf Testungen in besonders gefährdeten Bereichen und auf Personengruppen, die bislang nicht den Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) entsprechen, teilte das Gesundheitsministerium am 17. Juli in Saarbrücken mit. "Wir müssen Neuinfektionen zuverlässig und frühzeitig erkennen. Im Rahmen unserer bisherigen Testmaßnahmen werden wöchentlich rund 6.800 Tests durchgeführt", sagte Ministerin Monika Bachmann (CDU). Diese Tests sollen "nun zielgerecht erweitert werden".
So hat das Saarland bereits in der vergangenen Woche eine freiwillige Testreihe für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Produktionsbereich großer saarländischer Fleischbetriebe gestartet. Damit können bis zu 700 Beschäftigte an einem freiwilligen Test teilnehmen. Ähnliche Testreihen sollen auch in anderen Betrieben durchgeführt werden. Überdies sollen alle Schülerinnen und Schüler, Kita-Kinder sowie das Lehr- und pädagogische Personal in Kindertagesstätten und Schulen im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie getestet werden.
Bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Saarland auf dem derzeit niedrigen Niveau, werden alle Neuaufnahmen und Rückverlegungen in Pflegeheimen zuvor getestet. Zudem erhalten circa 500 Beschäftigte in Pflegeheimen, der ambulanten Pflege und der Tagespflege, etwa 160 Beschäftigte in Behinderteneinrichtungen und bis zu 150 Neuankommende in der Landesaufnahmestelle Lebach monatlich Abstriche. Bei Ein- und Rückreisenden, die sich entsprechend der Veröffentlichungen des Robert-Koch-Instituts in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann auf die zweiwöchige Quarantäne verzichtet werden, wenn sie ein negatives Testergebnis vorweisen können.
Durch die hohe Zahl an Tests entstehe ein erheblicher Mehraufwand, betonte Bachmann. Deshalb werde gemeinsam mit der Bundeswehr und Honorarärzten auf dem Messegelände in Saarbrücken ein stationäres Drive-In-Testzentrum errichtet. Diese Drive-In-Station ist Teil der ersten Stufe der neuen Strategie. Dort sollen täglich bis zu 750 Abstriche genommen werden. Im Falle einer neuen Infektionswelle kann die Kapazität der Station auf bis zu 2.000 tägliche Abstriche erhöht werden. Zusätzlich stehen dann in dieser zweiten Stufe eine mobile Teststation, die an täglich wechselnden Standorten bis zu 250 Tests durchführen kann, und ein mobiles Abstrichteam zur Verfügung, das rund 50 Menschen pro Tag testen kann.
Tierversuchsgegner protestieren gegen Affenlabor in Münster
Münster (epd). Ein Bündnis von Tierversuchsgegnern hat am 18. Juli mit einer Mahnwache gegen das Tierversuchslabor Covance in Münster demonstriert. Rund 150 Teilnehmer beteiligten sich an dem lautstarken Protest mit Trillerpfeifen. Jedes Jahr würden in dem Labor bis zu 2.000 Affen bei qualvollen Giftigkeitsprüfungen sterben, sagte Astrid Beckmann von der Organisation "Ärzte gegen Tierversuche". "Kein Tier verlässt das Labor lebend." Beckmann kritisierte die Tierversuche als überflüssig, da die Ergebnisse keinerlei Aussagekraft für den Menschen hätten. Sie forderte eine sofortige Einstellung der Tierversuche.
An den Protesten beteiligten sich unter anderem auch "Animal Rights Watch", tierretter.de, Nestwerk Münsterland und der Tierschutzverein Tierfreunde Münster. Bereits im November des vergangenen Jahres hatten mehr als 1.000 Menschen gegen das Tierversuchslabor in Münster demonstriert. Bernd Bünker von der Organisation tierretter.de aus Münster kündigte weitere Aktivitäten des Bündnisses an. Am 15. August sei ein bundesweiter Aktionstag mit Mahnwachen vor Tierversuchslaboren im ganzen Land geplant.
Das US-Forschungszentrum Covance, das mit der Planung und Durchführung von klinischen Studien befasst ist, soll im Süden Münsters im Auftrag der Pharmaindustrie Medikamente an Affen testen. Das Unternehmen, dessen Hauptsitz in Princeton im Bundesstaat New York liegt, ist in rund 20 Ländern vertreten. In Deutschland ist es in München und Münster ansässig. Das dortige Tierversuchslabor gilt als eines der größten in Europa.
Soziales
Homeoffice für immer?

epd-bild/Jens Schulze
Frankfurt a.M. (epd). War das Homeoffice vor der Corona-Pandemie in vielen Branchen eher selten, so könnte der jetzige Ausnahmezustand zur Regel werden. Doch noch sind viele Fragen ungeklärt: Wie soll Büroarbeit in Post-Corona-Zeiten aussehen? Und wer reformiert das Arbeitsrecht? Deutschland befindet sich in einem riesigen Sozialexperiment - mit offenem Ausgang.
"Homeoffice ist die Zukunft der Arbeitswelt", sagen die Zukunftsforscher Daniel Dettling und sein Bruder Thomas J. Dettling. Es gehe künftig "um mehr Selbstständigkeit, um unternehmerisches Mitgestalten und um die Entfaltung aller Potenziale". Das setze jedoch ein völlig anderes Führungsverständnis von Vorgesetzten voraus: "Das hat etwas mit 'los-lassen' zu tun."
"Homeoffice kann die Autonomie der Beschäftigten erweitern oder im Gegenteil zu mehr Kontrolle führen", sagt Bettina Kohlrausch, Wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Das Homeoffice leiste "der zunehmenden Kontrolle, Intensivierung und Entgrenzung der Arbeit Vorschub". Latent betroffen sind laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 35 Prozent der 44,6 Millionen Beschäftigten, die im April zumindest tageweise im Homeoffice waren.
Kein "Flurfunk"-Empfang mehr
Viele klappten anfangs begeistert ihren Laptop auf der Couch auf und betrachteten die Verbannung aus dem Büro zunächst als willkommene Abwechslung. An negative Folgen wie die soziale Isolation, fehlenden "Flurfunk" und Arbeitsschutz oder die Gefahren der Selbstausbeutung dachten die Wenigsten.
Unterdessen haben die Deutschen das Homeoffice offenbar schon wieder satt. Viele bevorzugen eine "hybride Arbeitsweise" zwischen Präsenz im Unternehmen und dem Homeoffice. Karl Edlbauer, Geschäftsführer der Stellenbörse Hokify, jüngst in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Es wird sich eine Mischform einpendeln, die je nach Funktion und Branche unterschiedlich sein wird."
"Einige Arbeitnehmer erlebten eine Art Vorhölle: Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, enge Lebensverhältnisse, Existenzängste, Überforderung. Andere beschreiben diese Zeit als wahre Glückseligkeit: Da wurde neben der Arbeit gegärtnert, getöpfert, man genoss die Entschleunigung und das Leben im Corona-Biedermeier", so der Marktforscher Stephan Grünwald. Problem für die Unternehmen: "Wer den Lockdown als eine Phase der Entspannung erlebt hat, möchte dieses Lebensgefühl nur ungern wieder aufgeben."
Umfragen spiegeln indes eine andere Sicht. Das Forschungsinstitut YouGov berichtet, etwa jeder zweite Beschäftigte (47 Prozent), der wegen der Pandemie im Homeoffice ist, will so bald wie möglich an den Arbeitsplatz zurückkehren - Männer deutlich häufiger (52 Prozent) als Frauen (41 Prozent).
"Im aktuellen Change-Prozess liegt eine riesige Chance für Arbeitgeber und Arbeitnehmer", sagt Grünwald. Denn wenn Mitarbeiter daheim effizienter arbeiten könnten als im Büro, dann freue sich auch der Arbeitgeber über diesen Produktivitätszuwachs. Doch ist das wirklich so?
Gesetzentwurf im Herbst
Laut DIW arbeitet nur jeder zehnte Befragte zuhause mehr und besser. 40 Prozent machen die gegenteilige Erfahrung: Sie schaffen weniger. Grünwald ist überzeugt, dass sich "neue Formen der Zusammenarbeit etablieren, weil nicht jeder mehr seinen festen Platz im Büro einnimmt." So würden freie Flächen entstehen, die neu genutzt werden könnten - zum Beispiel für Kreativräume oder Stillarbeitsplätze.
Doch ob es in großem Stil dazu kommt, ist fraglich. Aber: Nach einer noch nicht veröffentlichten Umfrage des Fraunhofer Instituts und der Deutschen Gesellschaft für Personalführung erklärten 89 Prozent der Unternehmen, Homeoffice lasse sich umsetzen, ohne dass daraus Nachteile entstünden.
Die Gewerkschaften hoffen auf Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der bis zum Herbst ein Gesetz zum Recht auf Homeoffice vorlegen will. "Was nicht geht, ist die vollkommene Willkür und der Wildwuchs, den es beim Homeoffice noch gibt", sagt Anja Piel, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Gegenüber dem epd listete sie ihre Forderungen auf: "Es braucht einen Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten. Dazu gehört ein Rechtsanspruch auf selbstbestimmtes, freiwilliges mobiles Arbeiten." Und: "Das Recht auf Abschalten und Nichterreichbarkeit muss auch für den Arbeitsplatz zu Hause gelten."
Gericht kippt Volksbegehren "#6 Jahre Mietenstopp"
München (epd). In Bayern wird es kein Volksbegehren "#6 Jahre Mietenstopp" geben. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am 16. Juli in München entschieden, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens nicht gegeben sind. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass der aktuelle Gesetzentwurf des Volksbegehren-Bündnisses "mit Bundesrecht offensichtlich unvereinbar" ist, weil dem Freistaat dazu die Gesetzgebungskompetenz fehle. Mit der Mietpreisbremse des Bundes seien erschöpfende Regelungen gegeben - der Entwurf des Volksbegehrens stelle nur eine Verschärfung dessen dar, hieß es.
Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zeigte sich nach Bekanntwerden der Entscheidung zufrieden. Das Gericht habe die Rechtsauffassung seines Ministeriums bestätigt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens nicht gegeben seien.
Mieterbund sieht sozialen Frieden gefährdet
Dagegen zeigte sich der Deutsche Mieterbund enttäuscht. "Die Neuvertragsmieten in München liegen derzeit bei 18,31 Euro pro Quadratmeter. Solche Wuchermieten sind unanständig und gefährden den sozialen Frieden in unserem Land", sagte der Präsident des Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. "Die Neuvertragsmieten in München liegen derzeit bei 18,31 Euro pro Quadratmeter. Solche Wuchermieten sind unanständig und gefährden den sozialen Frieden in unserem Land." Die Mieterinnen und Mieter hätten eine Atempause dringend gebraucht.
Im März hatten die Initiatoren des Volksbegehrens 52.000 Unterschriften mit dem Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens beim Innenministerium eingereicht. Ziel des Volksbegehrens ist ein Gesetz, das die Höhe der Mieten im Freistaat begrenzen soll. So sollen etwa Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen und die Miethöhe bei Neuvermietungen gedeckelt werden.
Hinter dem Volksbegehren stehen unter anderem die bayerische SPD und die Grünen, aber auch viele weitere Parteien, Sozialverbände und Gewerkschaften sowie der bayerische Landesverband des Deutschen Mieterbundes.
Land NRW beruft Ombudsfrau für Auszubildende der Pflegeberufe
Düsseldorf, Münster (epd). Für die voraussichtlich mehr als 19.000 Auszubildenden, die in diesem Jahr mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen starten, gibt es ab sofort eine Ombudsfrau. Die gelernte Krankenpflegerin und Diplom-Pflegepädagogin Brigitte von Germeten-Ortmann soll bei Konflikten zwischen Auszubildenden und den Ausbildungseinrichtungen vermitteln, wie das NRW-Gesundheitsministerium am 16. Juli in Düsseldorf mitteilte. Ihre Geschäftsstelle wird bei der Bezirksregierung Münster eingerichtet.
"Mit ihrer großen fachlichen Kompetenz und ihrer langjährigen Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Pflege wird Frau von Germeten-Ortmann eine gute Ansprechpartnerin für die angehenden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sein", sagte Minister Karl-Josef Laumann (CDU). Die Ombudsstelle werde einen wichtigen Beitrag zur Beilegung von möglichen Streitigkeiten zwischen den Auszubildenden und den Trägern der praktischen Ausbildung in der ambulanten und stationären Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege leisten.
Brigitte von Germeten-Ortmann hatte seit 2004 die Abteilung Gesundheits- und Altenpflege beim Diözesan-Caritasverband Paderborn geleitet. Seit Februar dieses Jahres ist sie im Ruhestand, die Tätigkeit als erste Ombudsfrau in der generalistischen Pflegeausbildung übernimmt sie ehrenamtlich.
Grundlage für die Einrichtung der Ombudsstelle ist das seit Jahresbeginn geltende Pflegeberufegesetz des Bundes. Es regelt die neue generalistische Pflegeausbildung, die die bislang getrennten Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammenlegt. Damit soll den Auszubildenden der Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert und die Attraktivität des Pflegeberufes gesteigert werden.
Niedersächsischer Ministerpräsident Weil besucht Hanns-Lilje-Heim
Wolfsburg (epd). Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am 13. Juli das von der Diakonie betriebene Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim besucht, das wegen eines massiven Corona-Ausbruchs und einer Vielzahl von Todesfällen in die Schlagzeilen geraten war. Der Ministerpräsident informierte sich über die aktuelle Lage sowie Besuchs- und Hygienekonzepte in dem Heim für dementiell erkrankte Menschen. Nach einem Gespräch mit Vertretern der Stadt, der Heimleitung, der Qualitätsbeauftragten und dem Pflegeteam betonte Weil, dass ihn der selbstlose Einsatz der Mitarbeiter mit "Hochachtung und Respekt" erfülle.
"Das sind absolute Extrembedingungen, unter denen hier gearbeitet werden musste, und schlimme Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben. Umso mehr beeindruckt mich die großartige Arbeit, die hier weit über das zumutbare Maß hinaus geleistet wurde", sagte Weil und verwies auf eine moralische Zwickmühle, für die es zurzeit keine Lösung gebe. Gerade Demenzkranke bräuchten Berührung und Körperkontakt. "Unter den vielen schwierigen Entscheidungen ist das die vielleicht schwierigste, diese Berührung und Nähe in der letzten Lebensphase nicht ausreichend geben zu können", sagte der Ministerpräsident.
45 Corona-Tote
Heimleiter Torsten Juch sagte, das Team habe das Infektionsgeschehen im Hanns-Lilje-Haus nur mit strengsten Hygieneregeln in den Griff bekommen. Dazu zählten unter anderem ein strikter Aufnahme- und Besuchsstopp, das penible Einhalten aller Hygiene- und Abstandsregeln sowie zahlreiche Covid-19-Tests. Auch heute werde jede Pflegekraft, die aus dem Urlaub kommt, auf das Coronavirus getestet. "Wir sind wirklich sehr sensibel geworden", betonte der Heimleiter. "Unser aller Leben hat sich durch die Geschehnisse verändert."
In der Einrichtung mit insgesamt 165 Plätzen hatten sich zwischen Mitte März und April die meisten der oft hochbetagten Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Erreger angesteckt. Infizierte und nichtinfizierte Bewohner wurden daraufhin nach Etagen strikt voneinander getrennt. Zwischenzeitlich litten 111 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer Covid-19-Infektion. 45 Bewohnerinnen und Bewohner sind infolge der Infektion im Heim gestorben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt sogar aufgrund von 48 Todesfällen, weil sie auch Fälle einbezieht, in denen Bewohner im Krankenhaus und nicht im Heim starben.
Zahl der häuslichen Sterbebegleitungen in NRW steigt auf über 13.800
Düsseldorf (epd). Immer mehr schwerstkranke Menschen in Nordrhein-Westfalen verbringen die letzte Phase ihres Lebens in ihrer gewohnten Umgebung. Die ambulanten Hospizdienste mit ihren ehrenamtlichen Sterbebegleitern ermöglichten das im vergangenen Jahr in NRW in über 13.800 Fällen, wie der Verband der Ersatzkassen am 16. Juli in Düsseldorf mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete das einen Anstieg von mehr als 2.200 Fällen.
Im laufenden Jahr fördern die gesetzlichen Krankenkassen die rund 250 ambulanten Hospizdienste in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 23,6 Millionen Euro. Das entspreche einer geplanten Steigerung von etwa sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Landesweit ist die Zahl der ehrenamtlichen Begleiter um fast 500 auf knapp 11.300 gestiegen. Die Hospizdienste und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen sicher, dass es in Nordrhein-Westfalen flächendeckend Angebote für häusliche Sterbebegleitung gibt.
VdK: Corona trifft arme, kranke und alte Menschen besonders hart
Unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden pflegebedürftige, behinderte und alte Menschen besonders. Der Sozialverband VdK in NRW fordert eine Analyse, um Benachteiligungen künftig zu vermeiden.Düsseldorf (epd). Der Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen befürchtet nachteilige Folgen der Corona-Pandemie für arme, kranke, behinderte und ältere Menschen. Die Bewältigung der Corona-Krise dürfe nicht auf Kosten sozial benachteiligter Gruppen gehen, mahnte der VdK-Landesvorsitzende Horst Vöge am 16. Juli in Düsseldorf. "Durch unsere 370.000 Mitglieder wissen wir, dass vielfach aus Angst, Hilflosigkeit oder fehlender Unterstützung starke persönliche Einbußen hingenommen werden - etwa bei der gesundheitlichen Versorgung."
Auch mit Blick auf eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle fordert der Sozialverband deshalb von Land und Kommunen eine Bilanz der bisherigen Krisenbewältigung. Damit könnten Schlussfolgerungen für die künftige Gestaltung der Gesundheits- und Sozialpolitik gezogen und sozialen Folgewirkungen besser vorgebeugt werden, sagte Vöge.
In dem Fazit sollte nach Einschätzung des VdK unter anderem bilanziert werden, wie Krankenhäuser, Pflege- und Bildungseinrichtungen auf die Pandemie reagiert haben. Mögliche Benachteiligungen von Älteren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung seien zu prüfen. "Pflegebedürftige gehören zu den am schwersten Betroffenen in der Corona-Krise", unterstrich Vöge. "60 Prozent aller Verstorbenen sind von Pflegeheimen oder Pflegediensten betreute Menschen. Deren Anteil an infizierten Personen beträgt aber nur 8,5 Prozent."
Mit Sorge registriert der VdK in diesem Zusammenhang auch die hohen Infektionsraten beim Pflegepersonal: "Der Anteil infizierter Mitarbeiter ist in ambulanten Pflegediensten doppelt so hoch wie in der Normalbevölkerung, in stationären Einrichtungen sogar sechsmal so hoch", gab Vöge zu bedenken. Hier habe es im Verlauf der Krise zu wenig Vorsorge gegeben. Deshalb müsse es künftig eine dauerhafte und ausreichende Versorgung mit Schutz- und Desinfektionsmitteln, systematische und regelmäßige Tests bei den Bewohnern und eine bessere Vergütung für das Personal geben.
Auch die häusliche Pflege und die vielen pflegenden Angehörigen dürften im Zuge der Corona-Krise nicht aus dem Blick geraten, mahnte der VdK-Landeschef. Denn über 75 Prozent der Pflegebedürftigen - allein rund 420.000 in NRW - würden zu Hause durch Angehörige versorgt. Doch hätten sich viele dieser Menschen in der Ausnahmesituation von Bund und Land benachteiligt gefühlt. Notwendig seien daher Sofort-Hilfe-Pakete mit Leistungen wie Lohnersatz für berufstätige pflegende Angehörige sowie Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder.
Der VdK warnte außerdem davor, dass im Zuge der Corona-Krise wichtige Projekte wie die bis 2022 geplante Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr, die Stärkung von sozialen Versorgungsstrukturen in der Fläche und der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur vernachlässigt werden könnten. Auch bei der Schaffung gleicher Bildungschancen müsse es weiter vorangehen. So dürften etwa Kinder aus einkommensschwachen Haushalten nicht "digital ausgegrenzt" werden, weil das Geld für Computer fehle. All diese Themen gehörten weiterhin "ganz oben auf die Agenda".
Die Kosten der Corona-Krise will der VdK "sozial gerecht verteilt" sehen und befürwortet die Erhebung einer einmaligen Abgabe für Vermögen über dem Freibetrag von mindestens einer Million Euro. Auch die SPD hat bereits eine entsprechende "Reichen-Steuer", von der selbstbewohnte Häuser und Wohnungen aber ausgenommen werden sollen, zur Diskussion gestellt. Union und mittelständische Unternehmen halten dagegen nichts von der Idee.
Großteil der LWL-Ausgaben fließt in Hilfen für Behinderte
Münster (epd). Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) hat im vergangenen Jahr 4,7 Milliarden Euro in der Region ausgegeben. Das sind 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie der Verband am 15. Juli in Münster mitteilte. Der Großteil des Geldes sei ebenso wie im Vorjahr mit 2,7 Milliarden Euro in die Unterstützung von behinderten und pflegebedürftigen Menschen geflossen. Ziel sei es, Menschen mit Behinderungen ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Als Beispiel nannte der LWL die Förderung von Ambulant Betreutem Wohnen als Alternative zu Wohnheimen.
Die Corona-Krise habe der Landschaftsverband bislang gut überstanden, hieß es. Nur sehr wenige Patienten oder Heimbewohner, für die der LWL sorge, seien mit dem Corona-Virus infiziert gewesen. Auch die LWL-Beschäftigten seien durch Vorsichtsmaßnahmen, Home-Office und gegenseitige Hilfe in der Lage gewesen, die Dienstleistungen des Verbandes in der Region fortzusetzen.
Der Kommunalverband unterstützte nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 32.340 Menschen in Westfalen dabei, alleine oder mit anderen in einer eigenen Wohnung leben zu können (2018: 31.139). Außerdem wurden 22.015 Wohnheimplätze und 37.518 Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen finanziert.
Rund 72 Millionen Euro zahlte der Landschaftsverband dafür, dass 9.119 Kinder mit Behinderung eine von 3.323 Regel-Kindertageseinrichtungen besuchen konnten. In Westfalen besuchten im vergangenen Jahr 6.304 Kinder mit Behinderungen einen Förderschulkindergarten oder eine Förderschule des LWL.
Die Verbandsmitglieder - 18 Kreise und neun kreisfreie Städte in Westfalen und Lippe - zahlten den Angaben nach im vergangenen Jahr ebenso wie im Vorjahr einen Mitgliedsbeitrag von insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro an den Kommunalverband. Die Differenz von 2,5 Milliarden Euro in 2019 wurde den Angaben zufolge aus Bundes- und Landesmitteln finanziert. Als Kommunalverband übernimmt der LWL Aufgaben für seine Mitglieder im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur. Unter anderem betreibt er 35 Förderschulen, 21 Krankenhäuser, 18 Museen sowie zwei Besucherzentren.
Mehr als die Hälfte der LVR-Ausgaben fließt in Hilfen für Behinderte
Köln (epd). Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat im vergangenen Haushaltsjahr seinen Mitgliedskommunen Leistungen in Höhe von 5,29 Milliarden Euro zukommen lassen. Rund 2,96 Milliarden Euro waren Eigenmittel des LVR, der Rest stammte aus Bundes- und Landesmitteln sowie der Ausgleichsabgabe, wie der Landschaftsverband am Donnerstag in Köln mitteilte. Rund 58 Prozent der vom LVR finanzierten Leistungen kamen Menschen mit Behinderungen zugute: Etwa 3,05 Milliarden Euro waren Sozialhilfeleistungen für Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, für Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf.
Der LVR übernimmt als regionaler Kommunalverband Aufgaben in Bereichen wie Soziales, Gesundheit, Schulen, Jugend und Kultur. Die 13 kreisfreien Städte und die zwölf Kreise im Rheinland sowie die Städteregion Aachen sind die Mitgliedskörperschaften des Verbandes.
Saar-Arbeitskammer lädt Pflegekräfte zu Teilnahme an Kampagne ein
Saarbrücken (epd). Die Arbeitskammer (AK) des Saarlandes lädt Pflegekräfte dazu ein, sich an der Kampagne "Eine*r von rund 18.000" zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege zu beteiligen. Nachdem die Arbeitskammer seit Anfang Juni bislang vier Spots für die Kampagne produziert und online gestellt hat, sind nun die Pflegekräfte dazu aufgerufen, kurze Filme mit ihren Smartphones zu produzieren oder Statements aufzunehmen und auf der Website der Arbeitskammer hochzuladen, wie die Organisation am 17. Juli in Saarbrücken mitteilte. "Mit der Kampagne geben wir den Beschäftigten die Möglichkeiten, selbst zu sprechen, öffentlich und politisch wahrgenommen zu werden", sagte die AK-Geschäftsführerin Beatrice Zeiger.
In den bislang produzieren Spots machen Pflegekräfte auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der Alten- und Krankenpflegekräfte aufmerksam, zudem stellt die AK arbeits- und gesundheitspolitische Forderungen auf. "Unsere Spots erreichen eine hohe Reichweite in den sozialen Medien und wir bekommen durchweg gute Rückmeldungen, vor allem auch von vielen in der Pflege Beschäftigten, die sich in den Spots wiederfinden. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und laden die Pflegebeschäftigten selbst ein, unsere Seite als öffentliche Plattform zu nutzen", erklärte Zeiger.
Medien & Kultur
Gutachten empfiehlt Neuordnung von Stiftung Preußischer Kulturbesitz

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Der deutsche Wissenschaftsrat empfiehlt eine grundlegende Neuordnung der 1957 gegründeten Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK). Das Potenzial der Sammlungen und Bestände von Weltrang werde derzeit nicht hinreichend ausgeschöpft, sagte die Vorsitzende der Gutachtergruppe, Marina Münkler, bei der Vorstellung der Empfehlungen am 13. Juli in Berlin. Die Handlungsspielräume müssten erweitert werden. Erforderlich sei auch eine "deutlich bessere finanzielle Ausstattung", sagte Münkler.
Die bisherige von Bund und Ländern getragene Dachstruktur sollte aufgelöst und in vier eigenständige Organisationen für die Staatlichen Museen, die Berliner Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut überführt werden, empfiehlt der Wissenschaftsrat. Träger der Einrichtungen solle künftig der Bund sein.
"Unklare Entscheidungsprozesse"
Die Weiterentwicklung der Stiftung werde derzeit durch "tief gestaffelte Hierarchien und unklare Entscheidungsprozesse" behindert, sagte Münkler. Bei den Museen drohe der Anschluss an die internationale Entwicklung verloren zu gehen. Bei der Digitalisierung der Bestände gebe es großen Aufholbedarf.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nannte das knapp 300 Seiten starke Gutachten einen wichtigen Schritt, "um die SPK zukunftsfest zu machen". Für die Stiftung beginne damit "ein mittelfristiger Reformprozess", der in drei bis fünf Jahren veränderte Strukturen zum Ergebnis haben solle, sagte Grütters: "Das wird kein Sprint, das wird eher ein Marathon." Ziel sei, Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe zu verbessern. Arbeitsplätze seien nicht gefährdet, Verschlechterungen seien nicht zu befürchten.
Die Museen der vor allem vom Bund finanzierten Stiftung seien derzeit "finanziell und personell unzureichend ausgestattet", sagte Münkler. Genauere Angaben zum zusätzlichen Finanzbedarf wurden nicht gemacht. "Den haben wir nicht beziffert", sagte Münkler. Es sei jedoch "sicher keine kleine Summe". Das Gutachten wurde 2018 von Grütters in Auftrag gegeben. Der Haushaltsplan für 2020 hat nach Stiftungsangaben einen Umfang von rund 336 Millionen Euro. 2019 waren es nach Angaben des Wissenschaftsrates rund 357 Millionen Euro.
"Bereit zur Veränderung"
Der Präsident der Stiftung, Hermann Parzinger, bezeichnete das Gutachten als guten Ausgangspunkt für weitere Diskussionen und "riesige Chance". Die SPK als größte deutsche Kulturstiftung sei bereit "zu einer radikalen Veränderung". Der Schlüssel für die Weiterentwicklung liege in einer größeren Autonomie und Verantwortung der einzelnen Häuser sowie in flacheren Hierarchien. Ziel müsse sein, mit der künftigen Struktur die Entwicklungspotenziale zu stärken und "das nationale und internationale Renommee und die Strahlkraft nicht zu beschädigen", sagte Parzinger. Eine Auflösung nur um der Auflösung willen sei jedoch nicht praktikabel.
Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören unter anderen 15 Museumssammlungen, darunter die Antikensammlung, das Ägyptische Museum, die Museen für asiatische, islamische und byzantinische Kunst, das Kupferstichkabinett und die Gemäldegalerie. Der Archäologe Parzinger ist seit 2008 Präsident der Stiftung mit derzeit etwa 2.000 Beschäftigten.
Türkisches Gericht verurteilt Deniz Yücel zu Haftstrafe

epd-bild/Christian Ditsch
Frankfurt a.M./Istanbul (epd). Der Journalist Deniz Yücel ist in Istanbul wegen angeblicher Propaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte Yücel, der bei der Urteilsverkündung nicht anwesend war, am 16. Juli auf Twitter mit. Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte in Berlin, das Urteil gegen den deutsch-türkischen Journalisten sende das "absolut falsche Signal".
Die Ankündigung weiterer Ermittlungsverfahren sei für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar, sagte der Minister. "Darin zeigt sich, dass wir weiterhin erhebliche Differenzen beim Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit haben." Diese Entwicklung trage nicht dazu bei, Vertrauen in die Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Türkei aufzubauen. Maas erinnerte auch an weitere deutsche Staatsbürger, die sich in türkischer Haft befinden.
"Unrechtsstaat"
Auch die Grünen kritisierten das Urteil als einen Skandal. Die Medienpolitikerin Margit Stumpp wies darauf hin, dass sich das Istanbuler Gericht nicht nur gegen ein Urteil des Verfassungsgerichts in Ankara, sondern auch gegen die Rechtsprechung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes stelle.
Die Journalistengewerkschaft dju in ver.di erklärte, zwar habe die 32. Istanbuler Strafkammer Yücel vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Doch sei das Urteil ein "weiterer Schlag gegen Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei". Das Urteil sei ein Beleg dafür, "dass die Türkei ein Unrechtsstaat ist", sagte die dju-Bundesvorsitzende Tina Groll.
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) sprach von einem "Willkürurteil, das kritische und unabhängige Berichterstattung dauerhaft kriminalisiert". Offensichtlich sei Rache das alles bestimmende Motiv der türkischen Justiz gegen die Kritiker von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, sagte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall.
"Politisches Urteil"
Yücel twitterte: "Dass die Richter entschieden haben, lieber das Verfassungsgericht bloßzustellen als den Staatspräsidenten, (...) zeigt einmal mehr, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land bestellt ist: erbärmlich". In einem ersten Statement für "welt.de" sprach er von einem "politischen Urteil, wie die ganze Geschichte meiner Verhaftung politisch motiviert war".
Das Urteil sieht Yücel dennoch gelassen: Er sei inhaftiert worden, weil er seine Arbeit als Journalist gemacht habe. "Natürlich wäre ein Freispruch nicht nur rechtlich zwingend, sondern auch erleichternd gewesen. Aber letztlich ist mir dieses Urteil egal, es hat auch keine praktischen Auswirkungen."
Amnesty Deutschland erklärte, die Verurteilung Yücels zeige, dass die Verfolgung von kritischen Journalisten in der Türkei unvermindert weitergehe. "Laut Amnesty sitzen derzeit rund 100 Medienschaffende in türkischen Gefängnissen - mehr als in jedem anderen Land der Welt.
Yücel hatte von Februar 2017 an gut ein Jahr lang in der Türkei im Gefängnis gesessen hatte, davon zehn Monate in Isolationshaft. Der ehemalige Türkei-Korrespondent der Zeitung "Welt" hatte sich in einigen Artikeln kritisch über den Kurdenkonflikt und den Putschversuch im Juli 2016 geäußert. Daraufhin hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Yücel als "PKK-Vertreter" und "deutschen Agenten" bezeichnet. Im Februar 2018 konnte Yücel nach Deutschland zurückkehren. Ende Juni 2018 begann der Prozess in Istanbul in seiner Abwesenheit.
Afrika-Journalistin Bettina Rühl erhält Bundesverdienstkreuz

epd-bild/Norbert Neetz
Frankfurt a.M. (epd). Die Journalistin Bettina Rühl (54) wird für ihre Arbeit als unabhängige Afrika-Korrespondentin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Vorgeschlagen habe sie Außenminister Heiko Maas (SPD) aufgrund ihrer "überdurchschnittlich engagierten und bemerkenswerten Recherche-Arbeit in und ihre Berichterstattung über Afrika", wie das Netzwerk Weltreporter, dessen Vorsitzende Rühl ist, am 15. Juli mitteilte.
Bettina Rühl ist 2011 nach Nairobi (Kenia) gezogen und unter anderem für den ARD-Hörfunk, den Evangelischen Pressedienst (epd), Magazine, Zeitschriften und ab und an für Fernsehsender tätig. Ihre Recherchereisen führen sie häufig in Konflikt- und Krisengebiete in Somalia, Mali, im Kongo und im Sudan. Ihre Reportagen und Features wurden vielfach ausgezeichnet. 2018 erhielt sie den Robert-Geisendörfer Sonderpreis, den Medienpreis der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Die Ordensinsignien des Bundesverdienstkreuzes werden Rühl am 30. Juli in der deutschen Botschaft in Nairobi von Botschafterin Annett Günther überreicht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Rühl das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bereits im Mai verliehen.
Katholischer Medienpreis 2020 vergeben
Bonn (epd). Mit dem Katholischen Medienpreis 2020 sind ein Beitrag der "Zeit" über den Jemen und ein Arte-Film über die Ein-Kind-Politik Chinas ausgezeichnet worden. Der Preis in der Kategorie Printmedien geht an Amrai Coen und Malte Henk, in der Kategorie Elektronische Medien wurden Nanfu Wang und Jialing Zhang geehrt, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am 15. Juli in Bonn mitteilte. Die beiden Kategorien sind mit je 5.000 Euro dotiert.
Den mit 2.000 Euro dotierten Sonderpreis der Jury erhält Veronika Wawatschek für ihren im BR ausgestrahlten Beitrag "Kirche, was tust Du? 10 Jahre Missbrauchsskandal und kein Ende" (Bayern 2-Radio Revue). Bischof Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart), Vorsitzender der Publizistischen Kommission der DBK und der Jury, wird die Auszeichnungen am 12. November in Bonn überreichen.
"Wie können Menschen so etwas tun?"
Amrai Coen (Jahrgang 1986) und Malte Henk (Jahrgang 1976) bekommen den Preis für ihren Beitrag "Wenn sie euch nicht in den Jemen lassen, berichtet trotzdem!", der im August 2019 in der Wochenzeitung "Die Zeit" erschienen ist. Die Autoren hätten sich auf den Weg in den Jemen gemacht und nicht aufgegeben, als ihnen die Einreise verweigert wurde, erklärte die DBK. Sie hätten nach anderen Möglichkeiten gesucht, um über die Menschen im Jemen zu berichten. "Das macht ihre Geschichte preiswürdig. Denn nicht zu berichten hieße, den Kriegsparteien nachzugeben und den Blick abzuwenden vom Leid der Menschen", lobten die Bischöfe. Stattdessen habe das Team das Verständnis für die Menschen in einem vergessenen Krieg gestärkt, ihnen eine Stimme gegeben und die humanitäre Katastrophe dort offengelegt.
Nanfu Wang (Jahrgang 1985) und Jialing Zhang (Jahrgang 1984) erhalten die Auszeichnung für den Film "Land der Einzelkinder", gesendet auf Arte am 22. Oktober 2019. Die Autorinnen, selbst in China geboren, beschreiben die Ein-Kind-Politik des Landes und des kommunistischen Systems. Was sie erfahren hätten, sei "monströs", erklärte die Bischofskonferenz. Dabei beleuchteten die Autorinnen auch die Mitverantwortung des Einzelnen. "Die zentrale Frage des Films 'Wie können Menschen so etwas tun?' stellen Wang und Zhang ebenso unermüdlich wie frei von Aggression", hieß es zur Begründung für den Preis. "Sie bewegen sich journalistisch, inhaltlich und ästhetisch auf höchstem Niveau und werben so für humanitäres und soziales Verantwortungsbewusstsein als Grundlage und Voraussetzung für menschenwürdiges Zusammenleben."
185 Beiträge eingereicht
Der Katholische Medienpreis wird seit 2003 jährlich von der Deutschen Bischofskonferenz zusammen mit der Gesellschaft Katholischer Publizisten (GKP) und dem Katholischen Medienverband ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden Beiträge, die die Orientierung an christlichen Werten sowie das Verständnis für Menschen und gesellschaftliche Zusammenhänge fördern, das humanitäre und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zum Zusammenleben unterschiedlicher Gemeinschaften, Religionen, Kulturen und Einzelpersonen beitragen. In diesem Jahr wurden den Angaben zufolge insgesamt 185 Beiträge eingereicht, 102 in der Kategorie Elektronische Medien und 83 in der Kategorie Printmedien.
"Literarischer Sommer" startet trotz Pandemie
Krefeld (epd). Das deutsch-niederländische Festival "Literarischer Sommer" wird trotz Corona in diesem Jahr stattfinden. "Wir sind froh, dass es etwas Analoges gibt", sagte Gabriele König, Kulturbeauftragte der Stadt Krefeld am 15. Juli. Die 21. Ausgabe des "Literarischen Sommers" beginnt am 29. Juli in Aachen mit einer Lesung von Alexander Osang und endet am 8. September mit einer Lesung von Jan Costin Wagner in Venlo. Es gelten verschiedene Corona-Schutzmaßnahmen.
Die meisten Autorinnen und Autoren lesen den Organisatoren zufolge aus Romanen. Zudem gebe es eine Poetry-Slam-Veranstaltung, eine Kinderbuch-Vorstellung, zwei Krimi-Lesungen und es werde literarisch durch Düsseldorf geführt. Zum sechsten Mal sei zudem eine Lesung aus der "Het Bureau"-Reihe des niederländischen Autors J.J. Voskuil geplant. Die teilnehmenden Städte in der Grenzregion sind Aachen, Bedburg-Hau, Düsseldorf, Eijsden, Heerlen, Kerkrade, Korschenbroich, Krefeld, Neuss, Rommerskirchen, Vaals, Valkenburg und Venlo.
Im Vergleich zu den vorangegangen Jahren habe sich die Zahl der Autorinnen und Autoren durch die Corona-Bedingungen verringert: "Die Zahl der Lesungen hat sich etwa halbiert", sagt Evelyn Buchholtz von der Mediothek Krefeld. "Wir sind sehr froh, Lesern und Autoren etwas anbieten zu können." In den Räumen solle bis zum Platznehmen ein Mundschutz getragen werden.
Die Tickets für die Veranstaltungen sind den Angabe zufolge in Aachen, Krefeld und Neuss ausschließlich digital zu kaufen: "Damit werden zugleich die Kontaktdaten erfasst", erklärte die Mediothek Krefeld. Gedruckte Festivalkarten werden in diesem Jahr nicht angeboten, ebenso wenig ein gedrucktes Programmheft.
Rekordreichweite: 1,69 Millionen Menschen lesen regelmäßig "chrismon"
Frankfurt a.M. (epd). Das evangelische Magazin "chrismon" hat einer aktuellen Erhebung zufolge rund 1,69 Millionen regelmäßige Leser. Das sei der höchste Wert seit der Gründung im Jahr 2000, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 14. Juli in Frankfurt am Main mit. Bei den Leserinnen und Lesern, die das Magazin intensiv nutzen, sei eine Steigerung von 67 Prozent gegenüber 2014 zu verzeichnen. Die Zahlen gehen aus der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2020 (AWA 2020) hervor.
"Wir sind froh und dankbar, mit jedem Jahr noch mehr Menschen mit starken Geschichten und berührenden Bildern voller Zuversicht und Menschenfreundlichkeit zu begeistern", sagte "chrismon"-Chefredakteurin Ursula Ott. Das Magazin wird großen deutschen Tages- und Wochenzeitungen beigelegt, darunter die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", die "Süddeutsche Zeitung", die "Welt" und die "Welt am Sonntag" sowie "Die Zeit".
"chrismon" wird vom Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik verlegt. Das GEP ist das zentrale Mediendienstleistungsunternehmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Gliedkirchen, Werke und Einrichtungen. Es trägt unter anderem auch die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd).
Saar-Musikfestival "Resonanzen" passt sich Corona an
Saarbrücken (epd). Das neue saarländische Musikfestival "Resonanzen" plant wegen der Corona-Pandemie für seinen Start am 1. Oktober mit einem flexiblen Baukastensystem. Bisher hätte das Team bestätigte Künstler für einzelne Termine mit der Option für weitere Tage sowie Spielorte festgezurrt, sagte der künstlerische Leiter Sebastian Studnitzky am 17. Juli in Saarbrücken. Gegen Ende August sollten dann die Künstler mit den Spielorten zusammengeführt werden. Sie hielten die Planung so lange offen, wie sie in keine "planerische Bredouille" kommen, betonte er. Das Festival soll bis zum 11. Oktober gehen.
Zu den bisherigen Veranstaltungsorten gehören etwa das Saarbrücker Congress-Zentrum, das Studio Halberg beim Saarländische Rundfunk (SR), die evangelische Johanneskirche und mit dem Pingusson-Gebäude die frühere französische Botschaft. Das Festival orientiere sich an den Begriffen, jung, urban und grenzüberschreitend. Die meisten Künstler kämen aus der jüngeren Generation, darunter viele aus Luxemburg, Frankreich oder der Wallonie. Es gehe auch darum einen Dialog aufzubauen und sowohl Musiker als auch Fans miteinander in Verbindung zu bringen. Musikalisch sei es eine Mischung aus experimentellem Pop, Elektronik und Jazz, aber letzten Endes gehe es um Musiker, die genreübergreifend denken oder arbeiten.
"Resonanzen" folgt auf das erste und einzige Popkulturfestival "Colors of Pop" von 2017. Unter dem Motto "Jung - urban - grenzüberschreitend" soll sich das Festival unter Rechtsträgerschaft der Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit auf aktuelle Entwicklungen in der Musik, insbesondere in den Schnittmengen der verschiedenen musikalischen Richtungen konzentrieren. Das Land fördert es mit 600.000 Euro.
Entwicklung
Eckpunkte für Lieferkettengesetz im August im Kabinett

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Große deutsche Firmen sollen künftig für ausbeuterische Praktiken ihrer ausländischen Partner haftbar gemacht werden können. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gaben am 14. Juli in Berlin bekannt, dass sie dem Kabinett im August Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz vorlegen wollen. Ziel der Minister ist es, in dieser Legislaturperiode zu einem Gesetz zu kommen.
Heil sagte, es gehe nun darum, die Rechte der Menschen zu schützen, die Waren für Deutschland produzierten. Müller fügte mit Blick auf Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern hinzu: "Wir tolerieren im großen Stil Kinderarbeit." Pro Kopf arbeiteten "für unseren Konsum" im Durchschnitt "50 Sklaven" in der Schuhproduktion, der Textilproduktion und anderen Bereichen.
Das Lieferkettengesetz geht auf den "Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte" (NAP) aus dem Jahr 2016 zurück, der auch im Koalitionsvertrag bekräftigt wird. Dieser sieht vor: Wenn sich bis 2020 herausstellt, dass weniger als die Hälfte der großen Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachkommen, sollen "weitergehende Schritte bis hin zu gesetzlichen Maßnahmen" geprüft werden. Dazu liefen seit dem vergangenen Sommer Umfragen zur Selbsteinschätzung deutscher Unternehmen.
"Ernüchternde Ergebnisse"
Nun wurden die Ergebnisse vorgestellt: Von rund 2.250 befragten Unternehmen in einer zweiten Fragerunde haben gerade einmal 455 Firmen gültige Antworten eingereicht. Lediglich 22 Prozent kämen ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nach, sagte Müller. In der ersten Runde der Umfragen sah es ähnlich aus: nur 465 von 3.300 angeschriebenen Unternehmen haben den Fragebogen ausgefüllt, davon erfüllten 18 Prozent die Vorgaben. Beide Minister sahen damit die Voraussetzungen für ein Lieferkettengesetz erfüllt.
Heil betonte, die "ernüchternden" Ergebnisse zeigten, "dass Freiwilligkeit nicht ausreicht". Betroffen von einem Lieferkettengesetz wären den Angaben nach rund 7.000 Unternehmen. Es gehe um große Firmen, nicht um den kleinen Handwerker um die Ecke, sagte der Minister.
Außenminister Heiko Maas (SPD), unter dessen Federführung die Umfragen erfolgten, teilte mit, es müsse jetzt über gesetzliche Regelungen gesprochen werden, "damit sich vorbildliches Verhalten von Unternehmen lohnt und die schwarzen Schafe zur Rechenschaft gezogen werden".
Das Wirtschaftsministerium warnte hingegen vor "Schnellschüssen", die sich bei solch wichtigen Themen "verbieten". Dort, wo es noch Optimierungsbedarf gebe, sollten gemeinsam mit der Wirtschaft Gespräche über mögliche weitere Maßnahmen und Schritte geführt werden. Wirtschaftsverbände warnten bereits eindringlich vor einem Lieferkettengesetz.
Gegen Benachteiligung von Frauen vorgehen
Mehrere Nichtregierungsorganisationen forderten, auch gegen die Benachteiligung von Frauen vorzugehen. Es seien vor allem Frauen, die international für Niedrigstlöhne arbeiten, hoben "Brot für die Welt", Femnet, FIAN und das Global Policy Forum in einer gemeinsamen Erklärung hervor. Die "Initiative Lieferkettengesetz" aus mehr als 90 Organisationen verlangte klare Haftungsregeln.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen mahnte, Verbraucher müssten sich darauf verlassen können, dass ihr Einkauf keine Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung fördert. Der TÜV-Verband, der in die Überprüfung einbezogen werden könnte, begrüßte die Pläne. Allerdings reiche ein nationales Gesetz nicht aus. Deutschland müsse sich für eine europäische Lösung stark machen.
Nach Angaben von Müller und Heil will sich die Bundesregierung während der aktuellen deutschen EU-Ratspräsidentschaft auch für einen EU-Aktionsplan zur Stärkung der Unternehmensverantwortung in globalen Lieferketten einsetzen.
Zwischen Chaos und Ignoranz
Während Europa über immer mehr Lockerungen diskutiert, wütet die Corona-Pandemie in Lateinamerika. Die Regierungen der Länder agieren unterschiedlich - teils mit dramatischen Konsequenzen.Berlin, São Paulo (epd). Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Lateinamerika seit Wochen, ein Ende ist nicht in Sicht. Der Subkontinent hat sich zum neuen Epizentrum der Pandemie entwickelt. Fast täglich melden Länder wie Brasilien und Mexiko neue Negativrekorde bei Erkrankten und Toten. Auch in Peru, Chile, Kolumbien, Venezuela und Bolivien steigen die Zahlen stetig an.
Die Gründe für die dramatische Situation in der Region sind vielfältig und doch immer gleich. Vor allem die Armen sind auf das marode staatliche Gesundheitswesen angewiesen, sie wohnen oft beengt unter prekären hygienischen Bedingungen und können selbst bei einer Infektion nicht in Quarantäne gehen. Hinzu kommen Desinformation und Fake-News sowie ein in vielen Ländern weit verbreiteter Aberglaube. Aufklärungsmaßnahmen der Behörden, wenn es sie gibt, erreichen viel zu wenig Menschen.
Schlimmer als in Italien
Mehr als drei Millionen Menschen sind in der Region mit dem Covid-19-Virus offiziell infiziert. Wegen der geringen Testkapazität liegt die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher. Rund 150.000 Menschen sind bereits gestorben. Lateinamerika ist in Bezug auf die Todesfälle die nach Europa am schwersten getroffene Region, noch vor den USA. Laut Prognosen der Weltgesundheitsorganisation könnten auf dem Subkontinent bis Oktober bis zu 438.000 Menschen an den Folgen des Virus sterben.
Brasilien, Peru und Mexiko haben am schwersten mit der Pandemie zu kämpfen. Doch die Regierungen reagieren sehr unterschiedlich - mit verheerenden Auswirkungen. Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair Bolsonaro leugnet trotz mehr als 72.000 Corona-Toten in seinem Land immer noch die Gefährlichkeit des Virus. Auch in Mexiko spielte Präsident Andrés Manuel López Obrador lange die Pandemie herunter und lenkte erst sehr spät mit einheitlichen Schutzmaßnahmen ein. Inzwischen hat das Land mehr als 36.000 Tote zu beklagen und damit Italien überholt.
Ausbreitung trotz Ausgangsbeschränkungen
Peru verhängte bereits Mitte März, noch vor Deutschland und anderen europäischen Ländern, strenge Ausgangsbeschränkungen, die immer noch gelten. Trotzdem konnte das Virus nicht aufgehalten werden. Hauptgrund dafür ist wie in anderen lateinamerikanischen Ländern die große soziale Ungleichheit. So haben in Peru 40 Prozent der Haushalte keinen Kühlschrank. Die Menschen könnten keine Vorräte anlegen, sondern müssten regelmäßig auf den Markt gehen, erklärt der peruanische Ökonom Hugo Ñopo. Nach offiziellen Angaben waren beispielsweise 86 Prozent der Händler auf dem größten Gemüsemarkt der Hauptstadt Lima mit dem Virus infiziert. Ähnlich hoch waren die Infektionsraten auf anderen lokalen Märkten.
Statt konsequenter Aufklärung verstärkte Mexikos Präsident López Obrador den Aberglauben in seinem Land. Der beste Schutz gegen das Virus sei Ehrlichkeit, verkündet der Populist Mitte März auf einer Pressekonferenz. Dann fingerte er einen roten Stofffetzen mit dem Bild von Jesus aus seiner Hosentasche und zeigte es andächtig in die Kameras. Das Amulett sei sein Schutzschild vor einer Infektion.
Brasiliens Präsident Bolsonaro hat sich selbst mit Covid-19 infiziert, was ihn aber nicht daran hindert, regelmäßig Werbung für das umstrittene und bei Covid-19 als wirkungslos geltende Malariamittel Hydroxychloroquin zu machen. "Wir kämpfen gegen das Corona-Virus und das Bolsonaro-Virus", sagte São Paulos Gouverneur João Doria. Während die Regierung im Chaos versinkt, haben die Gouverneure im Alleingang Ausgangsbeschränkungen und Quarantänemaßnahmen umgesetzt.
Steigende Armut
Viel Lob für sein striktes Durchgreifen im Kampf gegen die Pandemie hat Argentinien erhalten. Präsident Alberto Fernández koordiniert die Maßnahmen zusammen mit den Gouverneuren, der Opposition und Wissenschaftlern. Seit dem 19. März gilt ein Ausgangsverbot. Damit konnte zwar die ungebremste Ausbreitung des Virus verhindert werden, doch der soziale Preis ist hoch. Die Armut ist extrem gestiegen und dem Land droht erneut eine Staatspleite.
Auch die Vereinten Nationen warnen vor einer Armutswelle auf dem Kontinent. Rund 45 Millionen Menschen könnten aus der Mittelklasse in die Armut rutschen, sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Damit würden mehr als 230 Millionen Menschen auf dem Kontinent in Armut leben und die Armutsrate um sieben Prozentpunkte auf rund 37 Prozent klettern.
Brasilien überschreitet Marke von zwei Millionen Corona-Infizierten
Berlin, São Paulo (epd). Brasilien hat die Marke von mehr als zwei Millionen Corona-Infizierten überschritten. Wie das Gesundheitsministerium am 16. Juli mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 45.400 Neuinfektionen registriert. 1.322 Menschen sind offiziellen Angaben zufolge innerhalb eines Tages an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten auf knapp 77.000. Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet.
Da Lateinamerikas größte Volkswirtschaft über geringe Testkapazitäten verfügt, könnte die Zahl der Corona-Infizierten laut Experten rund sieben Mal höher liegen. Präsident Jair Bolsonaro verharmlost trotz seiner eigenen Covid-19-Infektion die Pandemie weiter als "kleine Grippe" und drängt auf mehr Lockerungen bei den Einschränkungen. Seit zwei Monaten ist Brasiliens Regierung zudem ohne Gesundheitsminister. Im Streit über das Krisenmanagement mit Bolsonaro haben binnen weniger Wochen zwei Gesundheitsminister, beides Ärzte, die Regierung verlassen. Jetzt wird das Ministerium übergangsweise von General Eduardo Pazuello geführt, der weder über eine medizinische noch administrative Erfahrungen verfügt.
Hotspot São Paulo
Besonders schwer von der Pandemie ist der größte Bundesstaat São Paulo betroffen. Mehr als 400.000 Infektionen wurden dort bislang registriert, über 19.000 Menschen starben an den Folgen einer Corona-Infektion. Trotzdem hatte die Regionalregierung Lockerungen wie die Öffnung von Läden, Shopping-Centern sowie von Restaurants und Bars verfügt. Das Virus breitet sich jetzt Medienberichten zufolge vor allem im Innern des Landes mit ungebremster Geschwindigkeit aus. Laut der staatlichen Gesundheitsstiftung Fiocruz ist der Höhepunkt der Pandemie in Brasilien noch nicht erreicht.
Corona: "Radikale Quarantäne" in Caracas
Berlin, Caracas (epd). Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro hat eine "radikale Quarantäne" für die Hauptstadt Caracas verhängt. Nur noch wichtige Bereiche wie das Gesundheitswesen, Telekommunikation und Sicherheit dürften weiter arbeiten, verkündet Maduro am 15. Juli via Twitter. Der Rest der Bevölkerung müsse zu Hause bleiben. Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung gelten für den Großraum Caracas und den angrenzenden Bundesstaat Miranda, wo insgesamt rund sechs Millionen Menschen leben.
Maduro rief die nach Kolumbien geflohenen Venezolaner auf, auf legalem Weg in ihr Land zurückzukehren und sich in Quarantäne zu begeben. "Hier werden sie mit Liebe empfangen", sagte er. Wer illegal mit Schleusern zurückkehre, infiziere möglicherweise seine Familie. Maduro machte die Rückkehrer für die Ausbreitung des Coronavirus in Venezuela mitverantwortlich. Wegen der schweren Wirtschaftskrise haben rund fünf Millionen Venezolaner ihr Land verlassen. Die meisten sind nach Kolumbien geflohen. Allerdings sind aufgrund der Pandemie die Grenzen geschlossen.
Gesundheitswesen vor Zusammenbruch
Vizepräsidentin Delcy Rodríguez hatte zuvor einen neuen Anstieg der Corona-Infektionen bekanntgegeben. Insgesamt sind offiziellen Angaben zufolge etwa 10.500 Menschen infiziert. Die Dunkelziffer dürfte aber weit höher liegen. Venezuela verfügt über sehr geringe Testkapazitäten, das Gesundheitswesen in dem Krisenland steht vor dem Zusammenbruch. Rund 100 Menschen sind Rodríguez zufolge bislang an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.
Die meisten Venezolaner können sich nicht an die seit Mitte März geltenden Ausgangsbeschränkungen halten, weil sie für ihren Lebensunterhalt sorgen müssen. Hinzukommen fast tägliche Stromausfälle sowie fehlende Medikamente und Schutzkleidung. Auch venezolanische Ärzteverbände hatten erklärt, dass die Krankenhäuser nicht in der Lage seien, an Covid-19 Erkrankte zu behandeln.
Anklage in Den Haag: Islamist wegen Terror in Mali vor Gericht
Den Haag (epd). Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat die Anklagebehörde schwere Vorwürfe gegen einen mutmaßlichen Anführer der islamistischen Terrorgruppe Ansar Dine aus Mali erhoben. Al-Hassan Ag Abdoul Aziz sei persönlich für Folter und Gewalt gegen die Bevölkerung im Norden Malis verantwortlich, sagte Chefanklägerin Fatou Bensouda zur Eröffnung des Prozesses am 14. Juli. "Er stand im Zentrum eines Regimes von Unterdrückung und Verfolgung."
Der 42-jährige Al-Hassan muss sich vor dem Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verantworten, darunter Folter, Mord, Vergewaltigung, sexuelle Versklavung und Zerstörung von Kultur- und Religionsgütern. Er soll 2012 und 2013 De-facto-Chef einer islamistischen Polizei im Norden Malis gewesen sein. Die Anklagebe wirft ihm vor, an der Errichtung eines Terrorregimes in der Stadt und Region Timbuktu beteiligt gewesen sein, nach dem Musik, Tanz und traditionelle Kleidung verboten waren. Al-Hassan selbst sei beispielsweise an der Auspeitschung von Frauen beteiligt gewesen, sagte Bensouda.
Bis zu 30 Jahre Haft
Al-Hassan schwieg zu den Vorwürfen. Er erklärte, er wolle sich nicht zu den Anklagepunkten äußern. Die Verteidigung hatte zuvor aus Gesundheitsgründen eine Verschiebung des Prozesses gefordert. Al-Hassan sei während der Untersuchungshaft in Mali gefoltert worden. Wegen der Corona-Krise habe in den vergangenen Monaten jedoch keine eingehende Untersuchung seines körperlichen Zustands stattfinden können, sagte Al-Hassans Anwältin Nicoletta Montefusco. Das Gericht lehnte den Antrag auf Verschiebung ab.
Al-Hassan wurde im März 2018 in Mali verhaftet und an das Gericht in den Niederlanden überstellt. Mit einem Urteil wird nicht vor Ende kommenden Jahres gerechnet. Bei einem Schuldspruch drohen bis zu 30 Jahre Haft. Al-Hassan ist der zweite Angeklagte aus Mali. Im September 2016 verurteilte der Strafgerichtshof den Gelehrten und lokalen Chef der islamistischen Polizei, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, zu neun Jahren Haft.
Teil von Al-Kaida
Die Miliz Ansah Diene ist Teil des Terrornetzwerks Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQIM) und übernahm 2012 im Norden Malis gemeinsam mit anderen islamistischen Gruppen die Macht. Während der Besetzung von Timbuktu zerstörten sie auch historische Gebäude, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehörten. 2013 hatte der Strafgerichtshof Ermittlungen zu Mali aufgenommen. Die Milizen wurden verdrängt.
Trotz internationaler Militäreinsätze, an denen auch die Bundeswehr beteiligt ist, kommt es immer wieder zu Anschlägen. Chefanklägerin Bensouda äußerte sich besorgt über eine Zunahme der Gewalt in den vergangenen Monaten. Der Prozess gegen Al-Hassan sei jedoch eine Botschaft an die Verantwortlichen, dass jeder zur Rechenschaft gezogen werden könne.
UN: Zahl der Hungernden steigt - Corona verschärft Versorgungslage
Knapp neun Prozent der Weltbevölkerung leiden an Hunger - Tendenz steigend. Drei Milliarden Menschen können sich zudem keine gesunde Ernährung leisten. Hilfswerke fordern ein Umdenken der Politik.Rom, New York (epd). Nach Erfolgen im Kampf gegen Unterernährung weltweit steigt die Zahl der Hungernden wieder an. 60 Millionen Menschen mehr als vor fünf Jahren hatten 2019 laut den Vereinten Nationen nicht genug zu essen. Dies geht aus dem Welternährungsbericht hervor, der am 13. Juli in New York und Rom veröffentlicht wurde. Etwa 690 Millionen Menschen und damit knapp neun Prozent der Weltbevölkerung sind demnach unterernährt. In Afrika leidet ein Fünftel der Bevölkerung an Hunger. Sollte der derzeitige Trend anhalten, dürfte die Zahl der Hungernden bis 2030 auf 840 Millionen steigen. Die Corona-Pandemie verschärft die Versorgungslage den UN zufolge massiv.
Der Bericht über die "Lage der Nahrungssicherheit und Ernährung" korrigierte in diesem Jahr aufgrund zusätzlicher Daten aus China die Zahlen der vergangenen Jahre nach unten. Der Trend des seit 2014 langsam aber stetig wachsenden Hungers habe sich dadurch jedoch nicht verändert, teilten die beteiligten UN-Organisationen mit. In diesem Jahr verschlechterten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie wie Ausgangssperren und die Unterbrechung von Transportwegen die Ernährungslage vieler Menschen. Etwa 130 Millionen Frauen, Männer und Kinder zusätzlich müssten dadurch womöglich hungern, warnen die Autorinnen und Autoren der Studie.
"Dramatische neue Zahlen"
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte, der Bericht zeige, wie sehr sich die Lage der hungernden Menschen in der Welt verschärfe. "Wir dürfen es nicht hinnehmen, dass nach zehn Jahren des Rückgangs die Hungerzahlen weiter ansteigen", betonte er.
Entwicklungsorganisationen forderten ein Umdenken in der Politik. "Angesichts der dramatischen neuen Zahlen kann es in der Hungerbekämpfung kein 'Weiter so' mehr geben", erklärte die Agrarexpertin von Oxfam, Marita Wiggerthale. Die Bundesregierung müsse sich für existenzsichernde Einkommen und Löhne bei den Produzenten weltweit sowie für Agrarökologie einsetzen. "Die Regierungen tun viel zu wenig, um den Hunger zu bekämpfen." Nur neun Prozent des Corona-Hilfsaufrufs der UN seien bislang finanziert.
Der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Fian, Philipp Mimkes, erklärte: "Es ist eine bittere Realität, dass das Menschenrecht auf Nahrung von immer mehr Menschen verletzt wird, obwohl wir mehr als genug Nahrungsmittel produzieren." Das Ziel der Staatengemeinschaft, den Hunger bis 2030 zu besiegen, werde immer unrealistischer.
Das katholische Hilfswerk Misereor sprach von einem Weckruf für die Weltgemeinschaft, das globalisierte Ernährungssystem endlich zu reformieren. In der Corona-Krise zeigten sich dessen Schwachstellen mit dramatischer Deutlichkeit, sagte Hauptgeschäftsführer Pirmin Spiegel. Es sei ein System, "das die Armen noch ärmer macht und die Erde gnadenlos zerstört". Lokale Produktions- und Wirtschaftskreisläufe müssten wiederbelebt werden.
"Versagen der Weltgemeinschaft"
Laut dem UN-Bericht können sich drei Milliarden Menschen keine gesunde Ernährung leisten. Die meisten von ihnen, 1,9 Milliarden, leben dem Bericht zufolge in Asien, gefolgt von Afrika (965 Millionen). Insgesamt ist Asien mit etwa 380 Millionen Hungernden der Kontinent mit den meisten Menschen, die nicht genug zu essen haben. Am schnellsten steigt die Zahl derer, die Hunger leiden, jedoch in Afrika.
Der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Uwe Kekeritz, erklärte, der Welternährungsbericht 2020 belege zum fünften Mal in Folge das Versagen der Weltgemeinschaft. Ursachen für den Hunger seien unter anderen die Klimakrise, gewaltsame Konflikte, Ungleichheit und eine fehlgeleitete Agrar- und Handelspolitik.
Der Welternährungsbericht wurde gemeinsam von Welternährungsprogramm (WFP), Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), Kinderhilfsprogramm (Unicef), Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Fonds für Landwirtschaftsentwicklung (Ifad) erstellt. Die Urheber warnen darin überdies vor wachsenden Zahlen an Übergewichtigen in armen ebenso wie in reichen Ländern.

