Kirchen
"Die Ökumene lebt"

epd-bild/Albin Hillert
Amsterdam (epd). Mit einem Festgottesdienst an seinem Gründungsort hat der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) am 23. August sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. In der historischen Nieuwe Kerk in Amsterdam, wo der Weltkirchenrat am 23. August 1948 gegründet wurde, würdigten Vertreter der Mitgliedskirchen die Fortschritte der Ökumene in den vergangenen Jahrzehnten. 350 Kirchen in aller Welt sind heute Teil der Gemeinschaft. Sie vertreten mehr als eine halbe Milliarde Christen.
"Der Weltkirchenrat hat seit seiner Gründung die Leben vieler Menschen berührt und den Stimmlosen eine Stimme gegeben", sagte die Vorsitzende des ÖRK-Zentralausschusses, Agnes Abuom von der anglikanischen Kirche von Kenia. "Der Samen, der in Amsterdam vor 70 Jahren gepflanzt wurde, ist heute ein Baum, der Christen weltweit Schatten spendet." Junge Christen unter anderem aus dem Südsudan, Palästina und Südkorea wirkten an dem Gottesdienst mit.
Abuom erinnerte an die Ursprünge des Weltkirchenrats, der unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges gegründet wurde und sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Der Krieg, der damals Millionen Leben in Europa kostete, tobe heute unter anderem im Nahen Osten, in Afrika und Asien. Der Weltkirchenrat sei deshalb nach wie vor wichtig als Ort für Dialog und gemeinsames Handeln, sagte die Theologin.
"Nur ein Glaube"
Der norwegische Pfarrer und ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit betonte in seiner Predigt die Notwendigkeit der Einheit. "Die Ökumene lebt", sagte Tveit und erklärte, es gebe nur einen Glauben, eine Menschheit und eine Welt.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, würdigte den ÖRK als Antwort auf die Spaltung der Kirchen. "Es gibt keinen katholischen Christus, keinen orthodoxen Christus und keinen protestantischen Christus! Es gibt nur den einen Jesus Christus, der uns alle vereint," sagte der deutsche Theologe in Amsterdam.
ÖRK-Mitgliedskirchen finden sich in allen Regionen der Welt. Zu ihnen zählen die Mehrzahl der orthodoxen Kirchen, alt-katholische, anglikanische, baptistische, lutherische, mennonitische, methodistische, reformierte und unabhängige Freikirchen sowie einige Pfingstkirchen. Die römisch-katholische Kirche, die fast 1,4 Milliarden Gläubige vereint, ist nicht Mitglied. Vertreter des Vatikans arbeiten jedoch seit Ende der 1960er Jahre in wichtigen ÖRK-Gremien mit.
Pilgerweg der Gerechtigkeit
Bei einem Marsch durch die Innenstadt von Amsterdam erinnerten den Veranstaltern zufolge am 23. August rund 250 Menschen an den Einsatz des Weltkirchenrats für Gerechtigkeit und Frieden. Der Marsch symbolisierte den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens, auf dem die Arbeit des ÖRK beruht. Zuvor hatten sich Vertreter der Mitgliedskirchen bei einem Symposium an der Freien Universität Amsterdam ausgetauscht. Die Veranstaltungen in Amsterdam sind Teil einer Reihe von Jubiläumsfeierlichkeiten, die während des gesamten Jahres an verschiedenen Orten stattfinden.
Bedford-Strohm: Europa braucht Impulse der Christenheit

epd-bild/Norbert Neetz
München (epd). Seit 70 Jahren besteht der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK). Am 23. August 2018 wurde in Amsterdam gefeiert - unter anderem mit einem Walk of Peace. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ist mitgelaufen und erzählt dem Evangelischen Pressedienst (epd) von seinen Eindrücken.
epd: Ihr Eindruck von den Feierlichkeiten zum ÖRK-Jubiläum und dem Walk of Peace?
Bedford-Strohm: Immer wieder habe ich Bilder von der Gründungsversammlung des ÖRK 1948 in Amsterdam gesehen. Deswegen war es schon ein besonderes Erlebnis, nun auf den Tag genau 70 Jahre später am gleichen Ort in der vollen Nieuwe Kerk in Amsterdam beim Jubiläumsgottesdienst mitwirken zu dürfen. Es war ein fröhlicher Gottesdienst mit der Mitwirkung vieler junger Leute unterschiedlicher Hautfarben. Die Zukunft der Kirche, wie ich sie mir erhoffe, ist sinnlich sichtbar geworden: fromm und hoffnungsvoll, engagiert, bunt, weltzugewandt, völkerverbindend und alle Generationen umgreifend. Der wichtigste Impuls, den ich aus Amsterdam nach Deutschland mitnehme, ist die konsequente Beteiligung der jungen Generation.
epd: Der ÖRK wurde vor 70 Jahre gegründet: Sind die Kirchen weltweit seither zusammengewachsen oder streben sie auseinander?
Bedford-Strohm: Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Auch die Kirchen sind nicht frei von den Polarisierungen in der Welt, die wir gegenwärtig erleben. Aber ich habe den Eindruck, dass überall da, wo wir wirklich auf Christus hören, die Grundlage für die Überwindung dieser Polarisierungen gelegt ist. Die radikale Liebe Jesu Christi ist die größte Gegenkraft gegen die Missachtung der Menschenwürde, die sich in Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus oder nationalistischer Selbstüberhöhung zeigt. Ich bin in Amsterdam immer wieder auf den in Deutschland besonders deutlich gewordenen ökumenischen Geist des Reformationsjubiläums angesprochen worden. Der daraus erwachsende Impuls für Arbeit an der Einheit der Kirchen ist weltweit wahrgenommen worden. Daran können wir jetzt anknüpfen.
epd: Welchen Herausforderungen muss sich der ÖRK aktuell widmen?
Bedford-Strohm: Wenn es den ÖRK nicht schon gäbe, müsste er gerade jetzt dringend erfunden werden. Gerade wir in Europa brauchen in zunehmend säkularisierten Umgebungen die Impulse der Glaubensfreude und täglich gelebten Frömmigkeit aus der weltweiten Christenheit. Und die Welt braucht das Orientierungswissen der Christenheit in den großen Zukunftsfragen der Menschheit. Keine dieser Fragen ist heute noch auf nationaler Ebene zu lösen. Soziale Gerechtigkeit, Überwindung der Gewalt, die Umorientierung hin zu einer ökologisch verträglichen Wirtschaftsweise, die ernst nimmt, dass uns die Natur als Schöpfung Gottes anvertraut ist - das alles braucht verantwortliches Handeln auf globaler Ebene.
Deswegen ist das internationale Netzwerk der Kirchen gerade heute so wichtig. Durch ihre Gemeinden tief verwurzelt in den lokalen Kontexten und gleichzeitig universal ausgerichtet im Horizont der Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns verheißen hat - das ist die Kirche. Und deswegen ist sie geradezu prädestiniert als kraftvoller Akteur einer weltweiten Zivilgesellschaft. Der Weltkirchenrat ist dafür die wichtigste institutionelle Basis. Deswegen bin ich so dankbar dafür, dass es ihn gibt.
Viele Gemeinden missachten Verfahrensregeln beim Kirchenasyl

epd-bild/Jens Schulze
Berlin (epd). Nur jede zweite Gemeinde, die Flüchtlingen Kirchenasyl gewährt, kommt den geforderten Verfahrensregeln nach. Aus Gesprächen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wisse man, dass 2017 entgegen der Übereinkunft zwischen Staat und Kirchen nur in etwa der Hälfte aller Kirchenasylfälle Gemeinden ein Dossier eingereicht hätten, sagte der Leiter des Berliner Büros der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Karl Jüsten, der Tageszeitung "Die Welt" (21. August). Der Berliner Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Martin Dutzmann, bestätigte die Zahl "über alle Konfessionen hinweg". Von den evangelischen Asyl-Gemeinden reichten ihm zufolge etwa 53 Prozent im vergangenen Jahr ein Dossier ein.
Zahlen aus dem niedersächsischen Innenministerium entsprechen den Angaben der beiden Prälaten: Aus einer Auswertung des niedersächsischen Bundesamtes für den Zeitraum von Mai 2016 bis September 2017 gehe hervor, dass nur in rund 54 Prozent der Fälle Dossiers eingereicht wurden, nur 58 Prozent hätten dem Bundesamt einen Kirchenvertreter als Ansprechpartner genannt.
Vereinbarung mit dem Bundesamt
Die evangelische Kirche in Niedersachsen wollte die Tendenzen nicht bestätigen. Es treffe zwar zu, dass in der Konföderation der fünf Landeskirchen die Zahl der gemeldeten Kirchenasyle von der Zahl der eingereichten Dossiers abweiche, sagte Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke dem epd. "Allerdings sind das nur einige wenige Abweichler." Das Gros der Gemeinden gehe sehr sorgsam mit dem Kirchenasyl um.
2015 hatten Kirchen und Bundesamt vereinbart, dass der Staat das Kirchenasyl hinnimmt und zur Prüfung der jeweiligen Fälle bereit ist, sofern die Gemeinden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Dossiers zu den Hintergründen der Asylsuchenden übermitteln und einen kirchlichen Ansprechpartner benennen.
Prälat Dutzmann sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), die EKD bedauere, dass es den Gemeinden nicht in allen Kirchenasylfällen gelinge, zeitnah ein vollständiges Dossier einzureichen. Allerdings sei dessen Erstellung oft schwierig und zeitaufwendig, das Bundesamt stelle hohe Anforderungen. Die Personen, die den Schutzsuchenden Obhut gewährten, seien in der Regel juristische und medizinische Laien. "Deshalb sind sie auf fachlichen Rat angewiesen", sagte Dutzmann.
Frist auf 18 Monate verlängert
Aber insbesondere fachärztliche Atteste etwa über eine akute Suizidgefahr sei in manchen Region kurzfristig nicht zu bekommen. Aber nur ein aussagekräftiges Dossiers versetze das Bundesamt in die Lage, den von der Gemeinde angenommenen besonderen humanitären Härtefall zu überprüfen, sagte Dutzmann. Selbstverständlich bitte die EKD die Gemeinden weiterhin, dem Bundesamt die besondere Härte des Einzelfalls auch konkret darzulegen.
Zwischen 1. Januar 2017 und 30. Juni 2018 hatten katholische, evangelische und freikirchliche Gemeinden laut "Welt" 2.533 Fälle von Kirchenasyl gemeldet. Insgesamt hätten in diesem Zeitraum 3.481 Personen in den Gotteshäusern Schutz gesucht. Aktuell sind nach Angaben der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche zum Stichtag 15. August 552 Fälle von Kirchenasyl bekannt, bei denen 868 Personen Schutz suchten, darunter 175 Kinder. 512 Fälle fallen dem Verein zufolge unter die Dublin-Regelung, wonach Asylsuchende, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, dorthin zurückgeführt werden können. Die Frist für das Verfahren betrug bislang sechs Monate. Nach Ablauf war das aktuelle Land für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig.
Viele Kirchen boten den Schutzsuchenden sechs Monate Unterschlupf, um die Rückführung in das Erstregistrierungsland zu verhindern. Seit dem 1. August gilt ein Erlass des Bundesinnenministeriums, wonach bei Kirchenasylfällen in nicht vereinbarungsgemäß kooperierenden Gemeinden sich die Frist auf 18 Monate erhöht. Wollen die Kirchengemeinden die Überstellung in ein EU-Erstaufnahmeland verhindern, müssten sie den Betroffenen mindestens 18 Monate Schutz bieten. Die 18-Monate-Frist gilt auch dann, wenn die Gemeinden ein Kirchenasyl nicht innerhalb von drei Tagen nach einer abschlägigen neuerlichen Prüfung durch das Bundesamt beenden.
Angesichts des neuen Erlasses rief Prälat Jüsten die Gemeinden zur Kooperation auf. Das liege "nicht zuletzt auch im Interesse der schutzsuchenden Person selbst".
Bedford-Strohm kritisiert verschärfte Verfahrensregeln
Der EKD-Ratsvorsitzende hat als bayerischer Landesbischof einen Brief an alle Gemeinden und Einrichtungen geschickt. Darin stellt er sich hinter das Kirchenasyl und kritisiert die verschärften Verfahrensregeln dafür.München (epd). Die Diskussion ums Kirchenasyl geht weiter: Nachdem bekanntgeworden war, dass nur etwa jede zweite Gemeinde, die ein Kirchenasyl gewährt, den geforderten Verfahrensregeln nachkommt, ist am 22. August ein Brief des bayerischen evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm an die Öffentlichkeit gelangt. Mit Datum vom 7. August schreibt er an alle Pfarrämter und kirchlichen Einrichtungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. In dem dreiseitigen Schreiben kritisiert er die neuen Regeln für Kirchenasyle.
Durch die seit 1. August geltenden neuen Regeln würden den Gemeinden mit Kirchenasylen "Aufgaben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aufgebürdet, die in manchen konkreten Fällen schwer umzusetzen sind", schreibt Bedford-Strohm in seinem Brief, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Sollten sich Gemeinden nicht daran halten, müssen Flüchtlinge 18 Monate und nicht wie bislang sechs Monate im Kirchenasyl ausharren, um nicht ins Erstaufnahmeland abgeschoben zu werden. Zudem riskieren die Gemeinden ein Strafverfahren.
"Konstruktive Kommunikation mit dem Rechtsstaat"
Kirchenasyle, die Menschen "in einer nachweislich besonderen Notsituation aufnehmen, haben meine Unterstützung", schreibt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in dem Brief, über den zunächst die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichteten: "Ein Kirchenasyl ist zunächst eine christliche Tat der Nächstenliebe." Menschen in Notsituationen zu helfen sei "unsere Christenpflicht". Wichtig sei aber auch eine "gute und konstruktive Kommunikation mit dem Rechtsstaat". Kirchenasyle stellten diesen nicht infrage, es gehe vielmehr "im Gegenteil um ein Eintreten für seinen tieferen Sinn".
Viele Christen, die ein Kirchenasyl organisieren, empfänden es aber so, dass ihr Hilfehandeln "immer stärker auf einen Verwaltungsakt reduziert wird". Zu den Verfahrensregeln gehört, dass sie vor jedem Kirchenasyl ihren jeweiligen landeskirchlichen Ansprechpartner informieren und innerhalb vier Wochen ein Dossier einreichen müssen, anhand dessen der Fall erneut geprüft wird. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass bundesweit und konfessionsübergreifend nur etwa in der Hälfte aller Kirchenasyle ein solches Dossier eingereicht wurde.
Die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Ilse Junkermann, verteidigte die Gemeinden gegen Vorwürfe, sich beim Kirchenasyl nicht an Absprachen mit dem Staat zu halten. Zwar stimme es, dass nur etwa die Hälfte der betroffenen Gemeinden sogenannte Härtefall-Dossiers für Flüchtlinge erstellt hätten, die Schutz in den Kirchen suchten, sagte sie "MDR Aktuell". Allerdings seien diese Dossiers auch alles andere als leicht anzufertigen.
"Frist für Dossier zu kurz"
Junkermann sagte, die jetzt geforderte Frist von vier Wochen sei dafür viel zu kurz. "Für die Kirchengemeinden ist es sehr, sehr schwierig, in so kurzer Zeit ein Dossier zu erstellen", sagte sie. Als Laien seien sie auf externen juristischen und medizinischen Sachverstand angewiesen, den sie nicht immer so schnell bekommen könnten. Jeder wisse doch, wie lange man oft auf einen Termin bei einem Facharzt warten müsse, so die Bischöfin. Auf einen Vorschlag für eine zeitliche Vorgabe wollte sie sich nicht festlegen.
Bedford-Strohm schreibt in seinem vor mehr als zwei Wochen datierten Brief dazu: Selbst wenn alle formalen Vorgaben eingehalten würden, sei nach bisheriger Praxis des Bamf sehr wahrscheinlich, dass das Dossier abgelehnt werde. Bundesweit habe die Behörde in 21 Prozent der Fälle den Selbsteintritt erklärt, also das Asylverfahren an sich gezogen, in 79 Prozent seien die Dossiers oft aus formalen Gründen abgelehnt worden. "Eine Prüfung der humanitären Notlage wurde oft nur bedingt vorgenommen", schreibt der Landesbischof weiter.
"Asyl in der Kirche" weist Kritik zurück
Berlin (epd). Die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft "Asyl in der Kirche" weist Vorwürfe zurück, Kirchengemeinden hielten sich nicht an staatliche Regeln. "Das zentrale Anliegen von Kirchenasyl ist der Schutz von Menschenrechten, nicht Regelkonformität", erklärte die Vorstandsvorsitzende des Vereins, Pastorin Dietlind Jochims, am 23. August in Berlin. Man sei froh, dass es Gemeinden gebe, die aus christlicher Verantwortung handelten, wenn Menschen durch eine Abschiebung Gefahr drohte, sagte Jochims. Den Angaben zufolge sind derzeit bundesweit 552 aktive Kirchenasyle mit mindestens 868 Personen bekannt, davon seien etwa 175 Kinder. 512 der Kirchenasyle seien sogenannte Dublin Fälle.
2015 hatten Kirchen und Bundesamt vereinbart, dass der Staat das Kirchenasyl hinnimmt und zur Prüfung der jeweiligen Fälle bereit ist, sofern die Gemeinden dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Dossiers zu den Hintergründen der Asylsuchenden übermitteln und einen kirchlichen Ansprechpartner benennen.
Dossierquote unbefriedigend
Das Einreichen eines Härtefalldossiers sei wünschenswert und im eigenen Interesse der Kirchengemeinden und Betroffenen, räumte Jochims ein. Nur so könne das Bamf die vorgebrachten Umstände sichten und bewerten. Eine Dossierquote von lediglich 50 Prozent sei unbefriedigend, so Jochims. Als ein Regelverstoß allerdings könnten in der Vergangenheit nicht eingereichte Dossiers nicht automatisch gewertet werden, fügte die Vorstandsvorsitzende hinzu. Eine Verpflichtung zur Vorlage habe es in der Vereinbarung von 2015 nicht gegeben. Für etliche Fälle hätten Kirchen und Bamf außerdem ausdrücklich vereinbart, kein Dossier zu erstellen.
Zum ganzen Bild gehöre ebenfalls, dass seit 2016 das Dublin-Referat des Bamf die Bearbeitung der Dossiers übernommen habe, bis dahin sei die Qualitätssicherung der Behörde zuständig gewesen, so Jochims. Die Anerkennungsquote für Dossiers sei seit diesem Zuständigkeitswechsel von 80 Prozent auf 20 Prozent gesunken. Antworten seien oft erschreckend allgemein und pauschal. Individuelle Erfahrungen und humanitäre Gesichtspunkte blieben unberücksichtigt. Jochims: "Wir vermissen Überlegungen, wie diese Defizite im Bamf endlich behoben werden sollen. Eingereichte Einzelfälle qualitativ gut zu überprüfen, das gehört selbstverständlich auch zur Vereinbarung."
Papst bittet in Irland um Vergebung für Missbrauch in der Kirche
Zwei Tage war Papst Franziskus in Irland zu Besuch, Anlass war das Weltfamilientreffen in Dublin. Doch geprägt war die Visite von der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in den kirchlichen Einrichtungen des Landes.Rom/Dublin (epd). Papst Franziskus hat am 26. August zum Abschluss seiner zweitägigen Irlandreise um Vergebung für sexuellen Missbrauch durch Geistliche sowie die Vertuschung der Übergriffe gebeten. Zugleich forderte er bei der Abschlussmesse des Weltfamilientreffens in Dublin vor Hunderttausenden Gläubigen dazu auf, adoptierte Kinder lediger Mütter, die in kirchlichen Mütterheimen in Irland festgehalten wurden, mit ihren Eltern zusammenzuführen.
In Berichten staatlicher Untersuchungskommissionen war in den vergangenen Jahren von 14.500 Missbrauchsopfern in der irischen Kirche die Rede. Nach Bekanntwerden der Skandale um den Missbrauch Minderjähriger, die Ausbeutung lediger Mütter und illegale Adoptionen von deren Kindern war es 2011 zu einer diplomatischen Verstimmung zwischen Irland und dem Heiligen Stuhl gekommen. Auf deren Höhepunkt wurde der Vatikanbotschafter aus Dublin abgezogen und die irische Botschaft beim Heiligen Stuhl zeitweise geschlossen
Christliche Liebe, wie sie von Familien verkörpert werde, könne allein die Welt von der Sklaverei der Sünde, von Egoismus, Gier und Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen der weniger Erfolgreichen erlösen, sagte der Papst bei der Messe zum Weltfamilientreffen im Croke-Park-Stadion in seiner Predigt. Er äußerte Verständnis für die Schwierigkeit, christliche Gebote wie Barmherzigkeit und Vergebung umzusetzen.
"Offene Wunde"
Bei einem Besuch im Marienheiligtum von Knock in Westirland hatte der Papst Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche zuvor als "offene Wunde" bezeichnet. Die Kirche dürfe nie wieder zuzulassen, dass sich Missbrauch und Misshandlungen wiederholen, sagte er beim Angelusgebet am Sonntagvormittag in Knock-
Der irische Premierminister Leo Varadkar hatte den Papst am Samstagabend zu verstärkten Bemühungen bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle aufgerufen. Versäumnisse im Umgang mit Missbrauch bezeichnete er als Geschichte von Leid und Schmerz, die Staat und Kirche in Irland miteinander teilten. Bei einer Begegnung mit Regierungsvertretern, Diplomaten und Vertretern der Zivilgesellschaft sagte Franziskus in Dublin, das Versäumnis kirchlicher Autoritäten, mit diesen "abscheulichen Verbrechen" angemessen umzugehen, habe zu Recht Empörung hervorgerufen. Es sei für Katholiken noch immer Grund für Leid und Scham.
Franziskus traf sich am 25. August in der Vatikanbotschaft in Dublin mit acht Missbrauchsopfern. Dabei verglich er die Täter nach Angaben von Teilnehmern mit einem umgangssprachlichen Begriff auf Spanisch mit Exkrementen. Demonstranten wollten am Sonntag am Sitz eines ehemaligen kirchlichen Heims für ledige Mütter und ihre Kinder, auf deren Gelände 2014 ein anonymes Grab mit Überresten Hunderter Babyleichen entdeckt worden war, eine Mahnwache halten.
Rücktrittsforderung
Während der Papst in Irland wiederholt Versäumnisse der Kirche im Umgang mit Missbrauch anprangerte und um Vergebung dafür bat, forderte ihn ein ehemaliger Vatikandiplomat zum Rücktritt auf. In einem elfseitigen Schreiben an konservative katholische Medien erklärte Erzbischof Carlo Maria Viganò, er habe Franziskus umgehend nach dessen Wahl 2013 über Missbrauchsvorwürfe gegen US-Kardinal Theodore McCarrick informiert. Franziskus hatte vor wenigen Wochen den Rücktritt des ehemaligen Bischofs von Washington aus dem Kardinalskollegium angenommen. Dieser soll minderjährige und volljährige Seminaristen missbraucht haben. Viganò war von 2011 bis 2016 Vatikanbotschafter in Washington.
Kurschus betont in USA Einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde

epd-bild/Werner Krueper
Bielefeld/Louisville (USA) (epd). Die westfälische Präses Annette Kurschus hat zum Auftakt ihrer USA-Reise den Einsatz der Christen für Gerechtigkeit und Menschenwürde betont. Gott nehme seinen Platz zuallererst an der Seite der Armen, Schwachen und Hilfsbedürftigen ein, sagte Kurschus in Louisville/Kentucky, wie die Evangelische Kirche von Westfalen am Montag in Bielefeld mitteilte. Die leitende Theologin der westfälischen Landeskirche besucht seit Samstag mit einer Delegation die US-Partnerkirche United Church of Christ (Vereinigte Kirche Christi, UCC).
Die elfköpfige Gruppe der westfälischen Kirchenleitung besucht bis zum 8. September Gemeinden und Einrichtungen der UCC in den US-Bundesstaaten Kentucky, Indiana und Ohio. Schwerpunkte der Reise sind nach Angaben der Landeskirche die diakonische Arbeit der Partnerkirche, Zuwanderung und Integration sowie der Dialog mit dem Islam. Vorgesehen sind zudem in Washington ein Treffen mit der deutschen Botschafterin sowie Gespräche mit Vertretern der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds.
Die Evangelische Kirche von Westfalen ist seit 1980 mit der United Church of Christ in Kirchengemeinschaft verbunden. Die in Teilen auf deutsche Auswanderer zurückgehende Kirche zählt nach Angaben des Bielefelder Landeskirchenamtes rund eine Million Mitglieder. Die Gemeinden sind weitgehend selbstständig. Entschiedene Gegner und Befürworter von Präsident Donald Trump stünden sich auch in dieser Kirche gegenüber, hieß es.
Andacht auf Knopfdruck

epd/René Traut
Netphen (epd). Der Altarraum der Kirche St. Matthias ist in blaues Licht getaucht. Die Lichtspots auf der Klinkerwand lenken den Blick auf das große Kreuz in der Mitte. "Es war ein hammerharter Alptraum", tönt es dazu aus den Lautsprechern. In Rap-Form wird die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Die katholische St. Matthias-Kirche in Netphen-Deuz im Siegerland ist seit Mai eine Lichterkirche. Besucher können an einem Terminal selbst Andachten mit passender Musik und Beleuchtung auswählen. Für Kinder und Jugendliche gibt es Geschichten und Lieder wie den Bibel-Rap.
"Kirche muss neue Wege gehen"
"Die Kirche muss neue Wege gehen", betont Alexander Weber, der Vorsitzende des Kirchenvereins von St. Matthias. Die katholische Gemeinde in dem 2.000-Seelen-Dorf Deuz spürt wie Kirchen vielerorts die Auswirkungen von Pfarrermangel und immer weniger Gottesdienstbesuchern. Sonntagsmessen finden nur noch alle zwei Wochen statt. Dazwischen war die Kirche abgeschlossen - bis im Mai das Multimedia-System "MediaKi" installiert wurde. Seitdem steht St. Matthias täglich zwischen 10 und 18 Uhr Besuchern offen, die sich einen persönlichen Zuspruch wünschen oder bei Musik und Bibelversen zur Ruhe kommen wollen.
Vertrieben wird "MediaKi" von dem Wirtschaftswissenschaftler Lars Weber. Er entwickelte das patentierte System mit seinem Vater, dem evangelischen Pfarrer Ulf Weber, als dessen damalige Kirche im hessischen Willingen-Rattlar renoviert wurde. Die Idee: "Eine offene Kirche, in der Besucher nicht nur Kerzen entzünden können, sondern auch einen Zuspruch für ihre momentane Emotion finden", berichtet Ulf Weber.
Das System ist simpel zu bedienen: Auf einem Terminal mit Touchscreen wählen Besucher zwischen Kurz-Andachten, Psalmen und Liedern aus. Der Altarraum wird dazu passend mal gelb, mal rot oder blau beleuchtet. Am beliebtesten seien die etwa 15-minütigen Andachten zu Gefühlen wie Freude, Trauer oder Zorn, die mit Musik untermalt sind, berichtet Ulf Weber.
2014 wurde "MediaKi" in Rattlar installiert. Mit der Zeit wandten sich andere Gemeinden an Weber, und mittlerweile gibt es sieben Lichterkirchen in Hessen, NRW und Thüringen. Die Kosten - in Deuz lagen sie inklusive Umbaumaßnahmen bei 20.000 Euro - werden oft zum Großteil von Bistümern oder evangelischen Landeskirchen übernommen. Die meisten Lichterkirchen liegen wie St. Matthias im ländlichen Raum, wie Lars Weber berichtet. "Kirchen, die geschlossen werden sollten, konnten sich mit dem Kirchensystem und einem eigenen Konzept über einen großartigen Zuspruch freuen."
Alexander Weber aus dem Deuzer Kirchenverein ist überzeugt: Auch wenn die Zeiten voller Sonntagsgottesdienste vorbei seien, sei der Bedarf an Spiritualität und geistlichen Impulsen weiterhin da. Das zeige auch die Resonanz auf "MediaKi" in St. Matthias. Das Gästebuch der Kirche ist voll des Lobs. "Eine schöne Unterbrechung unserer Radtour", lautet ein Eintrag. Eine andere Besucherin schreibt: "Es tut gut, hier zu entspannen und Kraft zu schöpfen."
Lichterkirche will Gottesdienst nicht ersetzen
Auch Besucher des nahe gelegenen Bestattungswaldes könnten in der Lichterkirche Trost finden, sagt Alexander Weber. Eine Gemeindereferentin aus Siegen wolle dafür eine Andacht einspielen. Solche eigenen Projekte haben auch andere Lichterkirchen umgesetzt. So widmet sich die St. Antonius-Kirche im sauerländischen Medebach-Oberschledorn dem Thema Kunst. In Ulf Webers aktueller Gemeinde im thüringischen Schmalkalden setzten Jugendliche ein Hörspiel über Luthers Gewittererlebnis um - inklusive Lichtblitze und Nebelmaschine. Gemeinden können ihre Inhalte dann untereinander austauschen.
Eines kann und will das multimediale Kirchensystem aber ausdrücklich nicht: einen Gottesdienst ersetzen. "In einem Gottesdienst gibt es einen Pfarrer, es wird Segen zugesprochen, man singt miteinander Lieder", sagt Ulf Weber. Das multimediale Kirchensystem sei eher mit geistlichen Podcasts oder Andachten im Rundfunk vergleichbar. Das Besondere bei "MediaKi" sei der Ort, sagt der Pfarrer. "Es ist schon etwas anderes, ob ich eine sakrale Atmosphäre habe oder ob ich im Wohnzimmer sitze, die Füße hochlege und Bibel TV gucke." Und vielleicht, ergänzt Lars Weber, führe ein Besuch in einer Lichterkirche manche Menschen auch wieder in den Gottesdienst.
Landessuperintendent bei Gottesdienst und Pilgerweg für den Frieden

epd-bild / Werner Krueper
Bad Salzuflen/Detmold (epd). Ein Friedensgottesdienst mit dem lippischen Landessuperintendenten Dietmar Arends findet am 2. September in der Kilianskirche in Bad Salzuflen-Schötmar statt. Zu dem Gottesdienst lädt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Schötmar ein, wie die Lippische Landeskirche am 20. August in Detmold mitteilte. Im Anschluss begleite Arends die Teilnehmer eines Friedenspilgerwegs von Schötmar nach Papenhausen, wo die Aktion mit einer Friedensandacht ende.
Der Gottesdienst ist den Angaben zufolge der Auftakt zur Aktion "Wanderfriedenskerze" in der Landeskirche. Bis zum Buß- und Bettag am 21. November werde die Kerze in verschiedenen lippischen Kirchengemeinden angezündet. 400 Jahre nach Ausbruch des 30-jährigen Krieges und 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges erscheine es dringender denn je, die Friedensbotschaft des Glaubens zu thematisieren, erklärte die Landeskirche.
Theologe Buß: Nachhaltiger Lebensstil entscheidet sich vor Ort
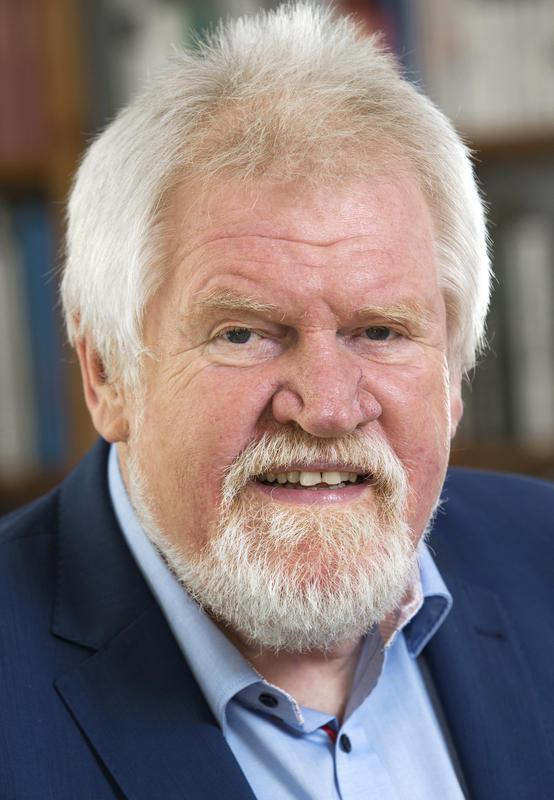
epd-bild/Friedrich Stark
Köln, Unna (epd). Der Umweltexperte und Theologe Alfred Buß hat angesichts des Klimawandels zu einem nachhaltigen Lebensstil aufgerufen. Das ganze Tun und Lassen müsse von Nachhaltigkeit geprägt sein, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW am 25. August im "Wort zum Sonntag" in der ARD: "Wie wirkt sich auf Dauer aus, was wir konsumieren, in den Müll werfen, wie wir uns fortbewegen, was wir in die Luft blasen oder abholzen?"
Ob die Zukunft nachhaltig und gerecht gestaltet werde, entscheide sich "da, wo wir wohnen, leben und arbeiten", betonte der frühere Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen. Bei nachhaltigem Planen in den Städten und Kommunen gehe es im Kern um Gerechtigkeit: "um gute Lebensgrundlagen der Enkelkinder ebenso wie um bezahlbare und wärmegedämmte Wohnungen heute".
Theologe Drewermann ruft Christen zu mehr Engagement für Frieden auf

epd-bild/Friedrich Stark
Frankfurt a.M., Paderborn (epd). Der katholische Theologe Eugen Drewermann hat die Christen aufgerufen, sich stärker für den Erhalt des Friedens einzusetzen. Sie trügen den "Frieden des Heiligen Abends" in den Herzen, sagte er am 25. August auf einem Studientag der hessen-nassauischen Kirche in Frankfurt am Main. Drewermann wandte sich gegen eine Logik der Angst, die der "Furie des Kriegs" immer bessere Panzer und Kampfdrohnen entgegensetzen und damit Frieden schaffen wolle. "Maximales Drohpotential" werde auf diese Weise mit Frieden verwechselt. Nach dieser Logik sei Sicherheit erst möglich, "wenn wir die ganze Welt vernichtet haben".
Der Theologe und Publizist erinnerte an die Erkenntnis des Reformators Martin Luther (1483-1546) von der Güte Gottes. Demnach könnten sich die Menschen selbst akzeptieren und sich infolgedessen friedlich zusammenschließen. Die biblische Friedensbotschaft könne den Weg zu einer friedlicheren Welt neu ebnen. Sie richte den Blick nicht auf andere Menschen mit dem Hintergedanken, sie zu übertrumpfen. Die Botschaft Jesu lasse sich auch zusammenfassen mit den Worten "das ganze Leben ist Abrüstung", sagte Drewermann.
Drewermann studierte unter anderem Theologie in Paderborn, wurde 1966 wurde zum Priester geweiht und arbeitete danach im Gemeindedienst und in der Studentenseelsorge. Aufgrund seiner zunehmend kritischen Haltung gegenüber der katholischen Amtskirche entzog ihm der Paderborner Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt 1991 die kirchliche Lehrerlaubnis. Dem folgten ein Predigtverbot und 1992 die Suspension vom Priesteramt. Heute ist Drewermann als freier Schriftsteller und Vortragsreisender tätig.
Die Geschäftsführerin des Internationalen Christlichen Friedensdienstes Eirene mit Sitz in Neuwied, Anthea Bethge, forderte bei der Veranstaltung, bei Konflikten regionale Kräfte zu unterstützen, die für friedliche Lösungsstrategien eintreten. Strategien für eine gemeinsame und zivile Konfliktbearbeitung müssten gestärkt werden.
"Güstrow schwebt" bald

epd-bild/Norbert Neetz
Güstrow (epd). Besucher des Güstrower Doms in Mecklenburg-Vorpommern können bald auf Höhe von Ernst Barlachs bekannter Bronzeplastik "Der Schwebende" selbst ins "Schweben" kommen. Dank einer Spende soll im Oktober zwei Wochen lang eine hölzerne Zwischenebene direkt über den Bänken einen völlig anderen Raumeindruck ermöglichen, sagte der evangelische Dompastor Christian Höser. Ähnlich dem vor der Reformation, als es noch keine durchgängige Bestuhlung gab. Der temporäre Holzboden wird bis an die Wände und bis zum Chorraum reichen und soll so die ganze Weite des Gebäudes uneingeschränkt erlebbar machen. "In den nächsten hundert Jahren wird es sowas nicht wieder geben im Dom", ist Höser überzeugt.
Mit der Aktion "Güstrow schwebt" wolle die 2.250 Mitglieder zählende Domgemeinde ihre Freude mit anderen teilen darüber, dass der Backsteinbau nach über 15 Jahren nun im Wesentlichen restauriert und für alle Besucher einladend ist, sagte der Theologe. Die letzte große Domsanierung im neugotischen Stil (1865-1868) ist genau 150 Jahren her. Etwa 3,25 Millionen Euro sind nach Angaben des Kirchenkreises Mecklenburg seit 2002 in die Restaurierung der 1335 geweihten, dreischiffigen Basilika geflossen.
Die Idee zum "Zwischenraum" auf der Höhe des "Schwebenden" entstand durch die einmalige Raumerfahrung während der Bauarbeiten auf dem Gerüst direkt unter der Decke. Während der Aktion "Güstrow schwebt" wird der Dom vom 2. bis 14. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Am 2. und 7. Oktober gibt es Konzerte, und am 7. und 14. Oktober kreative Gottesdienste. Dies alles kann kostenfrei besucht werden.
Haupteingang verlegt
Außerdem sind vom 3. bis 6. Oktober tägliche Abendveranstaltungen auf der Zwischenebene geplant, die Kunst und Genuss vereinen sollen. Jeweils von 19 bis 21.30 Uhr können 120 Menschen an Sechser-Tischen Platz nehmen und ein Programm mit Pop, Theater, Kabarett, geistlichem Impuls sowie einem Drei-Gänge-Menü erleben. Karten (15 Euro) gibt es dafür am 26. August und 9. September jeweils nach dem Sonntagsgottesdienst.
Ab 10. September sind Karten für 25 Euro in der Güstrow-Information im freien Verkauf erhältlich - sofern noch verfügbar. Denn die Hälfte der Abendkarten sei zum vergünstigten Preis von 15 Euro pro Stück "in die Stadt hinein verschickt" worden, um mit Pflegediensten, Krankenhaus und anderen "unsere Freude zu teilen", sagte Pastor Höser.
Bis Oktober soll noch der Haupteingang von der Südseite in den Westen verlegt werden. Dafür wurde bereits Barrierefreiheit im künftigen Eingangsbereich geschaffen und ein Tresen für die Domwache eingebaut. Ein gläserner Windfang und Glasscheiben am Tresen sollen bis Oktober noch folgen. Für die restaurierte Lütkemüller-Orgel von 1868 gibt es bereits vom 2. bis 9. September eine eigene Festwoche mit Gottesdienst zur Wiederweihe, Konzerten und einer Orgelführung.
Er wünsche sich, dass die jetzt erfolgte Sanierung des Domes wieder 150 Jahre hält, sagte Pastor Höser. Doch er ist überzeugt davon, dass die Klimaveränderungen sich auch auf Kirchen auswirken. Der Theologe erinnerte beispielsweise an den Tornado, der am 5. Mai 2015 über Bützow nahe Güstrow hinwegfegte und auch die dortige Stiftskirche stark beschädigte.
Evangelische Kirche startet "Die Filmshow" auf Youtube
Frankfurt a.M. (epd). Ein Pfarrer erklärt die neuesten Kinofilme: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat das Youtube-Format "Die Filmshow" gestartet. In den etwa fünfminütigen Clips spricht EKD-Filmpastor Christian Engels jeden Donnerstag über neue Kinofilme, wie das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) am 22. August in Frankfurt a.M. mitteilte. Die wöchentliche Videokolumne geht ab Donnerstag zusätzlich auch auf den Seiten der Deutschen Welle online.
Glaube und Werte stünden bei den Filmtipps nicht zwangsläufig im Mittelpunkt. Darüber zu reden, sei nur sinnvoll, wo es sich ergibt, sagte Engels, Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD.
"Wir wollen mit 'Die Filmshow' auch in der digitalen Welt Kriterien evangelischer Filmarbeit vermitteln, die uns wichtig sind", sagte GEP-Direktor Jörg Bollmann. Dazu gehörten hohe Ansprüche an die Qualität und die ethischen Aussagen der Filme ebenso wie ein scharfer Blick auf den gesellschaftlichen Kontext. Mit der "Filmshow" erweitere das GEP seine Kompetenz in der Unterstützung starker Filme, sagte Bollmann. Das GEP verantwortet bereits die Zeitschrift "epd Film" und die Auszeichnung "Film des Monats", die durch eine evangelische Jury verliehen wird.
Das GEP ist die zentrale Medieneinrichtung der EKD, ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Es trägt unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), die Rundfunkarbeit der EKD und das Onlineportal "evangelisch.de".
Katholikentags-Kollekte: Über 83.000 Euro für syrische Kriegsopfer
Münster (epd). Mehr als 83.000 Euro sind auf dem 101. Deutschen Katholikentag in Münster im Mai während der Gottesdienste gespendet worden. Es sei eines der höchsten Kollektenergebnisse in der jüngeren Geschichte der Katholikentage, teilten die Veranstalter am 22. August mit. Das Geld komme zu gleichen Teilen zwei Projekten zu Gute, die Hilfe für die Betroffenen des Krieges in Syrien leisten: Die Missionszentrale der Franziskaner unterstütze damit Familien im kriegszerstörten Aleppo. Der Caritasverband für die Diözese Münster fördere ein Projekt von Caritas international im Libanon, in dem Kinder und Jugendliche an mehreren Orten schulisch betreut werden.
Im Vergleich zu den Katholikentagen in Leipzig 2016 mit mehr als 60.000 Euro und Regensburg 2014 mit 50.000 Euro habe sich das Ergebnis der Kollekte in Münster mit mehr als 83.000 Euro deutlich gesteigert, hieß es weiter. Der 101. Deutsche Katholikentag fand vom 9. bis 13. Mai 2018 in Münster statt. Insgesamt kamen zu der Großveranstaltung, bei der Themen aus Politik, Gesellschaft Kirche und Religion diskutiert wurden, den Angaben zufolge etwa 90.000 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet.
Katholikentage werden vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken in der Regel alle zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 100. Deutsche Katholikentag fand 2016 in Leipzig statt, 2014 trafen sich die katholischen Laien in Regensburg, 2012 in Mannheim.
Leiter des Katholischen Büros Saarland in Ruhestand verabschiedet
Saarbrücken (epd). Der frühere Leiter des Katholischen Büros Saarland, Peter Prassel, ist nun auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Prassel sei kein abgebrühter Kirchenfunktionär und auch kein glatter Diplomat, sagte der Trierer Bischof Stephan Ackermann. Vielmehr sei er ein Mensch mit Herz und Gefühl, der eine verlässliche Institution des Dialogs gewesen sei. Prassel wurde bereits am 30. April in den Ruhestand versetzt. Seine Nachfolge hat seit 1. August die Diplom-Verwaltungswirtin Katja Göbel übernommen.
Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) würdigte Prassel für dessen Umgang und Stil: "Nicht mit erhobenem Zeigefinger auf Politik einzugehen, sondern mit Argumenten zu überzeugen." Zudem habe der Prälat stets mit "stoischer Ruhe die langen Sitzungen des Parlaments mitertragen".
Die Katholischen Büros in Deutschland sind die Kontakt- und Verbindungsstellen der Bistümer zu den politischen und gesellschaftlichen Akteuren der Bundesländer. Auf evangelischer Seite sind bei den Landesregierungen Beauftragte der Landeskirchen aktiv. Prassel leitete das Katholische Büro zehn Jahre lang. Seine Nachfolgerin Göbel arbeitete dem Bistum Trier zufolge seit ihrer Ausbildung bei der Knappschaft und engagiert sich ehrenamtlich in ihrer Heimat-Pfarrgemeinschaft am Schaumberg.
Kandidaten für Bischofswahl in Oldenburg

epd-bild/Denis Wege/Photo von Oven
Oldenburg (epd). Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg wählt im September einen neuen Bischof. Kandidaten für das Amt sind die Theologen Thomas Adomeit (48) aus Oldenburg und Johann Schneider (54) aus Halle in Sachsen-Anhalt. Sie werden sich am 22. September der Synode vorstellen, wie Synodenpräsidentin Sabine Blütchen am 23. August in Oldenburg ankündigte. Der neue Bischof soll noch am selben Tag gewählt werden.
Adomeit wurde nach dem überraschenden Rücktritt von Bischof Jan Janssen im November 2017 im vergangenen Februar zum Oberkirchenrat und Vertreter im Bischofsamt der oldenburgischen Kirche ernannt. Der gebürtige Stuttgarter studierte evangelische Theologie in Mainz, Berlin und Marburg. Adomeit sagte dem epd, er würde gerne den bereits eingeläuteten Veränderungsprozess seiner Kirche weiter begleiten. Er erlebe die oldenburgische Kirche als eine kleine und selbstbewusste Kirche, die die Notwendigkeit zum Wandel erkannt habe.
Nach seinem Vikariat in Oldenburg war Adomeit 2004 Beauftragter für den Oldenburger Landeskirchentag "Mehr Himmel auf Erden". Danach übernahm er bis 2007 eine Pfarrstelle in Bad Zwischenahn. Anschließend leitete er die Akademie der oldenburgischen Kirche. Von 2009 an war Adomeit persönlicher Referent des damaligen Bischofs Janssen.
116 Gemeinden
Schneider ist seit 2012 Regionalbischof des Propstsprengels Halle-Wittenberg in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Er wurde im rumänischen Mediasch geboren und studierte nach einer Lehre als Werkzeugmacher Theologie in Neuendettelsau, Tübingen, München, Erlangen und Rom. Schneider sagte dem epd, er blicke voller Spannung und Erwartung nach Oldenburg. Der eingeschlagene Weg werfe die Kernfragen christlicher Existenz auf: "Was ist aus der Sicht der Gemeinden der Auftrag der Kirche Jesu Christi an Orten wie Wilhelmshaven oder dem Ammerland?"
Bevor er nach Halle wechselte war Schneider zunächst Pfarrer und Dozent in Erlangen und danach beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie beim Lutherischen Weltbund tätig. 2017 wurde ihm auf Vorschlag der Theologischen Fakultät von der Universität "Lucian Blaga" in Sibiu-Hermannstadt (Rumänien) die Ehrendoktorwürde verliehen. Zum Propstsprengel Halle-Wittenberg gehören sieben Kirchenkreise mit zusammen 170.000 Gemeindegliedern.
Um am 22. September gewählt zu werden, müsse ein Kandidat drei Viertel der insgesamt 60 Stimmen der Synodalen auf sich vereinen, sagte Blütchen. Gelinge dies nicht, werde es drei Stunden später einen zweiten Wahlgang geben. Dabei gehe es wieder um eine Drei-Viertel- Mehrheit. Gebe es danach noch immer kein Ergebnis, müssten die Synodalen eine Woche später am 29. September erneut zur Wahlurne schreiten. Dann genüge die einfache Mehrheit von 31 Stimmen.
Zur oldenburgischen Kirche zählen 116 Gemeinden zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und den Dammer Bergen. Ihr gehören knapp 411.600 Mitglieder an.
Gesellschaft
Grüne und SPD kritisieren Seehofer-Vorstoß zu Religionsdebatte

epd-bild/Christian Ditsch
Frankfurt a.M. (epd). Mit seinem Vorstoß für eine neue Religionsdebatte hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geteilte Reaktionen hervorgerufen. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) begrüßten Seehofers Initiative. SPD und Grüne äußerten dagegen Kritik.
"Die Wandlung vom Saulus zum Paulus ist im Falle von Horst Seehofer denkbar unglaubwürdig", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner der "Passauer Neuen Presse" (24. August). Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sieht in dem Vorstoß des CSU-Vorsitzenden einen Versuch, sich von seiner offenbar gescheiterten "Politik der Konfrontation" zu distanzieren. Sie sagte dem Blatt: "Jetzt versucht er umzusteuern und verkündet einen Dialog, den er erst ins Stocken gebracht hat." Seehofers Beitrag lese sich für sie so, "als ob er persönlich enttäuscht ist, dass seine privaten Überzeugungen nicht mehr die der Mehrheit inklusive der Kirchenleitungen sind".
Mazeyk sieht Fortschritt
Kurz nach seinem Amtsantritt im März hatte der Innenminister gesagt, der Islam gehöre seiner Ansicht nach nicht zu Deutschland. Die hier lebenden Muslime gehörten allerdings zu Deutschland. In einem Gastbeitrag für "Die Welt" sprach sich Seehofer nun für eine gesellschaftliche Diskussion über die Rolle der Religion und ihr Verhältnis zum Staat aus. Er kündigte an, das Gespräch mit allen relevanten religiösen Gemeinschaften suchen zu wollen. "Die Zuwanderung von Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsstaaten, mit unterschiedlicher religiöser und kultureller Prägung, hat zu erheblichen Herausforderungen geführt, die auch das Verhältnis zwischen Religion und Staat betreffen", schrieb der CSU-Vorsitzende.
Dass sich Seehofer mit seinem Vorschlag den Muslimen in Deutschland zuwendet, bezweifelte die Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt: "Die Muslime spricht Seehofer allenfalls indirekt an." SPD-Vize Stegner sagte, es passe schlecht zusammen, erst eine Debatte anzustoßen, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht, und dann den Dialog zu propagieren.
Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland, sieht in dem Vorstoß Seehofers hingegen einen Fortschritt. "Wir begrüßen, dass der Innenminister am Grundgesetz entlang argumentiert und somit einen guten Geist in die Debatte wirft, der besser ist als der aus den vergangenen Diskussionen", sagte er der "Passauer Neuen Presse". Seehofers Betonung, dass das Grundgesetz allgemein von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften spreche und nicht nur von den Kirchen, die bei der Entstehung der Weimarer Verfassung dominiert hätten, sei "wichtig und bemerkenswert, denn es ist das Gegenteil von Ausgrenzung", sagte Mazyek. "Es ist zu hoffen, dass die skurrile Islamdebatte nun der Vergangenheit angehört."
Heinig wünscht differenzierte Debatte
Auch die EKD begrüßte das Gesprächsanliegen Seehofers: "Das interreligiöse Gespräch und der gesellschaftliche Diskurs gehören zur guten Tradition des Landes", sagte eine Sprecherin. Der Staatskirchenrechtler Hans Michael Heinig hält vor allem Seehofers Anspruch, das Gespräch mit allen relevanten religiösen Gemeinschaften suchen zu wollen, für wichtig. "Es wird nicht genügen, nur mit den beiden großen christlichen Kirchen und zwei muslimischen Verbänden ein Gesprächsforum zu entwickeln", sagte der Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dem Evangelischen Pressedienst (epd). Ein Großteil der in Deutschland lebenden Muslime sei nicht in den Verbänden organisiert, ebenso wenig sei die Mehrheit der Konfessionslosen Mitglied im Humanistischen Verband.
Um die Gegenwartslage der Gesellschaft aber adäquat abbilden zu können, müsse die Politik alle Interessen in dem Arrangement zwischen Staat und Religionsgemeinschaften einbinden, erläuterte Heinig. Eine niveauvolle und differenzierte Debatte über die Rolle der Religion und ihr Verhältnis zum Staat sei daher dringend nötig.
KZ-Aufseher Palij gab sich als NS-Opfer aus
Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende wurde der frühere KZ-Aufseher Palij am Dienstag aus den USA abgeschoben. Wie jetzt bekannt wurde, hatte sich Palij Ende der 1940er Jahre in Deutschland als NS-Opfer ausgegeben und wurde daher finanziell unterstützt.München (epd). Der aus den USA nach Deutschland abgeschobene frühere KZ-Aufseher Jakiw Palij hat sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Hilfeleistungen für NS-Opfer erschlichen. Der heute 95-Jährige hielt sich in sogenannten DP-Camps für von den Nazis verschleppte und verfolgte Menschen auf und erhielt Unterstützung für seine Auswanderung in die USA, wie das Archiv des Internationalen Suchdienstes in Bad Arolsen (ITS) dem Evangelischen Pressedienst (epd) bestätigte. Über den Fall hatte zuerst die "Bild"-Zeitung berichtet. Palij soll unter anderem in DP-Lagern in Bamberg und im Resettlement Center in Schweinfurt gewesen sein.
Laut Unterlagen des ITS-Archivs habe Palij seine SS-Zugehörigkeit offenbar verschwiegen und sich so Hilfeleistungen erschlichen, hieß es. Der Leiter der ITS-Abteilung Forschung und Bildung, Henning Borggräfe, sagte der "Bild", die Alliierten hätten Palij als "Displaced Person" (DP) anerkannt und seine Emigration unterstützt: "Unterlagen zum Anerkennungsverfahren liegen jedoch nicht vor, so dass unklar bleibt, wie er sich gegenüber den alliierten Hilfsorganisationen zu seiner Vergangenheit während des Zweiten Weltkriegs geäußert hatte."
Keine Papiere
Borggräfe sagte dem epd, es sei wahrscheinlich "nicht allzu schwer gewesen" nach Kriegsende die Seiten zu wechseln und sich statt als KZ-Aufseher als NS-Opfer auszugeben. Grundlagen für die Anerkennungsverfahren der alliierten Hilfsorganisationen seien ausgefüllte Fragebögen und Befragungen gewesen. "Danach wurde das Ganze auf Plausibilität geprüft und entschieden", erklärte der Experte. Es sei gut denkbar, dass unter den anerkannten DP "auch einige Tausend Menschen mit fragwürdiger Vergangenheit waren", etwa aus den Baltikum-Verbänden, die mit der Wehrmacht kämpften.
Borggräfe betonte, dies sei nicht Anschuldigung zu verstehen: "Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war extrem unübersichtlich. Die Menschen hatten entweder gar keine Papiere - oder welche, die leicht gefälscht werden konnten." Es sei kaum überprüfbar gewesen, ob ein Mensch aus der Ukraine nun NS-Opfer oder KZ-Aufseher gewesen sei. Anders als etwa Mitglieder der Waffen-SS und anderer SS-Verbände, die eine sogenannte Blutgruppentätowierung hatten, habe man Mitgliedern der SS-Hilfstruppen ihre Mitgliedschaft äußerlich nicht nachweisen können, erklärte er.
"Unter die Opfer eingeschlichen"
Der Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, Christoph Heubner, sagte der "Bild": "Offensichtlich hat sich Palij auch noch direkt nach Kriegsende in DP-Camps unter die Opfer eingeschlichen. Die Lüge seines Lebenslaufes, die er in den USA fortgesetzt hat, begann also bereits in Deutschland." Gegenüber den US-Behörden hatte der ehemalige KZ-Aufseher Ende der 1940er Jahre bei seiner Einreise falsche Angaben gemacht. Seine SS-Tätigkeit wurde von US-Behörden um die Jahrtausendwende enttarnt. Die USA versuchten seit 2004, Palij nach Deutschland abzuschieben.
Seit seiner Abschiebung nach Deutschland am 21. August wird Palij vom Land Nordrhein-Westfalen untergebracht und versorgt. In Deutschland laufen gegen ihn zurzeit aber keine strafrechtlichen Ermittlungen, wie die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg erklärte. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte zwar in der Vergangenheit schon einmal gegen Palij ermittelt, das Verfahren aber aus Mangel an Beweisen eingestellt.
Plädoyer für Debatte über deutsch-muslimische Identität
Köln (epd). Der Journalist und Autor Eren Güvercin fordert eine Debatte über die deutsch-muslimische Identität. "Wir müssen dringend inhaltlich über eine deutsch-muslimische Identität sprechen, ansonsten werden Begriffe wie 'deutscher Islam' zu Kampfbegriffen", sagte das Gründungs- und Vorstandsmitglied der Alhambra Gesellschaft dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Der vor rund einem Jahr gegründete Verein versteht sich als Debattenplattform für Muslime. Auf ihrer Webseite veröffentlicht die Alhambra Gesellschaft unter anderem wöchentlich "Freitagsworte", in denen sich Mitglieder und Gastautoren mit Themen beschäftigen, die ihnen in den Freitagspredigten in der Moschee fehlen.
Türkisch geprägte Verbände wie Ditib und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs haben Güvercin zufolge vereinzelte Versuche, eine innermuslimische Diskussion zu beginnen, aus Angst vor einem Machtverlust bisher im Ansatz verhindert. "Die türkisch dominierten Verbände agieren wie Heimatvertriebenen-Vereine", sagte der 37-jährige Rechtswissenschaftler. Statt eine positive deutsch-muslimische Identität zu fördern, versuchten sie, das Migranten-Dasein hierzulande künstlich aufrechtzuerhalten.
Dabei ließen sich die Verbände auch von der Politik Ankaras instrumentalisieren, kritisierte Güvercin. Die kommenden Generationen von Deutschtürken sollen zum Beispiel durch Jugendreisen, die das Amt für Auslandstürken vom türkischen Staat großzügig finanziere, "ideologisch auf Linie" gehalten werden. Die Reisen seien zwar als Kulturprogramm vermarktet, dahinter verberge sich aber eine religiös angehauchte nationalistische Indoktrinierung.
Der Kölner Güvercin, dessen Eltern in den 60er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland kamen, rät Muslimen, sich mit dem Gedanken an einen "deutschen Islam" anzufreunden. Wer in Deutschland aufgewachsen ist und sich als "türkischer Muslim" bezeichnet, reagiere unreflektiert und emotional auf hitzige Debatten wie auf die um Ex-Nationalspieler Mesut Özil, sagte Güvercin: "Die Realität, die die türkischstämmigen Jugendlichen von heute geformt hat, ist die deutsche." Die Jugendlichen seien durch ihre Sprache und Kultur in Deutschland verwurzelt. "Man kann auch ein deutscher Staatsbürger und konservativer Muslim sein", betonte er.
Güvercin begrüßte, dass die Deutsche Islamkonferenz nach der Sommerpause über die Frage sprechen will, ob es so etwas wie einen "deutschen Islam" gebe und wie dieser aussehen könne. Die Islamkonferenz biete den Muslimen einen Rahmen, um über Grundsatzfragen zu diskutieren, erläuterte er. Der Koordinationsrat der Muslime, in dem die großen Verbände organisiert sind, habe ein innermuslimisches Forum, in der man diese Fragen hätte diskutieren können, hingegen immer verhindert.
Kopftuchverbot für Mädchen gefordert

epd-bild / Gustavo Alabiso
Berlin (epd). Die Menschenrechtsorganisation "Terre des Femmes" hat von der Bundesregierung ein gesetzliches Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen und Kitas gefordert. Eine Verschleierung im Kindesalter konditioniere Mädchen in einem Ausmaß, dass sie das Kopftuch später nicht mehr ablegen können, erklärten Vertreter der Organisation am 23. August in Berlin. Die Verschleierung von Mädchen aller Altersstufen sei ein zunehmendes Phänomen in vielen Schulen und sogar im Kindergarten. Sie stehe für eine Diskriminierung und Sexualisierung von Minderjährigen.
"Terre des Femmes" machte zugleich auf eine Unterschriftenaktion unter dem Titel "Den Kopf frei haben!" aufmerksam, mit der der Forderung nach einem gesetzlichen Verbot des Mädchenkopftuchs Nachdruck verliehen werden soll. Die Petition wird den Angaben zufolge unter anderem von der Schauspielerin Sibel Kekilli, Frauenrechtlerin Alice Schwarzer und dem Islamexperten Ahmad Mansour unterstützt. Auch Organisationen wie der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte und der Berufsverband der Frauenärzte beteiligen sich an der Aktion.
"Kinderrechtsverletzung"
"Das Kinderkopftuch ist für uns eine Kinderrechtsverletzung", sagte die Bundesgeschäftsführerin von "Terre des Femmes", Christa Stolle. Die Organisation dringe deshalb auf "ein faires Regelwerk - um nicht zu sagen Verbot-, um Mädchen die Chance zu geben, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei aufwachsen und leben zu können - und wir fordern das für alle Mädchen, egal aus welchem Kulturkreis".
Die Verschleierung von Mädchen sei keine harmlose religiöse Bedeckung des Kopfes, fügte die Frauenrechtsorganisation hinzu. Sie stelle eine geschlechtsspezifische Diskriminierung und eine gesundheitliche Gefahr dar. Die Chancen der Mädchen auf eine gleichberechtigte Teilnahme am gesamtgesellschaftlichen Leben würden massiv eingeschränkt. Öffentliche Schulen müssten für alle Minderjährigen eine angstfreie Entwicklung ermöglichen und als neutrale staatliche Orte religiöse und ideologische Symbolik vermeiden, hieß es. Besonders problematisch sei, dass zuletzt im Internet Videos veröffentlicht wurden, die bereits Babys mit Hidschab zeigten. "Hier geht es nicht mehr um die Ausübung des eigenen Glaubens, sondern um Missbrauch von Kindern für fundamentalistische Zwecke", so Stolle.
Umstrittene Petition
Die Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, Susanne Schröter, betonte, dass es vor rund 20 Jahren noch keine Mädchen mit Kopftuch an deutschen Grundschulen gegeben habe. Inzwischen sei dieses Phänomen vielerorts zu beobachten. Das sei eine neue Entwicklung. Genaue Zahlen, wie viele Mädchen in Deutschland das muslimische Kopftuch tragen, gebe es allerdings nicht. Die Berliner Juristin Seyran Ates sagte, das Kopftuch befördere "Geschlechterapartheid". Das Kinderkopftuch sei aus ihrer Ansicht zudem Kindesmissbrauch.
Zugleich räumte "Terre des Femmes" ein, dass die im Juni gestartete Petition für ein Kopftuchverbot in der Öffentlichkeit mit erheblichen Gegenwind zu kämpfen habe. So würden die großen Onlineplattformen für Petitionen die Aktion "Den Kopf frei haben!" nicht verbreiten. Viele Menschen wollten sich nicht gegen ein Kinderkopftuch positionieren, aus "Angst als rassistisch und rechtspopulistisch abgestempelt zu werden", so Stolle. Bislang hätten weniger als 10.000 Personen die Petition für ein Kinderkopftuch-Verbot unterzeichnet.
NRW fehlen im neuen Schuljahr knapp 3.700 Lehrer

epd-bild / Jens Schulze
Düsseldorf (epd). Die Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen sich wegen Lehrermangels weiter auf Unterrichtsausfall einstellen. Für das neue Schuljahr 2018/19 konnten 3.694 Lehrerstellen nicht besetzt werden, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am 24. August in Düsseldorf sagte. Dennoch habe sich die Besetzungsquote auf 61,6 (Vorjahr: 53,3) Prozent verbessert. Damit wurden nach Angaben der Ministerin 5.929 der 9.623 zu besetzenden Lehrerstellen belegt.
Vor allem Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschulen (Sekundarstufe I) sowie Berufskollegs litten unter Lehrermangel. Nach Schätzungen des Schulministeriums werden hier in den nächsten zehn Jahren rund 15.000 Lehrkräfte fehlen. Dagegen werde es für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen der Sekundarstufe II in diesem Zeitraum voraussichtlich einen Überhang von 16.000 Lehrkräften geben.
Das Land setzt vor diesem Hintergrund auf Maßnahmen, um gegenzusteuern und den Lehrermangel einzudämmen: "Fehlende Lehrkräfte belasten alle - Schüler, Lehrer und Eltern", betonte Gebauer. "Wir lassen nichts unversucht, um Angebot und Nachfrage wieder ins Lot zu bringen." Demnach sollen stellenlose Oberstufenlehrer in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis an Grundschulen wechseln können - verbunden mit der Zusage, nach vier Jahren auf eine Sekundarstufe II-Stelle zu wechseln.
Auch die Verbeamtung der Lehrerschaft soll dem Angaben zufolge erleichtert werden, um so den Beruf attraktiver zu machen. Zudem sollten anstehende Pensionäre durch einen Besoldungszuschlag in Höhe von zehn Prozent zur Verlängerung ihrer Dienstzeit motiviert werden. Auch könnten sich künftig Seiteneinsteiger mit einem Fachhochschul-Masterabschluss auf eine Lehrerstelle bewerben. Bislang war das nur mit Universitätsabschluss möglich. "Wir erweitern damit vor allem den Bewerberkreis für die Berufskollegs", betonte Gebauer.
Von 2017 bis 2019 solle die Zahl der Ganztagsplätze von 307.000 auf 323.000 zulegen, sagte die FDP-Politikerin. Dafür stelle das Land 93 Millionen Euro im Jahr zusätzlich bereit. Hintergrund sei das Ziel des Bundes, einen Rechtsanspruch auf einen offenen Ganztag an den Grundschulen einzuführen. Bei der Inklusion sollten in den nächsten sieben Jahren insgesamt rund drei Milliarden Euro in den Personalausbau fließen, hieß es weiter. Rund 6.000 neue Stellen sollten so geschaffen werden.
Die Gesamtzahl der Schüler steigt dem Ministerium zufolge im neuen Schuljahr leicht um 0,3 Prozent auf 2,5 Millionen, davon 1,94 Millionen (plus 0,4 Prozent) an den allgemeinbildenden Schulen und unverändert 562.230 an den Berufskollegs. Mit 640.770 (plus 0,3 Prozent) Schülern entfällt gut ein Viertel auf die Grundschulen, gefolgt von den Gymnasien mit 524.460 (plus 0,9 Prozent) und den Gesamtschulen mit 322.670 (plus 4,8 Prozent) Schülern.
Armutsrisiko in NRW ist gestiegen
In Nordrhein-Westfalen wächst die Zahl derer, die von Armut bedroht sind. Im vergangenen Jahr verfügten rund drei Millionen Menschen in NRW über ein Einkommen, das unterhalb der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle lag.Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen ist das Armutsrisiko in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am 23. August in Düsseldorf mitteilte, bezogen im vergangenen Jahr rund drei Millionen Menschen in NRW ein Einkommen, das unterhalb der sogenannten Armutsgefährdungsschwelle lag. Damit war mehr als jeder sechste Bürger (17,2 Prozent) im Land von dieser Entwicklung betroffen. Im Jahr 2007 hatte die Quote noch bei 14,5 Prozent gelegen.
Menschen mit niedriger beruflicher Qualifikation haben laut den Statistikern ein größeres Risiko der "relativen Einkommensarmut". Nach der Definition der Europäischen Union gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn ihr weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung zur Verfügung steht. Die Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte lag in NRW 2017 bei monatlich 968 Euro.
Nach Ansicht des Sozialverbands VdK Nordrhein-Westfalen belegen die Zahlen des Landesamtes, dass sich die Ungleichheit in der Gesellschaft verfestigt hat. "Obwohl es der deutschen Wirtschaft gutgeht, konzentriert sich der Reichtum nach wie vor nur auf einige wenige. Auf der anderen Seite lebt in unserem Bundesland mittlerweile mehr als jeder Sechste am Existenzminimum", kritisierte der Vorsitzende Horst Vöge. Vor allem Alleinerziehende und deren Kinder, Rentner sowie Niedriglohnbezieher seien betroffen.
Neben wirksamen Initiativen gegen Alters- und Kinderarmut fordert der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen daher verstärkte Bemühungen von der schwarz-gelben Landesregierung zur Eindämmung von Minijobs, Befristungen sowie Zeit- und Leiharbeit. "Allein im vergangenen Jahr stand hierzulande jeder Vierte abhängig Beschäftige in einem atypischen Arbeitsverhältnis. Davon waren mit 1,22 Millionen mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen", betonte Vöge.
Gericht überprüft Umsetzung des Luftreinhalteplanes für Düsseldorf
Düsseldorf (epd). In den kommenden Wochen will das Verwaltungsgericht Düsseldorf entscheiden, ob die vom Land Nordrhein-Westfalen geplanten Maßnahmen zur Luftreinheit ausreichen. Wie ein Sprecher des Gerichts am 21. August mitteilte, kann auch ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro gegen das Land angedroht werden. Hintergrund des Verfahrens (AK.: 3 M 123/18) ist die Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH), die vom Land strengere Auflagen bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes in Düsseldorf fordert. Dazu gehören auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Es wird erwartet, dass das Gericht im Laufe des Septembers seine Entscheidung bekanntgibt.
In dem am Dienstag verhandelten Fall am Verwaltungsgericht ging es zunächst um formale Fragen. Auch wurde beraten, ob das Land NRW die Urteile des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom September 2016 (AK.: 3 K 7695/15) und des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig von Februar dieses Jahres (AK.: 7 C 26.16) ausreichend berücksichtigt hat. Diese Urteile verpflichten das Land und die Bezirksregierung als ausführende Behörde zur Weiterentwicklung des Luftreinhalteplanes für die Stadt Düsseldorf. Dabei sollten nach Ansicht der Richter auch Fahrverbote für Dieselfahrzeuge erwogen werden.
Die Deutschen Umwelthilfe wirft dem Land NRW vor, die von den Gerichten geforderten Maßnahmen zur Luftreinhaltung bislang nicht angemessen umzusetzen. Das Land lehnt Fahrverbote für Dieselfahrzeuge bislang ab. Auch der am 21. August von der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegte und überarbeitete Luftreinhalteplan schließt solche Maßnahmen aus.
Der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch nannte es einen "Affront", dass der fortgeschriebene Luftreinhalteplan erst zum Gerichtstermin vorgelegt wurde. Offenbar wolle das Land das Verfahren um jeden Preis verzögern. Zugleich zeigte sich Resch zuversichtlich, dass das Gericht feststellen werde, dass das Land rechtswidrig die Fortschreibung des Luftreinhalteplanes für Düsseldorf verzögert habe.
Expertin: Internationale Verflechtung erschwert Rüstungskontrolle

epd-bild/Sebastian Backhaus
Berlin (epd). Die Kontrolle von Rüstungsgeschäften wird nach Angaben der Konfliktforscherin Simone Wisotzki wegen der Internationalisierung der Branche zunehmend schwieriger. Länder wie Saudi-Arabien arbeiteten daran, von Rüstungsimporten unabhängiger zu werden und eigene Produktionsstandorte aufzubauen, sagte die Wissenschaftlerin dem Evangelischen Pressedienst (epd) aus Anlass des Anti-Kriegs-Tages am 1. September. Deutsche Unternehmen kooperierten mit internationalen Partnern, um Waffen und Munition direkt vor Ort zu produzieren. Das sei ein "besorgniserregender Trend", warnte die Forscherin am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main.
Als Beispiel nannte Wisotzki den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall, der mit dem südafrikanischen Unternehmen Denel den Joint Venture Rheinmetall Denel Munition gegründet habe. Von diesem Joint Venture wiederum werde seit 2016 eine Munitionsfabrik in Saudi-Arabien betrieben, in der zurzeit täglich 300 Artilleriegranaten und 600 Mörsergranaten produziert würden. "Das sind die Waffen, die im Jemen zum Einsatz kommen", sagte die Konfliktforscherin. Saudi-Arabien interveniert in dem seit 2013 andauernden Bürgerkrieg im Jemen, der gravierende humanitäre Folgen hat.
Modulare Waffenproduktion
Eine neue Entwicklung ist laut der Konfliktforscherin ferner, dass Kleinwaffen zunehmend modular produziert würden. Es sei daher vorstellbar, dass Einzelteile aus unterschiedlichen Staaten kämen. Die technologische Entwicklung schreite so schnell voran, dass Gesetze und Regelungen oft viel zu spät seien. Die Politik müsse daher immer wieder Gesetze ändern und Lücken schließen.
Wisotzki, die als Co-Vorsitzende der Fachgruppe Rüstungsexport der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) zusammen mit anderen Experten jährlich den Rüstungsexportbericht publiziert, sprach sich in dem Zusammenhang für ein deutsches Rüstungsexportkontrollgesetz aus sowie für einen Beschluss, wonach grundsätzlich nur noch an Länder geliefert wird, die das Internationale Waffenhandelsabkommen (Arms Trade Treaty) unterzeichnet haben. Bisher haben dieses Abkommen weder die arabischen Staaten unterschrieben, noch Indien oder Pakistan.
Kämpfer für den Frieden

epd-bild / Debbie Hill
Tel Aviv (epd). Mit seinen hellgrauen Haaren und dem Bart war Uri Avnery schon von Weitem unverkennbar, wenn er bei Demonstrationen vorneweg marschierte. Bis ins Alter von 94 Jahren war Israels unermüdlichster Kämpfer für den Frieden geistig und körperlich fit. In der Nacht zum 20. August starb er in einem Tel Aviver Krankenhaus an den Folgen eines Gehirnschlags.
Avnery liebte es, Tabus zu brechen, und setzte sich bisweilen auch über Gesetze hinweg. Als erster jüdischer Israeli traf er 1982 noch während des Krieges zwischen Israel und dem Libanon den Chef der Palästinensischen Befreiungsorganisation, Jassir Arafat, in Beirut. "Ein Staat", lautete damals das Ziel der PLO. Avnery hingegen war Zionist. Ihm schwebte die Zweistaatenlösung vor: Israel und Palästina in friedlicher Nachbarschaft.
Als jüngster von zwei Söhnen der Familie Ostermann kam er 1923 zur Welt und erhielt den Vornamen Helmut. "Ich war sehr bewusster Beobachter dessen, was in Deutschland passiert ist", sagte er einmal im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im Jahr der Machtergreifung Hitlers, 1933, emigrierten die Ostermanns nach Palästina. Sie waren die einzigen der gesamten Familie, die die Nazi-Zeit überlebten.
Im Untergrund
Um Palästina von den britischen Mandatsherren zu befreien und die Juden im Land vor arabischem Terror zu schützen, schloss sich der junge Mann zunächst der radikalen Untergrundbewegung Irgun an. Während des Unabhängigkeitskrieges wechselte er zur Hagana, dem Vorgänger der israelischen Armee.
Seine Kriegserlebnisse verarbeitete er zu einem ersten Buch, das ein Bestseller wurde und Uri Avnery, wie er sich inzwischen nannte, zu einem Volkshelden machte. Der Erfolg irritierte ihn. Er fühlte sich missverstanden und schrieb ein weiteres Buch: "Die Kehrseite der Medaille" erzählt von den Schrecken der blutigen Kämpfe, vom Tod und von der Skrupellosigkeit der Politiker - Dinge, die zum damaligen Zeitpunkt niemand hören wollte.
Zusammen mit Schalom Cohen, einem Kameraden seiner Armee-Einheit, kaufte er das Nachrichtenmagazin "HaOlam HaSe" ("Diese Welt"). Zu seinen Themen gehörten Korruption sowie die Diskriminierung der Sfaradim, der aus arabischen Staaten eingewanderten Juden. Er schrieb über "feige Ja-Sager" rund um den ersten Regierungschef David Ben-Gurion, den er auf einer Titelseite einen "Diktator" nannte. Er trat für die Rechte des palästinensischen Volkes und für Meinungsfreiheit ein. Keine andere israelische Zeitung veröffentlichte weder zuvor noch danach derart provokative Nacktbilder wie "HaOlam HaSe".
Das Wochenblatt polarisierte. Mitte der 70er Jahre entkam Avnery nur knapp einem Messerattentat. Am meisten verhasst war der Chef von "HaOlam HaSe" den Politikern, die von Woche zu Woche mit Verhöhnung oder Entlarvung rechnen mussten. Mit dem "Gesetz gegen die üble Nachrede" sollte das Magazin vom Markt verschwinden. Avnery nahm die Kampfansage an und kandidierte Mitte der 60er Jahre selbst für die Knesset. Dort bliebt er zehn Jahre.
Kontakt zur PLO-Führung
In dieser Zeit soll er keine einzige Sitzung verpasst haben, über 1.000 Reden gehalten und 1.000 Gesetzentwürfe eingebracht haben, unter anderem zur Einführung standesamtlicher Trauungen sowie der Legalisierung von Homosexualität und Abtreibungen. Keine seiner Gesetzesinitiativen erreichte eine Mehrheit. 1981 zog er aus der Knesset wieder aus, um seinen Platz für einen arabischen Parteifreund zu räumen.
Zu dieser Zeit unterhielt er bereits seit Jahren Kontakte zur PLO-Führung, was damals gesetzlich verboten war. "Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft", sagte Avnery Jahrzehnte nach seinem ersten Treffen mit Arafat. "Ich habe immer geglaubt, dass man mit Arafat Frieden machen kann und sollte."
Anfang der 90er Jahre, als Israel und die PLO doch Verhandlungen führten, gründete Avnery die Initiative "Gusch Schalom", den Friedensblock, um auf außerparlamentarischer Bühne Druck auf die politische Führung auszuüben. Er organisierte Demonstrationen und schrieb wöchentlich im Newsletter der Bewegung zu aktuellen Themen.
International wurden ihm dafür höchste Ehren zuteil. 2001 erhielt er mit seiner Frau den "alternativen Nobelpreis", 2003 zusammen mit dem Palästinenser Sari Nusselbeh den Lew-Kopelew-Preis und 2008 die Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationale Liga für Menschenrechte.
Noch Anfang August veröffentlichte er einen ausführliches Essay zum neuen Nationalstaatsgesetz, dem er eine "halbfaschistische Natur" unterstellte. Es zeige, wie dringlich die Debatte darüber sei, "wer wir sind, was wir wollen und wohin wir gehören", schrieb er. Die Hoffnung auf Frieden gab er bis zum Schluss nicht auf: "Man weiß nie, welche Kräfte am Werk sind - auch, wenn es heute so aussieht, als steuerten wir geradewegs auf einen Eisberg zu."
Francos Schatten
Die spanische Regierung will die Gebeine von Diktator Franco an einem anderen Ort bestattet wissen. Trotz einer Mehrheit der Befürworter gibt es Widerstand.Madrid (epd). Die spanische Regierung möchte Diktator Francisco Franco (1892-1975) aus seinem Mausoleum im sogenannten Tal der Gefallenen herausholen. Die Entscheidung zu einer Umbettung der Gebeine traf das Kabinett am 24. August per Dekret.
"Keine Demokratie kann sich Denkmäler erlauben, die alte Diktatoren rühmen", sagte Regierungschef Pedro Sánchez schon vor der Sommerpause. Aus dem Tal der Gefallenen, einer enormen, in den Fels der Gebirgskette Sierra de Guadarrma vor Madrid gehauenen Basilika, soll eine demokratische Gedenkstätte werden. Die Nachkommen Francos haben nach Inkrafttreten des Dekrets 15 Tage Zeit, eine neue Ruhestätte zu brennen.
Die Benediktiner, die Francos bisherige letzte Ruhestätte verwalten, kündigten Widerstand an. Bislang liegt das Grab des Diktators direkt neben dem Altar der Basilika. Es zieht jedes Jahr einige Tausend Ewiggestrige an, zuletzt am 18. Juli, dem Jahrestag des Putsches der Generäle von Franco, die damit 1936 den spanischen Bürgerkrieg auslösten. Die Demonstranten erhoben dabei den rechten Arm zum faschistischen Gruß und sangen das Parteilied "Cara al Sol".
Mehrheit der Bürger für Umbettung
Umfragen zufolge ist eine Mehrheit der Spanier dafür, den alten Diktator umzubetten. Allerdings spricht sich ein Drittel auch dagegen aus. Das spanische Parlament hatte sich schon im Juli vergangenen Jahres mit nur einer Gegenstimme für eine Umbettung ausgesprochen. Die Abgeordneten der konservativen Volkspartei stimmten zwar nicht dagegen, enthielten sich aber.
Das Parlament muss nun auch über das Regierungsdekret abstimmen. Diesmal will sich auch die Partei Ciudadanos enthalten, was die Mehrheit für die Umbettung im stark fragmentierten Parlament aber nicht gefährden würde.
Emilio Silva glaubt nicht, dass eine Umbettung großen gesellschaftlichen Widerstand auslösen wird. Silva, Vorsitzender der Vereinigung zur Erlangung des Historischen Gedächtnisses, vergleicht die Umbettung Francos mit der Demontage eines Reiterstandbilds des Ex-Diktators im Zentrum Madrids im Jahr 2005. "Damals demonstrierten an einem Tag rund 400 Leute. Das war's." Jüngste Proteste im Tal der Gefallenen bezeichnet er scherzhaft als "das letzte Selfie der Francoanhänger im letzten Schützengraben, den die Demokratie noch nicht eingenommen hat".
"Kein Ort der Versöhnung"
Dennoch glaubt Silva nicht, aus dem Tal der Gefallenen könne ohne Franco ein Ort der Versöhnung werden. In dem Stollen der Basilika liegen die Gebeine von 30.000 Menschen, darunter Bürgerkriegskämpfer auf beiden Seiten, aber auch Opfer der Repression des Franco-Regimes, die nach 1959 ohne das Einverständnis der Angehörigen dorthin gebracht wurden.
Die Toten ließen sich nicht vergleichen. Die einen kämpften gegen die demokratische Republik, die anderen verteidigten sie, sagt Silva. Der Ort könne aber von seiner Entstehung erzählen, von den 20.000 Zwangsarbeitern, die ihn errichtet hätten.
Einer dieser Zwangsarbeiter war 1948 vier Monate lang der spätere spanische Historiker Nicolás Sánchez-Albornoz. Im gelang damals die Flucht im Peugeot von Norman Mailer. Barbara Mailer, die damals in Paris lebende Schwester des US-Schriftstellers, saß am Steuer. Sánchez-Albornoz hofft, der Zahn der Zeit werde die Debatte um die Zukunft des Tals der Gefallenen beenden. Das 150 Meter hohe Betonkreuz auf dem Felsen schwanke schon heute um mehr als einen Meter von einer Seite zur anderen: "Es ist durchaus möglich, dass es einmal umfällt."
"Blumen für Stukenbrock" erinnert an Opfer der NS-Zeit
Schloß Holte-Stukenbrock (epd). Der friedenspolitische Arbeitskreis "Blumen für Stukenbrock" erinnert mit einer Gedenkveranstaltung am 1. September an die Opfer des nationalsozialistischen deutschen Staates. Der Arbeitskreis fordert aus Anlass des Antikriegstages eine "konstruktive Friedenspolitik der Bundesregierung", wie es in dem am 24. August veröffentlichten Aufruf heißt. Dazu gehörten ein Verzicht auf höhere Rüstungsausgaben und ein Exportverbot für Kriegswaffen. Die Gedenkveranstaltung findet auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof im ostwestfälischen Stukenbrock-Senne statt.
Mit dem verbrecherischen Krieg habe das Nazi-Regime Deutschland und fast die ganze Welt in eine Katastrophe gestürzt, wie sie die Menschheit bisher nicht erlebt gehabt habe, erklärte der Arbeitskreis. Mit dem Krieg habe auch der Leidensweg der Kriegsgefangenen des Lagers Stalag 326 in Stukenbrock-Senne begonnen. Die 65.000 in Verantwortung der deutschen Wehrmacht zu Tode gequälten Menschen des Kriegsgefangenenlagers in Stukenbrock klagten jene an, die aus der Geschichte nichts gelernt hätten und heute wieder einen Kalten Krieg mit Russland führten.
Auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof liegen nach Angaben der Initiative mehr als 65.000 sowjetische Opfer. Das Kriegsgefangenenlager Stalag 326 wurde am 2. April 1945 durch die US-Armee befreit. Der vor rund 50 Jahren gegründete Arbeitskreis "Blumen für Stukenbrock" pflegt das Andenken an die auf dem Soldatenfriedhof begrabenen Opfer der NS-Diktatur. Als Rednerin bei der Gedenkveranstaltung ist die DGB-Geschäftsführerin Ostwestfalen-Lippe, Anke Unger, angekündigt.
Saar-Arbeitskammer fordert Aktionsplan gegen Armut
Saarbrücken (epd). Die Arbeitskammer des Saarlandes hat die Landesregierung aufgerufen, "endlich einen wirksamen Aktionsplan zur Armutsbekämpfung zu verabschieden". Im Fokus müssten etwa die Bekämpfung von Kinderarmut, bessere Bildungschancen, bezahlbarer Wohnraum, der Ausbau eines öffentlich geförderten Arbeitsmarktes und die Verbesserung der Infrastruktur stehen, teilte die Kammer am 23. August in Saarbrücken mit. Die Maßnahmen müssten dabei kontinuierlich begleitet und bewertet werden.
Die Arbeitskammer reagierte damit auf Zahlen der Sozialberichterstattung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Demnach liegt die Armutsquote im Saarland mit Blick auf die bundesweite Armutsgefährdungsschwelle bei 16,8 Prozent, deutschlandweit ist sie bei 15,8 Prozent. Werden die regionalen Besonderheiten wie unterschiedliche Einkommen mit einbezogen, hat das kleinste Flächenbundesland mit Blick auf die saarländische Armutsgefährdungsschwelle eine Gefährdungsquote von 15,7 Prozent.
Im Saarland sind den Statistikern zufolge im direkten Vergleich vor allem unter 18-Jährige (22,1 Prozent) und 18 bis 25-Jährige (24,6 Prozent) von Armut bedroht. Die Quote bei Saarländern ab 65 Jahren liegt bei 17,6 Prozent. Der Wert für Frauen in dieser Alterskategorie ist den Zahlen zufolge aber um einiges höher (20,3 Prozent) als für Männer (14 Prozent). Alleinerziehende im Saarland sind am häufigsten von Armut bedroht (42,6 Prozent), gefolgt von Familien mit drei oder mehr Kindern (32,1 Prozent) und Alleinlebenden (28,3 Prozent).
Die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) hatte im Juli angekündigt, dass bis Sommer 2019 ein neuer Aktionsplan gegen Armut stehen sollte. Anfang 2017 war der erste saarländische Familienreport erschienen, der unter anderem auf die schwierige Situation von Alleinerziehenden und Familien mit vielen Kindern hinwies. Bereits im Jahr 2015 wurde der saarländische Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht, der neben den Alleinerziehenden vor allem die Armut im Alter als wichtiges Thema hervorhob. Im vergangenen Sommer hatte die Ministerin ursprünglich angekündigt, bis Ende 2017 Maßnahmen zum Kampf gegen Armut erarbeiten zu lassen.
Transparency empfiehlt Bischofskonferenz Anti-Korruptions-Regeln
Münster (epd). Transparency International (TI) empfiehlt der Deutschen Bischofskonferenz verbindliche Regeln zur Vermeidung von Korruption. Die Bischöfe sollten mit Hilfe von Transparency prüfen, "wo Schwachstellen im System sind und wo etwas getan werden muss", sagte TI-Gründer Peter Eigen der in Münster erscheinenden katholischen Wochenzeitung "Kirche + Leben" (Ausgabe 26. August). Die Rolle der Kirchen mache es notwendig, dass diese wie andere Institutionen systematisch gegen Korruption vorgingen, sagte Eigen.
Einzelfälle von Korruption würden besonders bei den Kirchen wahrgenommen, erklärte der Transparency-Gründer. So stünden die orthodoxen Kirchen im Ruf, Teil der korrupten Systeme in Russland und den Nachbarländern zu sein. In der katholischen Kirche sei der Banken-Skandal im Vatikan angepackt worden. "Solche Fälle von Fehlverhalten werden den Kirchen und allgemein den Religionsgemeinschaften besonders stark angelastet", sagte der Gründer von Transparency International.
Von den Kirchen erwarte er, dass sie nicht nur in ihrem eigenen Bereich, sondern auch in der Gesellschaft eine führende Rolle gegen Korruption spielten, sagte Eigen weiter. Für die Bekämpfung von Bestechung und Bestechlichkeit seien nicht allein strafrechtliche Sanktionen wichtig, sagte Eigen weiter. "Es geht darum, die Versuchung einzuschränken, sich durch Bestechung Vorurteile zu erwerben." Überall, wo Organisationen große Machtchancen für Einzelne böten, müsse man so vorgehen.
Die 1993 gegründete Nichtregierungsorganisation Transparency International mit Sitz in Berlin ist weltweit tätig. Sie ist politisch unabhängig und arbeitet nach eigenen Angaben an einer nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung von Korruption.
Friedenskundgebungen in Trier und Saarbrücken
Trier (epd). Friedensaktivisten rufen für den 1. September zu Kundgebungen in Trier, Saarbrücken, Mainz und Kaiserslautern auf. Zum Antikriegstag gehe es um den Einsatz für Frieden und Abrüstung, sagte Markus Pflüger von der AG Frieden Trier am 23. August. Zudem müsse das zwei Prozent-Ziel bei den Rüstungsausgaben verhindert werden. "Die geplante Aufrüstung sichert nicht den Frieden, sondern führt zu einer neuen Rüstungsspirale", betonte er.
Die Friedenskundgebungen gehören den Angaben zufolge zu der Kampagne "Krieg beginnt hier", die die Funktion des Militärs in der Region kritisiert. Anstelle von Kriegseinsätzen, Fluglärm und Emissionen muss es laut Waltraud Andruet vom Friedennetz Saar mehr Friedensbildung geben. "Wir protestieren für eine Welt ohne Kriege, von hier soll Frieden ausgehen", sagte sie. Es brauche zivile Strategien, die an den Ursachen von Kriegen und Konflikten ansetzten.
Barley: Kinderrechte sollen bald ins Grundgesetz
Düsseldorf (epd). Die Kinderrechte sollen nach Worten von Justizministerin Katarina Barley (SPD) noch in dieser Legislaturperiode im Grundgesetz verankert werden. "Das haben wir in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt", sagte Barley der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (23. August). Bis Ende 2019 solle gemeinsam mit Experten von Bund und Ländern beraten werden, wie eine solche Änderung unseres Grundgesetzes aussehen werde.
Die Regierung wolle Kinder auch darin bestärken, ihre Rechte gegenüber dem Staat besser wahrnehmen zu können, sagte Barley. "Mir geht es darum, die Rechte der jüngsten Bürger besser sichtbar zu machen", erläuterte die Justizministerin. Wenn diese ausdrücklichen Verfassungsrang erhielten, würden Kinder auch im alltäglichen staatlichen Handeln besser zur Geltung kommen.
Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. Da sich Grüne und die Linkspartei mehrfach für Kinderrechte in der Verfassung eingesetzt haben, gilt die nötige Mehrheit als wahrscheinlich.
Düsseldorfer Synagoge vor 60 Jahren eingeweiht
Düsseldorf (epd). Die Jüdische Gemeinde Düsseldorf blickt am 7. September auf den 60. Jahrestag der Einweihung ihrer Synagoge. Die mit rund 7.000 Mitgliedern drittgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland hat nach eigenen Angaben bislang keine Fest-Veranstaltungen anlässlich des Jahrestags geplant. Stattdessen stehen Sanierungsarbeiten an: Dafür muss die Synagoge ab Anfang Oktober bis voraussichtlich April geschlossen werden, wie Inessa Lipskaja von der Gemeinde dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte.
Am 9. November 1956 feierte die Gemeinde, die damals rund 850 Mitglieder hatte, in Düsseldorf die Grundsteinlegung ihres neuen Gotteshauses. Der planende Architekt war Hermann Zvi Guttmann. Die feierliche Einweihung fand am jüdischen Neujahrstag "Rosch ha-Schana" am 7. September 1958 in Anwesenheit des damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Franz Meyers (CDU) statt. Die Synagoge hat rund 400 Plätze, 250 für Männer und 150 für Frauen auf der Empore. Es gibt zudem noch einen kleineren Betsaal.
Die Große Synagoge in Düsseldorf in der Kasernenstraße war während der Novemberpogrome 1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckt worden. Die Ruine wurde noch im selben Jahr abgebrochen. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden 1953 erste Pläne zur Neuerrichtung einer Synagoge entwickelt. Neben der Synagoge wurden 1958 auch ein großräumiges Verwaltungsgebäude und ein Gemeindesaal eingeweiht.
Die Synagoge beschreibt in der äußeren Form ein Oval. Sie ist mit einer flachen Kupferhaube bedeckt und an den Außenwänden mit hellen Natursteinplatten bekleidet. Im Innern hat sie geschwungene Wände. Über dem an besonderen Anlässen geöffneten Hauptportal steht auf Hebräisch ein Vers aus Psalm 26: "Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre thront."
Die Synagoge befindet sich auf dem Paul-Spiegel-Platz an der Ecke Zietenstraße im Stadtteil Golzheim. Der Platz vor der Synagoge erhielt seinen neuen Namen im Jahr 2007 nach dem ein Jahr zuvor gestorbenen ehemaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Im Oktober des Jahres 2000 wurde ein Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge verübt, der in der Öffentlichkeit heftige Reaktionen auslöste.
Fördermittel für Digitalisierung an Schulen wenig genutzt
Düsseldorf (epd). Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat Kommunen aufgefordert, mehr Fördergelder für die Digitalisierung an den Schulen abzurufen. "Wir haben das Programm 'Gute Schule 2020' so geändert, dass die Mittel auch für Digitalgeräte verwendet werden können", sagte Gebauer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (22. August). "Ich wünsche mir, dass mehr Kommunen davon Gebrauch machen." Zwischen Januar 2017 und Ende Juni 2018 seien aber von den abgerufenen 333 Millionen Euro nur 15 Prozent in die Digitalisierung geflossen.
Das bedeutet dem Bericht zufolge zugleich, dass die Kommunen von den für 2017 und 2018 zur Verfügung stehenden Fördermitteln in Höhe von einer Milliarde Euro bis Ende Juni insgesamt erst ein Drittel abgerufen hatten. Mit dem Programm, das noch von der rot-grünen Vorgängerregierung aufgelegt wurde, können die Städte und Gemeinden seit 2017 bis zum Jahr 2020 über langfristige Kredite der landeseigenen NRW-Bank jährlich 500 Millionen Euro zur Sanierung und digitalen Modernisierung ihrer Schulen abrufen. Die Tilgung der Kredite übernimmt das Land. Seit 2018 wird auch die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter gefördert, etwa Endgeräte für Schüler und W-Lan-Ausstattung.
Bereits im vergangenen Jahr waren von den insgesamt 500 Millionen Euro lediglich 223 Millionen Euro abgerufen worden. In einer Umfrage des WDR im Januar 2018 nannten viele Kommunen als Grund für die schleppende Nutzung des Programms unter anderem fehlendes Personal und ausgelastete Handwerksbetriebe.
Der Lehrerverband VBE fordert, über Konsequenzen aus der schleppenden Verwendung der Fördermittel aus "Gute Schule" nachzudenken: "Gegebenenfalls muss das Projekt in die Verlängerung", sagte Landeschef Stefan Behlau der "Rheinischen Post". "In Verwaltungen fehlt das nötige Personal für die Planung, das Handwerk erreicht vielerorts seine Kapazitätsgrenzen, und der Investitionsstau im Land wächst."
Ströbele hält Laudatio auf Aachener Friedenpreisträger
Aachen (epd). Der Berliner Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele wird am 1. September die Laudatio auf die Preisträger des diesjährigen Aachener Friedenspreises halten. Wie die Organisatoren am 24. August mitteilten, findet die Preisverleihung ab 19 Uhr in der Aula Carolina statt. Die Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an die kolumbianische Menschenrechts- und Entwicklungsorganisation "Concern Universal Colombia" sowie das Berliner Aktivistenkollektiv "Peng!". Der mit jeweils 2.000 Euro dotierte Preis wird traditionell am Antikriegstag am 1. September verliehen.
"Concern Universal Colombia" erhalte die Auszeichnung "für die praxisbezogene Sozialarbeit und das ganzheitliche Verständnis von Frieden, das mehr beinhaltet als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt", hieß es weiter. Die Organisation wurde den Angaben zufolge in den 1980er Jahren von der walisischen Entwicklungshelferin Siobhan McGee und dem kolumbianische Lehrer Jaime Bernal gegründet. Sie initiierten den Aufbau von Kleinstbetrieben, Kinderbetreuung und Seniorenbildung sowie politischer Bildung zum Thema Menschenrechte. Mittlerweile habe das Projekt rund 100 Mitarbeiter, hieß es weiter. Ein neuer Schwerpunkt sei inzwischen die Arbeit mit indigenen Gruppen im Süden der Provinz Tolima, deren Kultur auszusterben drohe. Programmleiter Bernal beteilige sich darüber hinaus aktiv am Friedensprozess, nachdem die Regierung einen Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen unterzeichnet hat.
Der zweite Preisträger, das Künstler- und Aktivistenkollektiv "Peng!", werde für seine "mutigen, kreativen und humorvollen Aktionen im Internet und in den Medien" geehrt. Die Mitglieder infiltrieren Veranstaltungen mit falschen Identitäten und starten Scheinkampagnen. Damit wollten sie Ungerechtigkeiten anprangern und politische Absurditäten entlarven, hieß es. Ein Schwerpunkt liege dabei auf Friedensthemen.
Unter anderem verbreitete das Kollektiv im Namen des Bundesarbeitsministeriums eine Entschuldigung für die Hartz-IV-Gesetze. Es verkündete den Rückruf aller Heckler & Koch-Waffen in den USA und warnte auf einer der Bundeswehr-Werbeseite nachempfundenen Website vor den Gefahren deutscher Auslandseinsätze. An einen Rüstungsmanager verliehen "Peng!"-Aktivisten den Friedenspreis der Waffenindustrie.
Der Aachener Friedenspreis wird seit 1988 an Menschen verliehen, die sich in ihrem Umfeld für Frieden und Völkerverständigung einsetzen. Er wird von rund 50 kirchlichen, politischen, gewerkschaftlichen und gesellschaftlichen Gruppen sowie von etwa 350 Einzelpersonen getragen, die im Verein "Aachener Friedenspreis" zusammengeschlossen sind.
Eingefroren für die Ewigkeit

epd-bild/Peter Sierigk
Braunschweig (epd). Heinz Martin Schumacher hebt vorsichtig den Deckel eines Metall-Containers an. Schnell umgibt den Wissenschaftler eine weiße Nebelwolke: flüssiger Stickstoff. Schumacher, der über seinem weißen Kittel eine blaue Kälteschutz-Schürze trägt, zieht langsam ein Metallgestell aus dem Container. Daran sind Kästen mit kleinen Kunststoffgefäßen befestigt, in denen bei minus 196 Grad Teile von Kartoffelpflanzen im Miniaturformat eingefroren sind. "Wir hoffen, damit die Pflanzen möglichst mehrere Jahrhunderte erhalten zu können", sagt Schumacher und blickt unter der Schutzbrille kurz auf.
Um die Artenvielfalt zu sichern, lagern in Braunschweig Tausende Duplikate einer der größten sogenannten Kryo-Sammlungen weltweit in einer Art Dornröschenschlaf. Die ursprüngliche Sammlung befindet sich etwa 100 Kilometer weiter südöstlich im Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben in Sachsen-Anhalt. Dort werden die Pflanzenproben seit mehr als 20 Jahren eingefroren. Etwa 1.600 Kartoffelsorten und dazu noch Knoblauch- und Minzarten hat Biologin Manuela Nagel mit ihrem Team bereits in den Stickstoff-Tanks eingelagert.
Verfahren aus den 50er Jahren
Während das Verfahren der Kryo-Konservierung (wörtlich: Kälte-Konservierung) bereits seit den 1950er Jahren für die Reproduktionsmedizin weiterentwickelt wurde, ist die Geschichte der Pflanzenproben im flüssigen Stickstoff noch relativ jung. Am Braunschweiger Leibniz-Institut der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen hat Kurator Schumacher in den 1990er Jahren an der Entwicklung einer Methode mitgearbeitet: Mit dieser können Genbanken weltweit Pflanzen, insbesondere die Sorten, die mit Samen nicht erhalten werden können, routinemäßig einfrieren und bei Bedarf wieder auftauen.
Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts geht die Vielfalt der Pflanzenarten zurück, wie Biologin Nagel erklärt. "Im Handel sind oft nur noch wenige Kartoffelsorten zu finden, da Landwirte aufgrund des steigenden Kostendrucks nur noch resistente Hochzuchtsorten anbauen, die reich im Ertrag sind." Die teils vom Aussterben bedrohten Landsorten aus aller Welt werden in Gatersleben und einem weiteren Institut in Groß Lüsewitz in Mecklenburg-Vorpommern aufbewahrt. Dazu zählen auch blaue Kartoffeln oder welche mit rotem Fruchtfleisch. Angefragt werden die Sorten für wissenschaftliche Zwecke oder von Landwirten oder Privatpersonen, die einen erneuten Anbau planen.
Für die Kryo-Konservierung entziehen die Wissenschaftler den etwa einen Millimeter großen Spitzen der Sprossen das Wasser, sagt Nagel. "Indem man sie dann schnell in flüssigem Stickstoff abkühlt, wird die Bildung von Eiskristallen vermieden, die das Gewebe schädigen können." Ebenso schnell müssen die gefrorenen Pflanzenteile auch wieder aufgetaut werden. "Bis ein erkennbares Pflänzchen entsteht, dauert es acht Wochen und dann bis zu einem Jahr, bis sie zu einer Kartoffelpflanze heranwächst."
Geldproblem
Kartoffeln können nur über die Knollen im Feld, über kleine Pflänzchen auf Nährboden im Reagenzglas oder über die Kryo-Konservierung sortenrein erhalten werden, sagt Nagel. Der Prozess zur Kryo-Konservierung ist zwar aufwendig, aber dennoch weniger arbeitsintensiv als die anderen beiden Methoden. Zumal die Erhaltung im Feld auch bedeutet, dass die Pflanzen unter anderem anfällig für Viren, Pilze, Bakterien und Umweltkatastrophen sind.
In Braunschweig schließt Kurator Schumacher mit seinen blauen Schutzhandschuhen die Stickstoff-Tanks wieder fest zu. Die Technologie der Kryo-Konservierung von Pflanzenproben habe sich zwar rasant entwickelt, sei aber immer noch mit einem hohen Kosten- und Zeitaufwand verbunden, sagt er.
Rund 95 Prozent aller Pflanzen könnten über eigenes Saatgut in einem Kühllager bei minus 18 Grad erhalten werden. Dies werde wohl auch in Zukunft die Methode der Wahl bleiben. Besonders in tropischen Ländern wäre die Kryo-Konservierung jedoch sinnvoll, weil es dort besonders viele Arten ohne Saatgut gebe. "Leider reichen dort oft die finanziellen Ressourcen nicht aus."
Das Braunschweiger Institut beherbergt mittlerweile in einem fensterlosen Raum vier große Stickstoff-Tanks aus Gatersleben. Jeder enthält jeweils mehr als 4.000 Proben. Ob diese tatsächlich nach 1.000 Jahren wieder aufgetaut und zu Pflanzen gezüchtet werden können, sei natürlich ungewiss, sagt Schumacher. "Bewiesen ist die Annahme erst, wenn die Proben nach vielen Jahrzehnten der Lagerung erfolgreich reanimiert wurden."
Reul eröffnet weitere Beratungsstelle gegen Salafismus in Oberhausen
Oberhausen (epd). Das NRW-Innenministerium hat am 24. August in Oberhausen eine weitere "Wegweiser"-Beratungsstelle des Präventionsprogramms gegen gewaltbereiten Salafismus eröffnet. Die Einrichtung sei in NRW die bislang 17. Beratungsstelle für junge Menschen, die in die gewaltbereite salafistische Szene abzurutschen drohten, teilte das Ministerium mit. "Wenn man jung ist, ist man häufig leicht beeinflussbar. Unser Präventionsprogramm gibt Jugendlichen daher buchstäblich einen Wegweiser an die Hand", sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Eröffnung.
Träger der neuen Beratungsstelle für die Städte Oberhausen und Mülheim an der Ruhr ist der Verein "Ruhrwerkstatt - Kultur-Arbeit im Revier". Reul kündigte an, die Zahl der Beratungsstellen im Land auf 25 auszubauen. Noch in diesem Jahr soll die Ausschreibung von sieben weiteren "Wegweiser"-Einrichtungen folgen. Ziel sei eine landesweite Abdeckung mit Beratungsstellen. "Wir müssen die Jugendlichen in ihrer Prägephase stärken. Je früher, desto besser. Nur so können wir eine Radikalisierung verhindern", sagte er.
Seit das Projekt "Wegweiser" im Jahr 2014 an den Start gegangen ist, haben die Mitarbeiter rund 730 intensive Beratungen von Betroffenen durchgeführt. 80 bis 90 Prozent davon nahmen den Angaben zufolge einen positiven Verlauf. Insgesamt registrierten die "Wegweiser"-Beratungsstellen etwa 16.000 Kontakte. "Die stetig steigende Nachfrage zeigt, wie wichtig 'Wegweiser' ist", betonte Reul.
Flüchtlinge
Rückkehr zur Normalität statt Willkommenskultur

epd-bild/Jens Schulze
München (epd). Die ehrenamtliche Flüchtlingsmentorin Monika Schubert (Name geändert) hatte gehofft, dass man ihrem Schützling bei der örtlichen Industrie- und Handelskammer (IHK) helfen könnte. Schnell wurde aber klar, dass die IHK-Flüchtlings-Beraterin für den jungen Afghanen keine Einstiegsmöglichkeit in den Job anzubieten hatte. "Hellhörig wurde die Beraterin allerdings, als sie erfuhr, dass mein Schützling gerade ein Praktikum macht, das ich ihm selbst über private Kontakte vermittelt hatte", berichtet die Flüchtlingsmentorin. "Sie bat uns um eine Kopie der Praktikumszusage." Allerdings sollte das nicht etwa der Jobsuche für den jungen Mann dienen. "Nein, die wollte sie zu ihren Akten nehmen und als eigene erfolgreiche Vermittlung ausgeben", empört sich Schubert.
Ganz freimütig gestand die IHK-Mitarbeiterin der Flüchtlingsmentorin, dass sie Schwierigkeiten habe, die geforderte Anzahl erfolgreicher Vermittlungen zu erreichen. Da könne sie jeden zusätzlichen Nachweis gebrauchen. "Dass selbst eine IHK-Mitarbeiterin so verzweifelt ist, wirft kein gutes Licht auf die Bereitschaft der Unternehmen, Flüchtlinge zu beschäftigen", schlussfolgert Schubert.
Wieder klassische Bewerbungen
Tatsächlich beobachten Flüchtlingshelfer derzeit eine sinkende Bereitschaft bei Unternehmen, Flüchtlingen Einstiegsmöglichkeiten zu bieten. Die Welle der Aufmerksamkeit, die es 2015 und 2016 gegeben habe, sei deutlich abgeebbt, sagt Ulrike Garanin, Vorstand von "Joblinge". Die Initiative mit Sitz in München und Geschäftsstellen in bundesweit 30 Städten schult junge Flüchtlinge und vermittelt sie in Arbeit sowie Ausbildung. Von den 2.000 Partner-Unternehmen mit denen die Initiative zusammenarbeite, sei zwar keines abgesprungen, sagt Garanin. "Aber es gab eine Rückkehr zur Normalität."
In den Jahren zuvor seien viele Unternehmen bereit gewesen, von ihren klassischen Bewerbungsprozessen abzuweichen, sagt Garanin. "Jetzt heißt es wieder: Bewerben Sie sich mit anerkannten Zeugnissen und den üblichen Unterlagen." Das aber sei oftmals ein Problem, weil Flüchtlingen häufig die nötigen Nachweise fehlten. "Wenn man unsere Jugendlichen nur anhand der Papiere beurteilt, haben sie oft keine Chance."
Andere Initiativen bestätigen diesen Eindruck. "Die Willkommenskultur ist verpufft", stellt die Vorstandsvorsitzende des Essener Vereins "Werden hilft!", Ulla Lötzer, fest. Die Bereitschaft von Firmen, Praktika oder Beschäftigungsmöglichkeiten für Flüchtlinge bereitzustellen, sei deutlich gesunken.
"Weiter hohe Relevanz"
Der Arbeitsmarktexperte des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Stefan Hardege, will das hingegen so nicht stehen lassen. "Das Thema Integration von Flüchtlingen hat für die Unternehmen weiterhin hohe Relevanz", stellt er fest. Insgesamt bilden laut DIHK 14 Prozent der IHK-Betriebe knapp 20.000 Flüchtlinge aus.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks meldet eine zunehmende Zahl von Lehrlingen mit Fluchthintergrund. Mit 11.000 Auszubildenden aus den acht häufigsten Herkunftsländern von Asylbewerbern habe sich ihre Zahl im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Auch die Bundesagentur für Arbeit verweist auf Erfolge. Immer mehr Geflüchtete kämen in Arbeit, heißt es. Allein zwischen Juli 2017 und Juni 2018 hätten 90.000 eine Beschäftigung gefunden.
Unbestritten ist, dass die Ausbildung von Flüchtlingen für die Betriebe häufig auch mit Problemen verbunden ist. So reichten die Sprachkenntnisse der Azubis oft nicht aus und es würden zu wenige berufsbezogene Sprachkurse angeboten, erklärt Hardege. Ein Hemmnis für die Beschäftigung von Flüchtlingen sei auch, dass die Arbeitgeber deren Aufenthaltsstatus und die Zugangsberechtigung zum Arbeitsmarkt oft kaum abschätzen könnten.
Laut Bundesagentur für Arbeit sind derzeit 180.000 Flüchtlinge auf Jobsuche. "Wir brauchen jetzt eine Aufmerksamkeit wie 2015", fordert Garanin.
Idee eines Dienstjahres für Flüchtlinge stößt auf breite Ablehnung
Die Debatte über ein soziales Dienstjahr für junge Leute nimmt wieder Fahrt auf. Bisher wurde vor allem diskutiert, ob ein Sozialjahr freiwillig bleiben oder verpflichtend werden soll. Jetzt wird in der CDU überlegt, auch Flüchtlinge einzubeziehen.Düsseldorf, Berlin (epd). CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will auch Flüchtlinge und Asylbewerber in ein allgemeines Dienstjahr für junge Leute einbeziehen. Für diesen Vorstoß erntete sie Kritik von Oppositionsparteien, SPD und Wohlfahrtsverbänden, Zustimmung kam dagegen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Strittig bleibt auch, ob junge Menschen zu einem sozialen Dienstjahr verpflichtet werden sollen. In der auch CDU-intern umstrittenen Frage sprachen sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans und Ex-Arbeitsminister Norbert Blüm (beide CDU) für einen Pflichtdienst aus.
Kramp-Karrenbauer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (25. August): "Wenn Flüchtlinge ein solches Jahr absolvieren, freiwillig oder verpflichtend, dient das ihrer Integration in Staat und Gesellschaft." In der Bevölkerung würde dies "die Akzeptanz erhöhen, dass Flüchtlinge bei uns leben". Auch Kretschmer erwartet durch einen solchen Schritt Hilfe bei der Integration. "Ich halte es für einen guten Vorschlag, wenn Deutsche und Migranten einen gemeinsamen Dienst für unsere Gesellschaft leisten", sagte er den Funke-Zeitungen (Montag).
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warf der CDU-Politikerin dagegen vor, sie zettele eine populistische Debatte über Flüchtlinge an, um von anderen Themen abzulenken: "Die Union hat Angst vor einer Debatte über stabile Renten und die Verlässlichkeit des Staates, weil sie hier völlig ideenlos ist", sagte Klingbeil den Funke-Blättern (26. August/27. August).
Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagfraktion, Marco Buschmann, bewertet den Vorschlag Kramp-Karrenbauers als "sozialen Sprengstoff", der keinen Beitrag zur Befriedung des gesellschaftlichen Konflikts um die Integration leiste. Flüchtlinge sollten stattdessen in den regulären Arbeitsmarkt integriert werden, sagte Buschmann der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS).
Ähnlich äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte. Ein verpflichtender Dienst "wäre sicherlich keine geeignete integrative Maßnahme - eine reguläre Beschäftigung hingegen schon", erklärte er in Berlin.
Für "völlig absurd" hält der Paritätische Wohlfahrtsverband den Vorstoß der CDU-Generasekretärin. "Einerseits will die CDU integrierte Flüchtlinge vom Arbeitsmarkt fernhalten und abschieben, andererseits macht sie dann einen Vorschlag, nach dem Asylbewerber ohne Sprachkenntnis in Pflegeheimen und Kitas arbeiten sollen", kritisierte er in der FAS. Die Präsidentin des Deutschen Rotes Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, plädierte im selben Blatt dafür, "die vorhandenen Strukturen der Freiwilligendienste konsequent zu nutzen und auszubauen". Diese Dienste müssten auch Flüchtlingen offenstehen.
Saar-Ministerpräsident Hans erhofft sich von einer Dienstpflicht, dass sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt. Angesichts hoher sozialer Standards dürfe erwartet werden, "dass junge Menschen ihrem Land etwas zurückgeben", sagte er der "Bild am Sonntag". Ex-Arbeitsminister Blüm argumentierte in der "Welt am Sonntag" mit einer "Einübung in die Gesamtverantwortung aller Staatsbürger". Es würde "in diesem verpflichtenden Sozialjahr weniger um die Senkung der Kosten des Sozialstaats, sondern mehr um eine Schule der Empathie" gehen, sagte er.
Nach den Worten Kramp-Karrenbauers, die die Debatte ausgelöst hatte, gibt es derzeit in der CDU eine "große Sympathie" dafür, den Dienst zur Pflicht zu machen. Sie selbst sei "noch nicht ganz entschlossen". Für das neue Grundsatzprogramm der Partei solle in den kommenden zwei Jahren eine Grundsatzentscheidung gefällt werden. Für eine allgemeine soziale Dienstpflicht müsste das Grundgesetz geändert werden.
NRW-Petitionsausschuss fordert Einsatz für Flüchtlingsbürgen
Minden/Düsseldorf (epd). Der Petitionsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags setzt sich für Flüchtlingsbürgen ein, die Zahlungsaufforderungen von Behörden erhalten haben. Die Landesregierung solle sich dafür stark machen, dass die Rechnungen bis zu einer "endgültigen politischen Lösung" ausgesetzt werden, heißt es in einem jetzt bekannt gewordenen Beschluss des Gremiums. Mit den zuständigen Behörden sollten "auf allen Ebenen" Gespräche in diesem Sinne geführt werden.
Rüdiger Höcker vom Kirchenkreis Minden sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), er erwarte, dass die politisch Verantwortlichen "endlich" eine einvernehmliche Lösung vorlegen. Der Petitionsausschuss hatte in der vergangenen Woche in Düsseldorf über eine Eingabe von evangelischer Kirche und Initiativen aus Minden beraten. Der Ausschuss nehme die Zusage des NRW-Integrationsministeriums "wohlwollend zur Kenntnis", sich gegenüber dem Bund für eine Lösung im Sinne der Flüchtlingsbürgen einzusetzen, hieß es.
Seit mehr als einem Jahr verschicken Jobcenter und Sozialämter Rechnungen von bis zu 60.000 Euro an Privatpersonen, Initiativen und Kirchengemeinden, die zwischen 2013 und 2015 für syrische Flüchtlinge gebürgt hatten. Auf diese Weise konnten sich allein in Nordrhein-Westfalen 2.600 Syrer vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat in Sicherheit bringen. Vergleichbare Aufnahmeprogramme gab es in fast allen Bundesländern.
Die Geltungsdauer der Verpflichtungen war damals jedoch ungeklärt: Länder wie NRW, Hessen und Niedersachsen gingen von einer Befristung bis zur Anerkennung der Syrer als Flüchtlinge aus. Aus Sicht der Bundesregierung aber galt die Bürgschaft auch danach fort. Zahlreiche Betroffene ziehen nun gegen die Kostenbescheide der Behörden vor Gericht.
Das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichts Minden gegen eine Kirchengemeinde unterstreiche, wie dringend eine politische Lösung sei, erklärte der Petitionsausschuss. Das Gericht hatte am 8. August die Evangelische Kirchengemeinde Lübbecke zur Rückzahlung von 10.000 Euro an die Stadt Lübbecke verurteilt. Die Gemeinde hatte für eine 77-jährige Syrerin gebürgt, die nach ihrer Anerkennung Hilfe zur Grundsicherung im Alter bekommt.
Verwaltungsgericht weist Klagen von Flüchtlingshelfern teilweise ab
Gießen (epd). Das Verwaltungsgericht Gießen hat am 23. August erneut über Klagen von Flüchtlingshelfern verhandelt, die Bürgschaften für syrische Kriegsflüchtlinge übernommen haben. Das Gericht habe den Klagen jeweils nur zu einem geringen Teil stattgegeben, nämlich soweit das Jobcenter auch die Kosten der Kranken- und Pflegeversicherung verlangt hat, teilte das Gericht mit. Nur in einem Fall seien die Kostenanforderungen des Jobcenters Gießen vollständig aufgehoben worden. Grund dafür sei gewesen, dass die Verpflichtungserklärung ausdrücklich nur für die Dauer der Aufenthaltserlaubnis des betroffenen Flüchtlings gelten sollte. (AZ: 6 K 3886/16.GI u.a.)
Die 6. Kammer verhandelte insgesamt sechs Klagen von Flüchtlingshelfern. Die Bürgen hatten sich mit Verpflichtungserklärungen gegenüber den Ausländerbehörden verpflichtet, für den Lebensunterhalt syrischer Flüchtlinge nach deren Einreise in die Bundesrepublik aufzukommen.
Bis zu 8.000 Euro
Die Bürgen wendeten sich mit ihren Klagen gegen Bescheide des Jobcenters Gießen. Dieses hatte die Kläger für die Kosten in Anspruch genommen, die dadurch entstanden, dass die Flüchtlinge nach Abschluss der Asylverfahren Leistungen erhielten. Diese beliefen sich jeweils auf Beträge zwischen 2.500 bis 8.000 Euro. Alle Asylbewerber waren als Flüchtlinge anerkannt worden. Strittig war vor allem, ob die Verpflichtungserklärungen sich auch auf die nach der Flüchtlingsanerkennung entstandenen Kosten beziehen.
Das Verwaltungsgericht hat bereits im Mai und im Dezember vergangenen Jahres über Klagen von Flüchtlingsbürgen entschieden und dabei unterschiedlich geurteilt: In einem Fall hob es die Kostenforderung auf, in zwei anderen Fällen verringerte es die Kostenforderung geringfügig ebenfalls um die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Entscheidend war auch damals laut Gericht der Wortlaut der Verpflichtungserklärungen, der sich von Fall zu Fall unterschied.
Die aktuellen Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen binnen eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Entscheidungsgründe die Zulassung der Berufung beim hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel beantragen.
Bielefelder OB verteidigt Vorstoß für junge Flüchtlinge
Bielefeld, Köln (epd). Der Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) hat seinen Vorschlag bekräftigt, mehr junge unbegleitete Flüchtlinge in Bielefeld aufzunehmen. Angesichts der Situation der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, dürfe man nicht tatenlos daneben stehen, sondern da sei man als Stadt gefragt, auch mehr zu tun als man verpflichtet sei, sagte Clausen am 23. August im WDR-Radio. Clausen hatte in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben, dass er mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen wolle. Mit dem Vorschlag soll sich der Stadtrat ab Ende September befassen.
Clausen erklärte, Kritik dürfe nicht dazu führen, dass man Menschen in einer akuten Lebensgefahr sage, dass man erst mal diskutieren müsse, bevor man überlege zu helfen. "Das ist nicht mein Grundverständnis von Humanität", erklärte Clausen. Der Vorschlag beziehe sich auf minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, erläuterte er. Derzeit lebten 220 solcher jungen Flüchtlinge in Bielefeld. Die offizielle Aufnahmequote für die Stadt liege bei 190. Vor einigen Jahren habe Bielefeld durch professionelle Expertise und großes ehrenamtliches Engagement bis zu 550 unbegleitete Flüchtlinge untergebracht. "Die Zahlen zeigen, da ist Luft nach oben, wir können mehr."
Kritik an dem Vorstoß Clausens kam unter anderem von der Bielefelder CDU und FDP sowie dem Direktor des Bielefelder Amtsgerichts. Die Bielefelder Fraktion der Grünen bezeichnete hingegen den Vorschlag als klares Signal, dass die Stadt für eine humanitäre Lösung für die aus Seenot geretteten Geflüchteten eintrete.
Superintendenten fordern eine andere Migrations- und Asylpolitik
Duisburg, Moers (epd). In einem gemeinsamen Aufruf wenden sich die Superintendenten der Kirchenkreise Duisburg und Moers gegen die Behinderung und Kriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer. "Als Christinnen und Christen sind wir erschüttert über die derzeitige Migrations- und Asylpolitik in Europa", erklärten Armin Schneider, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg, und Wolfram Syben, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Moers, in dem Aufruf. "Wir können und wollen nicht tatenlos zusehen, wie Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer ertrinken und gleichzeitig zivile Seenotrettungsmaßnahmen behindert werden", hieß es weiter.
Diese Politik führe dazu, dass nur wenige der Überlebenden eine Chance hätten, eine neue Heimat zu finden, die ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. "Das ist mit unserem Verständnis christlicher Nächstenliebe nicht zu vereinbaren", erklärten die Theologen.
Zugleich riefen die Kirchenvertreter zur Teilnahme an der Demonstration der Bewegung "Seebrücke" auf, die am 1. September in Duisburg stattfindet. Mit der Kundgebung solle die Politik dazu aufgefordert werden, dass weiteres Sterben im Mittelmeer zu verhindern.
Die Superintendenten Schneider und Syben verwiesen zudem auf die Erfahrungen des rheinischen Präses Manfred Rekowski, der im Juli auf Malta gewesen war, um sich ein Bild von der Lage der Seenotrettungsorganisationen zu machen. Dabei sprach er seine Solidarität mit denen aus, die sich für Flüchtlinge einsetzen. "Mit Rekowski fordern wir, bei den Ursachen von Migration und Flucht anzusetzen, legale und sichere Zugangswege zu eröffnen und ein solidarisches Verteilsystem in Europa einzurichten", betonten die beiden Superintendenten.
Die Demonstration der Bewegung "Seebrücke" beginnt am 1. September um 17 Uhr am Ludgeriplatz im Stadtteil Neudorf. Sie ist die zentrale Kundgebung im Ruhrgebiet innerhalb der Europaweiten Großaktionen der Bewegung "Seebrücke", die vom 25. August bis 2. September dauern.
Soziales
"Unanständige Renditen" oder Signale eines dynamischen Marktes?

epd-bild/Meike Böschemeyer
Frankfurt a.M. (epd). In der deutschen Pflegebranche werden Jahr für Jahr viele Milliarden Euro umgesetzt. Tendenz steigend. Weil hier sicheres Geld zu verdienen ist, tummeln sich vermehrt auch institutionelle Anleger wie Staatsfonds, Banken oder Versicherungen auf diesem Parkett. Sie haben ein klares Ziel: Renditen zu erwirtschaften. Das gefällt nicht jedem.
Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind die sogenannten "Private-Equity-Fonds" ein Dorn im Auge. Deshalb überlege er, ob zweistellige Renditen bei Investoren in der Pflege nicht gesetzlich unterbunden werden könnten, sagt er jüngst. Solch hohe Gewinne "für Finanzinvestoren und Kapitalgesellschaften, das ist nicht die Idee einer sozialen Pflegeversicherung". Doch unklar bleibt, ob und wie er das überhaupt bewerkstelligen könnte. Sein Ministerium reagierte auf Anfrage des epd nicht.
Bernd Meurer, der Präsident des Bundesverbandes der privaten Anbieter sozialer Dienste (bpa), schüttelt über Spahns Pläne den Kopf: Eine Renditebegrenzung sei durch nichts zu begründen, es wäre "ein Angriff auf die privaten Akteure in der Pflege". Meurer stellt mit Blick auf die institutionellen Investoren klar: "Der Pflegemarkt ist nach wie vor kleinbetrieblich und mittelständisch geprägt. Die großen Betreiber weisen einen Marktanteil von nicht einmal fünf Prozent auf." Derzeit gibt es bundesweit knapp 11.400 Heime.
80 Milliarden Euro
Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe (VDAB) appelliert an die Politik, "in der Pflege die Dynamik eines Wettbewerbs zu fördern und nicht abzuwürgen". Private Pflegeunternehmen müssten unterstützt werden: "Denn die Herausforderung ist enorm: Investitionen von bis zu 80 Milliarden Euro braucht es, um die Versorgung für die Zukunft nachhaltig aufzustellen."
Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, findet dagegen "überhöhte Renditen zulasten der Versorgung Pflegebedürftiger und auf Kosten unterbezahlten Personals unanständig". Eine Begrenzung der Renditen börsennotierter Pflegeanbieter wäre ein Novum, aber rechtlich möglich, wie die Rabattverträge für Arzneimittel zeigten, sagte Hesse. Er lobte Spahns unbedingten Handlungswillen.
Front gegen die Privatisierung von Heimen macht auch Ulrike Höhmann von der Universität Witten/Herdecke. "Wenn Gesundheitseinrichtungen als rein renditeorienterter Wirtschaftsbetrieb geführt werden, dann ist das schlicht unmoralisch", kritisierte die Expertin.
Wie sich das Angebot an stationären Einrichtungen entwickeln wird, ist der Studie "Struktur des Pflegemarktes in Deutschland und Potenziale seiner Entwicklung" für das Bundeswirtschaftsministerium aus dem Jahr 2016 zu entnehmen. Demnach gewinnt vor allem der private Markt weiter hinzu: Die Zahl der privat betriebenen Pflegeheime wird bis 2030 um voraussichtlich rund 2.600 auf dann fast 8.000 Heime steigen - ein Zuwachs von 48 Prozent.
Mehr als die Hälfte privat
Etwa fünf Prozent der rund 930.000 Pflegeheimplätze sowie fast alle großen privaten, überregionalen Intensivpflegedienste seien im Besitz von institutionellen Anlegern, heißt es bei der Gewerkschaft ver.di: "Der zunehmende Einkauf von privaten Betreibern in den Pflegemarkt setzt auch die Altenpflegeeinrichtungen der Kirchen und Wohlfahrtsverbände zunehmend unter Druck." Der Anteil privater Pflegebetriebe sei zwischen 1999 und 2015 von 43,7 auf 52,3 Prozent gestiegen.
Der VDAB betont, gegen die Übernahme von Einrichtungen durch finanzstarke Investoren gebe es kaum Mittel. "Man kann niemals ausschließen, dass auch ein Mittelständler sein Unternehmen verkauft", sagte Sprecher Jens Ofiera. Doch er betonte zugleich: "Kein mittelständischer Unternehmer verkauft sein wirtschaftlich gut und solide aufgestelltes Haus." Grund könnte eher Frust sein, der durch die pauschale Verurteilung als "böse und nur auf Gewinn fokussierte Unternehmer" entstehe.
Nach einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (2015) ergibt sich bis zum Jahr 2030 ein zusätzlicher Bedarf von 180.000 bis 220.000 zusätzlichen Betten in der Pflege. Ohne private Investitionen dürfte das kaum zu schaffen sein. Das weiß auch Spahn: "Ein Platz im Pflegeheim erfordert Investitionen von etwa 120.000 Euro. AWO, Caritas und Diakonie allein werden die Milliarden nicht aufbringen."
Diakonie-Präsident: Stadt-Land-Gefälle gefährdet die Demokratie
Syke (epd). Diakonie-Präsident Ulrich Lilie hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell die Rahmenbedingungen für gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt zu schaffen. "Das regionale Arm-Reich-Gefälle gefährdet den sozialen Frieden und die Demokratie", sagte Lilie am 20. August in Syke bei Bremen und ergänzte: "Während in Städten wie Düsseldorf mit einer florierenden Wirtschaft viele Angebote für die Bürger umsonst und draußen sind, können die ärmsten Kommunen nur wenige Kilometer weiter nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen."
Die Enquete-Kommission, die laut Koalitionsvertrag ein Förderprogramm und neue Ideen für strukturschwache Gebiete entwickeln soll, müsse jetzt endlich ihre Arbeit aufnehmen, betonte der Präsident am Rande einer Podiumsdiskussion. "Alle Augen sind auf den Innenminister gerichtet." Lilie debattierte im Rahmen der bundesweiten Diakonie-Kampagne "unerhört" mit Vertretern aus Politik und Kirche unter dem Titel "Stadt - Land - Schluss?" über die Situation im ländlichen Raum.
Die Kampagne, die noch bis 2020 läuft, soll den Angaben zufolge diejenigen Menschen zu Wort kommen lassen, die häufig ungehört bleiben. Dazu zählten etwa Flüchtlinge, Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger. Die Diakonischen Werke machen bundesweit in Diskussionsforen auf sozialpolitische Brennpunkt-Themen aufmerksam.
Sozialwissenschaftler Wegner: Sanktionen bei Hartz IV ganz abschaffen
Hannover (epd). Der hannoversche Theologe und Sozialwissenschaftler Gerhard Wegner unterstützt die Forderung von SPD-Parteichefin Andrea Nahles nach einer Abschaffung von Sanktionen für junge Hartz-IV-Empfänger. Er würde sogar noch einen Schritt weitergehen und komplett auf Sanktionen verzichten, sagte Wegner am 20. August dem Evangelischen Pressedienst (epd). Studien belegten, dass solche Strafmaßnahmen nur für einen Teil der Betroffenen eine antreibende "Push-Funktion" hätten. "Für einen anderen Teil ist das aber ein Tritt in die Depression", erklärte er. Das gelte für Jugendliche und für Erwachsene gleichermaßen.
Er plädiere schon seit langem dafür, Hartz IV auf ein Belohnungssystem umzustellen, sagte der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): "Die Menschen dürfen nicht dafür bestraft werden, wenn sie etwas nicht schaffen. Sie müssen vielmehr dafür belohnt werden, wenn sie etwas schaffen." Vorstellbar sei etwa eine einmalige Zahlung von 200 oder 300 Euro, wenn jemand etwa eine Qualifizierungsmaßnahme abschließt oder eine Ausbildung beginnen kann.
Ermutigung statt Drohung
"Die Sichtweise, dass die Arbeitslosen zur Faulheit tendieren und sich nicht um Jobs bemühen, ist nicht berechtigt", betonte Wegner. Wer länger arbeitslos sei und den Einstieg in die Arbeitswelt nicht schaffe, benötige "Unterstützung und Ermutigung und nicht eine Drohung mit Sanktionen im Hintergrund". Nur dann könne das Selbstwertgefühl wieder aufgebaut werden.
Eine solche Unterstützung könnten aber die Fallmanager in den Jobcentern nicht leisten. "Das sind Verwaltungsbeamte. Die sind nicht dafür qualifiziert, Menschen zu helfen, die durchhängen und gerade ein angeknackstes Selbstbewusstsein haben", sagte der Theologe. Die Erfahrung mit den rund eine Million Langzeitarbeitslosen zeige, dass dieser Ansatz tatsächlich nicht funktioniere. Wegner schlug vor, die Jobcenter sollten Sozialpädagogen einstellen. "Eine stärkere sozialpädagogische Betreuung gerade bei Jugendlichen halte ich für nötig."
Verfassungsrechtlich problematisch
Der Institutsdirektor wies zudem darauf hin, dass Sanktionen verfassungsrechtlich ein Problem seien: "Man droht damit, dass die Menschen unterhalb des Existenzminimums geraten, das vom Staat eigentlich garantiert werden muss. Das ist mit der Vorstellung von Menschenwürde in unserem Land nicht vereinbar."
Das Echo auf Nahles' Vorschlag war zunächst geteilt. Die Union und die Arbeitgeber lehnen einen Verzicht auf Sanktionen ab. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), Grüne und die Links-Partei sehen darin dagegen einen Schritt in die richtige Richtung. Der DGB plädierte ebenfalls dafür, Sanktionen ganz abzuschaffen.
Tafel startet Projekt gegen Lebensmittelverschwendung
Berlin (epd). Die Tafel startet ein neues Projekt gegen Lebensmittelverschwendung: Verbraucher, Landwirte und Lebensmittelhändler sollen dabei konkrete Anregungen erhalten, um selbst weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Umgesetzt wird die Initiative von der Tafel-Akademie gemeinsam mit dem tschechischen Verein "Zachran jidlo" (Essen retten), teilte die Tafel am 21. August in Berlin mit. Details sollen Ende September beim Zukunftskongress der Tafel Deutschland vorgestellt werden.
Die gemeinnützige Tafel-Akademie ist eine hundertprozentige Tochter des Tafel Deutschland e.V.. Das neue Projekt gegen die Verschwendung von Lebensmitteln trägt den Titel "Jeder kann die Lebensmittelverschwendung vermeiden". Ein Kernelement sei ein Instagram-Wettbewerb, der im November 2018 starten soll. "Wir wollen mit dem Projekt insbesondere junge Menschen ansprechen und auch neue Wege ausprobieren, um diese Zielgruppe zu erreichen", erklärt Evelin Schulz, Geschäftsführerin der Tafel-Akademie. Das Projekt wird den Angaben zufolge von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.
Land akzeptiert Gerichtsentscheidung zu ehemaligem Förderschüler
Köln (epd). Im Rechtsstreit um das Schicksal des ehemaligen Förderschülers Nenad M. akzeptiert das Land NRW das Urteil des Landgerichts Köln. Wie ein Sprecher der Bezirksregierung Köln am 23. August mitteilte, verzichtet das Land auf eine Berufung gegen die vor gut einem Monat gefallene Entscheidung, wonach das Land Nenad M. entschädigen muss. Das Urteil ist damit rechtskräftig (AZ.: 5 O 182/16).
Der 21-Jährige hatte das Land in dem Zivilverfahren verklagt, weil er nach seiner Ansicht zu Unrecht jahrelang auf einer Förderschule unterrichtet wurde. Über die Höhe der Entschädigung wird das Gericht nach einer weiteren Beweisaufnahme noch entscheiden müssen, dazu soll auch ein psychiatrisches Gutachten erstellt und geklärt werden, ob der junge Mann an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Nenad M. selbst hatte einen Verdienstausfallschaden von fast 40.000 Euro und ein Schmerzensgeld wegen der erlittenen psychischen Schäden in Höhe von 20.000 Euro gefordert.
Nach Ansicht des Gerichts hätte der Schule bei der jährlichen Überprüfung des Förderbedarfs auffallen müssen, dass Nenad M. keinen Förderbedarf im Bereich Geistige Entwicklung hatte. Bei der gebotenen Prüfung wäre auch der falsche Förderschwerpunkt festgestellt worden und der Kläger hätte auf eine andere Schule wechseln können, auf der er zeitnah einen Hauptschulabschluss hätte erwerben können, erklärte das Gericht.
Nenad M. hat nach Angaben des Elternvereins Mittendrin, der die Klage unterstützt, fast elf Jahre lang eine Schule für geistig behinderte Menschen besucht, obwohl er durchschnittlich begabt ist. Trotz jahrelanger Bitten an seine Lehrer habe er erst kurz vor seinem 18. Geburtstag auf ein Berufskolleg wechseln dürfen, wo er mit Bestnoten seinen Hauptschulabschluss nachgeholt hatte.
Zugleich rief der Verein NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dazu auf, aus dem Fall Konsequenzen zu ziehen. Vor allem Kinder aus schwierigen Verhältnissen und Zuwandererfamilien sowie geflüchtete Jugendliche würden oft in Schulen für geistig Behinderte unterrichtet, obwohl dies gar nicht nötig sei. Deshalb müsse eine Kommission eingerichtet werden, die überprüft, ob Schülerinnen und Schüler zu Recht in Förderschulen unterrichtet werden oder ob ihnen dort Bildungschancen vorenthalten werden.
Der Traum vom grenzenlosen Tanzen

epd-bild/Winfried Rothermel
Essen, Lahr (epd). Sie leben ihren Traum vom Tanzen. Einem Tanzen, das das keinen Unterschied macht zwischen ihnen und professionell ausgebildeten Künstlern. Ricarda Noetzel, Matthieu Bergmiller und Jörg Beese sind tanztalentierte Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. Vormittags arbeiten sie in den Werkstätten in der Schwarzwaldstadt Lahr, nachmittags absolvieren sie eine Tanzausbildung bei der Tanzkompanie "Szene 2wei" - und trainieren dort mit Profitänzern.
Im Jahr 2009 gründete der Sozialpädagoge und ausgebildete Tänzer Timo Gmeiner gemeinsam mit dem Choreographen und Tänzer William Sánchez H. die inklusive Kompanie in Essen. Derzeit studieren sie ihre neue Produktion "Wanderlust" ein, die sich mit der Zukunft der Natur in Zeiten von Klimawandel und Naturkatastrophen beschäftigt. Premiere des zeitgenössischen Tanzstücks ist am 22. September in Reutlingen, es folgen Aufführungen in Berlin, Hamburg, Essen und Stuttgart.
Wenn die Tänzer kauernd und zitternd ihre Arme reiben, die Körper sich einem imaginären Windsturm entgegenstellen, wird auch den Zuschauern kühl - trotz sommerlicher Außentemperaturen. Die Sprache des Tanzes habe keine Grenzen, sagt Choreograph William Sánchez H.: "Tanz kennt keine Kategorien wie behindert oder nicht behindert." Es sei wichtig, die individuellen Stärken und Perspektiven der Tänzer aufzugreifen. Daher schont der Kolumbianer mit den dunkelbraunen Locken keinen von ihnen.
Denn egal, ob Beeinträchtigung oder nicht: Alle müssen neben Talent auch Disziplin, Ehrgeiz, hohe Konzentrationsfähigkeit und ein gutes Körpergefühl mitbringen. Mit den unterschiedlichen Körpern zu arbeiten, erlaube ihm, noch kreativer zu sein, sagt der 37-jährige Sánchez. Jede Besonderheit biete Möglichkeiten, "die wir auf der Bühne gezielt einsetzen".
Gerade ist die Truppe von einer Studienwoche bei der spanischen "Nationalen Tanzkompanie" in Madrid zurückgekommen. Auch in Lahr wird nicht nur nachmittags drei bis vier Stunden geübt, sondern oft zusätzlich auch vormittags. Normalerweise arbeiten Noetzel, Bergmiller und Beese an den Vormittagen in der Gärtnerei oder der Elektromontage in den Lahrer Werkstätten, dem Kooperationspartner der Kompanie.
Doch gleich zu Beginn zeigten sich die Werkstätten, die zur Johannes-Diakonie Mosbach gehören, offen gegenüber dem ungewöhnlichen Projekt. "Eine solche Zusammenarbeit war auch für uns etwas Neues", sagt Werkstätten-Leiter Erwin Stiegeler. Die große künstlerische und körperliche Leistung seiner Mitarbeiter im sehr modernen und ausdrucksvollen Tanzen sei erstaunlich. Besonders bewundere er, wie die Rollifahrerin Ricarda Noetzel tanze.
Für die 27-Jährige ist es körperlich besonders anstrengend. Da sie ihre Beine kaum benutzen kann, muss sie dies mit den Armen und dem Oberkörper ausgleichen. Sie hat gelernt, aus dem Rollstuhl zu gleiten und sich elegant tänzerisch auf dem Boden zu bewegen: liegend, rollend oder robbend.
"Tanzen macht mir großen Spaß", sagt die junge Frau mit den langen braunen Haaren strahlend. Sie würde ihre Leidenschaft gerne zum Beruf machen. "Ich habe meinen Körper viel besser kennengelernt und traue mir viel mehr zu."
Auch Jörg Beese liebt das Schauspielern und die Bewegung. Wegen des Tanzens zog 25-Jährige extra von Mülheim an der Ruhr in das Schwarzwaldstädtchen. Am liebsten würde er auch seine Arbeitsschuhe, die er vormittags in der Elektromontage trägt, ganz an den Nagel hängen.
Beim Tanzen ließen sich kaum Unterschiede erkennen, erklärt Timo Gmeiner, der pädagogische und künstlerische Leiter der Truppe. Jeder Mensch bringe unterschiedliches Potenzial mit und solle die Möglichkeit bekommen, dies auszubilden, wünscht sich der 34-Jährige.
Die inklusive Tanzkompanie will zeitgenössisches Tanztheater als "Medium und Motor für inklusives Handeln" sehen. Sie ist deutschlandweit tätig, vor allem aber in Essen und in Lahr. Das Projekt wird auch von der "Aktion Mensch" in Bonn gefördert.
"Unser gemeinsames Ziel ist es, Grenzen zu sprengen - seien es diejenigen zwischen Künstler und Zuschauer oder solche, die in den Köpfen der Menschen existieren", sagt Timo Gmeiner. Von den Zuschauern wünscht er sich Offenheit. Die Einteilung in behindert oder nichtbehindert spiele nur anfangs eine Rolle.
Nach der Probe lassen sich die Tänzer erst einmal schwer atmend und erschöpft in verschiedenen Ecken auf den Boden fallen und trinken Wasser. Nach ein paar Minuten setzen sie sich zusammen, reden und lachen. Der enge Zusammenhalt, die Freundschaften, gehen über das gemeinsame Tanzen hinaus. Einige Tänzer leben sogar gemeinsam in einer inklusiven Wohngemeinschaft.
Pflegekosten: Sozialamt kann auf geschenktes Haus zugreifen
Karlsruhe, Bielefeld (epd). Das Sozialamt kann auf eine Schenkung von Eltern an ihre Kinder zugreifen, um damit die Pflegekosten der Mutter zu decken. Als Schenkung gilt dabei nicht nur ein auf die Kinder übertragenes Haus, sondern auch der Wertzuwachs eines Grundstücks aufgrund des Verzichts auf ein zuvor vereinbartes lebenslanges Wohnrecht, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 23. August veröffentlichten Urteil. Zahlen die Eltern dann noch Miete an ihre Kinder, müsse auch dieser Nutzen aus der Schenkung berücksichtigt werden, so die Karlsruher Richter. (AZ: X ZR 65/17)
Im konkreten Fall hatten Eltern ihrer Tochter 1995 ein Haus im Raum Bielefeld geschenkt. Die Eltern verzichteten 2003 auf ein zuvor im Grundbuch eingetragenes lebenslanges Wohnrecht. Die Mutter zahlte der Tochter nun für die bewohnte Wohnung monatlich 340 Euro Kaltmiete.
Als der Vater starb und die Mutter 2012 in ein Pflegeheim zog, kam der Landkreis Schaumburg als Sozialhilfeträger für die Heimkosten auf. Bis zum Tod der Mutter fiel so Hilfe zur Pflege in Höhe von 22.248 Euro an.
Dieses Geld forderte der Landkreis von der Tochter zurück. Das 1995 geschenkte Haus könne zwar nicht mehr als Schenkung zurückgefordert werden. Anders sehe dies aber bei dem nachträglich erklärten Verzicht der Eltern auf ihr Wohnrecht und der daraufhin erhaltenen Miete aus.
Dies bestätigte nun auch der BGH. Innerhalb von zehn Jahren könnten Schenkungen bei einer wirtschaftlichen Notlage des Schenkers zurückgefordert werden. Als Schenkung sei hier der spätere Verzicht auf das lebenslange Wohnrecht anzusehen. Denn dadurch sei der Wert des Grundstücks gestiegen, so der BGH. Auch die Mieteinnahmen müsse sich die Tochter anrechnen lassen. Das Oberlandesgericht Hamm muss nun den genauen Rückforderungsanspruch des Landkreises bestimmen.
Online-Hilfe für Arbeitnehmer mit Behinderung geplant
Düsseldorf (epd). Ein neues Angebot im Internet soll Arbeitnehmern mit einer Schwerbehinderung oder einer chronischen Krankheit zukünftig bei Fragen rund um den Job unterstützen. Das Projekt "Sag ich's?" helfe Betroffenen interaktiv bei der Frage, ob sie ihre Erkrankung am Arbeitsplatz offenbaren sollten oder nicht, erklärte die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung und chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen (BAG Selbsthilfe) am 21. August in Düsseldorf. Beteiligt sind zudem die Universität zu Köln, das Pharmaunternehmen Abbvie und der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW).
Das Projekt, das das Bundessozialministerium den Angaben nach finanziell fördert, biete Betroffenen einfachen Zugang zu Unterstützung und verweise bei Bedarf an weitere Beratungsangebote. "Wir arbeiten mit einer Mischung aus Erklärvideos und Fragen, die zum Nachdenken anregen sollen", erklärte Mathilde Niehaus, Leiterin des Lehrstuhls für Arbeit und berufliche Rehabilitation der Uni zu Köln. Zudem bleibe alles anonym.
Medien & Kultur
"Was ist eigentlich verboten und was nicht?"

epd-bild / Norbert Neetz
Frankfurt a.M. (epd). Für Klaus Blees ist es die fünfte Sperre bei Facebook. "Nur sind (d)es die feigen palästinensischen Terroristen, die palästinensische Zivilisten einschließlich Kinder(n) als menschliche Schutzschilde missbrauchen", schreibt er in einer öffentlichen Facebook-Gruppe. In der hitzigen Diskussion über den israelisch-palästinensischen Konflikt folgt ein harscher Kommentar auf den nächsten. Der 64-Jährige versucht, gegen seiner Meinung nach ungerechtfertigte Kritik an Israel anzuschreiben, bis es ihn erwischt: "Dieser Beitrag ist nur für dich sichtbar, da er gegen unsere Standards hinsichtlich Hassrede verstößt", informiert ihn das Unternehmen. Für 30 Tage gilt die Sperre - solange kann Blees nichts auf Facebook posten.
Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) verpflichtet soziale Netzwerke, illegale und rechtswidrige Inhalte wie "Volksverhetzung" oder "Beleidigung" rasch zu entfernen. Bei Verstößen drohen den Unternehmen hohe Bußgelder. Aber auch Inhalte, die gegen die sogenannten Gemeinschaftsstandards verstoßen, werden regelmäßig entfernt. Wenn Postings nach Einschätzung von Facebook gewalttätiges und kriminelles Verhalten fördern oder als Hassrede gelten, nimmt das Unternehmen sie von der Plattform. Allerdings nur, wenn sich Nutzer über Beiträge beschwert hätten, sagt eine Sprecherin. Selbst auf die Suche nach Hasskommentaren gehe das Netzwerk nicht.
Einladung zu Veranstaltung gesperrt
Doch wie entscheidet das Unternehmen, was Hassrede ist? Man definiere Hassrede als direkten Angriff auf Personen, erklärt Facebook auf seiner Seite: "ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Kaste, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Behinderung oder Krankheit. Auch Einwanderungsstatus ist in gewissem Umfang eine geschützte Eigenschaft." Als Angriff definiere man als gewalttätige oder entmenschlichende Sprache.
Blees ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Aktion 3. Welt Saar im Saarland. Der gemeinnützige Verein recherchiert und publiziert zu Asyl, Rassismus, Fairer Handel, Antisemitismus und Islamismus. Am 10. Februar habe der Verein eine Veranstaltung angekündigt mit dem Titel "Plädoyer für eine politische Lösung des Türkei-Kurdistan-Konfliktes", sagt Blees. Vier Tage später wurde die Ankündigung auf der offiziellen Seite gelöscht - begründet diesmal mit einem Verstoß gegen die Facebook-Richtlinien.
Blees gibt zu, in manchen Facebook-Diskussionen provozieren zu wollen, um zum Nachdenken anzuregen. Doch er fragt sich auch, was mit all den anderen Kommentaren ist, die die Plattform stehen lasse und die tatsächlich in ihrer ganzen Zielrichtung hasserfüllt und beleidigend seien. "Manche davon gewiss auch in strafrechtlich relevantem Sinn."
Gemeinhin bestreitet Facebook, dass viele Beschwerden dazu führen, dass ein Posting gelöscht wird. Ausschlaggebend sei die Prüfung durch einen Mitarbeiter, sagt eine Unternehmenssprecherin. Aber wie kommt es dann immer wieder zu Sperrungen von Accounts und Postings, die satirische Beiträge darstellen oder gar einzelne Sichtweisen im demokratischen Meinungsspektrum widerspiegeln?
Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Serap Güler (CDU), engagiert sich gegen das Tragen von Kopftüchern bei Mädchen unter 14 Jahren. Bei Facebook und Twitter postete sie im April: "Einem jungen Mädchen ein Kopftuch überzustülpen, ist pure Perversion. Das sexualisiert das Kind." Facebook löschte das Posting, Twitter nicht.
Kritik an Intransparenz
Auch die dunkelhäutige Imoan Kinshasa wurde bei Facebook gesperrt, einen Tag lang. Auf einem österreichischen Weinfest sei sie, weil sie die bayerische Tracht getragen habe, als "Neger im Dirndl" beleidigt worden, berichtete sie auf ihrer Seite. Der Zeitung "Der Standard" zufolge wurde der Beitrag fast 12.000 gelikt und 5.000 Mal geteilt. Dann sperrte ihn Facebook wegen Hassrede, obwohl sie in ihrem Posting den entschärften Begriff "N*eger" benutzt hatte. Zwischenzeitlich ist der Beitrag wieder sichtbar.
Was Blees besonders ärgert: Eine konkrete Begründung für die Sperre bekomme man nie. Diese Intransparenz kritisiert auch Markus Reuter von "netzpolitik.org": "Was ist eigentlich verboten und was nicht?" Facebook argumentiere zwar mit dem Hausrecht. Doch bei der Größe und Wichtigkeit, die das Netzwerk für die Öffentlichkeit habe, sei es eher zu vergleichen mit einer Infrastruktur wie die Telefonleitung. Anders als Facebook und Twitter immer behaupteten, würden Inhalte "mit Sicherheit" auch automatisch gelöscht, vermutet Reuter.
Und auch die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" beobachtet einen Übereifer bei den Plattformen: Facebook und Google begriffen sich als Privatunternehmen und löschten nach ihren eigenen Regeln. Sie räumten sich das Recht ein, auch Inhalte zu entfernen, die von den Kommunikationsfreiheiten gedeckt seien.
Die Kölner Medienanwältin Lina Bock sagt: "Nicht jedes gesperrte Posting ist zwangsläufig auch rechtlich bedenklich." Die Frage, was noch zulässige Meinung sei, sei häufig Abwägungssache und die könne auch fehlerhaft ausfallen. Im Zweifel müsse das ein Gericht klären, sagt Bock. In der jüngsten Zeit haben deutsche Gerichte in einzelnen Urteilen bewirkt, dass Facebook bereits gelöschte Kommentare wieder entsperren musste, weil es sich um zulässige Meinungsäußerungen gehandelt hatte.
Bei der letzten Sperre hat Klaus Blees Facebook einfach zurückgeschrieben: Sein Posting über die "palästinensischen Terroristen" sei kein Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards. Daraufhin wurde sein Kommentar wieder freigeschaltet. Es liege doch keine Hassrede vor, antwortete das soziale Netzwerk. Sein Konto aber blieb gesperrt.
Mesale Tolu: "Freue mich nicht wirklich über Ausreise"

epd-bild/Verena Müller
Stuttgart (epd). Die in der Türkei angeklagte Journalistin Mesale Tolu ist wieder in Deutschland. Am 26. August landete die deutsche Staatsbürgerin fast anderthalb Jahre nach ihrer Festnahme gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn auf dem Stuttgarter Flughafen. "Ich freue mich aber nicht wirklich über die Ausreise", sagte Tolu vor Journalisten.
Sie wisse, dass sich in dem Land, in dem sie eingesperrt war, nichts verändert habe. Zahlreiche Kollegen, Oppositionelle, Anwälte, aber auch Studenten seien immer noch eingesperrt. "Für ihre Freisetzung werde ich mich weiterhin einsetzen", erklärte sie.
Ein türkisches Gericht hatte die Ausreisesperre für die Reporterin aufgehoben. Der Prozess gegen sie soll aber fortgesetzt werden. Tolu steht in Istanbul wegen des Vorwurfs der Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor Gericht. Der 33-Jährigen drohen bis zu 20 Jahre Haft.
"Bin der Meinung, dass ich im Recht bin"
Zu ihrem nächsten Gerichtstermin am 16. Oktober will die Journalistin wieder in die Türkei reisen. "Ich bin der Meinung, dass ich im Recht bin", sagte Tolu. Sie habe verschiedene Anträge gestellt, um ihre Unschuld zu beweisen. Konkretes wollte die Journalistin wegen des laufenden Prozesses nicht sagen.
Ihr sei bewusst, dass eine Teilnahme an der Verhandlung möglicherweise naiv sei. Denn die Hoffnung auf einen fairen Prozess setze voraus, dass die Türkei ein Rechtsstaat sei - und keine Willkür-Herrschaft: "Ich bin aber erstmal ein bisschen mutig."
Ihre Verhaftung, die bisherigen Prozesstermine und die Ausreisesperre empfindet Tolu als eine "Kette von Ungerechtigkeiten". "Man hat bei den Vorwürfen gegen mich der Fantasie freien Lauf gelassen", sagte sie. Dasselbe sei auch vielen anderen Journalisten passiert. "Alle, die kritisch gearbeitet haben, wurden unter Druck gesetzt, in Polizeigewahrsam genommen oder eingesperrt", berichtete Tolu.
Sie verurteile aber nicht die Menschen, die den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gewählt haben. Viele wüssten nichts von dem Druck und der Verfolgung, der die Opposition ausgesetzt sei. "Es gibt zum Beispiel keine unabhängigen Fernsehsender mehr, die die Menschen aufklären könnten", sagte die Journalistin.
Warum die Ausreisesperre ausgerechnet jetzt aufgehoben worden sei, wisse sie nicht. In den nächsten Tagen will Tolu ihre Freunde und ihre Familie treffen. Langfristig wolle sie wieder als Journalistin arbeiten.
Ehemann darf nicht ausreisen
Tolu war Ende April 2017 bei einer Razzia in Istanbul festgenommen worden und saß bis Dezember in Untersuchungshaft. Beim zweiten Prozesstermin im Dezember hatte das Gericht zwar Tolus Entlassung aus dem Gefängnis verfügt, aber ein Ausreiseverbot angeordnet. Tolu hat vor ihrer Verhaftung für die linke Nachrichtenagentur Etkin News Agency (Etha) gearbeitet. Mit ihr ist unter anderen ihr Ehemann Suat Corlu angeklagt. Seine Ausreisesperre besteht weiterhin.
Im Februar 2018 hatte ein Istanbuler Gericht die Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel verfügt. Yücel hatte mehr als ein Jahr ohne Anklage in türkischer Untersuchungshaft gesessen. Der Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner war im Oktober 2017 nach dreieinhalb Monaten Untersuchungshaft entlassen worden und aus der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt.
Ein modernes Haus für den "Bauernmaler"

epd-West/Katrin Nordwald
Werther (epd). Wie ein Findling fügt sich das Gebäude in die Landschaft aus Feldern, kleinen Wäldern und Obstwiesen im westfälischen Arrode, Ortsteil der Kleinstadt Werther nahe Bielefeld. Der geradlinige Flachbau hält sich zurück mit seiner geduckten Architektur, die graue Fassade aus Muschelkalk-Steinen. Innen offenbart sich ein großzügiger Raum mit warmen Holzelementen. Panoramafenster öffnen den Blick ins Grün und lassen viel Licht hinein ins Museum Peter August Böckstiegel, das nach rund zweijähriger Bauzeit am 30. August mit einem Festakt eröffnet wird.
Die moderne Architektur beherbergt künftig Kunst der klassischen Moderne. Dreh- und Angelpunkt wird das Werk des westfälischen Künstlers Böckstiegel (1899-1951) sein, Sohn von Arroder Kleinbauern, der vor 100 Jahren mit zur Avantgarde in Deutschland gehörte. Mit dem Neubau will die Peter-August-Böckstiegel-Stiftung die Bedeutung des Malers und Bildhauers in Erinnerung rufen, der in der Weimarer Republik mit zu den wichtigen Vertretern des späten Expressionismus zählte und der "Dresdner Sezession Gruppe 1919" um Otto Dix und Conrad Felixmüller angehörte.
Platz für den Nachlass des Künstlers
Gleichzeitig schafft das zweigeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von knapp 1.200 Quadratmetern Platz für Böckstiegels umfangreichen Nachlass. Neben insgesamt 1.300 Bildern und Skulpturen des Künstlers gehört dazu auch dessen große Kunstsammlung, in der Namen wie Barlach - den er sehr verehrte -, Lehmbruck, Munch und Kollwitz vertreten sind. Die Werke waren bislang zum großen Teil in einem Lager in Gütersloh untergebracht sowie im Geburtshaus Böckstiegels - ein leuchtend rotes Bauernhäuschen neben dem Museum, in dem der Künstler bis zu seinem Tod lebte und das von seiner Familie erhalten wurde.
Als neue Heimat der bedeutenden Sammlung bietet das Museum Peter August Böckstiegel ein klimatisiertes Depot und eine Ausstellungsfläche von rund 300 Quadratmetern. Außerdem befinden sich in dem barrierefreien Gebäude ein Raum für Kunstvermittlung, Museumsshop und Café. Für den Bau stellte der Kreis Gütersloh ein Stiftungskapital von zwei Millionen Euro bereit, weitere zwei Millionen Euro warb die Böckstiegel-Stiftung ein über private Spenden sowie Fördergelder ein, darunter vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und der NRW-Stiftung.
Drei Ausstellungen sind pro Jahr geplant. "Eine davon wird stets den Schwerpunkt auf Böckstiegels Werk legen", sagt Museumssprecherin Lilian Wohnhas. Außerdem werde der Blick auf Künstler gerichtet, die ihn inspirierten und beeinflussten. So ist im kommenden Frühjahr eine Ausstellung über den deutschen Impressionisten Robert Sterl (1867-1932) angesetzt.
Die Eröffnungsschau mit dem Titel "Ausdruck seines Ursprungs" vom 30. August bis 21. Oktober zeigt laut Wohnhas einen Querschnitt von Böckstiegels Vielseitigkeit. Rund 70 Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen und Skulpturen sind zu sehen. Zeitlich schlägt die Ausstellung einen Bogen von frühen Arbeiten im Jahr 1913 bis zum Spätwerk des Künstlers nach dem Zweiten Weltkrieg.
Vertreter eines "romantischen Expressionismus"
Böckstiegel vertrat im Gegensatz zu Felixmüllers sozialkritischen Darstellungen des Arbeitermilieus einen "romantischen Expressionismus". Wie seine Vorbilder, die Maler der Gruppe "Die Brücke" (1905-1913), war er geleitet von der Suche nach Ursprünglichkeit. Seine Motive sind Blumenstillleben, Ernte-Impressionen und immer wieder seine Eltern und die Bauern in Arrode, deren einfache Lebensform und Nähe zur Natur Böckstiegel bewunderte, ohne sie zu idealisieren. Ebenso oft hielt der "Bauernmaler", wie er sich selbst nannte, seine Ehefrau Hanna - stolz oder verklärt madonnenhaft - und die Kinder Sonja und Vincent im Bild fest.
Die klare Handschrift Böckstiegels sei in allen Werken sofort erkennbar, meint Wohnhas: "Kurze Pinselstriche, die Farbintensität, die Parallele, die sich zwischen Landschaft und Physiognomie der Menschen wiederfindet, etwa die Ackerfurchen als Falten in den Gesichtern der Bauern."
Auch Böckstiegels Bilder aus den beiden Weltkriegen widmen sich den Menschen. Er zeichnet die Alten und Kinder in den Dörfern Russlands und Rumäniens, wo er als Soldat im Ersten Weltkrieg stationiert war. Das Bild "Mein Quartier im Osten" von 1916 zeigt seinen Unterschlupf in einem tiefen, dunklen Wald in Weißrussland. Eine Flüchtlingsfrau malt er nach dem Zweiten Weltkrieg in sich versunken, grau, mit leerem Blick. "Heimat, der Verlust davon ist bei ihm wiederkehrendes Motiv", erklärt Wohnhas. Von den Nationalsozialisten als "entarteter Künstler" verfemt, konnte der Pazifist Böckstiegel nach 1945 im Kunstbetrieb nicht wieder Fuß fassen. Er war vor 1933 nicht so prominent gewesen wie Emil Nolde oder Max Beckmann, die später rehabilitiert wurden.
Das alte Ausstellungsgebäude in Arrode, das Böckstiegel-Geburtshaus, verzeichnete rund 4.000 Besucher pro Jahr. Das Museumsteam hofft, die Zahl mehr als zu verdreifachen. Ausstellungskooperation mit anderen Städten sind geplant, etwa mit Dresden. "Ihn verband viel mit der früheren Metropole, wo er studierte, ein Atelier unterhielt, wichtige Kontakte zur Avantgarde knüpfte und sein Kunstverständnis erweitere." In der sächsischen Hauptstadt erinnert heute eine August-Böckstiegel-Straße an ihn.
"Pegida"-Demo: Polizeipräsident bedauert Vorfall mit ZDF-Journalisten
Die sächsische Polizei äußert Selbstkritik und bekennt sich zur Pressefreiheit. Andrea Nahles und Anton Hofreiter befeuern derweil die Debatte über die politische Kultur in den Behörden im Freistaat. Horst Seehofer äußert sich zurückhaltend.Dresden (epd). Rund eine Woche nach dem umstrittenen Vorgehen sächsischer Polizisten gegen Journalisten des ZDF hat der Dresdner Polizeipräsident Horst Kretzschmar Fehler eingeräumt. Ihm sei unverständlich, dass die Journalisten 45 Minuten lang nicht ihrer Arbeit nachgehen konnten, erklärte Kretzschmar am 24. August in Dresden: "Ich bedaure diesen Umstand als Polizeiführung außerordentlich." Die Beamten hatten das ZDF-Team aufgehalten und unter anderem deren Personalien überprüft, nachdem ein Demonstrant einem Kameramann rechtswidriges Verhalten vorgeworfen hatte.
Die Journalisten waren am 16. August in Dresden für das Magazin "Frontal 21" im Einsatz und wurden bei Aufnahmen bei einer "Pegida"-Demonstration in ihrer Arbeit behindert. Zuvor hatte sich der Demonstrant am Rande eines Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) massiv bei dem Kameramann beschwert, der aus seiner Sicht widerrechtlich sein Gesicht gefilmt habe. Daraus ergab sich ein Polizeieinsatz, bei dem das Team 45 Minuten lang festgehalten wurde. Wie erst später bekannt wurde, ist der Mann, der den Einsatz ausgelöst hat, Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes.
"Daraus lernen"
Vertreter des ZDF trafen sich am 24. August in Dresden zu einem Gespräch mit dem Polizeipräsidenten Kretzschmar. Nach Angaben des Senders entschuldigte sich Kretzschmar. Er wolle die bislang falsche Darstellung der Ereignisse korrigieren. Der Polizeipräsident erklärte am Abend, er habe zugesichert, dass der Einsatz aufgearbeitet werde, "auch um daraus zu lernen". Die Polizei habe sicherzustellen, dass die Demonstrationsfreiheit gewährleistet und die freie Berichterstattung über Demonstrationen und Versammlungen garantiert bleibt.
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am 25. August in Berlin, Pressefreiheit müsse in Deutschland gewährleistet sein. Der Vorfall in Dresden müssen aufgeklärt werden. Er selbst wollte dazu zunächst keine Bewertung abgeben. Er sei noch im Urlaub, betonte er. Daher habe er keine direkte Informationen zu dem Sachverhalt bekommen, sondern kenne ihn nur vom Hörensagen.
SPD-Chefin Andrea Nahles sprach mit Bezug auf das Vorgehen der Polizei von einem Skandal. "Das ist leider auch nicht das erste Mal, dass solche Sachen berichtet werden aus Sachsen", sagte Nahles in einem vorab veröffentlichten Interview des Deutschlandfunks.
Entschuldigung von Kretschmer gefordert
Der Grünen-Fraktionschef im Bundestag, Anton Hofreiter, fordert eine Entschuldigung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU). Dieser hatte in einer Twitter-Nachricht die Polizisten in Schutz genommen und die Journalisten indirekt als unseriös bezeichnet.
"Es gibt Probleme in Teilen der sächsischen Sicherheitsbehörden", sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Manche wüssten dort offenbar nicht, wie man bei Demonstrationen mit Journalisten umzugehen hat. "Hier braucht es eine bessere Fort- und Ausbildung", sagte Hofreiter.
Giffey kritisiert NS-Symbole in Computerspielen
Berlin, Köln (epd). Erstmals dürfen verfassungswidrige Symbole in Computerspielen gezeigt werden: Politiker von SPD und Union und der Zentralrat der Juden kritisierten die Regeländerung. "Mit Hakenkreuzen spielt man nicht", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (23. August) in Berlin. Sie verwies auf die "besondere historische Verantwortung" Deutschlands. Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden, Abraham Lehrer, sagte der "Jüdischen Allgemeinen", die Vorstellung eines Videospiels mit Hakenkreuz und Hitlergruß auf der Kölner Messe Gamescom sei "absolut unpassend".
Auch die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), kritisierte die neuen Regeln. "Ich halte das Genre 'Computerspiel' nicht für geeignet, sich angemessen mit dem historischen Unrecht des Nationalsozialismus und dem Leid der Opfer auseinanderzusetzen", sagte sie den Funke-Zeitungen.
Auf der seit dem 21. August in Köln laufenden Computerspielmesse Gamescom wurde das erste Spiel vorgestellt, das NS-Symbole zeigt und von der Prüfstelle Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) zugelassen wurde. Im Spiel "Through the Darkest of Times" versetzen sich die Spieler in die Situation von Widerstandskämpfern im Zweiten Weltkrieg. Uniformierte SS-Männer tragen etwa Armbinden mit Hakenkreuzen.
Lehrer sagte, er sei enttäuscht, dass die Prüfstelle solche Spiele freigebe. "Nach vielen Jahren der guten Arbeit dieser Selbstkontrolleinrichtung wurde jetzt still und leise eine Änderung so gravierender Art vollzogen, ohne die Öffentlichkeit an einer Diskussion zu beteiligen." Er würde sich freuen, wenn die USK ihren Beschluss aussetze und in einen Dialog mit dem Zentralrat der Juden und anderen gesellschaftlichen Gruppen trete. "Und dann sollte die USK am Schluss des offenen Dialoges entscheiden, ob sie bei ihrer Entscheidung bleibt."
Bis Anfang August waren Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Computerspielen verboten. Nach einer neuen Regelung entscheiden die USK-Gremien zur Freigabe von Spielen nun über die sogenannte Sozialadäquanz: Tragen die gezeigten Symbole zu einer adäquaten Darstellung des Zeitgeschehens oder der Geschichte bei, erteilt die USK den Spielen die Altersfreigabe.
Trampender Roboter im Paderborner Computermuseum

epd-bild/Friedrich Stark
Paderborn (epd). Der trampende Roboter "Hitchbot" hat im Heinz-Nixdorf-Museumsforum (HNF) in Paderborn ein Zuhause gefunden. Der Roboter, der als weltweit erster seiner Art mehr als 6.000 Kilometer per Anhalter durch die USA, Kanada, Deutschland und die Niederlande zurückgelegt hat, ist ab jetzt dauerhaft in Paderborn zu sehen, wie das Museum am 21. August mitteilte. Der "Hitchbot", der über soziale Medien von seinen Reisen berichtete, sei ein herausragendes Beispiel für die Relevanz der digitalen Kanäle, erklärte HNF-Geschäftsführer Jochen Viehoff.
Der Roboter besteht aus einem Eimer, Schwimmnudeln, Kinder-Gummistiefeln und einem Tablet-Computer als Hirn. Im neuen Ausstellungsbereich zur Informationsgesellschaft lädt er auf dem Heck eines Oldtimers Besucher zu gemeinsamen Selfies ein. Im Sommer 2015 wurde der Roboter in Philadelphia von einem Unbekannten zerstört und seiner technischen Ausrüstung beraubt. Die Konstrukteure bauten den "Hitchbot" in Kanada wieder auf und übergaben den instandgesetzen Roboter dem Paderborner Museum.
Reise durch Kanada
Zum ersten Mal hatten Wissenschaftler von der Ryerson University in Toronto im Jahr 2014 den "Hitchbot" als soziales Experiment allein als Tramper auf eine Reise durch Kanada geschickt. Im Jahr 2015 war ein Zwilling des autonomen Roboters auch in Europa unterwegs, der in Deutschland etwa Schloss Neuschwanstein und den Kölner Karneval besuchte. Dutzende von Autofahrern nahmen den autonomen Roboter mit.
Das nach eigenen Angaben weltgrößte Computermuseum HNF eröffnet am 26. Oktober den erneuerten Ausstellungsbereich über "Künstliche Intelligenz und Robotik". Präsentiert werde dabei unter anderem der Industrieroboter Beppo, der als Straßenfeger seinen Dienst im Museum erledige. Themen seien zudem Mythen der Robotik wie "C-3PO" oder "HAL" aus den Filmen "Krieg der Sterne" und "2001 - Odyssee im Weltraum".
150 Jahre "Japanfieber"

epd-bild/Pummelpanda
Remagen (epd). Plötzlich trugen die Pariserinnen Kimonos. Sie dekorierten ihre Boudoirs und Salons mit japanischen Holzschnitten und servierten Tee in dünnwandigen Porzellantassen. Das Japanfieber war 1890 in der französischen Hauptstadt ausgebrochen, ausgelöst durch eine Ausstellung ostasiatischer Druckgrafik. Der Virus ergriff auch die damalige Künstler-Avantgarde. Unter dem Titel "Im Japanfieber. Von Monet bis Manga" zeigt das Arp Museum Rolandseck in Remagen seit Sonntag in einer Doppelausstellung den Einfluss der japanischen Kunst auf den Impressionismus und die heutige westliche Alltagskultur.
Im Mittelpunkt der bis zum 20. Januar terminierten Schau steht im ersten Teil Claude Monet, dessen bedeutende Sammlung japanischer Farb-Holzschnitte den Ausgangspunkt der Ausstellung bildet. Hinzu kommen Gemälde weiterer bekannter Maler wie Vincent van Gogh, Paul Signac und Georges Seurat, die in der Kunstkammer Rau des Museums zu sehen sind. Im Bahnhof Rolandseck werden zeitgleich Manga und Anime gezeigt, also japanische Comics und Zeichentrickfilme, die auch Teil der westlichen Alltagskultur geworden sind. Sie sind Auslöser für die heute beliebten "Cosplay"-Veranstaltungen, bei denen sich vorwiegend junge Leute als Manga-Charaktere verkleiden.
Begonnen hat das "Japanfieber" vor 150 Jahren mit der Meiji-Zeit, die die 200-jährige Isolation Japans beendete. Dadurch konnten plötzlich japanische Kunstgegenstände nach Europa gelangen. "Die Begegnung mit Japan bildet eine entscheidende Triebfeder des Impressionismus", erklärt Museumsdirektor Oliver Kornhoff. Die Japan-Begeisterung der Künstler schlug sich etwa in fernöstlichen Requisiten und Porträts von Geishas im Kimono nieder.
Claude Monet war einer der frühesten Sammler japanischer Grafik im 19. Jahrhundert. Die Ausstellung empfängt den Besucher mit einem Blick in das Speisezimmer des Malers. Fotografien dokumentieren, dass die Wände mit japanischen Holzschnitten bedeckt waren. In Rolandseck wurde ein Teil der Monet’schen Sammlung noch einmal so aufgehängt wie in seinem "Salon bleu".
Der Einfluss der Druckgrafiken, mit denen Monet lebte, lässt sich unmittelbar an einigen seiner Gemälde ablesen. Zum Beispiel an den Felsen im Meer, die deutliche Parallelen zu einem japanischen Holzschnitt mit dem Motiv einer Küstenlandschaft erkennen lassen. Da sind die Seerosen und nicht zuletzt die Brücke in Monets japanischem Garten. Die in flirrenden Farben fast zu einer reinen Form verschwimmende Brücke verweist bereits auf die Auflösung der gegenständlichen Malerei. "Der Weg in die Abstraktion führt letztlich auch über Japan", schlussfolgert Kuratorin Susanne Blöcker.
Nicht nur für Monet gehörten japanische Kunstgegenstände offenbar zum Alltag. Auch andere Künstler öffnen mit ihren Gemälden den Blick in japanisch dekorierte Innenräume. Schön zu sehen ist das zum Beispiel an Félix Vallottons Gemälde "Max Rodrigues-Henriques im Atelier seines Stiefvaters Félix Vallotton". Im Hintergrund der dargestellten Szene ist ein Holzschnitt des japanischen Künstlers Kitagawa Untamaro zu sehen. Gleich neben dem Bild hängt eine Reproduktion dieser Druckgrafik.
Paul Signac und William Merritt Chase beispielsweise nehmen die japanischen Accessoires bewusst in ihre Gemälde auf. Sie kleiden ihre Modelle in Kimonos und umgeben sie mit japanischen Gegenständen wie Fächer, Porzellan oder Paravents. Die japanische Geisha stand für sinnliche Exotik.
150 Jahre später ist aus der lasziven oder auch fügsamen Geisha das "Magical Girl" geworden. Geschichten von Mädchen mit übernatürlichen Kräften haben sich als Manga-Genre etabliert. Statt scheu den Blick zu senken, vertreibt etwa das Manga-Mädchen "Seven" nachts ein garstiges Monster aus dem Arp Museum, das sich über die Bilder hermacht. Die bekannte Zeichnerin mit dem Künstlernamen Pummelpanda hat das Manga eigens für die Ausstellung geschaffen.
Der meterlange Comic-Strip bildet den Übergang zum zweiten Teil der Schau, die zeigt, dass der kulturelle Einfluss Japans in Europa bis heute wirkt. Zeichentrickfilme wie "Heidi" oder "Biene Maja" waren Teil der Kindheit von Generationen. Zu sehen sind auch Filmausschnitte aus bekannten neuen Animes.
Nicht zuletzt lädt der zweite Teil der Ausstellung die Besucher auch dazu ein, selbst ein Teil der Manga-Welt zu werden. Es liegen Kostüme bereit, mit deren Hilfe Besucher sich in einen Manga-Charakter verwandeln können. Eine sinnliche Erfahrung bietet auch der vom Gartendesigner Peter Berg entworfene japanische Felsengarten vor dem Arp Museum.
WDR-Mitarbeiter nach Belästigungsvorwürfen wieder im Dienst
Köln (epd). Ein WDR-Mitarbeiter, gegen den Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erhoben wurden, ist inzwischen wieder im Dienst. "Diese Entscheidung erfolgte auf Grundlage des Ergebnisses einer sehr sorgfältigen Prüfung", sagte eine WDR-Sprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Köln und bestätigte damit einen Bericht des "Kölner Stadt-Anzeigers" (21. August). Die Vorwürfe gegen den Mann hätten sich auf Ereignisse aus den 90er Jahren bezogen.
Seit Anfang April hatten verschiedene Medien über mutmaßliche Fälle sexueller Belästigung durch verschiedene WDR-Mitarbeiter berichtet, die in manchen Fällen mehrere Jahrzehnte zurückliegen. Wegen entsprechender Vorwürfe kündigte die Rundfunkanstalt einem langjährigen Auslandskorrespondenten sowie auch dem ehemaligen Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie, Gebhard Henke. Beide Männer reichten Kündigungsschutzklagen vor dem Arbeitsgericht ein. Mit Henke, der über seinen Anwalt selbst an die Öffentlichkeit gegangen war und die Vorwürfe bestreitet, verglich sich der WDR im Juli außergerichtlich. Auch gegen den Mitarbeiter, der jetzt wieder im Dienst ist, waren Vorwürfe erhoben worden.
Die frühere EU-Kommissarin und Gewerkschafterin Monika Wulf-Mathies (SPD) prüft derzeit im Auftrag des WDR, ob sich Vorgesetzte im Zusammenhang mit den Belästigungsvorwürfen Fehlverhalten vorzuwerfen haben. Ihre Untersuchung soll noch im Sommer abgeschlossen werden.
Bibelmuseum untersucht möglichen Lehmziegel vom Turm zu Babel
Münster (epd). Ein historischer Lehmziegel, der zum Turm zu Babel gehören soll, besteht nach Forschungen des Münsteraner Bibelmuseums aus dem in der Bibel beschriebenen Material. Eine Untersuchung mit einem Computertomografen habe ergeben, dass der aus dem heutigen Irak stammende, acht Kilogramm schwere Lehmziegel Pflanzenreste und Halme enthalte, erklärten die Wissenschaftler des Bibelmuseums nach Mitteilung der Universität Münster vom 23. August. Eine schwarze Masse am Ziegel habe sich zudem als Bitumen oder Erdharz herausgestellt, das als Bindemittel im Mauerbau galt.
In der biblischen Überlieferung des Turmbaus zu Babel (1. Mose 10) heißt es: "Und sie sprachen untereinander: Wohlauf, lass uns Ziegel streichen und brennen! und nahmen Ziegel zu Stein und Erdharz zu Kalk und sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reiche." In der biblischen Erzählung bringt Gott den Turmbau durch eine Verwirrung der Sprache zum Stillstand. Das Turmbau-Vorhaben wird als Versuch der Menschheit gedeutet, Gott ebenbürtig werden zu wollen.
Der untersuchte Ziegelstein stammt laut der Universität aus Grabungen Robert Koldeweys aus dem Jahr 1913. Der Bauforscher habe die im Alten Testament und bei Herodot erwähnten Fundamente eines antiken Turms zu Babel in Babylon im heutigen Irak entdeckt. Das Bibelmuseum der Universität Münster habe den einen Stein als Dauerleihgabe erhalten. Die 155 noch erhaltenen Steine aus den Koldewey-Grabungen seien weltweit in vielen Museen verstreut.
Droste-Nachlass kommt ins Westfälische Literaturarchiv
Münster (epd). Der literarisches Nachlass der Autorin Annette von Droste-Hülshoff wird im Westfälischen Literaturarchiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster gelagert und erschlossen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die Universität Münster und der LWL unterzeichneten am 21. August in Münster eine entsprechende Vereinbarung. Damit bleibt einer der wichtigsten literarischen Kulturschätze der Region mit seiner identitätsstiftenden Bedeutung dauerhaft in Westfalen, erklärte der Landschaftsverband.
Die aus Westfalen stammende Dichterin hatte bei ihrem Tod 1848 in Meersburg am Bodensee einen umfangreichen Handschriftenbestand hinterlassen. Zu dem Bestand zählen den Angaben nach die Arbeitsmanuskripte und Reinschriften vieler der bekanntesten Gedichte der bedeutenden Autorin der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. Bislang wurden die Handschriften in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster aufbewahrt. Nun soll die Sammlung im Literaturarchiv des LWL untergebracht werden. Die im Jahr 2001 gegründete Einrichtung hat nach LWL-Angaben bislang mehr als 60 literarische Nachlässe aufgenommen.
Damit schärfe der Landschaftsverband sein Profil als Kristallisationspunkt der internationalen Droste-Hülshoff-Forschung, erklärte der LWL. Mit dem Werk der aus Westfalen stammenden Dichterin sind bereits die LWL-Literaturkommission für Westfalen mit seiner Droste-Forschungsstelle, das Westfälische Literaturarchiv und die Droste-Stiftung auf Burg Hülshoff befasst. Geplant sind unter anderem die Digitalisierung des Droste-Bestandes sowie eine weiterführende Verknüpfung des Handschriftenbestandes mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen über ein Internet-Portal.
Der "Meersburger Nachlass" der Dichterin wurde bis 1905 von der Familie von Laßberg in Meersburg und anschließend bis 1967 von der Familie von Droste-Hülshoff in Haus Stapel bei Havixbeck verwahrt. 1967 wurde der Bestand für die öffentliche Hand erworben und für den symbolischen Kaufpreis von einer Mark an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben. Ein 1967 unterzeichneter Dauerleihvertrag mit der Westfälischen Wilhelms-Universität sicherte den Verbleib des Nachlasses in Münster. Er befand sich seitdem als Dauerleihgabe der Berliner Staatsbibliothek - Stiftung Preußischer Kulturbesitz in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
Die westfälische Dichterin Annette von Droste-Hülshoff wurde 1797 auf dem Wasserschloss Burg Hülshoff in Havixbeck geboren. Zu Lebzeiten weitgehend unbekannt gehört ihr Werk mit der Novelle "Die Judenbuche" heute zur Weltliteratur.
Neue "Spiegel"-Chefredaktion soll Print und Online zusammenführen

epd-bild / Stephan Wallocha
Hamburg (epd). Nach jahrelangen Diskussionen legt der "Spiegel" die Redaktionen des gedruckten Magazins und des Nachrichtenportals "Spiegel Online" im Januar 2019 zusammen. Vorsitzender der Chefredaktion der neuen Einheit wird Steffen Klusmann (52), wie der Spiegel-Verlag am 22. August in Hamburg mitteilte. Der Chefredakteur des "Manager Magazins" löst damit Klaus Brinkbäumer (51) ab, der nach dreieinhalb Jahren als Print-Chefredakteur aus dem Amt scheidet. Mit ihm werden "Gespräche über eine neue Aufgabe" geführt. Ebenfalls zur neuen Chefredaktion gehören Barbara Hans (37), bisher Chefredakteurin von "Spiegel Online", und Ullrich Fichtner (53), Reporter im Ressort Gesellschaft des gedruckten Magazins.
Geschäftsführer Thomas Hass hatte die Zusammenlegung der bisher getrennt arbeitenden Redaktion bereits im April avisiert, sich dabei aber nicht zu Personalien geäußert. Die neue Chefredaktion solle sich "formieren als ein Team, das die Aufgaben nach fachlichen und funktionalen Aspekten aufteilt, nicht mehr nach Medienkanälen", teilte der Verlag nun mit. Dadurch solle der "Spiegel" als "Leitmarke für exzellenten, unabhängigen, investigativen Journalismus in Deutschland" gestärkt werden, sagte Hass. Die Chefredaktion wird mit der Reform auch der Unternehmensleitung angehören.
Viermonatige Übergangszeit
In den kommenden Wochen soll die designierte Chefredaktion die geplante Redaktionsstruktur ausarbeiten. Gemeinsam mit der Geschäftsführung werde sie "einen Veränderungsprozess aufsetzen, der sorgfältig gemeinsam mit den Führungskräften und den Betriebsräten vorbereitet und beraten wird". In der Zeit des Übergangs bis Januar 2019 sollen die zurzeit amtierenden Chefredaktionen das Nachrichtenmagazin und das Portal weiter verantworten. Ob Brinkbäumer aber wirklich vier Monate lang als "lame duck" im Amt bleibt, scheint mindestens fraglich.
Kürzlich waren bereits Weichen für die Zusammenlegung der Redaktionen gestellt worden. Die frühere Spiegel Online GmbH firmiert nun als Spiegel Online GmbH & Co. KG und ist damit eine direkte Tochter des Verlags. Dadurch können Magazin und Nachrichtenportal vom Finanzamt als ein Steuersubjekt gemeinsam veranlagt werden.
Der radikale personelle Umbau kommt überraschend, denn Insidern zufolge haben sich die Zahlen des im Mai neu aufgestellten digitalen Bezahlangebots "Spiegel Plus" zuletzt gut entwickelt. Der gedruckte "Spiegel" hat allerdings seit Jahren mit herben Auflagenverlusten zu kämpfen. Im zweiten Quartal dieses Jahres verkaufte das Magazin pro Ausgabe noch 704.656 Exemplare, das waren fast acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Anzeigenbuchungen sind rückläufig. Im Jahr 2017 wurden bei Werbung und Vertrieb insgesamt rund elf Millionen Euro weniger erwirtschaftet als im Vorjahr.
Der Impuls für die Ablösung Brinkbäumers ging nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes (epd) von der Mitarbeiter KG aus, mit der die Belegschaft 50,5 Prozent der Anteile am Verlag hält. Erforderlich war dafür eine Einigung mit dem Minderheitsgesellschafter Gruner + Jahr, der 25,5 Prozent hält: Bei der Besetzung von Führungspositionen muss laut Gesellschaftervertrag eine Mehrheit von 76 Prozent unter den Eigentümern erreicht werden. Die Erben des Magazingründers Rudolf Augstein haben mit ihren 24 Prozent formell kein Mitspracherecht.
Früher Chef der FTD
Klusmann, lange Chefredakteur bei der inzwischen eingestellten Wirtschaftszeitung "Financial Times Deutschland" von Gruner + Jahr, soll beim "Spiegel" dem Vernehmen nach auch die Sparanstrengungen fortsetzen. Da das "Manager Magazin" ebenfalls zur Spiegel-Gruppe gehört, dürfte ihm die Finanzsituation des Gesamtkonzerns gut bekannt sein. "Spiegel"-Geschäftsführer Hass hatte Ende 2015 eine "Agenda 2018" angekündigt, wonach bei dem Nachrichtenmagazin 149 von 727 Stellen wegfallen - 35 in den Redaktionen, 100 im Verlagsbereich und 14 in der Dokumentation. Personal- und Sachkosten sollen so um 15 Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden.
Brinkbäumer war Anfang 2015 als Nachfolger von Wolfgang Büchner angetreten, der mit der Print-Redaktion über Kreuz lag und nach nur 15 Monaten abgelöst wurde. Der inzwischen beim Madsack-Konzern beschäftigte Büchner hatte ebenfalls den Plan, die Redaktionen von Print und Online stärker zusammenzuführen, stieß aber mit seinem Führungsstil auf scharfe Kritik. Brinkbäumer wiederum wurden Konflikte mit dem neuen Leiter Produktentwicklung der Spiegel-Gruppe, Stefan Ottlitz (früher Plöchinger), nachgesagt. Ottlitz war erst Anfang des Jahres von der "Süddeutschen Zeitung" zum "Spiegel" gewechselt. Auch er wird künftig der Unternehmensleitung angehören.
Landschaftsverband kürt Paderborner Orgel zum Denkmal des Monats
Paderborn (epd). Die Orgel in der Paderborner Kirche St. Georg ist vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zum Denkmal des Monats gekürt worden. Das Instrument sei eines der bedeutendsten westfälischen Zeugnisse der Orgelbaukunst des 19. Jahrhunderts, erklärte der LWL-Denkmalpfleger und Orgel-Experte Christian Steinmeier am 24. August in Münster. Das Kircheninstrument, das auf einer Empore über dem Haupteingang der Kirche steht, wurde von dem Orgelbaumeister Friedrich Bernhard Meyer (1829 - 1897) um das Jahr 1887 herum gebaut.
Die Orgel der katholischen Kirche St. Georg sei die letzte vollständig erhaltene Orgel mit mechanischer Kegellade aus der Werkstatt von Friedrich Bernhard Meyer, erklärte der Denkmalpfleger. Über den hölzernen Kasten - der Windlade - werde Druckluft zu den einzelnen Orgelpfeifen geleitet. Damit sei man dem Klangideal der Romantik sehr nahegekommen und habe das Gestalten großer kompositorischer Klangflächen ermöglicht. Neuerungen des technischen Fortschritts und eine geringe Wertschätzung der Instrumente der Romantik hätten ab den 1920er Jahren jedoch dazu geführt, dass nur sehr wenige Orgeln mit mechanischer Kegellade erhalten seien.
Die Orgel war den Angaben zufolge zunächst für eine andere Paderborner Kirche gedacht. In die Kirche St. Georg zog das Kircheninstrument erst im Jahr 1979 um. Die im Jahr 1936 entstandene katholische Kirche St. Georg habe wegen starker Umgestaltungen keinen Denkmalwert, erklärte der LWL. Die Orgel sei jedoch eine wahre Rarität und werde bald in die Denkmalliste eingetragen, erklärte der LWL.
Schau beleuchtet Marlene Dietrichs Verhältnis zu Nazideutschland
Dorsten (epd). Das Jüdische Museum Westfalen beleuchtet seit dem 26. August das Verhältnis Marlene Dietrichs zu Nazideutschland und den Deutschen. Unter dem Titel "Marlene Dietrich. Die Diva. Ihre Haltung. Und die Nazis" wird die Haltung der Schauspielerin und Sängerin gegenüber den Nationalsozialisten und der deutschen Nachkriegsgesellschaft in den Fokus gerückt, wie das Museum mitteilte. Neben vielen Fotografien aus dem Leben der Diva (1901-1992) sind laut Museum zahlreiche Dokumente und weitgehend unbekannte Filmsequenzen zum Thema zu sehen.
Die gebürtige Berlinerin ging noch vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten nach Hollywood. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 ließ sich Dietrich auf keine Zusammenarbeit mit dem NS-Propagandaministerium ein. Stattdessen half sie deutschen Flüchtlingen im Exil.
Im Jahr 1939 wurde Dietrich US-amerikanische Staatsbürgerin und unterstützte aus den USA aktiv den Kriegseinsatz gegen Nazi-Deutschland. Ihr Einsatz für die Amerikaner sei ihr bei ihrer Deutschland-Tournee 1960 in der deutschen Öffentlichkeit vorgeworfen worden, erklärte das Museum. In Israel sei sie zur gleichen Zeit für ihre Haltung gefeiert worden. Die mit Unterstützung der Marlene Dietrich Collection Berlin entstandene Wanderausstellung ist in Dorsten bis zum 16. Dezember zu sehen.
"Tatort"-Erfinder Gunther Witte gestorben

epd-bild/Jürgen Blume
Köln, Berlin (epd). Der langjährige Fernsehspielchef des WDR, Gunther Witte, ist tot. Er starb am 16. August im Alter von 82 Jahren unerwartet in Berlin, wie der Sender am 20. August unter Berufung auf Wittes Familie dem epd bestätigte. Witte hatte als WDR-Redakteur die Krimireihe "Tatort" erfunden, die seit 1970 im Ersten läuft. Von 1979 bis zu seinem Ruhestand 1998 war er Fernsehspielchef beim WDR.
Witte wurde 1935 im lettischen Riga geboren. In Ostberlin studierte er in den 1950er Jahren an der Humboldt-Universität Germanistik und Theaterwissenschaften. Ab 1963 arbeitete er als Redakteur und Dramaturg für die Fernsehspielabteilung des WDR. Dort entwickelte er im Auftrag des damaligen Fernsehspielchefs Günter Rohrbach die Idee zum "Tatort".
"Ausgelöst wurde das durch die Erfolge des ZDF in der Unterhaltung. Ich wusste gar nicht, was mich prädestiniert, mir etwas auf dem Gebiet des Krimis auszudenken", sagte Witte vor zwei Jahren dem Evangelischen Pressedienst (epd). Drei Kriterien nannte der "Tatort"-Erfinder zur tausendsten Folge im Herbst 2016 als grundlegend für die Reihe: Regionalität, die führende Rolle des Kommissars und Geschichten, "die mit unserer Realität zu tun haben". Doch dass der "Tatort" sich so lange gehalten habe, habe auch damit zu tun, dass junge Autoren und Regisseure ständig versuchten, die Grenzen des Genres zu erweitern und zu überschreiten, sagte er.
Produzierte Fassbinders "Alexanderplatz"
WDR-Intendant Tom Buhrow würdigte Witte als "eine der herausragenden Persönlichkeiten des Fernsehspiels". Mit seiner einzigartigen Erfindung der "Tatort"-Reihe habe er den WDR und das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer. "Das, was er geschaffen hat, bleibt und wird unsere Zuschauer weiterhin bereichern", sagte Buhrow.
Neben dem "Tatort" war Witte an vielen weiteren Fernsehfilmproduktionen des WDR beteiligt, als Produzent etwa an Volker Schlöndorffs "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" (1975) und an Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" (1980). In seine Zeit als Fernsehspielchef fiel auch der Start der Serie "Lindenstraße" 1985. Witte wurde 2001 mit der Besonderen Ehrung des Grimme-Preises ausgezeichnet.
Entwicklung
Dr. Lul gibt nicht auf

epd-bild/Bettina Rühl
Mogadischu (epd). Die Kinderärztin Lul Mohamud Mohamed wirkt etwas müde, als sie die Treppe in den ersten Stock des Banadir-Krankenhauses in Mogadischu hinaufsteigt. Aber die 56-Jährige ist ausdauernd wie eine Marathonläuferin. Deshalb geht sie einfach weiter, obwohl übervolle Arbeitstage und deprimierende Patientenschicksale an ihr zehren. "Für unterernährte Kinder haben wir im ersten Stock eine eigene Station", erklärt die Leiterin der Kinderabteilung in dem Krankenhaus in der somalischen Hauptstadt, das auf Mütter und Kinder spezialisiert ist. "Da kriegen wir in der letzten Zeit eher wieder mehr Patienten als weniger."
Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, denn einige Viertel von Mogadischu wirken geradezu, als boome die Wirtschaft. Immer mehr Hotels und Geschäftshäuser werden hochgezogen, und im vergangenen Jahr wurde die einigermaßen luxuriöse "Mogadishu Mall" errichtet, ein Einkaufzentrum mit spiegelnden Fliesen und den bislang einzigen Rolltreppen des Landes. Aber trotz des neuen Reichtums habe sich die Lage der Bevölkerung kaum verbessert, meint Lul Mohamud Mohamed: "Die Schere zwischen Arm und Reich wird nur größer."
Auf dem Weg in die Klinik gestorben
Die Ärztin steht jetzt im ersten Krankenzimmer der Ernährungsstation. Alle Betten sind belegt, die Mütter wachen über die kleinen, knochigen Körper. Die Medizinerin in weißem Kittel und braunem Kopftuch geht auf das Bett der kleinen Amina zu, die seit drei Tagen hier ist. Das Mädchen ist vier Monate alt und wiegt nur gut vier Kilo. "Sechs wären in ihrem Alter normal", sagt Lul. Dass sie sich um den Säugling sorgt, steht ihr ins Gesicht geschrieben.
Die Kleine hat wässrigen Durchfall. Ihre Mutter, die 18-jährige Sadia, wirkt ebenfalls geschwächt und fast zerbrechlich. Auch sie ist krank, außerdem in Sorge um Amina und zugleich voller Trauer: Auf dem Weg ins Krankenhaus ist ihr zweijähriger Sohn Mohamed gestorben. Er war durch wässrigen Durchfall völlig ausgezehrt. "Häufig kommen die Menschen einfach zu spät zu uns", sagt die Kinderärztin bedauernd. Sadia ist mit ihren Kindern vor neun Monaten aus einem der vielen umkämpften Gebiete in Somalia geflohen und kam nach Mogadischu. Landesweit sind etwa 800.000 Somalier auf der Flucht vor Hunger, Dürre, Überschwemmung und Krieg.
Auf der Ernährungsstation hört Lul Mohamud Mohamed viele Geschichten, die Sadias Schicksal ähneln. 40 Prozent ihrer Patienten seien Vertriebene, sagt die Ärztin. Sie litten unter vermeidbaren Krankheiten wie Durchfall, Masern, Unterernährung oder Gehirnhautentzündung. "Durch Impfkampagnen könnte man viele unnötige Tode leicht verhindern", sagt die Medizinerin. Sie betreut 120 Betten, schon seit längerem seien immer alle belegt, meistens mit Notfällen. "Eine Nacht, in der bei uns kein Kind stirbt, ist eine gute Nacht."
Fachärztin in Deutschland
Die Kindersterblichkeit in Somalia gehört seit Jahren zu den höchsten der Welt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stirbt eins von sieben Neugeborenen, ehe es fünf Jahre alt wird. Auch die Müttersterblichkeit ist dramatisch. Von 100.000 Gebärenden überleben 1.600 die Geburt ihres Kindes nicht. Die wichtigste Ursache dafür ist der jahrzehntelange Bürgerkrieg, der alle staatlichen Strukturen und auch das Gesundheitswesen zerstört hat. Die islamistische Shabaab-Miliz kontrolliert etliche Landesteile, kämpft gegen die schwache Regierung unter Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" und verübt regelmäßige Anschläge.
Lul Mohamud Mohamed versucht seit Jahrzehnten, dem großen Sterben etwas entgegenzusetzen. Noch bevor der Bürgerkrieg 1991 in Somalia begann, studierte sie Medizin in Mogadischu. Mit Hilfe eines Stipendiums machte sie ab 1996 ihren Facharzt als Kinderärztin in Deutschland. Von Berlin zog sie 1999 zunächst nach London, wurde britische Staatsbürgerin und kehrte sechs Jahre später nach Somalia zurück. Das war 2005, und ihr Land lag in Trümmern. "Aber meine Mutter war noch hier, um die ich mich kümmern musste", erklärt die Ärztin. "Und außerdem gab es kaum noch Ärzte, ich wurde gebraucht."
Das Banadir-Krankenhaus war damals geschlossen, mangels Personal. Die Ärztin machte sich daran, wenigstens die Pädiatrie wieder aufzubauen. Von den heute 30 Ärztinnen und Ärzten der Abteilung habe sie die meisten geschult, sagt Mohamed. Hilfsorganisationen halfen und helfen mit Medikamenten, medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterial. Von der somalischen Regierung bekomme sie keinerlei Unterstützung, obwohl das Banadir-Krankenhaus dem Gesundheitsministerium offiziell untersteht.
Über die Untätigkeit der Regierung ist die klein gewachsene Ärztin häufig wütend. Davon entmutigen lässt sie sich nicht. Lul Mohamud Mohamed kämpft jeden Tag neu um das Leben jedes Kindes auf ihrer Station.
Kongo: Regierung billigt Einsatz experimenteller Ebola-Medikamente
Genf, Kinshasa (epd). Im Kongo kämpft die Regierung mit noch nicht zugelassenen Medikamenten gegen das tödliche Ebola-Fieber. Den Einsatz von vier neuen Wirkstoffen, die sich noch in der Testphase befinden, habe der zuständige Ethikrat genehmigt, teilte das Gesundheitsministerium in der Hauptstadt Kinshasa am 22. August mit. So sei ein Patient in der Stadt Beni am Dienstag mit dem Wirkstoff Remdesivir behandelt worden.
Ein fünfter Wirkstoff, der ebenfalls noch nicht abschließend getestet wurde, wurde in den vergangenen zwei Wochen zehn Patienten verabreicht. Die Zahl der Ebola-Verdachtsfälle im Osten Kongos stieg bis Dienstag auf 102. Davon sind 75 klinisch bestätigt, 27 wahrscheinlich. Weitere neun Verdachtsfälle werden derzeit noch untersucht. Bislang gibt es mindestens 44 Tote. Nach Angaben der kongolesischen Regierung sind fast 1.700 Personen gegen Ebola geimpft worden, die im Kontakt mit Erkrankten standen.
Bis zu 300.000 Menschen bedroht
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte erklärt, es sei nicht sicher, ob bereits alle Ansteckungswege aufgedeckt worden seien. Umso wichtiger sei es, auch in abgelegenen Gegenden nach jedem einzelnen Erkrankten zu suchen, um eine Ausbreitung zu verhindern.
Ebola wird durch Körperflüssigkeiten übertragen und kann zum Tod führen. Bisher gibt es noch kein Heilmittel und keine abschließend getestete Schutzimpfung. Hilfsorganisationen zufolge sind im Grenzgebiet zu Uganda bis zu 300.000 Menschen bedroht. Die anhaltende Gewalt und die unzureichende Ausstattung der Gesundheitseinrichtungen im Osten Kongos behindern die Eindämmung der Krankheit.
Es ist das zehnte Mal, dass das Ebola-Fieber im Kongo grassiert. Erst am 24. Juli war ein Ausbruch in der nordwestlichen Provinz Equateur für beendet erklärt worden. Damals waren 54 Verdachtsfälle gemeldet worden und 33 Menschen gestorben. Bei der bislang schlimmsten Ebola-Epidemie 2013/2014 kamen in Guinea, Sierra Leone und Liberia insgesamt 11.300 Menschen ums Leben. Die WHO hatte den Ausbruch damals unterschätzt und wurde massiv kritisiert.
Das Wasser und Whatsapp
Allein Whatsapp hat in Indien über 200 Millionen Nutzer. Informationen breiten sich rasend schnell aus - sowohl die richtigen als auch die falschen. Mit gravierenden Folgen. Die Flut im indischen Kerala zeigt die Macht der sozialen Medien.Dubai, Neu-Delhi (epd). Der indische Bundesstaat Kerala leidet unter den schlimmsten Überschwemmungen seit 100 Jahren. Doch neben dem Wasser macht auch eine Flut an Nachrichten in den sozialen Medien der Regierung und Rettungskräften zu schaffen. Die Katastrophe zeigt erneut die enorme Macht der sozialen Medien.
Als die Wassermassen vor zwei Wochen kamen, hatte niemand eine Übersicht: Rettungsappelle und Hilferufe wurden wieder und wieder gepostet. Dies führte in den ersten Stunden zu Chaos. So überflog ein Rettungshubschrauber ein vom Wasser eingeschlossenes Haus, aus dem bereits alle Bewohner evakuiert worden waren. Mehr als 200 Menschen sind seit dem Beginn heftiger Regenfälle im südwestlichen Bundesstaat Kerala ums Leben gekommen. Mehr als eine Million Bewohner harren in Notlagern aus.
"Wir mussten einfach einen Weg finden", erklärt der 32-jährige Nair Prasanth. Als die Bilder von der verheerenden Überschwemmung im südindischen Kerala die Runde machten, beschloss der Verwaltungsangestellte in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi zu handeln, wie er indischen Medien erzählte. Mit Freunden in den USA und Großbritannien richtete er einen virtuellen Kontrollraum ein und begann Facebook-Seiten, Whatsapp-Gruppen und Twitter-Feeds zu durchkämmen.
Hilfe virtuell organisieren
Prasanth wollte die Dinge ordnen, eine Übersicht schaffen, um die Menschen in Not so schnell wie möglich zu orten und ihre Rettung zu koordinieren. Rasch hatte er über die sozialen Medien mehr als 6.000 Helfer engagiert, die meisten junge IT- Leute, Schüler und Studenten. Sie füllten Excel-Tabellen und Google-Bögen mit Namen und Adressen von Menschen in Not, verifizierten Daten und suchten nach Orten und Dörfern in Google-Maps. Es sei darum gegangen, Informationen zu sammeln, auszutauschen und weiterzugeben, sagt Prasanth.
Dabei spielt es keine Rolle, wo die Helfer sitzen: Sreejith Parappayi, ein Inder in Malaysia, kreierte die Facebook-Seite "Kerela safe roads", wo er Updates über die Situation im Bundesstaat veröffentlicht, um den Betroffenen im Flutgebiet Informationen darüber zu geben, welche Straßen unter Wasser stehen und wo noch Züge fahren. Andere erarbeiteten die Karte "Keralarescue", in denen die über 3.000 Notlager verzeichnet sind, die obdachlose Flutopfer aufnehmen.
Doch wo die sozialen Medien sich als Retter in der Not erwiesen, gab es auch dunkle Seiten: So machte ein Audio-Clip die Runde, worin behauptet wurde, die Flut habe nur wohlhabende Familien getroffen, und es gebe keinen Grund, Geld oder Kleider und Lebensmittel zu spenden. Auf Facebook fanden sich hetzerische Appelle wie "Spendet nicht für Kerala. Mehr als die Hälfte der Leute dort sind Christen und Muslime. Lasst sie leiden. Sie glauben an den falschen Gott." Und dann gab es Nachrichten über berstende Staudämme, die Panik unter der Bevölkerung erzeugen sollten.
Falschmeldungen enden nicht selten tödlich
Irreführende und falsche Nachrichten in den sozialen Medien sind in Indien weit verbreitet. Oft sind es nur harmlose Scherze, doch manchmal enden solche Nachrichten tödlich. Auf dem in Indien beliebte Messenger-Dienst Whatsapp etwa werden seit Monaten falsche Informationen über angebliche Geiselnahmen von Kindern verbreitet. "Lasst diese Leute in dem roten Auto nicht entkommen! Sie kidnappen Kinder", forderte eine Nachricht, die Mitte Juli an zahlreiche Whatsapp-Gruppen ging. Nur eine halbe Stunde später war ein 32-jähriger Software-Ingenieur tot, der im Bundesstaat Maharashtra unterwegs war. Seine drei Kollegen wurden schwer verletzt.
Mindestens 20 unschuldige Menschen sind in Indien seit Juni gelyncht worden, nachdem solche Nachrichten in Dörfern die Runde machten. Indiens Regierung führt derzeit Verhandlungen mit der Firma Whatsapp, um die Flut falscher Informationen auf der Plattform einzudämmen - bislang mit mäßigem Erfolg. Der Dienst hat in Indien mehr als 200 Millionen Nutzer.
Im Juli hat Whatsapp in Indien neue Regeln eingeführt, um das Verbreiten von Falschinformationen zu erschweren. Die Anzahl der Nutzer, an die eine Nachricht geschickt werden kann, wurde beschränkt. Doch Indiens Regierung ist nach wie vor der Ansicht, die Social-Media-Giganten müssten mehr tun, um die Inhalte auf ihren Plattformen zu kontrollieren.
Ohne Perspektive in Bangladesch

epd-bild/Nicola Glass
Cox's Bazar (epd). "Hals über Kopf mussten wir unsere Heimat verlassen", sagt Alinesa, die der Hölle in Myanmar mit ihren zwei Kindern entkam. Soldaten mordeten, vergewaltigten, folterten und machten ihr Dorf dem Erdboden gleich. Nach Monaten habe sie immer noch die brennenden Häuser vor Augen und das Dröhnen der Schüsse in den Ohren, schildert die Rohingya-Frau ihre anhaltenden Qualen. Ihren vollen Namen möchte sie nicht genannt wissen.
Mehr als 700.000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit flüchteten wie Alinesa seit Ende August vergangenen Jahres vor der brutalen Militäroffensive in ihrer Heimat ins Nachbarland Bangladesch. Etwa 70 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. In den Camps von Cox's Bazar, in denen nach mehreren Wellen gewaltsamer Vertreibung aus Myanmar nun eine Million Rohingya ausharren, versuchen sie, wieder Hoffnung zu schöpfen.
Dabei helfen ihnen Sozialarbeiter wie Rohima Begum. Die junge Frau mit der schwarzen Kleidung und dem pinkfarbenem Kopftuch ist für das katholische Hilfswerk Caritas tätig. Wichtig ist zunächst eine Atmosphäre des Vertrauens - schwer für die traumatisierten Flüchtlinge. In Gesprächen versichert Rohima Begum den Menschen immer wieder: "Wir sind für euch da, habt keine Angst."
Sexuelle Gewalt als Waffe
In Krisen und Konflikten sind Frauen und Kinder oft besonders gefährdet. Vor allem dann, wenn Täter wie myanmarische Soldaten und Milizen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einsetzen. Mitte Mai verwiesen Hilfsorganisationen darauf, dass Zehntausende Frauen in den Flüchtlingslagern von Bangladesch bald ein Kind zur Welt bringen werden. Viele von ihnen seien Vergewaltigungsopfer. Andere Frauen machten sich schon als Schwangere auf die Flucht. Bis Mai seien in den Camps bereits mehr als 16.000 Babys zur Welt gekommen, meldeten die Helfer. Aber der Platz ist begrenzt.
In Sicherheit sind die Rohingya, und vor allem die Frauen und Kinder, trotz aller Bemühungen beileibe nicht. Auch in den Lagern drohen ihnen große Gefahren: Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung. Die Internationale Organisation für Migration erklärte Ende Juli, sie habe bislang 78 Opfer von Menschenhandel identifiziert. Sie geht aber von einer beträchtlichen Dunkelziffer aus.
Wege aus dem Lager gibt es kaum. Das buddhistisch dominierte Myanmar verweigert den Rohingya die Bürgerrechte, und das muslimische Bangladesch, das zu Recht für seine offenen Grenzen gelobt wird, registriert sie nicht offiziell als Flüchtlinge. So könnten Erwachsene sich kein Leben außerhalb der Camps aufbauen und Kinder keine reguläre Schule besuchen, kritisiert Bill Frelick, Flüchtlingsexperte der Organisation Human Rights Watch.
Zwar gebe es sogenannte Lernzentren, die hielten aber nur zwei Stunden Unterricht täglich. Auch besuche bloß ein Viertel der schulpflichtigen Kinder diese Zentren. Somit erhielten etwa 400.000 Kinder und Jugendliche keine richtige Ausbildung. Gerne würde er arbeiten oder sich weiterbilden, sagt der junge Mohammed Akram wehmütig. Helfer vor Ort sprechen von einer verlorenen Generation.
Keine dauerhaften Unterkünfte
Sorge bereitet den Hilfsorganisationen auch das Wetter. Schon vor der Monsunzeit wurde versucht, die Flüchtlinge vor Erdrutschen und Tropenstürmen zu schützen und die zumeist notdürftigen Behausungen zu befestigen. Das aber erlaubt das arme Bangladesch nur bis zu einem gewissen Grad. Keinesfalls will die Regierung den Eindruck erwecken, dass hier dauerhafte Unterkünfte entstehen. Nach außen beharrt Dhaka darauf, dass die Aufnahme Hunderttausender Rohingya nur vorübergehend ist, um den Druck auf Myanmar aufrecht zu erhalten.
Indes hat Myanmar wohl entgegen aller öffentlichen Beteuerungen keine Absicht, die Menschen wieder aufzunehmen. So war die Militäroffensive, die viele Kritiker mittlerweile als Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnen, nach Recherchen von Menschenrechtlern von langer Hand vorbereitet.
Die Organisation "Fortify Rights" dokumentierte kürzlich Massenmorde, Vergewaltigungen und Brandanschläge durch Soldaten bereits 2016. Dies widerspreche der Darstellung Myanmars, wonach die Offensive "spontan" initiiert worden sei, nachdem die militante Rohingya-Organisation Arsa vor einem Jahr Polizeiposten angegriffen hatte. Wie alle anderen Flüchtlinge betont auch Mohammed Akram: "Wir gehen nur zurück, wenn Myanmar uns die Staatsbürgerschaft garantiert."

