Kirchen
Rheinische Kirchenjugend will mehr Mitsprache

epd-bild/Hans Jürgen Vollrath
Bad Neuenahr (epd). Mit Forderungen nach mehr Beteiligung junger Menschen in der Kirche und Unterstützung für minderjährige Flüchtlinge ist am 6. Januar die erste rheinische Jugendsynode zu Ende gegangen. "Wir haben dieser Generation bisher zu wenig Raum gegeben und zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten", sagte Präses Manfred Rekowski am Ende der dreitägigen Beratungen im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. "Das wollen wir jetzt ändern." Die rheinische Jugendsynode gilt als Vorreiter in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Die Bedürfnisse junger Leute sollten künftig bei allen Entscheidungen berücksichtigt werden, sagte auch Fiona Paulus, Vize-Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland: "Fast alle Beschlüsse haben Auswirkungen auf Jugendliche und junge Erwachsene."
Landessynode nimmt Beschlüsse auf
Konkret fordert die Jugendsynode eine Beteiligungsquote von 50 Prozent junger Menschen in zu gründenden Jugendausschüssen der 37 rheinischen Kirchenkreise sowie im synodalen Fachausschuss Jugend. Der Austausch zwischen Landeskirche und jungen Mitgliedern müsse intensiviert werden. Auch sollten die Kirchenkreise mehr junge Leute zur Landessynode entsenden, fordern die Jugendsynodalen.
Die Landessynode, das oberste Organ der mehr als 2,5 Millionen Mitglieder zählenden rheinischen Kirche, berät nun im Anschluss an die Jugendsynode bis zum Freitag auch über die Beschlüsse des Jugendgremiums. "Das, was hier beschlossen wurde, muss jetzt von der Synode behandelt werden", sagte Rekowski. Zur rheinischen Kirche gehören rund 650.000 getaufte Kinder und Jugendliche. An der Jugendsynode nahmen je 50 Delegierte der Landessynode und der evangelischen Jugend sowie zehn weitere Kirchenvertreter teil.
Mit Blick auf die Flüchtlingssituation an den EU-Außengrenzen plädiert die Jugendsynode für mehr Unterstützung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. "Sie bedürfen des besonderen Schutzes vor Missbrauch, Menschenhandel und Ausbeutung", heißt es in einem Beschluss. Konkrete Projekte wie die kirchliche Anlaufstelle für junge Migranten in der marokkanischen Stadt Ouja sollten dauerhaft gefördert werden.
Beim Thema Kinder- und Jugendarbeit ging es auch um eine finanzielle Förderung der Arbeit in strukturschwachen Regionen. Die Landessynode wurde aufgefordert zu prüfen, ob befristete Anschubfinanzierungen, eine dauerhafte Förderung oder zusätzliche Ko-Finanzierungen sowie Fundraising am besten seien.
Zur Verringerung der Jugend- und Familienarmut fordert die Jugendsynode niedrigschwellige lokale Servicestellen zur umfassenden Beratung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien. Die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen sei besonders stark von Armut gefährdet, hieß es. Fiona Paulus mahnte zudem eine Kultur des Helfens an, die die Jugendlichen nicht zu Bittstellern macht. Es brauche eine gleichwertige Begegnung.
Gemeindepädagoge: Kirche hat Relevanzproblem
Der Gemeindepädagoge Wolfgang Ilg sagte am 4. Januar, junge Menschen bewerteten die Kirche positiv. Ihnen fehle aber der Bezug zum eigenen Leben. "Kirche hat nicht in erster Linie ein Imageproblem, sondern ein Relevanzproblem", erklärte der Professor für Jugendarbeit und Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg.
Ilg präsentierte in Bad Neuenahr eine für die Jugendsynode erstellte Sonderauswertung eines Forschungsprojekts an der Universität Freiburg, das für jede evangelische Landeskirche und katholische Diözese langfristige Projektionen von Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteueraufkommen bis 2060 vornimmt. Der Untersuchung zufolge nehme die Kirchenmitgliedschaft eines Konfirmationsjahrgangs in den 25 Jahren nach der Konfirmation um etwa ein Viertel ab, sagte Ilg. Die Kirche müsse fragen, welche positiven Erfahrungen in den Jahren zwischen 14 und 28 fehlten, um der Kirche treu zu bleiben.
Jugenddelegierte und Landessynodale hätten auf Augenhöhe beraten, bilanzierte die Jugenddelegierte Paulus zum Schluss. Nun gehe es darum, die Ergebnisse auszuwerten. Ob es weitere Jugendsynoden geben soll oder die Interessen junger Leute auf andere Weise vertreten werden, blieb am Ende der Beratungen offen. Generell spreche nichts gegen eine weitere Jugendsynode, sagte Rekowski.
Rheinische Jugendsynode ebnet neue Wege
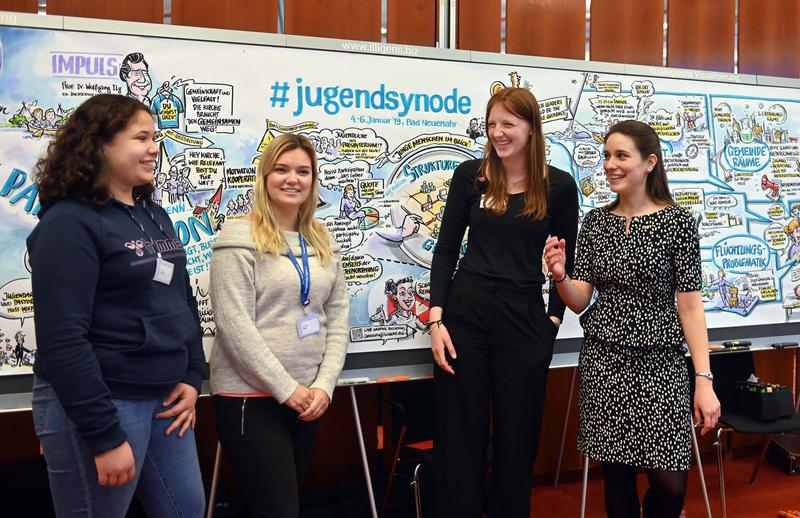
epd-bild/Hans Juergen Vollrath
Bad Neuenahr (epd). Emilia Zaghloul ist mit der Premiere zufrieden: "Wir konnten viel bewirken und haben Beschlüsse gefasst", sagte die 15-jährige Schülerin aus Aachen am 6. Januar zum Abschluss der ersten Jugendsynode in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Teenagerin mit dunklen Locken war eine der jüngsten unter den 110 Teilnehmern des dreitägigen Treffens. Erwartet hatte sie förmliche Diskussionen. Doch es seien Gespräche auf Augenhöhe zwischen Jüngeren und Älteren gewesen, sagt die Zehntklässlerin.
Lebhaft und engagiert diskutierten die Jugendsynodalen, die in dieser Form in der evangelischen Kirche bundesweit einmalig war, in dem rheinland-pfälzischen Kurort in Bad Neuenahr drei Tage lang vor allem über mehr Einfluss für die kirchliche Jugend. Es sei keine Jugendlichensynode gewesen, betonte Mitorganisator Jan Ehlert: Dem Gremium gehörten je 50 Delegierte der evangelischen Jugend und der rheinischen Landessynode an, neben jungen Gesichtern fanden sich auch einige ergraute Häupter.
Emilia Zaghloul ist nach der Erfahrung von Bad Neuenahr motiviert, sich weiter in die Kirche einzubringen. Dafür brauche sie aber noch mehr Informationen. "Wenn ich nicht direkt angesprochen werde, komme ich nicht auf die Idee, dass sie mich vielleicht brauchen könnten", sagt die Schülerin.
Engagiert
Ähnlich ergeht es der Saarländerin Wiebke Kopmeier. Die 25-jährige Studentin reiste bereits zum dritten Mal als Landessynodale für den Kirchenkreis Saar-Ost an. Kaum volljährig, übernahm sie als Presbyterin Verantwortung in ihrer Gemeinde, später folgten die Mitgliedschaft im Kreissynodalvorstand und dann auf Ebene der Landeskirche. Doch ohne die Frage, ob sie Verantwortung übernehmen will, hätte sie sich diese Positionen vermutlich nicht zugetraut, sagt sie.
Von der Jugendsynode der zweitgrößten deutschen Landeskirche mit über 2,5 Millionen Protestanten erhofft sich Kopmeier eine langfristige Wirkung. "Wenn die Jugendsynode gut funktioniert, brauchen wir sie von meinem Verständnis her nicht zeitnah noch einmal", sagt sie. Junge Menschen sollten sich stattdessen stärker in die Landessynode einbringen können.
Jugendsynode - das bedeutete nicht nur gemeinschaftliches Essen von Pommes und Burger, sondern auch gemischte Tische von Sakkoträgern und jüngeren Delegierten in Jeans und Turnschuhen. Statt der typischen Protokolle bereitete ein Illustrator die wichtigsten Ergebnisse in einer grafischen Darstellung auf. In den Diskussionen bemühten sich die Delegierten um einfache Sprache und ermunterten immer wieder, Fragen zu stellen.
Lebhafte Diskussionen
Nach lebhaften Diskussionen einigten sich die Synodalen auf die Forderung nach Jugendausschüssen mit einer Quote für junge Leute in allen 37 Kirchenkreisen zwischen Niederrhein und Saar. Auch die Jugendarbeit und die Situation junger unbegleiteter Flüchtlinge müssten verbessert werden.
Was aus den Beschlüssen wird, entscheidet die bis 11. Januar tagende Landessynode. Präses Manfred Rekowski betont, dass die Jugendsynode mehr als "eine Spielwiese" sei: "Ich glaube schon, dass Vieles sehr konsensfähig sein wird", sagt der leitende Theologe der rheinischen Kirche. "Wir haben dieser Generation bisher zu wenig Raum gegeben und zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten." Das wolle die rheinische Kirche nun ändern.
Annkatrin Zotter aus Düsseldorf plädiert für regelmäßige Tagungen junger Leute. "Vielleicht könnte die Jugendsynode alle vier Jahre stattfinden, so dass wir einen jugendlichen Anstoß in der Kirche bekommen", schlägt die stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Landesjugendvertretung im Rheinland (ELJVR) vor. Die 21-jährige Studentin besuchte erstmals eine Synode.
Lisa Marie Appel, Vorsitzende der Studierendenkonferenz der Evangelischen Studierendengemeinden (ESG) im Rheinland, dringt nach den positiven Erfahrungen auf neue Arbeitsweisen der Kirche. Die Landessynode könne von den kleinen Gruppen und dem Bemühen um Verständlichkeit während der Jugendsynode lernen, sagt die 24-jährige Theologiestudentin aus Wuppertal.
Während viele junge Delegierte nach dem Wochenende wieder abreisen, hat Appel als Gast auf der Landessynode ein Auge auf den Umgang mit der Vorgängerkonferenz. Sie hofft auf eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Themen der Jugendsynode: "Ich bin sehr darauf gespannt, wie mit den Ergebnissen umgegangen wird."
Die Beschlüsse der rheinischen Jugendsynode
Bad Neuenahr (epd). Die erste Jugendsynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat am Sonntag zum Abschluss ihrer dreitägigen Beratungen in Bad Neuenahr mehr Möglichkeiten zur Partizipation junger Leute in der Kirche angemahnt. Die wichtigsten Forderungen der dreitägigen Beratungen:
* PARTIZIPATION: Eine Beteiligungsquote von 50 Prozent junger Menschen in zu gründenden Jugendausschüssen der 37 rheinischen Kirchenkreise sowie im synodalen Fachausschuss Jugend. Modellprojekte in fünf Kirchenkreisen. Mehr junge Synodale bei der Landessynode.
* KINDER- UND JUGENDARBEIT: Eine verlässliche Finanzierung der Arbeit auch in strukturschwachen Regionen. Anschubfinanzierung, dauerhafte Unterstützung, Fundraising und Ko-Finanzierung als Möglichkeiten. Ein verbindliches Qualifikationsniveau.
* FLÜCHTLINGE: Mehr Unterstützung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unter anderem über Projekte. Die rheinische Kirche soll dem Aktionsbündnis "Seebrücke" beitreten und sich an der Finanzierung eines neuen Schiffs der Organisation SOS Méditeranée beteiligen.
* NEUE GEMEINDEFORMEN: Die Jugendsynode unterstützt das Vorhaben, fünf Millionen Euro über zehn Jahre verteilt für "Erprobungsräume" zur Verfügung zu stellen. In einem Vergabegremium sollen auch junge Menschen sein.
* JUGEND- UND FAMILIENARMUT: Niedrigschwellige Servicestellen zur Beratung von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien. Eine Kultur des Helfens auf Augenhöhe.
Theologe: Junge Menschen vermissen bei Kirche Lebensrelevanz

epd-bild/Hans Jürgen Vollrath
Bad Neuenahr (epd). Junge Menschen bewerten nach den Worten des Gemeindepädagogen Wolfgang Ilg die Kirche positiv. Ihnen fehle aber der Bezug zum eigenen Leben, sagte der Professor für Jugendarbeit und Gemeindepädagogik an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg am 4. Januar bei der rheinischen Jugendsynode in Bad Neuenahr. "Kirche hat nicht in erster Linie ein Imageproblem, sondern ein Relevanzproblem."
Ilg präsentierte eine für die Jugendsynode erstellte Sonderauswertung eines Forschungsprojekts an der Universität Freiburg, welches unter der Leitung von Bernd Raffelhüschen steht. Das Projekt sieht Ilg zufolge für jede evangelische Landeskirche und katholische Diözese langfristige Projektionen von Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteueraufkommen bis 2060 vor. Ergebnisse dieser bundesweit ersten koordinierten ökumenischen Mitglieder- und Kirchensteuervorausberechnung würden Anfang Mai veröffentlicht.
Demnach ist die höchste Wahrscheinlichkeit im Laufe eines Lebens evangelisch zu sein, zwischen dem 14. und 25. Lebensjahr. So nehme die Größe eines Konfirmationsjahrgangs in den 25 Jahren nach der Konfirmation um etwa ein Viertel ab, sagte Ilg. Kirche müsse fragen, welche positiven Erfahrungen in den Jahren zwischen 14 und 28 fehlten, um der Kirche treu zu bleiben.
"Glaube wird in der Gemeinschaft erlebbar, wird relevant", betonte der Theologe. Gemeinschaft sei eine Kernerfahrung kirchlicher Jugendarbeit. Es brauche einen Raum, damit diese Botschaft erlebbar werde. Jugendliche seien sich allerdings einig, dass der Gottesdienst am Sonntagmorgen nicht dafür geschaffen sei. Es ist dem Wissenschaftler zufolge an der Zeit, die Fixierung auf den Sonntagsgottesdienst als einzige "Mitte der Gemeinde" zu beenden. "Warum sollten junge Menschen ihre Mitte der Gemeinde nicht auch bei einer Freizeit erleben?", fragte er.
Gemeindepädagoge: Partizipation bedeutet mehr als Zuhören
Ilg warnte zudem vor einem zu engen Partizipationsbegriff in der Kirche. Es gehe "nicht um Zugeständnisse des Hirtenkreises an seine Schäfchen". Partizipation bedeute auch mitentscheiden zu können. "Wenn Partizipation gelingt, bleibt die Kirche nicht wie sie ist", unterstrich der Theologe und Psychologe. Neue engagierte Menschen sorgten automatisch für Veränderungen.
"Systeme im Krisenmodus neigen dazu, festzuhalten, was geht", sagte Ilg. Sie wollten bewahren und Änderungen vermeiden. "Wer festhalten, den Bestand erhalten will, wird spüren, wie verloren geht, was man doch zu sichern suchte." Aus einer Haltung der Gelassenheit und dem Loslassen könne hingegen Neues entstehen.
Rheinische Jugendsynode bislang einmalig in der EKD
Bad Neuenahr (epd). Die Jugendsynode der Evangelischen Kirche im Rheinland, die in Bad Neuenahr tagte, ist nicht nur eine Premiere für die Landeskirche: In der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit ihren 20 Mitgliedskirchen gibt es bislang kein vergleichbares Modell. Die 110 Delegierten der rheinischen Jugendsynode kamen unmittelbar vor der Landessynode zusammen, die seit 6. Januar ebenfalls in Bad Neuenahr tagt. Alle Beschlüsse des Jugendparlaments werden von der Landessynode aufgegriffen und beraten - dem obersten Organ der zweitgrößten deutschen Landeskirche, die mehr als 2,5 Millionen Mitglieder hat.
Ob es von nun an regelmäßig Jugendsynoden geben wird, ist laut Präses Manfred Rekowski noch nicht entschieden. Junge Leute sollten aber auf Dauer mehr Mitspracherechte erhalten. Die Jugendsynode setzt sich zusammen aus je 50 Delegierten der evangelischen Jugend und der Landessynode sowie zehn weiteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie vertreten die Studierendengemeinden, die landeskirchlichen Schulen und die ehrenamtliche Konfirmandenarbeit, auch drei ökumenische Gäste gehören dazu.
Die EKD diskutiert ebenfalls über eine stärkere Beteiligung von jungen Erwachsenen an ihren Gremien. Über eine Jugendsynode und ein volles Stimmrecht für Jungdelegierte auf der EKD-Synode wurde im November in Würzburg beraten. Auf EKD-Ebene haben Jungdelegierte bislang kein Stimmrecht. Sie können sich zu Wort melden, aber keine Anträge einbringen oder über Kirchengesetze abstimmen. Diskutiert wird auch eine Jugendquote von 20 Prozent, ähnlich wie sie beim Lutherischen Weltbund gilt.
Rheinischer Präses: Soziale Kluft überwinden

epd-bild/Hans-Jürgen Vollrath
Bad Neuenahr (epd). Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hat sich besorgt über ein "Auseinanderdriften der sozialen Milieus in der Gesellschaft" geäußert. "Die größer werdende Kluft findet nicht zuletzt in den politischen Verwerfungen unserer Tage eine Entsprechung", sagte der Theologe am 7. Januar vor der rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr. Es sei deshalb eine drängende sozialpolitische Herausforderung, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern. Dies sei gerade in Zeiten einer wachsenden Wirtschaftsleistung Aufgabe eine vorausschauenden Politik.
Zwar seien die Arbeitslosenzahlen so niedrig wie lange nicht mehr und auch die öffentlichen Kassen verzeichneten regelmäßig Mehreinnahmen, sagte der leitende Theologe der zweitgrößten deutschen Landeskirche. Zugleich lebten aber viele Menschen nach wie vor von Hartz IV oder könnten als Aufstocker nicht allein vom Lohn ihrer Arbeit leben. Immer mehr Menschen könnten sich Wohnungen in den Städten nicht mehr leisten und ein großer Prozentsatz der Kinder wachse "in diesem reichen Land unter Hartz-IV-Bedingungen auf".
Nach fast einem Jahrzehnt ungebrochenen Wirtschaftswachstums stehe sehr vielen Menschen tagtäglich vor Augen, wie fragil ihre soziale Lage sei, sagte der 60-jährige Theologe. "Deshalb ist es richtig und wichtig, dass Kirchen und Sozialverbände auch in diesen prosperierenden Zeiten nicht nachlassen, für die Perspektive derer einzutreten, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen." Sozialpolitische Entscheidung müssten mit einer langfristigen Perspektive getroffen werden, weil sie sich langfristig auswirkten.
Rekowski: Braunkohle-Ausstieg sozialverträglich gestalten
In der Diskussion über die Zukunft der Braunkohle warnt der Präses vor einem Strukturwandel zu Lasten der Menschen in den Tagebauregionen. Die Folgen des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung müssten gesamtgesellschaftlich getragen werden, sagte Rekowski. Der Theologe wies darauf hin, dass im Steinkohlebergbau seit den 50er Jahren mehr als 500.000 Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut worden seien. "Angesichts dieser gewaltigen Aufgabe, die unser Land gemeinsam bewältigt hat, scheint uns auch ein Transformationsprozess im Bereich der Braunkohle leistbar." Er müsse allerdings politisch gesteuert und gewollt werden. "Die dringlichste Frage scheint uns, dass es einen Zukunftsplan für die gesamte Region und verlässliche Perspektiven für die Betroffenen gibt", sagte Rekowski.
In der rheinischen Kirche sind fünf Kirchenkreise mit mehr als 450.000 evangelischen Gemeindemitgliedern vom Braunkohletagebau betroffen. Die Landeskirche setzt sich für einen Ausstieg aus der Kohleverstromung zum Schutz des Klimas ein, mahnt aber zugleich, die Zukunft der Beschäftigten im Blick zu behalten. Es gebe eine "Parteilichkeit der Kirche" sowohl für die Armen als auch für die Schöpfung, sagte Rekowski.
Aufruf zum Vertrauen
Die rheinische Landessynode hatte am 6. Januar mit einem Gottesdienst begonnen. Die Predigt zum Thema Vertrauen hielten fünf Mitglieder der ersten rheinischen Jugendsynode, die ihre Beratungen zuvor mit Forderungen nach mehr Einfluss und Beteiligung junger Leute beendet hatte. Im Vertrauen auf Gott lasse sich Neues entdecken und wagen, sagte Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer. Oberkirchenrätin Henrike Tetz hob hervor, dass Jesus Christus den Menschen "inmitten des Getöses der Welt" begegne, auch wenn sie ihn dort nicht vermuteten.
Die Synode beschäftigt sich bis 11. Januar unter anderem um die Beschlüsse der 110 Jugendsynodalen. Sie verlangen flächendeckend Jugendausschüsse in allen Gemeinden und Kirchenkreisen mit einer 50-Prozent-Quote für junge Leute. In Modellprojekten sollten zudem verbindliche Formen von mehr Teilhabe junger Menschen erprobt werden. Weitere Beschlüsse fasste die Jugendsynode zu den Themen Jugendarbeit, Jugend- und Familienarmut, Flüchtlinge und neue Gemeindeformen.
Die 206 stimmberechtigten und 27 beratenden Mitglieder der Landessynode entscheiden auch über weitere Belange der rheinischen Landeskirche, der mehr als 2,5 Millionen Protestanten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen angehören. So verabschiedet die Synode den Haushalt für 2019 und erörtert in Arbeitsgruppen und Ausschüssen eine gerechtere Verteilung der Kirchensteuereinnahmen.
Ein Hauptthema ist die Förderung innovativer Formen von Kirchengemeinde, dafür ist ein Fördertopf von insgesamt fünf Millionen Euro für die kommenden zehn Jahre vorgesehen. Außerdem geht es um die Bezahlung der Pfarrer und die Begegnung mit Kirchenvertretern aus Südafrika und Hongkong, die aus der Missionsarbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft hervorgegangen sind. Als Gast wurde am 7. Januar der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erwartet, der ein Grußwort sprechen sollte.
Westfälischer Vizepräsident: Christentum wird Minderheit

Bad Neuenahr (epd). Der Theologische Vizepräsident der Evangelischen Kirche von Westfalen, Ulf Schlüter, hat die christlichen Kirchen aufgerufen, ihre Kräfte zu bündeln und Synergien zu nutzen, um ihrem Auftrag in der Gesellschaft gerecht zu werden. "Im nächsten Jahrzehnt wird das Christentum Minderheit sein in dieser Gesellschaft", sagte er am 7. Januar vor der Landessynode der rheinischen Kirche in Bad Neuenahr.
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen müssten das Denken in Pfründen, Provinzen, Fürstentümern, Königreichen und Kirchenstaaten beharrlich und zügig überwinden. "Wir haben einen gemeinsamen Auftrag: das Evangelium zu kommunizieren, zum Vertrauen zu rufen, in Wort und Tat der Welt und dem Menschen heute zum Wohl und zum Heil zu dienen", betonte Schlüter. Kirche dürfe niemals selbstgenügsam sein.
"Wir sind gut, wenn man uns als evangelisch kennt", sagte der Theologe vor dem rheinischen Kirchenparlament. "Wir sind Anno 2019 gut, wenn wir überhaupt als Christinnen und Christen erkannt werden, zu sehen sind." Dazu gehörten gemeinsames Sprechen und Handeln sowie dialogisches Denken.
Hauschildt: Kirchengemeinden müssen zusammenarbeiten
Bonn (epd). Der Theologieprofessor Eberhard Hauschildt rät Kirchengemeinden, stärker zusammenzuarbeiten. "Bei begrenzten Ressourcen ist es nicht am günstigsten, wenn alle Gemeinden, vor allem im städtischen Bereich, genau das Gleiche machen", sagte der Professor für praktische Theologie der Universität Bonn dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Sie müssen ein bisschen auf Lücke arbeiten, sich ergänzen, Kooperationen eingehen."
Die Evangelische Kirche im Rheinland berät auf ihrer diesjährigen Landessynode auch darüber, wie neue und innovative Formen kirchlichen Lebens gefördert werden können. Für die Unterstützung von "Erprobungsräumen" sollen nach einer Synodenvorlage künftig pro Jahr 500.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Entstehung neuer Gemeindeformen sei eine interessante Entwicklung, sagte Hauschildt: "Ein gewisses Experimentieren braucht man."
Wenn sich ein Projekt nicht bewähre, stelle sich allerdings auch die Frage, "wie man da wieder rauskommt", gab Hauschildt zu bedenken. "Und wenn es sich bewährt, stellt sich die Frage: Wie institutionalisieren sich neue Gemeindeformen dann?" Wenn Neues auf Dauer angesetzt sei, werde es mit der Zeit zwangsläufig normaler. Dennoch sei es genau richtig, nicht in alte Muster hineinzurutschen und stattdessen zu überlegen, wie Kirche mit neuen Entwicklungen umgehen könne, betonte der Theologieprofessor.
Kirche ganz anders

epd-bild/Jörn Neumann
Köln (epd). Miriam Hoffmann sitzt auf einem alten grünen Sofa und blickt auf gerahmte Porträtfotos, die an weißgetünchten Backsteinwänden hängen. Sie zeigen Alltagsszenen von Menschen etwa in Aserbaidschan, Indien, dem Irak oder Amerika. Mal sind es fröhliche Schulkinder, mal eine obdachlose Frau auf einem Müllberg. "Die Fotos hat jemand aus dem Viertel gemacht", erzählt die 34-Jährige. "Ein Lehrer, der auf seinen Reisen fotografiert." In diesem Raum treffen sich die "Beymeister" - Mitglieder einer kleinen christlichen Gemeinschaft in Köln, die neue und ungewöhnliche Wege geht.
"Früher waren die Beymeister die verschiedenen Meister einer Zunft, die sich beratend und auf Augenhöhe zur Seite standen", erzählt Hoffmann. Daher hat das Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Mülheim seinen Namen. "Wir wollen einen Ort bieten, an dem sich der Stadtteil enger vernetzt, an dem sich Menschen einbringen und eine Gemeinschaft so gestalten, dass sie sich wohl fühlen."
Vorbild ist Fresh-X-Bewegung aus England
Hoffmann sitzt im "Wohnzimmer" der Beymeister: einer ehemaligen Schneiderei, deren Name noch auf dem großen Schaufenster prangt. Hier, kaum 50 Meter von der evangelischen Friedenskirche entfernt, treffen sich die Beymeister, trinken Kaffee und Tee, veranstalten Wohnzimmerkonzerte, kochen zusammen und beten miteinander - wenn das erwünscht ist. "Wir sind Kirche im Alltag", sagt Hoffmann, die Gemeindereferentin und Laienpredigerin ist. "Die Leute sprechen uns mit ihren Wünschen und Vorstellungen an, und wir versuchen, das dann umzusetzen."
Zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Sebastian Baer-Henney probiert Hoffmann seit 2015 neue Wege für die Gemeindearbeit vor Ort aus und testet dabei eine Struktur, die Menschen mit ihren Bedürfnissen außerhalb von Kirchengebäuden ansprechen soll. "Unser Vorbild ist die Fresh-X-Bewegung", erklärt sie. Diese Bewegung bildete sich in den letzten 20 Jahren in der Anglikanischen Kirche von England unter dem Begriff "Fresh Expressions of Church" (deutsch: neue Ausdrucksformen von Kirche) heraus.
Die Bewegung geht davon aus, dass die traditionellen Ausdrucksformen der Kirche für einen Großteil der Bevölkerung unbedeutend geworden sind. Nach einer statistischen Erfassung der Church of England aus dem Jahr 2007 gehören mehrere zehntausend Menschen solchen Gruppen an.
Zu den Beymeistern in Köln zählen 150 bis 200 Menschen, darunter ein "harter Kern" von 50 Leuten. "Die Menschen, die zu uns kommen, sind ganz unterschiedlich", sagt die 24-jährige Eva Kurrer, die Religions- und Gemeindepädagogik studiert und ihr Praxissemester bei den Beymeistern absolviert. "Die meisten sind zwischen 25 und 45 Jahre alt, sie sind Protestanten, Katholiken oder gar nichts." Sie alle verbinde, dass an diesem Ort "ihre Spiritualität Raum findet".
Versuchslabor
Offiziell sind sie Teil der Ortsgemeinde Köln-Mülheim, "aber mit klaren Abgrenzungen", betont Hoffmann: "Wir sehen unsere Rolle nicht darin, Menschen zu fischen, um sie in die Gemeinde zu überführen." Der Kirche würden auch keine Mitglieder abgeworben: "Die Menschen, die zu uns kommen, suchen etwas ganz anderes als traditionelle Kirche." Es gehe darum, die klassische Kirche zu ergänzen, um ein breiteres Spektrum abzudecken.
Für die Kirche seien die Beymeister eine Art Versuchslabor und zugleich ein Vorzeigeprojekt: "Presbyterien aus ganz Deutschland interessieren sich für die Beymeister." Die Evangelische Kirche im Rheinland will auf ihrer seit 6. Januar tagenden Landessynode in Bad Neuenahr darüber entscheiden, wie solche innovativen und kreativen Projekte gefördert werden können, damit sie auch an anderen Orten Schule machen. Unkonventionelle Gemeindenformen neben der klassischen Ortsgemeinde sollen einen Mentalitätswandel in der Kirche voranbringen.
Eine Schwierigkeit ist bisher die Finanzierung: Zwar gebe es Unterstützung durch die Landeskirche, sagt Hoffmann. Doch die Miete für die ehemalige Schneiderei müssten die Beymeister selbst aufbringen, mit Hilfe von Crowdfunding über die Website. Auch Hoffmanns Stelle als projektbezogene Gemeindereferentin hängt am seidenen Faden: "Meistens weiß ich im Dezember nicht, ob ich im Januar noch einen Job habe." Doch darüber macht sich die zweifache Mutter kaum Gedanken: "Ich wollte das hier unbedingt machen, dafür habe ich zwei Festanstellungen ausgeschlagen."
Einen Zehnjahresplan könne man bei einem Projekt wie diesem ohnehin nicht aufstellen, ergänzt Kurrer, bevor sie mit Hoffmann zum Einkauf aufbricht. Denn dienstags treffen sich die Beymeister zum gemeinsamen Kochen und Mittagessen. "Meistens so an die 20 Leute", sagt Kurrer, vor allem Freiberufler und Mütter mit Kindern. "Und wir haben noch keine Ahnung, was es gibt."
Vesperkirche in Gütersloh bittet erneut zu Tisch
Gütersloh (epd). Die 2018 gestartete erste Vesperkirche in Nordrhein-Westfalen bittet ab Ende Januar in Gütersloh erneut zu Tisch. Vom 27. Januar bis zum 10. Februar treffen sich in der evangelischen Martin-Luther-Kirche Menschen aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen zum gemeinsamen kostenlosen Mittagessen, wie Pfarrer Stefan Salzmann vom Organisationsteam der Vesperkirche am 2. Januar mitteilte. Erstmals werde zusätzlich auch an zwei Abenden eine Essensausgabe angeboten.
Die Organisatoren rechnen laut Salzmann mit einer ähnlichen Resonanz wie bei der ersten Auflage vor einem Jahr. Damals waren binnen 15 Tagen insgesamt 6.000 Mahlzeiten ausgegeben worden. Die auch dieses Mal benötigen 600 ehrenamtlichen Helfer hätten sich bereits bis Oktober gemeldet, mehreren Hundert weiteren Interessenten habe man absagen müssen, sagte der evangelische Pfarrer dem epd. Unter den Freiwilligen seien neben zahlreichen Einzelpersonen auch Teams aus Unternehmen, Sportvereinen oder Schulklassen.
Die Gäste der Vesperkirche speisen den Angaben zufolge täglich in zwei Durchgängen zwischen 12 und 14 Uhr - wer kann, gibt dafür eine Spende. An den im Kirchenraum aufgestellten Tischen ist Platz für 150 Leute. Begleitet werden die gemeinsamen Mahlzeiten von kurzen geistlichen Impulsen, Beratungsangeboten und einem musikalischen Abschluss durch Gütersloher Musikschulen. Bei den Kurzvorträgen sei erstmals auch eine Muslima beteiligt, kündigte Salzmann an.
Erweitertes Angebot
Bei den jeweils donnerstags vorgesehenen Abendspeisungen übernehmen Menschen mit Behinderungen die Bedienung, die in den Werkstätten des sozialen Dienstleistungsunternehmens Wertkreis Gütersloh arbeiten und lernen, wie es weiter hieß. Der Wertkreis liefere auch die Produkte für die kalten Abendmahlzeiten aus seinem ökologischen Landwirtschaftsbetrieb. Mit dem erweiterten Angebot wolle man verstärkt auch Berufstätige erreichen, die tagsüber wenig Zeit hätten, hieß es.
Das Mittagessen wird demnach erneut im evangelischen Pflegeheim Katharina-Luther-Haus gekocht und anschließend durch die Gütersloher Tafel zur Ausgabestelle transportiert. Für das Geschirr sorgt die Arbeitslosenselbsthilfe, die Landfrauen schenken Kaffee aus.
Mit der Vesperkirche wollen die Organisatoren nach eigenen Angaben "ein Zeichen gegen die fortschreitende soziale Trennung" der Gesellschaft setzen. Jung und Alt, gut situierte Bürger und Obdachlose, Alteingesessene und neu Hinzugezogene sollten miteinander ins Gespräch kommen. Bei der ersten Auflage sei es tatsächlich zu vielen Begegnungen ganz unterschiedlicher Menschen gekommen, betonte Pfarrer Salzmann. Diese Erfahrung habe maßgeblich zu einer Wiederholung des Projektes motiviert.
Die Gütersloher Vesperkirche ist laut Salzmann kein rein kirchliches oder konfessionsgebundenes Projekt, sondern werde von Bürgern für Bürger der Stadt ausgerichtet. Sie finanziere sich komplett aus Spendenmitteln.
Die erste evangelische Vesperkirche wurde 1994 in Stuttgart eröffnet und zu einem jährlichen Winterprojekt zugunsten von Bedürftigen ausgebaut. Mittlerweile gibt es davon 30 in Baden-Württemberg und Bayern sowie ein ähnliches Projekt in Hannover. In Nordrhein-Westfalen geht als zweites Projekt Ende Januar die Vesperkirche Niederberg mit den Standorten Velbert und Wülfrath an den Start, die vom Diakonischen Werk des Kirchenkreises Niederberg betrieben wird.
Weil und Meister rufen zum Kampf für die Demokratie auf
Beim Epiphanias-Empfang der hannoverschen Landeskirche mahnen die Hauptredner Engagement für die Werte der westlichen Gesellschaft an. Gleichzeitig raten sie zu mehr Augenmaß: Manche Sorge werde medial überhöht. Die Mehrheit stehe für Demokratie.Loccum (epd). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und der hannoversche Landesbsichof Ralf Meister haben zu mehr Engagement für die Demokratie, für Europa und gegen Rechtspopulismus aufgerufen. Die überragende Mehrheit der Bevölkerung stehe für einen starken demokratischen Staat und für eine starke Zivilgesellschaft, sagte Weil beim 69. Epiphanias-Empfang der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers am 6. Januar im Kloster Loccum bei Nienburg.
Der Ministerpräsident verwies dabei auf den Hashtag #wirsindmehr, der sich im vergangenen Sommer nach den rechtsmotivierten Ausschreitungen von Chemnitz in den sozialen Netzwerken gebildet hatte. Dennoch drohe ein unverkennbarer Rechtsruck in Europa viele Errungenschaften in Frage zu stellen, warnte Weil vor rund 130 Gästen aus Landespolitik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Er rief die Bürger dazu auf, "mit aller Kraft" für die Demokratie und für Europa einzutreten und zu kämpfen.
Landesbischof Meister: Von der Sorge zum Handeln kommen
Landesbischof Meister warnte angesichts der Vorfälle in Amberg und Bottrop davor, dass rechte Parteien die Sorgen der Bürger für ihre Zwecke ausnutzen könnten. Die sozialen Netzwerke und die Medien verstärkten die Ängste durch ihre Berichterstattung um ein Vielfaches, kritisierte Meister. Er bezog sich auf den Angriff jugendlicher Asylsuchender auf Passanten im oberpfälzischen Amberg und die Tat eines 50-jährigen Deutschen in Bottrop, der mit seinem Auto gezielt in Gruppen mit Ausländern fuhr.
"Die Aufmerksamkeit, die auf Attentäter, Kriminelle, Irregeleitete und auf ihre Taten gelenkt wird, ist unerträglich. Jede blutige Sekunde ist rund um den Erdball verfolgbar", sagte der evangelische Theologe und ergänzte: "In der Erregungskultur der sozialen Medien wird eine Messerstecherei schnell zum Terroranschlag, ein Amoklauf zum Vorboten eines Weltuntergangs, ein Attentäter weckt Schläfer."
Umso wichtiger sei es, von der Sorge zum Hoffen und Handeln zu kommen. "Es liegt an uns, unserer Hoffnung eine sichtbare Gestalt zu geben, indem wir jeden Tag handeln", sagte Meister. Dabei komme es auch darauf an, "die Weiterentwicklung Europas konstruktiv und kritisch zu begleiten".
Die Landeskirche lädt seit 69 Jahren Repräsentanten des öffentlichen Lebens zum Jahreswechsel zu dem Empfang in das mehr als 850 Jahre alte Zisterzienserkloster ein. Der frühere Landesbischof Hanns Lilje (1899-1977) hatte 1950 nach seiner Wahl zum Abt zu Loccum erstmals zum "Empfang zwischen den Jahren" gebeten.
Hannoversche Landeskirche startet Themenjahr "Zeit für Freiräume"
Hannover (epd). Unter dem Motto "...um des Menschen willen - Zeit für Freiräume 2019" will die hannoversche Landeskirche in diesem Jahr Routinen hinterfragen und Raum geben, sich auf Wesentliches zu besinnen. Das Themenjahr wurde am 6. Januar mit Gottesdiensten in den sechs Kirchensprengeln der größten evangelischen Landeskirche in Deutschland eröffnet. "Dabei geht es darum, mit welchen Mustern und Traditionen man auch einmal brechen kann", sagte Landesbischof Ralf Meister am 4. Januar in Hannover. "Wir brauchen viel mehr mutige Musterbrecher."
Angesichts von sinkenden Mitgliederzahlen werde sich die Kirche verändern, erläuterte der Bischof. Die Zahl der Pastorinnen und Pastoren gehe zurück, und nicht mehr alle Gebäude könnten gehalten werden. Das Jahr solle die mehr als 1.200 Kirchengemeinden und die Einrichtungen der Landeskirche anregen, darüber nachzudenken, was sie anders machen könnten und was Ursprung und Kern ihrer Arbeit sei. Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter könnten Ideen dazu entwickeln, wie sie trotz Belastungen Ruhe und Kraft fänden. Dazu sollen Angebote in Klöstern und "Oasentage" ebenso beitragen wie Coaching, Seelsorge-Angebote und Beratungen, erläuterte Pastorin Karoline Läger-Reinbold als Projektleiterin.
Meister erhofft sich auch Wirkungen über die Kirche hinaus, etwa wenn es um die Diskussion um die Sonntagsruhe als gemeinsame gesellschaftliche Auszeit gehe. Der Bischof hat die Idee gemeinsam mit den sechs Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfen der Landeskirche entwickelt.
Hannoverscher Bischof will nur noch elektrisch fahren

epd-bild/Rainer Oettel
Hannover (epd). Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister will umweltfreundlich ins neue Jahr starten. Künftig ist der evangelische Theologe mit einem Elektroauto unterwegs, das eigentlich schon im Herbst geliefert werden sollte. Er sei damit der erste deutsche Bischof mit einem E-Auto, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Beim jährlichen bundesweiten Dienstwagencheck der Deutschen Umwelthilfe unter mehr als 40 leitenden Theologen war er vor wenigen Wochen mit seinem derzeitigen Audi Q7 Diesel/Elektro mit 225 Gramm CO2 pro Kilometer auf dem letzten Platz gelandet.
Dieser Schritt solle aber nicht überbewertet werden, unterstrich der Landesbischof: "Der beste Schutz für die Umwelt in Sachen Mobilität ist ein vollständiger Verzicht auf Verbrennungsmotoren und insgesamt auf Fahrzeuge, die allein genutzt werden." Die Zukunft werde sicherlich nicht nur in den Millionenmetropolen, sondern auch in den mittleren Städten im Carsharing liegen. "Der wichtigste Maßstab ist für mich, möglichst auf das Autofahren zu verzichten." Er nehme so oft wie möglich die Bahn und innerhalb Hannovers das Fahrrad.
Bischof Adomeit: Krieg darf keine politische Option sein

epd-bild/Jens Schulze
Oldenburg (epd). Der oldenburgische Bischof Thomas Adomeit hat mehr Engagement in Politik und Gesellschaft für den Frieden gefordert. "Es ist entsetzlich, dass Krieg als Ultima Ratio - also als letztes Mittel - wieder eine politische Option geworden ist", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit Blick auf die biblische Jahreslosung für 2019 "Suche Frieden und jage ihm nach".
In der Politik sei ein Wechsel weg von der Verteidigungshaltung und hin zu einer politischen Einflussnahme mit Gewalt zu beobachten, sagte Adomeit. "Ich glaube, dass manches Tun nicht unter dem Label, den Frieden zu sichern, gedacht wird, sondern als Interessensvertretung. Da müssen wir als Kirche den Finger heben und fragen: Wer verfolgt hier welches Interesse?"
"Erlebnisgeneration" stirbt aus
Es sei ein Problem, dass die Generation derjenigen weniger werde, die Krieg erlebt hätten, sagte der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. Die absolute Wertschätzung des Friedens drohe in Vergessenheit zu geraten. "Die Erlebnisgeneration kann uns nicht mehr berichten, wie es ist zu hungern oder zu hören, wenn Fliegerbomben fallen", sagte Adomeit. Die Kirchen stünden vor der Aufgabe, den "unglaublichen Wert von Frieden" für die Menschen wieder hervorzuheben.
Junkermann: Kirche wichtige Stimme gegen Rechtspopulisten

epd-bild/Peter Endig
Magdeburg (epd). Die Bischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann, sieht die Kirche als wichtige Stimme in der Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten. So sei es auch eine aufklärerische Aufgabe, über die Inhalte der AfD aufzuklären, sagte Junkermann am 6. Januar in Magdeburg MDR Aktuell.
Es sei "nach wie vor markant für die AfD, dass sie sich profiliert über Abgrenzung und Verunglimpfung anderer politischer Meinungen, bis hin zur Hetze und Hassreden, selbst aber politisch relativ wenig inhaltlich liefert", sagte die Bischöfin. Sie plädierte dafür, das Gespräch mit AfD-Wählern zu suchen. Gerade im Osten gebe es ein Bedürfnis nach verlässlicher und stabiler Orientierung. Dabei sei es Aufgabe der Kirche, eine Grundzuversicht zu vermitteln.
Junkermann verteidigte zugleich, die AfD nicht auf Kirchentage einzuladen. Öffentliche Plattformen werteten die Partei auf. Es sei aber richtig, Vertreter der Partei zu internen Diskussionen einzuladen oder beispielsweise zu Veranstaltungen über Wahlprüfsteine, sagte die Bischöfin.
Schäuble Festredner bei Garnisonkirchenempfang
Potsdam/Berlin (epd). Beim Neujahrsempfang der Potsdamer Garnisonkirchenstiftung am 15. Januar wird Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Festrede halten. Das bestätigte das Bundestagsbüro des Politikers am 3. Januar in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Bei dem Neujahrsempfang im Gebäude der Potsdamer Industrie- und Handelskammer gegenüber der Baustelle des neuen Garnisonkirchturms soll auch ein Ausblick auf die Planungen der Stiftung für 2019 gegeben werden.
Die Bauarbeiten für den neuen Kirchturm haben Ende Oktober 2017 begonnen, das Fundament ist inzwischen fertiggestellt. Zunächst soll aus Geldmangel eine rund 27 Millionen Euro teure Grundvariante des Turms ohne Schmuckelemente und Turmhaube gebaut werden. Für den kompletten rund 40 Millionen Euro teuren Turm fehlen rund zehn Millionen Euro.
Die 1735 fertiggestellte evangelische Garnisonkirche wurde 1945 bei einem Luftangriff auf den Potsdamer Hauptbahnhof weitgehend zerstört. Ein Raum im Kirchturm wurde bis in die 60er Jahre weiter als Kapelle für Andachten und Gottesdienste genutzt. 1968 wurde die Ruine in der DDR abgerissen.
Zusätzliche Baugenehmigung beantragt
Der Wiederaufbau ist umstritten. Kritiker sehen die Garnisonkirche wegen ihrer Geschichte als Symbol des preußischen Militärs und des NS-Regimes. Befürworter argumentieren unter anderem mit der Bedeutung des Bauwerks für das Stadtbild und einer Wiedergutmachung für den Abriss in der DDR. Die evangelische Kirche will den neuen Turm für Friedens- und Versöhnungsarbeit nutzen.
Der Bund fördert den Turmbau mit zwölf Millionen Euro, von der evangelischen Kirche kommen fünf Millionen Euro Kredite. Weitere Mittel kommen von Spendern und Sponsoren. Die bereits 2013 erteilte Baugenehmigung für den Turm läuft Mitte 2019 ab, die Bauarbeiten müssten damit nach brandenburgischem Baurecht bis Mitte 2020 abgeschlossen werden. Weil dies unrealistisch ist, wurde inzwischen eine zusätzliche Baugenehmigung bei der Stadt Potsdam beantragt. Der bereits vor einigen Monaten eingereichte neue Bauantrag werde weiter geprüft, hieß es dazu am 3. Januar bei der Stadtverwaltung.
Benefizaktion "Ungeliebte Weihnachtsgeschenke" erbringt 1.500 Euro
Düsseldorf (epd). Die diesjährige Benefizaktion "ungeliebter Weihnachtsgeschenke" in der evangelischen Johanneskirche in Düsseldorf hat laut der Veranstalter insgesamt gut 1.500 Euro eingebracht. Die Einnahmen der schon traditionellen Benefizaktion zum Jahresanfang kommen, wie bereits in den letzten Jahren, der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" zu Gute, wie Barbara Wengler von der Johanneskirche erklärte. Nach Angaben der Mitarbeiter im Kirchencafé der Citykirche hatten seit dem 2. Januar wieder viele Menschen überflüssige, nicht gewollte oder auch doppelt erhaltene Geschenke und Gegenstände abgegeben, um damit "dem guten Zweck" zu dienen.
Neben Büchern, Kerzenhaltern, Tischdekorationen Spielen fand unter anderem auch eine neue Kaffeemaschine einen neuen Besitzer. Außerdem werden rund 1.100 Euro aus den wöchentlichen Bücherbasaren der Johanneskirche aus dem vergangenen Jahr an "Ärzte ohne Grenzen" überwiesen, erklärte Wengler. Wenn auch die Kleinbeträge ausgezählt seien, könnte der Gesamtbetrag für die Hilfsorganisation bei etwa 2.700 Euro liegen. Auch 2019 soll die Aktion nach dem Weihnachtsfest wieder angeboten werden.
Gesellschaft
UNHCR: Die Zahl neu eintreffender Flüchtlinge sinkt

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Während die Flüchtlingszahlen weltweit im vergangenen Jahr erneut gestiegen sind, nimmt die Zahl der Ankünfte in Deutschland weiter ab. Wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) am 6. Januar in Berlin mitteilte, sank in Deutschland die Zahl der Asylanträge in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres um weitere 20 Prozent. Im ersten Halbjahr 2018 seien 81.800 Anträge auf Asyl registriert worden. 2017 waren es im gleichen Zeitraum 101.000 Anträge, 2016 noch 387.700, wie das Flüchtlingshilfswerk weiter mitteilte.
"Die Flüchtlingskrise findet woanders statt, etwa in Bangladesch oder Libanon", erklärte Dominik Bartsch, UNHCR-Repräsentant in Deutschland. "Sieben von acht Flüchtlingen haben nicht etwa in Deutschland, Österreich oder Italien Zuflucht gefunden, sondern in Entwicklungsländern wie Bangladesch, Uganda oder Pakistan", sagte Bartsch weiter. Jetzt, wo sich die Situation beruhigt habe, müsse Europa Konzepte für den Umgang mit Flüchtlingen finden und seiner Verantwortung gerecht werden.
Weltweit gab es laut UNHCR zur Mitte des vergangenen Jahres 68,8 Millionen Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Asylsuchende. Das seien rund 300.000 mehr als ein halbes Jahr zuvor, zum 31. Dezember 2017. Die Zahl der Flüchtlinge stieg dabei um 554.000 auf 20,5 Millionen. Die Zahl der Binnenvertriebenen sank demnach leicht von 40 Millionen auf 39,7 Millionen. Hinzu kamen 3,2 Millionen Menschen, die asylsuchend sind und über deren Fälle noch nicht entschieden ist.
Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien
Syrien ist den Angaben zufolge nach wie vor das Land, aus dem die meisten Flüchtlinge stammen. Jeder dritte Flüchtling auf der Erde sei Syrer, hieß es weiter. Auch wenn einige Menschen in ihre Heimat zurückkehrten, würden noch mehr vertrieben, so dass die Zahl der syrischen Flüchtlinge um gut 180.000 auf 6,5 Millionen gewachsen sei. Die meisten von ihnen lebten in der Türkei (3,6 Millionen), gefolgt von Libanon (968.100) und Jordanien (667.200).
In Deutschland lebten laut UNHCR Mitte 2018 rund 514.000 Syrer. Die Bundesrepublik habe im ersten Halbjahr 2018 rund 22.200 Syrer neu als Flüchtlinge anerkannt. Im ersten Halbjahr 2017 waren es noch 72.600 Syrer. UNHCR-Experten rechneten nicht damit, dass sich die Zahl der syrischen Flüchtlinge in Deutschland in nächster Zeit signifikant erhöhen wird, hieß es weiter.
Die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan stieg weltweit um ein Prozent auf 2,7 Millionen. Davon hätten allein 1,4 Millionen in Pakistan, weitere 951.100 im Iran Zuflucht gefunden. In Deutschland seien es 116.700 Menschen aus Afghanistan. Aus dem Südsudan sind 2,5 Millionen Menschen geflohen. 1,1 Millionen von ihnen sind jetzt in Uganda, 768.100 im Sudan und 445.000 in Äthiopien.
Präses Rekowski dringt auf Hilfe für "Sea-Watch"-Flüchtlinge

epd-bild/Heiko Kantar
Bad Neuenahr (epd). Im Ringen um das Schicksal der 32 Flüchtlinge an Bord des Seenotrettungsschiffs "Sea-Watch 3" vor der Küste Maltas hat der rheinische Präses Manfred Rekowski seine Forderung erneuert, die Menschen aufzunehmen. Es müsse eine kurzfristige humanitäre Lösung geben, sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland am 7. Januar in seinem Jahresbericht vor der rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr. "Hier sind auch Deutschland und andere europäische Länder gefragt."
An dem Fall zeige sich, "dass nach wie vor tragfähige humanitäre europäische Lösungen in der Flüchtlingspolitik fehlen", kritisierte Rekowski, der auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist. Er hoffe im nun begonnenen Jahr der Europawahl 2019 auf Lösungen, "bei denen die Länder mit EU-Außengrenzen nicht überproportional belastet werden".
Nachhaltige Lösungen werde es allerdings nur geben, "wenn soziale und ökologische Fragen konsequent im Rahmen einer Weltinnenpolitik auch in anderen Teilen der Welt angegangen werden", sagte der evangelische Migrationsexperte. Er hatte im vergangenen Sommer das über mehrere Monate vor Malta festgesetzte Rettungsschiff "Sea-Watch 3" besucht und seine Solidarität mit der ehrenamtlichen Schiffsbesatzung gezeigt.
Die EKD unterstützt mehrere zivile Seenotrettungsorganisationen und setzt sich seit Jahren für legale und sichere Migrations- und Fluchtwege nach Europa ein, um das anhaltende Sterben auf dem Mittelmeer zu verhindern.
Auch NRW-Politiker von Hackerangriff betroffen

epd-bild/Annette Zoepf
Düsseldorf, Berlin (epd). Der Hackerangriff auf Daten von Politikern und Prominenten betrifft offenbar auch Nordrhein-Westfalen. So sollen sich unter den von den Hackern veröffentlichten Informationen auch Kontaktdaten von Mitgliedern der Landesregierung befunden haben, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf am 4. Januar mitteilte. Dabei soll es sich nach Angaben des Westdeutschen Rundfunks (WDR) etwa um private Telefonnummern von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und seinem Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) handeln. Auch Daten zu Oppositionspolitikern von SPD und Grünen sollen öffentlich gemacht worden sein. Politiker der AfD seien nicht von der Veröffentlichung betroffen.
Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, gebe es bislang keine Informationen, dass Mitglieder der Landesregierung unmittelbar Ziel eines Hackerangriffs geworden sind. "Derzeit wird geprüft, ob und inwiefern gegebenenfalls weitere Schritte einzuleiten sind", erklärte der stellvertretende Regierungssprecher Moritz Kracht. Die nordrhein-westfälische Grünen-Landtagsfraktion kündigte an, den Hacker-Angriff zum Thema im Ältestenrat und der Arbeitsgruppe Information und Kommunikation des Landtags zu machen. Die Landesbehörden müssten zudem ihre IT-Infrastruktur auf mögliche Sicherheitsrisiken kritisch überprüfen, forderte die innenpolitische Fraktionssprecherin Verena Schäffer.
Nach bisherigen Erkenntnissen sind mehrere Hundert Politiker sowie weitere Personen des öffentlichen Lebens von dem Datenklau betroffen, darunter Journalisten, Künstler und Musiker. Veröffentlicht wurden vor allem Handynummern und Adressen, aber auch amtliche Dokumente wie Personalausweise und persönliche Angelegenheiten wie Briefe, Chatverläufe, Fotos, Kontoauszüge oder Mietverträge. Auch Daten von Familienmitgliedern wurden öffentlich gemacht. Die Daten sind zum Teil schon länger im Netz. Sie waren über einen Twitter-Account in Form eines "Adventskalenders" veröffentlicht worden. Der Account wurde am 4. Januar gesperrt.
Nach Angaben der Bundesregierung dauern die Ermittlungen zu dem Vorfall an, es werde mit Hochdruck daran gearbeitet. Es seien Politiker und Mandatsträger auf allen Ebenen betroffen, von der Kommunalpolitik bis zum Europaparlament, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. "Die Bundesregierung nimmt diesen Vorfall sehr ernst", betonte sie. Politiker und Parteien verurteilten die Veröffentlichung persönlicher Daten und Dokumente im Internet als Angriff auf demokratische Grundwerte.
Nach Amokfahrt: Weißer Ring fordert schnellere Hilfe für Opfer
Bottrop/Mainz (epd). Die Opferhilfe-Organisation "Weißer Ring" hat nach der Amokfahrt von Bottrop und Essen eine schnelle psychotherapeutische Betreuung für die betroffenen Menschen angemahnt. Bislang scheitere die Behandlung solcher Trauma-Opfer daran, dass es nicht genügend Psychotherapeuten mit Kassenzulassung gebe, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation, Dominic Schreiner, am 4. Januar dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Folge seien "unzumutbare Wartezeiten für Menschen, die eigentlich schnelle Hilfe benötigen". Der "Weiße Ring" fordere seit Jahren von den Krankenkassen, dass sie erheblich mehr Psychotherapeuten zuließen. "Die Bedarfsplanungen der Kassen, die Grundlage für die Zulassungen sind, müssen dringend angepasst werden", betonte Schreiner.
Menschen, die traumatische Situationen wie die Amokfahrt an Silvester erlebt haben, befänden sich oft für einige Stunden in einer Art Schockzustand. Dem könne sich für ein bis vier Wochen eine "akute Belastungsphase" anschließen, die von Gefühlen wie Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht begleitet wird. "Dem folgt dann die Verarbeitung, das heißt: Das Erlebte wird nach und nach in Form von Erinnerungsfragmenten in die eigene Lebensgeschichte eingebaut", erklärte der Sprecher. Im Optimalfall könne das den Betroffenen wieder mehr Sicherheit im Alltag vermitteln. Aus Angst vor Rückschlägen würden zudem Situationen, die dem traumatischen Erlebnis gleichen, vermieden.
Gefahr einer Posttraumatischen Belastungsstörung
Überdies sei bei den traumatisierten Personen oft der Schlaf gestört, auch Konzentrationsprobleme könnten auftreten. Gelinge den Betroffenen die Verarbeitung des Erlebten nicht, kann sich eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) entwickeln. Laut dem Weißen Ring tritt bei etwa jeder vierten Person, die ein traumatisches Erlebnis hat, eine solche Störung auf, die auch nach sechs Monaten noch akut ist.
Zur unmittelbaren Hilfe in den Notsituationen sei ein klärendes Gespräch mit den Betroffenen wichtig, führte Schreiner weiter aus: "Reden hilft - mit dem eigenen sozialen Umfeld oder mit professionell ausgebildeten Opferhelfern wie den Beschäftigten in den bundesweit rund 160 Trauma-Ambulanzen." Zwei davon gebe es auch in Essen. Dort könne die Akutbehandlung der Betroffenen erfolgen und eine weitere Betreuung in die Wege geleitet werden.
In Bottrop und Essen war in der Silvesternacht ein 50-jähriger Deutscher mit seinem Wagen gezielt in Gruppen mit ausländisch aussehenden Personen gefahren. Acht Menschen unter anderem aus Syrien und Afghanistan wurden dabei zum Teil schwerst verletzt. Bei der Festnahme erklärte der aus Essen stammende Mann, er habe aus Ausländerhass gehandelt. Der 50-Jährige kam am 2. Januar wegen mehrfachen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Zudem prüfen die Ermittlungsbehörden derzeit auch noch, inwieweit eine psychische Erkrankung bei dem Beschuldigten vorliegt.
Sternsinger bei Steinmeier

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am 6. Januar in Berlin im Schloss Bellevue eine Abordnung der katholischen Sternsinger empfangen. Die 39 Kinder und Jugendlichen aus dem Bistum Trier schrieben den traditionellen Segen an das große Eingangsportal des Berliner Amtsitzes von Steinmeier und schenkten ihm eine Weinrebe. Anschließend luden der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender die Sternsinger ins Schloss ein.
Die Sternsinger sammeln bundesweit um den Jahreswechsel Spenden für notleidende Kinder in der Welt. Als Heilige Drei Könige verkleidet ziehen sie dafür von Tür zu Tür und schreiben den Schriftzug "C+M+B" auf Haustüren. Die Buchstaben stehen für den lateinischen Satz "Christus mansionem benedicat" (Christus segne dieses Haus) oder auch für die Anfangsbuchstaben der drei Könige, Caspar, Melchior und Balthasar.
Steinmeier dankte den Sternsingern für ihr Engagement. Es sei nicht selbstverständlich, sich für andere Menschen einzusetzen. "Ihr schaut nicht nur darauf, dass es euch gut geht", sagte Steinmeier. Sternsinger und die Menschen, die ihnen die Tür aufmachen, verbinde etwas: "Ihr seid offen für Neues", sagte der Bundespräsident.
Die Mädchen und Jungen, die Schloss Bellevue besuchten, kamen den Angaben zufolge aus den Pfarreien St. Antonius in Saarhölzbach, St. Hildegard in Emelshausen, St. Johannes in Sirzenich und dem Pestalozzi-Haus in Neunkirchen. Das Motto der diesjährigen Aktion heißt: "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!". Dabei soll besonders auf Kinder mit Behinderung aufmerksam gemacht werden. Beispielland ist Peru. Bundesweit eröffnet wurde die Aktion mit dem Dreikönigssingen am 28. Dezember im bayerischen Altötting.
Die seit 1959 stattfindende Sternsingeraktion wird vom Hilfswerk der Sternsinger und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) veranstaltet. Insgesamt haben die Sternsinger bisher mehr als eine Milliarde Euro gesammelt. Weltweit konnten dadurch mehr als 73.000 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert werden.
Segen "20 C+M+B 19" auch für Düsseldorfer Staatskanzlei
Düsseldorf (epd). NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat am 4. Januar in Düsseldorf 55 Sternsinger aus den katholischen Diözesen Aachen, Essen, Köln, Münster und Paderborn empfangen. "Ich finde es großartig, dass diese Mädchen und Jungen Engagement zeigen und sich für Zusammenhalt in der Welt einsetzen", sagte Laschet bei der Begrüßung der Mädchen und Jungen, die der Staatskanzlei den traditionellen Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus" überbrachten. Der Ministerpräsident lobte die Aktion als "einzigartige Geste der Solidarität von Kindern für Kinder". Dieser Einsatz für grundlegende gesellschaftliche Werte sei heute wichtiger denn je.
Das Motto der 61. Aktion Dreikönigssingen lautet "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen - in Peru und weltweit!". Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr auch Kinder mit Behinderungen. Die Sternsinger unterstützen nach eigenen Angaben mit den Spenden unter anderem das Projekt "Yancana Huasy" in der peruanischen Hauptstadt Lima. Die Einrichtung fördert jährlich rund 1.000 Mädchen und Jungen mit Behinderung und ermöglicht ihnen Zugang zu Bildung.
Noch bis zum 18. Januar sind deutschlandweit rund 300.000 Kinder und Jugendliche verkleidet als die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs. Sie klingeln an Haustüren, um den Bewohnern den Segen Gottes zu bringen und um Spenden zu bitten. Die Aktion Sternsingen gibt es in Deutschland seit 1959. Seitdem haben die Sternsinger rund eine Milliarde Euro gesammelt. Im vergangenen Jahr wurden mit den Spenden über 1.400 Projekte in 108 Ländern unterstützt.
Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Die Sternsinger sind eine der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit.
Neuer Mikrozensus in Nordrhein-Westfalen
Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen werden auch in diesem Jahr wieder ausgewählte Haushalte zu ihrer Größe und zum Familienstand befragt. Für den sogenannten Mikrozensus werden im ganzen Bundesland rund 350 geschulte Interviewer unterwegs sein und ihren Besuch vorher schriftlich ankündigen, wie das statistische Landesamt am 7. Januar in Düsseldorf mitteilte. Die Haushalte könnten auch selbst einen Fragebogen ausfüllen und diesen per Post an das Statistische Landesamt senden. Die Interviewer seien zur Verschwiegenheit verpflichtet. Für einen Teil der Fragen bestehe vonseiten der ausgewählten Haushalte eine Auskunftspflicht, hieß es.
Information und Technik Nordrhein-Westfalen befragt als statistisches Landesamt nach eigenen Angaben jährlich rund 80.000 Haushalte. Abgefragt werden beispielsweise persönliche Merkmale wie Alter, Familienstand, Staatsangehörigkeit, Schulbesuch und Erwerbstätigkeit. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht eine Auskunftspflicht. Doch auch bei der Beantwortung der Fragen auf freiwilliger Basis hoffen die Statistiker auf eine hohe Beteiligung. Denn die Ergebnisse lieferten die Basis für politische und wirtschaftliche Entscheidungen.
Der Mikrozensus wird den Angaben nach seit 1957 jedes Jahr bei einem Prozent aller Haushalte im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Es handelt sich um eine sogenannte Flächenstichprobe. Nach einem mathematischen Zufallsverfahren werden Straßenzüge beziehungsweise Gebäude ausgewählt. Die Haushalte, die in diesen Gebäuden wohnen, werden vier Jahre lang befragt. In jedem Jahr wird zur Entlastung der Befragten ein Viertel der Haushalte durch andere ersetzt.
Gericht weist Haftbeschwerde von mutmaßlichem Kölner Geiselnehmer ab
Köln (epd). Das Landgericht Köln hat eine Haftbeschwerde des mutmaßlichen Geiselnehmers vom Kölner Hauptbahnhof abgewiesen. Mit der am 4. Januar veröffentlichten Entscheidung bestätigte das Gericht den Haftbefehl des Amtsgerichts Köln gegen den Syrer, der wegen des Tatvorwurfs des versuchten Mordes in mehreren Fällen, der gefährlichen Körperverletzung und Geiselnahme seit Mitte Oktober in Untersuchungshaft sitzt. Er soll einen Brandsatz in ein Schnellrestaurant am Kölner Hauptbahnhof geworfen und anschließend in einer Apotheke eine Geisel genommen haben. (AZ: 111 Qs 65/18)
Die 11. große Strafkammer des Landgerichts verwies darauf, dass gegen den Mann dringender Tatverdacht bestehe. Bei dem Beschuldigten bestehe trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands Fluchtgefahr. In der Untersuchungshaft sei eine ausreichende medizinische Versorgung des Mannes möglich, erklärten die Kölner Richter weiter. Andere Unterbringungsmöglichkeiten wie Rehabilitationskliniken seien weder ersichtlich, noch in der Beschwerdebegründung aufgezeigt worden, zumal der Beschuldigte nicht krankenversichert sei.
Dem anerkannten Flüchtling, der seit 2015 bereits mehrfach straffällig geworden war, wird vorgeworfen, am 15. Oktober mit Benzin und Gas ein Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof betreten und einen Brandsatz geworfen zu haben. Die mit Stahlkugeln präparierten Gaskartuschen explodierten nicht, ein 14-jähriges Mädchen wurde jedoch durch den Brandsatz schwer verletzt. Anschließend soll der Mann eine Geisel in der gegenüberliegenden Apotheke genommen haben. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei überwältigte den Syrer und verletzte ihn durch Schüsse schwer. Ein zunächst angenommener Terrorverdacht erhärtete sich im Zuge der Ermittlungen nicht.
Besucherrekord in Gedenkstätte Berliner Mauer

epd-bild / Norbert Neetz
Berlin (epd). Die Gedenkstätte Berliner Mauer verzeichnete 2018 mit mehr als 1,1 Millionen Besuchern einen neuen Besucherrekord. Nach Angaben der Stiftung Berliner Mauer vom 3. Januar besichtigten im vergangenen Jahr 164.000 Menschen mehr das Gelände an der Bernauer Straße als im Vorjahr (956.000). In der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde blieben die Besucherzahlen mit 10.100 Besuchern konstant.
Die Gedenkstätte Günter Litfin am Spandauer Schifffahrtskanal unweit des Invalidenfriedhofs besuchten 2018 mehr als 7.000 Menschen. Sie erinnert an den ersten Mauertoten. Günter Litfin war wenige Tage nach dem Mauerbau am 24. August 1961 bei einem Fluchtversuch an der innerstädtischen Berliner Grenze erschossen worden.
Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren verzeichnet die Mauerstiftung mit ihren historischen Gedenk-, Erinnerungs- und Lernorten nach eigenen Angaben mehr als acht Millionen Interessenten. Die Stiftung wird seit 2009 mit Mitteln des Landes Berlin und des Bundes in Höhe von derzeit insgesamt rund 3,6 Millionen Euro jährlich gefördert.
Neben der Gedenkstätte Berliner Mauer und der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde gehören seit August 2017 die Gedenkstätte Günter Litfin und seit November 2018 auch die East Side Gallery zur Stiftung.
Bürgermeister Müller spricht von einer Erfolgsgeschichte
Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) nannte die Stiftung eine Erfolgsgeschichte. Ihre Arbeit strahle weit über die Berliner Museums- und Gedenkstättenlandschaft hinaus. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sprach von einem äußerst wichtigen Partner bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die konstant hohen Besucherzahlen belegten das ungebrochene Interesse an den Themen Diktatur und Widerstand, Demokratie, Unfreiheit und Freiheit - auch im 30. Jahr des Mauerfalls.
Stiftungsdirektor Axel Klausmeier betonte, alle historischen Orte, die heute zur Stiftung Berliner Mauer gehören, seien aus bürgerschaftlichem Engagement entstanden. "Dafür bin ich allen damaligen Akteurinnen und Akteuren dankbar. Unsere Aufgabe ist es, dieser Vielfalt der Perspektiven auch in Zukunft Ausdruck zu verleihen", sagte Klausmeier.
Ex-DDR-Bürgerrechtler warnt vor Verwässerung des Erinnerns an 1989
Leipzig (epd). Der Leiter der Leipziger Stasi-Gedenkstätte Museum in der "Runden Ecke", Tobias Hollitzer, warnt vor einer thematischen Beliebigkeit des Leipziger Lichtfestes. Mit Blick auf das 30. Jubiläum der friedlichen Revolution in diesem Jahr sagte der frühere DDR-Bürgerrechtler dem Evangelischen Pressedienst (epd): "Ich kann nicht alles, was irgendwie mit Demokratie oder demokratischem Zusammenleben zu tun hat, in das Lichtfest und in die Erinnerung an die friedliche Revolution packen." In Leipzig wird seit einigen Jahren um die thematische Ausrichtung der zentralen Gedenkveranstaltung am 9. Oktober gestritten.
Das Lichtfest erinnert seit 2009 im Verbund mit einem Friedensgebet und einer Rede zur Demokratie alljährlich an die entscheidende Montagsdemonstration vom 9. Oktober 1989. Damals zogen von der Leipziger Nikolaikirche aus mehr als 70.000 Menschen über den Innenstadtring und protestierten friedlich gegen das SED-Regime. Das Datum gilt als wichtige Wegmarke der friedlichen Revolution. Wenige Wochen später fiel die Mauer.
Kritiker haben zuletzt wiederholt eine thematische Überfrachtung des Festes und eine Verwässerung durch Bezüge zu aktuellen politischen Themen kritisiert. Dazu sagte Hollitzer dem epd: "Wir müssen nicht die Weltwirtschaft auf den Augustusplatz holen und auch nicht die Verantwortung für die ehemaligen Kolonialgebiete." Das seien "alles wichtige Dinge, über die wir nachdenken sollten, keine Frage. Aber nicht an diesem Tag und an diesem Ort", erklärte Hollitzer.
"Es geht um die Einmaligkeit des Ereignisses"
Auch dürfe man den 9. Oktober nicht zum Anlass nehmen, "um aktuelle politische Botschaften unters Volk zu bringen oder die Ereignisse von vor 30 Jahren ins Heute zu ziehen", sagte Hollitzer weiter. Wenn zum Beispiel "Legida"-Gegendemonstranten bei Sitzblockaden argumentierten, sie machten doch heute dasselbe wie die Demonstranten von 1989 und gingen auf die Straße, obwohl der Staat dies verboten habe, "dann ist bei der Vermittlung der Ereignisse von damals irgendetwas ganz grundsätzlich schiefgelaufen", sagte Hollitzer.
Es sei ein "riesengroßer Unterschied", ob sich jemand teilweise unter Inkaufnahme von Gefahren für die eigene Gesundheit und Biografie gegen eine Diktatur und für Demokratie einsetze, oder ob er heute "die damals erstrittene Freiheit und die demokratischen Grundrechte" nutze, fügte Hollitzer hinzu. Beim Erinnern müsse daher das Geschehen aus dem Herbst 1989 weiter klar im Fokus stehen: "Es geht um die Einmaligkeit des Ereignisses der friedlichen Revolution. Es geht darum, sich immer wieder deutlich zu machen, was damals, friedlich, möglich gewesen ist."
Weniger Interesse an Stasiakten
Berlin (epd). Das Interesse an den Stasiakten ist im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Nach Angaben der Stasi-Unterlagenbehörde (BStU) wurden bis Ende November 42.761 Anträge auf persönliche Akteneinsicht gestellt. Das waren knapp 3.600 Anträge weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (46.354). Endgültige Zahlen für 2018 lägen aber erst im Januar vor, sagte Behördensprecherin Dagmar Hovestädt dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Die meisten Anträge wurden bis Ende November in Berlin (13.437) und Sachsen (10.187) gestellt. Die wenigsten Ersuche gab es in Brandenburg mit 2.056 Anträgen. In Thüringen gingen 6.535, in Sachsen-Anhalt 5.414 und in Mecklenburg-Vorpommern 5.132 Anträge auf Akteneinsicht bei den Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde ein. Seit der Möglichkeit auf persönliche Akteneinsicht Anfang 1992 wurden bislang rund 3,2 Millionen sogenannte Bürgeranträge gestellt.
Neben Privatleuten können auch Wissenschaftler und Journalisten Einsicht in die Akten beantragen. Diese Zahlen werden gesondert aufgeführt.
Das Stasi-Unterlagen-Archiv ist derzeit noch auf 13 Standorte verteilt. In der Summe finden sich dort den Angaben zufolge mehr als 111 Kilometer Stasi-Akten. Davon sind etwa 43 Kilometer Material aus dem Ministeriumsstandort Berlin und etwa 68 Kilometer Material aus den früheren Bezirksverwaltungen der Staatssicherheit.
In den kommenden Jahren sollen die Aktenbestände in das Bundesarchiv überführt werden, aber weiterhin für alle zugänglich bleiben. Geplant ist, in jedem ostdeutschen Land ein Archivstandort zu erhalten.
Lucas-Cranach-Preis für Yadegar Asisi
Wittenberg (epd). Für besonderes gesellschaftliches Engagement hat die Lutherstadt Wittenberg am 4. Januar den Lucas-Cranach-Preis 2019 verliehen. Für die diesjährige Auszeichnung wurden vier Preisträger in verschiedenen Kategorien ausgewählt, darunter der Künstler Yadegar Asisi, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die Preise wurden während des städtischen Neujahrsempfangs vergeben. Asisi soll die Auszeichnung allerdings zu einem späteren Zeitpunkt entgegennehmen, da er nicht an dem Neujahrsempfang teilnehmen konnte. Der undotierte Lucas-Cranach-Preis ist nach der Ehrenbürgerwürde die höchste Auszeichnung, die die Lutherstadt Wittenberg jährlich vergibt.
Yadegar Asisi hatte anlässlich des 500. Reformationsjubiläums im Jahr 2017 das 360-Grad-Panorama "Luther 1517" gestaltet. Seit Ende Oktober 2016 ist die Lutherstadt damit neben Berlin, Leipzig, Dresden, Pforzheim und der französischen Stadt Rouen ein Ausstellungsort des Künstlers.
In der Kategorie "Arbeit im Ehrenamt" wurde die Deutsch-Russländische Gesellschaft geehrt. Sie gründete sich 1992, um Kindern zu helfen, die die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl 1986 überlebt haben. In der Kategorie "Impulse für die Stadt" wurde die Tesvolt GmbH ausgezeichnet, ein Anbieter intelligenter und ökonomischer Stromspeicher. Der Preisträger in der Kategorie "Kunst und Kultur" ist Michael Marinov. Der Musiker leitet ehrenamtlich das Paul-Gerhardt-Orchester der Kreismusikschule Wittenberg.
Soziales
Allgemeiner Tarifvertrag für die Altenpflege rückt näher

epd-bild / Thomas Lohnes
Berlin (epd). Es geht um mehr als eine Million Beschäftigte und ein politisches Versprechen: Altenpflegekräfte in Deutschland sollen besser bezahlt werden. An seinem ersten Tag als Bundesgesundheitsminister sagte Jens Spahn (CDU) auf dem Deutschen Pflegetag, sein Ziel sei, zu einer Tarifbezahlung in der Altenpflege zu kommen. In dreieinhalb Jahren, am Ende der Legislaturperiode, wolle er sagen können, es sei besser geworden.
Um eine Ausweitung der tariflichen Bezahlung in der Altenpflege wird schon lange gerungen. Rund 80 Prozent der Heime und Pflegedienste sind nicht tarifgebunden und nur zehn Prozent der Pflegekräfte gewerkschaftlich organisiert. Das liegt auch daran, dass zwei der großen Pflegeanbieter, die evangelischen und katholischen Träger, keine Tarifverträge sondern Arbeitsvertragsrichtlinien (AVR) haben.
Kirchlicher Extra-Weg
Sie erreichen damit bei den eigenen Einrichtungen eine hohe überbetriebliche Verbindlichkeit der Lohnabschlüsse - bei den diakonischen Unternehmen sind es laut dem Arbeitgeberverband VdDD 93 Prozent - aber eben nach kirchlichem Arbeitsrecht, das beispielsweise Streiks ausschließt. Mit der Bezahlung liegen Diakonie und Caritas am oberen Ende der Lohnskala.
Nicht nur der kirchliche Extra-Weg unterscheidet die Verhältnisse in der Altenpflege von anderen Branchen. Es existieren unterschiedliche Tarifwerke nebeneinander. Gemeinnützige Anbieter konkurrieren mit privaten Unternehmen und zunehmend auch mit Konzernen.
Politischer Wille ist da
Nun soll ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Tarifbindung getan werden. Der AWO-Bundesvorsitzende Wolfgang Stadler sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), er gehe davon aus, "dass im Januar der Durchbruch gelingt und alle Voraussetzungen erfüllt sind, um einen allgemeinverbindlichen Tarif in der Pflege umzusetzen". Ein gemeinsamer Arbeitgeberverband der nichtkirchlichen, gemeinnützigen Organisationen werde den notwendigen Rahmen geben, um das Projekt Anfang 2019 auf den Weg zu bringen, erklärte Stadler - gemeint ist die Aufnahme von Verhandlungen mit der Tarifkommission der Gewerkschaft ver.di.
Kommt es zu einem Abschluss, kann das Bundesarbeitsministerium diesen für allgemeinverbindlich erklären. Der politische Wille dazu ist da. Dann dürfte kein Pflegeunternehmen mehr geringere Löhne zahlen, als dieser Tarif vorgibt. Mit den Lohnforderungen will sich ver.di an den Tarifen im öffentlichen Dienst orientieren.
Niedriges Branchenniveau
Jörg Kruttschnitt vom Vorstand des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung ist zuversichtlich, dass es zu einem allgemeinverbindlichen Tarif kommen wird. Er glaubt aber, dass dieser niedrigere Löhne vorsehen wird als etwa die AVR der Diakonie. "Man darf nicht übersehen, dass die ganze Branche mitgenommen werden muss", sagte Kruttschnitt. Das Branchenniveau sei niedriger als die Bezahlung bei kirchlichen Trägern oder nach dem - kaum angewendeten - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.
Ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler sagte dem epd, der angestrebte Tarifvertrag werde dazu beitragen, dass sich mehr Menschen für den Pflegeberuf entscheiden und Altenpflegerinnen, die aus dem Beruf geflüchtet sind, zurückkommen. "Ein bundesweit geltender Tarifvertrag, der von keinem Anbieter unterschritten werden darf, hilft nicht nur den Beschäftigten, sondern müsste eigentlich auch im Interesse der privaten Pflegekonzerne sein", sagte Bühler weiter: "Wenn sie keine Fachkräfte mehr bekommen, ist schließlich ihr 'Geschäftsmodell' gefährdet."
"Schwerwiegender Eingriff in die Tarifautonomie"
Das sehen die privaten Anbieter anders, so etwa der Präsident des bpa-Arbeitgeberverbandes Rainer Brüderle: "Wir sehen die Versuche, allgemeinverbindliche Tarifverträge in der Pflege zu erleichtern, als schwerwiegenden Eingriff in die Tarifautonomie." Die Arbeitgeber seien gar nicht gegen Tarifverträge. Sie hätten aber kein Gegenüber, sagt Brüderle: "Wir stellen fest, dass ver.di aufgrund fehlender Mitglieder als Verhandlungspartner ausfällt."
Der bpa-Arbeitgeberverband hat eigene Entgelttabellen für alle Bundesländer beschlossen. Er reagiert damit auf den Druck Richtung tariflicher Bezahlung. Eine Pflegekraft verdiene danach knapp 60 Euro mehr im Monat als im Bundesdurchschnitt, erklärt der Verband. Offen bleibt allerdings, wie groß - oder gering - der Anteil der Unternehmen ist, die tatsächlich entsprechend bezahlen. Der Arbeitgeberverband Pflege, in dem die umsatzstärksten Konzerne zusammengeschlossen sind, spricht sich lediglich dafür aus, Pflegekräften ein Mindesteinkommen von 2.500 Euro monatlich zu garantieren.
Land NRW will Schiedsverfahren in Pflege beschleunigen
Düsseldorf (epd). Das Land NRW will die Schiedsverfahren zur Festlegung der Pflegesätze in Seniorenheimen vereinfachen und beschleunigen. Dazu solle in Nordrhein-Westfalen nun eine Novelle der Schiedsstellenverordnung auf den Weg gebracht werden, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am 3. Januar in Düsseldorf an. Die Schiedsverfahren dauern seiner Ansicht nach derzeit noch zu lange und sind zu kompliziert. "Wir brauchen einen möglichst niedrigschwelligen Zugang, damit einzelne Heime ermutigt werden, solche Verfahren zu führen", forderte Laumann.
Laumann: Entscheidungsprozesse entschlacken
Hintergrund der geplanten Novelle ist die Tatsache, dass die Pflegeheime und Einrichtungsträger in Deutschland mit den Kostenträgern - also den Pflegekassen und den Trägern der Sozialhilfe - für jedes Heim individuelle Pflegesätze aushandeln. Darin enthalten sind nicht zuletzt auch die Personalkosten. Kann man sich bei den Verhandlungen nicht auf eine Vereinbarung verständigen, können beide Seiten die Schiedsstelle anrufen, die anschließend die entsprechenden Pflegesätze festsetzt. Zwischen 2015 und 2018 wurden in NRW insgesamt 60 solcher Schiedsverfahren in der Pflege eingeleitet.
Durch die Novelle soll den Angaben nach künftig gesetzlich vorgeschrieben werden, dass die Schiedsstelle in Nordrhein-Westfalen maximal drei Monate Zeit hat, um eine Entscheidung zu treffen. Bereits nach sechs Wochen muss sie überdies dem NRW-Gesundheitsministerium einen Bericht über den Verlauf des Schiedsverfahrens vorlegen, sollte zu dem Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen sein.
Darüber hinaus soll mit der Novelle festgelegt werden, dass die Zahl der Mitglieder der Schiedsstelle auf elf begrenzt wird, wie es weiter hieß. Damit würden die bundesrechtlichen Mindestvorgaben erfüllt. "Bisher ist die Schiedsstelle in Nordrhein-Westfalen mit 19 Mitgliedern besetzt und viel zu groß. Das erschwert den Entscheidungsprozess unnötig", monierte Laumann.
Rekowski: Hospiz-Mitarbeiter geben Hilfe, Halt und Nähe

epd-bild / Werner Krüper
Bad Neuenahr (epd). Der rheinische Präses Manfred Rekowski hat die Bedeutung einer professionellen Sterbebegleitung für todkranke Menschen gewürdigt. "Sterbebegleitung heißt für mich, die Wünsche und Bedürfnisse der sterbenden Menschen bestmöglich zu erfüllen", sagte der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland am 4. Januar beim Besuch eines ökumenischen Hospizes im rheinland-pfälzischen Bad Neuenahr. "Nach christlichem Verständnis kommt jedem Menschen als Ebenbild Gottes eine besondere und unverlierbare Würde zu. Diese Würde gilt es im Leben und insbesondere auch im Sterben zu achten."
Aufgabe der Kirche sei es, Menschen in "eigentlich unaushaltbaren Situationen" seelsorglich zu begleiten, sagte Rekowski. So könne Hoffnung entstehen, erklärte der Präses. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitender der Hospize gäben den Gästen am Lebensende Hilfe, Halt und Nähe.
Das Hospiz im Ahrtal hatte im Januar 2016 seinen Betrieb aufgenommen. Es wird gemeinsam getragen vom Hospiz-Verein Rhein-Ahr, der katholischen Marienhaus-Unternehmensgruppe und den von evangelischen v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Das Haus verfügt über zehn Zimmer für schwerstkranke und sterbende Menschen und bietet palliativpflegerische und palliativmedizinische Versorgung, Schmerztherapie sowie psychosoziale Begleitung. Eine katholische Seelsorgerin und eine evangelische Pfarrerin betreuen die Hospizgäste sowie deren Angehörige. 2018 haben die rund 50 haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 109 Menschen am Lebensende begleitet. Gäste blieben im Durchschnitt etwa 33 Tage.
Zeugen nannten Ex-Krankenpfleger Högel "Rettungs-Rambo"
Oldenburg (epd). Im Mordprozess gegen den früheren Krankenpfleger Niels Högel vor dem Landgericht Oldenburg haben am 4. Januar weitere Polizeibeamte über ihre Ermittlungsarbeit berichtet. Auffällig sei, dass frühere Kollegen Högels aus dem Klinikum Oldenburg stets mit einem vom Klinikum bezahlten Rechtsanwalt zu den Vernehmungen erschienen seien, sagten die Ermittler übereinstimmend. Oft sei der Eindruck entstanden, die befragten Zeugen hielten sich mit ihren Erinnerungen zurück. Die Zeugen aus dem früheren Krankenhaus Delmenhorst hätten dagegen sehr viel freier ihre Eindrücke geschildert (Az: 5Ks 1/18).
Laut Anklageschrift soll der ehemalige Krankenpfleger in den Jahren 2000 bis 2005 in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst 100 Patienten mit Medikamenten vergiftet haben, die zum Herzstillstand oder Kammerflimmern führten. Anschließend versuchte er, sie wiederzubeleben, um als rettender Held dazustehen.
Högel bei fast allen Notfällen zugegen
Eine Ermittlerin berichtete von Gerüchten und Spitznamen wie "Rettungs-Rambo", die laut Zeugenaussagen im Krankenhaus Delmenhorst kursierten. Eine frühere Kollegin habe es als auffällig empfunden, dass Högel bei fast allen Notfällen zugegen gewesen sei. Doch auch sie habe keinen konkreten Verdachtsfall benennen können.
Eine andere Pflegerin habe ausgesagt, dass Högel oft 20 Minuten früher zur Arbeit gekommen sei, um sich in den Patientenzimmern einen Überblick zu verschaffen, berichtete ein weiterer Polizist. Die Zeugin habe sich einmal einer Kollegin anvertraut. Diese habe ihr geraten, den Mund zu halten, solange sie keine Beweise habe. Als dann die ersten Pflegekräfte von der Polizei vernommen worden seien, habe ein Vorgesetzter zusätzlichen Druck ausgeübt. Also habe sie weiter geschwiegen.
Prozess wird am 22. Januar fortgesetzt
Der pensionierte Kriminalbeamte Manfred B. erzählte, wie er mit dem Fall Högel in Kontakt kam. Das Krankenhaus Delmenhorst habe Högel am 1. Juli 2005 wegen eines Todesfalles angezeigt. Bei seinen Ermittlungen sei er auf den sprunghaften Anstieg von Todesfällen und den enormen Mehrverbrauch des Medikaments Gilurytmal gestoßen. "Und bei 75 Prozent der Sterbefälle hatte Högel Dienst", sagte der Kripo-Beamte. Er habe nach Abschluss seiner Ermittlungen die Akten an die Staatsanwaltschaft weitergegeben mit dem Hinweis, dass er Högel für weitere Taten verantwortlich halte.
Im Dezember 2006 wurde Högel für diesen Fall zu fünf Jahren Haft wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und zu fünf Jahren Berufsverbot verurteilt. Allerdings musste er bis 2009 nicht ins Gefängnis, weil Revision eingelegt wurde. Weitere Ermittlungen wurden zu dem Zeitpunkt vonseiten der Staatsanwaltschaft trotz des Hinweises damals nicht betrieben.
Der Prozess wird am 22. Januar fortgesetzt. Dann sollen frühere Kollegen und Ärzte befragt werden. Högel hat im Verlauf des Prozesses, der Ende Oktober begonnen hatte, 43 Mordfälle eingeräumt. Fünfmal wies er die Anschuldigung zurück. An die weiteren Patienten könne er sich nicht erinnern, sagte er. Wegen weiterer Taten verbüßt Högel bereits eine lebenslange Haftstrafe.
Berliner Diakonie fordert Bauprogramm für Wohnungslose

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Die Berliner Diakoniechefin Barbara Eschen hat sich für ein Sonderbauprogramm für Wohnungslose ausgesprochen. Die rund 50.000 Menschen, die in der Hauptstadt wegen fehlenden Wohnraums in Unterkünften von den Behörden untergebracht seien, seien "ein Problem, das angegangen werden muss", sagte Eschen in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd).
"Wir müssen uns um diese Menschen spezielle Gedanken machen", betonte die Berliner Diakoniechefin weiter. Unabhängig von der Debatte um kostengünstigen Wohnraum sei ein eigenes Wohnungsbauprogramm für diese Gruppe nötig, damit sich die Situation entspannt. "Es ist zu befürchten, dass die Zahl der Wohnungslosen noch zunimmt", sagte Eschen. Deshalb sollten gegebenenfalls auch "Übergangsbauten" wie etwa Modularbauten genutzt werden.
Als wohnungslos werden Menschen bezeichnet, die - aus welchen Gründen auch immer - keine eigene Wohnung mehr haben und anderweitig untergebracht worden sind. Dazu gehören auch Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften.
Lob für Kältehilfe
Weiter lobte Eschen die diesjährige Kältehilfe, die als Notversorgung Obdachlosen in der Winterzeit einen Schlafplatz zur Verfügung stellt. Anders als in den Vorjahren habe die Versorgung rechtzeitig begonnen. Aktuell stünden rund 950 Schlafplätze zur Verfügung. Die Auslastung liege bei 76,7 Prozent, hieß es weiter. Außerdem gebe es so 129 Schlafplätze für Frauen, so viele wie noch nie: "Das ist richtig gut, die werden aber nicht so nachgefragt." Die Auslastung lag bis kurz vor Weihnachten bei 43 Prozent. Der Grund dafür sei noch unklar, sagte Eschen.
Deutlich weniger Hartz-IV-Haushalte

epd-bild/Norbert Neetz
Berlin (epd). Die Zahl der Hartz-IV-Empfänger geht nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit deutlich zurück. Erstmals seit der Einführung der Arbeitsmarktreform lebten im November weniger als drei Millionen Haushalte von der Grundsicherung, wie die Bundesagentur am 4. Januar in Nürnberg mitteilte. Im Dezember sank die Zahl der Hartz-IV-Bezieher weiter. Bundesagentur-Chef Detlef Scheele (SPD) sagte, er sehe keine Notwendigkeit für eine grundlegende Hartz-IV-Reform, wohl aber für Korrekturen. Union und FDP nannten Hartz IV ein "erfolgreiches System".
Die Bundesagentur verzeichnete im Dezember rund 2,995 Millionen sogenannte Bedarfsgemeinschaften. Das sind 5,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und 17 Prozent weniger als 2008. In den Hartz-IV-Haushalten lebten im Dezember 2018 zusammen gut 5,9 Millionen Menschen, wie die BA weiter mitteilte. Das waren 281.000 weniger als ein Jahr zuvor.
Der Chef der Bundesagentur wertet den Rückgang der von Hartz IV abhängigen Haushalte als Beleg für eine funktionierende Grundsicherung. Viele ehemalige Hartz-IV-Bezieher hätten Arbeit gefunden oder seien in Rente gegangen, sagte Scheele in Nürnberg.
Für den sozialpolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Peter Weiß (CDU), zeigen die Zahlen, dass "es keinen Grund für eine größere Reform oder gar die Abschaffung von Hartz IV gibt". Umfassende Änderungen, etwa bei Sanktionen, gefährdeten die Erfolge: "Wir haben mit diesem System über 1,1 Millionen Empfänger aus der Arbeitslosigkeit geholt", sagte Weiß.
Der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, nannte es vollkommen unverständlich, dass Politiker von SPD und Grünen Hartz IV abschaffen wollen. "Stattdessen muss Hartz IV weiter verbessert werden, beispielsweise durch eine maßvolle Ausweitung des Schonvermögens", forderte Kober.
Bundesagentur-Chef Scheele für Reformen
Bundesagentur-Chef Scheele sprach sich ebenfalls für Reformen am Hartz-IV-Gesetz aus. Er plädierte für eine Vereinfachung des Leistungsrechts und für ein Ende härterer Sanktionen von Hartz-IV-Beziehern unter 25 Jahren. Die Sanktionen für Jüngere sollten an diejenigen für ältere Hartz-IV-Bezieher angeglichen werden, sagte Scheele. Die Abschaffung des umstrittenen Gesetzes lehnte er ab.
Scheele wehrte sich gegen Vorwürfe, die Jobcenter drangsalierten Langzeitarbeitslose. Auch zwängen die Jobcenter die Langzeitarbeitslosen nicht, jede Stelle anzunehmen. Vielmehr würden oftmals zweijährige Umschulungsmaßnahmen einer Arbeitsstelle vorgezogen, um auf diese Weise eine "nachhaltige Integration am Arbeitsmarkt zu erzielen", sagte Scheele.
Trotz der positiven Entwicklung bei der Grundsicherung seien "nach wie vor über eine Million erwerbstätige Menschen im Leistungsbezug, die trotz Arbeit mit Hartz IV aufstocken müssen", erklärte der Paritätische Wohlfahrtsverband. Der Sozialverband forderte eine Anhebung der Regelsätze für Erwachsene von derzeit 424 Euro auf 571 Euro und die Einführung einer existenzsichernden Kindergrundsicherung.
Kommunalverband: Ländliche Regionen brauchen mehr Unterstützung
Berlin (epd). Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert rasche Investitionen in Bildung und Infrastruktur und von allen Bundesländern die Einrichtung zentraler Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen für Flüchtlinge. Der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes, Uwe Brandl (CSU), und Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg warnten vor einer Benachteiligung ländlicher Regionen in Deutschland. Sie sagten bei der Vorstellung der Bilanz 2018 und des Ausblicks 2019 am 3. Januar in Berlin, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, müsse für gleichwertige Lebensverhältnisse beherzt eingetreten werden.
Bilanz bei Integration "ernüchternd"
Mit Blick auf die Integration von Flüchtlingen sprach Verbandspräsident Brandl, der auch Bürgermeister im niederbayerischen Abensberg ist, von einer "ernüchternden" Bilanz. Nur zehn Prozent dieser Menschen seien in Lohn und Brot. Noch immer hake es bei der Anerkennung von Abschlüssen. Die große Mehrheit sei nach wie vor auf Transferleistungen angewiesen.
Bund und Länder müssten die Kosten für geduldete und für rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber übernehmen, die weder ausreisen noch abgeschoben werden können, fordert der Städte- und Gemeindebund. Die finanziellen und personellen Mehrbelastungen für deren Versorgung hinderten die Kommunen daran, sich auf Menschen mit einer guten Bleibeperspektive zu konzentrieren.
Der Städte- und Gemeindebund erwartet von allen Bundesländern, dass sie sogenannte Anker-Zentren einrichten. Abgelehnte Asylbewerber und solche mit unklarer Bleibeperspektive dürften gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden, sondern müssten in solchen Zentren bleiben, bis ihre Verfahren abgeschlossen seien. Bisher gebe es aber nur sieben solcher Zentren in Bayern, Sachsen und im Saarland, bemängelt der Kommunalverband.
Der kommunale Investitionsrückstand habe im vergangenen Jahr einen traurigen Rekord von 159 Milliarden Euro erreicht. "Obwohl die Steuerquellen sprudeln und vieles unternommen wird, fühlen sich die Menschen in Deutschland in manchen Gegenden abgehängt", erklärten Landsberg und Brandl. Sie betonten: "Wo der Bus nur einmal am Tag fährt, die Ärzte sich zurückziehen, die Schulen in schlechtem Zustand und die Arbeitsplätze sehr weit entfernt sind, ist dies nachvollziehbar."
Kritik an Fülle von Bauvorschriften
Als eines der Investitionshemmnisse nannte Hauptgeschäftsführer Landsberg die Bürokratie. Allein die Zahl der Bauvorschriften habe sich in den vergangenen Jahren vervierfacht. Bundesweit seien im vergangenen Jahr nur 284.000 neue Wohnungen gebaut worden; es würden aber pro Jahr 400.000 zusätzliche Wohnungen benötigt.
Den Kindertagesstätten fehle es an Platz, Personal und Geld. Beim Ausbau von Bahnstrecken dauere ein Kilometer gar bis zu acht Jahren. Bei der Digitalisierung wolle jeder 5G, doch niemand Masten vor der Haustür haben, monierte er. Brandl warnte davor, ländliche Regionen durch unterschiedliche Geschwindigkeiten beim Breitbandausbau weiter zu benachteiligen.
Der "Scheinwerfer" dürfe nicht nur auf die Großstädte gerichtet werden, mahnte Landsberg und betonte, dass laut Umfrage nur 16 Prozent der Bevölkerung in einer Großstadt leben wollten, die Übrigen bevorzugten Dörfer oder Kleinstädte.
IW-Studie: Kita-Gebühren gleichen einem "Flickenteppich"

epd-bild/Kathrin Doepner
Köln (epd). Bei den Gebühren für die Betreuung von Vorschulkindern in Kindertagesstätten gibt es in Deutschland laut einer aktuellen Untersuchung große Unterschiede. Wie eine am 2. Januar vorgelegte Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ergab, gleicht die Höhe der Elternbeiträge im bundesweiten Vergleich einem "Flickenteppich". Wie viel Geld Eltern für einen Kita-Platz ausgeben müssten, hänge demnach stark vom Wohnort ab. Bund und Länder ließen den Kommunen viel Spielraum bei der Gestaltung der Gebührenordnungen, zudem unterschieden sich die gesetzlichen Vorgaben der Bundesländer stark, hieß es.
In der Studie hatte das IW die Gebührenordnungen der 26 größten deutschen Städte mit mehr als 250.000 Einwohnern sowie aller Landeshauptstädte untersucht. Berlin hat den Angaben zufolge die Kita-Gebühren komplett abgeschafft, in Rheinland-Pfalz müssen Eltern nur für Kinder unter zwei Jahren zahlen. In Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein ist dagegen auch das letzte Kindergartenjahr kostenpflichtig.
Auch zwischen Nachbarstädten gibt es mitunter deutliche Unterschiede bei den Gebühren. Ein Paar, das in Köln 50.000 Euro brutto pro Jahr verdient und ein anderthalbjähriges Kind 35 Stunden in der Woche betreuen lässt, zahlt dafür im Schnitt 298 Euro monatlich. In Düsseldorf würde dasselbe Paar nur 125 Euro bezahlen, wie das IW erklärte. Die Gebühren seien zudem in vielen Städten nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt. Aber auch bei der Staffelung gebe es deutliche Differenzen: So verlangt etwa Duisburg den maximalen Elternbeitrag schon ab einem Bruttoeinkommen von 75.000 Euro, Münster dagegen erst ab 150.000 Euro.
Um die Gebühren in Deutschland zu vereinheitlichen, spricht sich der Studienautor und IW-Ökonom Wido Geis-Thöne für ihre komplette Abschaffung aus. Nur so würde niemand mehr benachteiligt werden, erklärte er. Allerdings müssten dann im Gegenzug die Zuschüsse der Länder und die Bundes erhöht werden. Städte und Gemeinden seien auf diese finanzielle Unterstützung angewiesen, da sie ansonsten nicht in der Lage seien, die Betreuung weiter zu verbessern und neue Plätze zu schaffen.
Die Entdeckung der Hypersensibilität

epd-bild/Markram
Frankfurt a.M., Bielefeld (epd). Der Straßenverkehr dröhnt in den Ohren wie kreischender Fluglärm. Lichter blenden wie Hochleistungsscheinwerfer. Die Gespräche der Menschen ringsum ergeben eine verworrene Kakophonie aus Wortfetzen. Eindrücke, die den meisten Menschen kaum auffallen, werden von vielen Autisten sehr intensiv wahrgenommen.
Zu der Erkenntnis der Hypersensibilität von Autisten war es allerdings ein langer Weg. "Seit 60 Jahren wird behauptet, Autisten haben keine Gefühle, keine Empathie", sagte der israelische Hirnforscher Henry Markram dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Aber wenn du aus einer anderen Perspektive draufschaust, kommst du zu einem anderen Schluss." Der heute 56-Jährige hatte sich bereits einen Namen als Neurologe gemacht, als seine Frau Anat und er einen autistischen Sohn bekamen. "Ein besonderer Zufall", sagt Markram heute. Denn er sollte das Verständnis von Autismus grundlegend infrage stellen.
In Rituale geflüchtet
Auf den ersten Blick wirke es oft so, als könnten viele Menschen mit Autismus-Spektrums-Störungen sich nicht in andere hineinversetzen, räumt Markram ein. Viele Autisten sprächen etwa am Telefon so, als sei der Gesprächspartner im selben Raum. Oder sie bekämen scheinbar unvorhersehbare Wutausbrüche. Auch bei seinem Sohn Kai sei das vorgekommen. Er habe sich nicht so entwickelt wie andere Kinder, sich abgekapselt und in Rituale geflüchtet: Ohne die richtigen Socken ging er morgens nicht aus dem Haus, ohne ein Brot mit Hüttenkäse und das richtige Kissen abends nicht ins Bett.
Andererseits habe Kai aber auch die Gabe, sich in Menschen hineinzuversetzen und ihre Gefühle vorherzusagen. In Urlauben eroberte er die Herzen der Hotelmitarbeiter und liebte es, Menschen zu umarmen. Solche Situationen beschreibt der Journalist und Autor Lorenz Wagner. Er hat die Familie einige Monate begleitet und ihre Geschichte nun in dem Buch "Der Junge, der zu viel fühlte" veröffentlicht. Das passte nicht richtig mit den wissenschaftlichen Annahmen zusammen. Um seinen Sohn verstehen zu können, spezialisierte sich Markram auf neurologische Autismusforschung.
Gehirnzellen sind hyperreaktiv
Nach jahrelangen Tests gelang Markram und seiner jetzigen Frau Kamila schließlich ein Durchbruch: Die Gehirnzellen von Autisten sind demnach hyperreaktiv. Für die Wahrnehmung heißt das, die Sinneseindrücke werden verstärkt wahrgenommen. So kamen die Markrams zu der These: Autisten haben gar nicht zu wenig Gefühle, sondern zu viel. Von Autisten wird die Welt also viel schneller, lauter, bunter wahrgenommen. "Intense World Syndrom" nennen die Markrams das.
Der Rückzug autistischer Menschen in ihre eigene Welt sei also eher ein Schutzmechanismus vor diesem Sinnesfeuerwerk, folgerten die Markrams. Die Ursachen für soziale und sprachliche Probleme autistischer Kinder lägen demnach darin, dass wichtige Impulse im Chaos der Reize untergingen. Frühes Gegensteuern, ein Reduzieren intensiver Reize in der Umgebung der Kinder könne die Behinderung mildern oder gar ganz vermeiden, folgern die Markrams. Autistische Kinder sollten nicht dazu gedrillt und gedrängt werden, mit anderen zu interagieren, sondern erst einmal in ihrer eigenen Welt gelassen werden.
Mehr Verständnis entwickeln
Die Theorie ruft aber auch Kritik hervor: Auch zu wenige Reize, zu wenig Input in frühen Entwicklungsphasen könnten die Entwicklung sozialer, kognitiver und emotionaler Fähigkeiten von Kindern gefährden, schreiben Anna Remington und Uta Frith in dem wissenschaftlichen Autismus-Magazin "Spectrum". Die Ausprägungen von Autismus seien zudem so unterschiedlich, dass eine übergreifende Theorie zu weit gegriffen sei.
Trotz der Kritikpunkte mache Markrams Forschung eines deutlich, sagt Wolfgang Ludwig von den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel: "Das Thema Hypersensitivität wurde in der Arbeit mit Autisten zu lange vernachlässigt." Der Pädagoge und Gesundheitsmanager ist in Bielefeld-Bethel für die Arbeit mit Autisten zuständig. Autisten würden oft in die Nerd-Ecke gestellt, aber im Autismus-Spektrum gebe es natürlich sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.
Um mehr Verständnis zu entwickeln, brauche es in Deutschland noch deutlich mehr Aufklärung, sagt Ludwig: "Dafür muss vor allem auch Menschen mit Autismus selbst eine Bühne gegeben werden." Denn Mythen über Autismus hielten sich hartnäckig. "Nicht Autisten fehlt es an Empathie", sagt Markram. "Sondern uns fehlt sie für sie."
Zahl der Gewebespender 2018 deutlich gestiegen
Hannover/Saarbrücken (epd). In Deutschland haben im vergangenen Jahr 16 Prozent mehr Menschen Gewebe gespendet als 2017. Durch die uneigennützige Entscheidung von 2.711 Betroffenen hätten 5.544 Patienten zeitnah und sicher mit Transplantaten versorgt werden könnten, teilte die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation mit Sitz in Hannover am 1. Januar mit. Die Spenden in Baden-Württemberg, im Saarland, in Thüringen und Berlin hätten sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Der Bedarf an humanen Gewebetransplantaten sei nach wie vor hoch.
Neben der Zustimmung zur Spende spiele auch das Engagement der Krankenhäuser eine entscheidende Rolle, erklärte die Gesellschaft. Nicht jede Klinik verfüge über eine eigene Gewebebank und sei in der Lage, Gewebespenden zu realisieren. Inzwischen gebe es 27 Standorte, die bundesweit mehr als 90 Kliniken versorgten. In dem offenen Netzwerk der Gesellschaft kooperierten zahlreiche Universitätskliniken sowie kommunale und konfessionelle Krankenhäuser und große Klinikverbünde, hieß es.
Insgesamt gingen bei den Spendekrankenhäusern den Angaben zufolge 35.992 Meldungen potenzieller Spender ein. Die durchschnittliche Zustimmungsquote habe bei 38 Prozent gelegen. Es gebe viel Zustimmung in der Bevölkerung. Gewebe, die nach dem Tod gespendet werden können, seien neben Augenhornhäuten, Herzklappen und Blutgefäßen auch Knochen, Sehnen, Bänder und Haut.
Die Deutsche Gesellschaft für Gewebetransplantation ist nach eigenen Angaben eine unabhängige, gemeinnützige Gesellschaft, die ausschließlich von öffentlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens getragen wird. Gesellschafter sind die Medizinische Hochschule Hannover, das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden, das Universitätsklinikum Leipzig, die Universitätsmedizin Rostock sowie das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg.
Studie: Viel helfen macht glücklicher als viel verdienen
Berlin (epd). Wer gerne hilft, sich für die Familie engagiert und religiös lebt, ist laut einer Studie zufriedener als andere Menschen. Das Streben nach Geld und Karriere macht hingegen eher unglücklich, wie aus einer am 3. Januar vorgelegten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hervorgeht. Besonders groß ist die Zufriedenheit demnach, wenn sich in einer Beziehung beide Partner für andere und die Familie engagieren.
In ihrer Analyse haben Gert G. Wagner, Senior Research Fellow am DIW Berlin, und der australische Sozialwissenschaftler Bruce Headey von der Universität Melbourne die Bedeutung von vier möglichen "Glücksrezepten" überprüft: die Bereitschaft, anderen zu helfen (Altruismus), Familienorientierung, religiöser Glaube sowie Geld und Karriere.
Das Ergebnis der Analysen zeigt: Je altruistischer Menschen sind, desto zufriedener sind sie mit ihrem Leben. Auch familienorientierte Menschen, also Menschen, denen ihre Kinder und Haus- und Gartenarbeit besonders wichtig sind, sind im Durchschnitt zufriedener als ihre Mitmenschen. "Das ist vor allem dann der Fall, wenn beide Partner die gleichen Werte leben", sagte Studienautor Wagner.
Auch der religiöse Glaube kann der Studie zufolge die Lebenszufriedenheit steigern. Das könne auch dadurch erklärt werden, dass religiöse Menschen häufiger als andere altruistisch und familienorientiert leben, schreiben die Autoren.
Wer hingegen vor allem nach materiellen Werten strebt, also mehr verdienen will als andere, sei im Durchschnitt unzufriedener, als er sein könnte. "Solche Menschen sind dem stetigen Stress ausgesetzt, dass andere noch erfolgreicher sind. Denn nicht jeder kann an der Spitze stehen", erklärte Wagner. Allerdings ist nach Angaben der Wissenschaftler auch eine andere Interpretation der Studienergebnisse möglich: Nicht Geld und Karriere machen unglücklich, sondern unglückliche Menschen versuchen, mit Hilfe von Geld und Karriere zufriedener zu werden.
Für die Studie wurden mehr als 100.000 Angaben von Menschen im Alter von 25 bis 54 Jahren analysiert, die zwischen 2003 und 2016 immer wieder befragt worden waren. Darüber hinaus wurden knapp 30.000 Angaben von Befragten einer australischen Langzeitstudie ausgewertet.
Schulabgänger in NRW spenden 8.400 Euro für guten Zweck
Düsseldorf (epd). Die besten Schulabgängerinnen und Schulabgänger des vergangenen Jahres aus Nordrhein-Westfalen haben insgesamt 8.400 Euro für zwei ehrenamtliche Initiativen im Land zur Verfügung gestellt. Zusammengekommen war das Geld durch einen Brief, den Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) im Oktober an 1.480 Schulabsolventen mit der Note 1,0 beziehungsweise 1,3 (Schüler mit Inklusionsbedarf) geschrieben hatte, wie die Staatskanzlei am 3. Januar in Düsseldorf mitteilte. Die Schulabgänger konnten sich bis Anfang Dezember entscheiden, ob sie einen Büchergutschein in Höhe von 20 Euro erhalten oder das von der Landesregierung zur Verfügung gestellte Preisgeld an eine von zwei ehrenamtlichen Initiativen spenden wollen.
1.167 der Absolventinnen und Absolventen antworteten per Online-Aktion auf das Schreiben des Ministerpräsidenten: 420 entschieden sich für eine Spende. Das Geld kommt nun zum einen der Initiative "Auxilium Reloaded" der Malteser aus Dortmund zugute. Dort wird Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit riskantem Medienkonsum geholfen. Zum anderen geht das Geld an die Initiative "ArbeiterKind.de NRW" in Essen, die Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne Hochschulerfahrung dabei unterstützt, als erste in ihrer Familie zu studieren.
Die Besten-Ehrung findet seit 2007 jedes Jahr statt. Damit sollen herausragende Schulleistungen an allen weiterführenden Schularten in NRW gewürdigt werden.
Bewerbungsfrist für Hildebrandt-Preis 2019 endet
Bielefeld (epd). Die Bielefelder Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut zeichnet auch in diesem Jahr vorbildliche soziale Projekte mit dem Regine-Hildebrandt-Preis aus. Noch bis zum 31. Januar können online unter www.stiftung-solidaritaet.de Projekte oder Einzelpersonen aus Deutschland vorgeschlagen werden, die sich beispielhaft für Hilfen bei Arbeitslosigkeit und Armut einsetzen, wie die Stiftung am 3. Januar mitteilte. Soziale Initiativen können sich zudem selbst bewerben. Der Preis ist demnach mit 10.000 Euro dotiert und kommt ausschließlich gemeinnützigen Projekten nach Wahl der Preisträger zugute.
Der Regine-Hildebrandt-Preis wird seit 1997 für besonderes soziales Engagement vergeben. Die Auszeichnung erinnert an die erste Preisträgerin und spätere Schirmherrin der Stiftung, die SPD-Politikerin Regine Hildebrandt (1941-2001). Hildebrandt war 1990 in der ersten frei gewählten Regierung der ehemaligen DDR Ministerin für Arbeit und Soziales, anschließend war sie neun Jahre Ministerin des Landes Brandenburg für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Preisträger im vergangenen Jahr waren die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali sowie das Berliner Integrationsprojekt "Über den Tellerrand".
Medien & Kultur
EKD-Kulturbeauftrager sieht "Holo-Kitsch" bei Menasse

epd-bild/Norbert Neetz
Frankfurt a.M./Berlin (epd). Der evangelische Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen wirft dem Schriftsteller Robert Menasse "Holo-Kitsch" vor. Dessen in Diskussionen und Essays geäußerte Behauptung, Walter Hallstein (1901-1982) habe seine Antrittsrede als erster europäischer Kommissionschef 1958 am Ort des NS-Konzentrationslagers gehalten, sei eine "geschmacklose Auschwitz-Erfindung", sagte Claussen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sie sei historisch falsch, moralisch anstößig, weil sie den Holocaust instrumentalisiere, und ästhisch nicht überzeugend.
Daher habe Menasse auch wenig Anlass, andere Leute zu kritisieren, sagte Claussen mit Blick auf Menasses Beitrag in der "Welt" (5. Januar), in dem der österreichische Autor sich zwar für die angeblichen Zitate entschuldigt, den Deutschen in Bezug auf die Positionen Hallsteins aber erneut Vergesslichkeit vorwirft und von "künstlicher Aufregung" spricht.
"Mir scheint, er ist sich nicht klar in dem, was er tut", sagte Claussen. Einerseits erzähle Menasse Geschichten, und in der Fiktion sei alles möglich und erlaubt; andrerseits vertrete der Autor eines Brüssel-Romans und Träger des Deutschen Buchpreises von 2017 ein politisches Interesse. "In der Ideenpolitik müsste er sich dem Anspruch von Wahrhaftigkeit unterstellen und dem wird er nicht gerecht", sagte der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Politik gehorcht anderen Regeln als Literatur und man kann nicht einfach Dinge behaupten, die nicht stimmen."
Dass Menasse seinem Europaprojekt geschadet habe, sieht Claussen nicht. Seine europapolitische Idee habe jedoch erkennbare Schwächen. Man müsste Europa vor "überengagierten Apologeten" eher verteidigen, sagte der Theologe. Notwendig seien keine "besinnungslos Begeisterten", sondern vielmehr "nüchterne Sympathie".
Es sei gut, dass es heute ein stärkeres Interesse gebe, Menschen wie Menasse oder den früheren "Spiegel"-Autor Claas Relotius auf die Wahrhaftigkeit ihrer Aussagen zu überprüfen, sagte der EKD-Kulturbeaufragte weiter. Wer im öffentlichen Leben stehe, müsse wissen, was er tue - das gelte für Politiker, Pfarrer, Journalisten, Schriftsteller und andere.
Als die Geschichte der Familie Weiss die Deutschen bewegte
Die US-Fernsehserie "Holocaust" löste vor 40 Jahren ein ungeahntes Echo in Deutschland aus. Über das Schicksal der Familie Weiss fanden viele Deutsche Zugang zu ihrer eigenen Geschichte.Frankfurt a.M. (epd). Die Ausstrahlung der Fernsehserie "Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss" im deutschen Fernsehen ab dem 22. Januar 1979 war ein Medienereignis - und auch ein Wendepunkt in der deutschen Erinnerungskultur. Danach wurden Naziverbrechen und Massenmord an den europäischen Juden anders wahrgenommen. Mit "Holocaust" geriet Auschwitz ins kollektive Gedächtnis und der Begriff "Holocaust" wurde Allgemeingut, bis heute.
Zuvor war die Serie im US-Fernsehen gelaufen, durchaus umstritten. Der jüdische Philosoph und Holocaust-Überlebende Eli Wiesel (1928-2016) fällte das Urteil, es handle sich um eine "Trivialisierung des Holocaust". Produziert wurde sie vom US-Sender NBC. Sie war eine Antwort auf den kommerziellen Erfolg der ABC-Serie "Roots" über die Sklaverei in den USA. Hier wie dort wählte Regisseur Marvin J. Chomsky das Format der Mini-Serie mit überschaubarem Personal und übersichtlicher Dramaturgie nach amerikanischen Erzählmustern.
"Holocaust" erzählt von der Judenverfolgung der Nationalsozialisten am Beispiel zweier fiktiver Familien, der jüdischen Familie Weiss und der Familie des SS-Sturmbannführers Erik Dorf. Die Protagonisten durchleben im Film wesentliche historische Stationen, von der Pogromnacht 1938 bis zum Warschauer Ghetto, vom Massaker in Babi Jar bis Auschwitz.
Nur Sohn Rudi Weiss überlebt, alle anderen kommen ums Leben. Erik Dorf begeht Suizid. Im Film wird er Adjutant von Reinhard Heydrich, berüchtigter Chef des Reichssicherheitshauptamtes und Organisator des Massenmords an den Juden.
Deutsche Schauspieler nur in Nebenrollen
Gedreht wurde in Wien, Berlin-Wedding und im KZ Mauthausen. Die Darsteller der wichtigen Rollen kamen aus den USA, die Nazis wurden von Briten gespielt, deutsche Schauspieler fanden sich nur in Nebenrollen. "Holocaust" wurde insgesamt in mehr als 30 Ländern ausgestrahlt und von weltweit 700 Millionen Zuschauern gesehen.
Die deutsche Ausstrahlung verlief kompliziert: Schon zuvor wurde in der Presse über Trivialisierung und Emotionalisierung des Massenmordes an den europäischen Juden diskutiert. Die ARD konnte sich über eine Platzierung im Ersten nicht einigen, der Bayerische Rundfunk drohte mit Ausstieg. Man verständigte sich auf eine gemeinsame Ausstrahlung in allen Dritten Programmen, ein mediengeschichtliches Novum.
Der Erfolg war überwältigend. Die Zuschauerzahl stieg mit jeder Folge an. Am Ende hatte jeder zweite erwachsene Deutsche wenigstens einen Teil der Serie gesehen. Auch bei den mitternächtlichen Fernseh-Debatten im Anschluss an die Ausstrahlungen blieb die Zuschauerbeteiligung hoch. Die Telefonnetze der Sender brachen unter dem Ansturm der Anrufe zusammen.
Was war geschehen, dass es sich anfühlte, als hörten die Deutschen mehr als 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs zum ersten Mal von den Verbrechen der Nazis? Immerhin war das Thema nicht vom Himmel gefallen. Es gab den Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963-65 und den Düsseldorfer Majdanek-Prozess 1975-1981.
Im Theater hatten 1963 Rolf Hochhuths "Der Stellvertreter" - über die Haltung des Vatikan zu den Judendeportationen - und 1965 Peter Weiss' "Die Ermittlung" über den Auschwitz-Prozess für Debatten gesorgt. Mitte der 50er Jahre war "Nacht und Nebel" entstanden, ein Dokumentarfilm über das KZ-System von dem Franzosen Alain Resnais. Im Fernsehen waren Eberhard Fechners Film über den Majdanek-Prozess gelaufen und Egon Monks "Ein Tag - Bericht aus einem Konzentrationslager 1939".
Aber die vielen Dokumente, Beweise, Appelle und Analysen erreichten nicht die Wirkung des TV-Vierteilers "Holocaust". Norbert Schneider, damals Fernsehbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, analysierte 1979, es sei den vielen ambitionierten Versuchen kaum mehr gelungen, "als die Aufgeklärten noch einmal aufzuklären": "Für wenige wird relativ viel angeboten, für die vielen dagegen relativ wenig". Fazit: "Die Aufklärung über Ursachen und Geschichte des deutschen Faschismus als eine massenhafte Veranstaltung ist noch zu leisten - jedenfalls in den Medien."
In "Holocaust" wurde nichts beschönigt
Dass die US-Serie "Holocaust" über die Ursachen des Faschismus aufgeklärt habe, kann man nicht sagen. Wohl aber, dass die Serie einen stillgelegten Bewusstseinsbereich bei "den vielen" aufgebrochen hat. Über die Familien Weiss und Dorf fanden viele Deutsche erstmals Zugang zu den Grausamkeiten ihrer eigenen Geschichte, begannen Familien, ihre Biografien zu befragen, wurden biografische Illusionen zerstört.
Wenn man die Filme heute wiedersieht, sieht man natürlich immer noch die zusammengeklöppelte Dramaturgie, die Fehler und Unwahrscheinlichkeiten, die gezielte Emotionalisierung, das klinisch saubere Ghetto. Aber: Es wurde in "Holocaust" nichts beschönigt, die Verbrechen wurden genannt und gezeigt, die Opfer bekamen Gesicht, Namen und eine individuelle Geschichte. Das hat die Menschen damals vor den Bildschirmen bewegt und aufgeregt.
Vom 7. Januar an zeigen NDR und WDR, vom 9. Januar an auch der SWR die vier Teile von «Holocaust» erneut im TV, ergänzt um die Dokumentation «Wie 'Holocaust' ins Fernsehen kam».
Umgang mit kolonialem Erbe: Bund-Länder-Position bis März
Berlin (epd). Bund und Länder wollen bis März eine gemeinsame Position zum Umgang mit dem kolonialen Erbe vorlegen. Das kündigte der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda (SPD), Gründungsvorsitzender der neuen Fachkonferenz der für Kultur zuständigen Länderminister, in "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (4. Januar) an. Die Rückgabe von Museumsstücken aus ehemaligen Kolonien wird damit zum ersten Schwerpunktthema der Kultur-Fachministerkonferenz, die zum Jahreswechsel ihre Arbeit aufgenommen hat.
"Frankreich zeigt uns gerade, wie man da vorgehen kann, und Deutschland darf bei diesem Thema nicht abseits stehen", sagte Brosda mit Blick auf eine Initiative von Staatspräsident Emmanuel Macron zur großzügigen Rückgabe von Kolonialkunst an die Ursprungsländer.
Die Denkmalschutzorganisation World Heritage Watch mahnte unterdessen in der Debatte um die Kulturgüterrückgabe die Beteiligung der Herkunftsgesellschaften an. In vielen Fällen der Rückgabe von Kulturgütern aus der Kolonialzeit sei die Zusammenarbeit mit den heutigen staatlichen Stellen der Herkunftsländer nicht der geeignete Weg, erklärte der Vorsitzende von World Heritage Watch, Stephan Dömpke, in einem offenen Brief an den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. "Vielmehr sollten die Empfänger solcher Kulturgüter die Herkunftskulturen sein." In multiethnischen Staaten sei dies ein entscheidender Unterschied, erklärte Dömpke.
In vielen dieser Staaten hätten manche Ethnien keine politische Repräsentation oder keinen gleichen Zugang zu staatlichen Institutionen und Entscheidungsprozessen, heißt es in dem Brief. Regierungen und Verwaltungsapparate seien oft mit Vertretern nur einer oder weniger Ethnien besetzt. "Die in Frage stehenden Objekte wurden aber in der Kolonialzeit nicht von Staaten erworben - die es damals zumeist gar nicht gab -, sondern von den indigenen Kulturen", sagte Dömpke. Daher müssten sie auch an diese zurückgegeben werden: "Nur sie sind als Nachkommen der Geschädigten die legitimen Empfänger von Rückgaben."
Parzinger hatte den Angaben zufolge zuvor gefordert, dass im Zuge der Rückgabe von in der Kolonialzeit erworbenen Kulturgütern und Gebeinen Institutionen der Herkunftsländer bei der Restaurierung und Konservierung etwa durch einen staatlichen Strukturfonds unterstützt werden sollten.
Spiele-Entwickler will Neues Testament erlebbar machen
Im Computerspiel "One of the 500" geht es um die Bibel. Mit seiner hochprofessionellen Grafik soll es weltlichen Spielen in nichts nachstehen. Der Theologie-Doktorand Amin Josua sucht nun nach Investoren für sein Start-up.Heidelberg (epd). Der Fischerjunge muss sich entscheiden: Sammelt er Geld für ein neues Fischernetz oder kürzt er den Spielverlauf ab und stiehlt es? Von seiner Entscheidung hängt ab, wie die Geschichte des Adventure-Games "One of the 500" weitergeht. Einen eindeutig "guten" oder "bösen" Weg gebe es dabei nicht, sagt Entwickler Amin Josua (31). Manchmal komme der Spieler mit moralisch verwerflichen Lösungen durch, manchmal müsse er sich später dafür verantworten.
Der Heidelberger Theologie-Doktorand arbeitet seit anderthalb Jahren an dem Spiel, das erstmals das Evangelium in hochqualitativer 3D erlebbar machen will. Für sein millionenschweres Vorhaben ist Josua in die Startup-Szene eingestiegen und hat Ende September eine Firma gegründet. Im Februar soll der Prototyp erscheinen.
Prototyp soll im Februar erscheinen
Der Startup-Gründer sitzt auf einem roten Sofa in einem Stuttgarter Coworking-Gebäude, wo er und sein vierköpfiges Team jüngst ein Büro bezogen haben. "Viele Menschen interessieren sich dafür, welche Rolle Jesus für Christen und ihre Alltag spielt", ist der langjährige Zocker überzeugt.
"One of the 500" ist zur Zeit Jesu verortet, Schauplatz sind Geschichten aus dem Evangelium. Der Titel geht zurück auf eine Bibelstelle. Aber um welche 500 es sich handelt, müssen die Spieler selbst herausfinden, sagt Josua. Das Spiel solle einen Überblick über die Worte und Ereignisse rund um Jesus geben, dabei aber nicht "teachy-preachy" sein, sondern die Spieler moralisch, ethisch und spirituell herausfordern.
Das Spiel greife biblische Lebensfragen auf, die heute noch gesellschaftlich relevant seien. "Etwa die Frage, wie ich mit meinen Feinden umgehe oder mit der Stigmatisierung gesellschaftlicher Gruppen." Außerdem soll historisches Wissen vermittelt werden, beispielsweise wie es vor 2.000 Jahren am See Genezareth aussah. Dafür setzt Josua auf hochprofessionelle Grafik, die säkularen Spielen in nichts nachstehen soll.
Die Idee, ein Spiel zu entwickeln, kam Josua, als er in einem Schülerprojekt fragte, wie Kirche für Jugendliche wieder relevant werden könne. Ein Schüler antwortete: "Die einzige Chance, dass ich mich mit biblischen Inhalten auseinandersetze, wäre, dass ich sie zocken kann." Da habe es bei ihm "geklingelt", denkt Josua zurück. "Digitale Spiele sind eine Kommunikationsstruktur, die sehr viele Menschen nutzen." Eine Kommunikationsstruktur, die von Kirche und Christen bislang weitestgehend brach liegen gelassen werde.
Games als Kulturgut
Laut "game", dem Verband der deutschen Games-Branche, zocken rund 34 Millionen Deutsche digitale Spiele, ihr Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren. Das gesellschaftliche Image von Games habe sich gewandelt, sagt Verbandsgeschäftsführer Felix Falk. Sie würden heute ganz selbstverständlich als Kulturgut, Wirtschaftsfaktor und Innovationstreiber wahrgenommen.
Zudem seien Computer- und Videospiele ein sehr gutes Lehr- und Lernmedium, erläutert Falk. "Sie sind interaktiv und können auch zusammen gespielt werden, was den Lernerfolg deutlich steigern kann." Ob und wie gut ein Spieler lerne, hänge von verschiedenen Faktoren ab: "Je besser die Spieler motiviert werden, desto besser vermitteln sich auch die Inhalte."
Für Josua ist es außerdem wichtig, dass seine Zielgruppe Interesse am Thema mitbringt, sagt er. Nach dem Schülerprojekt präsentierte er seine Idee dem Digitalisierungsprojekt der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und was damals als "müsste man mal machen" begann, wurde rasch immer größer: Zweimal flog der Familienvater in die USA zur Christian Game Developer Conference nach Portland.
Dort knüpfte er Kontakte zu einem Produktionsstudio. Die Landeskirche stellte eine Startfinanzierung von 300.000 Euro zur Verfügung. Als jüngsten Coup konnte Josua den Schriftsteller Titus Müller, bekannt für seine historischen Romane, als Writer gewinnen. "Es hat sich herausgestellt, dass Müller auch gerne zockt", freut er sich.
Die Gesamtkosten für Entwicklung, Produktion und Marketing schätzt der Gründer auf rund sieben Millionen Euro. Nun gilt es, Investoren zu finden. Auch weitere Mitarbeiter werden gesucht. "One of the 500" soll einmal den weltweiten Markt erobern, sagt Josua selbstbewusst. Noch ist nicht sicher, wo die Reise hingeht und ob alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Aber der gläubige Christ ist zuversichtlich. In den vergangenen anderthalb Jahren habe sich so viel ergeben und gefügt: "Das kann kein Zufall sein."
Jubeljahr für Arp Schnitger

epd-bild / Stephan Wallocha
Stade (epd). Kenner vergleichen die Klasse seiner Instrumente gerne mit der Qualität der Stradivari-Geigen. Was der barocke Orgelbaumeister Arp Schnitger (1648-1719) geschaffen hat, fasziniert Musiker und Publikum bis heute. Etwa 170 Orgeln soll er neu gebaut oder wesentlich umgestaltet haben, etwa 30 sind noch erhalten. Sein 300. Todesjahr - das genaue Sterbe-Datum ist nicht bekannt - wird 2019 an der Küste zwischen Groningen und Hamburg mit Musikfestivals, Symposien und Exkursionen gefeiert. "Arp Schnitger war schon zu Lebzeiten eine Legende", sagt der Bremer Orgelprofessor Harald Vogel.
Die Musik galt zu Schnitgers Zeit als Vorstufe zum himmlischen Paradies, die Orgel selbst als Instrument zur Ehre Gottes. Deshalb wurde vielerorts auch nicht an Baumaterial und Ausstattung gespart, wenn es darum ging, die Kirche mit einer Orgel auszustatten. Das wirkt sich bis in die Gegenwart aus: Feines Zinn, gutes Leder und abgelagertes Holz ließen die Mechanik oft Jahrhunderte überdauern.
Pfeifen aus edelstem Material
In der Stader Cosmae-Kirche lieferte Schnitger sein Gesellenstück ab. Und in Lüdingworth bei Cuxhaven steht eine besonders prachtvolle Orgel aus seiner Werkstatt: Die reichen Marschenhöfe ließen sich hier in ihrem "Bauerndom" ein Instrument mit riesigen Pedaltürmen und 2.200 Pfeifen aus edelstem Material bauen. Die Tasten des Spieltisches sind teils mit Buchsbaum belegt, teils aus Ebenholz.
"Die Bauern an der Küste von Amsterdam im Südwesten bis Hamburg und dann weiter in den Raum nördlich von Ribe in Dänemark haben die allererste geschlossene Orgellandschaft der Welt geschaffen", schwärmt der Freiburger Musikwissenschaftlicher Konrad Küster. Dabei ging es nicht nur um Frömmigkeit, denn die Orgel war auch ein Statussymbol. Mit einem Instrument von Arp Schnitger sicherten sich die Bauern da am zuverlässigsten die neidvolle Anerkennung aus den Nachbarorten. Denn Schnitger, Tischlersohn aus der Wesermarsch, zählte europaweit zu den besten Orgelbauern.
Estaunliche Klangfülle
Das reiche Alte Land zwischen Stade und Hamburg sticht noch hervor, weil hier besonders viele Orgeln von Schnitger stehen. 1678 übernahm er nach dem Tod seines Lehrmeisters Berendt Hus dessen Werkstatt in Stade. Bereits vier Jahre später zog er nach Hamburg, um in der Hauptkirche St. Jacobi sein größtes Werk mit knapp 4.000 Pfeifen zu bauen. Von Hamburg aus exportierte er später seine Instrumente zunächst in den norddeutschen Raum und in die Niederlande, dann nach Russland, England, Spanien und Portugal. In Neuenfelde, heute ein Teil von Hamburg, wurde der Meister schließlich am 28. Juli 1719 begraben.
Nach Schnitgers Tod machten sich viele seiner Schüler selbstständig und konstruierten Orgeln im Stile ihres Meisters. Bis heute werden Instrumente von Schnitger weltweit bei großen Orgelneubauten als Vorbild genutzt. Und noch immer sind Musiker fasziniert vom Klang der Schnitger-Orgeln. Sie loben das harmonische Verhältnis von Grund- und Obertönen, die unterschiedlichsten Charaktere der Flöten, die zu einer erstaunlichen Klangfülle verschmelzen.
"Ich habe nie viel verlangt"
Das soll hörbar werden, wenn beispielsweise Groningen im Schnitgerjahr einlädt. Die Region dort wird gerne als "Orgeltuin van Nederland", als Orgelgarten der Niederlande bezeichnet, zehn Schnitger-Meisterwerke inklusive. Besondere Konzerte sind auch weiter östlich in Ostfriesland, im Elbe-Weser-Raum und in Hamburg geplant, das unter dem Motto "Hamburg zieht alle Register" feiert. Wer will, kann im Alten Land auf Exkursionen per Rad Orgeln entdecken oder im Rahmen von "Wandelkonzerten" von einer Kirche zur anderen und damit von einem Instrument zum anderen spazieren.
Ein zentraler niedersächsischer Festakt ist für den 2. Juni in der Georgskirche im ostfriesischen Weener geplant. Natürlich soll es ein Konzert an der dortigen Schnitger-Orgel geben. Aber auch ein eigens für das Jubiläum geschriebenes niederdeutsches Theaterstück wird aufgeführt. Unter dem Titel "Gliek un doch heel anners" (Gleich und doch ganz anders) beschäftigt sich das historische Spiel mit Schnitger und seinen Konkurrenten in Ostfriesland.
Ein "Schnitgerfest rund um die Kirche" lockt im Sommer nach Steinkirchen ins Alte Land. Die Arp-Schnitger-Gesellschaft in der Wesermarsch plant rund um die Taufkirche des Baumeisters in Golzwarden unter anderem ein internationales Orgelbauer-Symposium und eine Wanderausstellung zu Leben und Werk des Orgelbauers, der oft uneigennützig gehandelt hat. Schnitger schrieb über sich selbst: "Ich habe nie viel verlangt, sondern den Kirchen, wenn sie keine ausreichenden Mittel besaßen, zur Ehre Gottes die Orgel für den halben Preis gebaut."
Zwickau ehrt Clara Schumann mit mehreren Ausstellungen
Zwickau (epd). Der Pianistin und Komponistin Clara Schumann ist vom 14. Januar an eine Ausstellung in Zwickau gewidmet. Unter dem Motto "Clara Schumann als Komponistin" werden im Robert-Schumann-Haus ihre Werke in Originalhandschriften und -ausgaben präsentiert, teilte das Museum am 3. Januar im sächsischen Zwickau mit. In diesem Jahr am 13. September jährt sich der Geburtstag von Clara Schumann (1819-1896) zum 200. Mal. Die in Leipzig geborene Künstlerin war die Ehefrau von Robert Schumann (1810-1856). Der Komponist wurde in Zwickau geboren.
Gezeigt werden in der Sonderausstellung bis 31. März auch Dokumente zur Entstehungsgeschichte der Werke Clara Schumanns, darunter Tagebucheintragungen und Briefe. Erstmals zu sehen seien Erwerbungen von Originalausgaben einzelner Klavierstücke der Komponistin aus den Jahren 1885 und 1892. Alle Exponate gehören den Angaben zufolge zum Archivbestand des Zwickauer Schumann-Hauses.
Komponierende Frauen im 19. Jahrhundert waren den Angaben zufolge eine Ausnahme. Dass Clara Schumann mehr als 20 ihrer Werke in Druckausgaben bei renommierten Verlagen vorlegen konnte, sei umso ungewöhnlicher, hieß es. Die Originalausgaben der frühen Klavierwerke kamen aus dem Nachlass von Friedrich Wieck, Clara Schumanns Vater, ins Zwickauer Schumann-Museum.
Außerdem wurden beim Ankauf des Schumann-Nachlasses durch die Stadt Zwickau 1925 auch zahlreiche Notenhandschriften Clara Schumanns erworben. 1971 konnte schließlich die Partiturhandschrift von Clara Schumanns wohl bedeutendstem Werk, ihrem Klaviertrio opus 17, aus dem Nachlass einer Schülerin erworben werden. Das Museum plant im Jubiläumsjahr 2019 weitere Ausstellungen zum Leben und Schaffen Clara Schumanns, darunter eine über Clara und ihre Kinder sowie eine zu ihren Konzerten und Reisen.
Fontane-Jubiläumsjahr wird von Steinmeier eröffnet
Neuruppin/Potsdam (epd). Das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane (1819-1898) wird am 30. März von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im brandenburgischen Neuruppin eröffnet. Die Zusage sei vor wenigen Tagen eingetroffen, sagte der Bürgermeister der märkischen Stadt, Jens-Peter Golde (Pro Ruppin), am 4. Januar in Potsdam.
Fontane wurde als Sohn eines Apothekers in Neuruppin geboren. Bis zum 200. Fontane-Geburtstag am 30. Dezember sei ein "ausgeklügeltes" Programm" geplant, darunter eine große Ausstellung im Stadtmuseum von Neuruppin, sagte Golde. Der Ort am Ruppiner See gehört zu den brandenburgischen Städten mit historischen Stadtkernen.
Die Ausstellung werde Fontane als Wanderer durch die Mark Brandenburg reflektieren und als "Vielschreiber" und "Schreibdenker" vorstellen, sagte Golde. Der Schriftsteller mache es einem dabei "relativ leicht", weil er "mit der Feder in der Hand auf dem Papier gedacht" habe. Auf dem Programm stehen neben den Fontane-Festspielen, Open-Air-Theater und einem "musikalischen Spektakel" unter anderem rund 60 touristische und teils sportliche Aktivitäten rund um Neuruppin, darunter ein Triathlon auf Fontanes Spuren.
Einige spezielle Angebote richten sich an junge Leute, sagte Golde. Darunter seien Workshops für Schüler ab der zehnten Klasse, die auf der Grundlage von Fontane-Werken Computerspiele entwickeln sollen. Die Ergebnisse würden anschließend im Internet präsentiert. Angeboten würden auch Stadtrallyes für Kinder und Jugendliche, die nach der Erkundung der Stadt mit der Lösung eines Rätsels enden sollen.
Ziel des Neuruppiner Jubiläumsprogramms sei, "Fontane den Menschen näher zu bringen", die Kulturstadt Neuruppin auch außerhalb der Region stärker bekanntzumachen und das Kulturland Brandenburg von Hamburg bis München stärker in den Blick zu rücken, betonte Golde. Dafür sei Fontane ein "ganz hervorragender intellektueller Katalysator".
Zeitungshäuser im Münsterland und Ostwestfalen wollen fusionieren

epd-bild / Matthias Rietschel
Bielefeld/Münster (epd). Die Bielefelder Unternehmensgruppe "Westfalen-Blatt" und der Zeitungsverlag Aschendorff in Münster führen ihre Medienaktivitäten unter einem Dach zusammen. Beide Häuser haben zum 1. Januar die Westfälische Medien Holding AG gegründet, wie sie am 4. Januar mitteilten. Das Fusionsvorhaben stehe noch unter dem Vorbehalt einer Freigabe durch das Bundeskartellamt. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) appellierte an die Verlage, keine Stellen abzubauen.
Neue Holding
Beide Unternehmensbereiche sollen den Angaben zufolge als Tochtergesellschaften der neuen Holding weitergeführt und "erfolgreich weiterentwickelt" werden. Flaggschiffe der beiden Medienhäuser sind die Tageszeitungen: Im Verlag Aschendorff erscheinen die "Westfälischen Nachrichten" und die "Münstersche Zeitung" mit einer verkauften Auflage von zusammen gut 106.000 Exemplaren im dritten Quartal 2018. Das "Westfalen-Blatt" verkaufte im dritten Quartal ebenfalls rund 106.000 Exemplare. In der Holding bündeln die Verlage außerdem ihr Anzeigenblatt-, Druckerei-, Rundfunk- und Reisebürogeschäft.
Die Fusion sei eine Reaktion auf die großen Herausforderungen im Bereich des Marktes für Regionalzeitungen, sagte der Chefredakteur der "Westfälischen Nachrichten" (WN), Norbert Tiemann, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Auflagen nähmen nicht mehr zu, Anzeigenerlöse stagnierten und auch die digitalen Angebote erwirtschafteten noch nicht genug. Zugleich seien die Kosten für die Zustellung besonders in ländlichen Räumen wie dem Münsterland und Ostwestfalen erheblich gestiegen, erläuterte Tiemann.
Der Verlag des "Westfalen-Blattes" erklärte, beide Unternehmen sähen in der Bündelung der Aktivitäten bessere Zukunftsperspektiven. Eine Weiterentwicklung betreffe sowohl den Print- als auch den Digitalbereich. Unmittelbar nach Gründung der Holding stellten sich Fragen nach Veränderungen und Synergien jedoch noch nicht, unterstrich das Bielefelder Medien-Unternehmen.
Auch WN-Chefredakteur Tiemann sagte, man wolle zwar nach Synergiepotenzialen suchen, es gebe jedoch noch keine konkreten Themen. Für Zeitungsleser, Anzeigenkunden und Mitarbeiter der Zeitungen werde sich nichts ändern, betonte Tiemann.
Journalistenverband fordert Erhalt der Arbeitsplätze
Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) wertete die Gründung der Westfälischen Medien Holding als "Übernahme" des "Westfalen-Blatts" durch die Aschendorff-Gruppe. Der DJV setze darauf, dass die Fusion nicht zum Abbau von Arbeitsplätzen an einem der beiden Standorte führe, sagte der NRW-Landesvorsitzende des Verbands, Frank Stach. Eine Zusammenlegung der Mantelredaktionen wäre "ein weiterer Schlag für die Medienvielfalt in Nordrhein-Westfalen".
Nach Angaben der beiden Verlage ist die Unternehmensgruppe Aschendorff bereits seit 2011 über die C.W. Busse Holding finanziell am "Westfalen-Blatt" beteiligt. Beide Häuser arbeiten im Rahmen der Zeitungsgruppe Westfalen auch auf dem Anzeigenmarkt zusammen.
Entwicklung
Kinder retten, Frauen stärken

epd-bild/BMZ Pool/Ute Grabowsky/photothek.net
Lilongwe (epd). Winzig und zerbrechlich ist der kleine Junge. Zwölf Wochen zu früh wurde er geboren, mit gerade einmal etwas mehr als 900 Gramm. "Baby Zoan Thomas" wird er genannt, nach dem Vor- und Nachnamen seiner Mutter. Wenn er überlebt, wird die Mama zusammen mit der Verwandtschaft zu Hause im Dorf entscheiden, wie der Kleine heißen soll.
Etwa 25 Prozent Überlebenschancen hätten so früh Geborene in Malawi, sagt die Ärztin Catherine Hodge im Krankenhaus von Nkhoma östlich der Hauptstadt Lilongwe. Bei "Baby Zoan Thomas" sieht es gut aus. In der kirchlichen Klinik setzen die Mediziner und Schwestern alles daran, dass der Junge es schafft. Neben ihm in der Neugeborenenstation liegen noch rund ein Dutzend Babys - wie viele von ihnen überleben, ist offen.
Mehr als 40 von 1.000 Babys in Malawi sterben den jüngsten Daten zufolge vor ihrem ersten Geburtstag. Dabei hat das südostafrikanische Land - auch mit Hilfe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit - schon enorme Fortschritte gemacht: Noch 2011 war eine Säuglingssterblichkeit von 66 pro 1.000 Babys zu beklagen. Dennoch ist auch die aktuelle Zahl viel zu hoch. Und auch die Müttersterblichkeit in Malawi ist trotz großer Erfolge nach wie vor erheblich. 2016 gab es 439 Todesfälle auf 100.000 Lebendgeburten, in Deutschland liegt die Zahl klar unter 10.
Für Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sind die Zahlen Herausforderung und Ansporn. Der Besuch des Krankenhauses von Nkhoma überzeugt ihn von der Sinnhaftigkeit und der Notwendigkeit des deutschen Engagements im Gesundheitswesen Malawis. "Was brauchen Sie besonders dringend?", fragt er den Pflegeleiter der Kinderstation. Sam Kabote wünscht sich Anti-Moskito-Spray, um den Raum von den gefährlichen Malaria-Mücken freizuhalten. Die rund 25 Betten in dem Saal sind viel zu wenig, in jedem Bett liegen zwei Kinder. Die meisten von ihnen sind mit Malaria in die Klinik gekommen.
Malawi zählt zu den ärmsten Länder der Welt
Minister Müller bewegt das Schicksal der Kinder, im Krankenhaus ebenso wie im SOS-Kinderdorf, bei einem Gemeindeprojekt zur Unterstützung von HIV-Infizierten oder einfach im Wissen um die Armut und Mangelernährung vieler Jungen und Mädchen. "Ich komme als erster deutscher Entwicklungsminister seit 2001 nach Malawi und möchte damit bewusst ein Zeichen setzen für den Kampf gegen Armut", betont Müller. "Wir müssen verhindern, dass heute noch Menschen an Hunger oder Aids sterben."
Malawi zählt zu den ärmsten Länder der Welt, drei Viertel der Menschen leben von weniger als einem US-Dollar pro Tag. Darüber hinaus ist Malawi eines der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder. Ansatzpunkte der deutschen Unterstützung zur Armutsbekämpfung sind besonders Bildung, Gesundheit und landwirtschaftliche Entwicklung. Alle drei Themen überschneiden sich im Bereich Familienplanung. Die Bevölkerung des afrikanischen Landes, das etwa ein Drittel so groß ist wie Deutschland, hat sich seit den 1960er Jahren auf rund 18 Millionen verfünffacht. Inzwischen wurde die Geburtenrate in den vergangenen fünf Jahren von 6 auf 4,4 gesenkt, doch weiterhin können zahlreiche Familien ihre Kinder nicht ernähren, geschweige denn ihnen Schulbildung bieten. Zudem bekommen viele Mädchen schon in jungem Alter Kinder - unaufgeklärt und ungewollt. Die gesundheitlichen Gefahren für die Mädchen sind groß.
Mädchen werden oft früh verheiratet
Kinderehen sind mittlerweile verboten. "Ich glaube, in der Praxis ist es nach wie vor so, dass junge Mädchen in der großen Gefahr sind verheiratet zu werden", sagt die Gynäkologin Ruth Hildebrandt, die für die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) für deren Gesundheitsprogramm in Malawi verantwortlich ist. "Wir sprechen hier von Mädchen ab zehn Jahren."
Loveness Kaomba war immerhin schon 17, als sie schwanger wurde. Aber auch für sie war ein Schulbesuch zunächst hinfällig. Nach der Geburt jedoch regte sich bei Loveness Widerstand dagegen, sich von der Bildung und Chancen auf einen auskömmlichen Job ausschließen zu lassen. Die junge Frau fand den Mut, sich bei einem von Deutschland unterstützten Gesundheitszentrum zu melden, über Familienplanung zu informieren und für Empfängnisverhütung zu entscheiden. Damit schaffte sie den Sprung zurück an die Schule. Inzwischen ist Loveness 24 und bald bereit für weitere Kinder. Zwei Geschwister für ihre kleine Tochter wünscht sie sich.
Vom verrückten Farmer zum Millionen-Bäume-Mann
Bauern im Sahel hielten Tony Rinaudo lange Zeit für verrückt. 2018 wurde der Australier für seinen Kampf gegen Wüstenbildung mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt - für ihn ein Ansporn weiterzumachen.Genf (epd). Den Bruch mit Traditionen kann Tony Rinaudo empfehlen. Der Australier jedenfalls hat nur gute Erfahrungen damit gemacht. "Als ich jung war und bei der Aufforstung des Sahel helfen wollte, da habe ich mich an unsere westlichen Traditionen gehalten und in Niger Bäume gepflanzt, viele Bäume", erinnert er sich. Das Problem: Es brachte nichts. "Ich habe versucht, noch härter zu arbeiten, früher zu pflanzen, mehr zu wässern oder neue exotische Spezies auszuprobieren - alles ohne Erfolg." Nur durch Zufall fand Rinaudo heraus, dass gar nicht die Bäume das Problem waren, sondern die Traditionen - seine und die der Bevölkerung vor Ort.
Im Norden Nigers stößt die Wüste an die staubige Ebene, die Generationen von Bauern von aller Vegetation befreit haben. "Dort hält ein ordentlicher Bauer seine Felder traditionell frei von allem, was er nicht gepflanzt hat, nur nachlässige Bauern tun das nicht", erklärt Rinaudo. Eines Tages, es war 1983, fuhr er mit einer Ladung Bäume in Richtung eines Dorfes, obwohl er längst wusste, dass sie eingehen würden wie die anderen auch. "Schließlich habe ich frustriert angehalten, bin umhergelaufen und habe mir erstmals die Büsche in der Umgebung angeschaut - und gemerkt, dass das Bäume waren!" Das änderte alles, sein Leben und das der Bauern.
Bescheiden und glücklich
Seine Geschichte hat Tony Rinaudo in den vergangenen Wochen vielleicht ein paar hundert Mal erzählt, seit die Jury des Alternativen Nobelpreises ihn am 24. September zum Preisträger ernannt hat. Das Erzählen von sich fällt Rinaudo inzwischen leichter, obwohl man immer noch merkt, wie bescheiden er ist. Er fühle sich geehrt, vor allem aber glücklich, sagt er über die Auszeichnung, die sein System der Aufforstung durch die Bauern selber weltberühmt gemacht hat. "Besonders glücklich macht mich aber, dass alle meine Kollegen sich genauso gefreut haben, dass es sich also um einen Preis für uns alle handelt, nicht nur für mich."
Als Rinaudo in Niger die Bäume fand, die er vor lauter Plänen vom neugepflanzten Wald nicht gesehen hatte, begann er, seine Strategie zu ändern. Er überredete befreundete Bauern, mit ihren Traditionen zu brechen und die Triebe der Bäume auf ihren Feldern zu pflegen anstatt sie wie bisher auszureißen. Die meisten wollten davon nichts wissen, schnell war Rinaudo der "verrückte weiße Bauer". Doch die, die mitmachten, wurden nach einer Dürre mit besserer Ernte belohnt, mit Schatten auf den Feldern und kostenlosem Futter für das Vieh. Ohne dass Rinaudo davon wusste, erzählten Bauern Freunden und Verwandten auf Besuch von der Idee, die sich so im ganzen Land ausbreitete.
Methode kopiert
200 Millionen Bäume sind dank Rinaudos Methode inzwischen alleine in Niger gepflanzt worden. In vier Sahelstaaten haben Bauern die Methode kopiert, für die sie nur ein geübtes Auge, ein Messer und Geduld brauchen. Und die Bereitschaft, sich von Traditionen zu lösen. "Wenn Du von falschen Voraussetzungen ausgehst, dann spielt es keine Rolle, wie sehr Du Dich bemühst, wie viel Geld Du ausgibst oder wie klug Du bist - Du wirst nie die beste Lösung für das Problem finden, das Du lösen willst", sagt Rinaudo.
Und trotzdem werden überall in Afrika bis heute Millionen Bäume gepflanzt, vor allem Eukalyptus. "Als Monokultur ist das einfach nur schädlich - und dann kosten diese Pflanzprogramme Millionen, obwohl alle wissen, dass nur wenige Bäume überleben." Vielleicht ist einer der Gründe dafür, dass Rinaudos Idee sich noch nicht flächendeckend durchgesetzt hat, der, dass er niemanden reich zu machen verspricht, keinen Großgrundbesitzer, kein Unternehmen und keinen korrupten Regierungsbeamten. "Dabei profitieren auch die Reichen davon, wenn die Armen mehr Geld haben, weil die Kaufkraft insgesamt steigt."
Afrika grüner machen
Mit dem Rückenwind des Alternativen Nobelpreises führt Rinaudo jetzt mit mehr Regierungen Verhandlungen. So will die äthiopische Regierung jährlich eine Milliarde Bäume aufforsten und bis 2030 rund 50 Millionen Hektar Fläche zu Wald machen. "Wir sind im Gespräch mit dem zuständigen Ministerium, das unsere Methode einsetzen will." Rinaudo sagt wir, weil der "verrückte Bauer" von einst längst bei der Organisation Worldvision im Team für sein Ziel arbeitet, Afrika grüner zu machen und die Wüsten aufzuhalten.
Alleine fühlt sich Rinaudo in seinem Kampf schon lange nicht mehr. Bei der Verleihung des Alternativen Nobelpreises traf er zum zweiten Mal Yacouba Sawadogo, einen Kleinbauern aus Burkina Faso, der die staubigen Böden seiner Heimat mit einer traditionellen, fast vergessenen Anbauweise wieder zum Blühen bringt. "Unsere Methoden ergänzen sich wunderbar", freut sich Rinaudo. Was zeigt, dass Traditionen ihren Platz haben, solange sie nicht unhinterfragt bleiben.
Ausland
Papst zeichnet düsteres Zukunftsbild

epd-bild/Cristian Gennari/Agenzia Romano Siciliani
Rom (epd). Die Suche nach kurzfristiger Zustimmung der Bevölkerung und einseitigen Lösungen bedrohe die internationale Ordnung, beklagte er am 7. Januar beim Neujahrsempfang für das diplomatische Corps des Heiligen Stuhls. Populistische Tendenzen erinnerten durch die Schwächung internationaler Organisationen an die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg.
Vor dem für Februar im Vatikan geplanten Missbrauchsgipfel mit den Spitzen der katholischen Bischofskonferenzen weltweit bekräftigte Franziskus seinen Willen, sexuelle Übergriffe durch Geistliche sowie deren Vertuschung zu ahnden und für Prävention zu sorgen. Missbrauch füge als eines der schlimmsten Verbrechen "irreparable Schäden für den Rest des Lebens" zu.
Kritik an Aufrüstung
Besorgt äußerte sich der Papst angesichts des drohenden Scheiterns des IFN-Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme überdies über ein neues Wettrüsten. An die Stelle der Abrüstung der vergangenen Jahrzehnte sei ein Streben nach immer weiter entwickelten Atomwaffen mit einem höheren Zerstörungspotential getreten. Der Waffenhandel kenne keine Rückschläge sondern profitiere von einer zunehmenden Tendenz von Staaten und Einzelpersonen, sich zu bewaffnen.
Besonderes Augenmerk richtete der Papst auf die vielfältigen Spannungen im Nahen Osten. Die internationale Gemeinschaft müsse sich dringend für eine politische Lösung des Konflikts in Syrien einsetzen, bei dem es keine Sieger sondern nur Besiegte geben könne. Franziskus forderte insbesondere ein Ende der Verletzungen des humanitären Rechts. Dieses Unrecht füge der Zivilbevölkerung, insbesondere Frauen und Kindern durch Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen und Flüchtlingslager unsagbare Leiden zu.
In seiner jährlichen Grundsatzrede an die Diplomaten mahnte der Papst überdies gemeinsame Lösungen für Flüchtlings- und Migrationsströme an. "Jeder Mensch strebt nach einem besseren Leben", betonte das Kirchenoberhaupt. Herausforderungen durch Migration könnten nicht mit Hilfe von Gewalt, Aussonderung oder gar Teillösungen gemeistert werden.
Hinsichtlich zwischenstaatlicher Konflikte und mit Blick auf Migrationsströme beklagte das Kirchenoberhaupt eine Aushöhlung des Völkerrechts. Gefühlsmäßig motivierte und voreilige Maßnahmen könnten zwar kurzfristig für Konsens sorgen. Die grundlegenden Probleme könnten sie jedoch nicht lösen, sondern vergrößerten sie nur.
Vor den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Botschaftern verteidigte Franziskus überdies das innerkirchlich umstrittene Abkommen vom vergangenen Jahr mit China zur Ernennung von Bischöfen. Dieses sei das Ergebnis langwieriger Verhandlungen. Der Papst äußerte die Hoffnung, dass weitere Kontakte zur chinesischen Führung noch offene Fragen klären und zur Gewährung der Religionsfreiheit in der Volksrepublik beitragen könnten.
US-Repräsentantenhaus erlaubt Muslimin Tragen eines Kopftuchs
Washington (epd). Das US-amerikanische Repräsentantenhaus hat zu Beginn seiner neuen Legislaturperiode am 3. Januar ein seit Mitte des 19. Jahrhunderts geltendes Verbot von Kopfbedeckungen bei Sitzungen gelockert. Künftig werden laut dem Beschluss aus religiösen Gründen getragene Kopfbedeckungen wie das muslimische Kopftuch, die jüdische Kippa und der Sikh-Turban zugelassen.
Konkret betrifft die Reform die Kopftuch tragende neue Abgeordnete Ilhan Omar aus Minnesota. Zusammen mit Rashida Tlaib aus Michigan gehört die in Somalia geborene Omar zu den ersten muslimischen Frauen im Repräsentantenhaus.
Omar hatte bei der Kongresswahl im November vergangenen Jahres in ihrem Wahlkreis 78 Prozent der Stimmen erhalten. Im Kurzmitteilungsdienst Twitter erklärte die 37-jährige Politikerin der Demokraten, das Tragen eines Kopftuchs sei eine persönliche Entscheidung, geschützt vom Religionsfreiheitgebot in der US-Verfassung.
Nach Angaben des Repräsentantenhauses wurde das Tragen von Hüten bei Sitzungen 1837 verboten. Die Entscheidung war damals umstritten. Eine Kopfbedeckung galt manchen Politikern als unhöflich und manchen als Zeichen persönlicher Freiheit. Die Reform der Vorschrift am Donnerstag war Teil eines umfangreichen Beschlusses zur Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses, der mit 234 zu 197 Stimmen angenommen wurde.
Omar war 1995 mit ihren Eltern vor dem Bürgerkrieg in Somalia in die USA geflüchtet. Im Wahlkampf forderte sie eine staatliche Krankenversicherung, besseren Klimaschutz und höhere Mindestlöhne.

