 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 49/2022 - 09.12.2022
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 49/2022 - 09.12.2022
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 49/2022 - 09.12.2022
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 49/2022 - 09.12.2022

in deutschen Krankenhäusern knirscht es gewaltig - nicht erst seit Corona. Aber die Pandemie hat die akuten Probleme wieder in den Fokus gerückt, allem voran den Personalmangel, der dazu führt, dass viele Stationen geschlossen werden müssen. Doch den Kliniken fehlt seit Jahren auch Geld, viel Geld sogar. Deshalb will Gesundheitsminister Lauterbach nun den Hebel umlegen und die Finanzierung der Klinikleistungen umkrempeln und die Fallpauschalen reformieren. Doch ob das reicht, die Misere zu beheben, bleibt fraglich. Es gibt viel Kritik an den Plänen.
Es ist offenkundig, dass die Politik aus Fehlern nicht immer lernt. So im Fall der Corona-Prämien für Pflegekräfte. Die sollten deren besondere Leistungen in der Pandemie belohnen. Doch die Beschäftigten in Kliniken und Heimen beklagen Willkür und Ungerechtigkeiten bei der Auszahlung der Lohnzuschläge - und viele Fachkräfte gehen leer aus. Und das war 2021 schon einmal der Fall.
Die hohen Energiepreise zwingen auch Sozialträger zu einem harten Sparkurs. Doch Heizung herunterdrehen, Warmwasser abstellen - in Krankenhäusern oder Seniorenheimen ist das fast nicht möglich. Auch kirchliche Einrichtungen wie die Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg suchen nach Wegen, um Energie zu sparen - und fordern Hilfe von der Politik.
Selbstständige Hartz-IV-Aufstocker haben trotz einer verpassten Jobcenter-Frist zum Einreichen von Unterlagen über die Betriebseinnahmen und -ausgaben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Reichen sie die Papiere erst verspätet mit einer Klage vor Gericht nach, darf die Hilfeleistung nicht versagt werden, urteilte das Bundessozialgericht.
Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitterkanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.
Dirk Baas

Berlin (epd). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Vergütungssystem für Krankenhäuser umkrempeln. Gemeinsam mit der Regierungskommission für die Klinikversorgung in Deutschland stellte er am 6. Dezember in Berlin die Vorschläge vor. Er wolle sie zur Grundlage politischer Entscheidungen machen, sagte der SPD-Politiker und sprach von einer „Revolution im System“. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) kritisierte umgehend, die vorhandenen Finanzmittel sollten nur umverteilt werden. Das reiche nicht.
Künftig sollen alle Kliniken eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung von Betten, Personal und medizinischem Gerät erhalten und nur einen Teil ihrer Ausgaben über Fallpauschalen für die jeweiligen Behandlungen refinanziert bekommen. Im Kern sollen die Kliniken in drei Vergütungsgruppen eingeteilt werden, lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale Krankenhäuser und solche, die wegen ihrer Kapazitäten und Spezialisierung von überregionaler Bedeutung sind, inklusive der Universitätskliniken.
Lauterbach sagte, die derzeitige Not in den Kinderkliniken zeige beispielhaft, was in der Klinikfinanzierung seit mindestens zehn Jahren falsch laufe. Kinderheilkunde, die Geburtshilfe oder die Pflege im Krankenhaus rechneten sich im gegenwärtigen Fallpauschalen-System nicht und seien vernachlässigt worden. Geld verdienen lasse sich dann, wenn möglichst billig, möglichst viele Patienten behandelt würden, erklärte Lauterbach. Er selbst wisse von Ärztinnen und Ärzten, die diesem ökonomischen Druck nicht mehr unterworfen sein und nicht mehr im Krankenhaus arbeiten wollten, beim Pflegepersonal sei es genauso, sagte Lauterbach. Die Probleme seien lange bekannt, aber nie grundsätzlich angegangen worden.
Verantwortlich für viele Fehlentwicklungen ist nach Lauterbachs Überzeugung die allzu gründliche Unterwerfung der Krankenhausbehandlung in Deutschland unter das Fallpauschalen-System. Die Reformvorschläge der Regierungskommission laufen darauf hinaus, es teilweise und insbesondere in der Grundversorgung ganz wieder abzuschaffen. Die Fallpauschalen, auch DRGs, die sich nach den Diagnosen der Patienten richten, sind vor knapp 20 Jahren eingeführt worden, um die Kosten der Krankenhausversorgung zu senken. Seitdem werden die Behandlungsfälle pauschal vergütet und nicht danach, wie hoch oder gering der Aufwand tatsächlich ist.
Eine der Fehlentwicklungen ist, dass Kliniken vor allem in der Pflege Stellen wegrationalisierten, um Personalkosten zu sparen. Die Pflege ist inzwischen aus dem Fallpauschalensystem wieder herausgenommen worden. In der vergangenen Woche hat der Bundestag zudem ein Gesetz beschlossen, wonach unter anderem Kinderkliniken und die Geburtshilfe mehr Geld erhalten.
Im Idealfall, so die Regierungskommission, sollen die Reformen dazu führen, dass einerseits überall die Grundversorgung gesichert ist und die Zusammenarbeit zwischen kleinen Kliniken und niedergelassenen Ärzten enger wird. Die Finanzierung großer Kliniken soll sich hingegen vor allem nach ihren Leistungen in der spezialisierten Medizin richten. Der Kölner Intensivmediziner Christian Karagiannidis betonte, man wolle erreichen, dass überall in den Kliniken Mindestqualitätsanforderungen umgesetzt würden.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft begrüßte den Aufbruch zu Reformen zwar, bezweifelte aber, dass sie zu einer Überwindung des bisherigen Systems führten, wenn nicht als erstes die „Unterfinanzierung“ behoben werde. „Die Reform soll nach Vorstellung der Kommission die aktuellen Mittel nur umverteilen. Basis sind die Zahlen aus dem Jahr 2021. Damit basiert die Finanzreform aber bereits auf einer strukturellen Unterfinanzierung und ist damit im Prinzip schon zu Beginn zum Scheitern verurteilt“, sagte DKG-Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß. Das Budget der Kliniken müsse um mindestens 15 Milliarden Euro bei den Betriebskosten und jährlich vier Milliarden Euro bei den Investitionskosten aufgestockt werden.
Demgegenüber argumentierte der Koordinator der Regierungskommission, der Berliner Psychiater und Klinikleiter Tom Bschor, Deutschland gebe mit rund 13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes so viel Geld für das Gesundheitswesen aus wie kaum ein anderes Land. Nirgends seien aber auch die Fallpauschalen so gründlich zur Finanzierungsbasis der Klinikversorgung gemacht worden und hätten ein sich immer schneller drehendes Hamsterrad in Gang gesetzt. „Die Krankenhäuser werden kollabieren, wenn wir das nicht reformieren“, warnte Bschor.
Berlin (epd). Im Kern will Gesundheits Lauterbach an den umstrittenen Fallpauschalen zur Finanzierung der Klinikleistungen festhalten. Allerdings wird das Volumen der Vergütungen auf 60 Prozent zurückgefahren. In Zukunft sollen 40 Prozent der Krankenhausbezüge durch ein sogenanntes Vorhaltebudget abgedeckt werden. epd sozial hat Stimmen dazu aus den Verbänden gesammelt:
Verena Bentele, Präsidentin des VdK: „Der Minister hat viele Fehler in der Krankenhausbehandlung richtig benannt, es folgen aber nur zum Teil richtige Schritte daraus. Er hält weiterhin am System der Fallpauschalen fest, auch wenn er es etwas abspeckt. Die Gesundheitsversorgung darf nicht länger am Gewinnstreben der Träger ausgerichtet sein. Maßstab aller ambulanten und stationären Behandlungen muss ausschließlich der gesundheitliche Bedarf der Patienten sein. Die Fallpauschalen gehören abgeschafft. Die Vergütung darf nur der Selbstkostendeckung dienen.“
Christoph Radbruch, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes (DEKV): „Die vorgelegten Empfehlungen zur übergreifenden Krankenhausreform sind eine gute Grundlage für die Evolution des Gesundheitssystems. Bei der Umsetzung der Vorschläge ist aber ein Praxischeck der Auswirkungen auf die Versorgung vor Ort zwingend nötig. Ferner braucht es ausreichend Zeit für eine sorgfältige Prüfung der Versorgungs- und Finanzauswirkungen dieser neuen Finanzierungsmaßnahmen. Auch müssen wir uns die Zeit für eine eingehende gesellschaftspolitische Debatte mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen nehmen. Denn bei den krankenhausregulatorischen Maßnahmen liegt meist die Tücke im Detail. Mögliche Fehlanreize zeigen sich häufig erst zeitversetzt und Lücken in der Regelung treten erst bei der Praxisanwendung hervor.“
Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbands Deutschlands (kkvd): „Die Regierungskommission schlägt vor, die Krankenhäuser künftig über ein Zwei-Säulen-Modell bestehend aus Vorhaltepauschalen und einer mengenabhängigen Komponente zu finanzieren. Das wäre ein wichtiger Fortschritt, mit dem die Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse in der Gesundheitsversorgung gut abgesichert werden können. Gleichzeitig ist es sinnvoll, die Wirtschaftlichkeit nicht völlig außer Acht zu lassen. Diesem Prinzip folgen die freigemeinnützigen Einrichtungen von je her, vor allem da kirchliche Krankenhäuser gerade auch in strukturschwachen Regionen die Gesundheitsversorgung sicherstellen. Daher fühlen wir uns mit den Vorschlägen der Regierungskommission bestärkt und unterstützt.“
Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats (DPR): „Der sichtbar fehlerhafte Anreiz des Fallpauschalensystems, immer mehr Leistungen zu erbringen, wird unterbrochen. Das entlastet die beruflich Pflegenden. Der Weg der skizzierten Krankenhausreform ist aus Sicht des Deutschen Pflegerats vorstellbar. Sie darf jedoch nicht Halt machen an reinen Strukturänderungen im Krankenhausbereich. Der Deutsche Pflegerat unterstützt diesen Prozess gerne.“
Sylvia Bühler, Vorstand der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di): „Die Empfehlungen der Regierungskommission gehen zwar in die richtige Richtung, aber noch nicht weit genug. Die Abkehr vom durchökonomisierten System der Krankenhausfinanzierung ist eingeleitet. Die vom Bundesgesundheitsminister angekündigte Abschaffung des Fallpauschalensystems ist allerdings noch nicht in Sicht, hier ist die Kommission eindeutig zu kurz gesprungen. Krankenhäuser sind ein elementarer Bereich der Daseinsvorsorge, da passt ein System, das auf Gewinn aufbaut, einfach vorne und hinten nicht.“
Gerald Gaß, Vorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG): „Unser Fazit zu den Vorschlägen der Kommission lautet: Grundsätzlich richtige Gedanken zur Novellierung der Finanzierung, aber deutlich zu kurz gesprungen, weil die Hybrid-DRGs zur Ambulantisierung am Krankenhaus, die strukturelle Unterfinanzierung und die Defizite bei der Investitionsförderung schlicht ausgeblendet werden. Die nächsten Monate werden von einem nicht einfachen Diskussionsprozess von Bund, Ländern und den umsetzenden Verbänden und Akteuren geprägt sein. Wir Krankenhäuser stehen für diesen Prozess bereit. Aber uns läuft auch die Zeit davon. Krankenhäuser brauchen verlässliche Perspektiven und Planungssicherheit. Die aktuelle Lage ist eher trostlos.“
Klaus Emmerich, Bündnis Klinikrettung: „Die Vorschläge der Regierungskommission zielen nicht darauf ab, die Krankenhäuser tatsächlich ausreichend zu finanzieren. Es geht lediglich darum, die knappen finanziellen Ressourcen zu verschieben. Die vorgesehenen Vorhaltekosten werden dem Budget für DRG-Fallpauschalen entzogen. Das ist ein Nullsummenspiel, bundesweit wird es nicht mehr Geld für die Krankenhäuser geben. Neue Vergütungsmodelle wie die tagesstationäre Behandlung und Hybrid-DRGs bedeuten einen zusätzlichen, ungeheuren Bürokratieaufwand, der das Krankenhauspersonal noch weiter belasten wird.“
Hamburg, Berlin (epd). Die Fallpauschalen oder „diagnosis related groups“ (DRG) sollten bei ihrer Einführung im Jahr 2004 das Gesundheitssystem effizienter machen. Das DRG-System regelt, dass ein Krankenhaus für einen Behandlungsfall abhängig von der jeweiligen Diagnose einen festen Betrag erhält.
Für die Implantierung eines Defibrillators in einer Herzkammer erhielt eine Klinik im Jahr 2022 demzufolge in der Regel 5.187 Euro, für eine Lungentransplantation 24.720 Euro. Mit diesen Fallpauschalen muss eine Klinik auskommen. Das bedeutet: Kann sie einen Patienten recht schnell wieder entlassen, macht sie Gewinn, muss er länger bleiben, legt sie drauf.
Die Fallpauschalen sollten unter anderem die Liegezeiten in Krankenhäusern reduzieren. Vor 2004 wurden Krankenhäuser für jeden Tag bezahlt, den eine Patientin oder ein Patient in einem ihrer Betten lag. Ob dieses Reduktionsziel erreicht wurde, ist unklar. Laut einer Studie der Universität Hamburg sank die durchschnittliche Verweildauer seit der DRG-Einführung zwar. Sie war allerdings schon vorher im Sinken begriffen, und sie sank davor sogar schneller als danach.
In anderen Bereichen habe das DRG-System durchaus für mehr Sparsamkeit gesorgt, erklärt die Politologin Ricarda Milstein, Mitarbeiterin am Lehrstuhl Management im Gesundheitswesen der Uni Hamburg: „Das hat schon einen Anreiz geschaffen, besser mit finanziellen Ressourcen umzugehen.“ Durch das Kodiersystem, in das die Behandlungsfälle in den Kliniken einsortiert werden, seien die Krankenhäuser auch transparenter geworden.
Kritiker weisen allerdings schon lange darauf hin, dass das DRG-System zu teuren Fehlanreizen führt. So zeigt beispielsweise ein Gutachten des GKV-Spitzenverbands aus dem Jahr 2012, dass seit Einführung der Fallpauschalen die Zahl der behandelten Fälle gestiegen ist - und zwar so stark, dass sich dieser Anstieg mit einer immer älter und kränker werdenden Bevölkerung allein nicht erklären lässt.
Andere Untersuchungen, etwa der Uni Düsseldorf, deuten auf das sogenannte Upcoding hin. Krankenhäuser gruppieren demnach Patienten unter Umständen in Diagnosegruppen ein, die besser vergütet werden.
„Qualität ist kein Bestandteil des DRG-Systems“, kritisiert Milstein weiter, „alle Krankenhäuser werden gleich behandelt.“ Kliniken der Maximalversorgung, die oft komplizierte und schwierige Fälle behandeln, haben daher Mühe, mit den Fallpauschalen auszukommen.
Die Auslastung von Herzkatheterlaboren oder orthopädischen Abteilungen lässt sich in der Regel gut planen, was für stabile Erlöse sorgt. Das DRG-System zwinge Klinken daher „zum Aufbau von Spezialabteilungen, obwohl diese in der Region bereits vorhanden sind“, kritisiert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund.
Zugleich führe das System dazu, dass beispielsweise Geburtshilfe- und Kinderstationen kaum zu finanzieren seien. Deren Auslastung ist schlecht planbar, ihre Vorhaltekosten bleiben aber auch bei geringen Fallzahlen fast gleich. Zuletzt beschloss der Bundestag dreistellige Millionenzuschüsse für die Geburtshilfe und die unterfinanzierten Kinderkliniken, in denen zudem wegen einer Welle von Atemwegserkrankungen derzeit akuter Personal- und Bettenmangel herrscht. Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist das der erste Schritt zur Abschaffung der Fallpauschalen in der Kinderheilkunde.
Die Hamburger Forscherin Milstein verweist allerdings darauf, dass es für diese Zusammenhänge kaum wissenschaftliche Belege gebe. Insbesondere für die Schließung von Geburtshilfestationen kämen auch andere Faktoren in Betracht.
Das DRG-System steht auch im Verdacht, den Personalmangel in der Pflege mitverursacht oder verschlimmert zu haben. Kliniken können ihre Erlöse steigern, wenn sie ihre Aufwendungen für ihre Fälle reduzieren - zum Beispiel in der Pflege. Denn ärztliches Personal bringt Geld ein, wenn es Diagnosen stellt. Pflegepersonal hingegen kostet nur.
Auch für diesen Vorwurf gibt es nach Auskunft Milsteins aber keine eindeutige Bestätigung aus der Forschung. Milstein gibt außerdem zu bedenken, dass es mittlerweile mit den Pflegeuntergrenzen einen Mechanismus gebe, der allzu großen Personalabbau in der Pflege verhindere.
Das DRG-System biete durchaus Vorteile, sagt Milstein. Deutschland verlasse sich aber bei der Klinikfinanzierung zu sehr darauf. Andere Länder modifizierten ihre Fallpauschalen in der Vergangenheit, um die Nachteile des Systems einzuhegen.

Frankfurt a.M. (epd). Nach den schlechten Erfahrungen mit dem Corona-Bonus im ersten Pandemie-Jahr 2020 beklagen die Pflegekräfte bei der aktuellen Verteilung der Corona-Prämien für das Jahr 2021 Willkür und Ungerechtigkeiten. Die Bundesregierung verfehle ihr Ziel, mit einer Sonderzahlung von insgesamt einer Milliarde Euro die besondere Belastung der Arbeit mit Covid-Patientinnen und-Patienten zu honorieren. Das stellt der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) nach „vielen Rückmeldungen beruflich Pflegender“ fest, wie er dem Evangelischen Pressedienst (epd) berichtete. Krankenhäuser und Einrichtungen der Altenpflege sind gesetzlich verpflichtet, die Corona-Prämien bis Jahresende an die Beschäftigten auszuzahlen.
„Es hat bei dieser dritten Auflage eines Corona-Bonus kein Lerneffekt bei den politisch Verantwortlichen stattgefunden, sondern er erweist sich wieder als intransparent, willkürlich und Belegschaften spaltend“, kritisierte der Verband. Die Kolleginnen und Kollegen erlebten derzeit in den Betrieben eine ungerechte Verteilung des Lohnzuschlags.
Die Liste der Beschwerden, die Pflegekräfte ihrem Berufsverband geschickt haben, sei lang. So stößt beispielsweise auf Unverständnis, dass Krankenpflegehelferinnen im Unterschied zu ihren examinierten Kolleginnen keinen Bonus bekommen. „Das wird als ungerecht empfunden, wenn man miteinander und Hand in Hand auf derselben Station gearbeitet hat“, erklärte der Verband.
Der DBfK Nordwest mit Sitz in Hannover kritisiert: „Ein zu 50 Prozent freigestelltes Betriebsratsmitglied bekommt den Bonus nur zu 50 Prozent, obwohl Betriebsratstätigkeit nicht zu Nachteilen führen darf.“ Der Verband berichtet aus der Klinikpraxis über eine weitere negative Erfahrung: „Eine Krankenschwester aus der Notaufnahme wird wegen Personalmangels regelmäßig in die Akutstation beordert und hat dadurch mehr als 185 Tage auf einer bettenführenden Station gearbeitet. Laut Stellenplan gehört sie aber zur Notaufnahme und bekommt deswegen keinen Bonus.“ Der DBfK bilanziert enttäuscht: „Dieser Bonus ist von einem als wirklich wertschätzend empfundenen 'Wumms' weit entfernt.“
Die Gewerkschaft ver.di hatte schon im Frühjahr 2021 darauf hingewiesen, dass Pflegekräfte in der Altenpflege den Corona-Bonus für das Jahr 2020 nicht bekommen haben. Die Steuerberatungsgesellschaft ETL Advision (Berlin) hatte damals in einer aufwendigen Studie festgestellt, dass bundesweit nicht einmal 60 Prozent aller Berechtigten den Pflegebonus von ihren Arbeitgebern bis Ende 2020 erhalten hatten. „Wir bekommen noch E-Mails von Beschäftigten, die bis heute keine Prämie erhalten haben und fürchten, dass sie mit der neuerlichen Prämie 2022 wieder leer ausgehen“, sagte Matthias Gruß, ver.di-Gewerkschaftssekretär für die Altenpflege, dem epd.
Gruß nennt es „schändlich, wie hier mit Pflegekräften umgegangen wird, die seit mehr als 2,5 Jahren sich in dieser Pandemie physisch und psychisch aufreiben“. Dabei koste die Arbeitgeber die Prämie keinen Cent, da sie diese voll von den gesetzlichen Pflegekassen erstattet bekämen. „Die Pflegeeinrichtungen mussten den Kassen ausschließlich melden, wie viele Beschäftigte mit welchem Anspruch in ihren Einrichtungen arbeiten.“ Auf dieser Basis bekommen sie eine Vorauszahlung, die sie mit dem Lohn auszahlen müssen.
Nach dem im Sommer dieses Jahres beschlossenen Gesetz der Ampel-Koalition soll Pflegekräften in der Altenpflege und in Krankenhäusern für ihre besonderen Leistungen im Corona-Jahr 2021 ein Bonus gezahlt werden. Sie erhalten insgesamt eine Milliarde Euro aus Bundesmitteln. Die Summe wird zu gleichen Teilen auf beide Bereiche verteilt.
Arbeitgeber in der Altenpflege sind verpflichtet, den Pflegekräften den Bonus unverzüglich nach Erhalt der Vorauszahlung von den Pflegekassen zum 30. September 2022, spätestens aber bis zum 31. Dezember 2022 auszuzahlen. In der Altenpflege erhalten Vollzeitbeschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung den höchsten Bonus in Höhe von bis zu 550 Euro.
Krankenhäuser sollen den Bonus innerhalb von vier Wochen nach Auszahlung durch den GKV-Spitzenverband an die Pflegekräfte auszahlen. Der GKV-Spitzenverband hat die Bundesmittel in Höhe von 500 Millionen Euro anhand einer Liste des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) an alle 837 anspruchsberechtigten Krankenhäuser Anfang Oktober 2022 vollständig weitergeleitet, wie der Verband dem epd mitteilte. „Die Krankenhäuser hatten die Prämienbeträge folglich an die Pflegefachkräfte und Intensivpflegefachkräfte auszuzahlen“, erklärt der Verband der gesetzlichen Krankenkassen.
Das Bundesgesundheitsministerium rechnet nach eigenen Angaben damit, dass in den Krankenhäusern mehr als 204.000 Pflegefachkräfte einen Bonus erhalten und mehr als 25.000 Intensivpflegefachkräfte. Die Auszahlung der Corona-Prämien für 2021 werde streng geprüft: „Der Gesetzgeber hat vorgesehen, dass Arbeitgeber für den Pflegebonus bis spätestens zum 15. Februar 2023 zusätzlich zu erklären haben, an wie viele Beschäftigte und zu welchem Zeitpunkt die Bonusauszahlungen erfolgt sind“, teilte das Ministerium mit.
Nach Mitteilung des GKV-Spitzenverbandes wird im weiteren Verlauf des Verfahrens durch Jahresabschlussprüfer geprüft, ob die Bundesmittel zweckentsprechend verwendet wurden. Sofern das nicht geschehen sei, seien diese Beträge bis Ende Dezember 2023 an den GKV-Spitzenverband zurückzuzahlen. Am Ende gingen die zurückgezahlten Beträge an den Bund. Die Pflegekräfte würden also bei Fehlverhalten ihrer Arbeitgeber leer ausgehen. Um das zu verhindern, können sie, wie ver.di mitteilte, ihren Arbeitgeber verklagen.

Berlin (epd). Der Bundestag hat am 2. Dezember Änderungen im Aufenthalts- und Asylrecht beschlossen, die langjährig in Deutschland geduldeten Ausländern eine Perspektive auf ein sicheres Bleiberecht geben soll. Mit der Mehrheit von 371 Stimmen verabschiedete das Parlament in namentlicher Abstimmung das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht. Menschen, die am 31. Oktober dieses Jahres bereits seit fünf Jahren ohne sicheren Aufenthaltstitel in Deutschland lebten, sollen für 18 Monate den neuen Status bekommen, um innerhalb dieser Zeit die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht nachzuweisen. Außerdem beschloss der Bundestag ein Gesetz zur Beschleunigung von Asyl- und Asylgerichtsverfahren.
Das Chancen-Aufenthaltsrecht soll Menschen eine Perspektive geben, die in der Vergangenheit jeweils nur den befristeten Duldungsstatus bekommen haben. Er bedeutet, dass die Betroffenen eigentlich ausreisepflichtig sind, zugleich aber aus persönlichen Gründen oder wegen der Situation im Herkunftsland nicht abgeschoben werden können. Der SPD-Abgeordnete Helge Lindh bezeichnete diese Kettenduldungen als „unwürdigen Zustand“. Deswegen sei das neue Aufenthaltsrecht ein „Gesetz der Vernunft“.
Um nach den 18 Monaten ein dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen, müssen die Menschen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. „Das bedeutet Sprache, Job und selbstverständlich auch sauber bleiben“, betonte der FDP-Abgeordnete Muhanad Al-Halak. Er warb mit seiner persönlichen Biografie dafür, Geduldeten eine Chance zu geben. Dass „ein Junge aus dem Irak“ wie er heute als Bürger Deutschlands im Bundestag stehe, sei doch kein Problem, sagte er.
Werden die Bedingungen für ein Bleiberecht nach 18 Monaten nicht erfüllt, fallen die Betroffenen wieder auf den Duldungsstatus zurück. Vom Chancen-Aufenthaltsrecht ausgeschlossen werden Straftäter. Rund 137.000 der rund 248.000 Geduldeten könnten von der Neuregelung profitieren.
Mit dem vom Parlament beschlossenen Gesetz werden auch für Hürden für das stichtagsunabhängige Bleiberecht gesenkt, indem die Wartezeiten verkürzt werden. Zudem wird beim Familiennachzug zu Fachkräften in Deutschland künftig kein Sprachnachweis mehr verlangt.
Ferner beschloss das Parlament ein Gesetz, das Änderungen für Asyl- und Asylgerichtsverfahren vorsieht. Ziel ist es jeweils, die Verfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie vor Gerichten zu beschleunigen. Mit dem Gesetz wird zudem erstmals eine behördenunabhängige Asylverfahrensberatung eingeführt, bei der sich Flüchtlinge vor und während des Verfahrens Rat und Hilfe holen können. Dies werde die Qualität der Asylbescheide steigern, sagte die Grünen-Politikerin Filiz Polat.
Die Union kritisierte die beiden Gesetze. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindholz (CSU) sprach von „Fehlanreizen“. Schon die bestehenden Regelungen gäben Geduldeten bei guter Integration eine Perspektive. Das neue Gesetz belohne „die Falschen“. Wie die AfD hatte die Union angekündigt, gegen das Gesetz zu stimmen. Nach der zweiten Lesung enthielten sich aber auch Unionsabgeordnete bei der Abstimmung mit Handzeichen. In der namentlichen Schlussabstimmung gab es 226 Stimmen gegen das Chancen-Aufenthaltsrecht und 57 Enthaltungen.
Die Linke übte ebenfalls Kritik an den Gesetzen. Ihr geht wiederum das Chancen-Aufenthaltsrecht nicht weit genug. Im Gesetz für die Beschleunigung von Asylverfahren sieht sie zudem eine Verschärfung. Dass Anhörungen im Asylverfahren künftig auch mit Videotechnik möglich sein sollen, bezeichnete die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Clara Bünger, als „Tabubruch“. Die Anhörung sei Kern des Asylverfahrens, in der persönliche, oft dramatische Geschichte berichtet werde. Mit Videotechnik sei die dafür notwendige vertrauensvolle Atmosphäre kaum möglich.
Berlin (epd). Als erstes Migrationspaket bezeichnet die Ampelkoalition die beiden am 2. Dezember verabschiedeten Gesetze zu Chancen-Bleiberecht und Asylverfahren. Ein zweites soll folgen, denn die bisher beschlossenen Regelungen enthalten längst noch nicht alles, was SPD, Grüne und FDP im Bereich von Asyl, Zuwanderung und Einbürgerung versprochen haben. Das sind die durchgesetzten Regelungen im Detail:
CHANCEN-AUFENTHALTSRECHT
Ausländer, die zum Stichtag 31. Oktober 2022 seit fünf Jahren ohne sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland lebten, sollen für 18 Monate das sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht bekommen. In dieser Zeit haben sie die Chance, die Voraussetzungen für ein dauerhaftes Bleiberecht zu erfüllen. Dazu zählen unter anderem Sprachkenntnisse, der Identitätsnachweis und die Sicherung des Lebensunterhalts. Wer es nicht schafft, fällt in die Duldung zurück. Straftäter und deren Familien werden vom Chancen-Bleiberecht ausgeschlossen. Vom neuen Bleiberecht profitieren könnten rund 137.000 der etwa 248.000 Geduldeten, die zum Stichtag 31. Oktober in Deutschland lebten.
WEITERE ERLEICHTERUNGEN IM BLEIBERECHT
Mit dem Gesetz werden auch die Hürden für das stichtagsunabhängige Bleiberecht gesenkt. Für Erwachsene soll die Wartezeit auf sechs (bislang acht) Jahre beziehungsweise bei Familien mit minderjährigen Kindern auf vier (bislang sechs) Jahre reduziert werden. Dann können sie ein sicheres Aufenthaltsrecht erhalten, wenn sie Voraussetzungen wie Sprachkenntnisse und Lebensunterhaltssicherung erfüllen. Gut integrierte Jugendliche und Erwachsene bis 27 Jahren sollen künftig nach drei statt bislang vier Jahren einen sicheren Aufenthaltsstatus bekommen können. Allerdings haben die Parlamentarier kurz vor Verabschiedung für junge Betroffene eine einjährige sogenannte Vorduldungszeit in das Gesetz geschrieben, in der Abschiebungen möglich sein sollen. Vom seit 2015 geltenden stichtagsunabhängigen Bleiberecht hatten bis Sommer dieses Jahres 16.000 Jugendliche und 12.000 Erwachsene, die alle Voraussetzungen erfüllten, Gebrauch gemacht und sind damit den sogenannten Kettenduldungen entkommen.
VERZICHT AUF SPRACHKENNTNISSE BEI NACHZUG ZU FACHKRÄFTEN
Um für Fachkräfte die Einwanderung nach Deutschland attraktiver zu gestalten, wird beim Nachzug ihrer Familien künftig auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichtet. SPD, Grüne und FDP hatten auch Erleichterungen beim Familiennachzug für Flüchtlinge angekündigt. Sie werden mit dem aktuellen Gesetz noch nicht umgesetzt.
ABSCHIEBEHAFT
Das Gesetz sieht auch eine Ausweitung der Abschiebehaft vor. Künftig sollen Ausländer bis zu sechs Monate in Abschiebehaft genommen werden können, wenn das sogenannte Ausweisungsinteresse bei ihnen groß ist. Das gilt etwa nach der Verurteilung wegen begangener Straftaten. Die maximal zulässige Dauer der Abschiebehaft liegt eigentlich bei drei Monaten.
SCHNELLERE UND EFFIZIENTERE ASYLVERFAHREN
Ein zweites vom Bundestag beschlossenes Gesetz soll für schnellere und effizientere Asylverfahren sorgen. Es legt die maximale Dauer für ein Asylverfahren auf sechs Monate fest, erlaubt aber eine Verlängerung auf bis zu 18 Monate, wenn entsprechende Gründe vorliegen. Durch Änderungen im Asylverfahrensrecht soll es schnellere Gerichtsurteile geben. Der Gesetzentwurf verweist auf die hohe Klagequote nach Asylentscheidungen. Im Sommer lag sie bei rund einem Drittel. Im Jahr 2021 wurde sogar gegen 38 Prozent der Asylentscheidungen geklagt.
Eine weitere Neuerung ist, dass sogenannte Widerrufsverfahren nur noch anlassbezogen erfolgen sollen. Dabei wird nach einigen Jahren geprüft, ob die Gründe für den Schutzstatus noch vorliegen. Durch den Wegfall der Pflicht zur Überprüfung entfallen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach Schätzung des Entwurfs rund 15.500 der aufwendigen Prüfverfahren pro Jahr.
UNABHÄNGIGE ASYLVERFAHRENSBERATUNG
Das Gesetz kommt zudem einer langjährigen Forderung von Verbänden nach einer behördenunabhängigen Asylverfahrensberatung nach. Schon vor dem Asylantrag sollen Schutzsuchende sich dort Rat holen können und durch das Verfahren begleitet werden.

Berlin (epd). Es gibt ein erhebliches Potenzial von internationalen Fachkräften, die sich für Deutschland interessieren. Sie sind überwiegend hochqualifiziert und stark motiviert, die Anforderungen zu erfüllen, wie eine Online-Befragung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ergibt, die am 2. Dezember in Berlin vorgestellt wurde. Die größten Hürden sehen die potenziellen Zuwanderer allerdings bei der Arbeitssuche. Die Studie sei die erste Befragung von einwanderungswilligen Fachkräften überhaupt, sagte der Leiter der OECD-Migrationsabteilung, Thomas Liebig.
Der Befragung zufolge haben drei von vier Interessentinnen und Interessenten einen Hochschulabschluss. Der größte Teil (19 Prozent), überwiegend IT-Fachkräfte, stammt aus Indien. An zweiter Stelle liegt Kolumbien (10 Prozent). Aus dem Land kommen vor allem Pflegekräfte. An dritter Stelle liegt die Türkei, aus der vorwiegend Handwerker in Deutschland arbeiten wollen.
90 Prozent derer, die bereits Schritte zur Einwanderung unternehmen, würden der Studie zufolge Weiterbildungen absolvieren, wenn dies verlangt wird. Die Mehrheit wäre dazu aber nur bereit, wenn sie währenddessen bereits in Deutschland arbeiten könnte. Ähnliches gilt für die Deutschkenntnisse.
Als höchste Hürde auf dem Weg nach Deutschland nennt die große Mehrheit der Befragten die Suche nach einem Arbeitsplatz. Vier von fünf potenziellen Einwanderern wünschen sich mehr Unterstützung durch die deutsche Seite. Am schwierigsten sei es, Stellenangebote überhaupt zu finden und Kontakte zu Arbeitgebern aufzunehmen. 70 Prozent der Befragten wünschen sich daher die Erteilung von Visa zur Arbeitssuche.
Ein Arbeitsvertrag ist in der Regel die Voraussetzung für die Zuwanderung nach Deutschland. Mit einem von Deutschland anerkannten Abschluss können Fachkräfte seit 2020 aber für ein halbes Jahr auch zur Arbeitssuche einreisen. Die Bundesregierung hat in dieser Woche Eckpunkte für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorgestellt, das die bisherigen Regeln vereinfachen und Hürden abbauen soll. Schätzungen zufolge werden künftig Hunderttausende Zuwanderer pro Jahr gebraucht, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen.
Zu den Neuerungen soll nach dem Willen der Ampel-Koalition ein Punktesystem gehören, um mehr Menschen die Einreise zur Arbeitssuche ermöglichen. Außerdem soll es künftig möglich sein, ohne einen anerkannten Abschluss eine Arbeit aufzunehmen und die Anerkennung in Deutschland nachzuholen.
Der OECD-Migrationsexperte Liebig bewertete die Regierungspläne als überwiegend positiv. Sie böten die Chance, die Fachkräfteeinwanderung „kräftig voranzubringen“, sagte er. Ob sich das Punktesystem in Verbindung mit einer „Chancenkarte“ bewähren werde, hänge allerdings von der Ausgestaltung ab. Beim Thema Qualifikationsvoraussetzungen sei zu hoffen, dass die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen einfacher und schneller werde.
Die OECD-Forscherinnen und Forscher haben im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums von August bis Oktober dieses Jahres fast 30.000 Fachkräfte befragt, die nach Deutschland kommen wollen. Sie wurden über das offizielle Portal der Bundesregierung „Make it in Germany“ sowie über die Auslandsvertretungen für die Umfrage gewonnen. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Studien-Mitautorin Anne-Sophie Senner nicht repräsentativ, geben aber einen guten Einblick in die Erwartungen der Menschen und die Hürden, denen sie sich gegenübersehen. Die Befragungen sollen noch zweimal wiederholt werden, um Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob die Menschen am Ende tatsächlich nach Deutschland kommen oder nicht.
Berlin (epd). Bei einer dauerhaften Zuwanderung von rund 400.000 Menschen pro Jahr könnte die Bevölkerung in Deutschland nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes bis 2070 auf 90 Millionen Einwohner anwachsen. Das geht aus der am 2. Dezember in Berlin vorgestellten 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung der Statistiker hervor. Sie haben dazu drei Szenarien zur Entwicklung der Bevölkerungszahl in den kommenden fünf Jahrzehnten durchgerechnet. Aktuell zählt Deutschland 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.
Bei einer jährlichen Nettozuwanderung von durchschnittlich 290.000 Personen würde die Bevölkerungszahl bis 2031 auf 85 Millionen Menschen anwachsen und dann bis 2070 auf 83 Millionen zurückgehen, sagte der Leiter der Abteilung Bevölkerung im Statistischen Bundesamt, Karsten Lummer. Bei einer niedrigen Nettozuwanderung von 180.000 Personen pro Jahr würde die Bevölkerungszahl auf 75 Millionen Menschen im Jahr 2070 sinken.
„Langfristige Bevölkerungsvorausberechnungen sind keine Prognosen“, betonte Lummer. Sie lieferten „Wenn-Dann-Aussagen“ und zeigten, wie sich die Bevölkerung und deren Struktur unter bestimmten Annahmen verändern würden. Grundlage der Berechnungen sind die Faktoren Geburtenhäufigkeit (derzeit bei 1,58 Kindern je Frau), Lebenserwartung (78,5 Jahre bei Männern, 83 Jahre bei Frauen) und Außenwanderungssaldo.
Das Gros der Nettozuwanderung komme aktuell aus dem europäischen Ausland nach Deutschland, sagte der Leiter der Gruppe Demografie und Arbeitsmarkt, Stephan Lüken. Insbesondere die Staaten Osteuropas stünden aber auch vor einer starken Überalterung. „Dadurch könnten ihre Fachkräfte auf dem einheimischen Arbeitsmarkt gebraucht werden“, sagte Lüken.
Ohne Zuwanderung wäre die deutsche Bevölkerung dabei schon seit längerer Zeit geschrumpft. Seit 1972 sterben hierzulande mehr Menschen als geboren werden. 2021 lag das Geburtendefizit laut Lüken bei 230.000. Ohne Nettozuwanderung und bei einer moderaten Entwicklung der Geburtenhäufigkeit und der Lebenserwartung würde das jährliche Geburtendefizit bis 2055 auf 540.000 zunehmen und anschließend bis 2070 leicht sinken. Vermindert werde es nur durch Zuwanderung.
Deutschland erlebe derzeit eine spürbare Alterung des Erwerbspersonenpotenzials, weil die Babyboomer demnächst in Rente gehen, sagte Lüken. Aktuell gehörten 51,4 Millionen Menschen der Altersgruppe von 20 bis 66 Jahren an. Das entspreche 62 Prozent der Bevölkerung. Selbst bei einer hohen Nettozuwanderung rechnet das Bundesamt bis Mitte der 2030er Jahre mit einer Abnahme um 1,6 Millionen Menschen in der erwerbstätigen Bevölkerung. Bei niedriger Nettozuwanderung könne die Zahl sogar um 4,8 Millionen Personen sinken. 2070 könnte ihr Anteil bei nur noch 54 Prozent liegen.
Gütersloh (epd). Trotz eines Fachkräftemangels in der deutschen Wirtschaft heuern nur wenige Unternehmen laut einer Studie geeignete Mitarbeiter aus anderen Ländern an. Nur etwa jedes sechste Unternehmen (17 Prozent) suche nach eigenen Angaben Fachkräfte im Ausland, erklärte die Bertelsmann Stiftung am 8. Dezember in Gütersloh bei der Vorstellung des aktuellen Fachkräftemonitors. Offenbar seien die Hindernisse für die Rekrutierung im Ausland nach wie vor zu hoch.
Als Hauptprobleme hätten Unternehmen Sprachbarrieren, rechtliche und bürokratische Hürden sowie die schwierige Einschätzung ausländischer Qualifikationen genannt.
Im Jahr 2021 seien zwar wieder etwas mehr Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland gekommen als unmittelbar nach Beginn der Pandemie, erklärte die Bertelsmann Stiftung. Mit knapp 25.000 Menschen liege deren Anzahl aber deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau von fast 40.000 Menschen. Rund die Hälfte der eingewanderten Fachkräfte stamme aus Asien.
Fast drei Viertel der Entscheider (73 Prozent) hätten laut der aktuellen Umfrage von Fachkräfteengpässen in ihrem Betrieb berichtet, erklärte die Stiftung. Im Jahr 2021 seien dies noch 66 Prozent und im Jahr davor lediglich 55 Prozent gewesen. Die vom Fachmangel am meisten betroffenen Branchen seien die Kranken- und Altenpflege, Bau und Handwerk sowie Industrie, Logistik und Tourismus.
Um mehr Fachkräfte zu gewinnen, werde zurzeit in erster Linie auf Aus- und Weiterbildung im eigenen Betrieb sowie auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesetzt, erklärte die Bertelsmann Stiftung weiter. Allerdings gingen der Umfrage zufolge weniger als ein Fünftel der befragten Entscheider davon aus, dass in Deutschland ausreichend Personal zur Verfügung stehe.
Die aktuellen Vorschläge der Bundesregierung für ein modernisiertes Zuwanderungsgesetz gingen in die richtige Richtung und könnten Hürden für den Zuzug ausländischer Fachkräfte abbauen, erklärte die Expertin für Migrationspolitik der Bertelsmann Stiftung, Susanne Schultz. Ein neues Einwanderungsrecht müsse jedoch auch konsequent umgesetzt werden, etwa in den Ausländerbehörden und Auslandsvertretungen. Dazu zählten Angebote zur Sprachförderung, Integrationshilfe vor Ort sowie eine engere Vernetzung von Unternehmen, Behörden und Zivilgesellschaft.
Für den Fachkräftemigrationsmonitor 2022 befragte das Meinungsforschungsinistitut Civey zwischen August und Oktober je nach Frage bis zu 7.500 Entscheider aus deutschen Unternehmen mit einer Größe von mindestens zehn Mitarbeitenden. Zudem wurden Zahlen zur Zu- und Abwanderung von Erwerbs- und Fachkräften aus dem Ausländerzentralregister für das Jahr 2021 analysiert, die auf der Personenstatistik der Ausländerbehörden basieren.
Berlin (epd). Mit einer eigenen Initiative will Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Sicht und die Sorgen der Jugend erreichen. Dafür rief sie am 8. Dezember in Berlin mit 130 Erstunterzeichnerinnen und -unterzeichnern einer „Gemeinsamen Erklärung“ das „Bündnis für die junge Generation“ ins Leben. Die Partner aus Wissenschaft, Kultur, Politik, Sport und Gesellschaft verpflichten sich, auf die Belange der jungen Generation aufmerksam zu machen und sie zu unterstützen. In Deutschland leben rund 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene.
Paus erinnerte an die Einschränkungen und Belastungen in der Pandemie. Kinder und Jugendliche hätten zurückgesteckt und große Solidarität mit den Älteren gezeigt. Die Gesellschaft sei ihnen aber bis heute darauf eine angemessene Antwort schuldig geblieben, vielmehr habe sie es versäumt, ihnen Halt zu geben: „Jetzt ist es an der Zeit, mit den jungen Menschen solidarisch zu sein“, sagte Paus.
Sie verwies auf eine aktuelle Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, wonach die Politik sicherstellen muss, dass Kinder und Jugendliche in der aktuellen Energiekrise nicht erneut und überwiegend die Lasten der Krisenbewältigung tragen müssen. So würden etwa Energieeinsparungen in Schwimmbädern, Turnhallen, Schulen oder an Universität Kinder und Jugendliche besonders treffen, hatte das Gremium erklärt.
Paus sagte, viele junge Menschen hätten eigentlich eine optimistische Grundhaltung. Aber heute machten sich 70 Prozent große Sorgen um ihre Zukunft, noch mehr als in der Hochphase der Pandemie. Hauptgründe seien die Klimakrise, die Inflation und die Folgen des Ukraine-Kriegs. Zwei Drittel hätten den Eindruck, dass sie von der Politik nicht gehört würden. Paus kündigte an, als Ministerin Kinderarmut konsequent bekämpfen und die junge Generation bei allen Entscheidungen mitreden lassen zu wollen, die sie betreffen.
In der gemeinsamen Erklärung verpflichten sich die Akteurinnen und Akteure, die Interessen junger Menschen in ihrer Arbeit zu berücksichtigen und sie an relevanten politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen zu beteiligen. Junge Menschen „haben die Krisen nicht verursacht, müssen aber in Gegenwart und Zukunft mit massiven Einschränkungen leben“, heißt es in dem Bündnis-Aufruf. Deshalb müssten sie mitreden und mitgestalten können.
Zu den Erstunterzeichnern gehören beispielsweise die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, Jutta Allmendinger, der Klimaforscher Ottmar Edenhofer oder die Kinderbuchautorin Kirsten Boie. Allmendinger sagte, man werde im kommenden Jahr Gesprächsformate mit Kindern und Jugendlichen am Wissenschaftszentrum etablieren, um ihre Sicht in Forschungsprojekte einzubeziehen.
Mit als erste haben auch Diakonie-Präsident Ulrich Lilie unterschrieben, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa, der Filmemacher Detlev Buck, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, und Fiete Aleksander von der „jung genug“-Redaktion, die Jugendliche im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung über Politik informiert.
Berlin (epd). Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sind in Deutschland nach Erkenntnissen des Deutschen Instituts für Menschenrechte in vielen Bereichen nicht immer gewahrt. Der am 7. Dezember präsentierte aktuelle Bericht des Instituts nimmt vor allem das Schulsystem in den Blick. Es benachteilige behinderte Kinder und Jugendliche, ein diskriminierungsfreier Zugang zu inklusiven Bildungsstätten werde vielen „de facto verwehrt“.
Das Menschenrechts-Institut verlangt, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen an allgemeinbildenden Schulen inklusiv beschult und Förderschulen schrittweise abgebaut werden. Denn Förderschulen würden meist ohne Schulabschluss verlassen. Das sei der „Beginn einer lebenslangen Exklusionskette“ mit wenig Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Für Eltern sei es jedoch weiterhin mangels Informationen extrem aufwändig, einen inklusiven Schulplatz zu organisieren. Immer wieder werde ihnen nahegelegt, eine Förderschule zu wählen. Die Förderschulen müssten aber „schrittweise abgebaut werden“, forderte Institutsdirektorin Beate Rudolf, das sei „gut für alle Kinder, mit und ohne Behinderungen“.
In vielen Bundesländern fehle der politische Wille, ein inklusives Schulsystem aufzubauen, sagte Rudolf. Die Kompetenzen des Bundes müssten ausgeweitet werden, andernfalls werde eine inklusive Bildung in ganz Deutschland nicht gelingen.
Auch für das Gesundheitswesen mahnte Direktorin Rudolf Verbesserungen für Menschen mit Behinderungen an. Sie kritisierte die kürzlich beschlossene Triage-Regelung. Die Formulierung, dass nur die kurzfristige Überlebenswahrscheinlichkeit darüber entscheiden dürfe, wer behandelt werde und wer nicht, sei ein „Einfallstor für unbewusste Diskriminierungen“ durch Gesundheitspersonal.
Auch die Klimaschutz-Maßnahmen in Deutschland nimmt das Institut in seinem Bericht zur Entwicklung der Menschenrechtslage in Deutschland kritisch unter die Lupe. Diese reichten nicht aus, um das 1,5-Grad-Zeil einzuhalten, kritisierte die Institutsdirektorin. Dadurch würden Freiheit und Menschenrechte künftiger Generationen eingeschränkt. Zudem werde zu wenig getan, um den Folgen der Erderwärmung zu begegnen, sagte sie. Der Katastrophenschutz zum Beispiel sei bislang zu wenig auf die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen eingestellt.
Rudolfs Stellvertreter Michael Windfuhr sagte, gemäß internationaler Rechtsprechung seien Straßenblockaden als Protestform nicht strafbar. Die strenge Präventivhaftregelung in Bayern, wo bis zu 60 Tage Haft möglich sind, sei daher unangemessen.
An den EU-Außengrenzen werden Rudolfs Worten zufolge Menschenrechte massiv verletzt, etwa an der polnisch-belarussischen Grenze. „Belarus lockt Schutzbedürftige an und schickt sie dann in Richtung EU-Außengrenze“, sagte Rudolf. Es sei dennoch nicht mit den Menschenrechten vereinbar, diese Menschen einfach wieder zurückzuschicken. Sie hätten einen Anspruch auf Prüfung ihres Asylanspruchs, „unabhängig davon, dass ein anderer Staat die Not der Menschen ausnutzt, um die EU unter Druck zu setzen“.
Das Institut ist die auf Empfehlung der Vereinten Nationen eingerichtete nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands. Es ist unter anderem dafür zuständig, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention zu überwachen.
Berlin (epd). Elf Sozialverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund fordern Bund und Länder auf, in diesem Winter Energiesperren für Privathaushalte zu verbieten. In einem am 7. Dezember in Berlin veröffentlichten Schreiben an das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten der Bundesländer erklären die Verbände, dies sei notwendig, um mindestens im kommenden halben Jahr Sicherheit für die Privathaushalte zu schaffen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Der Caritasverband wies darauf hin, dass viele Menschen auch mehr Beratung bräuchten.
Die Verbände, zu denen unter anderem der Sozialverband VdK, der Mieterbund, der Paritätische Gesamtverband, die Tafel Deutschland und der Sozialverband Deutschland gehören, fordern außerdem ein Kündigungsmoratorium für bestehende Mietverträge. Die angesichts der hohen Energiepreise beschlossenen Entlastungsmaßnahmen für die Bevölkerung seien begrüßenswert, schreiben die Verbände in einem Offenen Brief an das Kanzleramt und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten. Es könne aber sein, dass sie für viele Menschen, die sich am Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten befinden, nicht ausreichten oder zu spät kämen.
So sei etwa derzeit noch unklar, wie schnell das zum Jahresanfang 2023 erhöhte Wohngeld wirklich bei den Haushalten ankomme. Es bestünden auch noch Unklarheiten darüber, wie im Rahmen der Energiepreisbremsen mögliche Härtefallregelungen umgesetzt werden sollten. Deshalb sei es kurzfristig notwendig, die betroffenen Menschen vor Strom- und Gassperren oder einer Kündigung wegen Mietrückständen zu schützen. Den Offenen Brief haben auch der Kinderschutzbund, die Verbraucherzentralen und die Volkssolidarität unterschrieben.
Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) anlässlich der Initiative, es brauche zudem mehr Beratungsangebote, die Menschen aus der Schockstarre befreien, die sie befällt, wenn sie Worte wie „Energiesperre“ oder auch „Gaspreisbremse“ hören. „Nicht alles, was politisch gut gemeint ist, um die Energiekrise zu bewältigen, wird auch gut verstanden“, sagte Welskop-Deffaa. Schon jetzt fragten in den Caritas-Beratungsstellen doppelt so viele Menschen mit Energieschulden an wie im Jahr 2019.
Der Caritasverband bietet bundesweit gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands kostenlose Checks für den Strom-, Energie- und Wasserverbrauch in einkommensarmen Haushalten an. Das von dem katholischen Sozialverband initiierte Projekt wird inzwischen vom Klimaschutzministerium gefördert.
Berlin (epd). Der Bund will die Länder auch weiterhin bei der Verbesserung der Kindertagesbetreuung unterstützen. Der Bundestag beschloss am 2. Dezember in Berlin das Kita-Qualitätsgesetz. Die Bundesländer sollen in den kommenden beiden Jahren knapp vier Milliarden Euro erhalten.
Sogenannte Sprach-Kitas werden noch bis Mitte 2023 durch den Bund finanziert. Das Bundes-Modellprogramm zur Förderung von Kindern, die nicht gut Deutsch sprechen, läuft eigentlich zum Ende des Jahres aus. Das hatte für Protest seitens der Länder und von Eltern sowie Trägern von Kindertagesstätten gesorgt.
Mit dem Kita-Qualitätsgesetz wird das sogenannte Gute-Kita-Gesetz der Vorgängerregierung weiterentwickelt. Im Unterschied zu den vergangenen Jahren dürfen die Länder aber künftig keine Bundesmittel mehr in neue Maßnahmen zur Beitragsentlastung für die Eltern stecken. Bis 2025 will die Ampel-Koalition bundesweit einheitliche Standards für die Qualität der Kinderbetreuung entwickeln, die dann das Kita-Qualitätsgesetz ablösen sollen.
Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sagte in der abschließenden Debatte, jahrelang seien die Betreuungsplätze massiv ausgebaut worden. Inzwischen würden 3,4 Millionen Kinder vor ihrer Einschulung in einer Kita oder bei Tageseltern betreut. Deshalb werde jetzt in die Qualität investiert. Es gehe um die Chancengerechtigkeit für jedes Kind, betonte Paus. An keinem anderen Ort jenseits der Familie lernten kleine Kinder so viel wie in der Kita.
Die Sprachförderung für Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, soll dem Gesetz zufolge weiterhin zu den wichtigsten Qualitätskriterien gehören. Sie muss aber nach dem Auslaufen des Bundesprogramms ab Mitte 2023 von den Bundesländern fortgeführt und finanziert werden. Die Länder können das Geld des Bundes unter anderem für die Gewinnung zusätzlicher Fachkräfte, für Tagesmütter- und -väter sowie für gesundes Kita-Essen, Gesundheitsvorsorge und für Bewegungsangebote einsetzen. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen.
Der Bund hat elf Jahre lang mit Modellprogrammen die Sprachförderung bei Kindergartenkindern unterstützt. Nach Angaben des Familienministeriums wurden 7.500 Halbtagsstellen für zusätzliche Sprach-Fachkräfte in 6.900 Kitas finanziert, womit rund eine halbe Million Kinder erreicht worden seien.
Bochum (epd). Mehr als 30.000 ukrainische Staatsbürger arbeiten derzeit in einem Minijob in Deutschland. Rund drei Viertel der Beschäftigten sind Frauen, wie die Minijob-Zentrale in Bochum am 6. Dezember mitteilte. Insgesamt arbeiteten Ende September 2022 rund 6,76 Millionen Menschen in Deutschland in einem Minijob - das waren 0,3 Prozent mehr als Ende Juni dieses Jahres.
Sowohl im gewerblichen Bereich als auch in Privathaushalten sind den Angaben zufolge deutschlandweit die meisten Menschen im Minijob in Nordrhein-Westfalen (1,52 Millionen) gemeldet. Im Anschluss folgten die Länder Bayern und Baden-Württemberg (1,19 beziehungsweise 1,02 Millionen).
Der Quartalsbericht für Ende September weist einen Anstieg der Zahl der Menschen, die einen Minijob im gewerblichen Bereich ausüben, auf knapp 6,5 Millionen aus. In diesem Bereich ist die Zahl im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 um 0,5 Prozent gestiegen.
Die Entwicklung bei der Zahl der Minijobber in Privathaushalten ist dagegen leicht rückläufig: Zum 30. September waren rund fast 266.000 geringfügig entlohnte Beschäftigte bei der Minijob-Zentrale gemeldet. Das entsprach einem Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal.

Magdeburg/Halle (epd). Zwei Krankenhäuser, Pflegeheime, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen und vieles mehr - das Gelände der Pfeifferschen Stiftungen im Magdeburger Stadtteil Cracau ist weitläufig. Hier stehen neben modernen Häusern auch denkmalgeschützte Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. Diese wurden zwar in den 1990er Jahren grundsaniert, erreichen aber energetisch nicht die Werte eines Neubaus. Das wird in Zeiten der Energiekrise mit rasant steigenden Kosten immer mehr zum Problem.
Veit Osterburg ist technischer Leiter und damit auch Energiemanager der Pfeifferschen Stiftungen, einem großen diakonischen Betrieb. Dass Energiesparen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen ein sensibles Thema ist, weiß er. Denn in Krankenhäusern wie auch in Wohnheimen für Senioren oder Menschen mit Behinderungen lässt sich die Raumtemperatur nicht beliebig herunterregeln. Auch Mindesttemperaturen für warmes Wasser sind in diesen Einrichtungen unverzichtbar.
Deshalb haben die Stiftungen an diesen Stellen bislang nur wenige Anpassungen vornehmen können, sagte Osterburg dem Evangelischen Pressedienst (epd). Stattdessen setzt der Energiemanager darauf, unabhängiger vom Gas zu werden und an anderen Stellen Energie zu sparen. Der Sparkurs ist dringend notwendig: Die Kosten für Strom und Wärme werden sich auch für die Pfeifferschen Stiftungen ab dem kommenden Jahr vervielfachen und voraussichtlich langfristig auf hohem Niveau bleiben.
Neben mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern setzt der Betreiber auf viele kleine Maßnahmen, die in der Summe deutliche Einsparwirkungen erzielen sollen. Beispielsweise wird bei der Sterilisation von medizinischem Gerät das sogenannte Power-to-Heat-Verfahren angewandt, bei dem elektrischer Strom aus regenerativen Quellen für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Bislang erfolgt das noch mittels Gas, erläutert Osterburg. Auch die Nutzung alternativer Quellen zum Heizen, etwa Wärmepumpen, soll geprüft werden.
Vor ähnlichen Problemen steht die Caritas im katholischen Bistum Magdeburg. Die Trägergesellschaft St. Mauritius (ctm) unterhält in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg 28 Einrichtungen der Alten-, Behinderten- und Erziehungshilfe mit rund 90 Betriebsstätten. „In unseren Einrichtungen wollen wir aktuell keine Maßnahmen durchführen, die die Lebensqualität der uns Anvertrauten einschränken“, sagt ctm-Sprecherin Bernadette Olma: „Alle sollen sich weiterhin in unseren Häusern sicher und gut aufgehoben fühlen.“ So gibt es für die Einrichtungen nur Energiespartipps, die als Handlungsempfehlungen dienen sollen - etwa, Heizungsanlagen nachts abzusenken und die Warmwasserzirkulation zeitlich zu begrenzen.
Das katholische Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle spart nicht am Warmwasser und der Raumtemperatur im Patientenbereich. Lediglich in den Büros der Verwaltung müssen die Mitarbeiter öfter mal die Jacke anlassen. Kliniksprecher Jan-Stephan Schweda sagt, außerdem setze man auf Solarstrom, eine optimierte Belüftung sowie LED-Beleuchtung zur Energieeinsparung.
In den Pfeifferschen Stiftungen denkt Energiemanager Osterburg noch weiter, will die alten Gebäude dort, wo der Denkmalschutz es zulässt, noch besser dämmen. Doch das dafür notwendige Geld geht jetzt größtenteils für die gestiegenen Energiekosten drauf. Deshalb wünscht er sich mehr Hilfe vom Land und aus der Politik: „Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sind durch Corona, fehlende Pflegekräfte und jetzt die Energiekrise mehrfach stark getroffen“, sagt Osterburg. Seitens der Politik fehle es den Kliniken aber nach wie vor an klaren Informationen, mit welchen Maßnahmen sie in den kommenden Jahren zielgerichtet unterstützt werden können, sagt Osterburg.

Nürnberg/München (epd). „Etwas Warmes braucht der Mensch“, das Motto aus einer alten Werbekampagne passt sehr gut als Klammer für die vielen Projekte, die in evangelischen Gemeinden derzeit ausgetüftelt werden oder schon angelaufen sind. Ihr gemeinsames Ziel: Menschen zu unterstützen, die wegen der hohen Inflation nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. In Bamberg heißt ein Projekt im Januar und Februar 2023 sogar „Suppenkirche - ein Teller Wärme“. Wochentags soll es wechselnd in fünf verschiedenen Gemeinden für alle einen Teller Suppe mit Brot an einem gemeinsamen Tisch geben, ist die Idee.
Essensausgaben und Wärmestuben einzurichten, beheizte Kirchen oder kirchliche Häuser nach dem Gottesdienst oder zu anderen Zeiten offenzuhalten, Beratungsangebote zu schaffen, bei denen Menschen in Notlagen Informationen zu staatlichen Hilfen erhalten - das war der Gedanke, der hinter dem im Oktober von Diakonie und Evangelischer Kirche in Deutschland (EKD) ausgerufenen #wärmewinter steckt.
Er soll die Antwort sein auf die Überschrift „Wutwinter“, mit der im Herbst manche Gruppen zum Protest gegen die Regierung aufgerufen hatten. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft stehe vor einer neuen Bewährungsprobe, sagten Diakoniepräsident Ulrich Lilie und die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus. Politischen Radikalisierungen und spaltenden Tendenzen wolle man entgegentreten.
An besserverdienende Bürgerinnen und Bürger hat die Stadtmission in Nürnberg appelliert, ihre Energiepreispauschalen an dringend Bedürftige weiterzugeben. Die Energiepreisbremsen des Staates würden jetzt pauschal und kurzfristig alle Bürgerinnen und Bürger entlasten, heißt es in dem Aufruf: „Den ständigen Existenzkampf für Menschen am untersten Einkommensende beenden sie nicht“.
Mieten, Lebensmittel, Strom- und Heizkosten würden permanent teurer. Darauf könne keine Sozialbehörde schnell genug reagieren, erklärt Christine Mürau von der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) der Stadtmission. „Unsere Klientel hat große Angst, ihr Lebensnotwendiges nicht mehr bezahlen zu können“, sagt sie.
Eine Solidaritätsaktion gibt es auch im Dekanat Erlangen, denn dort stehen über 4.000 Menschen jede Woche bei der Tafel an, um Gemüse, Brot und Milchprodukte oder haltbare Lebensmittel zu erhalten. „Viele Menschen treibt die Frage um, was die kommenden Monate angesichts des Krieges in der Ukraine und der gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten bringen werden“, heißt es in einem Aufruf von Dekanat und Tafel.
Von Armut betroffene Menschen würden immer häufiger vor der Frage stehen: „Gebe ich das vorhandene Geld für Essen aus oder heize ich meine Wohnung?“ Deswegen sind nun Gemeindemitglieder aufgefordert, haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Fisch- und Gemüsekonserven, Mehl oder Nudeln in Kirchen zu bringen.
Auch im unterfränkischen Lohr sammelt die Kirchengemeinde Spenden für bedürftige Menschen. Die Gemeinde der Fürther Kirche St. Paul hat vorsorglich einen Notfonds für Bedürftige eingerichtet, weil sie erwartet, dass vermehrt Menschen beim Pfarramt klingeln und um Unterstützung bitten. Die Gemeinde der Reformations-Gedächtnis-Kirche im Münchner Westen kooperiert mit der Bahnhofsmission. Mit Spendengeldern sollen Schlafsäcke, Isomatten, Socken, Handschuhe und noch mehr wärmendes für Obdachlose gekauft werden.
Eine warme Mahlzeit, ein heißes Getränk und ein gemütlicher Platz zum Reden sollen zweimal in der Woche Menschen in Amberg bekommen, denen ein kaltes Wohnzimmer und menschliche Einsamkeit drohen, erklärt Pfarrer David Scherf. Der Gemeindesaal der Erlöserkirche bleibt gut geheizt für die Aktion „WARMumsHERZ“ der Kirchengemeinde zusammen mit dem Verein Zamhaltn. „Die Menschen müssen nicht allein bleiben“, sagt Scherf. Auch die Himmelfahrtskirche in München-Sendling bietet bis Ende März ein Wintercafé an. Jeweils donnerstags gibt es Kaffee, Tee, Kuchen, Zeitschriften und Musik im Hintergrund. Ein ökumenisches und interkulturelles Projekt stellen zwei Gemeinden im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer unter dem Motto „Gleißhammer isst was“ auf die Beine.
Auch im Nürnberger Süden kann nach zwei Jahren Pause im Januar wieder die große Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche öffnen, in der sich in den Vorjahren sechs Wochen lang täglich etwa 400 Menschen bunt gemischt zum Mittagsmahl trafen.
In der Stadtkirche in Kitzingen gibt es im Dezember und Januar Adventskaffee, einen Spielenachmittag und eine gemütliche Einstimmung vor der Christvesper, teilt Dekanin Kerstin Baderschneider mit. Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA) werde sich mit Beratungsangeboten an kommunale Initiativen wie einen Mittagstisch andocken. Das Diakonische Werk Ansbach plant in der Stadt für Menschen ohne Obdach, aber auch einsame Menschen ein erweitertes Wärmestubenangebot. Die Diakonie Hochfranken öffnet das Café im Mehrgenerationenhaus in Hof. Hier haben Menschen die Möglichkeit, sich aufzuwärmen, wenn sie wegen der steigenden Energiepreise ihre Wohnung nicht mehr richtig heizen. Über eine solche „Wärmeinsel“ denkt auch die Gemeinde St. Anna in Augsburg nach.
Nicht frieren sollen auch die Studierenden der Evangelischen Hochschule (EVHN) in Nürnberg. Bibliothek und Cafeteria bleiben geheizt, hat das Kuratorium entschieden und damit eine Ausnahme zu einem Beschluss der Landeskirche genehmigt. Gerade nach den Corona-bedingten Online-Semestern sei gemeinsames Leben an der Hochschule besonders wichtig. Dafür schaffe die EVHN „warme Rahmenbedingungen“, sagt der Präsident der Hochschule, Thomas Popp.

München (epd). Ab 1. Januar verdreifacht sich der Gaspreis bei den Stadtwerken München im Vergleich zum Jahr 2021. Mit einer Beratungshotline im Auftrag der Stadt ab Januar 2023 hilft die Diakonie München Menschen, die ihre Energiekosten nicht mehr stemmen können. Zudem richtet sie ein Spendenkonto für jene ein, die ihre Energiepauschale gern weitergeben möchten. Mit der Diakonie-Vorständin Andrea Betz sprach Susanne Schröder.
epd sozial: Frau Betz, bei welchen Fragen hilft die Energieberatungshotline?
Andrea Betz: Es wird vor allem um Nachzahlungsbescheide, Ratenzahlungen, Anträge auf Hilfen gehen. Die Stadt München hat einen Wärmefonds mit 20 Millionen Euro aufgelegt. Eine Förderung muss man aktiv beantragen, sonst kriegt man nichts. Gerade ältere Menschen tun sich schwer: Strompreisbremse, Bürgergeld, Entlastungspaket - was heißt das alles? Wir wissen aus Erfahrung, dass Scham und Nichtwissen oft dazu führen, dass Menschen nicht die Hilfe beanspruchen, die ihnen zusteht. Wir appellieren deshalb an alle: Kommt zu den Beratungsstellen, egal zu welchen.
epd: Auch Lebensmittel kosten viel mehr: Wie macht sich das in den Einrichtungen der Diakonie bemerkbar?
Betz: Besonders merken wir, dass mehr alleinstehende Seniorinnen und mehr Familien kommen. Sie haben bislang keine staatlichen Hilfen beansprucht, aber jetzt packen sie es finanziell nicht mehr. Die Lebenshaltungskosten sind viel höher, das spüren wir an den Kleiderausgaben und den Mittagstischen - für gestiegene Energiekosten ist keine Reserve mehr da. Wir finden es sozial nicht gerecht, dass die Energiepauschale an alle fließen soll. Es wäre besser gewesen, höhere Beträge an die zu geben, die es dringend brauchen. Das denken offenbar viele Menschen. Sie melden sich bei uns, weil sie ihre Pauschale spenden wollen. Dafür haben wir jetzt ein Spendenkonto eingerichtet.
epd: Landeskirche und Diakonie haben Gemeinden aufgerufen, ihre Zentren zu öffnen, damit niemand frieren muss. Worauf sollte man dabei achten?
Betz: Der Grundgedanke dieser solidarischen Aktion ist sehr schön. Wir machen auch mit. Scham ist immer ein Thema, deshalb muss so ein Angebot niedrigschwellig sein. Man sollte nicht klingeln und weder Namen noch Gründe nennen müssen. Es ist wichtig, dass Haupt- oder Ehrenamtliche vor Ort sind, aber sehr zurückhaltend. Es gibt Menschen, die einfach nur sitzen wollen, um sich zu wärmen und um nicht allein zu sein. Wer es möchte, sollte beraten und unterstützt werden, um über den Monat zu kommen. Wir müssen dafür sorgen, dass niemandem der Strom oder die Heizung abgedreht wird.

Nürnberg (epd). Das Motto „Ökologisch denken, sozial handeln, Zusammenhalt nachhaltig stärken“ ist bereits am ersten Tag der Nürnberger Messe ConSozial für die Sozialwirtschaft ausgiebig beleuchtet worden. „Die Verbindung von Ökologie und Sozialem ist die Fortschrittsagenda des 21. Jahrhunderts“, sagte zum Auftakt die Berliner Gesellschaftswissenschaftlerin Maja Göpel. Angesichts der vielfältigen Probleme bei Fachkräften, Energiekosten und Inflation dürfe man nicht nur für einzelne Details nach Lösungen suchen. „Wir müssen mehr auf die Netzwerke blicken.“
Aus Sicht der Professorin ist der anhaltende Pflegenotstand ein „Ausdruck des Nicht-Sehen-Wollens“. Die Gesellschaft habe zwar der Sozialbranche mit ihren systemrelevanten Jobs applaudiert. Unterm Strich erlebten die Beschäftigten in den Sozialberufen aber ganz generell „zu wenig Wertschätzung“. Motivation und Berufung für aufreibende Aufgaben hielten nur begrenzt an. Hier zog die Bestsellerautorin eine Parallele zur Natur. Das ökologische System gerate ebenfalls aus dem Gleichgewicht, „wenn es überhitzt wird“. Die Lehre: „Wir brauchen ein Netzwerk des Miteinanderlebens und müssen uns als Teil des Systems begreifen.“
Die Wohlfahrtspflege in Deutschland wolle ein Hebel für mehr Nachhaltigkeit sein, betonte der Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Ulrich Lilie. „Wir haben zwei Millionen hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese wichtigen Schritte gehen wollen“, sagte Lilie, der auch Präsident der Diakonie Deutschland ist, bei einer Pressekonferenz. Alle Krankenhäuser in Deutschland zusammen hätten den gleichen ökologischen Fußabdruck wie Flugverkehr und Bahnverkehr in Deutschland zusammen, erläuterte er. Viele der Kliniken könnten einen Großteil ihrer Energie selbst erzeugen, aber „wir müssen endlich ins Tun kommen“.
Einem Sozialunternehmen, das nachts die nicht genutzte Energie aus seinem eigenen Blockheizkraftwerk ins öffentliche Netz einspeiste, sollte vom Finanzamt die Gemeinnützigkeit aberkannt werden, weil es auf Gewinn ausgerichtet sei, berichtet Lilie von einem Fall. An dem Beispiel werde deutlich, dass es für nachhaltiges Denken noch keine „gemeinsame Logik gebe“. Er kritisierte eine „Projekteritis“ statt einer zusammenhängenden und vor allem langfristigen Förderung für klimaneutrale Sozialunternehmen. Das Thema Nachhaltigkeit müsse auch in den Sozialgesetzbüchern verankert werden, so der Diakoniechef.
Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) sagte, sie erlebe bei den Beschäftigten in der Sozialwirtschaft ein „hohes Interesse“, Nachhaltigkeit zu fördern. Sie räumte ein, dass die Rahmenbedingungen das manchmal schwer machten. In dem Motto der diesjährigen ConSozial „Ökologisch denken, sozial handeln, Zusammenhalt nachhaltig stärken“ verdichteten sich die Herausforderungen, vor denen die Branche stehe, so Scharf.
Die Mitveranstalterin der ConSozial berichtete, dass mit einem ersten Förderprogramm die Evangelische Hochschule Nürnberg zum klimaneutralen Sozialunternehmen werden soll. Einen wichtigen Beitrag könnten auch die über 110.000 Beschäftigten in bayerischen Kitas leisten. „Umweltbildung von Kindern ist wichtig.“ Insgesamt hat die Sozialwirtschaft in Bayern rund 450.000 Mitarbeiter.
Die Ministerin wiederholte ihre Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten in den Pflegeberufen. Der Gesundheitsschutz müsse dabei zwingend im Zentrum stehen, sagte sie. Aber: „Wir müssen offen über eine längere Arbeitszeit an einzelnen Tagen von bis zu zwölf Stunden und eine Wochenarbeitszeit von 48 Stunden diskutieren - flexibel und auf freiwilliger Basis der Beschäftigten.“
Nicole Schley und Stefan Wolfshörndl, die Landesvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Bayern, gingen umgehend auf Distanz: „Das wäre nicht nur ein Schritt, sondern ein Spurt nach hinten. Was wir brauchen, sind vorwärts gerichtete, mutige Maßnahmen, die nicht zuletzt das Wohl der Arbeitnehmer im Fokus haben. Dazu zählt die 35 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, gute Arbeitsbedingungen und mehr Personal, aber keine endlosen Schichten, die zum Hamsterrad für die Fachkräfte werden.“
Die ConSozial gilt als wichtigste Messe für Fach- und Führungskräfte der Sozialpolitik, der Sozialwirtschaft und des Sozialwesens im deutschsprachigen Raum. An zwei Tagen informieren sich rund 5.000 Besucherinnen und Besucher über neue Entwicklungen. Parallel findet der KITA-Kongress für Fach- und Führungskräfte von Kitas statt.

Köln (epd). Für einen Beitrag in der Publikation „Trendinfo“ der Bank für Sozialwirtschaft (BFS) hat Stefan Arend die Daten des Statistischen Bundesamtes ausgewertet, die Mitte Juli veröffentlicht wurden und die auf der Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung fußen. Danach sind die Azubi-Zahlen fast überall gewachsen. Was jedoch weiter nicht vorankommt, ist die Akademisierung in der Pflege.
Bei allen positiven Zahlen und Entwicklungen stimmen laut Arend einige Werte aus der neuen offiziellen Statistik nachdenklich. So sind die Ausbildungszahlen in einigen Bundesländern - gegen den positiven Bundestrend - zum Teil deutlich zurückgegangen: in Sachsen-Anhalt, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Bremen und vor allem auch in Bayern
Der Statistik zufolge haben im Jahr 2021 56.259 Auszubildende eine Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann begonnen (Stichtag: 31. Dezember). Damit wurden fünf Prozent mehr Ausbildungen begonnen als 2020. Damals hatten sich 53.610 Auszubildende für diesen Beruf entschieden.
Insgesamt waren nach Angaben von Destatis Ende 2021 rund 102.900 Personen im ersten und zweiten Ausbildungsjahr in Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann. Rechnet man die Auszubildenden hinzu, die sich noch nach den alten Ausbildungsregeln im dritten Schuljahr befinden, so waren schätzungsweise rund 152.000 bis 153.000 Personen in einer Ausbildung zur dreijährig-examinierten Pflegefachkraft.
Wenig überraschend: die generalistische Ausbildung wird, ebenso wie die Vorläuferausbildungen, vor allem von Frauen gewählt: 76 Prozent (42.546) der Auszubildenden mit neuem Ausbildungsvertrag waren weiblich. Im Vorjahr hatte der Frauenanteil ebenfalls bei 76 Prozent gelegen (40.602).
Wie Arend weiter schriebt, wurde der deutlich überwiegende Teil der neuen Ausbildungsplätze in Krankenhäusern angeboten: 28.923 (51 Prozent). In den stationären Pflegeeinrichtungen gab es 18.240 (32 Prozent) und in den ambulanten Pflegeeinrichtungen 6.459 (zwölf Prozent) neue Ausbildungsplätze. Bei fünf Prozent (2.640) der abgeschlossenen Ausbildungsverträge fehlte die Angabe des Ortes der praktischen Ausbildung.
Eine besondere Bedeutung hat, wie bei allen Ausbildungen, die Abbrecherquote. Sie ist im 1. Ausbildungsjahr in den einzelnen Bundesländern recht unterschiedlich ausgeprägt und reicht von 4,36 Prozent in Brandenburg bis zu 14,56 Prozent in Hamburg.
Das primärqualifizierende Pflegestudium kommt anders als die neue Ausbildung nicht voran. Dazu hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) eine erste Sondererhebung seines Pflegepanels im Mai 2022 veröffentlicht. Demnach schrieben sich bundesweit bei den 27 Hochschulen, die ein primärqualifizierendes Studium anbieten, im Wintersemester 2021/2022 lediglich 488 Studierende ein. Damit blieben 56 Prozent der angebotenen 1.109 Studienplätze unbesetzt. Damit ist auch die Akademisierungsquote in der Pflege sehr gering.

Mainz (epd). Der Mainzer Obdachlosenarzt und Kandidat bei der vergangenen Bundespräsidentenwahl, Gerhard Trabert, registriert zunehmend eine aggressive Haltung gegenüber Wohnungslosen. Bei seinen Kontakten zu wohnungslosen Patienten höre er immer häufiger von gewalttätigen Übergriffen, sagte der Mediziner dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Bundesweit gebe es zudem in Großstädten Versuche, Wohnungslose aus dem Stadtbild zu verdrängen, rügte der Arzt. Eine solche Politik bezeichnete Trabert als „strukturelle Gewalt“: „Der öffentliche Raum gehört jedem - auch Wohnungslosen.“
Statt das zu akzeptieren, würden Plätze so umgebaut, dass sie für Wohnungslose unattraktiv werden - etwa durch Sitzbänke, deren Form ein Hinlegen unmöglich macht. Beispielhaft für diesen Trend sei auch der Bau eines Metallzauns vor der Mainzer Stadtbibliothek, unter deren überdachtem Vorbau sich früher oft obdachlose Menschen aufhielten.
Die absolute Mehrzahl wohnungsloser Menschen stelle für niemanden eine Bedrohung dar, sagte der Gründer des Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“, der in Mainz und Umgebung seit vielen Jahren wohnungslose Patienten betreut. Wenn es Probleme mit einzelnen Personen gebe, müssten die im Dialog mit Hilfsorganisationen oder Sozialarbeitern gelöst werden.
Bei seinen Kontakten zu wohnungslosen Patienten höre er in jüngster Zeit vermehrt, dass Obdachlose mit Steinen beworfen oder beschimpft würden, berichtete Trabert. Teilweise würden dabei rechte Parolen gerufen. Auch gebe es zunehmend Klagen darüber, dass Täter nachts auf Menschen urinierten, die im Freien schlafen.
„Manche steigen schon nicht mehr in ihre Schlafsäcke, sondern decken sich damit nur noch zu, um schnell fliehen oder sich wehren zu können“, sagte Trabert. In Mainz habe sein Verein in diesem Jahr auch schon zwei wohnungslose Frauen betreut, die Opfer von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt geworden seien. Grundsätzlich herrsche in Deutschland ein Mangel an sicheren Übernachtungsplätzen für wohnungslose Frauen.
In den meisten Fällen scheuten sich obdachlose Opfer von Überfällen davor, zur Polizei zu gehen, bedauerte Trabert. „Dabei würde ich Mut machen, so etwas zur Anzeige zu bringen.“ In Mainz gehe die Kriminalpolizei bei Straftaten gegen Wohnungslose beispielsweise stets gründlich und wertschätzend vor. Das Gleiche gelte, wenn Menschen ohne festen Wohnsitz aus ungeklärter Ursache versterben: „Da wird nie gesagt: Das ist ja nur ein Penner.“
Berlin, Freiburg (epd). Der Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD) und der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) rufen die Ampelregierung auf, die stationäre Pflege umgehend zu reformieren. Die Umsetzung der Vorhaben im Koalitionsvertrag müsse zügig erfolgen. „Die Langzeitpflege braucht eine tragfähige Strategie“, heißt es in einer Mitteilung vom 7. Dezember.
Eva-Maria Güthoff, Vorstandsvorsitzende des VKAD, kritisierte, es fehlten „nach wie vor ernstzunehmende Maßnahmen, um die Langzeitpflege zu entlasten. Die Politik muss ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag jetzt in die Tat umsetzen“. Die Situation in der Langezeitpflege sei mittlerweile dramatisch.
Nach ihren Angaben decken die Kapazitäten in der ambulanten und stationären Langzeitpflege nicht mehr den tatsächlichen Pflegebedarf: ambulante Touren werden abgesagt und in stationären Einrichtungen Betten nicht mehr belegt. Grund sei trotz steigernder Ausbildungszahlen der Personalmangel.
„Bestimmte Stellschrauben, wie sie der Koalitionsvertrag vorsieht, können Pflegebedürftige und Angehörige schon jetzt entlasten und sollten zeitnah umgesetzt werden“, sagte Wilfried Wesemann, Vorstandsvorsitzender des DEVAP. „Die Behandlungspflege muss auch in der stationären Pflege von den Krankenkassen übernommen werden und die pandemiebedingten Zusatzkosten vollständig aus Steuermitteln finanziert werden, damit die Pflegeversicherung endlich wieder hinreichend liquide ist.“
Wesemann warb erneut für Schritte gegen die steigenden Eigenanteile, die Pflegebedürftige in heimen selbst zahlen müssen. „Wir dürfen die Pflegebedürftigen mit dieser Last nicht allein lassen. Langfristig hilft nur eine gesetzliche Begrenzung der Eigenanteile, die die Kosten für Pflegebedürftige kalkulierbar macht.“ Hierzu fordern die beiden Verbände, die Ausbildungskostenumlage wie geplant noch in dieser Legislatur aus den Eigenanteilen herauszunehmen.
„Neben den kleineren Maßnahmen muss die Politik eine langfristige Reformstrategie verfolgen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, im nächsten Jahr die Finanzierung der Pflegeversicherung anzugehen. Aus unserer Sicht sollte das Thema besser gestern als morgen auf der Agenda des Gesundheitsministers stehen. Dazu ist die Lage zu ernst“, so Güthoff.
Berlin (epd). Der Paritätische Gesamtverband kritisiert in seinem jährlichen Bericht zur gesellschaftlichen Teilhabe die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung auf dem Wohnungsmarkt. Die Untersuchung zeige, dass „Barrierefreiheit auf dem deutschen Wohnungsmarkt leider die Ausnahme ist“, sagte der Verbandsvorsitzende, Rolf Rosenbrock am 2. Dezember in Berlin.
Jeder fünfte Mensch mit Behinderung muss den Angaben nach mehr als die Hälfte seines Einkommens für Wohnkosten ausgeben, so der Verband. Bei Menschen ohne Behinderung sei es nur in etwa jeder Zehnte. So träfe die ohnehin angespannte Lage auf dem Mietmarkt behinderte Menschen besonders stark. Rosenbrock zählt sie deshalb zu den „großen Verlierern auf dem Wohnungsmarkt“.
Bezüglich der Barrierefreiheit gab der Verband an, dass von vier Menschen mit anerkannter Behinderung derzeit nur einer in einer barrierefreien Wohnung lebe. Eine Wohnung ganz ohne Stufen und Treppen sei extrem schwer zu finden: „Nur jeder Fünfte hat das Glück.“
Der Paritätische Gesamtverband kritisierte die von der Bundesregierung beschlossene Initiative zur Barrierefreiheit als unzureichend. „Mindestens jede dritte Wohnung, die jetzt neu gebaut wird, muss barrierefrei sein“, forderte Rosenbrock. Er plädierte dafür, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, unabhängig davon, ob ein Mensch eine Behinderung habe oder nicht.
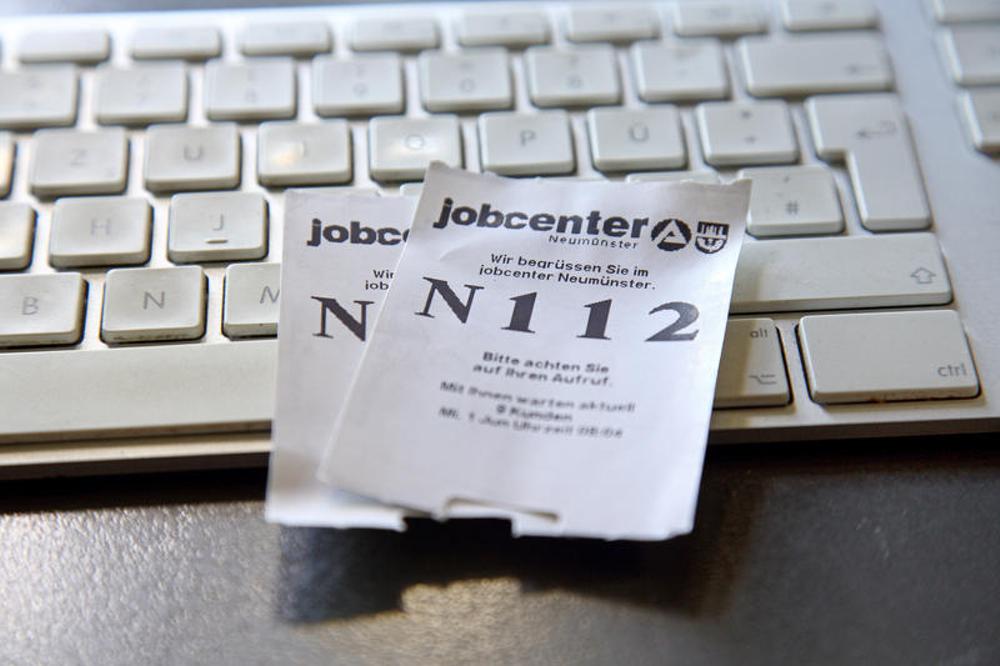
Kassel (epd). Selbstständige Hartz-IV-Aufstocker können auch bei einer verpassten Jobcenter-Frist zum Einreichen von Unterlagen über die Betriebseinnahmen und -ausgaben ihren Arbeitslosengeld-II-Anspruch noch sichern. Reichen sie die Papiere erst verspätet mit einer Klage vor Gericht nach, darf die Hilfeleistung nicht versagt und das bislang vorläufig gezahlte Arbeitslosengeld II nicht zurückgefordert werden, urteilte am 29. November das Bundessozialgericht (BSG). In zwei weiteren Urteilen klärten die Kasseler Richter die Anforderungen an eine Rechtsfolgenbelehrung bei vorzeitiger Beendigung einer Berufsfördermaßnahme sowie einen Erstattungsanspruch des Jobcenters, wenn dem Hartz-IV-Bezieher innerhalb eines Monats auch für einige Tage Arbeitslosengeld I bewilligt wurde.
Im ersten Verfahren ging es um eine selbstständige Grafikdesignerin aus Hamburg, die vom 1. April bis 30. Juni 2017 zur Deckung ihres Lebensunterhalts auf aufstockende Hartz-IV-Leistungen angewiesen war.
Üblicherweise erhalten selbstständige Hartz-IV-Aufstocker wegen unregelmäßiger Einkünfte zunächst nur vorläufig Arbeitslosengeld II. Beim Jobcenter müssen sie eine Prognose über ihre betrieblichen Einnahmen abgeben. Legen sie später dann die tatsächlichen Betriebseinnahmen und -ausgaben vor, kann die Behörde einen abschließenden Arbeitslosengeld-II-Bescheid erstellen. Liegen bei dem Selbstständigen zu hohe Einnahmen vor, muss er zu viel erhaltenes Arbeitslosengeld II zurückzahlen.
Um das Arbeitslosengeld II bei der Frau abschließend bestimmen zu können, forderte das Jobcenter die Vorlage von Nachweisen über die Betriebseinnahmen und -ausgaben. Meist gewährt die Behörde hierfür eine Frist von zwei Monaten.
Doch die Grafikdesignerin kam dem zunächst nicht nach. Das Jobcenter setzte wegen der verpassten Frist daraufhin per Bescheid den Arbeitslosengeld-II-Anspruch auf null fest, um so später die bereits gewährte Zahlung zurückfordern zu können. Erst im Klageverfahren legte die Frau vor Gericht die Nachweise über ihre Betriebseinnahmen und -ausgaben vor. Danach hatte sie nur im Monat April 570 Euro verdient.
Das Jobcenter hielt das für zu spät. Die Frau habe mit der versäumten Frist ihre Mitwirkungspflicht verletzt, so dass sie keinen Anspruch auf die Hilfeleistung habe, so die Argumentation. Es sei zu spät, wenn die geforderten Unterlagen erst im Klageverfahren eingereicht werden, meinte die Behörde. Nach dem Gesetz dürfe sie bei zu spät eingereichten Unterlagen die Hilfeleistung gänzlich versagen. Allein in Hamburg sind nach Angaben des Jobcenters etwa 300 vergleichbare Klagen wegen Fristversäumnissen anhängig.
Das Landessozialgericht Hamburg urteilte, dass der Frau Arbeitslosengeld II in Höhe von monatlich 637 Euro zustehe. Auch das BSG gab der Frau recht. Zwar müsse eine Verwaltung abschließend über einen Arbeitslosengeld-II-Anspruch entscheiden können. Hierfür dürfe die Behörde auch Fristen setzen. Allerdings lege hier die maßgebliche gesetzliche Bestimmung für den Anspruch auf Arbeitslosengeld II nicht eindeutig fest, dass verspätet eingereichte Belege einen gänzlichen Verlust der Hilfeleistung zur Folge haben können. Über die Folgen verpasster Fristen müsse aber „Rechtsklarheit“ herrschen. Der Klägerin dürfe daher wegen der erst im Klageverfahren nachgereichten Unterlagen nicht die Leistung versagt werden. Der Gesetzgeber hat auch beim kommenden „Bürgergeld“ die vom BSG beanstandete unklare Formulierung in den Vorschriften übernommen.
In einem weiteren Verfahren mahnten die obersten Sozialrichter eine konkrete Rechtsfolgenbelehrung an, wenn Arbeitslose die Teilnahmevereinbarung für eine von der Bundesagentur für Arbeit veranlasste Arbeitsförderungsmaßnahme nicht unterzeichnen und diese einfach grundlos abbrechen. Im Streitfall hatte die Arbeitsagentur bei dem Kläger deshalb eine dreiwöchige Sperrzeit auf sein Arbeits-losengeld I verhängt.
Doch das war rechtswidrig, befand das BSG. Denn in der Rechtsmittelbelehrung hätte eindeutiger auf die drohende Sperrzeit hingewiesen werden müssen. So gebe es darin keinen Hinweis auf die Frage, für welche konkreten Tage der Zahlungsanspruch entfallen würde. Die Formulierung „vom Tag nach ...“ hätte bereits ausgereicht und „das sperrzeitbegründende Ereignis hinreichend konkretisiert“.
Erhalten Arbeitslose in einem Monat sowohl für einige Tage Hartz-IV-Leistungen als auch Arbeitslosengeld I, können sie keine taggenaue Abrechnung der Geldzuflüsse verlangen, entschied das BSG in dem dritten Fall. Das Jobcenter könne das ausgezahlte Arbeitslosengeld I voll als Einnahme auf die Hartz-IV-Leistungen mindernd anrechnen.
Im konkreten Fall ging es um einen Auszubildenden, der bis zum Ende seiner Ausbildung im Juni 2015 aufstockende Hartz-IV-Leistungen erhalten hatte. Danach wurde ihm wegen Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld I bewilligt. Die Auszahlung in Höhe von 527 Euro wurde ihm jedoch für den Monat Juni verweigert. Da er in dem Monat auch Hartz IV erhalten habe, stehe dem Jobcenter ein Erstattungsanspruch zu. Es gelte das sogenannte Zuflussprinzip. Weil der Kläger das Arbeitslosengeld I noch Ende Juni erhalten habe, müsse es auf die im selben Monat erhaltene Hilfeleistung des Jobcenters mindernd angerechnet werden. Entscheidend sei, welche Einkünfte der Kläger in einem Monat erhalten habe. Eine taggenaue Trennung zwischen Arbeitslosengeld I und II sei nach dem Gesetz nicht vorgesehen.
Az.: B 4 AS 64/21 R (Bundessozialgericht Hartz IV-Aufstocker Fristen)
Az.: B 11 AL 33/21 R (Bundessozialgericht Rechtsfolgenbelehrung Qualifikationsmaßnahme)
Az.: B 11 AL 12/21 R (Bundessozialgericht Arbeitslosengeld I)
Leipzig (epd). Geduldete Ausländerinnen und Ausländer dürfen nicht von der Wahl des Integrationsbeirats eines Landkreises ausgeschlossen werden. Es verletzt den Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn in das Gremium Ausländer mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus gewählt werden können, geduldete Personen aber nicht, urteilte am 29. November das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.
Im konkreten Fall ging es um den im Oktober 2015 gebildeten Integrationsbeirat des Landkreises Leipzig. Zu den zu wählenden Mitgliedern sollten unter anderem auch zwei im Landkreis lebende Personen mit Migrationshintergrund gehören.
Doch dann änderte der Kreistag im September 2018 die Vorschriften, wer in den Integrationsbeirat gewählt werden kann. Nun sollten drei Einwohner mit Migrationshintergrund in das Gremium gewählt werden, die über die deutsche Staatsangehörigkeit oder einen gesicherten Aufenthaltsstatus verfügen. Das ist etwa eine Aufenthalts- oder Niederlassungserlaubnis oder eine Freizügigkeitsberechtigung für EU-Bürger.
Doch die im Landkreis lebenden pakistanischen Antragsteller waren nur geduldet. Sie engagieren sich ehrenamtlich in unterschiedlichen Vereinen, unter anderem auch mit dem Ziel der Integration von Asylsuchenden im Landkreis Leipzig. Sie rügten, dass sie nach den geänderten Vorschriften als „Geduldete“ nicht mehr in den Integrationsbeirat, welcher Behörden in integrationspolitischen Fragen berät, gewählt werden können.
Das Bundesverwaltungsgericht gab den Klägern recht und kippte die Vorschriften des Landkreises. Die Regelung verletze den Gleichbehandlungsgrundsatz und sei damit unwirksam.
Zwar habe der Kreistag mit der Anforderung eines gesicherten Aufenthaltsstatus eine „kontinuierliche Mitwirkung der Gewählten im Beirat“ sichern wollen. Doch auch bei einer Duldung zu Ausbildungszwecken oder wegen eines langjährigen Krieges im Herkunftsstaat könne sich eine voraussichtlich längere Aufenthaltsdauer und eine lange Mitarbeit im Integrationsbeirat ergeben. Warum geduldete Ausländer von der ehrenamtlichen Tätigkeit im Integrationsbeirat ausgeschlossen werden sollen, sei daher nicht ersichtlich, so das Gericht.
Az.: 8 CN 1.22
Stuttgart (epd). Hat ein Sozialhilfebezieher mit heftigem Klopfen gegen die Zimmerdecke wegen lärmender Nachbarn die Decke beschädigt, muss das Sozialamt beim Auszug des Mieters nicht für die Beseitigung der Löcher aufkommen. Das hat das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart in einem am 30. November bekanntgegebenen Urteil entschieden.
Der Kläger bezieht eine Rente wegen voller Erwerbsminderung und ergänzende Sozialhilfeleistungen. In seinem Mehrfamilienhaus war er nicht sonderlich beliebt, weil er Nachbarn mehrfach zu viel Lärm oder auch „unerträgliche Stimmen“ vorwarf. Auf die Beschwerden der Nachbarn mahnte ihn der Vermieter mehrfach ab und kündigte schließlich.
Der Vermieter stellte in der Wohnung des Mannes 14 Löcher an der Decke fest. Für deren Reparatur verlangte er von dem Sozialhilfeempfänger knapp 1.500 Euro. Dieser wandte sich zur Behebung der „Schönheitsreparaturen“ an das Sozialamt. Die Behörde lehnte die Kostenübernahme jedoch ab.
Zu Recht, befand das LSG. Die Reparatur der Decke sei „kein berücksichtigungsfähiger Bedarf“. Nur angemessene und notwendige Unterkunftskosten könnten übernommen werden. Angemessen und notwendig seien aber nur Kosten, die bei einer ordnungsgemäßen Nutzung der Wohnung entstehen, so das Gericht.
Zwar könnten durchaus beim Ein- und Auszug auch angefallene Schönheitsreparaturen dazugehören. Hier habe der Kläger die Schäden aber „selbst unrechtmäßig verursacht“. Die so entstandenen Kosten dürften nicht der Solidargemeinschaft der Steuerzahler aufgebürdet werden.
Ob der Vermieter die Kosten von dem Sozialhilfebezieher erstattet bekommt, ist jedoch offen. Die Durchsetzbarkeit der Forderung liege „im Risikobereich des Vermieters“, so das LSG.
Az.: L 7 SO 1522/22
Stuttgart (epd). Auch Heimbewohner, die Sozialhilfe erhalten, haben einen Anspruch auf Corona-Hilfen. Sie können vom Sozialhilfeträger eine Einmalzahlung von monatlich 150 Euro beanspruchen, sofern sie im Mai 2021 einen Barbetrag und eine Bekleidungspauschale bezogen haben, entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg in einem am 5. Dezember in Stuttgart veröffentlichten Urteil. Das Sozialamt der Stadt Freiburg wurde damit auch in zweiter Instanz zur Einmalzahlung für den Zeitraum von Januar bis einschließlich Juni 2021 verpflichtet.
Geklagt hatte ein 83-Jähriger, der im Pflegeheim lebt und Sozialhilfe bezieht. Der Betreuer des Klägers beantragte für diesen im Juni 2021 die Corona-Einmalzahlung von 150 Euro. Dagegen hatte die südbadische Stadt geklagt. Die Klage wies der Zweite Senat des Landessozialgerichts zurück.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde eine Revision an das Bundessozialgericht zugelassen.
Az.: L 2 SO 1183/22
Frankfurt a.M. (epd). Wegen einer überhöhten Miete muss ein Vermieter in Frankfurt am Main eine Geldbuße von 3.000 Euro zahlen. Außerdem muss er den Mehrerlös von 1.180 Euro abgeben. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 6. Dezember mitteilte, hat das entsprechende Urteil des Amtsgerichts Bestand. Der Vermieter habe die Knappheit an Mietwohnungen für eine unangemessen hohe Miete ausgenutzt.
Der Mieter hatte eine 33 Quadratmeter große, teilmöblierte Einzimmerwohnung mit Kochnische und fensterlosem Bad in Frankfurt-Nied gemietet. Der Vermieter verlangte dafür eine Kaltmiete von 550 Euro plus Nebenkosten von 180 Euro, zusammen 730 Euro im Monat. Dagegen wehrte sich der Mieter mit einer Anzeige, und das Amt für Wohnungswesen ermittelte.
Das Amtsgericht befand, dass von einer ortsüblichen Gesamtmiete von 379 Euro auszugehen sei. Eine Miete, die um mehr als 20 Prozent darüber liege, sei unangemessen. Der Vermieter habe die Marktsituation und die Notlage des Vermieters vorsätzlich ausgenutzt. Die Bestätigung des Oberlandesgerichts ist nicht anfechtbar.
Az.: OLG: 3 Ss-OWi 1115/22 Az.: Amtsgericht: 941 OWi 862 Js 17536/22

Hannover (epd). Die Diakovere Krankenhaus gGmbH in Hannover, Teil von Niedersachsens größtem gemeinnützigen Unternehmen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich, stellt ihre Geschäftsführung neu auf. Zum 1. April des nächsten Jahres wird Christian Unzicker (44) neuer Medizinischer Geschäftsführer. Sein Vorgänger Thomas Kersting verlässt Diakovere. Co-Geschäftsführer bleibt Stefan David, Vorsitzender der Diakovere gGmbH.
Unzicker ist Facharzt für innere Medizin und Gesundheitsökonom (MBA). Nach Stationen als Ärztlicher Direktor der KRH-Kliniken wurde er Ärztlicher Klinikleiter bei der München Klinik gGmbH. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Medizinstrategie und damit innovative Konzepte bei der Standortentwicklung, vor allem im Bereich der Ambulantisierung und bei der Neustrukturierung der Notfallversorgung.
Die Diakovere Krankenhaus gGmbH ist mit rund 300 Millionen Euro Umsatz eine der großen Klinikbetreiberinnen in Niedersachsen. Mehr als 5.400 Menschen arbeiten nach eigenen Angaben bei Diakovere: in den drei Krankenhäusern Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift einschließlich einer Rehabilitationseinrichtung für Schwerunfallverletzte, in der Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe, der Palliativmedizin und dem Hospiz. Auch Fachschulen für Gesundheitsberufe mit 780 Ausbildungsplätzen, eine Akademie, ein Berufsbildungswerk für Menschen mit Behinderung sowie eine inklusive Grund- und Oberschule gehören zu dem Unternehmen.
Andrea Asch, Vorständin des Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, hat turnusgemäß die Federführung in der Liga der Berliner Wohlfahrtsverbände übernommen. Die Diakonie übernahm die Aufgabe vom Paritätischen Wohlfahrtsverband. Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, übergab den Vorsitz an ihre Nachfolgerin Asch. In der Liga kooperieren Arbeiterwohlfahrt, der Caritasverband für das Erzbistum Berlin, die Diakonie und der Paritätische Wohlfahrtsverband. „Wir fordern, dass alle gesehen werden, auch die schwachen Gruppen, und dass niemand allein gelassen wird“, sagte Asch. Die vier Verbände vertreten rund 150.000 Menschen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich unter dem Dach der Berliner Wohlfahrtsverbände in insgesamt 1.200 sozialen Einrichtungen arbeiten.
Achim Schütz hat zum 1. Dezember die Geschäftsführung der drei Kliniken der Stiftung Kreuznacher Diakonie im Saarland übernommen. Er folgt auf Rafaela Korte, die nun Geschäftsführerin des Wilhelmshavener Klinikums ist. Schütz ist damit für das Diakonie Klinikum sowie das Fliedner Krankenhaus in Neunkirchen und das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken verantwortlich. Die Kreuznacher Diakonie hatte im September 2021 die Schließung des Diakonie Klinikums in Neunkirchen angekündigt. Dieses Jahr im September folgte die Mitteilung, auch das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken innerhalb der nächsten sechs Monate schließen zu wollen. Beide Schließungen werden mit Defiziten in Millionenhöhe begründet. Schütz war zuletzt für die Hospital Management Group Geschäftsführer im Warsteiner Maria Hilf Krankenhaus.
Hannes B. Erhardt (45) und Robert Flock (65) werden ihre Tätigkeit für das ESW- Evangelisches Siedlungswerk zum Jahresende 2022 beenden. Erhardt begann seine Tätigkeit für das ESW im Februar 2007. 2009 trat er in die Geschäftsführung ein, die er ab 2011 als Sprecher vertrat. Flock kam im April 2008 ins Unternehmen und wurde im Januar 2011 als Geschäftsführer bestellt. Die beiden Geschäftsführer verantworten damit die Geschäfte der Gesellschaft gemeinsam seit mehr als elf Jahren.
Joachim Laupenmühlen ist zum Vorsitzender Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) Bayern gewählt worden. Er leitet das Gremium bis Ende September 2023. Oberkirchenrat Nikolaus Blum wurde zum Stellvertreter gewählt. Turnusgemäß wechselt der Vorsitz jährlich zwischen Dienstnehmer- und Dienstgeberseite. Die ARK Bayern ist das oberste Tarifgremium für die Evangelisch-Lutherische Kirche und ihre Diakonie in Bayern. Ihre Entscheidungen betreffen derzeit rund 117.000 Mitarbeitende. Die Kommission besteht aus 16 unabhängigen Mitgliedern.
Lisa Schürmann hat am 1. Dezember 2022 die Stelle der Referentin Öffentlichkeitsarbeit des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (KDA) Bayern angetreten. zuvor war die Kommunikationsexpertin für die Bundesgeschäftsstelle des Weltgebetstags der Frauen - Deutsches Komitee in Stein bei Nürnberg tätig. Als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bringt sie Erfahrungen aus der bundesweiten wie internationalen Ökumene mit.
Blanka Weiland hat den Bayerischen Verfassungsorden erhalten. Die Vorsitzende der Kommission Inklusion beim Bayerischen Jugendring (BJR) engagiert sich seit fast 40 Jahren für Inklusion und Vielfalt in der Jugendarbeit. Seit frühester Kindheit ist die 1965 geborene Nürnbergerin in ihrer körperlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Seit rund 20 Jahren ist Weiland auf einen Rollstuhl angewiesen. Im Zuge ihres Engagements sorgte sie mit dafür, dass sich Inklusion als Querschnittsthema in der Jugendarbeit etablierte. Seit 2016 ist sie im Vorstand des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt. 2020 wurde sie von der Vollversammlung des BJR zur Vorsitzenden der neu gegründeten Kommission Inklusion gewählt.
Wir haben Tagungen, Seminare, Workshops und Webinare aufgelistet, die aktuell geplant sind. Wegen der Corona-Epidemie sagen Veranstalter allerdings Termine auch kurzfristig ab. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, das zu beachten.
11.1.:
Online-Seminar „Kompetent online beraten per Video“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/2001700
16.1.:
Online-Workshop „Mit Wertschätzung und Klarheit - Kommunikation für Führungskräfte“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711 286976-10
26.-27.1.:
Online-Seminar „Umgang mit psychisch kranken alten Menschen“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/ 488 37-495
27.-28.1. Berlin:
Kongress „Pflege 2023“
der Springer Pflege
Tel.: 030/82787-5510
30.1.:
Online-Seminar „Feedbackmethoden und Lernkultur - Kommunikationstraining für eine bessere Zusammenarbeit“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-10
31.1.:
Online-Seminar „Probleme in der Pflege lösen“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/97356159
Februar
8.2. Köln:
Seminar „Personaleinsatzplanung unter dem Bundesteilhabegesetz: Chancen - Risiken - Lösungsansätze“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/97356-0
13.-15.2. Berlin:
Seminar „Überzeugend auftreten in Präsentation, Verhandlung und Gespräch - Einsatz von Körper, Stimme, Sprache“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
16.-23.2.:
Online-Seminar „Ausländer- und Sozialrecht für EU-BürgerInnnen“
Tel.: 030/26309-139
20.-22.2. Freiburg:
Seminar „Beratungsresistent - Lösungsorientiert handeln unter schwierigen Bedingungen“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/2001700