 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 44/2019 - 01.11.2019
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 44/2019 - 01.11.2019
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 44/2019 - 01.11.2019
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 44/2019 - 01.11.2019

ausreichend Fachkräfte für eine gute Pflege in den Krankenhäusern - das verspricht sich die Bundesregierung von neuen Vorschriften für Personaluntergrenzen. Doch die Selbstverwaltung von Krankenkassen und Kliniken, die die konkrete personelle Mindestausstattung gemeinsam festlegen sollen, kommt kaum voran. Nun haben Festlegungen des Gemeinsamen Bundesausschusses G-BA für die stationäre Psychiatrie Empörung ausgelöst.
Rettungskräfte erleben bei ihrem Einsatz an Unfallstellen zunehmend Gewalt und Pöbeleien. Deshalb werden Straftaten gegen sie seit zwei Jahren härter bestraft. Jetzt will Gesundheitsminister Spahn das medizinische Personal in Notfallambulanzen von Krankenhäusern ebenfalls besser schützen.
Vier von zehn Arbeitnehmern, die einen neuen Job antreten, gehen ein unsicheres Arbeitsverhältnis ein. Denn ihr Arbeitsvertrag ist von Anfang an zeitlich begrenzt. Befristete Jobs sind "Ausdruck der Machtverhältnisse", sagen die einen. "Besser, als arbeitslos zu sein", finden die anderen.
Die Wohlfahrtsbranche könnte deutlich mehr tun, damit "ein gutes Leben für alle" im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie erreicht wird. Davon ist Marianne Dehne von der Diakonie Deutschland überzeugt. Insbesondere beim Klimaschutz und beim "Nachhaltigen Konsum" habe die Branche noch "Luft nach oben", wie sie in epd sozial schreibt.
Kirchliche Beschäftigte werden oft fehlerhaft über ihre Arbeitsbedingungen informiert. Das Bundesarbeitsgericht hat im Fall eines früheren katholischen Küsters beanstandet, dass er in seinem Arbeitsvertrag nicht ausreichend auf eine sogenannte "Verfallsklausel" hingewiesen worden sei - darüber, in welcher Frist er nachträglich einen höheren Lohn nachfordern könne.
Folgen Sie epd sozial auch bei Twitter. Auf dieser Plattform erhalten Sie weitere Informationen. Und Sie können sich dort mit Entscheidern der Sozialbranche und der Sozialpolitik austauschen.
Hier geht es zur Gesamtausgabe von epd sozial 44/2019.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Markus Jantzer

Berlin (epd). Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgeschrieben, dass in allen "bettenführenden Abteilungen" der Kliniken Untergrenzen für das Pflegepersonal gelten sollen. Ein Mammutvorhaben, das noch nicht vollständig umgesetzt ist. Auch weil Krankenhausgesellschaft und Krankenkassen sich in Verhandlungen immer wieder verhedderten. Im Kern dreht sich der Streit darum, wie viele Fachkräfte tatsächlich gebraucht werden, um eine hochwertige Pflege sicherstellen zu können.
Seit Jahresbeginn gelten bereits Untergrenzen in vier Bereichen: in der Intensivmedizin, der Geriatrie, der Kardiologie und der Unfallchirurgie. Sie werden als maximale Anzahl von Patienten pro Pflegekraft festgelegt. Noch nicht geregelt ist der Fachkräfteeinsatz in der Psychiatrie. Ab Januar soll sich das ändern.
Voraussetzung dafür war das im Juni 2016 vom Bundestag gebilligte "Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen", dessen konkrete Vorgaben an den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) delegiert wurden. Der legt fest, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden.
Der G-BA hat jetzt die Mindestvorgaben für die stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik veröffentlicht - eine Entscheidung gegen die Stimmen der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Der Dachverband und mehrere Fachverbände üben Kritik - und rufen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, die Pläne noch zu stoppen.
Der G-BA hat nach eigenen Angaben die Minutenwerte, in denen der Personalbedarf je Woche bisher gemessen wird, bei der psychologischen Betreuung um durchschnittlich 60 Prozent und bei der Intensivbehandlung um zehn Prozent erhöht. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurden über fast alle Berufsgruppen hinweg die Minutenwerte um fünf Prozent erhöht - doch es gibt Ausnahmeregelungen.
"Die Entscheidung des G-BA belässt den Personalstand auf einem Niveau, das weiterhin eine unzureichende Pflege von psychisch kranken Menschen in Kauf nimmt", rügt Sandra Mehmecke, Sprecherin der Pflegekammerkonferenz. Seit 1989 habe es keine Anpassung der Pflegepersonalausstattung mehr gegeben. Die vom G-BA vorgesehene Erhöhung der Personalstärken sei viel zu gering: "Die fehlende Zeit geht dabei zulasten der Patienten."
Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschlands (kkvd), nennt den Beschluss einen Rückschritt. "Er schreibt größtenteils den Personalbestand aus dem Jahr 1991 fort, anstatt die Personalplanung an moderne Therapieformen und die veränderten Versorgungsstrukturen anzupassen." So werde beispielsweise ausgeblendet, dass Therapien heute oft stations- und sektorenübergreifend stattfinden.
Der Beschluss sei "eine große Enttäuschung für alle, die auf wirkliche Verbesserungen gehofft hatten", erklärte Gerald Gaß, der Präsident der DKG. Die Folge sei mehr Personal für Dokumentation und Bürokratie, weniger Personal für die psychisch kranken Menschen. Er rügte eine Kontrollwut der Krankenkassen, die moderne Versorgungsangebote unmöglich mache.
Das will der G-BA nicht auf sich sitzenlassen: Die DKG übersehe bei ihrer "völlig überzogenen Kritik, dass wir nicht einfach die alte Psychiatrie-Personalverordnung fortgeschrieben haben, die ein Personalbemessungsinstrument war und keine Mindestvorgaben enthalten hat".
Der Bundesverband Deutscher Privatkliniken sieht Mindestvorgaben beim Personal grundsätzlich kritisch: Planwirtschaft beim Personal führe "zu wenig passgenauen und damit unwirtschaftlichen Personalstrukturen". Den Versorgungsbedürfnissen der psychisch kranken Menschen trage eine solche starre Vorgabe nicht Rechnung, hieß es.
Spahn ist nun gefordert, den Beschluss des G-BA rasch zu prüfen. Auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) teilte das Minsiterium mit: "Das Ministerium wird die Richtlinie prüfen, sobald der Beschluss und die begründenden Unterlagen des G-BA vorliegen. Die Richtlinie kann dann innerhalb einer Frist von zwei Monaten beanstandet werden." Jetzt drängt die Zeit: Bei Nichtbeanstandung tritt die Richtlinie zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Berlin (epd). Die Bundesregierung plant schärfere Strafen bei Gewalt gegen Ärzte, Pflegepersonal und Helfer in ärztlichen Notdiensten und Notfallambulanzen. Die Zahl der Übergriffe auf medizinisches Personal sei in kürzester Zeit um mehr als die Hälfte gestiegen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am 29. Oktober in Berlin. Das Bundeskabinett brachte am 30. Oktober entsprechende gesetzliche Änderungen auf den Weg.
Danach soll das medizinische Personal von ärztlichen Notdiensten und in Notfallambulanzen in Zukunft unter dem gleichen strafrechtlichen Schutz stehen, wie er inzwischen auch für Rettungskräfte gilt - also für medizinisches Personal, das Notfälle außerhalb von Krankenhäusern und Praxen an der Unfallstelle oder am Unglücksort versorgt. Rettungskräfte seien besonderen Gefahren ausgesetzt. Das gelte auch für das medizinische Personal in Notfallambulanzen, hieß es.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, begrüßte Spahns Vorhaben. Dieses könne ein starkes Signal dafür sein, Gewalt gegen Retter und Helfer gesellschaftlich zu ächten. "Härtere Strafen für Prügler und Pöbler in Gesundheitseinrichtungen können abschreckend wirken und sind deshalb gut und richtig", sagte der Ärztepräsident in Berlin.
Vor zwei Jahren hatten Union und SPD den Schutz von Sicherheits- und Rettungskräften durch neue Straftatbestände verstärkt. Das "Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften" droht bei tätlichen Angriffen auf Polizisten, ermittelnde Staatsanwälte, Feldjäger und andere Sicherheitskräfte mit bis zu fünf Jahren Haft. Ebenso geschützt sind seitdem hauptamtliche und ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes und der Rettungsdienste.
Dem "Krankenhaus Barometer 2019" zufolge, einer jährlichen Befragung der Kliniken im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), registrieren fast drei Viertel der Krankenhäuser (73 Prozent) in ihren Notfallambulanzen körperliche und verbale Übergriffe auf die Mitarbeiter. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Attacken gestiegen, sagen mehr als die Hälfte der Kliniken (58 Prozent).
Die Zahl der Übergriffe auf Ärzte und Pflegekräfte hat sich von 2013 bis 2017 um mehr als die Hälfte erhöht. Das wurde aus Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik für Baden-Württemberg auf das Bundesgebiet hochgerechnet. Danach wurden 2013 Ärzte und Ärztinnen 435 Mal Opfer von Gewalt, vier Jahre später 692 Mal. Die Angriffe auf das Pflegepersonal erhöhten sich im selben Zeitraum von 1.725 auf 2.436 Übergriffe.
Aus einer Studie der Hochschule Fulda geht hervor, dass Alkohol und Drogen aufseiten der Patienten und ihrer Begleitpersonen in hohem Maße mitverantwortlich sind für die Ausbrüche, in 85 Prozent der Fälle. Aber auch die Wartezeiten lösen Aggressionen aus. Das Erleben von Gewalt sei in den Notaufnahmen zur Normalität geworden, erklärte das Personal aus rund 50 hessischen Notaufnahmen, nachts fühle man sich meistens nicht mehr sicher.
In der Folge steigt auch beim medizinischen Personal der Druck. Ärger (80 Prozent) und Wut (58 Prozent) gehören inzwischen zum Berufsalltag für Ärzte und Pflegekräften in den Notfallambulanzen, fast 40 Prozent des Personals sprechen von einer starken Belastung durch die Übergriffe.

Berlin (epd). Schlechte Witze, dumme Sprüche und ein Klaps: Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz sind kein Randphänomen, sondern weit verbreitet. Rund neun Prozent der Beschäftigten haben bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren, wie die Soziologin Monika Schröttle am 25. Oktober bei der Vorstellung einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sagte. Dabei fällt auf: Überwiegend handelt es sich nicht um einmalige Fälle, sondern um fortgesetzte schwere Belästigungen. 83 Prozent der Befragten erlebten mehr als einmal belästigende Situationen.
Rund ein Viertel der Betroffenen hat der Studie zufolge Erfahrungen von körperlichen Belästigungen und Nötigungen sowie den Zwang zu sexuellen Handlungen am Arbeitsplatz gemacht. Insgesamt handelt es sich bei 98 Prozent der Opfer um Frauen.
Der Studie zufolge ging mehr als die Hälfte aller Übergriffe (53 Prozent) von Kunden, Klienten und Patienten aus. Bei 43 Prozent der belästigenden Personen handelte es sich um Kollegen, bei einem Fünftel waren es Vorgesetzte oder höherstehende Personen. Grundsätzlich bestehe in allen Branchen das Risiko für sexuelle Belästigung, sagte Schröttle. Allerdings sind zu knapp einem Drittel Beschäftige im Pflege- und Gesundheitsbereich betroffen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) machte deutlich, dass es sich bei sexueller Belästigung um keinen Kavaliersdelikt, sondern um einen Straftatbestand handele. "Sie ist Ausdruck von Machtmissbrauch und eine Form von Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Männer", betonte Giffey. Arbeitgeber seien verpflichtet, für den Schutz ihrer Mitarbeiter zu sorgen. Dabei seien die Formen der sexuellen Belästigung oft vielfältig und deshalb schwer zu fassen, sagte die Ministerin. Sexuelle Belästigung beginne, wenn eine Geste oder ein Wort eine unterschwellige Bedeutung habe und reiche bis hin zu körperlicher Bedrängnis und Übergriffen.
Ein großes Problem ist, dass sexuelle Belästigung von den Opfern oftmals stillschweigend geduldet und damit auch nicht sanktioniert wird, wie es hieß. Giffey sagte, viele Betroffene hätten Angst, sich zu beschweren und bei Beschwerden gemobbt zu werden. Auch die Studie bestätigt, dass sich Betroffene zwar häufig verbal zur Wehr setzen, sich aber nur in vier von zehn Fällen an eine dritte Personen, wie etwa Kollegen, Vorgesetzte oder betriebliche Ansprechpartner wenden. Ganz selten werde der Rechtsweg eingeschlagen.
Sexuelle Belästigungen bei Frauen seien stark in Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse eingebunden, erklärte Schröttle. Besonders gefährdet seien weibliche Führungskräfte, Frauen in sogenannten Männerberufen, aber auch Selbstständige. Diese Berufsgruppen hätten mehrfach über sexuelle Belästigungen als "Form der Aggression und Machtdemonstration" berichtet.
Für die Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes wurden von Juni 2018 bis September 2019 insgesamt 1.531 Menschen per Telefon befragt.
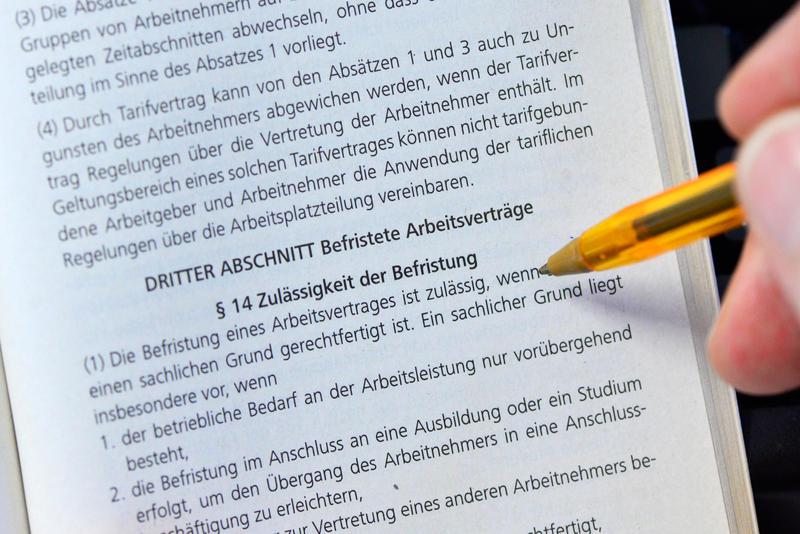
Düsseldorf, Köln (epd). Befristete Jobs werden in offiziellen Statistiken in die sogenannten "atypischen Beschäftigungsverhältnisse" eingruppiert. Doch ist ein Zeitvertrag tatsächlich atypisch, wenn vier von zehn Neueinstellungen befristet sind, wie das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit kürzlich in einer Studie veröffentlicht hat? Der Arbeitsmarktforscher der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, Eric Seils, sieht sie als Ausdruck der "Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt".
Insgesamt gehen in Deutschland nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes 2,7 Millionen Menschen einem zeitlich befristeten Job nach und können am Ende der Frist ohne weiteres wieder entlassen werden. Damit ist jeder zwölfte Arbeitsplatz (8,3 Prozent) befristet. Vor 20 Jahren waren nach den amtlichen Statistiken nur 5,4 Prozent aller Arbeitsverträge zeitlich begrenzt.
Seils kritisiert, dass viele befristete Einstellungen ohne sachlichen Grund erfolgen. "Unternehmen machen es, weil sie es können." Befristete Neueinstellungen entsprächen einer "verlängerten Probezeit", bestätigt die Studie der Bundesagentur für Arbeit.
Sachgrundlose Befristungen machen knapp die Hälfte aller Zeitverträge aus. Der Arbeitsmarktforscher des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), Holger Schäfer, rät dem Gesetzgeber davon ab, sie abzuschaffen. Nach seiner Beobachtung setzen Betriebe dieses Instrument auch deshalb ein, "weil eine gerichtsfeste sachliche Begründung einige juristische Kenntnisse erfordert".
Laut Seils bergen befristete Jobs für beide Seiten ein Risiko: "Die befristet Beschäftigten werden natürlich neben den Leiharbeitern zu den ersten Opfern gehören, wenn der wirtschaftliche Abschwung auf den Arbeitsmarkt übergreift." Auf der anderen Seite springen befristet Beschäftigte schnell ab, wenn sie andernorts eine Festanstellung bekommen, sagt Seils. Das IW weist hingegen darauf hin, dass die Übernahmequote aus auslaufenden Befristungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei. Das Institut schließt daraus: "Befristungen haben die Beschäftigungsperspektiven der Betroffenen nicht verschlechtert."
Schäfer räumt ein, dass eine Befristung "aus Sicht des Arbeitnehmers in der Tat keine unmittelbaren Vorteile gegenüber einem gleichartigen unbefristeten Vertrag hat". Er gibt aber zu bedenken, dass ohne diese zeitliche Begrenzung manch ein Arbeitsverhältnis gar nicht zustande käme. Gerade bei unsicherer Geschäftsentwicklung könnten Betriebe mit Befristungen die "notwendige Flexibilität herstellen".
Noch im Jahr 2000 war der Anteil der Zeitarbeitsverträge bei Neueinstellungen mit gut 30 Prozent erheblich kleiner als derzeit. "Deutliche Anstiege der Befristungsquoten sind Mitte der 2000er Jahre im Zuge der Hartz-Reformen und in der Finanzkrise 2008 zu erkennen", erklärt das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Seit 2010 geht die Befristungsquote leicht zurück, ist aber mit rund 40 Prozent bei Neueinstellungen weiter auf einem hohen Niveau.
Jeder dritte befristet Beschäftigte (34,1 Prozent) gab an, dass er seinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, weil er keine Dauerstelle gefunden habe. Über diese unfreiwillige Befristung ärgern sich vor allem erfahrene Arbeitnehmer. Von den befristet Beschäftigten, die 45 Jahre und älter sind, sagen laut Statistikbehörde 45,2 Prozent, dass sie das Arbeitsverhältnis nicht gern eingegangen seien.
Die Unsicherheit im Job hat soziale Folgen. Laut Seils gibt es "Belege dafür, dass befristete Beschäftigungen einen negativen Einfluss auf die Familienplanung haben: Befristet Beschäftigte sind seltener verheiratet und haben auch weniger Kinder." Aber auch ihr Gefühl, zur Gesellschaft zu gehören, werde beeinträchtigt. "Gesellschaftliche Integration hängt eben in hohem Maße von einer stabilen Beschäftigung ab", sagt der Forscher der Hans-Böckler-Stiftung.

Berlin, Paris (epd). Kita-Fachkräfte wünschen sich einer Umfrage zufolge mehr gesellschaftliche Anerkennung für ihre Arbeit. Wie aus einer am 25. Oktober in Berlin vorgestellten internationalen Studie weiter hervorgeht, üben Leitungskräfte häufig eine anspruchsvolle Tätigkeit aus, ohne für die Verwaltung oder Teamleitung in einer Kinderbetreuungseinrichtung ausgebildet zu sein. Für die OECD-Studie zur frühkindlichen Bildung wurden etwa 15.000 pädagogische Fachkräfte sowie knapp 3.000 Leitungskräfte in Deutschland, Chile, Dänemark, Island, Israel, Japan, Korea, Norwegen und der Türkei befragt.
Während in Deutschland 97 Prozent der Ü3-Fachkräfte (für Kinder über drei Jahren) und 95 Prozent der U3-Fachkräfte (für Kinder unter drei Jahren) speziell für die Arbeit mit Kindern ausgebildet sind, ist dieser Anteil den Angaben zufolge in allen anderen untersuchten Ländern geringer – mit 64 Prozent am geringsten in Island. Die Ausbildung, aber auch die Weiterbildung spiele für die Qualität der frühkindlichen Bildung eine wichtige Rolle, sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Denn gut ausgebildete Fachkräfte wenden eine größere Bandbreite von Methoden an, die die kindliche Entwicklung fördern.
Eine Mehrheit der Fachkräfte wünsche sich vor allem Weiterbildungsmaßnahmen für den Umgang mit Kindern, die einen fremdsprachlichen Hintergrund haben, sowie für den Umgang mit Kindern, die besonderen Förderbedarf haben. In über 40 Prozent der Kindertagesstätten in Deutschland haben, so die Studie, mindestens elf Prozent der Kinder einen fremdsprachlichen Hintergrund – das ist der höchste Wert im Vergleich der neun untersuchten Länder.
Gemeinsam ist allen neun untersuchten Ländern, dass frühkindliche Bildung noch immer eine Frauendomäne ist. Über 95 Prozent der Fachkräfte sind Frauen – diese Zahl gilt auch für Deutschland.
Ein ebenfalls länderübergreifendes Merkmal ist laut Studie die hohe Berufszufriedenheit unter den Fachkräften. In Deutschland sagen 93 Prozent der Ü3-Fachkräfte, sie seien insgesamt zufrieden. Zugleich ist aber nur rund ein Viertel mit seinem Gehalt zufrieden und nur 36 Prozent der Befragten fühlen sich in ihrer Rolle gesellschaftlich anerkannt.
Stark belastet zeigen sich die Leitungskräfte. Mehr als 60 Prozent von ihnen nennen Abwesenheiten und Personalmangel als Belastung für ihre Arbeit. Nur knapp die Hälfte berichtet, dass mindestens einmal jährlich externe Evaluationen vorgenommen worden, um Inhalt der Aktivitäten und Qualität im Umgang mit den Kindern zu beurteilen. Damit gehört Deutschland in der Studie zu den Schlusslichtern.

Frankfurt a.M. (epd). In den deutschen Millionenstädten sinkt die Zahl der Sozialbestattungen. In Berlin übernahmen die zuständigen Ämter im vergangenen Jahr in 1.543 Fällen die Kosten für die Beerdigung eines Menschen, dessen Angehörige dazu selbst nicht in der Lage waren, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter Stadtverwaltungen ergab. 2011 waren es noch 2.780 Bestattungen. In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 1.341 Sozialbestattungen gezählt, 214 weniger als 2009. Seit 2012 verzeichnet auch Köln einen Rückgang. Dort gab es 2018 717 Fälle. Eine sinkende Tendenz meldet auch München.
Etliche Großstädte verzeichnen laut der Umfrage weitgehend stabile Zahlen, darunter Frankfurt am Main. Einen deutlichen Anstieg gibt es indes in Hannover. Wurden dort 2009 noch 111 Anträge auf eine Sozialbestattung bewilligt, waren es im vergangenen Jahr mit 310 fast dreimal so viel. In Mainz hat sich die Zahl der Fälle in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt: 2009 wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 42 Mal Bestattungskosten bewilligt, im vergangenen Jahr 92 Mal.
Die Höhe der Kostenübernahme variiert stark von Kommune zu Kommune: Manche Städte erstatten lediglich rund 2.000 Euro, in Augsburg werden bis zu 6.200 Euro anerkannt.
Nach Darstellung der Verbraucherinitiative für Bestattungskultur Aeternitas bewegt sich die Zahl der Sozialbestattungen trotz der Rückgänge in manchen Städten weiter "auf hohem Niveau". Der Aeternitas-Rechtsexperte Torsten Schmitt forderte bundeseinheitliche Standards, damit die Verfahren zur Kostenübernahme fairer und transparenter werden. "Diese Standards würden in vielen Fällen verhindern, dass sich Betroffene an uns wenden müssen, denen die Behörden ihnen zustehende Leistungen verweigern wollen."
Laut Gesetz ist eine Sozialbestattung vorgesehen, wenn die Hinterbliebenen nicht in der Lage sind, die Kosten einer Bestattung zu tragen. Sozialbestattungen sind von den sogenannten ordnungsbehördlichen Bestattungen zu unterscheiden. Diese werden von den Verwaltungen dann angeordnet, wenn ein Toter keine lebenden Angehörigen hinterlässt.
Berlin (epd). Die offiziellen Statistiken zur Arbeitslosigkeit in Deutschland haben nach Ansicht der Grünen im Bundestag einen gravierenden Mangel: Sie erfassen viele Personen nicht, die dem Jobmarkt aus unterschiedlichen Gründen nicht oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Das räumte auch die Bundesregierung ein, die auf eine Anfrage der Grünen Auskunft gab. Nach der Antwort der Bundesregierung, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, fallen 372.000 Personen aus der Statistik heraus.
Die Bundesagentur für Arbeit rechnet zum Beispiel Erwerbslose im Alter von über 58 Jahren aus der offiziellen Statistik heraus. Das seien allein unter den Langzeitarbeitslosen, die das Arbeitslosengeld II erhalten, Ende vergangenen Jahres 170.000 Frauen und Männer gewesen, heißt es in der Antwort der Regierung. Ihre Zahl ist demnach seit 2013 ebenso deutlich gestiegen wie die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Bezieher in sogenannten Aktivierungsmaßnahmen.
"Diese Statistik verdeckt das eigentliche Ausmaß der Arbeitslosigkeit, da eigentlich mehr Menschen keiner Erwerbtätigkeit nachgehen als offiziell angegeben", sagte die Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke. Arbeitslose, die aktuell an einer Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder länger als sechs Wochen krankgeschrieben sind, würden in der Statistik nicht als arbeitslos berücksichtigt. Dasselbe gelte für Menschen, die älter als 58 Jahre alt sind und denen seit einem Jahr kein Beschäftigungsangebot unterbreitet wurde.
Nach Angaben der Grünen müssten für ein vollständiges Bild im Dezember 2018 zu den 1,78 Millionen Arbeitslosen im Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II noch 740.000 Menschen dazugerechnet werden, die entweder an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnahmen, kurzfristig arbeitsunfähig waren oder unter die "Sonderregelung für Ältere" fielen. Die offizielle Statistik weist für diesen Zeitraum rund 2,2 Millionen Erwerbslose aus.
"Während die offizielle Arbeitslosigkeit sinkt, steigt die Zahl der Menschen, die aufgrund ihres Alters oder ihrer Teilnahme an sinnlosen Aktivierungsmaßnahmen aus der Statistik fallen", kritisierte Müller-Gemmeke: "Sie gelten nicht mehr als arbeitslos, obwohl sie keinen Schritt näher an einem Job sind." Diese "Schönrechnerei auf dem Rücken der Menschen" sei absurd und müsse endlich beendet werden.
Es passe nicht zusammen, wenn Beschäftigte bis zum Alter von 67 Jahren arbeiten müssten "und andere schon mit 58 aufs Abstellgleis geschoben werden". Der Paragraf 53a des SGB II gehöre dringend abgeschafft. Ältere Arbeitslose dürften nicht länger ignoriert werden, sondern müssten stärkere Unterstützung bekommen.
Berlin (epd). Das Projekt "Pausentaste" des Bundesfamilienministeriums zur Unterstützung pflegender Kinder und Jugendlicher wird erweitert. Betroffene Mädchen und Jungen können sich jetzt auch in einem Chat beraten lassen, teilte das Ministerium am 29. Oktober in Berlin mit. Zwei Mal wöchentlich stünden dafür Fachleute vom Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer" bereit, hieß es.
Schon die bisherigen Angebote des Projekts werden den Angaben nach rege genutzt. Seit Beginn der Initiative im Januar 2018 verzeichnete die Webseite www.pausentaste.de über 50.000 Besuche. Zudem gab es den Angaben nach rund 3.300 Beratungen per Telefon oder E-Mail.
"Auch pflegende Kinder brauchen Pausen. Sie brauchen jemanden zum Zuhören. Sonst wird aus Pflege Stress, Überforderung und Einsamkeit", sagte Familienministerin Franziska Giffey bei einem Netzwerktreffen der "Pausentaste" in der Hauptstadt. Sie habe größten Respekt davor, was pflegende Kinder und Jugendliche für ihre Geschwister oder Eltern täglich leisteten: "Sie müssen wissen, dass sie nicht allein sind und bestmöglich unterstützt werden."
Laut einer Studie der Universität Witten-Herdecke (2018) im Auftrag des Gesundheitsministeriums kümmern sich bundesweit rund 479.000 Kinder und Jugendliche um chronisch kranke oder pflegebedürftige Angehörige. Sie sind oft psychisch schwer belastet, haben neben Schule und Pflege zu wenig Freizeit und haben niemanden, um über ihre Situation zu reden.
Ihnen will das bundesweite Projekt "Pausentaste" helfend zur Seite stehen. Das Angebot umfasst die Website www.pausentaste.de, sowie eine telefonische Beratung und eine E-Mail-Beratung beim Kinder- und Jugendtelefon der "Nummer gegen Kummer". Hinzu kommt nun die Beratung per Chat.
Bremerhaven, Berlin (epd). Die Städtische Wohnungsgesellschaft (STÄWOG) Bremerhaven hat mit ihrem Projekt "Gegen den Strom - Soziale Stadt Wulsdorf" den Preis Soziale Stadt 2019 gewonnen. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdige die Entwicklung und Sanierung des Bremerhavener Quartiers Wulsdorf-Ringstraße, teilte der Deutsche Mieterbund am 25. Oktober in Berlin mit. Er vergibt den Preis zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO), dem Deutschen Städtetag, dem Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und dem Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung.
Die Siedlung Wulsdorf-Ringstraße habe Ende 1990er Jahre "vor dem Abgrund" gestanden, hieß es: "Das Quartier war zum sozialen Brennpunkt verkommen, Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten lagen teils um ein vielfaches höher als im restlichen Stadtgebiet Bremerhavens." Gemeinsam mit den Bewohnern und Kooperationspartnern sei die STÄWOG seit 1999 die architektonischen und sozialen Missstände angegangen.
Statt des vielfach geforderten kompletten Abrisses habe sie auf teilweisen Rückbau, Neubau und innovative Weiterentwicklung der Gebäude gesetzt, was nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die vorhandenen sozialen Strukturen geschont und bewahrte habe. Das Quartier sei vom sozialen Brennpunkt zum Stolz der Bewohner geworden und strahle positiv in die Umgebung aus.
Das Siegerprojekt steht nach Angaben des Mieterbundes stellvertretend für das große soziale Engagement, das zahlreiche Akteure bundesweit in vielen Stadtteilen erbringen. Mehr als 180 Projekte hätten sich am Preis Soziale Stadt beteiligt. Der Wettbewerb wurde seit dem Jahr 2000 bereits zum zehnten Mal ausgelobt.
Wiesbaden (epd). Die hessische Landesregierung will die angekündigten Gelder aus dem "Gute-Kita-Gesetz" des Bundes vor allem für einen besseren Betreuungsschlüssel der Kinder nutzen. Das Land setze bei der Verwendung der bis 2022 zugesagten Mittel in Höhe von 412 Millionen Euro auf eine Qualitätsverbesserung in den Kindertagesstätten durch mehr Personal, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am 28. Oktober in Wiesbaden. Um die benötigten zusätzlichen Fachkräfte zu bekommen, soll zudem mit einer Werbe- und Imagekampagne versucht werden, die Vorzüge des Erzieherberufs deutlich zu machen.
Die Landesregierung werde die Mittel um 138 Millionen Euro aufstocken. Insgesamt stünden somit 550 Millionen Euro bis 2025 zur Verfügung. Hinzu kämen weitere Zuschüsse an die Kommunen durch das Landesprogramm "Starke Heimat".

Berlin (epd). Töchter, Schwiegertöchter, Ehefrauen: Wenn es in der Familie einen Pflegefall gibt, sind es zu 70 Prozent Frauen, die sich zu Hause um den Angehörigen kümmern. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) warnte am 29. Oktober in Berlin vor den Folgen. Häusliche Pflege trage zur Altersarmut von Frauen bei, bilanzierte Verbandschef Adolf Bauer und forderte einen finanziellen Ausgleich analog zum Elterngeld nach der Geburt eines Kindes. Die Zukunft von rund drei Millionen pflegender Frauen bereite ihm ernste Sorge, sagte Bauer.
Der Verband präsentierte ein Gutachten, wonach schon sechs Monate Unterbrechung der Berufsarbeit einen dauerhaften Lohnverlust von neun Prozent bedeuten. Bei einem Jahr Unterbrechung wächst die Lohnlücke im Vergleich zu ununterbrochener Berufstätigkeit auf 15 Prozent. Die Unterbrechung oder Einschränkung der Erwerbsarbeit wirkt sich finanziell umso negativer aus, je später im Lebenslauf sie erfolgt, da Frauen und Männer im Durchschnitt erst mit 55 Jahren das höchste Lohnniveau ihrer Berufslaufbahn erreichen. Das ist dann auch das Alter, in dem die Pflege der Eltern oder Schwiegereltern wahrscheinlicher wird.
Weitere Folgen unterbrochener oder eingeschränkter Berufsarbeit sind niedrigere Rentenansprüche und mehr Altersarmut. Zwar gehen zwei Drittel (65 Prozent) der pflegenden Frauen weiter ihrer Erwerbsarbeit nach, doch arbeiten sie in der Regel Teilzeit. Im Durchschnitt sind sie den Angaben zufolge 21 Stunden pro Woche mit der Pflege beschäftigt. Insgesamt pflegen derzeit rund 4,5 Millionen Menschen in Deutschland zu Hause einen Angehörigen, mehr als zwei Drittel sind Frauen.
Laut der Studie im Auftrag des SoVD werden die staatlichen Hilfen nicht gut angenommen und reichen nicht aus. Die Rentenpunkte für pflegende Angehörige kompensierten die Einkommensverluste nicht. Das zinslose Darlehen zur Überbrückung von Pflegezeiten werde kaum angenommen. Eine Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld könne hingegen die Einkommenssituation der pflegenden Frauen verbessern und dazu führen, dass mehr Männer die Pflege übernehmen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat ein Familienpflegegeld analog zum Elterngeld ins Gespräch gebracht, zugleich aber erklärt, das sei ein Zukunftsprojekt. Die Koalition von Union und SPD hat dazu keine Vereinbarungen getroffen.

Berlin (epd). Bekanntlich steht es um unseren Planeten nicht zum Besten. Dieses Jahr hat der sogenannte Erdüberlastungstag erstmals schon Ende Juli stattgefunden, die Erreichung der Klimaziele steht in den Sternen und laut Welthunger-Index gibt es bei der Bekämpfung des weltweiten Hungers wieder Rückschläge. Und das, obwohl die Generalversammlung der Vereinten Nationen im September 2015 ihre 17 "Ziele für nachhaltige Entwicklung" (Sustainable Development Goals, SDGs) verabschiedet hat. Dazu gehören beispielsweise "Keine Armut", "Gesundheit und Wohlergehen", "Nachhaltige/r Konsum und Produktion", "Maßnahmen zum Klimaschutz" und "Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen".
Bis 2030 sollen die 17 Ziele und ihre 169 Unterziele von der Staatengemeinschaft erreicht werden. Basis für die Umsetzung der SDGs in Deutschland ist die im Januar 2017 von der Bundesregierung verabschiedete Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016, die 2018 noch einmal aktualisiert wurde. Damit "ein gutes Leben für alle", wie es in dem Strategiepapier heißt, möglich wird, sind alle gesellschaftlichen Akteure zur Umsetzung aufgerufen. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, und eine dringliche dazu.
Sind auch wir Akteure der Freien Wohlfahrtspflege gefordert? Immerhin ist die Freie Wohlfahrtspflege ein sehr großer gesellschaftlicher Akteur und könnte schon aus diesem Grund richtig etwas bewegen. Die SDGs sind in der Tat für die Freie Wohlfahrtspflege relevant, und zwar in dreifacher Hinsicht.
Die SDGs bilden erstens einen konkreten Rahmen zur Bewältigung der verschiedenen kritischen Zukunftsthemen, einen Rahmen, der anschlussfähig ist an unsere Werte und unser Selbstverständnis. Sie stellen gewissermaßen eine gemeinsame Bezugsgröße dar, die branchenübergreifend und weltweit gültig ist.
Zweitens verleihen sie der sozialen Arbeit der Verbände, Unternehmen, Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege auf den verschiedenen Hilfefeldern eine noch stärkere Legitimation. Wir sollten in der Öffentlichkeit unbedingt sichtbarer machen, wie viel wir schon dazu beitragen, die SDGs in Deutschland umzusetzen, und vor diesem Hintergrund weitere Unterstützung dafür einfordern. Drittens aber bedeuten sie auch eine große Herausforderung, denn bei einigen Zielen haben wir deutlich noch "Luft nach oben".
Insbesondere "Klimaschutz" und "Nachhaltiger Konsum" sind Handlungsfelder, in denen in der Freien Wohlfahrtspflege noch Nachholbedarf besteht. Bei ökologischen Themen und bei Menschenrechtsthemen weltweit hält sich die Wohlfahrtspflege häufig "vornehm zurück". Dabei sind die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit beträchtlich. Grundsätzlich wird bei der Wohlfahrtspflege der wechselseitige Zusammenhang zwischen ökologischer und sozialer Gerechtigkeit stark unterschätzt. Dabei hat ein sorgsamer Umgang mit der Umwelt unmittelbar positive Effekte auf die Lebensbedingungen der Menschen. Wenn wir als Freie Wohlfahrtspflege auf die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten weltweit achten, beugen wir im Zeitalter der Globalisierung einer Abwärtsspirale vor, die auch bei uns um der Wettbewerbsfähigkeit willen zu einem Bröckeln von Standards führt.
Im Sinne einer ganzheitlichen Perspektive plädiere ich dafür, nicht einzelne Ziele gegeneinander auszuspielen, sondern nach Lösungen zu suchen, die keine Menschengruppen benachteiligen. So darf Klimaschutz selbstverständlich nicht auf Kosten von Menschen mit geringem Einkommen gehen. Aber das heißt ja nicht, dass ambitionierter Klimaschutz zum "Feindbild" der Sozialen Arbeit werden muss.
Natürlich geht es bei der Umsetzung der SDGs nicht ohne Prioritätensetzung. Alle 17 Ziele gleichzeitig anzugehen, hieße sich zu überheben. Eine gute Wesentlichkeitsanalyse hilft dabei zu klären: Welche Ziele hängen eng mit unserem eigenen Geschäftsmodell zusammen? Wo haben wir als Freie Wohlfahrt besonders viele Möglichkeiten, Dinge zum Besseren zu wenden? An welchen Stellen sind die negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt besonders groß, wenn wir nichts tun?
Die Freie Wohlfahrtspflege sollte das Thema auf drei Ebenen gleichzeitig angehen:
• Die Unternehmen, Einrichtungen und Dienste können je für sich anfangen, ihre Handlungsmöglichkeiten auszuloten und sich zu fragen, "was geht". Gerade das Kostenargument sollte nicht dazu führen, die eigene Verantwortung und die vorhandenen Spielräume von vornherein auszublenden. Es gibt schon eine ganze Reihe Mitglieder, die sich in diesem Sinne auf den Weg gemacht haben. Mittlerweile können sie dabei auch auf zahlreiche Unterstützungsangebote zurückgreifen. Dazu zählen beispielsweise die kostenlose Ausbildung zum/r Klimamanager/in im Krankenhaus, Materialien zur Umsetzung von Klima- und Ressourcenschutz in der Großküche, das Portal "Kompass Nachhaltigkeit" des Bundesentwicklungsministeriums, das Portal zur umweltfreundlichen Beschaffung des Umweltbundesamtes und die Förderberatung Energieeffizienz des Bundeswirtschaftsministeriums.
• Die Verbände können – neben der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaktivitäten im eigenen Haus - Anlaufstellen und Multiplikatoren sein. Sie können vernetzen, eine Plattform bieten und gute Beispiele aufbereiten. Sie können bei bestimmten Themen konkrete Schwerpunkte setzen und eigene Projekte realisieren. So hat etwa die Abteilung Qualitätsmanagement/Nachhaltigkeit des AWO Bundesverbandes das Projekt "Klimafreundlich pflegen" aufgesetzt, das CSR-Kompetenzzentrum im Deutschen Caritasverband hat u.a. eine Handreichung zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung veröffentlicht und die Diakonie Deutschland hat 2018 ihr Netzwerk "Nachhaltigkeit@Diakonie" gegründet, das allen Mitgliedern der Diakonie offensteht. Außerdem legt sie derzeit einen Schwerpunkt auf das Thema "Nachhaltige Textilien", die gerade im Krankenhaus- und Pflegebereich in großen Mengen eingesetzt werden. Hier ließe sich durch gezielte Bündelung der Nachfrage viel bewegen.
• Aber auch politisch können die Verbände stärker tätig werden. Denn die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür verbessern, dass sich ein SDG-orientiertes Verhalten lohnt. Sie müsste Anreize setzen und ihre Förder- und Unterstützungsstrukturen zum Thema Nachhaltigkeit für freigemeinnützige Unternehmen ausbauen. Kostenträger müssten bei der Vergabepraxis honorieren, dass Nachhaltigkeit an der einen oder anderen Stelle (zum Beispiel bei Lebensmitteln) ihren Preis hat – und dass das auch okay ist, denn schließlich geht es um eine andere Art von Qualität.
In diesem Sinne sollten sich möglichst viele Akteure der Freien Wohlfahrtspflege in die Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie einbringen, die am 29. Oktober 2019 gestartet ist. Denn bei den Indikatoren und Maßnahmen zu den Unterzielen der SDGs, die auf nationaler Ebene festgelegt werden, ist die Expertise der Freien Wohlfahrtspflege dringend gefragt. Und wir zeigen nicht nur, dass uns das Thema der SDGs wichtig ist, sondern auch, dass wir wichtig für ihre Umsetzung sind.

Frankfurt a.M. (epd). Seit Elijah laufen kann, ist er immer wieder davongerannt. Elijah ist Autist und nimmt Dinge anders wahr als Nicht-Autisten. "Wenn andere Kinder Mama oder Papa nicht mehr sehen, dann rufen sie - aber Elijah war das völlig egal", erzählt seine Mutter Leonie Richter (Name geändert). Zwei "extreme Situationen", bei denen Elijah als kleiner Junge zeitweise verschwunden sei, hätten sie traumatisiert, sagt Richter.
Neben der Furcht, dass Elijah alleine nicht zurückfindet, sei auch immer die Angst dagewesen, dass "böse Menschen" seine schutzlose Situation ausnützen könnten. Vor anderthalb Jahren beschlossen die Richters deshalb, einen GPS-Tracker für Elijah zu kaufen, um ihren mittlerweile neunjährigen Sohn im Notfall jederzeit wiederfinden zu können. "Das GPS gibt uns jetzt einfach Sicherheit", sagt Richter. "Im Notfall kann ich nachschauen, wo er ist."
Ein GPS-Tracker überträgt die Position des Gerätes in Echtzeit. Eltern können so am Smartphone nachverfolgen, wo ihr Kind sich im Augenblick aufhält. Neben Smartphones, die grundsätzlich eine GPS-Funktion besitzen, gibt es spezielle GPS-Tracker für Kinder. Zu kaufen sind sie etwa als bunte Uhren, Anhänger für den Schulranzen oder als Einlagen für die Schuhe. Hersteller werben: Eltern wissen durch die GPS-Geräte immer, wo sich ihr Kind aufhält.
Dass Kinder verschwinden oder entführt werden könnten, gehört wohl zu den größten Ängsten von Eltern. Die intensive Berichterstattung der Medien bei Einzelfällen suggeriert laut Bundeskriminalamt ein hohes Gefährdungspotenzial für alle Kinder. Die Statistik zeigt jedoch, dass der Anteil der Kinder, deren Verbleib auch nach längerer Zeit nicht geklärt ist, sehr gering ist.
Bei Kindern im Autismus-Spektrum wie bei Elijah kann es der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, noch nachvollziehen, dass Eltern sich ein GPS-Gerät anschaffen: "Ich würde aber immer in den Vordergrund stellen - auch bei solchen Kindern - die Geräte nur zeitweise einzusetzen."
Ansonsten ist Beckmann strikt gegen GPS-Tracker. Er sieht in den Geräten eine Gefahr für die Entwicklung der Kinder: "Man behindert dadurch das Selbstständigwerden." Wichtiger sei, Kinder frühzeitig über Gefahren aufzuklären, das Verhalten gegenüber Fremden abzusprechen und klare Regeln zu vereinbaren. Zudem wendet Beckmann ein, dass Kinder durch Ortungsgeräte nicht besser geschützt seien. "Vorfälle können auch durch das Tracking nicht verhindert werden", sagt er. "Sie schaffen eher eine trügerische Sicherheit."
Obwohl die Mehrheit der Eltern ihre Kinder nicht per GPS ortet, kann sich das doch nahezu die Hälfte der Mütter und Väter vorstellen, wie eine Befragung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen im Dezember 2017 ergab. Die andere Hälfte, die sich gegen eine Nutzung von GPS-Geräten aussprach, sah in einer Überwachung ein zu starkes Eindringen in die Privatsphäre des Kindes. Außerdem fanden viele Eltern, dass man seinem Kind auch vertrauen können müsse. Rund ein Drittel der Befragten sorgte sich zudem um den Datenschutz: Sie fürchteten den Zugriff Dritter auf die Daten.
Die Kritikpunkte der befragten Eltern teilt auch Marc Urlen vom Deutschen Jugendinstitut. "Kinder von klein auf zu überwachen, ist nicht okay", findet er. Zudem kritisiert Urlen erhebliche Sicherheitsmängel bei GPS-Trackern für Kinder: "Teilweise lassen sie sich leicht von Dritten anpeilen." Ein Vergleichstest aus dem Jahr 2017 stützt Urlens Kritik: Das AV-Test Institut prüfte sechs Kinderuhren mit GPS-Funktion, und bei allen stellten die Tester "erschreckende Sicherheitslücken" fest.
Die meisten Anbieter der getesteten GPS-Kinderuhren gewährleisteten den Datenschutz nicht ausreichend. Sie sammelten neben den Standortinformationen weitere sensible Daten wie etwa Rufnummern und Vitaldaten des Kindes. Im Test zeigten sich alle Kinderuhren darüber hinaus anfällig für sogenanntes Call ID Spoofing: Dabei ist es möglich, die wahre Identität des Absenders zu verschleiern. Zeigt die Uhr dem Kind an, dass Anrufe oder Textnachrichten von Mutter, Vater oder Oma stammen, muss das nicht zwingend der Fall sein.
"Das Sicherheitsbedürfnis der Eltern wird ausgenutzt", ist sich Urlen vom Deutschen Jugendinstitut sicher. "Sehr bedenkliche Geräte werden auf den Markt geworfen, weil es eine Nachfrage gibt."
Auch an Schulen sind GPS-Tracker mittlerweile ein Thema. "Bei uns ist das Problem nach den vergangenen Weihnachtsferien aufgekommen", erzählt Anke Schneider, Schulleiterin einer Grundschule in Hessen. Nachdem immer mehr Kinder GPS-Uhren trugen, entschloss sich die Schulleitung dazu, die Ortungsgeräte erst einmal zu verbieten. "Wir sehen einfach keine Notwendigkeit, dass Kinder solche Uhren tragen", sagt Schneider.
Leonie Richter erzählt, dass es ihr nie in den Sinn gekommen sei, Elijah das GPS-Gerät mit in den Kindergarten oder in die Schule zu geben. Er trage das Ortungsgerät meist nur in den Ferien oder in einer fremden Stadt. "Im Dorf lassen wir ihm die Freiheit", sagt die Mutter von zwei Kindern. Für ihre Tochter, die keine Autistin ist, würde sie auch nie ein GPS-Gerät kaufen, betont Richter. "Klar habe ich bei beiden Kindern Angst, dass sie verloren gehen. Aber ich muss auch lernen loszulassen."
Berlin (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie lehnen den Einsatz der umstrittenen therapeutischen Spielmethode "Original Play" in evangelischen Kindertagesstätten ab. "Wir warnen, die Methode 'Original Play' zu praktizieren, da es zu Grenzüberschreitungen im Umgang mit Nähe und Distanz kommen könnte", teilten die EKD und der evangelische Wohlfahrtsverband am 28. Oktober auf Anfrage in einer gemeinsamen Erklärung mit. Pädagogische Konzepte, die durch Externe in die Kindertageseinrichtungen eingebracht werden, müssten immer zur Voraussetzung haben, dass sie das Wohl des Kindes einschließlich körperlicher und psychischer Unversehrtheit uneingeschränkt garantieren.
Hintergrund ist ein Bericht der ARD-Sendung "Kontraste" vom 24. Oktober. Darin hatten Eltern zweier evangelischer Kindertagesstätten aus Hamburg und Berlin berichtet, dass ihre Kinder im Zusammenhang mit "Original Play" sexuelle Gewalt erlebt hätten. Beim vom US-Amerikaner Fred Donaldson entwickelten Pädagogikkonzept rangeln und raufen die Kinder mit fremden Erwachsenen, es kommt zu engem Körperkontakt. 2018 soll es in einer evangelischen Kita in Berlin-Kreuzberg zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen wegen eines Mangels an Beweisen eingestellt.
Die Berliner Landeskirche erklärt auf ihrer Homepage, die Kita in Kreuzberg habe 2014 die Spielmethode in ihr pädagogisches Konzept aufgenommen. Der evangelische Träger habe erst zum 1. Januar 2017 die Kita übernommen. Er habe dann entschieden, dass das Spiel ab Mai 2018 nicht mehr gespielt wurde. Es werde zudem in keiner Kindertagesstätte dieses Kitaverbandes gespielt.
Berlin (epd). Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe - Frauen gegen Gewalt (bff) kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung über das Soziale Entschädigungsrecht (SER). Nicht alle Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Erwachsener seien darin eindeutig umfasst, teilte der Verband am 29. Oktober in Berlin mit. Er sieht die Gefahr, dass Frauen nach sexualisierter Gewalt von Leistungen ausgeschlossen werden.
Viele betroffene Frauen machten die Erfahrung, dass ihre Anträge auf Entschädigungsleistungen abgelehnt werden. Besonders problematisch sei der zu erbringende Nachweis von Ursachen und Folgen einer Gewalttat. "Die im Referentenentwurf aufgenommene Vermutungsregel ist unverzichtbar, sollte aber auch für psychosomatische Folgen gelten", erklärte die Frauenorganisation.
Betroffene hätten auch weiterhin keine Rechtssicherheit bei sexuellen Übergriffen ohne zusätzliche Gewaltanwendung. In Deutschland gelte im Strafrecht "Nein heißt Nein", dieser Grundsatz müsse auch im Entschädigungsrecht umgesetzt werden. Der Verband begrüßte, dass der Regierungsentwurf auch Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Minderjähriger umfasst.
Anträge auf Entschädigung würden meist abgelehnt, wenn Frauen sich nicht aus der gewalttätigen Beziehung herausbegeben. Es werde ihnen dann eine Mitschuld an der erlebten Gewalt gegeben.
Weil das geplante Gesetz erst ab 2024 gilt, kämen die Regelungen für viele Opfer zu spät. Taten, die zwischen 2020 und 2024 verübt werden, würden noch nach dem alten Recht beurteilt. "Es braucht daher eine Regel zu rückwirkenden Entschädigungsleistungen", fordert der Frauenverband.
Kassel (epd). Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, hat sich für die Einführung eines "Wagniskapitals" für innovative soziale Start-ups ausgesprochen. Dieses solle 25.000 Euro betragen, sagte Habeck am 29. Oktober bei der Innovationskonferenz der Diakonie Deutschland in Kassel. Bestehe mehr Bedarf, könnten sich auch mehrere Gründer zusammenschließen. Bei Erfolg solle das Kapital dann zurückgezahlt werden. Diese Kontrolle am Ende statt am Anfang eines Projektes würde viele bürokratische Hürden ersparen und Innovationen fördern.
Zudem müsse im Bereich der Wohlfahrt auch über neue Rechtsformen nachgedacht werde, sagte Habeck. Bisher werde streng zwischen kommerziellen und nichtkommerziellen Unternehmen differenziert. Es könne aber auch dem sozialen Fortschritt dienen, wenn eine gute soziale Idee umgesetzt und ein Geschäftsmodell daraus gemacht werde, sagte Habeck.
Unterstützung bekam der Chef der Grünen für seinen Vorschlag von Christian Dopheide vom Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland. Derzeit gingen viele Preisverhandlungen in der Wohlfahrt nur von einer reinen Kostenerstattung aus. "Auch soziale Unternehmen müssen Gewinn machen, um in Zukunft investieren zu können", betonte er.
Thorsten Jahnke vom "Social Impact Lab" in Berlin riet dazu, möglichst viele Akteure zusammenzubringen. Soziale Start-ups würden oft ganz anders denken und seien in der Lage, schnell zu reagieren. Es gebe schon viele gute Ideen und Start-ups, doch hätten diese in der Gesellschaft nur wenig Einfluss.
Oberwesel, St. Goar (epd). Die Krankenhäuser in St. Goar und Oberwesel im Mittelrheintal werden geschlossen. Die katholische Marienhaus-Holding könne die beiden Kliniken aus wirtschaftlichen Gründen nicht erhalten, auch nicht an einem Standort, sagte der Marienhaus-Sprecher Heribert Frieling dem Evangelischen Pressedienst (epd). Neben der Regelversorgung hätten die Häuser eine renommierte konservative Orthopädie angeboten. Während für den Standort St. Goar Ende 2019 Schluss sein soll, solle Oberwesel Ende März 2020 schließen. Von der am 25. Oktober bekanntgegebenen Schließung seien 350 Mitarbeiter betroffen. Das Loreley-Seniorenzentrum werde aber weiter betrieben.
Die Untersuchung einer Beratungsfirma habe ergeben, dass weder ein Umbau noch eine Fusion der beiden Krankenhäuser wirtschaftlich tragfähig sei, erklärte Frieling. Die gesetzlichen Neuregelungen, insbesondere die neuen Vorgaben zur Notfallversorgung und das Pflegestärkungsgesetz, das ab 2020 die Pflegebudgets ausgliedert und die Personalkosten nicht ausreichend finanziere, seien verantwortlich für die Schließung. Daneben seien es die überproportional gestiegenen Tariflöhne sowie die verstärkten Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen und dessen restriktive Leistungserstattung, die die Loreley-Kliniken finanziell in die Knie zwängen.
Parallel zur Schließung der Loreley-Kliniken werde die Marienhaus-Unternehmensgruppe mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz den Standort Bingen mit dem Heilig-Geist-Hospital stärken, versicherte der Sprecher.
Hannover (epd). Mit einem "alternativen Wohnraumgipfel" wollen Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften auf Änderungen in der Wohnungspolitik in Niedersachsen drängen. In Niedersachsen fehlten mehr als 100.000 bezahlbare Wohnungen, sagte Klaus-Dieter Gleitze von der Landesarmutskonferenz am 29. Oktober in Hannover. Der Gipfel am 4. November solle die Lage auf dem Wohnungsmarkt verdeutlichen. Dabei fließen laut Gleitze auch Daten des Pestel-Institutes ein. Die Verbände wollen Forderungen an die Landesregierung stellen.
Die Situation habe sich in Teilen des Landes dramatisch zugespitzt, sagte Gleitze. Mehr als 40 Prozent der Haushalte in Oldenburg, Hannover, Braunschweig und Osnabrück müssten mehr als 30 Prozent ihres Netto-Einkommens allein für die Miete ausgeben. Die Landesarmutskonferenz veranstaltet den Gipfel gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, dem Sozialverband Deutschland und dem Paritätischen. Unter den Organisatoren sind zudem der Deutsche Gewerkschaftsbund, ver.di, das Wohnungslosenmagazin "Asphalt", die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Gruppe "Gnadenlos Gerecht".
Kernen (epd). Die Diakonie Stetten belegt bei einer Umfrage des Frauenmagazins "freundin" und der Bewertungsplattform "kununu" zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern Deutschlands in der Branchen-Kategorie "Pflege, Gesellschaft und Soziales" Platz sechs. Der Vorstandsvorsitzende Pfarrer Rainer Hinzen freute sich: "Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir in der Diakonie Stetten bereits an vielen Stellen gute Lösungen für unsere Mitarbeitenden gefunden haben." Das sporne zu weiteren Verbesserungen an.
Die Diakonie Stetten ermöglicht unter anderem gehörten unter anderem flexible Arbeitszeiten und das Arbeiten im Home-Office. Wünsche nach Arbeit in Teilzeit würden auch auf der Führungsebene berücksichtigt, hieß es.
Die Diakonie Stetten bietet Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen und deren Familien, junge Menschen mit Förderbedarf, Menschen mit psychischer Erkrankung sowie Kinder, Jugendliche und Senioren. Sie beschäftigt dazu in ihren Diensten und Einrichtungen in sechs Landkreisen insgesamt rund 4.000 Mitarbeitende.

Erfurt (epd). Kirchliche Arbeitgeber informieren nach einem höchstrichterlichen Urteil ihre Beschäftigten oft fehlerhaft über sogenannte "Verfallsklauseln" - etwa darüber, in welcher Frist die Beschäftigten nachträglich einen höheren Lohn als vereinbart nachfordern können. Wie das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 30. Oktober urteilte, müssen die Beschäftigten schriftlich konkret über diese sogenannten Ausschlussfristen aufgeklärt werden.
Es reiche nicht aus, im Arbeitsvertrag lediglich auf die kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen Bezug zu nehmen, wenn diese entsprechende Verfallsfristen enthalten. Wie viele der über eine Million Beschäftigten bei den Kirchen und ihren Sozialunternehmen von dem Urteil genau betroffen sind, ist unklar.
Die in Arbeitsverträgen enthaltenen üblichen Ausschlussfristen legen fest, bis wann Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegenseitig Forderungen geltend machen müssen - beispielsweise bei zu wenig oder zu viel gezahltem Lohn. Wird solch eine oft drei- oder sechsmonatige Ausschlussfrist verpasst, verfällt der Anspruch.
Im jetzt entschiedenen Fall arbeitete der heute 68-jährige Kläger von 1996 bis 2016 als Küster und Reinigungskraft in einer katholischen Kirchengemeinde im Rheinland. Erst als Rentner stellte er fest, dass er von 2005 bis 2015 nach einer zu niedrigen Lohngruppe bezahlt wurde. Er verlangte daher eine Nachzahlung von rund 14.300 Euro.
Die Kirchengemeinde wies die Lohnnachschlagsforderung zurück und bezog sich auf den Arbeitsvertrag. Dieser verwies darauf, dass die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) greift. Die KAVO enthalte eine Ausschlussfrist von sechs Monaten, innerhalb derer Forderungen gegen den kirchlichen Arbeitgeber geltend gemacht werden müssen. Der Rentner habe die Frist verpasst.
Dem folgte zunächst auch das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf mit Urteil vom 10. April 2018. Werden in einen Arbeitsvertrag mit einem kirchlichen Arbeitgeber kirchenarbeitsrechtliche Regelungen des sogenannten "Dritten Weges" - hier der KAVO der katholischen Kirche - einbezogen, seien die darin enthaltenen Ausschlussfristen mit erfasst. Ein gesonderter Hinweis auf die Ausschlussfrist im Arbeitsvertrag sei nicht erforderlich.
Zwar gehe der Kläger zu Recht davon aus, dass ihm eine höhere Vergütung zugestanden hätte. Die Ansprüche seien aber wegen Ablaufs der in der KAVO enthaltenen Ausschlussfrist verfallen.
Das BAG bestätigte nun zwar, dass der Verweis auf die KAVO wirksam sei und daher auch die Ausschlussfrist formal als vereinbart gilt. Aber dem früheren Küster stehe Schadenersatz in Höhe des entgangenen Lohns zu, weil die Gemeinde ihn nicht schriftlich auf diese Frist hingewiesen hat.
Das sogenannte "Nachweisgesetz" schreibe fest, dass Arbeitgeber ihre Beschäftigten über die "wesentlichen Arbeitsbedingungen" ausdrücklich und schriftlich unterrichten müssen. Dazu gehöre etwa der Arbeitsbeginn, aber auch Ausschlussfristen, urteilte das BAG. Eine Ausnahme bestehe für Tarifverträge. Hier reiche es aus, dass im Arbeitsvertrag auf einen Tarifvertrag Bezug genommen wird, damit auch tarifliche Ausschlussfristen gelten.
Doch diese Ausnahmeklausel greife hier nicht. Denn die kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen würden nicht unter vergleichbaren Bedingungen wie ein Tarifvertrag ausgehandelt.
Im Ergebnis stehe dem Kläger daher Schadenersatz für die fehlerhafte Unterrichtung über die Ausschlussfristen in kirchlichen Arbeitsverträgen zu. Wie hoch dieser ist, soll nun das LAG prüfen.
Thomas Schwendele, Sprecher auf der Mitarbeiterseite der Zentral-KODA, die für die Ausgestaltung der Arbeitsvertragsgestaltung im Dritten Weg der katholischen Kirche zuständig ist, begrüßte die BAG-Entscheidung. "Wir gehen davon aus, dass die meisten der 750.000 Beschäftigten von katholischer Kirche und Caritas von dem BAG-Urteil betroffen sind", sagte Schwendele. Es sei die Regel, dass in den jeweiligen Arbeitsverträgen nicht ausdrücklich eine Ausschlussfrist vereinbart wurde, sondern stattdessen auf die kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien und die darin enthaltenen Fristen verwiesen werde.
Als Folge könnten Beschäftigte selbst nach Jahren noch entgangenen Lohn nachfordern. "In der Praxis werden das aber nicht so viele sein", sagte Schwendele. Außerdem könne der Dienstgeber jetzt mit dem BAG-Urteil sofort reagieren, indem er seine Beschäftigten schriftlich über die bestehenden Ausschlussfristen informiert. Schadenersatzansprüche für entgangenen früheren Lohn könnten dann nicht mehr geltend gemacht werden.
Die Diakonie Deutschland erklärte, dass sie die Begründung des BAG-Urteils "gründlich auswerten" werde. Zugleich teilte sie mit, dass in der Praxis die in den kollektiven Arbeitsrechtsregelungen der Diakonie enthaltenen Ausschlussfristen nur eine untergeordnete Rolle spielten. "Wir werden prüfen, ob gegebenenfalls die Arbeitsverträge, die in den diakonischen Unternehmen in der Regel verwendet werden, aufgrund des BAG-Urteils angepasst werden müssen und ob eine entsprechende Empfehlung an die Träger ausgegeben werden sollte", hieß es auf Anfrage.
Az.: 6 AZR 465/18
Az.: 3 Sa 144/17 (LAG Düsseldorf)

Frankfurt a.M. (epd). Verletzen Hartz-IV-Sanktionen die im Grundgesetz geschützte Menschenwürde? Ob die Jobcenter das zu gewährende menschenwürdige Existenzminimum bei Hartz-IV-Beziehern wegen Pflichtverstößen mit pauschalen Sanktionen weiter minimieren dürfen, entscheidet am 5. November das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Sozialverbände kritisieren seit Jahren die Strafen.
Von dem erwarteten Grundsatzurteil sind nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit 5,4 Millionen Menschen im Hartz-IV-Bezug betroffen, darunter rund 1,9 Millionen Personen unter 18 Jahren. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen die Jobcenter Arbeitslose "fördern und fordern" und sie möglichst schnell wieder in Lohn und Brot bringen. Doch mitunter kommen die Betroffenen den Vorgaben der Behörde nicht nach: Sie fehlen unentschuldigt bei einem Jobcenter-Termin, sie schreiben zu wenig Bewerbungen, oder sie brechen eine Weiterbildungsmaßnahme ohne ausreichende Begründung ab. In diesen Fällen kürzt die Behörde für drei Monate das Arbeitslosengeld II (monatlich 424 Euro für einen Alleinstehenden) um 10 oder 30 Prozent. Bei wiederholten Pflichtverstößen kann die Leistung um 60 Prozent oder sogar ganz gestrichen werden.
Für unter 25-Jährige sind die Sanktionen noch schärfer. Bei ihnen wird bereits beim ersten Pflichtverstoß die Regelleistung vollständig gekürzt, bei wiederholten Pflichtverstößen werden auch die Unterkunftskosten nicht mehr übernommen.
Im Jahr 2018 wurden laut Bundesagentur für Arbeit insgesamt 441.000 Hartz-IV-Bezieher mindestens einmal bestraft. In drei Viertel aller Fälle wurden Betroffene sanktioniert, weil sie unentschuldigt Meldetermine verpasst haben. Insgesamt wurden nach Angaben der Bundesregierung im vergangenen Jahr rund 900.000 neue Sanktionen an Bezieher von Arbeitslosengeld II verhängt.
Bei einer Hartz-IV-Kürzung von 60 oder mehr Prozent werde nicht mehr das zu gewährende menschenwürdige Existenzminimum gesichert, urteilte das Sozialgericht Gotha bereits im Jahr 2015. Die Sozialrichter hielten das Sanktionssystem für verfassungswidrig und legten den Rechtsstreit dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor.
In der mündlichen Verhandlung am 15. Januar dies Jahres in Karlsruhe sagte der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, dass die Zulässigkeit der Sanktionen insgesamt auf dem Prüfstand stehe. Es gehe darum, ob die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele geeignet und zumutbar für die Betroffenen seien, und nicht, ob das Sanktionssystem politisch sinnvoll sei.
Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte vor Gericht das Sanktionssystem. Der Sozialstaat müsse Mittel haben, die Mitwirkung der Leistungsbezieher einzufordern. "Zur Menschenwürde gehört auch, dass Menschen sich anstrengen. Sonst wäre das ein bedingungsloses Grundeinkommen", sagte Heil. Das wolle er nicht.
Susanne Böhme, Anwältin des vom Jobcenter bestraften Klägers, argumentierte, dass starre Sanktionen für drei Monate keine Verhaltensänderung beim Leistungsbezieher bewirken. "Sanktionen treffen in der Praxis häufig Menschen, die sich nicht ausdrücken können, und nicht diejenigen, die sich drücken", mahnte Friederike Mussgnug von der Diakonie. Überforderung, Krankheit, Depression, familiäre Konflikte oder Verständnisprobleme seien oft die eigentlichen Ursachen für sogenannte Pflichtverstöße.
Die Front der Sanktionsbefürworter scheint zu bröckeln. So hatte im April 2019 der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, Änderungen zumindest bei den schärferen Sanktionen gegen Jugendliche verlangt. Mit Blick auf eine mögliche Streichung der Unterkunftskosten durch das Jobcenter sagte Scheele: "Drohende Wohnungslosigkeit hilft uns nicht weiter. Wir verlieren die jungen Menschen dann aus den Augen und können uns nicht mehr kümmern."
Az.: 1 BvL 7/16
Az.: S 15 AS 5157/14 (Urteil des Sozialgerichts Gotha)
Karlsruhe (epd). Asylbewerber dürfen während ihres Asylverfahrens und auch nach ihrer Anerkennung in einem EU-Mitgliedstaat keiner unmenschlichen Behandlung ausgesetzt sein. Bevor deutsche Behörden einen nach Deutschland weitergereisten Flüchtling wieder in das Ersteinreise-Land abschiebt, müssen sie daher vorgebrachte Vorwürfe unmenschlicher Bedingungen für anerkannte Flüchtlinge in dem jeweiligen Staat auf den Grund gehen, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am 29. Oktober veröffentlichten Beschluss.
Im konkreten Fall war ein afghanischer Asylbewerber zunächst nach Griechenland geflohen und wurde dort im Juni 2018 als Asylsuchender registriert. Kurze Zeit später reiste er nach Deutschland weiter und stellte einen neuen Asylantrag.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnte den Asylantrag als unzulässig ab, da Griechenland als Erstaufnahmestaat für das Asylverfahren zuständig sei. Griechenland stimmte der Übernahme des Asylbewerbers zu.
Der Flüchtling erklärte, die Aufnahmebedingungen in Griechenland seien so schlecht, dass ihn eine unmenschliche oder entwürdigende Behandlung erwarteten. Von der Situation seien nicht nur Asylbewerber während ihres Asylverfahrens betroffen, sondern auch anerkannte Flüchtlinge.
Das Verwaltungsgericht billigte jedoch die Überstellung des Mannes nach Griechenland. Dem Mann drohe während des Asylverfahrens in Griechenland keine Verletzung der EU-Grundrechte-Charta. Das Verbot einer unmenschlichen Behandlung beziehe sich nach der EU-Rechtsprechung nur auf das Asylverfahren und nicht auf die Situation von Flüchtlingen nach deren Anerkennung.
Dem widersprach nun das Bundesverfassungsgericht und wies das Verfahren zum Verwaltungsgericht zurück. Die Entscheidung stehe im krassen Widerspruch zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes EuGH und sei daher willkürlich.
Benenne ein Asylbewerber konkrete Anhaltspunkte für eine drohende unmenschliche Behandlung von anerkannten Flüchtlingen in dem zuständigen EU-Mitgliedstaat, müssten dies deutsche Gerichte prüfen. Dies sei hier unterlassen worden. Sei von einer menschenunwürdigen Behandlung der Betroffenen auszugehen, sei Deutschland für das Asylverfahren zuständig.
Az.: 2 BvR 721/19
Kassel (epd). Hartz-IV-Bezieher können bei einem Umzug vom Jobcenter die Kostenübernahme von zwei Mieten verlangen. Ist die "Doppelmiete" umzugsbedingt unvermeidbar und angemessen, muss die Behörde sie übernehmen, urteilte das Bundessozialgericht (BSG) am 30. Oktober in Kassel. Was genau unter "unvermeidbar und konkret angemessen" zu verstehen ist, ließ das BSG jedoch offen.
Im konkreten Fall hatte eine Mutter von zwei Kindern eine zu kleine Wohnung mit nur 54 Quadratmetern in Bonn bewohnt. Vom Jobcenter erhielt sie daher die Zustimmung für den Umzug in eine neue Wohnung. Den entsprechenden Mietvertrag schloss sie zum 1. Juli 2014 ab. Da die neue Wohnung noch renoviert werden musste, verzögerte sich der Umzug. Die Familie zog erst am 19. Juli um, die alte Wohnung wurde am 31. Juli 2014 übergeben.
Das Jobcenter übernahm zwar die Mietkosten für die neue Wohnung, nicht aber die angefallene Miete für die alte Unterkunft. Bei solch einer Doppelmiete handele es sich um "Wohnungsbeschaffungskosten". Diese könnten nur nach vorheriger Zusicherung des Jobcenters übernommen werden. Die Hartz-IV-Bezieherin hatte dies aber vor ihrem Umzug nicht beantragt.
Die Klägerin meinte, dass eine vorherige Zustimmung des Jobcenters nicht erforderlich sei. Die Behörde müsse nach dem Gesetz tatsächlich angefallene Unterkunftskosten übernehmen. Darunter falle auch eine Doppelmiete wegen eines Umzugs.
Das BSG urteilte, dass auch ohne vorherige Zustimmung eine Doppelmiete vom Jobcenter übernommen werden könne. Voraussetzung hierfür sei, dass diese "unvermeidbar und konkret angemessen" sei. Ob das hier der Fall war und warum etwa der Umzug oder die Renovierung nicht früher stattfinden konnte, muss nun das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen prüfen.
Az.: B 14 AS 2/19 R
Kassel (epd). Familien mit geringen Einkünften darf wegen einer Wohngeldnachzahlung nicht einfach der beantragte Kinderzuschlag verweigert werden, urteilte am 30. Oktober das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.
Der aus Niedersachsen stammende Kläger sowie seine Ehefrau und ihre fünf Kinder lebten von geringen Einkünften und Kindergeld. Einen Hartz-IV-Antrag hatten sie nicht gestellt. Der Vater beantragte bei der Familienkasse jedoch den Kinderzuschlag. Im Streitjahr 2016 wären dies für ihn maximal 700 Euro gewesen.
Der Kinderzuschlag soll verhindern, dass Eltern allein wegen ihrer Kinder in den Hartz-IV-Bezug rutschen. Wie hoch dieser ist, hängt vom Einkommen und Vermögen ab. Derzeit werden pro Kind höchstens 185 Euro gezahlt.
Im konkreten Fall verweigerte die Familienkasse die Zahlung des Kindergeldes. Das nachgezahlte Wohngeld in Höhe von 180 Euro sei nicht als Einkommen zu werten. Dies führe dazu, dass die Familie das erforderliche Mindesteinkommen von 900 Euro um sechs Euro verfehle. Damit hätten sie wegen Hilfebedürftigkeit Anspruch auf Hartz IV gehabt, nicht aber auf den Kinderzuschlag.
Vor dem BSG bekam der Kläger jedoch recht. Die Wohngeldnachzahlung stelle zu berücksichtigendes Einkommen dar und müsse im Zuflussmonat berücksichtigt werden, entschied das BSG.
Az.: B 4 KG 1/19 R
Kassel (epd). Die Krankenkasse muss bei schweren oder tödlich verlaufenden Krankheiten nicht automatisch für die Kostenübernahme alternativer Behandlungsmethoden einspringen. Bei hohen Risiken der Alternativbehandlung kann auch eine auf Schmerzlinderung und Lebensqualität abzielende Therapie bevorzugt werden, urteilte am 8. Oktober das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Damit muss das Uniklinikum Tübingen im Fall einer Leukämie-Patientin fürchten, auf den Kosten einer Stammzelltransplantation sitzenzubleiben.
Die Patientin wurde zunächst mit Bluttransfusionen behandelt. Im September 2008 wurde dann bei der 74-jährigen Patientin eine Stammzelltransplantation gemacht. 20 Tage später starb sie.
Die Klinik stellte der DAK-Gesundheit die Behandlungskosten für die Stammzelltransplantation in Höhe von knapp 117.000 Euro in Rechnung. Der Betrag wurde zunächst gezahlt.
Doch nach Einholung eines Gutachtens machte die Kasse einen Rückzieher. Es bestehe kein Leistungsanspruch, da die Behandlung einen "experimentellen Charakter" hatte und nur innerhalb einer klinischen Studie hätte erfolgen dürfen.
Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg gab der Klage des Uniklinikums statt und begründete das Urteil mit dem sogenannten Nikolausbeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005. Danach müssen Krankenkassen auch nicht anerkannte Heilmethoden bezahlen, wenn es eine "nicht ganz entfernt liegende Aussicht" auf Heilung oder Linderung besteht und eine anerkannte Alternativbehandlung nicht zur Verfügung steht.
Das BSG hob das LSG-Urteil jedoch auf und verwies den Rechtsstreit zurück. Auch bei lebensbedrohlichen Krankheiten leite sich aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht ein Anspruch auf jegliche Behandlung ab, erklärten die obersten Sozialrichter.
Hier habe ein besonders großes Sterberisiko bestanden. Es habe bei der Operation bei 30 Prozent und das Risiko eines tödlichen Rückfalls bei 35 Prozent gelegen. Weise der kurative Behandlungsansatz jedoch solch ein hohes Sterberisiko auf, müsse geprüft werden, ob nicht ausnahmsweise eine Palliativbehandlung "einen zeitlich größeren Überlebensvorteil eröffnet".
Über die Möglichkeiten und Risiken beider Wege müsse die Klinik umfassend aufklären, so das BSG. Das LSG müsse daher nun Feststellungen treffen, ob eine Palliativbehandlung vorrangig gewesen wäre und ob die Patientin in die Stammzelltransplantation überhaupt wirksam eingewilligt hatte.
Az.: B 1 KR 3/19 R
Az.: 1 BvR 347/98 (Beschluss des Bundesverfassungsgerichts)
Kassel (epd). Sehbehinderte Menschen können das Merkzeichen "Bl" für "blind" in ihrem Schwerbehindertenausweis nur bei Störungen des Sehapparates beanspruchen. Menschen, die etwa wegen einer hirnorganischen Störungen Sehreize nicht richtig verarbeiten können, haben keinen Anspruch auf das Merkzeichen "Bl", urteilte am 24. Oktober das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel.
In dem Fall hatte ein zwölfjähriges Mädchen mit einer ausgeprägten Stoffwechselstörung geklagt. Wegen dieser Erkrankung war sie zu einer differenzierten Sinneswahrnehmung nicht in der Lage und zeigte auch keinerlei Interesse an optischen Reizen. Beim Land Niedersachsen beantragte das zu 100 Prozent als Schwerbehinderte anerkannte Mädchen das Merkzeichen "Bl" für "blind" in ihrem Schwerbehindertenausweis. Das Merkzeichen dient vor allem dazu, Ansprüche auf Blindengeld geltend zu machen.
Das Land lehnte die Erteilung des Merkzeichens ab. Nach der Versorgungsmedizin-Verordnung müsse eine blinde Person wegen einer Schädigung am Sehapparat blind sein. Dies sei hier nicht belegt.
Die Klägerin verwies dagegen auf ein Urteil des BSG aus dem Jahr 2015 (Az.: B 9 BL 1/14 R). Danach könne für den Anspruch auf das bayerische Landesblindengeld auch jemand als blind gelten, der wegen einer hirnorganischen Störung Sehreize nicht verarbeiten kann und damit faktisch blind sei. Dies müsse bei der Erteilung des Merkzeichens auch gelten.
Das BSG stellte nun klar, dass Bayern beim Anspruch auf das Landesblindengeld nach den Landesvorschriften einen anderen Blindheitsbegriff zugrunde legt. Bei der Erteilung des Merkzeichens "Bl" gelte jedoch die Versorgungsmedizin-Verordnung. Diese setze für "Blindsein" eine Störung des Sehapparats voraus.
Den konkreten Fall verwies das BSG an die Vorinstanz zurück. Dies müsse noch prüfen, ob die Klägerin nicht doch wegen einer Störung der Sehrinde im Gehirn nicht sehen kann. In diesem Fall würde eine "Blindheit" für die Erteilung des Merkzeichens "Bl" vorliegen. In Niedersachsen ist dies Voraussetzung für den Anspruch auf Blindengeld.
Az.: B 9 SB 1/18 R
Münster (epd). Wer regelmäßig im Wechsel drei Monate in Deutschland als Pflegekraft arbeitet und dazwischen zwei Monate in der polnischen Heimat lebt, hat keinen Anspruch auf deutsches Kindergeld. Denn die Pflegekraft hat nach diesem Arbeitsmodell keinen erforderlichen festen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Deutschland, entschied das Finanzgericht Münster in einem am 15. Oktober bekanntgegebenen Urteil.
Damit scheiterte eine polnische Betreuungskraft mit ihrer Klage. Die Frau wurde von einer deutschen Firma in Polen angeworben und an ein pflegebedürftiges älteres Ehepaar in Deutschland vermittelt. Sie arbeitete auf selbstständiger Basis als Franchisenehmerin der Firma.
Ab 2015 war sie bei dem älteren Ehepaar tätig. Nach dem Tod des Mannes betreute die Pflegekraft die Witwe bis zu deren Tod im Februar 2016. Dabei lebte sie in drei Blöcken von jeweils etwa drei Monaten mit im Haus der Senioren. Dazwischen kehrte sie für jeweils zwei Monate zu ihrer Familie nach Polen zurück.
Wegen ihrer Tätigkeit in Deutschland beantragte sie für ihren in Polen lebenden Sohn deutsches Kindergeld. Die Familienkasse lehnte dies ab.
Zu Recht, wie das Finanzgericht entschied. Denn wegen des ständigen Wechsels zwischen Deutschland und Polen habe die Pflegekraft in Deutschland keinen festen Wohnsitz oder einen "gewöhnlichen Aufenthalt". Dies sei aber für einen Kindergeldanspruch erforderlich.
Für einen "gewöhnlichen Aufenthalt" seien die Unterbrechungen von zwei Monaten gemessen an den Arbeitsaufenthalten in Deutschland von drei Monaten zu lang. Auch einen festen Wohnsitz habe die Seniorenbetreuerin nicht gehabt. Denn die Nutzung eines Zimmers und eines Bads im Haus der Senioren sei immer nur für die Betreuungszeiten vereinbart gewesen. Während ihrer Aufenthalte in Polen seien Zimmer und Bad von einer anderen Betreuerin genutzt worden.
Az.: 5 K 3345/17 Kg
Düsseldorf (epd). Wer medizinisches Cannabis zu sich nimmt, darf trotzdem Auto fahren. Ein Führerschein steht auch Cannabis-Patienten zu, wie das Verwaltungsgericht Düsseldorf am 24. Oktober urteilte. Der Rhein-Kreis Neuss hatte es abgelehnt, dem Mann eine neue Fahrerlaubnis auszustellen. Dagegen hatte er geklagt - und Recht bekommen.
Nach Ansicht der Richter können Menschen, die ärztlich verschriebenes medizinisches Cannabis einnehmen, anders als illegale Konsumenten, in der Lage sein, Auto zu fahren. Der Kläger könne eine Fahrerlaubnis erhalten, wenn er auch unter Wirkung des Mittels ausreichend leistungsfähig sei. Ein Gutachten habe die Leistungsfähigkeit des Mannes unter Cannabiswirkung bestätigt. Daher bestehe ein Anspruch auf einen neuen Führerschein.
Für die Frage der Fahreignung kommt es laut Urteil unter anderem darauf an, dass der Patient Cannabis zuverlässig nur nach der ärztlichen Verordnung nimmt. Zudem müsse der Betroffene verantwortlich mit dem Medikament umgehen. Die Leistungsfähigkeit dürfe nicht dauerhaft beeinträchtigt sein. Diese Voraussetzungen erfülle der Kläger, urteilten die Richter.
Außerdem dürfe ihm nicht auferlegt werden, sich regelmäßig erneut untersuchen zu lassen. Wegen möglicher Langzeitschäden von Cannabis dürfe ihn die Fahrerlaubnisbehörde jedoch in einiger Zeit erneut auffordern, seine Eignung wieder nachzuweisen. Über eine mögliche Berufung entscheidet das Oberverwaltungsgericht in Münster.
Az.: 6 K 4574/18

Berlin (epd). Ina Czyborra ist neue Landesvorsitzende der Berliner AWO. Die gebürtige Berlinerin folgt damit auf Ute Kumpf, die bereits im vergangenen Jahr aus persönlichen Gründen zurückgetreten ist. Czyborra zur Seite stehen die stellvertretenden Landesvorsitzenden Manfred Brand, Arvid Krüger, Anita Leese-Hehmke, Klaus Leonhardt, Manfred Nowak, Rainer Rheinsberg und Thomas Scheunemann.
"Ich möchte der AWO in Berlin ein Gesicht verleihen. Die AWO soll in meiner Amtszeit sichtbarer und lauter werden", sagte Czyborra in ihrer Antrittsrede am 26. Oktober. Auch den Erneuerungsprozess des Berliner Sozialverbandes möchte sie vorantreiben: "Wir müssen die sozialen Fragen in dieser Stadt neu stellen. Wie gehen wir mit den unterschiedlichen Ressourcen unserer Gesellschaft um? Wie begegnen wir dem Fachkräftemangel in den Bereichen Pflege und Kita?", fragte die neue Vorsitzende.
Ina Czyborra studierte Prähistorische Archäologie und Geschichte an der Freien Universität (FU) Berlin und in Bonn. 2001 promovierte sie an der FU. Czyborra ist Inhaberin der Firma IT-Event und seit 2011 ist sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Das Amt der stellvertretenden Landesvorsitzenden der Berliner SPD übt sie seit 2018 aus.
Bei der AWO in Berlin und ihren korporativen Mitgliedern sind rund 8.100 Mitarbeitende beschäftigt. Sie zählt derzeit rund 6.000 Mitglieder.
Rita Süssmuth (82) ist mit dem Ehrenring des Landschaftsverbands Rheinland ausgezeichnet worden. Die langjährige Bundestagspräsidentin erhielt die Ehrung für ihr "umfängliches und vielschichtiges Engagement sowie ihren Einsatz für Lösungen gesellschaftspolitischer Herausforderungen". Die CDU-Politikerin engagierte sich vor allem in den Bereichen der Frauen- und Familienpolitik, Integration und Migration, internationale Zusammenarbeit, Bildungspolitik und im Kampf gegen HIV. Süssmuth war im Kabinett von Bundeskanzler Helmu Kohl (CDU) Ministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit.
Thomas Greiner ist von der Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes Pflege für weitere zwei Jahre als Präsident in seinem Amt bestätigt worden. Jörg Braesecke, Friedhelm Fiedler und Axel Hölzer wurden ebenfalls einstimmig als Vizepräsidenten wiedergewählt. Greiner, Braesecke (Unternehmen Kursana/Dussmann) und Fiedler (Unternehmen Pro Seniore/Victor´s Group), zugleich Sprecher des Verbandes, gehören dem Präsidium seit Gründung des AGVP 2009 ohne Unterbrechung an. Axel Hölzer (Dorea-Gruppe) ist seit Juni 2018 dabei.
Franz Wagner, Präsident des Deutsche Pflegerates (DPR), hat die Ehrendoktorwürde der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) erhalten. "Franz Wagner hat sich um die Entwicklung und Innovation der Pflege zum Wohle der zu Pflegenden und der Pflegenden national wie international außerordentlich verdient gemacht", sagte Professor Frank Weidner, Lehrstuhlinhaber an der PTHV. Außerdem habe er sich maßgeblich für die Akademisierung der Pflege in Deutschland eingesetzt.
Steffen Waldminghaus ist neuer Präses des Dachverbandes der Christlichen Vereine Junger Menschen (CVJM) in Deutschland. Der 47-Jährige (47) wurde in Hofgeismar gewählt und folgt auf Karl-Heinz-Stengel, der den ehrenamtlichen Vorsitz 16 Jahre innehatte. Der CVJM ist nach eigenen Angaben die weltweit die größte überkonfessionelle christliche Jugendorganisation. In Deutschland hat der CVJM 330.000 Mitglieder und regelmäßige Teilnehmer. Schwerpunkt ist die örtliche Jugendarbeit in 2.200 Vereinen, Jugendwerken und Jugenddörfern.
Axel Radlach Pries ist als Dekan der Berliner Charité für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden. Damit führt der Professor für Physiologie sein Amt als Dekan fort, das er am 1. Januar 2015 angetreten hat. Seit der Fusion der Charité mit dem Universitätsklinikum Benjamin Franklin im Jahr 2003 war Pries bis zu seiner Wahl zum Dekan Mitglied des Fakultätsrats der Hochschule.
Oliver Wittke (53) ist vom Vorstand des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) zum neuen Hauptgeschäftsführer berufen worden. Der derzeitige Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und CDU-Bundestagsabgeordnete soll sein Amt im Herbst 2020 antreten. Er folgt auf den Geschäftsführer Klaus-Peter Hesse, der den Verband nach elf Jahren verlässt.
5.11. Berlin:
Symposium "360 Grad Pflege - Qualifikationsmix für den Patienten - in der Praxis"
Tel.: 0221/46861-30
6.11. Frankfurt a.M.:
Fachtag "Die Bedeutung von kultursensibler Arbeit in der Behindertenhilfe"
Tel.: 069/174892 800
6.-8.11. Berlin:
Seminar "Handwerkszeug für gelingende Netzwerkarbeit - Qualifizierung für Migrationsfachdienste"
Tel. 030 26309-0
12.-13.11. Paderborn:
Tagung "Grundlagen der Personaleinsatzplanung in der stationären Altenhilfe"
der IN VIA-Akademie
Tel. 05251/2908-38
13.11. Berlin:
Tagung "Tag der Pflegereform"
der Initiative Pro-Pflegereform
Tel.: 0711/63676-120
13.-14.11. Berlin:
Tagung "Tax Compliance in Kirche und Diakonie - Steuern im Griff, Tax-Compliance Management Systeme aufsetzen!"
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-488
14.11. Berlin:
Kongress "Betreutes Seniorenwohnen"
der BFS Service GmbH, Bank für Sozialwirtschaft und Kuratorium Deutsche Altershilfe
Tel.: 0221/97356-160
14.-15.11. Berlin:
Symposium "Jetzt wird's personell - Wer pflegt die kommenden Generationen?"
des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege
Tel.: 030/83001-267
21.11. Bremen:
Fachtag "Gewaltprävention - Let's talk about Sex!-uelle Gewalt! Zwischen Liebe, Lust und Übergriffen. Professioneller Umgang mit sexueller Gewalt als Alltagsphänomen in sozialen Einrichtungen"
der fj Prävention
21.11. Berlin:
Fachtagung "Demenz"
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 03048837-495
26.-27.11. Berlin:
Fortbildung "Was geht noch? Möglichkeiten des Aufenthalts nach Abschluss des Asylverfahrens"
Tel. 030/48837-495
28.11. Paderborn:
Seminar "Trauernde Menschen achtsam begleiten"
der IN VIA-Akademie
Tel. 05251/2908-38
28.11. Steinfurt:
Seminar "Keine Krise mit der Krise - Hilfreich bleiben auch in Ausnahmesituationen"
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
3.12. Frankfurt a.M.:
Fachtag "Fit for Future?"
des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-236
9.12. Berlin:
Seminar "Die Personalgewinnung und -bindung in der Pflege unter den Herausforderungen des Pflegeberufegesetzes"
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V.
Tel.: 030/62980-605