Kirchen
Kirchen rufen in Corona-Krise zu "Schulterschluss" auf

epd-bild/Vatican Media/Agenzia Siciliani
Rom (epd). Die großen Kirchen haben an Ostern zu Zuversicht und zu einem Schulterschluss aller in der Corona-Krise aufgerufen. Papst Franziskus feierte am 12. April die Ostermesse im leeren Petersdom und gedachte besonders der Corona-Opfer und der Flüchtlinge. Das katholische Kirchenoberhaupt rief angesichts der Pandemie weltweit zu einer Waffenruhe auf und erteilte den Segen "Urbi et Orbi" (der Stadt und dem Erdkreis) ohne Tausende Pilger auf dem Petersplatz. Die Messe wurde live in Internet und Rundfunk übertragen. Auch die Ostergottesdienste in Deutschland fanden in leeren Kirchen statt.
In seiner Osterbotschaft sagte Franziskus, die Familien der Menschen, die durch die Lungenkrankheit Covid-19 gestorben seien, hätten sich oft nicht von ihnen verabschieden können. Der Papst gestand ein, dass in diesem Jahr viele Gläubige ein "einsames Osterfest, inmitten von Trauer und Nöten, von körperlichem Leid bis hin zu finanziellen Schwierigkeiten" feierten. Viele Menschen sorgten sich angesichts der Corona-Krise um eine ungewisse Zukunft und um ihren Arbeitsplatz.
Wegen der Pandemie sieht der Papst die Europäische Union vor einer "epochalen Herausforderung, von der nicht nur ihre Zukunft, sondern die der ganzen Welt abhängt". Um diese zu meistern, seien auch "neue Wege" erforderlich, sagte er und warnte vor nationalem Egoismus. Zugleich forderte der Papst, der Krieg in Syrien, der Konflikt im Jemen und die Spannungen im Irak sowie im Libanon müssten endlich ein Ende haben.
Stream aus dem Berliner Dom
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief die Menschen zu gegenseitigem Beistand auf. Wer auf die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu Christi vertraue, der solle sie schon jetzt mit seinem Herzen und seinen Händen bezeugen, sagte der bayerische Landesbischof in seiner im Internet übertragenen Predigt im Berliner Dom. Er rief dazu auf, Menschen aus Flüchtlingslagern herauszuholen, in denen eine humanitäre Katastrophe drohe. Weltweit sei Solidarität mit den Ärmsten und Verletzlichsten geboten.
Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, rief ebenfalls zu Solidarität mit den Schwachen und Armen und den von der Corona-Epidemie besonders hart betroffenen Regionen auf. Die belastenden Jahre, die nun bevorstünden, könnten nur "im Schulterschluss aller in Europa und weltweit so gemeistert werden, dass sie die Ungleichheit und Ungerechtigkeit dieser Erde nicht noch vergrößern", sagte er in seiner Osterpredigt im Limburger Dom.
Nach Worten des lutherischen Superintendenten der Lippischen Landeskirche, Andreas Lange, ermutigt Ostern auch in Zeiten von Corona zu einem Blick nach vorn. Auch das Virus könne nicht daran rütteln, dass mit Ostern der Sieg des Lebens gefeiert werde, sagte Lange am Ostermontag in einem von der ARD ausgestrahlten Gottesdienst aus Lemgo "Wir stehen in einer traurigen Solidarität mit der ganzen Welt", sagte er.
Ökumenisches "Wort zum Sonntag"
In einem gemeinsamen ökumenischen "Wort zum Sonntag" verwiesen Bedford-Strohm und Bätzing auf die Auferstehung Jesu Christi: "Es gibt Hoffnung. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit", sagte Bedford-Strohm. Bätzing sagte: "Gott ist wirklich für alle Menschen da, er will Ihnen nahe sein in allen Sorgen." Er rief dazu auf, an die Menschen zu denken, denen es schlechter geht, die im Krankenhaus liegen oder die in anderen Ländern noch mehr von der Krise betroffen sind.
An vielen Orten in Deutschland beteiligten sich am 12. April Musikerinnen und Musiker an der Aktion "#osternvormbalkon" und ließen um 10.15 Uhr das Osterlied "Christ ist erstanden" von Balkonen, in Vorgärten und aus Fenstern erschallen. Der Flashmob des Posaunenwerks Hannover und des Evangelische Posaunendienstes in Deutschland wurde am Ende des ZDF-Fernsehgottesdiensts gezeigt, Fotos und Videos der Aktion gepostet.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dankte den Deutschen für Disziplin und Einsatz in der Corona-Krise. "Ich bin tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat", sagte er in einer am Samstagabend ausgestrahlten Fernsehansprache. Er rief zu Vertrauen in die Demokratie auf, warb um Solidarität und bat um weiteres Engagement.
"Noch ist die Gefahr nicht gebannt", betonte der Bundespräsident. "Aber schon heute können wir sagen: Jeder von Ihnen hat sein Leben radikal geändert, jeder von Ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet und rettet täglich mehr." In diesen Tagen zeige sich Deutschland als "lebendige Demokratie mit verantwortungsbewussten Bürgern".
Kirchen in NRW betonen Hoffnung und Erkenntnisgewinn
Auch Vertreter der beiden großen christlichen Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben in ihren Osterpredigten in Zeiten der Corona-Pandemie die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu als Zeichen der Liebe, des Lebens und der Hoffnung betont. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, äußerte sich überzeugt, dass Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie auch nach der Krise nicht so schnell wieder vergessen würden. "Wir achten darauf, dass die Schwachen und gefährdeten nicht auf der Strecke bleiben", sagte er in der Wuppertaler Philippuskirche. Ostern sei Gottes Angriff auf den stärksten Feind, den Tod. Und wo der Tod seine Macht verliere, seien Kettenreaktionen der Hoffnung möglich.
Der Lippische Landessuperintendent Dietmar Arends sieht in der Osterbotschaft eine Ermutigung, in Zeiten der Corona-Pandemie für andere Menschen da zu sein. Mit Ostern, an dem Christen die Auferstehung Jesu feiern, würden Menschen mit der Hoffnung erfüllt, dass das Leiden nicht das Endgültige sei, sagte Arends dem Evangelischen Pressedienst (epd). Aus den Jüngern, die nach der Kreuzigung Jesu verängstigt gewesen seien, seien Boten österlicher Hoffnung geworden. "Das sollte uns Mut geben, für die Menschen in dieser Zeit da zu sein und ihnen zur Seite zu stehen und so auch zu Boten der Hoffnung zu werden."
Der Essener Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck mahnte einen neuen Umgang mit Solidarität und Verteilungsgerechtigkeit an. "Wir werden Solidarität neu lernen müssen, wenn es gilt, die sozioökonomischen Folgen zu überwinden", sagte er in Mülheim an der Ruhr. Die Corona-Krise sei eine Chance zur Einsicht, wie Ökonomie, Ökologie und Soziales neu zusammenkommen könnten.
"Osterbotschaft mit in den Alltag zu nehmen"
Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki appellierte an die Menschen, zentrale Fragen nach dem Sinn von Leid, Sterben und dem Leben gerade in diesen Tagen zuzulassen. Schwere Erkrankungen, Sterbefälle, Folgen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit machten vielen zu schaffen. Die Osterbotschaft zeige, wie ein einziges Wort eine Situation von Grund auf verändern könne. "Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist besiegt."
Der Bischof von Münster, Felix Genn, rief dazu auf, die Osterbotschaft mit in den Alltag zu nehmen. Viele Christen täten dies bereits und seien politisch aktiv. Sie setzten sich für den Schutz des Lebens ein, wehrten sich gegen die Anfänge der Kriege. Auch im Bistum Münster entwickele sich besonders in diesen Tagen eine große Solidarität in den Gemeinden, den Nachbarschaftshilfen, im Dienst für die Kranken und dem Schutz für die Schwächsten. Auch der Paderborner Erzbischof, Hans-Josef Becker, betonte, Christen sollten gerade in Krisenzeiten die frohe Botschaft von Ostern als Botschaft der Hoffnung weitertragen.
Präses Kurschus: Jesus bleibt den Menschen nah

epd-bild//Gerd-Matthias Hoeffchen
Ingelheim (epd). Die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat in ihrer Osterpredigt Verständnis für die Kontaktsperren in der Corona-Krise geäußert. Viele Menschen sehnten sich danach, einander nah zu sein, sich zu berühren und berührt zu werden, sagte die westfälische Präses am 12. April in im rheinland-pfälzischen Ingelheim im ZDF-Fernsehgottesdienst. Zurzeit sei das leider schwierig. "Einander-nah-sein ist jetzt vor allem gefährlich, ansteckend, verboten", sagte Kurschus laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. In mancher Wohnung, in mancher Beziehung, in manchem Flüchtlingslager verkehre sich das in quälende Enge, in gewaltsame Übergriffe und bedrängende Not.
Die Nähe Jesu zu den Menschen wirkt nach Worten von Kurschus auch ohne Berührungen. Die Nähe bleibe auch dann gewiss, "wenn wir uns - so wie jetzt - körperlich nicht nah sein können oder dürfen", sagte die leitende Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen. Es sei eine Nähe, die mehr sei als Anfassen und Umarmen. Ostern sei anders, es verändere die Menschen und die ganze Welt, sagte Kurschus: "Wie auch immer uns unsere Wege führen: Wir gehen auf das Leben zu."
Rekowski für ethische Debatte über Rückkehr zur Normalität

epd-bild/Hans-Jürgen Vollrath
Düsseldorf (epd). Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, fordert eine intensive ethische Debatte über eine Lockerung oder Aufhebung des teilweisen Shutdown in Deutschland. "Die Einschränkungen sind die Reaktion auf eine Notstandssituation und kein Akt staatlicher Willkür, deshalb müssen wir sie akzeptieren", sagte Rekowski dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es gelte alles zu tun, was eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert. "Dennoch drängt sich die Frage auf, wann wir uns wieder einer Normalsituation nähern."
Dabei gehe es um sehr komplexe ethische Fragen, sagte der leitende Theologe der zweitgrößten deutschen Landeskirche. Grundsätzlich gelte die Würde jedes Menschen ohne Wenn und Aber. "Es ist aber nicht immer einfach zu sagen, wer die Schwachen sind, die geschützt werden müssen", betonte Rekowski. Dazu gehörten selbstverständlich die Risikogruppen - Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. "Aber es gibt auch eine Verantwortung für Menschen, die aufgrund der Einschränkungen und der damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen ihre Existenz zu verlieren drohen."
Das Gleiche gelte für Kinder, die in prekären Verhältnissen lebten und denen als Folge der Kontaktsperre häusliche Gewalt drohe. Auch ärmere Leute drohten wegen eines schlechteren Zugangs zu Hilfsangeboten auf der Strecke zu bleiben, Obdachlose hätten es besonders schwer und seien äußerst gefährdet.
"Hier helfen keine einfachen und auch keine pauschalen Antworten", unterstrich Rekowski. "Die ethischen Debatten darüber müssen intensiv geführt werden." Er vertraue darauf, "dass die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger in den nächsten Wochen verantwortliche Entscheidungen treffen werden".
EKD-Kirchen erwarten Kirchensteuer-Minus bis zu 15 Prozent
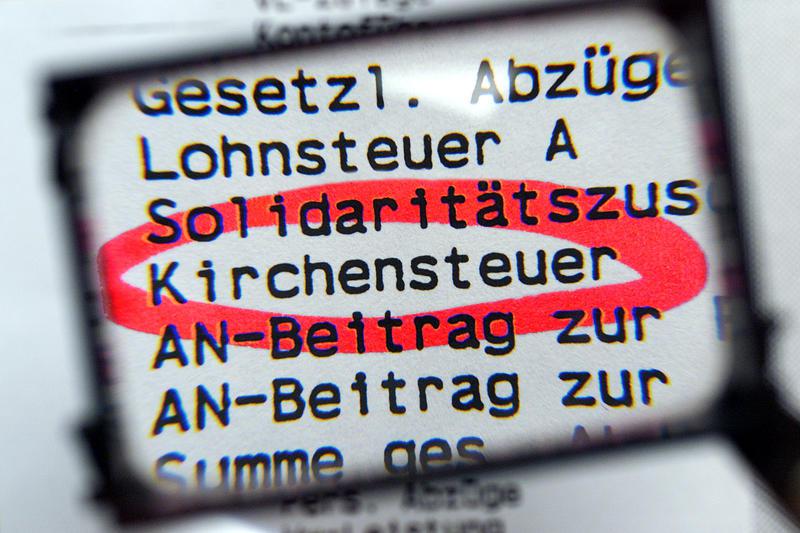
epd-bild / Norbert Neetz
Düsseldorf (epd). Die evangelischen Kirchen in Deutschland stellen sich wegen der Coronakrise auf einen drastischen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen in diesem Jahr ein. "Wir sind von den Auswirkungen ebenso betroffen wie alle anderen gesellschaftlichen Bereiche und rechnen mit deutlichen Einbußen in diesem Jahr", sagte der rheinische Präses Manfred Rekowski dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Es gibt zwar noch keine seriösen Prognosen, aber wir rechnen EKD-weit derzeit mit einem Minus von 10 bis 15 Prozent."
"Das Kurzarbeitergeld ist steuerfrei, damit entfällt auch die Kirchensteuer", erläuterte Rekowski. In Nordrhein-Westfalen werde Unternehmen zudem die Möglichkeit eingeräumt, Steuerzahlungen aufzuschieben - auch das wirke sich zwangsläufig negativ auf den Fluss der Kirchensteuermittel aus. "Auch wenn wir als Evangelische Kirche im Rheinland weiter liquide und handlungsfähig sind, trifft das alle Ebenen unserer Kirche."
"Tempo für nötige Veränderungen erhöhen"
Auch in der diakonischen Arbeit gebe es an vielen Stellen massive Einbrüche, sagte der leitende Theologe der zweitgrößten Mitgliedskirche der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit knapp 2,5 Millionen Mitgliedern. Mit Prognosen für die kommenden Jahre seien die Kirchen noch zurückhaltend. "Wenn die Krise die Wirtschaft für einen längeren Zeitraum zum Stillstand bringt, werden wir das aber massiver spüren", fügte Rekowski hinzu. "Das heißt, dass wir das Tempo für nötige Veränderungen in unserer Kirche wie Reduzierung der Aufgaben erhöhen müssen."
Belastend ist der teilweise Shutdown nach den Worten des 62-jährigen Theologen auch für die kirchliche Arbeit. Zwar sei er überwältigt vom Ideenreichtum, mit dem die Kirchengemeinden unter erschwerten Bedingungen Alternativen zum Normalfall kirchlicher Arbeit entwickelten und mit digitalen Möglichkeiten manches kompensierten. "Aber viel Zwischenmenschliches bleibt dabei auf der Strecke", sagte Rekowski.
Vor allem die Begrenzung auf den engsten Familien- und Freundeskreis bei Beerdigungen belaste viele Menschen, unterstrich der Theologe: "Eine würdige Trauerfeier ist sehr wichtig für den Abschied von einem geliebten Menschen, dessen Leben zurück in Gottes Hand gelegt wird." Auch dass Paare ihre Trauung absagen oder ohne Gäste heiraten müssten, sei für die Betroffenen eine schwierige Situation. "Hier müssen wir als Kirche flexibel terminliche Alternativen anbieten, wenn sich die Situation geändert hat", rät der rheinische Präses.
Berliner Bischof sieht neuen Konsens in Corona-Krise

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein nimmt in der Corona-Krise eine neue gesellschaftliche Einigkeit wahr. Die Krise zeige, "wie einig wir uns dann doch in bestimmten Grundfragen sind", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Das Miteinander in dieser Krise beweise, "dass die vielbeschworene Spaltung nicht so stark ist wie gedacht". Die jetzige Situation führe vor Augen, "dass es offensichtlich doch gemeinsame Dinge gibt, die uns mehr tragen als es uns manchmal bewusst ist", fügte der leitende Geistliche der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hinzu.
Zugleich sprach sich der Berliner Bischof für rasche Überlegungen zur Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie aus. "Die jetzige Situation fällt uns allen nicht leicht", sagte er. Verzicht werde in Verantwortung für die Schwächsten in der Gesellschaft geübt, um Menschen vor Ansteckung zu schützen. Trotzdem blieben Schmerz und Verzicht etwa darüber, "dass wir momentan unsere Gottesdienste nicht in der gewohnten Gemeinschaft feiern können".
"Sobald wie möglich Gottesdienste"
"Wir müssen immer wieder schauen, ob es noch richtig ist, was wir gerade tun. Das kann sich ja nicht von selber verstetigen", mahnte Stäblein. Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz fügte hinzu: "Wir möchten, sobald es wieder möglich ist, Gottesdienste feiern, wenn vielleicht auch erst einmal nur in kleiner Gemeinschaft."
Zu den wirtschaftlichen Folgen der Krise für die Kirchen sagte der Theologe, erste Schätzungen gingen von einem möglichen Rückgang der Kirchensteuer von 10 bis 15 Prozent aus. Auch bei den Kollekten sei ein Rückgang zu verzeichnen: "Diese kommen ja oft diakonischen Zwecken zugute, daher ist der Einbruch sehr bitter." Viele Effekte der jetzigen Situation würden sich zudem erst mit zeitlicher Verzögerung zeigen. "Wir versuchen uns wie die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft auf Zeiträume einzustellen, die nicht nur dieses Jahr umfassen", sagte der Bischof.
Die bereits zuvor geführte Debatte um die Konzentration kirchlicher Arbeit werde nach der Corona-Krise "noch deutlich an Schwung gewinnen müssen". Stäblein unterstrich: "Wir müssen wahrscheinlich schneller als bisher gedacht zu Lösungen kommen." Dies solle allerdings wie bisher "im guten, synodalen evangelischen Miteinander und in Mitsprache der vielen geschehen und kein Verteilungskampf zwischen kirchlichen Aufgaben werden".
Bilz rechnet nach Corona-Krise mit neuer Lebensqualität

epd-bild/Matthias Schumann
Dresden (epd). Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz rechnet nach der Corona-Krise mit einem Umdenken in der Gesellschaft. "Es werden Dinge in Bewegung kommen, die lange verfestigt waren", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Dresden. Als Beispiel nannte er das soziale Miteinander sowie Fragen des Klimaschutzes und der Verantwortung. Er gehe auch davon aus, dass familiäre Beziehungen und Freundschaften einen neuen Stellenwert bekommen.
"Die Menschen werden darüber nachdenken und neu entscheiden, was in ihrem Leben wichtig ist", sagte der evangelische Theologe. "Ich rechne mit einem neuen Nachdenken darüber, wie wir mit dieser Welt umgehen, mit der globalisierten Wirtschaft und der Umwelt", fügte er hinzu.
Die aktuelle Situation habe auch eine "erstaunliche Parallele" zum Ostergeschehen, wie es in der Bibel beschrieben wird: Aus der Krise heraus beginne etwas Neues, eine neue Qualität von Leben. So sei es nach dem Tod Jesu gewesen und so könne "auch aus unserer Krise neues Leben und eine neue Lebensqualität entstehen", sagte der sächsische Landesbischof. Dafür brauche es Geduld und daher sei es "ganz gut, zu Ostern ein wenig verhalten zu sein und sich selbst etwas zurückzunehmen".
"Schmerz und Einsicht"
Die derzeitige Einschränkung der Religionsfreiheit sei "eine Mischung aus Schmerz und Einsicht". "Die Krise ist ein tiefer Einschnitt in unsere Gewohnheiten", sagte Bilz: "Einen Gottesdienst zu besuchen, das gehört zum Glaubensleben vieler einfach dazu." Doch die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen hätten jetzt Vorrang. Sorgen, dass die Corona-Krise der Kirche längerfristig schaden könnte, habe er nicht.
Er rechne damit, dass nach dem 20. April neue Richtlinien zur Eindämmung der Corona-Krise kommen. "Ich wünsche mir sehr und bin auch guter Hoffnung, dass dann unter bestimmten Bedingungen allmählich die Zusammenkünfte wieder möglich werden", sagte der Landesbischof. Für den Besuch Einzelner blieben die meisten Kirchen auch in der Krise offen.
"Notzeiten brauchen Notlösungen"

epd-bild/Jens Schulze
Frankfurt a.M., Mainz (epd). Der letzte reguläre Sonntagsgottesdienst in der evangelischen Mainzer Auferstehungskirche ist mittlerweile einen Monat her. Wegen der Corona-Pandemie kommt die Gemeinde seither nur noch virtuell vor den PC- und Smartphone-Bildschirmen zusammen - inzwischen auch wieder zum Abendmahl. Zum Läuten der Kirchenglocken heißt es gleich zu Beginn des Livestreams aus der leeren Kirche: "Zur Vorbereitung stellen Sie sich gern eine Kerze, etwas Brot und Wein oder Saft bereit." Die Frage, ob es möglich ist, online Abendmahl zu feiern, wurde schon vor der Corona-Krise gestellt. In diesem Jahr ist sie aufgrund der Ausnahmesituation besonders drängend. Denn am Gründonnerstag erinnern Christen an das letzte Abendmahl Jesu Christi mit seinen Jüngern vor seiner Hinrichtung.
In der jetzigen Situation gibt es zwei Vorschläge: Eine Art Notabendmahl, das auch Laien erlaubt, das Abendmahl einzusetzen - was sonst nur Pfarrerinnen und Pfarrern vorbehalten ist. Im Netz gibt es dafür viele, teils von den Kirchenleitungen erprobte Beispiele für entsprechende Liturgien. Die zweite Möglichkeit ist ein Online-Abendmahl, das über die diversen medialen Kanäle von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin angeleitet wird. Dabei nehmen die Gläubigen dann ein zuvor bereitgestelltes Stück Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft zu sich.
"Einheit von Raum, Zeit und leiblichem Zusammensein"
"Mit beidem habe ich persönlich Schwierigkeiten", sagt Thies Gundlach, einer der drei theologischen Vizepräsidenten des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Denn das Abendmahl lebt ja davon, dass man es gereicht bekommt, dass es gegeben wird und nicht zu sich genommen wird." Ähnlich sieht das auch der Mainzer Theologie-Professor Kristian Fechtner, der dazu rät, für die Dauer der Corona-Krise bewusst auf das Abendmahl zu verzichten. Eine Feier im evangelischen Verständnis sei nur möglich, wenn "für alle Beteiligten die Einheit von Raum, Zeit und leiblichem Zusammensein gilt und erfahrbar wird".
Doch inzwischen mehren sich die Stimmen, die für eine andere Haltung plädieren. Pfarrer Ralf Peter Reimann, Internetbeauftragter der rheinischen Landeskirche, feiert seit zehn Jahren Online-Andachten. "Das ist genauso eine Gemeinschaft", versichert er. Entscheidend sei außerdem die Frage, wer zu einem Abendmahl einlade, gibt er in einem Blog-Beitrag zu bedenken: "Wenn es Christus selbst ist, wie können wir diese Einladung nur auf eine bestimmte räumliche Reichweite um den Altar herum beschränken?"
Getaufte Christen hätten als Kirchenmitglieder auch weiterhin ein Recht darauf, das Sakrament zu empfangen, erklärt auch der Theologe Jochen Arnold, der ein Standardwerk über die Theologie des Gottesdienstes geschrieben hat: "Die Verantwortlichen sind herausgefordert, alle theologisch verantwortbaren und technisch möglichen Optionen dafür bereit zu halten." Er geht sogar noch einen Schritt weiter: Beim Abendmahl spiele der Gemeinschaftsgedanke erst seit dem 20. Jahrhundert eine zentrale Rolle. Der Reformator Martin Luther selbst habe daran geglaubt, dass Christen sich in einer absoluten Ausnahmesituation sogar selbst die Einsetzungsworte zusprechen könnten.
Notliturgie
Aus seelsorgerischer Sicht sei das in der aktuellen Notlage besonders wichtig, denn viele ältere Menschen seien gar nicht in der Lage, die technischen Möglichkeiten zu nutzen. "Diejenigen, die eine häusliche Abendmahlsfeier wünschen und gestalten, sind überzeugte Christenmenschen. Sie werden mit großer Freude in die Gottesdienste der Gemeinde zurückkehren, wenn die Pandemie vorbei ist", sagt Arnold.
Die EKD hat die Diskussion in einer aktuellen Handreichung aufgegriffen. Darin wird empfohlen, sich für die grundsätzlichen theologischen Fragen Zeit zu nehmen. EKD-Vizepräsident Gundlach geht aber davon aus, dass am Gründonnerstag die evangelischen Gemeinden die Frage des Abendmahls unterschiedlich handhaben werden. Wenn es nach ihm ginge, würden die Gläubigen aber am Gründonnerstag entweder ganz auf Abendmahlfeiern verzichten, oder ein sogenanntes Agapemahl feiern, das an das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern erinnert, aber liturgisch betrachtet kein Abendmahl ist.
Die rheinische Landeskirche geht einen anderen Weg. Sie hat inzwischen für die Dauer der Corona-Krise eine Notliturgie ausgearbeitet, die auch die Möglichkeit zu einem Abendmahl enthält. "Notzeiten erfordern Notlösungen", sagt Pressesprecher Jens Peter Iven. Am Gründonnerstag sind alle Mitarbeiter des Landeskirchenamtes zu einem Internet-Gottesdienst eingeladen - mit Abendmahl.
Theologischer Kirchenrat: Gott ist in Krisenzeiten bei den Menschen
Detmold (epd). Der Karfreitag macht nach den Worten des lippischen Kirchenrats Tobias Treseler gerade in Krisenzeiten Mut. Der Tag, an dem Christen an die Kreuzigung Jesu erinnern, biete Raum für die innere Einkehr, sagte der evangelische Theologe am 10. April laut Redetext in einer im Internet übertragenen Predigt. Dem Ernst des Lebens könne man ins Gesicht sehen, "weil wir verstehen: Wir können das". Denn Gott lasse die Menschen nicht allein. Die tiefen Gräben des Lebens habe Gott durchschritten. Auch im Tod lasse er sich blicken.
Durch die Karfreitagsbotschaft werde niemandem die Angst vor dem Sterben genommen, sagte der Theologische Kirchenrat der Lippischen Landeskirche. Auch würden Befürchtungen nicht weggewischt, die viele in diesen Tagen hätten. Als Beispiele nannte Treseler Angst um die eigene Gesundheit und um die der Angehörigen sowie um die Welt.
Zudem machten vielen sich Sorgen um die Menschen im völlig überfüllten Flüchtlingslager Moria in Griechenland. Viele hätten auch Angst um die gesellschaftliche Entwicklung, um den eigenen Betrieb, um das Handwerk, um Dienstleistungen oder um die Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Diese Ängste könnten nicht genommen werden, sondern müssten irgendwie ausgehalten werden.
An Karfreitag werde deutlich, dass Gott Mensch werde, sagte Treseler weiter. Gott begebe sich "in den Müll des Lebens". Gott sterbe in seinem Sohn den Tod am Kreuz. Das mache den Tod ganz bestimmt nicht besser. "Aber es schenkt dem Leidenden eine Wahrnehmung und gibt ihm Würde", erklärte der Theologe.
Attacken auf evangelisch-konservative Gemeinde in Bremen
Bremen (epd). Bislang Unbekannte attackieren seit Wochen die evangelisch-konservativ ausgerichtete Bremer St.-Martini-Gemeinde und ihren umstrittenen Pastor Olaf Latzel. Sein Auto sei mehrfach zerkratzt, Schilder und Schaukästen seien beschmiert, Kondome und ein Dildo auf das Kirchengelände geworfen worden, sagte Latzel am 8. April dem epd. Zudem seien auf seinen Namen Bestellungen aufgegeben worden. Er selbst vermutet die Täter im linken Milieu und hat Strafanzeige gestellt. Der Staatsschutz ermittele, sagte Latzel.
Die Gemeinde hatte 2008 bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil sie Frauen auf ihrer Kanzel nicht duldete. Harsche Kritik gab es auch, als sich Latzel 2015 in einer Predigt gegen andere Religionen stellte. Der damalige leitende Theologe der Bremischen Evangelischen Kirche, Renke Brahms, sprach von "geistiger Brandstiftung".
Bremische Kirche: Inakzeptabel
Auch dass sich der Pastor gegen Abtreibungen und homosexuelle Lebensformen wendet, hat ihm in der Vergangenheit Proteste eingebracht. So wurde jetzt das ehemalige Küsterhaus der Martini-Kirche mit dem Schriftzug "god is gay" besprüht. Attacken wie diese gebe es seit Jahren, sagte Latzel. Obwohl die Polizei mit Ermittlungen und größerer Präsenz reagiert habe, sei es schwierig, die Täter dingfest zu machen.
Der Theologe warnte vor einer bundesweiten Entwicklung. In ganz Deutschland gebe es Attacken auf evangelikale Gemeinden und bibelfeste Christen. Die Bremische Evangelische Kirche kritisierte die Schmierereien. Das sei inakzeptabel, sagte ihre Sprecherin Sabine Hatscher. Kritik sollte ausnahmslos gewaltfrei und respektvoll erfolgen: "Abweichende Meinungen rechtfertigen keinerlei gewalttätige Handlungen gegenüber Menschen oder Sachen."
Australien: Oberstes Gericht spricht Kardinal George Pell frei
Rom/Sydney (epd). Der Ex-Finanzchef des Vatikans, der australische Kardinal George Pell, ist in seiner Heimat vom Vorwurf freigesprochen worden, in den 90er Jahren zwei Jungen missbraucht zu haben. Der ehemalige Erzbischof von Sydney wurde nach Angaben der offiziellen Internetseite "Vaticannews" vom 7. April zufolge umgehend aus der Haft entlassen.
Der Vatikan reagierte mit Erleichterung auf die Freilassung des 78-jährigen Kardinals. Der Heilige Stuhl habe stets Vertrauen in die australische Justiz gehegt, betonte der Vatikan, nachdem das Oberste Gericht von Australien das Missbrauchsurteil gekippt hatte. Der Heilige Stuhl begrüßte, dass die Richter dem Berufungsantrag stattgegeben hatten. Gleichzeitig bekräftigte er den Willen, "jede Form von Missbrauch gegenüber Minderjährigen vorzubeugen" und diese zu ahnden.
Pell kam unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid auf freien Fuß. Pell saß mehr als ein Jahr in Haft. "Ich habe stets meine Unschuld beteuert, während ich unter einer schweren Ungerechtigkeit litt", erklärte Pell nach dem Gerichtsbeschluss.
Das Oberste Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass entlastende Zeugenaussagen bei der Verurteilung Pells nicht berücksichtigt worden seien. Es sei möglich, dass in diesem Fall ein unschuldiger Mensch verurteilt worden sei.
"Für viele niederschmetternd"
Der Präfekt des vatikanischen Wirtschaftssekretariats war im Dezember 2018 von einem Geschworenengericht wegen Missbrauchs zweier Jungen schuldig gesprochen. Im März 2019 wurde das Strafmaß auf sechs Jahre Haft festgesetzt. Der Missbrauch an zwei Chorknaben im Alter von zwölf und 13 Jahren habe sich in Pells Zeit als Erzbischof von Melbourne Ende der 1990er Jahre ereignet, hieß es.
Die Verurteilung beruhte im Wesentlichen auf den Aussagen eines mutmaßlichen Opfers. Ein erster Berufungsantrag Pells war im August 2019 abgelehnt worden.
Der Vorsitzende der Australischen Bischofskonferenz, Mark Coleridge, gestand ein, dass die Gerichtsentscheidung für viele Menschen niederschmetternd sein werde, während sie für diejenigen, die von Pells Unschuld überzeugt seien, mit Erleichterung aufgenommen würde.
Pells Nachfolger als Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, betonte, der Fall mache die Notwendigkeit deutlich, das Justizsystem, den Umgang mit der Unschuldsvermutung und Anklagen gegen prominente Persönlichkeiten zu hinterfragen. Opfern widerfahre durch falsche Verurteilungen nicht Gerechtigkeit.
Gesundheit
Diskussion über Lockerung der Corona-Auflagen

epd-bild/Meike Böschemeyer
Düsseldorf (epd). In der Debatte über eine Lockerung der Corona-Auflagen zeichnet sich ein Vorgehen in kleinen Schritten ab. Ab wann die bis 19. April geltenden Kontaktbeschränkungen geändert und Einrichtungen wieder geöffnet werden, blieb aber auch am Osterwochenende unklar. Bund und Länder wollen am 15. April darüber beraten. Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina nannte Voraussetzungen für eine schrittweise Normalisierung des öffentlichen Lebens, darunter eine Maskenpflicht, ausreichend Krankenhausbetten und wenig Neuinfektionen.
Die Neuinfektionen müssten sich auf niedrigem Niveau stabilisieren und notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut werden, um auch andere Patienten wieder regulär zu versorgen, heißt es in der dritten Ad-hoc-Stellungnahme der Nationalakademie Leopoldina zum Coronavirus, die in Halle an der Saale veröffentlicht wurde. Außerdem müssten die bereits bekannten Schutzmaßnahmen diszipliniert eingehalten werden.
"Fundierte Expertise"
Mit Maßnahmen wie Hygiene- und Distanzregeln, Mund-Nasen-Schutz und einer zunehmenden Identifizierung Infizierter könnten dann zunächst unter anderem der Einzelhandel und Gaststätten wieder öffnen, empfehlen die Wissenschaftler. Auch der allgemeine geschäftliche und behördliche Publikumsverkehr könnte dann wieder aufgenommen werden. Dienstliche und private Reisen könnten unter Beachtung der genannten Schutzmaßnahmen ebenfalls wieder möglich werden. Insbesondere solle das Tragen von Schutzmasken in bestimmten Bereichen wie dem öffentlichen Nahverkehr Pflicht werden.
Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, die "fundierte wissenschaftliche Expertise" der Leopoldina werde nun ausgewertet und im Kabinett beraten werden. Absehbar sei schon jetzt, dass es längere Zeit dauern werde, bis an den Schulen wieder normaler Unterricht stattfinden könne, erklärte sie in Berlin. Die Wissenschaftler empfehlen auch eine schrittweise Öffnung des Bildungsbereichs.
"Geduld, Disziplin und Gemeinsinn"
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Latschet (CDU) warb für eine planvolle und schrittweise Aufhebung der Beschränkungen. "Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt", sagte er im WDR-Fernsehen. Eine Rückkehr in eine Normalität des Alltags gehe nicht mit einem großen Sprung, sondern mit vielen kleinen, vorsichtigen Schritten. "Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben."
Saar-Ministerpräsident Tobias Hans forderte einen Masterplan für den Umgang mit dem Coronavirus. Dieser müsse zwischen Bund und Ländern abgestimmt sein, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. An oberster Stelle stehe dabei, die Bürger vor Ansteckung zu schützen.
Zuvor hatte sich auch der nordrhein-westfälische Expertenrat für eine schrittweise Öffnung des sozialen und öffentlichen Lebens ausgesprochen - unter der Voraussetzung, dass das Gesundheitssystem mit dem Infektionsgeschehen der Pandemie nicht überfordert und ein besseres Monitoring der Krise möglich sei. Bildungseinrichtungen sollten so schnell wie möglich schrittweise wieder öffnen, unter Einhaltung hoher Schutzstandards, heißt es in einem dem epd vorliegenden Bericht. Konzerte und Theater könnten gegebenenfalls mit Abstandsregeln und begrenzter Besucherzahl stattfinden.
Die Experten plädieren für eine Ausweitung wissenschaftlicher Studien zum Coronavirus sowie die Entwicklung und den Ausbau weiterer Testverfahren. Für flächendeckende Tests spricht sich auch der Städte- und Gemeindebund aus. Bis Ende Mai müssten sie von derzeit 60.000 auf 500.000 pro Tag hochgefahren werden, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Funke-Zeitungen.
Freiwillig zu Hause bleiben
Zahlreiche Prominente über 70 plädierten inzwischen dafür, dass Ältere auch nach einer Lockerung noch einige Zeit freiwillig zu Hause bleiben sollten. An einem entsprechenden Aufruf, den die "Bild am Sonntag" veröffentlichte, beteiligten etwa sich BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht, SAP-Gründer Dietmar Hopp, Verleger Hubert Burda, die Unternehmerin Doris Leibinger (Trumpf-Gruppe) und der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende, Altbischof Wolfgang Huber.
Zur Eindämmung der Pandemie sind seit Mitte März Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Kurz darauf wurden Schließungen von Einzelhandelsgeschäften und Restaurants verfügt sowie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erlassen. Seit 22. März gilt bundesweit, dass Aufenthalte im Freien nur noch allein, zu zweit oder mit den Personen aus dem eigenen Haushalt erlaubt sind. Je nach Bundesland und Region gibt es im Detail verschiedene Regelungen.
Maßnahmen zur Virus-Eindämmung zeigen Wirkung
Die Einschränkung des öffentlichen Lebens führt laut Robert Koch-Institut zur Abflachung der Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus. Präsident Wieler will aber nicht von Entspannung reden. Merkel fordert zur weiteren Einhaltung der Regeln auf.Berlin (epd). Die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zeigen Wirkung. Kurz vor Ostern meldeten Bundesregierung und Robert Koch-Institut erste Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus. Der Anstieg der Infektionen flache sich ab, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 9. April in Berlin. Die Einschnitte in den Alltag zeigten Wirkung, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zugleich warnte Merkel vor Leichtsinnigkeit über Ostern. Die Lage sei fragil, die Regeln müssten weiter eingehalten werden.
Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, gab wie jeden Tag die aktuellen Zahlen bekannt. 108.202 Covid-19-Fälle und 2.107 Todesfälle wurden nach seinen Worten bis dahin in Deutschland gemeldet. Die Zahl der neu übermittelten Fälle sei weiter auf einem hohen Niveau, zu Beginn der Woche bei rund 4.000 täglich, am Donnerstag wieder bei 5.000. Die Schwankungen seien natürlich, zeigten aber auch, dass von einer Entspannung noch nicht ausgegangen werden dürfe, sagte Wieler.
"Nicht in Sicherheit wiegen"
Die Bundesregierung appellierte kurz vor den Feiertagen mit erwartetem guten Wetter umso mehr, die Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten, auf Besuche bei Verwandten und Freunden zu verzichten sowie in der Öffentlichkeit Abstand zu halten. "Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen", sagte Merkel. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) sagte, der bisherige Verzicht auf vieles dürfe nicht umsonst gewesen sein. Je besser die Befolgung der Regeln auch über das Osterfest gelinge, desto wahrscheinlicher werde eine schrittweise Rückkehr zur Normalität, sagte Spahn.
Über die mögliche Lockerung der Beschränkungen, die zunächst bis zum 19. April gelten, will Merkel am 15. April mit den Regierungschefs der Bundesländer beraten. Die Kanzlerin äußerte sich vor Ostern zurückhaltend. Vor nicht langer Zeit sei sie besorgt gewesen, ob die jetzt geltenden Maßnahmen nicht noch verschärft werden müssten. Man müsse darüber schon sehr froh sein, dass man dies "zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen muss". Im Falle einer Lockerung müsse man vorsichtig vorgehen, "wenn, dann in kleinen Schritten", sagte die Regierungschefin.
Tödlicher Verlauf bei 1,9 Prozent der Infizierten
Der Anteil der mit dem Coronavirus infizierten Verstorbenen liegt laut Robert Koch-Institut derzeit bei 1,9 Prozent aller Erkrankungen. Er sei gestiegen, weil es zunehmend Ausbrüche der Krankheit in Pflegeheimen und Krankenhäusern gebe. Daher sei mit einem weiteren Anstieg zu rechnen, zu Beginn der Epidemie seien mehr jüngere Menschen krank geworden. Wie viele Menschen in den systemrelevanten Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Lebensmittelhandel sich infiziert haben, ist laut Wieler nicht bekannt.
In der Debatte über Lockerungen sprach sich Giffey dagegen aus, ältere Menschen zu ihrem eigenen Schutz stärker einzuschränken als jüngere. "Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufmachen sollten zwischen denen, die rausdürfen und denen, die drin bleiben müssen", sagte sie. "Wir brauchen andere Lösungen." Man könne an die älteren Menschen appellieren, sich vernünftig zu verhalten, statt ihnen verbieten zu wollen, das Haus zu verlassen. "Ältere Menschen sind mündige Bürger", betonte Giffey. Sie reagierte damit auf Vorschläge, älteren Menschen länger Einschränkungen aufzuerlegen als Nicht-Risikogruppen.
Ethikrat fordert offene Kommunikation über Lockdown-Ende

epd-bild/Peter Roggenthin
Berlin (epd). Der Deutsche Ethikrat hat die Politik aufgefordert, sich der Debatte über ein Ende der derzeitigen Pandemie-Einschränkungen nicht zu verweigern. Diese Debatte könne und solle von allen, auch von der Politik, als Ausdruck der offenen Gesellschaft begrüßt werden, sagte der Vorsitzende des Ethikrats, Peter Dabrock, am 7. April in Berlin. Die gegenwärtige Kommunikationsstrategie vieler politisch Verantwortlicher zu möglichen Lockerungen sei "verbesserungsbedürftig", ergänzte der Theologe.
Dabrock betonte, es sei derzeit noch zu früh für Lockerungen, "aber es ist nie zu früh für eine öffentliche Diskussion über Öffnungsperspektiven". Alles andere wäre "obrigkeitsstaatliches Denken". Wenn Menschen in einem bewundernswerten Maß Solidarität zeigten und teils sehr drastische Freiheitseinschränkungen recht klaglos in Kauf nehmen würden, dürfe man ihnen nicht das Recht absprechen, darüber nachzudenken, zu hinterfragen, "ja auch zu klagen", sagte Dabrock.
Der Ethikratsvorsitzende forderte, dabei nicht primär über den Zeitpunkt zu debattieren, sondern Notwendigkeiten zu definieren. Die sachlichen und sozialen Kriterien würden derzeit hintangestellt, sagte Dabrock.
Solidaritätskonflikte
Der Ethikrat hatte Ende März eine Stellungnahme zur Corona-Krise veröffentlicht, in der er unter anderem ein Szenario für den Ausstieg aus den derzeitigen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie anmahnt. Dabrock sagte, schon jetzt zeigten sich neben den wirtschaftlichen Folgen Solidaritätskonflikte. Die Opfer des Lockdowns dürften nicht aus dem Blick geraten. Dazu zählte er etwa Menschen, deren Operationen derzeit verschoben werden sowie psychisch oder suchtkranke Menschen, deren Therapien derzeit unterbrochen sind. Mehr Aufmerksamkeit forderte er auch für den Bereich der Pflege, wo Besuche und Therapien derzeit auch ausgeschlossen sind.
Zur Diskussion über die Möglichkeit, Risikogruppen weiter zu isolieren, anderen aber wieder mehr Freiheit zu geben, sagte Dabrock, das sei eher mittel- bis langfristig eine Option, die aber gesellschaftlich debattiert werden müsse. Der Jurist und Ethikratsmitglied Steffen Augsberg sagte, es sei zu kurz gegriffen, dies allein als Generationenkonflikt zu sehen. Auch unter Jüngeren gebe es Risikopatienten.
Diskussion über Triage-Kriterien
Ein zweites Thema für den Ethikrat ist die sogenannte Triage, die Auswahl von Patienten bei zu knappen Ressourcen, etwa Beatmungsgeräten. Das Gremium selbst definiert keine Kriterien und warnt auch den Staat davor, Regeln dafür zu entwickeln. Die Ethik-Experten verwiesen in ihrer Stellungnahme auf die Verantwortung der medizinischen Fachleute.
An den Empfehlungen der Fachleute gibt es aber auch Kritik, etwa von der "Liga Selbstvertretung", einem Zusammenschluss von Behindertenorganisationen. Sie befürchten, dass bei einer Auswahl nach Gebrechlichkeitsanzeichen Behinderte von vornherein ausgeschlossen würden und fordern den Bundestag zum Handeln auf. Das sei menschrechtlich problematisch, argumentiert der Verband.
Augsberg räumte ein, dass es bei den Empfehlungen der Fachgesellschaften Klärungsbedarf gebe. "Wir wollen keine pauschale Ausgrenzung", betonte er. Wenn ein Gebrechlichkeitsindex dazu führe, dass Gruppen von vornherein chancenlos sind, "werden wir das nicht akzeptieren dürfen", sagte er.
Böckler-Stiftung gegen schnelle Lockerung der Kontaktsperren
Düsseldorf (epd). Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf spricht sich aus gesundheitlichen und ökonomischen Gründen gegen eine schnelle Lockerung der Kontaktsperren aus. Eine vorschnelle Aufhebung berge das Risiko eines neuen Aufflammens der Infektionen und damit verbundenen Kontaktbeschränkungen für einen längeren Zeitraum, heißt es in der am 14. April veröffentlichten Analyse "Schneller Ausstieg oder bedachte Lockerung?" des IMK. Eine schnelle Lockerung würde "die ökonomischen Gesamtkosten drastisch in die Höhe treiben".
Die Autoren der Analyse plädieren für eine nachhaltige und schrittweise Lockerung. Demnach sollen zunächst jene Beschränkungen aufgehoben werden, deren Wegfall möglichst geringe Ansteckungsgefahren mit sich bringt und deren Aufrechterhaltung besonders hohe ökonomische und soziale Kosten verursacht. Zudem brauche es einen Überblick über spezifische Maßnahmen wie etwa Schutzkleidung, Barrieren und Plexiglasscheiben, um Ansteckungen zu verringern.
Zunächst sei eine schnelle Kommunikation und Umsetzung von Infektionsschutz und Abstandsregeln in Kindertagesstätten, Schulen, Einzelhandel und Gastronomie nötig, erklärte die Hans-Böckler-Stiftung. "Den Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen muss klarer als bisher gesagt werden, was ab wann auf sie zukommt", sagte der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien. Dazu gehörten Vorgaben zu absehbar notwendigen Umbauten und Hygiene-Vorschriften zur Wiedereröffnung. Auch brauche es ein klares Statement, dass der Status quo ante nicht so schnell zurückkommen werde.
Masken-Pflicht auf Prüfstand
Für den Bereich der Schulen und Kitas sprechen sich die Forscher zunächst für eine Trennung der Gruppen aus. So könnte etwa jede Klasse nur jeden zweiten Tag Unterricht haben. Eine Pflicht zum Tragen von einfachen Masken solle geprüft werden, soweit die Verfügbarkeit gegeben ist.
Denkbar wäre auch ein abgestuftes Vorgehen bei der Lockerung: In Landkreisen mit beispielsweise niedrigen Infektionszahlen und einer niedriger Infektionsdynamik könnten Einzelhandel, Schulen, Kitas und Gastronomie schrittweise vor anderen Regionen wieder öffnen. Dabei dürften dann nur Menschen mit Wohnsitz in dem jeweiligen Kreis bedient werden.
Außerdem müssten Ressourcen in Möglichkeiten des datenschuzkonformen Trackings und Nachverfolgens von Infektionsketten fließen. Dabei müsse die europäische Perspektive eine Rolle spielen. "Wichtig ist hier, die nationalen Systeme kompatibel zueinander zu halten, um möglichst bald wieder den möglichst ungehinderten Grenzverkehr von Arbeitskräften zu ermöglichen, ohne neue, unentdeckte Infektionsketten zu riskieren", schreiben die Wissenschaftler. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit sei nötig, um Lieferketten innerhalb der Europäischen Union zu stabilisieren.
Kommunen wollen flächendeckende Corona-Tests
Essen (epd). Der Städte- und Gemeindebund spricht sich für flächendeckende Corona-Tests als Voraussetzung für eine Lockerung der Schutzmaßnahmen aus. Dazu gehöre der Aufbau eines bundesweit einheitlichen Test- und Meldesystems, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (14. April). Zudem müssten die Testkapazitäten deutlich ausgebaut werden, damit 80 bis 100 Prozent der Kontaktpersonen von Infizierten innerhalb eines Tages gefunden und getestet werden können. Bis Ende Mai müssten nach Ansicht von Landsberg die Tests von derzeit 60.000 auf 500.000 pro Tag hochgefahren werden.
Landsberg sprach sich auch für ein vorsorgliches Schutzmaskengebot in Geschäften, Behörden und dem öffentlichen Nahverkehr aus, sobald ausreichend Schutzmasken vorhanden sind. Darüber hinaus könne eine freiwillige Corona-Warn-App dazu beitragen, Infektionsketten schnell und effektiv zu durchbrechen.
Vor der Wiedereröffnung von Schulen und Kitas solle es Planspiele in den Kommunen geben - unterstützt vom Robert-Koch-Institut, fordert der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. In diesen Planspielen solle herausgefunden werden, ob es sinnvoll wäre, die Kinder hälftig vor- und nachmittags oder auch hälftig im 14-Tage-Wechsel zu betreuen.
Sonderregeln
Landsberg warb zudem dafür, allen Genesenen Sonderregeln zu gewähren. "Warum sollte ein Ein-Mann-Betrieb nicht wieder öffnen können, wenn der Inhaber gesundet ist, nachweislich niemand mehr anstecken kann und auch nicht als Überträger in Betracht kommt?"
Der kommunale Spitzenverband rief Bund und Länder dazu auf, eine "behutsame Exit-Strategie" vorzubereiten. Es werde sicherlich nicht kurzfristig einen Zeitpunkt geben, von dem an alles wie früher sei, sagte Landsberg. "Die besonderen Abstands- und Hygieneregeln werden uns noch lange begleiten."
Der Hauptgeschäftsführer warb für regionale Besonderheiten bei den Lockerungen. Auch der Föderalismus habe sich in der Krise bewährt. Die Situation in den Bundesländern und Regionen sei sehr unterschiedlich, "weshalb auch die Lockerungsanforderungen dementsprechend Rechnung tragen müssen", sagte Landsberg.
NRW-Landtag verabschiedet Epidemie-Gesetz
Nach harscher Kritik und einigen Änderungen hat der nordrhein-westfälische Landtag nun ein Gesetz für epidemische Krisen verabschiedet. Erste Schritte für eine Umsetzung nimmt Gesundheitsminister Laumann in den Blick.Düsseldorf (epd). Mit großer Mehrheit hat der nordrhein-westfälische Landtag das neue Epidemie-Gesetz verabschiedet. CDU, FDP, SPD und Grüne sowie der fraktionslose Abgeordnete Alexander Langguth stimmten am 14. April in dritter Lesung für den Gesetzentwurf, der der Landesregierung im Falle einer Verschärfung der Corona-Krise besondere Durchgriffsrechte ermöglicht. Die AfD, die die dritte Lesung zum Gesetz herbeigeführt hatte, votierte dagegen.
In dem überarbeiteten Gesetz ist die ursprünglich geplante Zwangsverpflichtung von medizinischem Personal für den Kriseneinsatz in Krankenhäusern nicht mehr vorgesehen. Ärzte, Pflegepersonal und Rettungskräfte können sich nun stattdessen in ein Freiwilligenregister eintragen. Dort soll aufgenommen werden, wer für einen Einsatz zur Verfügung steht. Zudem soll das Gesetz nur befristet bis Ende März 2021 gelten.
Auf zwei Monate befristet
Auch die geplante Beschlagnahme von medizinischem Gerät wird dem überarbeiteten Entwurf zufolge streng auf Einzelfälle beschränkt. Als Reaktion auf den Gesetzentwurf hatten einzelne Unternehmen aus NRW bereits angekündigt, ihre Medizinprodukte außerhalb des Bundeslandes lagern zu wollen. Die Festlegung einer epidemischen Notlage ist auf zwei Monate befristet. Solange gelten auch mögliche Einzel-Ermächtigungen der Minister. Mögliche notwendige Änderungen in Zeiten einer Epidemie, etwa am Schulgesetz, soll aber nur das Parlament vornehmen können. Ursprünglich hatte die Landesregierung das Gesetz im Eilverfahren beschließen willen, scheiterte damit aber am Widerstand der Opposition.
Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte, man werde mit den Handlungsmöglichkeiten, die das Gesetz biete, "sehr sorgsam umgehen" und in anstehenden Entscheidungen gegebenenfalls auch den Landtag einbinden. Als erste Schritte kündigte der Minister an, dass nun ermittelt werden soll, wo in NRW außerhalb der Krankenhäuser noch Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen. Überdies soll mit der Aufstellung des Freiwilligenregisters begonnen werden.
Laumann: In der Krise "noch nicht über den Berg"
Laumann lobte die Bevölkerung dafür, wie sie bislang mit den Corona-bedingten Einschnitten im öffentlichen Leben umgegangen sei. Es sei gelungen, den Zeitraum der Verdopplung der Zahl der Corona-Infizierten in NRW auf 15,2 Tage zu strecken. Das sei eine wichtige Grundlage für erste Lockerungen der aktuellen Auflagen. Zugleich mahnte der Minister aber, man sei in der aktuellen Krise "noch nicht über den Berg". Derzeit gehe es vor allem darum, die Bewohner in den Altenheimen und die Senioren in der ambulanten Pflege vor Covid-19 zu schützen.
Der SPD-Politiker Josef Neumann lobte, dass es gelungen sei, über das Parlament notwendige Änderungen an dem Gesetzentwurf zu erreichen. Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner erneuerte die Kritik seiner Fraktion an dem Gesetz: "Die Demokratie darf auch in Krisenzeiten nicht ungebührlich ausgehöhlt werden."
Ein Virus in Gebärdensprache

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Wenn der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, seine Statistiken zur Corona-Pandemie vorträgt, steht bei der Pressekonferenz schräg hinter ihm eine Gebärdensprachdolmetscherin und übersetzt simultan. Bernadette Zwiener ist staatlich geprüfte Übersetzerin. Seit drei Wochen sieht man sie in dunkler Kleidung am Bildrand, wo sie das Gesagte für Gehörlose verständlich macht. Davor war ein solcher Anblick während der wichtigsten Nachrichten in Deutschland selten. Allmählich wird er zur Normalität. Denn mehrere Institutionen haben nachgezogen: Simultanübersetzungen in Gebärdensprache gibt es inzwischen etwa bei Ansprachen der Kanzlerin oder bei den regelmäßigen Regierungspressekonferenzen.
Aber warum Gebärdensprache? Reichen Untertitel nicht aus, mögen sich all jene fragen, die keine tauben Menschen kennen. "Texte in deutscher Schrift sind immer eine Fremdsprache für Gehörlose", sagt Bernadette Zwiener. Denn Gebärdensprache ist von der Struktur her ganz anders: Sie ist dreidimensional und hat eine andere Grammatik. So wird das Virus zum Beispiel in der Deutschen Gebärdensprache mit eingeknickten Fingern dargestellt - eine Geste, die an in die Luft gezeichnete Anführungszeichen denken lässt. Das neuartige Coronavirus, das der Lunge gefährlich wird, kann mit den Händen auf der Lunge dargestellt werden. Eine andere Gebärde dafür ist die Faust über der die gespreizte Hand gedreht wird, was wiederum an die Mikroskopbilder des Erregers erinnert. Ironie im herkömmlichen Sinne gibt es in der Gebärdensprache nicht.
Aufträge weggebrochen
Dolmetscherin Zwiener arbeitet selbstständig, und man könnte vermuten, dass sie sich im Moment vor Aufträgen kaum retten kann. Doch der Eindruck, der entsteht, weil ihre Auftritte in den verschiedensten Medien wiederholt werden, trüge, sagt sie. Er spiegele nicht das tatsächliche aktuelle Arbeitspensum wider. Tatsächlich brechen ihr wegen der Pandemie zahlreiche Aufträge weg: Termine beim Arzt, in Firmen, Schulen, Museen oder bei Konferenzen.
Zwiener bereitet sich auf jeden Einsatz tagesaktuell vor. Sie selbst ist weder taub noch mit Gebärdensprachen groß geworden. "Man kann ein Leben lang in diesem Beruf tagtäglich etwas Neues lernen, es wird nie langweilig", sagt sie. Neben der Arbeit für das Robert Koch-Institut ist Zwiener auch im Haus der Bundespressekonferenz im Einsatz, zum Beispiel wenn Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung den Hauptstadtjournalisten Rede und Antwort stehen. Sie recherchiert vor ihren Auftritten in speziellen Lexika und schlägt Übersetzungsansätze für aktuelle Themen in Video-Gebärdensammlungen nach. Vor allem Videos von tauben Gebärdensprachdolmetschern - Muttersprachlern also - helfen Zwiener weiter. Und gibt es für ein Wort einmal keine Gebärde, buchstabiert sie.
Ihre Arbeit wird geschätzt. Viele Menschen schreiben ihr, dass es längst überfällig sei, dass Gebärdensprachübersetzungen angeboten würden. "Ich glaube, eine solche Resonanz hätte es vor einigen Jahren nicht gegeben", sagt Zwiener. "Die Inklusionsarbeit trägt Früchte." Etwa 80.000 Gehörlose leben nach Angaben des Deutschen Gehörlosen-Bundes in der Bundesrepublik. Doch gibt es für sie immer noch zu wenige Lehrkräfte, die überhaupt Gebärdensprache können, wie der Geschäftsführer der Berliner Gebärdensprachschule Yomma, Benedikt Sequeira Gerardo, sagt. Gehörlose würden im Bildungsbereich diskriminiert und wiesen deshalb oftmals ein hohes Bildungsdefizit auf.
"Hamstern"-Gebärde ging viral
Die Übersetzung aktueller Ansprachen und Pressekonferenzen in Gebärdensprache ist Teil der derzeitigen Ausnahmesituation und kein Garant dafür, dass es künftig so bleibt. Bernadette Zwiener sagt: "Im Moment gilt ein anderer Kosten-Nutzen-Faktor: Jetzt, wo es auf jede einzelne Person ankommt, weil alle Krankheitsüberträger sein können, muss auch jede einzelne Person informiert werden."
Gebärdensprache ist immerhin sichtbarer geworden. In den Niederlanden verbreitete sich in sozialen Medien jüngst ein Video sogar tausendfach. Es zeigt eine Gebärdensprachdolmetscherin, die das Wort "Hamstern" übersetzt: Mit verbissenem Blick schaufelt sie mit beiden Händen die imaginäre Ware zu sich hin.
Diakonie RWL trauert um Reinhard van Spankeren
Düsseldorf (epd). Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL) trauert um den Leiter ihrer der Öffentlichkeitsarbeit, Reinhard van Spankeren. Der Kommunikationsexperte starb im Alter von 62 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie der evangelische Wohlfahrtsverband in Düsseldorf mitteilte. Van Spankeren leitete seit 2015 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Diakonie RWL. Zuvor arbeitete er als Referent der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Der Vorstand der Diakonie RWL würdigte Van Spankeren als engagierten öffentlichen Streiter für soziale Gerechtigkeit und Menschlichkeit. In seiner rhetorisch geschulten und politisch wachen Art habe er sich dafür eingesetzt, die Lebensverhältnisse von Benachteiligten zu verbessern, ihre Geschichten zu erzählen und so politischen Anliegen ein menschliches Gesicht zu geben.
Van Spankeren habe sich unter anderem als stellvertretender Vorsitzender und Mitglied im Spendenbeirat der Aktion Lichtblicke, der Spendenaktion der lokalen Hörfunkanstalten in Nordrhein-Westfalen, für benachteiligte Familien und Kinder starkgemacht. Zudem habe er unter dem Vorsitz der Diakonie in den Jahren 2018/19 die Pressearbeit der Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen koordiniert.
Van Spankeren wirkte in zahlreichen weiteren Gremien und Ämtern. So war er Vorsitzender der Sammlungskonferenz Caritas und Diakonie in NRW sowie des Lenkungsausschusses Kommunikation der Diakonie Deutschland. Er engagierte sich zudem in der Mitgliederversammlung des Evangelischen Pressedienstes (epd) Region West.
Freie Wohlfahrtspflege NRW: Neue Corona-Auflagen nicht praktikabel
Düsseldorf (epd). Die Freie Wohlfahrtspflege NRW hält die neuen Auflagen für Pflegeheime und Einrichtungen der Behindertenhilfe in der Corona-Krise für nicht praktikabel. Die Auflagen sehen für Einrichtungen eine 14-tägige getrennte Unterbringung in drei Quarantänetrakten von Infizierten, Verdachtsfällen und übrigen Bewohnern vor, erklärte der Vorsitzende Frank Johannes Hensel am 7. April in Düsseldorf. Dies könne personell, räumlich und ausstattungstechnisch bei vielerorts mangelndem Schutzmaterial nicht zeitnah realisiert werden.
Die Freie Wohlfahrtspflege appellierte an Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), die Verordnung dahingehend auszulegen, eine Isolierung im eigenen Einzelzimmer mit pro Schicht einzelnen zugewiesenen Personen für die Pflege und Betreuung zu ermöglichen. "Sonst sehen wir kaum Möglichkeiten, dem Sinn und den Verpflichtungen aus der Verordnung zur Neu- und Wiederaufnahme aus dem Krankenhaus entsprechen zu können", erklärte Hensel.
Begrüßenswert sei hingegen die vorgesehene priorisierte Testung auf Covid19 von Pflegebedürftigen vor einer Entlassung aus dem Krankenhaus oder vor einer Neuaufnahme in einer stationären Pflegeeinrichtung sowie die Testung des Pflegepersonals in Pflegeeinrichtungen, erklärte die Freie Wohlfahrtspflege.
Patientenschützer: Corona-Grundschutz für Pflegeheime garantieren
Dortmund (epd). Die Stiftung Patientenschutz fordert klare Kriterien für die Einbindung von Pflegeheimbewohnern in die Corona-Exit-Strategie. "Wer Lockerungen nach Ostern ins Spiel bringt, der muss garantieren, dass der Grundschutz dauerhaft steht", sagte Vorstand Eugen Brysch am 10. April in Dortmund. "Pflegeheime sind keine Gefängnisse." Heimbewohner würden aber "in Haft genommen", weil die Gesundheitsministerien von Bund und Ländern sowie die Heimbetreiber beim Grundschutz in der Altenpflege "sträflich versagen".
Ein Ausstiegsszenario brauche verbindliche Kriterien und einen angepassten Zeitplan, mahnte der Patientenschützer. Wenn der Infektionsschutz gesichert sei, könnten Besuche über Zugangsschleusen erfolgen. Bund, Länder und Kommunen seien allerdings auch acht Wochen nach dem Corona-Ausbruch in Heinsberg nicht in der Lage zu garantieren, dass Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Desinfektionsmittel in den Einrichtungen für mindestens 14 Tage reichen, kritisierte Brysch. "Es gibt ambulante und stationäre Dienste, da reicht es nicht mal bis zum Abend."
Brysch forderte zudem, Pflegebedürftige systematisch auf das Virus zu testen, Menschen mit Grippe-Symptomen sofort. Vereinzelt gebe es schon gute Beispiele, wo Ärzte und Pfleger der Krankenhäuser, niedergelassene Mediziner und Altenpflegekräfte in Freiwilligen-Pools vor Ort zusammen arbeiteten. Sie können dort eingreifen, wo eine Kettenreaktion drohe. "Die Politik muss dafür sorgen, dass diese Maßnahmen endlich laufen", forderte Brysch.
Pflegeheim in Sankt Augustin wegen Corona-Ausbruch teilevakuiert
Köln/Sankt Augustin (epd). Ein Alten- und Pflegeheim in Sankt Augustin ist wegen vieler Corona-Infektionen teilweise evakuiert worden. Die knapp 40 positiv auf das Virus SARS-CoV-2 getesteten Bewohner wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, teilte die Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft (CBT) am 10. April in Köln mit. Die Maßnahmen seien gemeinsam mit dem Krisenstab des Rhein-Sieg-Kreises und der Stadt Sankt Augustin Beschlossen worden.
In der Einrichtung Sankt Monika waren nach CBT-Angaben zuvor 36 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weitere Pflegekräfte stünden unter Quarantäne. Wegen des Personalausfalls hatte der Katastrophenschutz in der Nacht zum Donnerstag die Notbetreuung in dem Pflegeheim übernommen. Durch die Reduzierung des Pflegeaufwandes sei der Betreiber nun aber in der Lage, mit den negativ getesteten Pflegekräften den Betrieb und die Betreuung der nicht infizierten Bewohner aufrecht zu erhalten, teilte die Stadt am Freitagabend mit.
Ärztepräsident: Besuche in Altenheimen mit Schutzkleidung ermöglichen
Berlin, Essen (epd). Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat vorgeschlagen, Besuche in Pflegeeinrichtungen unter Schutzvorkehrungen wieder zu ermöglichen. "In einem Altenheim zum Beispiel muss wieder Besuch stattfinden können - aber eben abgesichert", sagte Reinhardt des Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (8. April). Um die Bewohner vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, sollten alle Besucher Schutzkleidung tragen.
"Sinnvoll wäre auch eine Schleuse, in der sich Gäste desinfizieren und Schutzkleidung anlegen müssen", sagte der Ärztepräsident weiter. "Erst danach sollten sie die Räume der Bewohner betreten." Die zusätzlichen Hygienemaßnahmen für Besucher seien jedoch vom Pflegepersonal nicht zu leisten. "Das wäre etwas für Freiwilligendienste", regte Reinhardt an. Die Kosten dafür solle die öffentliche Hand tragen.
Gesellschaft
Helfer und Kirchenvertreter fordern Evakuierung der Flüchtlingslager

epd-bild/Jörn Neumann
Frankfurt a.M. (epd). Bei der Evakuierung von Flüchtlingen aus griechischen Lagern dringen Hilfsorganisationen und Kirchenvertreter auf mehr Solidarität und Tempo. Nicht erst seit der Corona-Krise litten die Menschen dort unter der katastrophalen Situation, erklärte der Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge am 9. April in Berlin. "Nun droht eine Tragödie, wenn nicht schnell gehandelt wird." Ähnlich äußerten sich "Ärzte ohne Grenzen", der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und weitere führende Kirchenvertreter.
Eine Aufnahme von 50 Minderjährigen sei völlig unzureichend, betonte der Bundesverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit Blick auf die entsprechende Ankündigung der Bundesregierung vom 8. April. Nach wochenlangen Verzögerungen soll die Aufnahme von Kindern aus den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln in der nächsten Woche mit 50 Minderjährigen starten. Insgesamt will die Bundesregierung insgesamt 300 bis 500 Flüchtlinge aus den Lagern übernehmen. "Wir können und müssen deutlich mehr tun", forderte der Verband.
"Richtiger Schritt"
"Ärzte ohne Grenzen" unterstrich, die Menschen in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln seien angesichts der Corona-Pandemie akut gefährdet. Hunderte Menschen, die zu Coronavirus-Hochrisikogruppen zählen, seien in den überfüllten Flüchtlingslagern noch immer in Gefahr, an Covid-19 zu erkranken, sagte Florian Westphal, Geschäftsführer der Organisation in Deutschland. "Daran ändert auch die Ankündigung der Bundesregierung nichts, 50 Kinder aus Moria zu evakuieren - auch wenn wir froh sind, dass nach vier Wochen nun überhaupt etwas geschieht."
Auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bedford-Strohm, forderte eine umgehende Evakuierung der Flüchtlingslager und die Verteilung der Menschen in Europa. "Es ist ein richtiger Schritt, dass jetzt endlich 50 Kinder kommen können. Aber es ist viel zu wenig", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". "Wenn sich das Coronavirus in dem völlig überfüllten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ausbreitet, hätte das dramatische Folgen", betonte der Theologe. Es müsse "Schluss sein damit, die Verantwortung in Europa hin- und herzuschieben".
"Beschämend"
Mit Blick auf die angekündigte Übernahme von 50 Minderjährigen sprach die westfälische Präses Annette Kurschus von einem Anfang. In Deutschland seien jedoch viele Menschen und Städte bereit, Kinder und Jugendliche aufzunehmen, erklärte stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Dieses Engagement müsse politisch gewürdigt, weitere rechtliche Möglichkeiten müssten eröffnet werden.
Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg, warf Europa fehlende Humanität vor. "Das ist beschämend und eine Folge rechtspopulistischen Gedankenguts in Europa", sagte er der "Passauer Neuen Presse". "Wir müssen zeigen, dass Humanität in Europa keine Dekoration ist, sondern zu seinen Grundpfeilern gehört. Das gilt für alle Europäer." Es sei erschreckend, dass die Regierungen von Polen, Ungarn und Tschechien eine Haltung zeigten, die nicht nur unsolidarisch sei, "sondern jedem christlichen Denken widerspricht", sagte Sternberg.
Ostermärsche erstmals ohne Straßen-Kundgebungen

epd-bild/Christian Ditsch
Dortmund (epd). Der diesjährige Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr ist am Ostermontag nach dreitägiger Dauer zu Ende gegangen. Unter anderem gab es in Bochum-Werne einen online-Friedensgottesdienst ohne Kirchgänger. Der Mitorganisator des digitalen Ostermarsches Rhein-Ruhr, NRW-Landesgeschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienstgegner Joachim Schramm, zog eine positive Bilanz der traditionsreichen Veranstaltung im Netz. "Vor dem Hintergrund, dass das für uns alle Neuland war, sind wir mit der Resonanz und Beteiligung der Mitglieder aus Friedensbewegung, Anti-Atom-Bewegung und Klimaschützern zufrieden", sagte Schramm dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Hunderte Menschen hätten ihre Fotos von ihren privaten Aktionen auf Balkonen, in Gärten oder bei Spaziergängen an das Ostermarschbüro geschickt. Zudem hätten rund 500 Personen das Video zu Auftakt am Karsamstag mit Rede- und Musikbeiträgen zum Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr angeklickt, schilderte Schramm. Der Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr 2020 fand unter dem Motto "Atomwaffen verbieten - Klima schützen - Nein zur EU-Armee" statt. Es war in der 60-jährigen Geschichte der Ostermarschbewegung hierzulande seit 1982 das erste mal, dass Demonstrationen und Kundgebungen nicht auf der Straße stattfanden. Auf Transparenten im Ruhrgebiet hieß es mit Bezug auf die Corona-Krise "Geld für Gesundheit statt für Rüstung oder "Beatmungsgeräte statt Atombomber".
Organisatoren mit Online-Ostermarsch Rhein-Ruhr zufrieden
Schramm vom Büro des Ostermarsches Rhein-Ruhr kritisierte, dass die Politik in Deutschland trotz der aktuellen Corona-Krise mit ihrer Ausweitung der Militärausgaben "einfach so weitermacht". Schramm wies dazu auf die Ankündigung von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer (CDU) hin, die während der Ostertage erklärt habe, am Ankauf neuer Atombomber festzuhalten. "Das zeigt, wie notwendig unser Engagement ist und wie schade, dass wir unseren Protest dagegen nicht auf die Straße bringen konnten." In den vergangenen Jahren nahmen an den regionalen Aktionen bis zu 2.500 Menschen teil.
Der langjährige Organisator des Ostermarsches Rhein-Ruhr wies auch auf einzelne Aktionen von Mitgliedern der Friedensbewegung hin, die etwa in Duisburg oder in Bonn mit mehreren Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln für Frieden und gegen eine weitere Militarisierung protestiert hatten. In Hattingen im Ruhrgebiet habe es in einem Mehrgenerationenhaus über vier Etagen eine gemeinsame Aktion von Friedensfreunden gegeben, die ihre Transparente und Fahnen allesamt gleichzeitig auf den Balkonen präsentiert hätten.
"Ostermarsch 2020 - Ohne Marsch - Aber in Bewegung"
Schramm bedauerte im Gespräch mit dem epd, dass der für den Ostersamstag geplante Osterspaziergang der örtlichen Friedensbewegung in Köln nicht habe stattfinden dürfen und warf den Ordnungsbehörden "Willkür" vor. Die Anmelder des Osterspaziergangs hätten im Vorfeld die Einhaltung von Mindestabständen sowie das Tragen von Mund-Nase-Masken zugesagt. Ein Sprecher des Online-Ostermarsches Rhein-Ruhr zog am 13. April das Fazit: "Ostermarsch 2020 - Ohne Marsch - Aber in Bewegung." Man hoffe, im kommenden Jahr wieder - wie gewohnt - auf der Straße demonstrieren zu können.
Fotos von "Osterspaziergängern"
Auch das Bremer Friedensforum und das Friedenszentrum in Braunschweig hatten ihre "Ostermärsche" mit Redebeiträgen und Forderungen online gestartet. Gerade in Corona-Zeiten werde die Notwendigkeit einer friedens- und abrüstungspolitischen Wende überdeutlich, so die Initiatoren. Sie forderten "weniger Mittel für todbringende Rüstung und Kriegseinsätze" und mehr für den Gesundheits- und Sozialbereich sowie für Klimaschutz.
Das Friedensbüro Hannover veröffentlichte auf seiner Internetseite Fotos von "Osterspaziergängern", die Plakate mit Forderungen der Friedensbewegung hoch hielten. Auf der Internetseite warnte der Hamburger Schauspieler Rolf Becker vor einer Lastenverteilung von oben nach unten angesichts wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie. Der Waffenexport bleibe uneingeschränkt, kritisierte er. "Die Einschränkung demokratischer Rechte, bislang von der Mehrheit der Bevölkerung noch hingenommen, schreitet fort."
Die Ostermärsche hatten ihren Ursprung Ende der 50er Jahre in Großbritannien. Den ersten Ostermarsch in der Bundesrepublik gab es 1960 in der Lüneburger Heide. Zu den Hochzeiten der Friedensbewegung zu Beginn der 80er Jahre kamen Hunderttausende zu den Kundgebungen. Danach wurde die Ostermarschbewegung schwächer, erlebte aber wegen Kriegen, etwa in Jugoslawien, immer wieder Zulauf.
Konfliktforscher warnt vor Stimmungsumschwung

epd-West/Universität Bielefeld
Bielefeld (epd). Der Konfliktforscher Andreas Zick sieht bei lange anhaltenden Einschränkungen in der Corona-Krise die Gefahr eines Stimmungswechsels in der Gesellschaft. Der Streit um die Lockerung mehre sich bereits, sagte der Wissenschaftler in Bielefeld dem Evangelischen Pressedienst (epd). Werde die freiwillige Einwilligung immer mehr als erzwungene Einwilligung erlebt, dann orientierten sich Menschen an anderen, die das als Freiheitsentzug interpretieren und revoltieren, warnte Zick.
Es komme daher darauf an, gewünschte Maßnahmen "weiterhin als Bitte und freiwillige Entscheidung zu organisieren", erklärte der Konfliktforscher. Auch müsse der Appell mit ausgewogenen Informationen über Gefahren wie auch mit positiven Nachrichten gekoppelt werden. Der gemeinsame Gesundheitsschutz könne jetzt Gemeinsamkeit schaffen, wie es der Klimaschutz auch in den vergangenen Monaten geschafft habe. "Zwang allein wird das Gegenteil erzeugen", warnte Zick.
Krisen durch Epidemien verstärken laut Zick bei vielen Menschen die Verunsicherung. Damit werde eine Flucht in eine vermeintliche Sicherheit attraktiv. Das könne zu autoritärem Verhalten oder auch zu einer pragmatischen Angepasstheit führen, erklärte der Wissenschaftler. In autoritären Regimen wie Ungarn sei die Gesellschaft durch Verbote sowie Ausgrenzungen von Gruppen in eine autoritäre Situation gebracht worden.
In Deutschland ist die Lage nach Worten Zicks jedoch anders: "Ich denke, wir sind in einem Prozess einer temporären Vergemeinschaftung, der notwendig ist, in Krisenzeiten, die nicht von politischen Krisen gezeichnet sind", sagte der Wissenschaftler. Aktuell suchten Menschen Sicherheit bei denen, die die Krankheit verstehen. Hier seien nicht Autoritäten des Staates, sondern der Ärzte und Wissenschaftler gefragt. "Wir sind in der Pandemie zu einer Expertinnen- und Expertengesellschaft geworden", sagte Zick.
Wenn die Krise jedoch länger andauere, könnten wirtschaftliche Krisen oder soziale Krisen durch die Isolation verstärkt werden, warnte Zick. Ohnmacht mache zudem anfällig für Populismus. Das könne dann Einstellungen stärken, es gäbe minderwertigere Andere und korrupte Eliten. Problematisch werde es, wenn der Logik des Marktes die Gefahrenabwehr für andere geopfert werde, sagte der Wissenschaftler. Das treffe oft Minderheiten, wie die Fälle von geringerer Gesundheitsprävention für Geflüchtete in Unterkünften oder an den Grenzen zeigten.
Historikerin: In der Krise fragen Menschen nach Sinn des Lebens
Osnabrück (epd). Die Vorsitzende des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands, Eva Schlotheuber, erwartet infolge der Corona-Pandemie, dass Fragen dem Sinn des Lebens wieder an Gewicht gewinnen. Die klassischen Kirchen würden von einer stärkeren Hinwendung der Menschen zum Glauben allerdings nicht profitieren, sagte Schlotheuber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (9. April). Die Corona-Krise ändere an deren Problemen nichts. "Vielleicht werden wir ganz neuartige religiöse Strömungen sehen", sagte die Universitätsprofessorin.
Pandemien "waren und sind immer wieder Ausgangspunkt von etwas grundsätzlich Neuem". Sie offenbarten "schonungslos die Schwächen des Status quo", sagte Schlotheuber. Daher werde auch das Coronavirus die gesellschaftlichen Paradigmen spürbar verschieben.
"Vor Überreaktionen hüten"
Wichtig sei es jetzt, "nüchtern zu bleiben und uns vor Überreaktionen zu hüten". Man wisse aus der Geschichte, dass Pandemien stets von Scharlatanerie, Hetze und Unruhen begleitet würden, sagte Schlotheuber: "Jede andere Annahme wäre naiv. Da sind wir alle gefragt gegenzuhalten."
Die Historikerin wandte sich gegen vorschnelle Schuldzuweisungen, wie etwa dem Kapitalismus einen Anteil zuzuschreiben. "Es ist erwartbar, wenn argumentiert wird, der Mammon sei letztlich an allem schuld", sagte sie und mahnte: "Denken Sie an die Judenverfolgungen und das Aufkommen der Legenden, dass sie die Brunnen vergiftet hätten in den Zeiten der großen Pest. Diese Stigmatisierung geschah auch vor dem Hintergrund ihrer großen Rolle beim Geldverleih."
Wichtig sei, die wirklichen Ursachen von Fehlentwicklungen in den Blick zu nehmen. Für denkbar halte sie, dass die globale Mobilität von Menschen und Waren stärker reflektiert wird.
"Aita Mari" rettet Flüchtlinge vor Malta
Ein kleines spanisches Rettungschiff holte am Ostermontag vor Malta Flüchtlinge aus einem sinkendem Schlauchboot. Die 149 Flüchtlinge der "Alan Kurdi" mussten unterdessen weiter auf dem deutschen Schiffs ausharren.Rom (epd). Das spanische Rettungsschiff "Aita Mari" hat am Ostermontag 47 Flüchtlinge aus einem sinkenden Schlauchboot gerettet. Nach Angaben der Hilfsorganisation "Salvamento Maritimo Humanitario" befand sich unter den Geretteten eine Schwangere, sechs Migranten seien bewusstlos gewesen. Das Boot ist demnach eines von vier Booten, die vor mehreren Tagen Notrufe abgesetzt hatten. Die 149 Flüchtlinge der "Alan Kurdi" mussten unterdessen am 13. April auf dem deutschen Rettungsschiff ausharren, obwohl die Italien ihnen tags zuvor ein Quarantäne-Schiff zugesagt hatte.
Die Migranten könnten aufgrund der Gesundheitslage nicht in einem italienischen Hafen an Land gehen, teilte der italienische Katastrophenschutz mit. Die "Alan Kurdi" befindet sich derzeit in internationalen Gewässern vor der sizilianischen Stadt Palermo. Der italienische Rundfunk berichtete unter Berufung auf das römische Innenministerium, Deutschland sei bereit, die Migranten im Anschluss an die Quarantäne aufzunehmen.
Widersprüchliche Angaben über Bootsunglück
Der italienische Küstenschutz widersprach unterdessen Berichten über ein vermutetes Bootsunglück vor der libyschen Küste. Das von einem Flugzeug der europäischen Grenzschutzagentur Frontex fotografierte Boot ohne Motor sei "wahrscheinlich in den vergangenen Tagen Gegenstand einer Rettungsaktion der libyschen Behörden" gewesen, teilte die italienische Behörde am 13. April mit. Auf den Bildern seien weder Leichen noch auf dem Wasser schwimmende Gegenstände auszumachen.
Die Berliner Hilfsorganisation Sea-Watch hatte zuvor berichtet, bei dem Boot handle es sich vermutlich um eines der vier Boote, die mit der Notruf-Initiative "Alarm Phone" Kontakt aufgenommen hatten. Das Boot mit 85 Menschen an Bord sende keine Signale mehr. "Wir müssen annehmen, dass alle ertrunken sind, da es keine Infos über Rettungen gibt."
Nachdem am 12. April ein Boot mit 101 Flüchtlingen die Südküste von Sizilien erreicht hatte, gingen am Tag darauf weitere 77 in Portopalo im Osten der Insel an Land. Damit erreichten in den vergangenen Tagen insgesamt fünf Flüchtlingsboote aus eigenen Kräften Sizilien.
Mit Blick auf die "Alan Kurdi begrüßte "Sea-Eye"-Sprecher Gorden Isler die Übernahme der Migranten auf ein italienisches Quarantäne-Schiff. "Eine solche Lösung wäre aus humanitären Gründen die beste Lösung", sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Schiffe der italienischen Küstenwache seien größer und besser geeignet, die Geretteten aufzunehmen. "Wir wären für eine solche Lösung sehr dankbar", fügte Isler hinzu.
Rom sieht Berlin in der Pflicht
Unklar sei aber weiter, wo die Migranten nach den 14 Tagen Quarantäne an Land gehen könnten. Die Regierung in Rom sieht Deutschland als Flaggenstaat der "Alan Kurdi" in der Pflicht. Italien und Malta hatten schon frühzeitig gewarnt, dass ihre Häfen für Flüchtlingsschiffe wegen der Corona-Krise geschlossen seien. Die Bundesregierung hatte am Mittwoch erklärt, sie sei mit allen Beteiligten im Gespräch, um eine Lösung zu finden.
Laut der Bordärztin der "Alan Kurdi" ist bisher kein Crewmitglied und auch keiner der Geretteten an Covid-19 erkrankt. Die Flüchtlinge sind seit ihrer Rettung aus Seenot vor der libyschen Küste am13. April unter beengten Verhältnissen auf dem Schiff. Die 17-köpfige Crew hatte beklagt, dass sie unter hohen psychischen Belastungen stehe und unter Schlafmangel leide. Die Crew müsse nicht nur die Menschen versorgen, sondern auch immer wieder Konflikte schlichten.
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, äußerte sich angesichts der Rettungsaktion der "Aita Mari" froh und dankte den Helfern. "Gott will das Leben", schrieb er bei Facebook: "Das ist die Botschaft des Osterfests." Zuvor hatte er an Malta und andere EU-Staaten appelliert, die Flüchtlinge im Mittelmeer nicht ertrinken zu lassen.
Papst Franziskus wandte sich unterdessen in einem Schreiben an italienische Seenotretter und sagte seine Unterstützung zu. "Danke für alles, was ihr tut. Ich möchte euch sagen, dass ich immer bereit bin, euch zu helfen. Zählt auf mich", erklärte der Papst.
Ex-Amnesty-Generalsekretär Volkmar Deile gestorben
Berlin (epd). Der langjährige Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Volkmar Deile, ist tot. Der evangelische Theologe starb bereits am 2. April im Alter von 77 Jahren, wie sein Freundeskreis am 8. April in einer Anzeige mitteilte. Deile leitete von 1990 bis 1999 die deutsche Sektion der Menschenrechtsorganisation. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und vertrat diese von 1981 bis 1984 auch im Koordinationsausschuss der Friedensbewegung, der die großen Bonner Friedensdemonstrationen von 1981 und 1983 organisierte.
Volkmar Deile stehe für die Abrüstungs- und Friedensbewegung in den 80er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, würdigte ihn die Aktion Sühnezeichen auf ihrer Homepage. Er habe eine Theologie nach Auschwitz geprägt, die sich im christlich-jüdischen Gespräch, in der Arbeit gegen Antisemitismus und in der Orientierung an Frieden und Menschenrechten zeigte.
"Ökumenischer Horizont stets politisch geerdet"
Mit klugen und besonnenen Beiträgen habe Deile "unser Denken über Frieden und Gerechtigkeit voran gebracht und geschärft. Sein weiter ökumenischer Horizont war stets politisch geerdet", würdigten ihn zahlreiche Weggefährten, darunter der Erfurter Altpropst Heino Falcke, der frühere Generalsekretär der Friedensbewegung Pax Christi, Joachim Garstecki, sowie der frühere Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Konrad Raiser, mit seiner Frau Elisabeth Raiser, die evangelische Präsidentin des ersten Ökumenischen Kirchentages 2003 in Berlin war.
Mehr rechtsextrem motivierte Straftaten in 2019
Der Mord an Lübcke, Schüsse in Halle, ein Blutbad in Hanau - rechtsextremistische und antisemitische Attentate haben in den vergangenen Monaten für Entsetzen gesorgt. Auch die Gesamtzahl der rechtsextrem motivierten Straftaten steigt.Berlin, Essen (epd). Die Zahl rechtsextrem motivierter Straftaten ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Politikerin Irene Mihalic hervorgeht, wurden für 2019 insgesamt 22.337 Delikte vorläufig im Kriminalpolizeilichen Meldedienst für Politisch Motivierte Kriminalität gemeldet, bei denen die Tat einen rechtsextremen Hintergrund hatte. 2018 zählte die Polizei 20.431 rechtsextrem motivierte Straftaten, 2017 insgesamt 20.520. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe (7. April) darüber berichtet.
Unter die für 2019 gemeldeten Delikte fallen laut Ministerium vor allem Propagandadelikte und Fälle von Volksverhetzung, aber auch fast 1.000 versuchte und vollzogene Gewalttaten wie Körperverletzung und in Einzelfällen auch Tötungsdelikte. Bei den rechtsextremistisch motivierten Gewaltdelikten zeichne sich ein Rückgang ab, von 1.156 im Jahr 2018 auf 986 im vergangenen Jahr. Die endgültigen Fallzahlen zur politisch motivierten Kriminalität werden laut Innenministerium voraussichtlich im Mai vorgestellt.
Insgesamt hat die Polizei laut vorläufigen Angaben der Bundesregierung im vergangenen Jahr 41.175 politisch motivierte Straftaten festgestellt, ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. 2018 waren es 36.062 Delikte, 2017 noch 39.505. Darunter wurden jeweils auch die versuchten Straftaten aufgeführt. Laut der Statistik hatten im vergangenen Jahr in 9.849 Fällen Linksextremisten politisch motivierte Straftaten verübt. 427 Delikte sind demnach religiös begründet.
Erneuter Anstieg der antisemitischen Straftaten
Laut den Angaben der Bundesregierung zeichnet sich auch ein erneuter Anstieg der antisemitischen Straftaten in Deutschland ab. Demnach registrierte die Polizei für 2019 vorläufig 2.032 Delikte, die sich gegen Menschen jüdischen Glaubens oder ihre Einrichtungen richteten. 2018 waren es nach endgültigen Polizeistatistiken 1.799 Fälle.
Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, erklärte, die aktuellen Zahlen zu rechtsextrem motivierten Straftaten "verdeutlichen den Ernst der Lage, der von der Bundesregierung zu lange nicht erkannt wurde". Sie betonte: "Insbesondere die vielen Angriffe gegen Jüdinnen und Juden offenbaren ein erschreckendes Bild und fordern nach einer nachhaltigen Strategie gegen Rechtsextremismus. Wir können nicht akzeptieren, dass jüdische Menschen in Deutschland dieser steigenden Anzahl von Straf- und Gewalttaten ausgesetzt sind."
Auch in den ersten Wochen dieses Jahres hat bereits ein rechtsextremistischer Anschlag die Bundesrepublik erschüttert: Im hessischen Hanau erschoss im Februar ein Mann neun Menschen mit Migrationshintergrund, einige von ihnen in einer Shisha-Bar. Vor einem halben Jahr schockierte eine Tat in Halle das Land: Dort wurden im Oktober eine Frau und ein Mann von einem Täter erschossen, der ein Blutbad in einer Synagoge geplant hatte. Im Juni sorgte der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke für Entsetzen. Der 65-jährige CDU-Politiker war vor seinem Wohnhaus mit einem Kopfschuss getötet worden. Der Tatverdächtige war laut Verfassungsschutz jahrzehntelang in der rechten Szene aktiv.
Bund verstärkt Antisemitismusforschung
Die Corona-Krise führt zu einer steigenden Judenfeindlichkeit. In den sozialen Netzwerken werden die Juden und Israel für das Virus verantwortlich gemacht. Der Bund will die Antisemitismusforschung stärken, um besser dagegen ankämpfen zu können.Berlin (epd). Die Bundesregierung sieht mit Sorge den wachsenden Antisemitismus im Zuge der Corona-Krise. So wird in sozialen Medien Israel beschuldigt, das Coronavirus als Biowaffe entwickelt zu haben und dunkle, jüdische Mächte würden die Pandemie nutzen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. "In Krisenzeiten sind die Menschen besonders anfällig für krude Erklärungsversuche", warnte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, am 7. April in Berlin: "Wir müssen alles dafür tun, um uns dagegen zu wehren", unter anderem durch Aufklärung und staatliche Repressionen.
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach von einer "inakzeptablen und abscheulichen Judenfeindlichkeit", die es in Deutschland nach wie vor gebe und den gesellschaftlichen Frieden gefährde. Gemeinsam mit Klein kündigte sie eine Verstärkung der Antisemitismusforschung in Deutschland an.
Wissen über Entstehung und Verbreitung von Judenhass
Dazu sollen zwischen 2021 und 2025 Forschungsverbünde mit insgesamt zwölf Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Mit den Geldern sollen laut Karliczek unter anderem interdisziplinäre Forschungsvorhaben gefördert, Ursachen und Verbreitung von Antisemitismus praxisbezogen untersucht und geeignete Gegenmaßnahmen entwickelt werden.
Es bestehe "dringender Handlungsbedarf", sagte Karliczek. Antisemitismus sei "Gift für unsere Gesellschaft" und eine wachsende Gefahr: "Wir müssen besser wissen, wo und wie er auftritt, worauf er zurückzuführen ist und wie wir ihn wirksam bekämpfen können." Forschung sei dabei die Grundlage einer wirksamen Prävention. "Wir werden dem Antisemitismus auch wissenschaftlich zu Leibe rücken", kündigte die Bundesforschungsministerin an. Seine Bekämpfung brauche "Evidenz-basiertes Wissen". Deshalb sei die neue Förderung wichtig.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, sprach von einem wichtigen Baustein der Gesamtstrategie gegen Judenhass. Die neue Förderung werde dazu beitragen, das Wissen über Entstehung und Verbreitung von Judenhass zu verbessern und zu vernetzen.
"Wie Covid-19"
"Antisemitismus ist wie Covid-19: ansteckend, lebensgefährlich und bedroht alle", sagte Klein. Gerade in Krisenzeiten wie diesen hätten Verschwörungstheorien Hochkonjunktur, Juden würden zu Sündenböcken gestempelt. "Diese Theorien in Kombination mit Gewaltfantasien können sehr gefährlich werden wie die Beispiele Halle und Hanau gezeigt haben", warnte Klein. Aber auch vor Corona sei die Judenfeindlichkeit in Deutschland schon stark ausgeprägt gewesen. "Je verrohter eine Gesellschaft ist, umso antisemitischer wird sie", sagte Klein: "Deshalb: Je mehr wir über Antisemitismus wissen, umso besser können wir ihn bekämpfen."
Antisemitismusforschung ist den Angaben zufolge bislang keine eigene Wissenschaftsdisziplin, sondern ein interdisziplinäres Querschnittsthema. So forschen zum Beispiel Wissenschaftler aus den Geschichts- und Literaturwissenschaften, der Philosophie, Theologie oder Jura an antisemitischen Erscheinungsformen. Mit der neuen Förderlinie sollen sie interdisziplinär und standortübergreifend enger miteinander vernetzt werden.
Stilles Gedenken in Buchenwald

epd-bild/Maik Schuck
Weimar (epd). In aller Stille ist am 11. April in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar der Befreiung des Konzentrationslagers durch Häftlinge und Einheiten der US-Streitkräfte am 11. April 1945 gedacht worden. Wegen der Corona-Krise wurden die Kränze zum 75. Jahrestag des historischen Ereignisses nur von Mitarbeitern der Gedenkstätte abgelegt. Zudem wurde eine Webseite mit einer "Thüringer Erklärung" freigeschaltet.
Sie solle das Gedenken an die Opfer ermöglichen, erklärte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Offizielle Veranstaltungen wie ein für den 5. April geplanter Gedenkakt im Deutschen Nationaltheater Weimar mit Buchenwald-Überlebenden wurden wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt.
Die von der Stiftung, den Repräsentanten der höchsten Verfassungsorgane und Überlebenden der Lager verfasste Erklärung trägt den Titel "75 Jahre danach - Historische Verantwortung wahren - Demokratie und Menschenrechte verteidigen". Auf der Webseite befinden sich zudem Statements von Überlebenden und Nachgeborenen sowie die Reden, die bei den Gedenkveranstaltungen in Weimar und in Nordhausen gehalten werden sollten.
Stiftungsdirektor Volkhard Knigge rief "alle Menschen guten Willens" dazu auf, sich der Erklärung anzuschließen. Sie setzten damit auch ein Zeichen gegen diejenigen, die vom Nationalsozialismus als "Vogelschiss" sprechen würden oder eine Kehrtwende der Erinnerungskultur forderten. Eine Unterzeichnung der Erklärung ist auf der Webseite möglich.
Mahnung von Huber
In einer Videobotschaft bezeichnete Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Verbrechen in den NS-Konzentrationslagern als Ausdruck der Zerstörung von Humanität und von Menschlichkeit. Die Erinnerung daran müsse wachgehalten werden, weil sich diese Menschheitsverbrechen niemals wiederholen dürften. Das bleibe "unsere Verantwortung in der heutigen Zeit und in der Zukunft", sagte Ramelow.
In einer Rede, die der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Wolfgang Huber, am 7. April in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora halten wollte, rief dieser zum "Widerstand gegen die 'Hölle von Dora' - heute erst recht" auf. Lange hätten die Deutschen geglaubt, menschenfeindlichen Hass und kollektive Verachtung hinter sich gelassen zu haben, schilderte der Theologe und Sozialethiker: "Heute erkennen wir, dass dies alles andere als ein sicherer Besitz ist." Gewalttaten, die sich aus Hass und Verachtung gegen Fremde richteten wie gegen diejenigen, die sich schützend vor sie stellten, "müssen uns aufrütteln", mahnte Huber.
Insgesamt starben laut Stiftung von 1937 bis 1945 mehr als 76.000 Männer, Frauen und Kinder in Buchenwald und Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Mehr als 340.000 Menschen aus ganz Europa wurden in die beiden KZ und ihre Außenlager verschleppt.
"Paar sein reicht nicht aus"

epd-bild/Doris Burger
Konstanz/Kreuzlingen (epd). Vorne am Grenzzaun wird gelacht. Drei Freundinnen haben sich hier verabredet, um endlich einmal wieder zu klönen. Eine steht auf der Schweizer Seite, zwei auf der deutschen Seite im Konstanzer Gebiet "Klein Venedig". Auch diese beiden halten Abstand, laut müssen alle drei sprechen. Denn zwei Meter beträgt die Distanz, der doppelte Zaun macht Diskretion unmöglich. So schnappt man Satzfetzen auf, um den kleinen Sohn der einen geht es gerade, um seine Beschäftigung rund um die Uhr, um volle Windeln. Alltagsgespräche in Zeiten der Corona-Pandemie.
"Wir haben uns verabredet, damit wir uns nach drei Wochen endlich wieder sehen können", sagt eine. Die Situation finden sie selbstredend "weniger schön". Vorher war die Grenze gar nicht spürbar, jetzt ist sie wegen der Corona-Krise geschlossen. Nun spielt plötzlich die Nationalität wieder eine große Rolle. "Eine weit größere, als man dachte", gibt eine der Deutschen zu Protokoll.
Doppeltes Pech
Die dritte Freundin ist auch Deutsche, wohnt aber im schweizerischen Kreuzlingen und darf jetzt nicht mehr rüber. Einschränkungen im Alltag hat sie kaum: "Okay, ich darf nicht mehr in Deutschland einkaufen". Ihre Namen wollen die Freundinnen aber nicht nennen: "Wir sind alle drei im öffentlichen Dienst. Das ist eine andere Rolle." Jetzt sind sie privat da. Für die Grenzschließung zeigen sie Verständnis: "Wenn man sich an die Regeln hält, kann man auch damit umgehen. Der Grund dafür ist in Ordnung."
Zwanzig Meter weiter weg vom See geht es traurig zu. Ein Paar sitzt hier, zu Boden gesunken sind beide. Sie plaudern leise über die Distanz. Man darf stören und erfährt, welch doppeltes Pech beide gerade haben. Etienne wohnt in Singen und geht am Gymnasium in Gaienhofen in die Abiturklasse. Seine Schweizer Freundin Maria wohnt in St. Gallen, sie steht ebenfalls kurz vor der Matura. Schwierige Zeiten für die Vorbereitung der Abschlussprüfungen, das private Kontaktverbot kommt erschwerend hinzu.
Erst zum zweiten Mal treffen sie sich hier am Zaun. Dieses Mal dürfen sie sich nicht einmal mehr umarmen. Etienne hat seiner Freundin ein T-Shirt mitgebracht, er wollte es ihr hinüberwerfen. Sofort wurden sie ermahnt: Das ist verboten, kein Austausch von Gegenständen, egal welcher Art! Die Schweizer Grenzer seien aber freundlich gewesen, so berichten die beiden: Das nächste Mal sei eine Buße fällig, 100 Schweizer Franken wurden angedroht. Dieses Mal beließen es die Grenzer bei einer Ermahnung - und Marie durfte das T-Shirt behalten. "Die Zöllner können auch nichts dafür", zeigt sich Etienne verständnisvoll.
Seit zwei Jahren sind die beiden ein Paar, sich zu besuchen war bislang kein Problem. Mit dem Zug fuhr Etienne von Singen nach Konstanz, über Kreuzlingen ging es flott nach St. Gallen. Jetzt sind sie betrübt: "Paar sein reicht nicht aus", sagen sie. Es ist kein Grund für einen Grenzübertritt. Eine Änderung ist zudem nicht in Sicht.
Provisorischer Zaun verdoppelt
Umarmungen und Ball spielen sind inzwischen verboten, Austausch von Gegenständen sowieso. Mitte März, nach der Grenzschließung, hatte die deutsche Bundespolizei zunächst einen Zaun aufgestellt. Am vergangenen Freitag wurde der provisorische Zaun verlängert und auf der Schweizer Seite verdoppelt.
2006 war der frühere Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz abgebaut und durch eine "Kunstgrenze" ersetzt worden. Bis vor wenigen Wochen konnten Spaziergänger noch ungehindert am Seeufer entlang schlendern und die roten Tarot-Figuren passieren. "Die Skulpturen des Künstlers Johannes Dörflinger stehen als Symbol für ein friedliches Europa ohne Grenzen", hieß es in einer Mitteilung der Stadt Konstanz.
Zurück zum Zaun - nach der Grenzschließung. "Am Wochenende war es richtig voll hier", berichten zwei Konstanzerinnen. Sie wissen noch eine Geschichte vom Vormittag zu berichten: Ein Enkel hatte seine Gitarre mitgebracht - und dem Opa auf der anderen Seite ein Lied gespielt.
Corona-Krise: Folkwang-Universität bietet Hilfsfonds für Studenten
Essen (epd). Die Folkwang-Universität der Künste will mit einem Hilfsfonds ihre Studenten in der Corona-Krise unterstützen. Folkwang-Studierende, die in diesem Sommersemester eingeschrieben sind, können mit einer Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro unterstützt werden, wie die Universität mitteilte. Insgesamt stehen rund 22.000 Euro zur Verfügung. Eingerichtet wurde der Fonds gemeinsam mit der "Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang-Universität".
Die bewilligten Gelder werden zweckgebunden "zur direkten Finanzierung des Lebensunterhalts und akuter Zahlungsverpflichtungen ausgezahlt", wenn ein "massiver finanzieller Engpass entstanden ist", teilte die Folkwang-Universität weiter mit. Nicht gefördert würden Abschlussprojekte, Reisekosten, Tagungsteilnahmen oder Instrumentenkauf. Anträge können bis spätestens zum 31. Mai gestellt werden.
Die Studenten seien parallel zu ihrer Ausbildung durch ihre verschiedenen Tätigkeiten beispielsweise als Musiker oder Musik- und Tanzpädagogen tragende Säulen der Kulturlandschaft, erklärte Folkwang-Rektor Andreas Jacob. Durch die weitgehende Einstellung des gesellschaftlichen Lebens seien den Studenten Verdienstmöglichkeiten weggebrochen. Im Gegenzug für die Hilfsfondsmittel setzt die Universität die für Juli geplante "Folkwang Preis Gala" aus. Sie soll durch eine Benefizveranstaltung in der zweiten Jahreshälfte ersetzt werden.
Gericht will Loveparade-Prozess einstellen
Wegen der Corona-Pandemie steht der Loveparade-Prozess vor der Einstellung. Durch die aktuellen Einschränkungen sieht das Gericht sieht kaum Chancen, vor einer Verjährungsfrist zu weiteren Urteilen zu kommen.Duisburg (epd). Das Landgericht Duisburg schlägt eine Einstellung des Loveparade-Prozesses vor. Wegen des Verbreitungsrisikos des Coronavirus könne das Verfahren nur eingeschränkt geführt werden, erklärte das Gericht am 7. April. Unter den Beteiligten gehörten mehrere Menschen zur Risikogruppe. Derzeit sei nicht absehbar, wann die Verhandlung fortgesetzt werden könne. Anwälte von Opfern und Angehörigen kritisierten eine mögliche Einstellung des Prozesses und forderten eine Debatte des Landtages über die Konsequenzen.
Für den Fall einer Fortführung sei mit einer "erheblichen Dauer des weiteren Verfahrens zu rechnen", erklärte das Gericht. Spätestens am 27. Juli dürfte allerdings der Vorwurf der fahrlässigen Tötung verjähren. Das Gericht sehe deshalb eine "sehr geringe Wahrscheinlichkeit", den angeklagten Sachverhalt verurteilungsreif aufzuklären. Die Prozessbeteiligten werden gebeten, bis zum 20. April eine Stellungnahme zum Vorschlag des Gerichts abzugeben.
Kanzlei: Weiterer "schwarzer Tag" für die Opfer der Katastrophe
Die Kanzlei Baum Reiter & Collegen erklärte, es sei ein "weiterer schwarzer Tag" für die Opfer der Katastrophe und ihre Angehörigen. Mit einer Einstellung des Verfahrens könnten die Angeklagten wahrscheinlich nicht zu Verantwortung gezogen werden, obwohl sie nach Einschätzung des Gerichts wahrscheinlich wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden wären. Die Geschädigten seien maßlos enttäuscht. "Wir erwarten nun eine Abschlussdebatte des Landtags über die Konsequenzen aus dem gescheiterten Loveparade-Prozess und die Konsequenzen, die die Landesregierung aus dem Sachverständigen-Gutachten unter anderem im Hinblick auf die Rolle der Polizei ziehen wird", erklärte die Kanzlei.
Im Prozess um das Loveparade-Unglück von Duisburg sollte ab dem 24. März der Sachverständige Jürgen Gerlach sein schriftliches Gutachten vorstellen. Der Verkehrsexperte der Universität Wuppertal sollte die Ursachen für das Gedränge im Tunnel und den Zugang zum Loveparade-Gelände am alten Güterbahnhof erläutern und erklären, wie das Unglück hätte verhindert werden können. Seine Befragung sollte über acht Sitzungstage laufen.
In dem im Dezember 2017 gestarteten Prozess mussten sich zunächst zehn Angeklagte unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Bei einem Gedränge auf dem Techno-Festival waren am 24. Juli 2010 in Duisburg 21 Menschen gestorben, mehr als 600 wurden verletzt.
Strafprozess gegen sieben Angeklagte mittlerweile eingestellt
Im Februar 2019 wurde bereits der Strafprozess gegen sieben Angeklagte ohne Auflagen eingestellt. Gegen drei weitere Mitarbeiter der Veranstalterfirma Lopavent wurde das Verfahren fortgesetzt, weil sie eine Einstellung des Prozesses abgelehnt hatten. Die Einstellung hatte die Staatsanwaltschaft damit begründet, dass das für ein Urteil erforderliche Beweisprogramm nicht bis zum Ablauf der Verjährungsfrist im Juli 2020 zu absolvieren sei. Zudem sei ein wesentliches Ziel bereits erreicht: die Aufklärung der Ursachen des Unglücks.
Nach Einschätzung des Gerichts ist die Loveparade-Katastrophe neben Planungsfehlern auf "kollektives Versagen" am Veranstaltungstag zurückzuführen. Dabei hätten unter anderem die Einrichtung einer Polizeikette auf der Rampe zum Gelände sowie Kommunikationsprobleme und Fehlentscheidungen eine Rolle gespielt.
Landeskriminalamt deaktiviert Fake-Seiten für Corona-Soforthilfen
Düsseldorf (epd). In Nordrhein-Westfalen warnen der Wirtschafts- und Innenminister ausdrücklich vor falschen Corona-Soforthilfe-Seiten. Die Ermittlungskommission des nordrhein-westfälischen Landeskriminalamtes (LKA NRW) habe in den letzten Tagen bereits mehrere gefälschte Internet-Seiten im Zusammenhang mit der Corona-Soforthilfe abschalten lasse, teilten die Ministerien am 12. April gemeinsam in Düsseldorf mit. Kriminelle versuchten dennoch weiterhin, über gefälschte Internet-Seiten an die Daten von Betroffenen zu gelangen.
Das Wirtschaftsministerium hatte am 9. April die offiziellen Corona-Soforthilfe-Seiten der NRW-Landesregierung vom Netz genommen. Nach ersten Hinweisen auf Fake-Webseiten, die in Suchergebnissen prominent platziert waren, hatte das Wirtschaftsministerium zuvor bereits Strafanzeige wegen Betrugs erstattet.
Land erstattet Strafanzeige wegen Betrugs
Innenminister Herbert Reul (CDU) betonte, dass die Seiten "frappierend echt" aussähen. Allein durch neue Hinweise am Wochenende sei deutlich geworden, dass es über 90 Fake-Seiten gebe. Das LKA arbeite mit Hochdruck daran, diese perfiden Machenschaften aufzudecken. "Ich kann nur an die Bürgerinnen und Bürger appellieren: Bitte rufen Sie keine gefälschten Internetseiten auf und geben dort keine Daten ein."
Die Ermittler des LKA Nordrhein-Westfalen arbeiten weiter intensiv daran, gefälschte Seiten zu identifizieren und über die Server-Betreiber, die sich meist im Ausland befinden, abzuschalten, wie die Ministerien erklärten. Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwischen 3.500 bis 4.000 Antragsteller betroffen.
Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) warnte: "Jede Soforthilfe-Seite, die Sie jetzt im Netz finden, ist ein Fake. Gehen Sie den Betrügern nicht auf den Leim." Nach dem Stopp der NRW-Soforthilfe werde mit Bezirksregierungen, Finanzverwaltung und dem statistischen Landesamt IT.NRW daran gearbeitet, betrügerische Anträge herauszufiltern und das Antragsverfahren mit zusätzlichen Checks im Hintergrund sicherer zu machen. Der Minister appellierte: "Lassen Sie sich nicht von Ergebnislisten großer Suchmaschinen täuschen. Wir werden Sie über die weiteren Schritte in den kommenden Tagen informieren."
Soziales
"Menschen nehmen zum ersten Mal ihre Umgebung wahr"

epd-bild / Gustavo Alàbiso
Kassel (epd). Neben Joggen und Radfahren gehört das Spazierengehen zu den wenigen Dingen, die derzeit in der Öffentlichkeit noch erlaubt sind - wenn auch mit strikten Beschränkungen und Distanzregeln. Dem Spaziergang komme ein neuer Stellenwert zu, beobachtet Martin Schmitz. Er ist Professor an der Kunsthochschule Kassel und beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Spazierengehen. "Einige Menschen erkunden jetzt zum ersten Mal ihre nähere Umgebung, da ihr Mobilitätsradius eingeschränkt ist oder sie zu Hause arbeiten. Bislang wussten sie wahrscheinlich eher, wie es auf Mallorca oder in ihrem italienischen Urlaubsort aussieht als direkt vor ihrer Haustür", sagt er.
Dabei könnten Spaziergänger wichtige Entdeckungen machen: "Da Stadtplanung in den letzten Jahren im wesentlichen Verkehrsplanung war, werden dem eingefleischten Autofahrer nun die Probleme der Fußgänger vielleicht bewusster", hofft Schmitz. Er hat die "Lucius und Annemarie Burckhardt Professur" inne, benannt nach dem Schweizer Gelehrten Lucius Burckhardt (1925-2003), der die sogenannte Spaziergangswissenschaft begründet hat.
Promenadologie
Bisher habe der Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder anderen Zielen immer strikt von A nach B geführt, sagt Schmitz. Zum Wandern sei man gezielt aus der Tiefgarage in idyllische Landschaften gefahren. Nun aber geht es oft einfach nur darum, mal frische Luft zu schnappen. "Das absichtslose Umherstreifen in der unmittelbaren Umgebung eröffnet ganz neue Perspektiven", erklärt Schmitz. Dies könne zu einer größeren Bereitschaft führen, sich um deren Gestaltung zu kümmern.
Die noch junge Spaziergangswissenschaft, auch Promenadologie genannt, spielt vor allem für Designer, Städtebauer und Architekten eine Rolle. In ihr wird der Zusammenhang zwischen Bewegung, Wahrnehmung und Gestaltung erforscht. Es geht darum, sich den eigenen Stadtraum oder die umgebende Landschaft zu erschließen.
Ihr Begründer Lucius Burckhardt schaffte es posthum 2017 sogar auf die Weltkunstausstellung documenta: In Athen und Kassel waren eine kleine Auswahl aus seinen 800 "landschaftstheoretischen Aquarellen" sowie ein Teil seiner persönlichen Bibliothek zu sehen. Die Aquarelle sollten laut documenta so etwas wie eine "Theorie der Landschaft" ergeben. Denn eine der Grundfragen, die Burckhardt sein ganzes Lehrerleben über begleiteten, sei die Frage gewesen, warum Landschaft schön sei.
"Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein"
Spazierengehen als Methode gibt es auch in der Philosophie: "Ich kann nur beim Gehen nachdenken. Bleibe ich stehen, tun dies auch meine Gedanken", schrieb einst der Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Und Johann Wolfgang von Goethe ließ im "Faust" die Menschen im "Osterspaziergang" jubeln: "Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein". Ausgedehnte Osterspaziergänge in großen Gruppen wie bei Goethe, wo alle der Enge ihrer Zimmer und Häuser entfliehen, sind allerdings in diesem Jahr nicht möglich.
Dafür wird der Spaziergang zurzeit - mangels Alternativen - öfter auch mit der Familie unternommen. Ob die familiären Spaziergänge auch zum Zusammenhalt derselben einen Beitrag leisten können? "Hoffentlich", sagt Schmitz.
Von der Schockstarre in den digitalen Hörsaal

epd-bild/Gudrun Petersen
Aachen, Essen (epd). Wie ausgestorben wirkt der Campus, erzählt Student Marc Gschlössl. Normalerweise tummelt sich ein Großteil der mehr als 45.000 Studierenden auf dem Gelände der RWTH Aachen, gerade zum Semesterwechsel: Sie schreiben Klausuren, bereiten sich in der Bibliothek vor oder absolvieren Praktika in den Laboren. Doch das Coronavirus legt auch das Leben an der Uni lahm: Prüfungen sind abgesagt, der Start der Veranstaltungen auf dem Campus auf den 20. April verschoben.
Falls auch danach noch Kontaktverbote gelten, arbeiten die deutschen Hochschulen auf Hochtouren daran, ihre Lehre noch stärkern ins Netz zu bringen. Die Fernuniversität Hagen konnte ganz normal zum April in ihr Sommersemester starten. Die Uni kündigte zudem an, ihre Expertise im zeit- und ortsunabhängigen Studium mit den anderen Hochschulen zu teilen.
Interaktive Planspiele, Video-Tutorials, Vorlesungen mit Audio-Begleitung
Die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe baut ihr Online-Angebot nach eigenen Angaben massiv aus, die Wirtschaftswissenschaften bieten etwa interaktive Planspiele, Video-Tutorials und Vorlesungen mit Audio-Begleitung im Internet an. Auch die Universität Duisburg-Essen arbeitet "fieberhaft daran, wie wir das kommende Semester möglicherweise ganz 'in räumlicher Distanz' bewältigen können", wie Sprecherin Ulrike Bohnsack mitteilt. Über mögliche Online-Prüfungen stimmten sich alle NRW-Universitäten und das Land gemeinsam ab.
Aus studentischer Sicht ist dieser Digitalisierungsschub auch eine Chance: "Wir haben die große Hoffnung, dass viel ausprobiert wird", sagt Marc Gschlössl, der auch Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der RWTH Aachen ist. Studenten würden ebenfalls eingebunden, die Video-AG der Fachschaft Informatik filme etwa Vorlesungen. Jedoch gibt er zu bedenken: "Die Hochschule ist gigantisch groß, es wird sehr schwer, das gesamte Lehrangebot online zu bringen." Allein an der RWTH seien 700 Prüfungen abgesagt worden.
Asta verzeichnet mehr Nachfrage nach Sozialdarlehen
Manche Studenten können deshalb ihr Studium nicht abschließen, andere haben ihren Studentenjob verloren. Beim Asta fragen deshalb immer mehr junge Menschen nach einem Sozialdarlehen, das die Studierendenvertretung zinsfrei vergibt. Bis zu 40 Mal die Woche beraten nach den Angaben des Asta-Chefs die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Asta derzeit zum Thema Darlehen. Etwa drei der Ratsuchenden entschieden sich, einen Antrag auf das Darlehen zwischen 300 und 3.000 Euro zu stellen. Normalerweise wenden sich ein oder zwei Menschen mit Anfragen wegen des Darlehens an das Sozialreferat.
"Die Studierenden haben noch nicht die großen finanziellen Probleme, aber wir prognostizieren, dass die kommen werden", sagt der 22-Jährige. Ein oder zwei Monatsmieten könnten viele auch ohne Job auffangen, doch danach werde es schwierig. Die Anfragen bewegten sich im Moment zwischen reiner Information und Studenten, die berichten: "Bei mir brennt alles, ich war vorher schon in Geldnöten und jetzt ist das Fass übergelaufen."
Die Initiative "Arbeiterkind" beobachtete bei den Ratsuchenden an ihrem Infotelefon zunächst eine Schockstarre, die sich langsam auflöse, berichtet Katja Urbatsch, die Gründerin der Organisation zur Förderung des Studiums von Erstakademikern in Berlin. Am härtesten getroffen seien Studierende, die sich selbst finanzieren müssten - und das seien mehrheitlich Studierende aus nicht-akademischen Familien.
"Arbeiterkind" schaltet Infotelefon
Langsam kämen auch in NRW mehr Anfragen bei "Arbeiterkind", erzählt Bundeslandkoordinatorin Cara Coenen. "Es ist eine große Verunsicherung zu spüren." Die Studierenden könnten die Bibliotheken und PC-Pools nicht mehr nutzen - und hätten damit auch keinen Zugriff mehr auf aufwendigere und teurere Programme, die sie etwa für ein Architekturstudium bräuchten.
"Arbeiterkind" sei jedoch "ganz normal weiter erreichbar", online und per Telefon, betont Cara Coenen. Engagierte in Bonn und Frankfurt bieten ihre Sprechstunden für Ratsuchende per Skype an, manche treffen sich zum Stammtisch nun online, außerhalb von NRW etwa in Bremen, Leipzig und Karlsruhe.
Blutspenden per Ticket
Auch in Aachen verlagerten die engagierten Studenten ihr Hochschulleben ins Netz, berichtet der Asta-Chef. Auf einer Internet-Seite bündelt der Asta Informationen über Kulturangebote. Kulturschaffende können ihre Angebote online stellen, andere treffen sich zum digitalen Spieleabend oder empfehlen Bücher.
Zudem gibt es die Nachbarschaftshilfe. Fast 300 Menschen bieten auf der Seite des Asta an, Besorgungen für andere zu erledigen. Noch näher kommen sich die Engagierten bei der Blutspendeaktion, die der Asta unterstützt. Täglich "rennen die Leute uns die Bude ein", erzählt Marc Gschlössl. Die Menschen stehen auf dem Campus Schlange, mit etwa zwei Metern Abstand, manche sitzen in der Sonne. Mittlerweile hat der Asta ein Ticketsystem und eine App eingeführt, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig auflaufen, berichtet der Student der Sprach- und Kommunikationswissenschaften. Zwischen 150 und 200 Menschen kommen pro Tag, um in der Corona-Krise ihr Blut abzugeben.
"Wortspende"-Aktion der Diakonie Bonn bringt Freude
Bonn (epd). Die "Wortspenden"-Aktion der Diakonie Bonn bringt nach Erfahrung der Pflegefachkraft Kathrin Ketzer Freude und Abwechslung in den Alltag von Pflegebedürftigen. Zwei Wochen nach dem Aufruf, Pflegebedürftigen einen Brief zu schreiben, sei die Bilanz durchweg positiv, sagte Ketzer, Pflegefachkraft im Ambulanten Pflegedienst des Pflege- und Gesundheitszentrums des Diakonischen Werks, dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Viele Kunden reagieren gerührt, manche sind richtig begeistert," berichtete Ketzer.
Insgesamt gingen in den ersten beiden Wochen der Aktion 120 Briefe von 77 Absendern ein. Die Diakonie hatte die "Wortspenden"-Aktion gestartet, um für ältere, pflegebedürftige Menschen während der Zeit der Corona-Ausgangssperre Kontaktmöglichkeiten zu schaffen. Die Briefe werden von den Diakonie-Pflegekräften zu den Patienten mitgenommen und teilweise auch vorgelesen.
"Manche unserer Kunden sehen nur uns Pfleger einmal am Tag", berichtete Ketzer. "Deshalb ist es auch für uns Pfleger entlastend, wenn wir den Menschen in dieser Zeit etwas Positives mitbringen können." Die Absender sind aufgerufen, die Umschläge mit groben Themen-Stichworten zu versehen, so dass die Pflegefachkräfte den passenden Empfänger auswählen können. Zum Teil hätten ältere Menschen geschrieben, die selbst noch gesund und mobil seien, beobachtete Ketzer, die einigen ihrer Kunden Briefe vorlas. Es seien aber auch eine Reihe jüngere Briefeschreiber dem Aufruf gefolgt.
Fantasievolle Briefe aus dem Alltag mit Corona
"Ich habe mich gewundert, wie fantasievoll die Menschen geschrieben haben", berichtete die Pflegefachkraft. Viele Absender hätten darüber berichtet, wie sie die Corona-Krise erleben und empfinden. "Das war aber immer mit einer positiven Sicht verbunden", stellte Ketzer fest. So hätten die Schreiber zum Beispiel festgestellt, dass sie nun mehr Zeit hätten, zur Ruhe zu kommen oder die Krise als Chance für künftige gesellschaftliche Entwicklungen begriffen. Eine Absenderin habe etwa selbst geschriebene Kurzgeschichten geschickt, eine alleinerziehende Mutter habe ihren Alltag im Homeoffice zusammen mit ihrem Sohn geschildert.
Alle Absender seien auch auf die Situation der Pflegebedürftigen eingegangen, die in dieser Zeit weniger Kontakte hätten, weil sie zur Risikogruppe gehören. Bemerkenswert sei auch, dass viele Schreiber ihre Briefe am Computer mit besonders großer Schrift erstellt hätten, damit sie besser lesbar seien, sagte Ketzer. Die Empfänger seien so gerührt gewesen, dass alle auf die Briefe reagieren und sich bedanken wollten. "Es kann auch sein, dass auf diese Weise längerfristige Briefkontakte entstehen", sagte Ketzer. Die Aktion sei allerdings nicht gedacht, um persönliche Besuche oder soziale Betreuung zu vermitteln.
Nach den ersten positiven Erfahrungen mit den "Wortspenden" wünscht sich Ketzer, dass die Aktion auch nach der Corona-Krise wiederholt wird. "Man sollte das zu bestimmten Anlässen im Jahr stattfinden lassen, vielleicht zu Weihnachten in der dunklen Jahreszeit."
DGB warnt vor Abrutschen in Hartz IV durch Kurzarbeit
Kurzarbeit in der Corona-Krise trifft untere Einkommensgruppen besonders hart. Laut Gewerkschaftsbund könnten viele Beschäftigte im Einzelhandel und der Gastronomie in die Grundsicherung abrutschen.Essen, Berlin (epd). Beschäftigten im unteren Lohnbereich droht laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) durch die Corona-bedingte Kurzarbeit ein Abrutschen in Hartz IV. Betroffen sind davon vor allem Beschäftigte in Dienstleistungsberufen wie Einzelhandel, Gastronomie und der Gebäudereinigung, wie aus Daten des Gewerkschaftsbundes hervorgeht, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegen. Der Gewerkschaftsbund fordert deshalb eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds.
Da wegen der Corona-Krise die Arbeit in vielen Betrieben komplett ausgesetzt wurde, leben laut DGB derzeit viele Beschäftigte vollständig vom Kurzarbeitergeld. Für Mitarbeiter von Restaurants etwa, deren Arbeitsplätze geschlossen sind, bedeute dies, dass sie mit rund 720 Euro im Monat auskommen müssten. Gebäudereiniger haben nach den Berechnungen des DGB rund 780 Euro zur Verfügung. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet.
Auch Kulturschaffende, die oft ebenfalls geringe Einkommen haben, könnten demnach leicht unter die Grenze der Grundsicherung rutschen, hieß es. Zusätzliche Härten entstünden für Beschäftige, die bislang in Teilzeit gearbeitet haben. Viele von ihnen müssten ergänzend Hartz IV beantragen.
DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach forderte eine deutliche Anhebung des Kurzarbeitergeldes. "Um halbwegs gut durchzukommen, sind mindestens 80 Prozent des normalen Verdienstes nötig", sagte Buntenbach den Funke-Zeitungen. Wenn Tausende zusätzlich Hartz IV beantragen müssten, weil sie von dem krisenbedingten Mini-Einkommen einfach nicht leben könnten, dann zahle das am Ende schließlich auch die Gemeinschaft." Kosten und Lasten der Krise müssten gerecht verteilt werden.
NRW entschädigt Eltern für Verdienstausfall wegen Kinderbetreuung
Münster (epd). Berufstätige und selbstständige Eltern, die wegen der Corona-Pandemie ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, erhalten vom Land Nordrhein-Westfalen eine Entschädigung für ihren Verdienstausfall. Betroffene sollen bis zu 67 Prozent ihres Nettoeinkommens, maximal 2.016 Euro im Monat bekommen, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am 6. April in Münster mitteilte. "Wir lassen die Menschen, die wegen der Kinderbetreuung finanzielle Einbußen haben, nicht im Regen stehen", sagte NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU)
Der Anspruch auf Entschädigung bestehe, wenn die Kita oder Schule aufgrund einer behördlichen Anordnung geschlossen sei und Kinder unter zwölf Jahren oder mit einer Behinderung nicht anderweitig betreut werden könnten, erklärte der LWL. Nicht erstattet werde der Ausfall für die Schließung während der Schulferien oder wenn die berufstätigen Eltern Kurzarbeitergeld beziehen oder während einer Freistellung weiter bezahlt werden.
Arbeitgeber sollen die Entschädigungen ab April für maximal sechs Wochen an ihre Beschäftigten auszahlen, wie es hieß. Sie könnten sich diese Gelder ebenso wie 80 Prozent der Sozialabgaben für die betroffenen Beschäftigten über den LWL beziehungsweise den Landschaftsverband Rheinland (LVR) erstatten lassen. Selbstständige Eltern sollten sich demnach ebenfalls an die Landschaftsverbände wenden.
Die Entschädigung für den Verdienstausfall erfolgt den Angaben zufolge aufgrund einer neuen Regelung im Infektionsschutzgesetz, die der Deutsche Bundestag am 25. März beschlossen hatte. Für Nordrhein-Westfalen wird den Angaben zufolge mit 270.000 Anträgen gerechnet. Erstattungsanträge könnten voraussichtlich ab Anfang Mai gestellt werden, hieß es.
Corona-Krise bringt private Kitas in Finanznot
Essen (epd). Die privat finanzierten Kindertageseinrichtungen in NRW sehen sich durch die Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet. Zwar habe Familienminister Joachim Stamp (FDP) zugesagt, dass Land und Kommunen die Finanzierung der wegen der Pandemie geschlossenen Kitas weiter sicherstellen wollten, teilte der NRW-Landesverband des Deutschen Kitaverbandes am 8. April in Essen mit. Diese Zusage gelte jedoch nur für Kitas, die bereits zuvor aus öffentlichen Mitteln gefördert wurden.
Für die privat finanzierten Kita-Träger fühle sich dagegen niemand zuständig, beklagte der Verbandsvorsitzende Klaus Bremen. Diese Einrichtungen finanzierten ihre Betriebskosten vor allem durch Elternbeiträge, die jedoch durch die derzeitigen Kita-Schließungen größtenteils wegfielen. Dabei beteiligten sich auch die privaten Kita-Träger an der Notfall-Betreuung etwa für Beschäftigte von Krankenhäusern oder Arzt-Praxen.
Wie Gastbetrieben oder Hotels stünden den privat finanzierten Kitas bei Einnahme-Ausfällen Förder- und Kreditprogramme offen, die für die gewerbliche Wirtschaft vorgesehen sind, hieß es. Doch vor Ort fühle sich niemand zuständig, kritisierte Bremen. Er forderte in einem Schreiben die Unterstützung des Landesfamilienministeriums und der Kommunen sowie klare Zuständigkeiten und eine unbürokratische Beratung und Information für die privat finanzierten Kita-Träger.
Dem 2019 gegründeten NRW-Landesverband des Deutschen Kitaverbandes gehören nach eigenen Angaben derzeit rund 35 Träger mit 20.000 Kita-Plätzen an.
Für viele arme Kinder eine Katastrophe
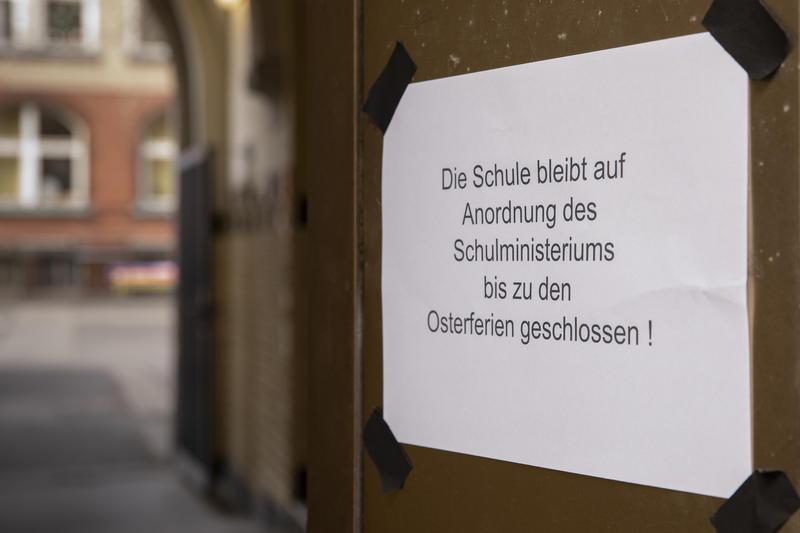
epd-bild/Guido Schiefer
Mainz, Stuttgart (epd). Manchmal sieht Christiane Steinhauer (Name geändert) ihre Schützlinge jetzt schon morgens um sieben Uhr auf den Spielplätzen. "Sie wissen, das Ordnungsamt kontrolliert so früh noch nicht", erzählt die Schulsozialarbeiterin einer Brennpunktschule aus Baden-Württemberg. Manche der Kinder leben in Familien, in denen sich zehn Personen eine Drei-Zimmer-Wohnung teilen müssen. Viele haben weder Handy noch Laptop. Das sind keine guten Voraussetzungen, um bis zum Ende der Corona-Krise selbstständig zu Hause zu lernen. Auch Lehrkräfte schlagen Alarm: Eine nennenswerte Zahl der Schüler ist seit Wochen praktisch nicht mehr auffindbar.
Seit Mitte März befindet sich das gesamte Schulsystem bundesweit im Ausnahmezustand. Bis auf eine Notbetreuung bleiben alle Schulen geschlossen, stattdessen senden die Lehrer ihren Klassen Aufgaben nach Hause und bleiben über Schul-Portale im Internet in Kontakt. "Meine Bilanz sieht trotz der schwierigen Umstände sehr, sehr positiv aus", sagt Stefanie Hubig, rheinland-pfälzische Bildungsministerin und aktuelle Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Aber selbst sie räumt ein, dass sich ihr Ministerium Sorgen um Familien mache, die "digital nicht gut ausgestattet" sind oder die ihren Kindern nicht die nötige Unterstützung geben können.
Kind nicht erreichbar
Ein Schulleiter aus Rheinhessen wird deutlicher. Von manchen Schülern gebe es seit Schließung der Schule keinerlei Rückmeldung mehr. E-Mails gingen ins Leere, auch telefonisch seien einige Familien nicht zu erreichen. "Noten, Zeugnisse und Versetzungen - solche Dinge lassen sich irgendwie regeln", sagt er. "Aber das ist eine echte Katastrophe."
Rheinland-Pfalz hat als Sofortmaßnahme inzwischen beschlossen, dass rund 25.000 in den Schulen und kommunalen Medienkompetenz-Zentren eingelagerte Rechner an Schüler ausgeliehen werden können. Hubig ist auch offen für den Vorschlag, armen Familien die Anschaffung der nötigen Technik für ihre Kinder zu finanzieren. Derzeit sei das im Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes ausdrücklich nicht vorgesehen.
Julia Netzer, Förderschullehrerin aus Hessen, macht in der Corona-Krise auch gegenteilige Erfahrungen. Sie unterrichtet gewöhnlich eine Klasse, in der es allein sechs Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gibt, und eigentlich hätte sie vor Ostern das Thema "Mittelalter" behandelt. Der geplante Bau einer Ritterburg aus Pappe sei nun zum Projekt für zu Hause geworden, die Ergebnisse könnten sich sehen lassen. Manche hätten in der Corona-Krise sogar mehr gearbeitet, als sonst in der Schule.
Aber auch bei ihr fallen Schüler durch das Raster. Bei fünf aus einer elfköpfigen Gruppe wisse sie nicht, ob die seit Mitte März überhaupt etwas gelernt hätten. Ein Kind, das gar nicht erreichbar sei, komme aus einer Familie, in der kaum jemand lesen und schreiben könne: "Da nützt es auch nichts, wenn ich Arbeitsblätter per Post schicke."
"Mutmacherbriefe" scheitern am Datenschutz
"Es trifft die Schicht, die schon immer benachteiligt war", sagt Christiane Steinhauer resigniert. Sie erlebt bei vielen Verantwortlichen den Wunsch, die Krise ohne viel Mühe auszusitzen und vielleicht noch etwas Geld zu sparen. So wurde ihre Arbeitszeit nach Schließung der Schulen sofort um 50 Prozent gekürzt, obwohl viele Schüler gerade in der häuslichen Enge einen Ansprechpartner bräuchten. Als sie den Kindern ihrer Schule "Mutmacherbriefe" schicken wollte, bekam sie keine Adressen - offiziell wegen Datenschutzbedenken. Kontakt zu den Schülern hält sie jetzt nur noch über WhatsApp, obwohl die Nutzung der problematischen App im Schuldienst verboten ist.
"Vielen Schülern geht es psychisch nicht gut", sagt die Sozialarbeiterin. Weil sie es zu Hause oft nicht aushielten und die Arbeitsaufträge der Lehrer nicht verstehen könnten, gebe es für viele nur einen Ausweg - den Erwachsenen so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen und so zu tun, als seien Ferien.
Eltern fordern Unterstützung für behinderte Kinder im Heimunterricht
Düsseldorf (epd). Eltern fordern Unterstützung für den Heimunterricht von Kindern mit Behinderungen. Bei dem von der Landesregierung wegen der Corona-Pandemie eingeführten Heimunterricht seien Kinder mit Förderbedarf nicht berücksichtigt worden, heißt es in einem am 14. April in Düsseldorf veröffentlichten Offenen Brief der Initiative "Gemeinsam Leben und Lernen Düsseldorf" an die Landesregierung. Viele der Kinder benötigten eine Schulbegleitung an ihrer Seite, das gelte auch für den Unterricht zu Hause.
Der Verein fordert eine einheitliche Regelung für die Schulbegleitung. Aktuelle handhabe das jede Kommune anders, erklärte "Gemeinsam Leben und Lernen". In Köln und Aachen würden Schulbegleiter auch im Einsatz bei den Kindern zu Hause finanziert, in Düsseldorf und Bielefeld bislang jedoch nicht. Das sei rechtlich nicht haltbar, erklärte Verein. Die Schulbegleitungen sollten dem Sozialgesetzbuch zufolge ausdrücklich die "Teilhabe an Bildung" sicherstellen.
Kinder mit Förderbedarf dürften nicht in ihrer Teilhabe an Bildung behindert werden, erklärte der Verein. Für den Fall, dass das Home-Schooling auch nach den Osterferien bestehen bleibe, müsse diese Ungerechtigkeit beseitigt werden und den Kindern ab 20. April die Teilnahme am Unterricht ermöglicht werden. Der Brief richtetet sich an Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sowie an Schulministerin Yvonne Gebauer und Familienminister Joachim Stamp (beide FDP).
Zahl der Organspender stagniert
Frankfurt a.M. (epd). Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 932 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe für eine Transplantation gespendet. Damit habe sich die Zahl der Organspender annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (955) gehalten, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am 7. April in Frankfurt am Main mit. Insgesamt seien 2019 knapp 3.000 Organe postmortal gespendet worden, darunter 1.524 Nieren, 726 Lebern, 329 Lungen und 324 Herzen.
Wie sich die Organspende und die Transplantationen in diesem Jahr entwickeln werde, sei angesichts der Coronavirus-Pandemie völlig ungewiss, schreiben die beiden Stiftungsvorstände Axel Rahmel und Thomas Biet im Vorwort des Jahresberichts für 2019. Die ersten beiden Monate 2020 zeigten eine deutliche Steigerung der realisierten Organspenden gegenüber dem Vorjahr. Dies sei ein positives Zeichen. Allerdings seien die Patienten auf den Wartelisten aktuell ganz besonders gefährdet: zum einen durch das Coronavirus, das für diese schwer vorerkrankten Patienten ein besonderes Risiko darstelle, zum anderen durch eine mögliche Einschränkung der medizinischen Vorbereitung zur Organspende während der Pandemie. 2019 hätten insgesamt 9.271 Patienten auf der Warteliste gestanden (2018: 9.400).
340 Kinder auf der Warteliste
Erstmals gibt es im DSO-Jahresbericht 2019 einen Abschnitt zur Transplantation bei Kindern bis 15 Jahre. Sie mache zwar nur einen kleinen prozentualen Anteil aller Transplantationen aus, aber hinter jeder einzelnen Zahl stehe ein großes Schicksal, heißt es dort. Für Kinder und ihre Familien sei allein schon die Wartezeit eine große psychische Belastung.
Nach den DSO-Zahlen standen 2019 rund 340 Kinder auf der Warteliste für ein Organ, die meisten für eine Leber und eine Niere. Die Lebendspende sei für die Transplantation bei Kindern eine lebenswichtige Alternative zur postmortalen Spende. 22 Prozent der Nierentransplantationen und 32 Prozent der Lebertransplantationen seien 2019 aufgrund einer Lebendspende ermöglicht worden.
Deutsche trinken weiterhin zu viel Alkohol

epd-bild/Maike Glöckner
Hamm (epd). In Deutschland wird nach Angaben der von Suchtexperten nach wie vor zu viel Alkohol getrunken. Jeder Bundesbürger ab 15 Jahren hat im Jahr 2017 durchschnittlich 10,5 Liter Reinalkohol getrunken, wie aus dem am 8. April in Hamm veröffentlichten "Jahrbuch Sucht 2020" der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) hervorgeht. Das ist nur leicht weniger als im Vorjahr. Deutschland zähle noch immer international zu den Hochkonsumländern, erklärten die Suchtexperten. Einen Anstieg gab es auch beim Tabak für Wasserpfeifen sowie beim Drogenkonsum und Medikamentenmissbrauch.
Der Gesamtverbrauch an alkoholischen Getränken in Deutschland stieg nach Angaben der Suchtexperten im Jahr 2018 um 0,3 Liter auf 131,3 Liter an alkoholischen Getränken je Einwohner. Diese Menge entspreche in etwa einer Badewanne an Bier, Wein, Schaumwein und Spirituosen, erklärte die Hauptstelle für Suchtfragen. Insgesamt drei Millionen Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland hatten demnach im Jahr 2018 eine alkoholbezogene Störung. Je zur Hälfte geht es dabei um Missbrauch (1,4 Millionen) und Abhängigkeit (1,6 Millionen).
Rund 74.000 Todesfälle werden den Angaben nach jährlich allein durch Alkoholkonsum oder den kombinierten Konsum von Tabak und Alkohol verursacht. Etwa 13,5 Prozent aller Todesfälle in Deutschland seien auf die Folgen des Rauchens zurückzuführen.
Zigaretten sind "out", Wasserpfeifen "hip"
Die Zahl der Raucher in Deutschland sei weiterhin rückläufig. Raucher sind nach Daten der Suchtexperten 26 Prozent der Männer und 19 der Frauen ab 15 Jahren. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Zigaretten lag im Jahr 2019 bei 900. Bei Jugendlichen sei der Trend zum Nichtrauchen bereits seit rund 15 Jahren zu beobachten. Es gebe jedoch weiterhin erheblichen Nachholbedarf bei der nachhaltigen Verringerung des Tabakkonsums und beim verbesserten Nichtraucherschutz, hieß es.
Mit insgesamt 74,6 Milliarden wurden den Angaben zufolge 0,3 Prozent mehr Fertigzigaretten als im Vorjahr konsumiert. Der Verbrauch von Feinschnitt ging um zwei Prozent auf 23.813 Tonnen zurück. Das entspreche etwa 35,7 Milliarden selbst gedrehter Zigaretten.
Erneut stark angestiegen ist nach Angaben der Suchtexperten der Konsum von Wasserpfeifentabak und Pfeifentabak. Im Jahr 2019 wurden 4.150 Tonnen verbraucht. Das sei ein Plus von fast 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das sei vor allem auf die Beliebtheit des speziellen Wasserpfeifentabaks zurückzuführen sein, den vor allem Jugendliche und junge Erwachsene in Shisha-Bars oder zu Hause rauchten.
Nach Hochrechnungen waren nach Angaben der Suchtexperten im Jahr 2018 309.000 Erwachsene im Alter von 18 bis 64 Jahren abhängig von Cannabis. Rund 41.000 der bis 64-Jährigen waren abhängig von Kokain, 103.000 Menschen von Amphetaminen. Derzeit erhielten 79.400 Menschen in Deutschland eine Substitutionstherapie. Die Zahl der polizeilich registrierten drogenbedingten Todesfälle lag im Jahr 2019 bei fast 1.400. Das sei Anstieg von 9,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.276 Drogentote).
Auch Drogen- und Medikamentenmissbrauch zugenommen
Aktuellen Schätzungen zufolge hätten 15,2 Millionen Erwachsene im Alter sowie etwa 477.000 Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren mindestens einmal in ihrem Leben eine illegale Droge konsumiert. Nach wie vor nehme Cannabis in allen Altersgruppen unter den illegalen Drogen die prominenteste Rolle ein.
Erhöht hat sich den Angaben zufolge auch der Missbrauch von Medikamenten. Schätzungen zufolge seien bis 1,9 Millionen Menschen in Deutschland medikamentenabhängig. Dabei gehe es vor allem um rezeptpflichtige Beruhigungs- und Schlafmittel sowie opioidhaltigen Schmerzmittel. Betroffen seine vor allem ältere Frauen, weil sie häufig über einen langen Zeitraum Psychopharmaka verordnet bekommen.
Medien & Kultur
Corona: WhatsApp beschränkt die Weiterleitung von Nachrichten

epd-bild/Friedrich Stark
Berlin (epd). Häufig weitergeleitete Nachrichten, die schon mit einem Doppelpfeil-Symbol gekennzeichnet sind, könnten ab sofort nur noch einzeln an einen Chat weitergeleitet werden, teilte das Unternehmen am 7. April in Berlin mit.
Mit dem gestiegenen Kommunikationsaufkommen in den letzten Wochen sei auch ein Anstieg von weitergeleiteten Nachrichten festzustellen, heißt es weiter. Weitergeleitete Nachrichten könnten auch zur Verbreitung von Falschinformationen beitragen. "Damit die Kommunikation auf WhatsApp sicher und privat bleibt, werden wir die Möglichkeit, häufig weitergeleitete Nachrichten noch weiter zu verbreiten, eindämmen."
Weiterleitungskennzeichnung
Bereits im letzten Jahr sei eine Weiterleitungskennzeichnung für Nachrichten eingeführt worden. Wenn eine Nachricht mehr als fünfmal weitergeleitet worden sei, werde diese mit einem Doppelpfeil-Symbol markiert, um Nutzern anzuzeigen, dass die Nachricht nicht von einem persönlichen Kontakt stammt. Diese Änderungen an der Weiterleitungsfunktion hat laut WhatsApp zu einem weltweiten Rückgang von weitergeleiteten Nachrichten um 25 Prozent geführt.
WhatsApp ist ein 2009 gegründeter Nachrichtensofortversand, der seit 2014 zu Facebook gehört. Nutzer können sich unter anderem (Sprach-)Nachrichten, Texte, Bilder und Videodateien schicken und miteinander kommunizieren.
Corona: Von der Tracking- zur Tracing-App
Frankfurt a.M. (epd). In der Diskussion um wirksame Maßnahmen gegen das Corona-Virus steht derzeit eine App für Smartphones im Mittelpunkt, die die Nachverfolgung von potentiellen Corona-Kontakten ermöglichen soll. Ihr Einsatz könnte kommen mit der Lockerung der aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens.
Synonym werden dabei die Begriffe Tracking- und Tracing-App verwendet. Indessen gibt es inhaltliche Unterschiede zwischen Tracing (zeitlich versetztes Verfolgen) und dem Tracking (gleichzeitiges Verfolgen).
Im März stellte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen Entwurf vor, demzufolge Funkzellen-Daten abgefragt werden sollen zur Verfolgung von potenziellen Corona-Kontaktpersonen. Doch diese Überlegung war politisch auf großen Widerstand gestoßen: Die Echtzeit-Handy-Standort-Daten seien aus datenschutzrechtlicher Perspektive zu personalisiert - es ließen sich zu viele Rückschlüsse auf Individuen und ihre sozialen Netze ziehen, bemängelten Kritiker. Für den Zweck der Corona-Nachverfolgung seien sie auch zu ungenau. Mit den Funkzellendaten lässt sich zwar grob eingrenzen, wo sich Mobiltelefone und ihre Nutzer aufgehalten haben, aber über physische Kontakte, bei denen potenziell eine Übertragung des Virus stattgefunden haben könnte, geben sie keine oder zu wenig Auskunft.
Übertragung per Bluetooth
Derzeit wird deshalb eine Technologie diskutiert, die genauer arbeiten soll und weniger personalisierte Daten speichert. Auch geht es dabei weniger um eine gleichzeitige Verfolgung, sondern um eine Nachverfolgung, also um das Tracing von potenziellen Corona-Kontakten: Nutzer und Nutzerinnen laden dazu die Tracing-App auf ihr Smartphone und schalten die Bluetooth-Funktion ihres Smartphones an. Alle paar Minuten erzeugt die App eine neue temporäre ID und sendet diese aus, um die Person beziehungsweise das Gerät zu anonymisieren.
Wenn zwei Geräte mehr als 15 Minuten weniger als zwei Meter voneinander entfernt waren und damit der Kontakt aus epidemiologischer Sicht relevant war, wird die anonyme ID auf dem Telefon abgespeichert. Auf die Weitergabe von Ortsdaten wird verzichtet. Interessant ist nämlich vor allem, ob die potenziell ansteckende Begegnung drinnen oder draußen stattgefunden hat, wie lange sie gedauert hat, wie nah sich die Beteiligen kamen und wer - anonymisiert - miteinander in Kontakt stand.
Daten lokal gespeichert
Erst wenn eine Person später positiv auf das Virus getestet wird, kann sie ihre lokal gespeicherten Daten auf den Server laden. Dort wird dann ausgewertet, mit welchen anderen temporären IDs das Handy in Kontakt war. Der Server kann dann diese Handys per App benachrichtigen. Der jeweilige Nutzer bekommt dann die Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben und sich beim Gesundheitsamt zu melden. Das alles soll auf freiwilliger Basis geschehen und ist umso wirkungsvoller, je mehr Menschen sich die App herunterladen. Dann nämlich stehen mehr Daten zur Verfügung und eine lückenlose Nachverfolgung wäre möglich.
Derzeit sitzt ein internationales Team aus Wissenschaftlern, IT-Fachleuten und einzelnen Unternehmen unter der Federführung des Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut) an der Entwicklung der PEPP-PT (Pan European Privacy Protecting Proximity Tracing) -Technologie, die genutzt werden könnte, um eine App zu konfigurieren. Zudem ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beteiligt sowie der Bundesdatenschutzbeauftragte. Das Robert Koch-Institut wird die App dann voraussichtlich veröffentlichen.
Jüngere schauen in der Corona-Krise wieder mehr Fernsehen

epd-bild/Jens Schulze
Frankfurt a.M. (epd). In der Corona-Krise schauen Jüngere in Deutschland wieder mehr klassisches Fernsehen. "Vor allem jüngere Zielgruppen kehren auf der Suche nach qualitativ hochwertiger Information zum linearen Fernsehen zurück", teilte die AGF Videoforschung am 8. April in Frankfurt am Main mit. Der langfristige Abwärtstrend, das Abwandern junger Zielgruppen in andere Medienkanäle, sei vorerst gestoppt.
Bei den 14- bis 49-Jährigen habe die Sehdauer im März bei 157 Minuten gelegen und damit zehn Prozent über dem Niveau vom Februar 2020. Bei den 14- bis 19-Jährigen habe das Plus 15,2 Prozent betragen, erklärte die AGF.
Beim Gesamtpublikum habe die Sehdauer mit durchschnittlich 244 Minuten sogar um 18 Minuten beziehungsweise 7,9 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen. Auch im Vergleich zum Februar 2020 hätten sich deutliche Effekte gezeigt: Binnen eines Monats sei die Sehdauer um 6,5 Prozent gestiegen. Das entspreche einem Plus von 15 Minuten.
Nettoreichweite steigt
Auch die Nettoreichweite, also der Anteil der Menschen, die im Monat mindestens einmal Kontakt mit dem Medium Fernsehen hatten, ist laut AGF gestiegen. Der Anteil habe von 70,9 Prozent im März 2019 auf 75,0 Prozent im März 2020 zugelegt. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen habe die Steigerung bei 3,5 Prozentpunkten auf 64,0 Prozent im März 2020 gelegen.
Die AGF Videoforschung erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland. Sie wird in Form einer GmbH von ihren Gesellschaftern ARD, ProSiebenSat.1 Media, Mediengruppe RTL Deutschland, ZDF, Discovery Communications Deutschland, Sky Deutschland, SPORT1, Tele 5, Viacom und Welt getragen.
Medienexperte: Corona-Berichterstattung zu oberflächlich
Frankfurt a.M./Berlin (epd). Der Medienexperte Norbert Schneider hat die Corona-Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender als zu oberflächlich kritisiert. Es fehle an aufklärerischer Einordnung der Nachrichten, der "embedded information", sagte Schneider in einem Interview des medien- und gesellschaftspolitischen Blogs "bruchstücke". Zwar werde eine Grundversorgung gewährleistet, doch wenig Hintergrund geboten. "Meistens ist es kaum mehr als die Oberfläche, die das Publikum zu sehen oder zu hören bekommt."
Ein schon vor der Corona-Krise erkennbares Problem sei die "Auslagerung der Expertise", etwa beim Fußball oder bei Attentaten, sagte der frühere Direktor der Landesmedienanstalt NRW. "Zumal in dieser Krise verlagert das Mediensystem, das ja als eine Art von 'vierter Gewalt' sich bewähren soll, seine Verantwortung auf den Experten, der weithin, von kritischen Fragen unbelästigt, eher schon angestaunt, die Begriffe und Themen setzt."
Die so entstehende "Expertokratie" bringe wichtige Einsichten, gehe aber mit einem "Verlust an journalistischer Autonomie" einher. Vor allem in den Talkshows begegne man den immergleichen Experten und einem Übermaß an Redundanz, erklärte Schneider. Nach und nach sei eine Engführung des Perspektive entstanden, "mit Blick auf die Experten nahezu ein closed shop. Und ihnen gegenüber kein böses Wort, selten irritierte Rückfragen."
"Exekutiv-Experten-Systems"
Schneider bekräftigte die Thesen des Kommunikationswissenschaftlers Otfried Jarren, der in einer Analyse für den Fachdienst "epd medien" kritisiert hatte, die Medien agierten nicht mehr selbstständig, sondern seien faktisch Teil eines "Exekutiv-Experten-Systems", da die interviewten Experten, Virologen und Epidemiologen ihrerseits die Bundes- und Landesregierungen beraten. Das sei ein wenig überspitzt formuliert, doch im Kern richtig, sagte Schneider.
Ursache für den "Verlust an Distanz zu den Akteuren" seien ein Mangel an Fortbildung und ganz allgemein ein Defizit an Gelegenheiten zur Selbstreflexion, sagte Schneider. So sei die wichtige Plattform der "Mainzer Tage der Fernsehkritik" gestrichen worden, die großen Medienforen in München und Düsseldorf hätten an Bedeutung verloren. Journalistenschulen seien von Schließung bedroht. "Die Medienpublizistik wird kaputt gespart, weil sie sich am Markt nicht rechnet."
Im Blog "bruchstücke" schreiben Publizisten, Sozial- und Kommunikationswissenschaftler sowie Medienexperten zu gesellschaftspolitischen und medienwissenschaftlichen Themen.
Osterflashmob: Musiker spielen von Balkonen und Kirchtürmen
Hildesheim (epd). An vielen Orten in Deutschland haben sich am 12. April Musikerinnen und Musiker an der Aktion "#osternvormbalkon" beteiligt. Unter anderen hatten das Posaunenwerk Hannover und der Evanglische Posaunendienst in Deutschland dazu aufgerufen, um 10:15 das Osterlied "Christ ist erstanden" von Balkons, in Vorgärten und aus Fenstern erschallen zu lassen. "Wir haben spontan Rückmeldungen bekommen, Fotos und Videos von Mitwirkenden, nicht nur aus Niedersachsen, auch aus vielen anderen Regionen Deutschlands", sagte die Landespastorin für die Bläserarbeit in der hannoverschen Landeskirche, Marianne Gorka, dem epd.
Zudem hatte das ZDF die Initiative zu dem Flashmob auf Abstand aufgegriffen, der in der Corona-Krise Mut machen und Zusammenhalt zeigen soll. Es beendete die Übertragung des Fernsehgottesdienstes aus der Kirche im rheinland-pfälzischen Ingelheim mit dem Osterlied und zeigte Bläserinnen und Bläser, die es aus Fenstern und Türen anstimmten.
Im Internet posteten ebenfalls unter anderem in den Facebookgruppen "#osternvombalkon" und "Posaunenarbeit im Corona-Ausnahmezustand" Musikerinnen und Musiker Fotos und Filmsequenzen. Darin sind sie jeweils einzelnd beim Musizieren zu sehen, etwa von einem Kirchturm in Gütersloh, aus einem Garten in Frankfurt-Rödelsheim, vor einer Feuerwehrwache im bayerischen Rüblanden oder aus einem Kuhstall in Ostfriesland.
"Es ist ein tolles Gefühl, wie wir einander auf diese Weise doch nah und verbunden sein können", sagte Gorka. Die Initiative entstand den Angaben zufolge im Posaunenwerk der hannoverschen Landeskirche. Das Posaunenwerk Hannover ist Teil des Evangelischen Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik im Michaeliskloster Hildesheim. Dazu gehören rund 600 Chöre mit insgesamt 12.000 Bläserinnen und Bläsern.
Ihre Bilder bewegen die Menschen

epd-bild/Friedrich Stark
Köln/Berlin (epd). Sterbende Kinder, trauernde Mütter und protestierende, ausgemergelte Arbeiter: Es sind Szenen der Verzweiflung, die Käthe Kollwitz (1867-1945) in ihrem Zyklus "Ein Weberaufstand" festhält. Die Grafik-Serie verschaffte ihr 1898 auf der Großen Berliner Kunstausstellung den Durchbruch. Mit dem Werk übersetzte die Künstlerin den historischen Weberaufstand von 1844 in ihre Gegenwart, um auf die elenden Lebensbedingungen der Berliner Arbeiter aufmerksam zu machen.
Heute, rund 120 Jahre nach der Entstehung der Bilder, fühlten sich die Menschen immer noch emotional angesprochen, stellt Josephine Gabler fest, Direktorin des Berliner Käthe-Kollwitz-Museums: "Kollwitz drückt essenzielle menschliche Zustände aus, die jeder nachvollziehen kann."
Am 22. April jährt sich der Todestag der Künstlerin zum 75. Mal. Sie habe sich immer so ausdrücken wollen, dass andere Menschen sie verstehen, sagt Hannelore Fischer, Direktorin des Kölner Käthe Kollwitz Museums: "Sie wollte das künstlerisch darstellen, was die Menschen bewegt und womit sie selber etwas bewegen kann." Kollwitz selbst erklärte einmal: "Ich bin einverstanden, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind."
"Sie hat um jedes Motiv gerungen"
Trauer, Schmerz, Tod und Leid, aber auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind sind zentrale Themen ihres Werks. Sie verarbeitete das, was sie erlebte: zwei Weltkriege, die Not während der Wirtschaftskrise in der Zeit der Weimarer Republik und die Nazi-Herrschaft. Ihre Lithografien, Radierungen, Holzschnitte oder Zeichnungen sind meist in Schwarz-Weiß oder Brauntönen gehalten. Die fehlende Farbigkeit reduziert den Ausdruck der Bilder auf das Wesentliche.
Kollwitz gilt als herausragende Meisterin der Druckgrafik und der Zeichnung. "Was sie als Künstlerin auszeichnet, ist, dass sie um jedes Motiv gerungen hat", sagt Fischer. Bis zu 30 Vorzeichnungen entstanden für jede Druckgrafik.
Das zeichnerische Talent der Künstlerin, die am 8. Juli 1867 in Königsberg als Käthe Schmidt zur Welt kam, wurde früh durch ihren Vater gefördert. Sie begann ihre künstlerische Ausbildung in Königsberg und studierte von 1888 bis 1890 an der Münchner Künstlerinnenschule. Im Alter von 23 Jahren heiratete sie ihren Jugendfreund, den Arzt Karl Kollwitz.
Als erste Frau in der Preußischen Akademie der Künste
Das Paar zog nach Berlin, wo Karl Kollwitz im Bezirk Prenzlauer Berg eine Kassenarzt-Praxis führte. Hier erlebte die junge Frau das Elend der Arbeiterfamilien, das sie in zahlreichen Zeichnungen und Grafiken festhielt. 1919 wurde sie als erste Frau in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen.
"Sie hat auch für heutige Künstlerinnen noch eine starke emotionale Bedeutung, weil sie für Frauen in der Kunst ganz viel angeschoben hat", sagt Gabler. Ein tiefer Einschnitt in Käthe Kollwitz' Leben war der Tod ihres jüngeren Sohnes Peter: Er wurde 1914 als Soldat im Ersten Weltkrieg getötet. Der 18-Jährige hatte sich freiwillig gemeldet und war gegen den Willen des Vaters, aber mit Unterstützung der Mutter in den Krieg gezogen.
Den Schmerz und die Gewissensbisse verarbeitete Kollwitz unter anderem in zahlreichen Selbstporträts. Die Skulptur "Die trauernden Eltern" wurde 1932 auf dem Soldatenfriedhof im belgischen Roggevelde aufgestellt und befindet sich heute auf dem Soldatenfriedhof Vladslo in Belgien, wo auch das Grab von Peter Kollwitz ist. Später folgte noch die Plastik "Mutter mit totem Sohn", die einer Pietà ähnelt. Eine vergrößerte Kopie steht in der "Neuen Wache" in Berlin und erinnert an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Glühende Pazifistin
Kollwitz wurde durch den Tod des Sohnes zur glühenden Pazifistin. Sie gehörte keiner Partei an, sah sich aber selbst als Sozialistin. Der Konflikt mit den Nationalsozialisten war programmiert. Nach der Machtübernahme Hitlers wurde sie gezwungen, aus der Preußischen Akademie der Künste auszutreten. Die Nazis diffamierten ihre Kunst als "entartet".
1943 wurde ihr Wohnhaus in der heutigen Kollwitzstraße durch Luftangriffe zerstört. Sie hatte Berlin zuvor verlassen. 1944 folgte sie einer Einladung Prinz Heinrichs von Sachsen, auf seinem Hof in Moritzburg zu wohnen. Dort starb sie wenige Tage vor Kriegsende am 22. April 1945.
Die Pflege des Erbes von Käthe Kollwitz liegt heute in der Hand privater Institutionen. Das Käthe Kollwitz Museum in Köln, das über die weltweit größte Sammlung ihrer Werke verfügt, wurde von der Kreissparkasse Köln gegründet. Diese hatte 1983 Werke von den Erben gekauft und damit dafür gesorgt, dass das Konvolut nicht auseinandergerissen wurde. Das Berliner Käthe-Kollwitz-Museum wurde 1986 mit Hilfe der Stiftung eines Kunsthändlers gegründet. Es ist derzeit in einer Gründerzeit-Villa in Charlottenburg untergebracht, soll aber 2022 in den geräumigeren Theaterbau des Schlosses Charlottenburg umziehen.
Saarlandmuseum stellt laufende Malerschau ins Internet
Saarbrücken (epd). Die Alte Sammlung des Saarlandmuseums hat wegen der Corona-Pandemie ihre aktuelle Ausstellung "…Lorenzetti, Perugino, Botticelli…" zu rund 40 italienischen Künstlern und ihren Werken komplett ins Internet gestellt. "Neben allen in Saarbrücken gezeigten Werken im Einzelportrait hat das Kuratorenteam um Thomas Martin zusätzlich ein paar Blicke 'hinter die Kulissen' zusammengestellt, die normalerweise beim Museumsbesuch nicht zu sehen sind", teilte die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz am 9. April in Saarbrücken mit. Die Werke sind mit Erklärtext nach Räumen sortiert und unter der Rubrik "Impressionen" sind Fotos aus den Ausstellungsräumen zu sehen.
Die Schau umfasst 65 Werke aus dem Lindenau-Museum im thüringischen Altenburg - vom zierlichen privaten Andachtsbild über Predellentafeln und Altarbildwerke bis zum großformatigen Tondo im Prunkrahmen. Die Lindenau-Sammlung sei eine der größten und bedeutendsten zur italienischen Malerei des 13. bis 15. Jahrhunderts. "Die Werke werden noch bis zum 15. November 2020 in Saarbrücken zu sehen sein, so dass hoffentlich noch viele Wochen des Live-Erlebens möglich sind", erklärte die Stiftung.
Neue Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland ab Mai im Amt
Saarbrücken (epd). Die im Januar gewählte Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland (LMS), Ruth Meyer, tritt am 1. Mai ihr Amt an. Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) überreichte ihr am 9. April die Ernennungsurkunde, wie der Landtag in Saarbrücken mitteilte. Ihr Mandat als Abgeordnete gebe die CDU-Politikerin zum 30. April zurück. Sie folgt auf Uwe Conradt (CDU), der 2019 Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken wurde.
Gegen Meyers Wahl hatte der unterlegene Bewerber und stellvertretende LMS-Direktor Jörg Ukrow einen Eilantrag gestellt. Das zuständige Verwaltungsgericht hatte diesen am Freitag abgewiesen und erklärt, dass die Wahl ohne Rechtsfehler verlaufen sei. Ukrow, der auch SPD-Mitglied ist, hatte daraufhin am Mittwoch erklärt, keine weiteren juristischen Schritte zu planen. Neben Ukrow hatte sich auch die Filmproduzentin Teresina Moscatiello um die Stelle beworben.
Der Landtag hatte Meyer mit 40 Stimmen der 51 Abgeordneten zur ersten LMS-Direktorin gewählt. Die CDU hatte sie bereits vor Ausschreibung der Stelle nominiert. Medienrechtler kritisierten das Verfahren. Ukrow hatte europa-, verfassungs-, medien- und beamtenrechtliche Bedenken gegen den Modus des Verfahrens geltend gemacht. Auch wenn das Verwaltungsgericht keine Verfahrensfehler feststellte, erklärte es als diskussionswürdig, die Direktorenstelle nicht durch den Landtag, sondern durch ein pluralistisch zusammengesetztes Gremium wählen zu lassen.
Entwicklung
Minister Müller und Hilfswerke für Solidarität mit den Ärmsten

epd-bild / Jörg Sarbach
Berlin (epd). Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ruft angesichts der Corona-Pandemie zu Spenden an deutsche Hilfsorganisationen auf. Sie leisteten "einen unverzichtbaren Beitrag, den Corona-Ausbruch in den Flüchtlingsregionen einzudämmen; sie sind häufig die einzige Zufluchtsstätte", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (8. April). Deshalb seien Unterstützung und Spenden jetzt so enorm wichtig.
In der Krise sollte man Solidarität mit den Ärmsten zeigen, betonte der Minister: "Die österliche Spendenaktion der kirchlichen Hilfswerke hilft, das Überleben von Millionen Flüchtlingen, besonders von Kindern, im Krisenbogen um Syrien zu sichern." Ein Ministeriumssprecher sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), der Minister höre derzeit "von vielen Seiten, dass die Kirchen in diesem Jahr einen Rückgang der Osterkollekte erwarten".
Spenden für "Brot für die Welt"
Die Präsidentin des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt", Cornelia Füllkrug-Weitzel, sagte den Funke-Zeitungen: "Kollekten und Spenden sind die Basis der Arbeit von 'Brot für die Welt'." Ohne diese Mittel könne armen und schutzlosen Menschen nicht geholfen werden. "300 Millionen Kinder weltweit bekommen kein Schulessen mehr - oft die einzige Mahlzeit am Tag." Dafür seien Kollekten und Spenden nötig.
Auch der Präsident der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, rief zu Spenden für "Brot für die Welt" auf. "Die Corona-Krise verstärkt bestehende Spaltungen zwischen Arm und Reich, bei uns und in der Welt", sagte er.
Das katholische Hilfswerk Misereor appellierte indes an die Bundesregierung. "Wir brauchen auch für Entwicklungsprojekte einen Schutzschirm und kreative Lösungen mit Blick auf Haushaltsordnung und Förderrichtlinien, sonst brechen uns vor Ort in vielen Ländern gerade diejenigen Partnerstrukturen weg, die für die Ärmsten von besonderer Bedeutung sind", erklärte Geschäftsführer Martin Bröckelmann-Simon in Aachen.
Reiseeinschränkungen, Kontaktsperren und Ausgehverbote behinderten Misereor-Partner massiv bei Aktivitäten. Fachkräfte könnten ihren Dienst nicht antreten oder müssten ihre Einsätze abbrechen: "In Indien mussten Partner ihre Berufsschulen auf Fernunterricht umstellen, Mitarbeiter von ländlichen Beratungsdiensten in Sri Lanka nähen nun Mundschutze, statt aufs Land hinauszufahren, städtische Beratungsorganisationen in den Slums von São Paulo werden durch die staatlichen Notverordnungen ausgesperrt, Straßenkinder-Projekte in Kenia konzentrieren sich jetzt auf Desinfektionsmaßnahmen und Corona-Prävention."
Grüne fordern mehr Entwicklungshilfe
Die Grünen dringen derweil auf eine deutliche Aufstockung der Entwicklungshilfe, wie "Der Spiegel" berichtet. In einem Positionspapier, das die Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie mehrere Fachpolitiker verfasst haben, fordern sie demnach die Koalition auf, "kurzfristig mindestens zwei Milliarden Euro zusätzlich für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe" bereitzustellen. Deutschland solle zudem seine Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation "substanziell aufstocken und verstetigen".
Nach dem Willen der Autoren sollten die Vereinten Nationen eine Corona-Taskforce gründen und einen Corona-Hilfsfonds zur Unterstützung von Staaten mit schwachem Gesundheitssystem einrichten.
Die Armee der weißen Kittel

epd-bild/Klaus Honigschnabel
Oaxaca, Havanna (epd). Italien, Andorra, Haiti, Venezuela, Jamaika - es war eine stattliche Liste, mit der Francisco Durán García an die Öffentlichkeit trat. 596 Ärzte habe man in insgesamt 14 Länder entsandt, um sie im Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen, sagte der Leiter der Abteilung Epidemiologie des kubanischen Gesundheitsministeriums jüngst in Havanna.
Kurz zuvor hatten Bilder aus Mailand Aufsehen erregt: 53 Mediziner und Krankenpfleger waren aus Kuba angereist, um ihren italienischen Kollegen beizustehen. Weiße Arztkittel, Mund und Nase mit Masken geschützt, zeigten sie sich mit der Flagge ihres Landes auf dem Flughafen.
Kaum ein Land profiliert sich derzeit in der medizinischen Kooperation so wie Kuba. Dabei kämpft der sozialistische Inselstaat selbst mit dem gefährlichen Virus. Bis 8. April waren laut der US-Universität Johns Hopkins 396 Corona-Fälle gemeldet worden - und elf Tote. Der Tourismus, eine Haupteinnahmequelle, liegt flach. Zudem leidet Kuba seit Jahrzehnten unter dem US-Wirtschaftsembargo, die internationale Geschäfte sehr einschränkt.
Ärzte-Export bringt Devisen
Auch deshalb leben viele Kubaner unter prekären Bedingungen. Lebensmittel sind knapp, in Krankenhäusern fehlt es an Medizin und Gerät. Dennoch sei man bereit zu helfen, betont der Pfarrer Bartolomé Lavastida. "Kuba ist entschlossen, die wenigen Mittel, die wir haben, zu teilen", sagt der Geistliche vom ökumenischen Bildungszentrum Lavastida in Santiago de Cuba.
Vor allem aber bringt der Export medizinischen Personals Milliarden an Devisen in die klamme Staatskasse. Nach Angaben der UN-Organisation für Handel und Entwicklung (Unctad) verdient das Land damit drei Mal so viel wie mit der Ausfuhr von Rum, Nickel, Zucker und Zigarren zusammen. "Kuba kooperiert derzeit mit 59 Ländern der Welt", erklärt Durán Garcia. 28.129 kubanische Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern und Pfleger seien im Ausland tätig.
Ihren Anfang nahmen die Einsätze bereits 1963. Der damalige Staats- und Parteichef Fidel Castro rief sie als "Armee der weißen Kittel" ins Leben. Viele Mediziner gingen in den vergangenen Jahren ins verbündete Venezuela, im Gegenzug erhielt Havanna günstiges Erdöl. Auch bei der Ebola-Epidemie 2014 in Westafrika halfen die Kubaner. Aus Brasilien und Bolivien mussten sie abziehen, nachdem dort in den vergangenen Jahren rechte Politiker die Regierungen übernommen hatten.
Kliniken in erbärmlichen Zustand
Für die Mediziner bietet der Auslandseinsatz die Möglichkeit, ihr bescheidenes Gehalt von umgerechnet 40 bis 70 Euro monatlich aufzubessern. So verdienten Ärzte, die in Brasilien tätig waren, 700 Euro monatlich. Das ist aber nur ein Viertel dessen, was Brasilien der Regierung in Havanna zahlte.
Die regimekritische Publizistin Yoani Sánchez bezeichnet die Entsendungen deshalb als gefährliche PR-Aktion. "Unsere Ärzte werden geopfert, sie arbeiten, rackern sich ab und riskieren ihr Leben, aber davon profitiert vor allem die Regierung", schreibt die Kubanerin auf ihrem Blog. Zugleich wachse die Unzufriedenheit über den erbärmlichen Zustand der kubanischen Krankenhäuser, in die die Patienten alles selbst mitbringen müssten, von den Decken bis zum Essen.
Schon lange fehlt es in dem Karibikstaat an Medikamenten, zumal ein Teil davon auf dem Schwarzmarkt landet. Zugleich verfügt Kuba aber über ein kostenloses Gesundheitssystem mit einer Arztdichte, von der andere Staaten nur träumen können. Zudem hat die Regierung auch in schweren Krisenzeiten an der medizinischen Forschung festgehalten.
Das macht sich jetzt bezahlt. Kubanische Biotechniker haben den antiviralen Wirkstoff Interferon Alfa 2b entwickelt. In China wurde das für die Krebsbehandlung produzierte Medikament bereits mit guten Resultaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 eingesetzt. Mehrere Staaten und Unternehmen haben Interesse angemeldet, darunter die sächsische Firma Profümed, die Medizinprodukte auf Zellstoffbasis wie Tupfer und Kompressen herstellt.
Viele Corona-Tests
Pfarrer Lavastida ist davon überzeugt, dass das kubanische Gesundheitssystem auf die Corona-Krise gut vorbereitet sei. "An Ärzten fehlt es trotz der Entsendungen nicht, da ja viele aus Brasilien und Bolivien zurückgekommen sind", sagt er. Er verweist darauf, dass zahlreiche Medizinstudenten von Haus zu Haus ziehen, um die Bewohner auf Corona-Symptome zu untersuchen.
Die Regierung behauptet, im Rahmen dieser Aktion "Pesquisas" (Nachforschungen) seien schon acht Millionen Menschen untersucht worden. Das wären drei Viertel der Bevölkerung. Trotz der knappen finanziellen Ressourcen ist auch der Künstler Omar Gomez vorsichtig optimistisch. "Wir haben schon ähnlich schwierige Situationen erlebt und gelernt, sie abzufedern", sagt er. "Da wir immer noch leben, muss unser Gesundheitssystem also etwas für sich haben."
Corona-Krise: Indigene in Brasilien besonders bedroht
Berlin, São Paulo (epd). In indianischen Gemeinden im Amazonasgebiet in Brasilien sind erste Corona-Fälle aufgetaucht. Wenn sich das Virus in den Schutzgebieten verbreite, wäre das eine Tragödie, warnte der katholische Indianermissionsrat Cimi am 6. April. In den meisten Reservaten gebe es kein sauberes Wasser und nur sehr wenige Gesundheitsstützpunkte, die über keine Intensivbetten verfügten.
Die brasilianische Staatsanwaltschaft forderte die Regionalregierungen und die Indianerschutzbehörde Funai auf, unverzüglich Schutzmaßnahmen zu ergreifen und sprach von der Gefahr eines Massensterbens. Besonders besorgt zeigte sich Cimi über die Situation im bevölkerungsreichsten Indianerreservat Dourados im südwestlichen Bundesstaat Mato Grosso do Sul, in dem 18.000 Ureinwohner vom Volk der Guaraní Kaiowá leben.
Cimi kritisierte, dass es überhaupt keinen Plan der Regierung für den Schutz der Indigenen gebe, obwohl sie vom Gesundheitsministerium als Risikogruppe eingestuft wurden. Die Ureinwohner haben ein anderes Immunsystem als die meisten Brasilianer und sind besonders anfällig für Viruserkrankungen wie Covid-19.
Covid könnte tödlich sein
Die Regierung müsse unverzüglich ein Feldhospital im Schutzgebiet Dourados mit Intensivbetten errichten, fordert Flávio Vicente Machado von Cimi. Um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurden die Indigenen aufgefordert, das Schutzgebiet nicht zu verlassen. Das sei aber nicht möglich, weil sie sich mit Lebensmitteln eindecken müssten.
Einem besonderen Risiko sind Völker ausgesetzt, die ohne Kontakt zur Außenwelt im Amazonasgebiet leben. Der staatliche Gesundheitsdienst für indigene Völker (Sesai) warnt, dass die Ureinwohner eine Covid-19-Erkrankung nicht überleben würden.
Laut Funai leben in Brasilien rund 900.000 Ureinwohner von 350 Ethnien. Das Volk der Guaraní ist mit 51.000 Indigenen das größte. Es gibt insgesamt 690 Schutzgebiete, die rund 13 Prozent der Landesfläche ausmachen.
Behörden in Afrika nutzen Corona-Bekämpfung zur Repression
Berlin (epd). Afrikanische Regierungen nutzen Menschenrechtlern zufolge die Corona-Bekämpfung, um mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen die Bevölkerung vorzugehen. "Die Sicherheitskräfte drohen im Kampf gegen Covid-19 zum Menschenrechtsrisiko zu werden", erklärte Amnesty International am 8. April in Berlin. So seien in Südafrika Gummigeschosse gegen Obdachlose eingesetzt worden. In Uganda hätten die Behörden Covid-19 zum Vorwand genommen, um Homosexuelle zu verhaften. Im Niger sei ein Journalist festgenommen worden, weil er über einen Corona-Verdachtsfall berichtet habe.
"Die Regierungen müssen mit aller Entschiedenheit die Achtung der Menschenrechte im Zuge der Bekämpfung von Covid-19 gewährleisten", forderte Amnesty-Afrika-Expertin Franziska Ulm-Düsterhöft. Dies sei wichtig, um eine Verunsicherung der Bevölkerung zu vermeiden und das Vertrauen in die Gesundheitsmaßnahmen zu stärken. "Covid-19 darf nicht zusätzlich zu einer Menschenrechtskrise in einzelnen afrikanischen Ländern führen."
"Doppelte Bedrohung"
Auch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie hätten staatliche Sicherheitskräfte neben bewaffneten Gruppierungen zu den größten Gefahren für die afrikanische Zivilgesellschaft gehört. 2019 sei in über 20 der 54 afrikanischen Staaten durch rechtswidrige Verbote, exzessiven Gewalteinsatz, Schikanen, willkürliche Inhaftierungen und andere Maßnahmen das Recht auf friedlichen Protest eingeschränkt worden, heißt es im Afrika-Bericht der Organisation. So seien im Sudan bei Protesten 177 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet und über 300 verletzt worden. In mindestens 25 afrikanischen Staaten wurden zudem die Medienfreiheit eingeschränkt und Journalisten kriminalisiert, wie es weiter hieß.
Außerdem seien bewaffnete Gruppierungen in mehr Staaten aktiv und töteten viele Menschen in Ländern wie Somalia, Mali, Burkina Faso und Nigeria. "In vielen Ländern Afrikas sehen sich die Menschen einer doppelten Bedrohung gegenüber", sagte Ulm-Düsterhöft. "Einerseits müssen sie grausame Übergriffe durch bewaffnete Gruppen wie Boko Haram fürchten und andererseits das gewaltsame Vorgehen von Sicherheitskräften im Kampf gegen den Terror."
Dennoch hätten die Menschen im vergangenen Jahr den Mut aufgebracht, auf die Straße zu gehen und für ihre Rechte zu demonstrieren, heißt es im Afrika-Bericht der Organisation. So hätten die Menschen in Äthiopien und dem Sudan politische Veränderungen erreicht, die zu einer Verbesserung der Menschenrechtslage geführt hätten.
Neue Ebola-Todesfälle im Kongo
Frankfurt a.M. (epd). Im Kongo droht nach einer erfolgreichen Eindämmung von Ebola in den vergangenen Monaten eine Rückkehr der tödlichen Krankheit. Zwei Menschen seien in den vergangenen Tagen an Ebola gestorben, berichtete der französische Sender RFI am 13. April. Zudem hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach fast zwei Monaten am 10. April einen neuen Fall bestätigt.
Durch die neue Infektion konnte der Ebola-Ausbruch nicht wie erhofft am Montag für beendet erklärt werden. Den Regularien der WHO zufolge wird ein Ausbruch für beendet erklärt, wenn nach dem letzten negativ getesteten Patienten für die Dauer von zwei Inkubationsperioden - also 42 Tagen - kein neuer Fall auftritt. Am 6. März hatte die WHO verkündet, dass die letzte Ebola-Patientin aus einem Behandlungszentrum in der Stadt Beni im Ostkongo entlassen wurde.
Mehr als 2.200 Tote
Bei den jüngsten Todesfällen handelt es sich dem Medienbericht zufolge um ein Mädchen und einen jungen Mann in Beni. Die WHO richtete am Wochenende Schnelltest-Center ein, um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern. Seit dem Ausbruch der Krankheit im August 2018 wurden in der Demokratischen Republik Kongo mehr als 3.400 Fälle bestätigt, mehr als 2.200 Menschen starben.
Andauernde Konflikte im Nordosten des Kongo erschweren die Überwachung von Patienten und die Rückverfolgung von Infektionen. Gewalt durch Milizen und Misstrauen in der Bevölkerung behindern die Arbeit medizinischer Teams. Auch beim bisher schwersten Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014 traten trotz Erfolgen bei der Bekämpfung zunächst immer wieder neue Fälle auf, bevor die Epidemie in Sierra Leone, Guinea und Liberia 2016 endgültig für beendet erklärt werden konnte.

