Kirchen
"Auge und Ohr Deutschlands"

epd-bild/Anestis Aslanidis
Nürnberg (epd). Die rund tausendjährige Geschichte Nürnbergs ist geprägt von Kunst, Handwerk und Gelehrsamkeit. Martin Luther (1483-1546) bezeichnete die mittelfränkische Stadt einmal als „das Auge und Ohr Deutschlands“. Durch den neuen Buchdruck verbreiteten sich seine reformatorischen Ideen auch rasant in Nürnberg, bis heute ein guter Ort für Protestanten: In der Stadt an der Pegnitz findet vom 7. bis zum 11. Juni der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Dazu werden rund 100.000 Teilnehmer erwartet.
2.000 Einzelveranstaltungen an fünf Tagen sollen die ganze Bandbreite von Kirche und Gesellschaft abdecken. Das Programm besteht laut Kirchentags-Generalsekretärin Kristin Jahn aus drei Kraftzentren: Spiritualität, Gesellschaftspolitik und Kultur. Erstmals wurden im Programm sogenannte Weiße und Graue Flecken festgelegt. So können aktuelle Ereignisse in das sonst monatelange im Voraus geplante Programm eingehen, so die Veranstalter.
„Leben in besonderen Zeiten“
Die Losung lautet „Jetzt ist die Zeit“, Worte aus dem Markusevangelium. „Mittlerweile sind wir alle einig, dass wir in besonderen Zeiten leben“, erklärte Kirchentagspräsident Thomas de Maizière, früherer CDU-Bundesinnen- und Bundesverteidigungsminister. Der Kirchentag wolle fragen, was das für Zeiten sind und inwiefern diese Zeiten besonders sind - vor allem mit Blick auf den Krieg, auf Frieden, auf Schöpfung, auf Gerechtigkeit und Demokratie, sagte de Maizière jüngst dem Medienmagazin „Pro“. Er wünsche sich, dass die Menschen den Kirchentag als „Schatz“ wahrnehmen, den es sonst nicht gibt. „Wir sind so eine Art Lagerfeuer“, sagte de Maizière.
Umweltschutz soll Kernthema auf dem Kirchentag sein. Im Programm widmen sich mehr als 100 Veranstaltungen unterschiedlichsten Aspekten des Themas Bewahrung der Schöpfung. Erwartet werden Vertreterinnen und Vertreter aus Klimaschutzbewegungen wie Luisa Neubauer oder Vanessa Nakate aus Uganda, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie die Politökonomin Maja Göpel. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Altbundespräsident Joachim Gauck wollen am Samstag auf einem Podium sprechen.
Ausgespart wird nicht die Zeit, in der Nürnberg der Selbstdarstellung des NS-Regimes diente, Stichwort „Stadt der Reichsparteitage“ und „Nürnberger Rassegesetze“. Nach Kriegsende standen die NS-Hauptkriegsverbrecher hier vor dem internationalen Militärtribunal. Der Aktualität des Antisemitismus widmet sich ein Podium mit dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein.
Treffpunkt für Christen oder mehr Öffnung zur Gesellschaft
Seit rund vier Jahren laufen die organisatorischen Vorbereitungen für den Nürnberger Kirchentag. Man sei „bestens vorbereitet“, erklärten die Veranstalter Mitte Mai. Nürnberg sei eine eventerprobte Stadt, sagte Janine Rolfsmeyer, Vorstand Organisation des Kirchentages. Polizeidirektor Andreas Belger vom Polizeipräsidium Mittelfranken betonte: „Wir werden während des Veranstaltungszeitraums sichtbar präsent sein.“ In enger Abstimmung mit den Behörden soll das Sicherheitskonzept fortlaufend der aktuellen Sicherheitslage angepasst werden. Rund 4.000 Ehrenamtliche des Kirchentages werden am Halstuch mit der Aufschrift 'Ich helfe' erkennbar sein.
Das Protestantenfest steht vor einem Wandlungsprozess. Dieser Ansicht ist Kirchentags-Generalsekretärin Jahn. Die Frage sei, ob der Kirchentag hauptsächlich ein Treffpunkt für Christen sein soll, oder ob man sich mehr für die Gesellschaft öffnen wolle, sagte Jahn im März. Immer wieder gibt es auch Überlegungen für einen vierten Ökumenischen Kirchentag, nach dem ersten 2003 in Berlin, dem zweiten 2010 in München und dem dritten 2021 in Frankfurt am Main.
In den nächsten Jahren feiert man allerdings noch konfessionell getrennt, wenn sich auch die beiden Christentreffen Beobachtern zufolge zunehmend angleichen. Die nächsten beiden Deutschen Katholikentage finden 2024 in Erfurt und 2026 in Würzburg statt, die Evangelischen wollen sich 2025 in Hannover und 2027 in Düsseldorf wieder zum Kirchentag treffen.
Streitbarer Präsident

epd-bild/Timm Schamberger
Berlin (epd). Für so manchen passen sie auf den ersten Blick nicht zusammen: Hier der evangelische Kirchentag, traditionell kritisch in Rüstungsfragen, fordernd, was Rettung und Aufnahme Asylsuchender angeht. Und dort der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière, der in seiner Amtszeit mit den Kirchen hart ums Kirchenasyl stritt. Der CDU-Politiker ist in diesem Jahr Präsident des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentags, der in der zweiten Juniwoche in Nürnberg stattfindet.
Wer Kirchentage besucht, weiß allerdings, dass de Maizière nicht nur regelmäßiger Gast und diskussionsfreudiger Diskutant beim Christentreffen ist, sondern auch eng mit der Bewegung verbunden. Seit 20 Jahren ist er Mitglied des Präsidiums der Laienbewegung. Auch in seiner Zeit als Bundesminister war der Kirchentag fester Teil des Terminkalenders.
De Maizière selbst irritiert es daher gar nicht, als CDU-Politiker Präsident des Kirchentags zu sein, dem eher eine Nähe zur SPD und den Grünen nachgesagt wird. Selbst wenn es so wäre, „würde es höchste Zeit, dass jemand wie ich mal Präsident wird“, sagte de Maizière im Frühjahr in einem Gespräch mit dem epd. Er wolle „die Meinungsblase aufstechen“ und den Kirchentag öffnen, ergänzte der 69-Jährige, dessen zurückliegende Karriere zeigt, dass er Meinungsdifferenzen nicht aus dem Weg geht. Im Gegenteil: Demokratie bedeute Debatte, Streit, Auseinandersetzung, sagte de Maizière einmal als Innenminister. Für den Kirchentag könnte er also im buchstäblichen Sinne ein streitbarer Präsident sein.
Kanzleramtschef und Minister
Angefangen hat de Maizières Karriere als Mitarbeiter des damaligen Regierenden Bürgermeisters in Berlin, Eberhard Diepgen (CDU). 1985 machte dieser de Maizière zum Leiter des Grundsatzreferates der Senatskanzlei. Nach dem Fall der Mauer verhandelte er damals als Mittdreißiger den Einigungsvertrag mit, wurde Chef der Staatskanzlei in Mecklenburg-Vorpommern, dann in Sachsen. 2005 holte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) de Maizière als ihren ersten Kanzleramtschef nach Berlin.
In Merkels Regierungszeit war de Maizière später Innenminister, dann Verteidigungsminister, nachdem Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) wegen der Plagiatsaffäre zurücktreten musste. 2013 zog er wieder an die Spitze des Bundesinnenministeriums und mit dem Haus um, aus dem Provisorium in Berlin-Moabit in die unmittelbare Nachbarschaft des Kanzleramts.
Es ist das Jahr, in dem Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien Deutschland erreichen, nachdem Ungarn und Österreich die Flüchtlinge weiterleiteten. Schon seit dem Frühsommer ist die Fluchtbewegung das Hauptthema für den Innenminister. Es bereitet ihm im Herbst lange Arbeitstage, oft bis in die Nacht, wie Mitarbeiter sagen. Charakterisieren sie de Maizière, fallen vor allem solche Worte: fleißig, genau, ein „Aktenfresser“. Die Krise um die Unterbringung der Schutzsuchenden fordert den Innenminister sichtlich. Die anfängliche Willkommensstimmung kippt, das Thema polarisiert vermehrt.
Nach der Bundestagswahl 2017 und quälend langen Koalitionsverhandlungen beansprucht die CSU das Innenministerium für sich. Minister wird der damalige Parteichef Horst Seehofer, der die Flüchtlingspolitik Merkels und de Maizières scharf angegriffen hatte, gar von einer „Herrschaft des Unrechts“ sprach. Als „ehrabschneidend“ habe er diesen Vorwurf empfunden, bekennt der Jurist de Maizière rückblickend in seinem Buch „Regieren“.
„Getragen von tiefer Zuversicht“
Mit dem Ausscheiden aus dem Kabinett ist de Maizière weiter einfacher Bundestagsabgeordneter. Zuvor von Personenschützern umgeben, sieht man ihn nun auch mal allein mit dem Fahrrad durchs Regierungsviertel fahren. Bei der Wahl 2021 kandidiert de Maizière nicht mehr für den Bundestag.
Im selben Jahr wird er Kirchentagspräsident. Als Politiker hat er oft betont, wie ihm der Glaube an Gott bei Entscheidungen geholfen oder auch entlastet hat. Mit Blick auf das Treffen in Nürnberg, wo die großen Krisen dieser Zeit diskutiert werden sollen - Ukraine-Krieg, Klimawandel, Flucht - beschreibt er es so: „Wir sind getragen von einer tiefen Zuversicht, dass die Welt nicht untergeht.“ Dafür müsse man aber auch etwas tun.
Höhepunkte des Kirchentags
Nürnberg (epd). Rund 2.000 Veranstaltungen in fünf Tagen: Besucherinnen und Besucher des Kirchentags vom 7. bis zum 11. Juni in Nürnberg werden es auch beim 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag schwer haben, den Überblick zu behalten. Einige Höhepunkte aber sind im Programm auszumachen:
Traditionell zählen Anfang und Ende zu den besonderen Erlebnissen: Es gibt zwei Eröffnungsgottesdienste: einen auf dem Hauptmarkt und einen in Leichter Sprache auf dem Kornmarkt in der Nürnberger Innenstadt. Beim „Abend der Begegnung“ steht das Straßenfest unter dem Motto „Wir. Hier. Jetzt.“ und lädt dazu ein, bayerisch-fränkische Vielfalt zu entdecken. Zu den Schlussgottesdiensten versammeln sich Menschen an denselben Orten wie bei der Eröffnung auf dem Hauptmarkt und für den Gottesdienst in Leichter Sprache auf dem Kornmarkt.
Einen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt des diesjährigen Kirchentages bildet das Thema „Bewahrung der Schöpfung“. Mehr als 100 Veranstaltungen des Programms drehen sich um das Thema Umweltschutz.
Zum Kirchentag in Nürnberg haben sich viele Prominente angekündigt. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), CDU-Chef Friedrich Merz, der Kabarettist Eckart von Hirschhausen und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Auf dem Hauptpodium in der Frankenhalle diskutiert der Kirchentagspräsident und ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer, Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold (Grüne) und dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Friedrich Kramer, über Grenzverschiebungen in der Friedensethik.
Zum Start in den Tag lädt der Kirchentag traditionell zu Bibelarbeiten ein. In Nürnberg deuten unter anderen die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), der Schauspieler und Autor Samuel Koch, die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus sowie die Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) ausgesuchte Passagen aus der Heiligen Schrift. Auch der CDU-Vorsitzende Merz wird eine Bibelarbeit anleiten.
Musik und Feiern sind bei jedem Kirchentag zentrale Bestandteile, oft spontan in Bahnen und Bussen oder auf offener Straße. Für einen Teil der Besucher sind abendliche Großkonzerte ein Anziehungspunkt. In Nürnberg werden neben anderen das Bundesjazzorchester sowie Malik Harris auftreten. Am Samstagabend ist das Kyiv Symphony Orchestra zu Gast beim Kirchentag.
Die Funktionen der Kirchentags-App, die bereits beim 37. Kirchentag in Dortmund im Einsatz war, wurden für Nürnberg deutlich erweitert: Die App beinhaltet nun auch digitale Tickets, ist Programmheft, Stadtplan und Navigator in einem und ermöglicht eine digitale Beteiligung des Publikums.
Bahr fordert von Kirchen wacheren Blick für koloniales Denken

epd-bild/Nancy Heusel
Hannover (epd). Die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr fordert von den evangelischen Kirchen in Deutschland einen wacheren Blick für ihr koloniales Erbe und nach wie vor vorhandene koloniale Denkmuster. „Christinnen und Christen aus Ländern des südlichen Afrikas gehen teilweise beeindruckend versöhnlich mit der Kolonial- und Missionsgeschichte um. Diese Freundlichkeit sollte uns aber nicht davon entlasten, die Geschichte gründlich aufzuarbeiten“, betonte Bahr im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Vielmehr gebe die „höchst ambivalente“ Missionsgeschichte einen Anlass, den eigenen Blick auf den Globalen Süden kritisch auf latente Überlegenheitsvorstellungen, Fehlwahrnehmungen und „folkloristische Klischees“ zu überprüfen.
Bahr kritisierte, dass in weiten Teilen der Gesellschaft wenig Interesse an kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten in den Ländern Afrikas herrsche. Kampagnen von Hilfswerken etwa, die das Afrika-Bild auf hungernde Kinder verkürzten, hätten sich derart tief eingeprägt, dass im Bewusstsein kaum Platz sei für positive Entwicklungen auf dem Kontinent, etwa einer wachsenden Mittelschicht, einem florierenden Tech-Sektor, richtungsweisendem Öko-Landbau oder international beachteter zeitgenössischer Kunst und Literatur.
Zwiespältige Rolle der Missionare
Auch über das geistliche Leben gebe es viele stereotype Denkweisen, unterstrich die Regionalbischöfin, die das Thema Kolonialismus und Kirche 6. Juni im Historischen Museum Hannover mit dem leitenden Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche im Südlichen Afrika, Nkosinathi Msawenkosi Myaka, diskutiert. „Oft höre ich Äußerungen wie: 'Hier das Geld, in Afrika die Begeisterung; hier das verkopfte Christentum, dort Tanz und Trommeln im Gottesdienst'.“ Dabei könne in einer lutherischen Gemeinde in Kapstadt durchaus auch mal eine Bach-Kantate erklingen - und theologische Diskussionen mit Kollegen und Kolleginnen aus Afrika könnten wiederum hiesige Formen des Denkens sehr bereichern.
Mit Blick auf die Missionsgeschichte hob Bahr die zwiespältige Rolle der christlichen Missionare hervor: „Einige von ihnen waren ausgesprochen kritisch gegenüber den Kolonialmächten und keineswegs bereit, ihr brutales Regiment mitzuvollziehen. Andere haben schlimmes Unrecht gerechtfertigt oder geschwiegen. Zudem sind lebendige Traditionen oftmals zerstört worden.“ So hätten die Missionare zwar maßgeblich zum Aufbau eines Bildungs- und Gesundheitswesens beigetragen, als Vertreter einer Schriftkultur zugleich aber eine weitgehend auf Mündlichkeit gründende Traditionsbildung zurückgedrängt - „mit tiefgreifenden Folgen für das kulturelle Gedächtnis und für gesellschaftliche Aushandlungs- und Konfliktlösungsprozesse“.
Eckart von Hirschhausen: Übernächstenliebe für das Klima nötig

epd-bild/Jens Schulze
Frankfurt a.M. (epd). Der Mediziner und TV-Moderator Eckart von Hirschhausen fordert von den christlichen Kirchen mehr Einsatz für den Klimaschutz. „Während der Zeithorizont von Politikern oft nicht ausreicht, um auf den ersten Blick unpopuläre Entscheidungen voranzubringen, könnten es sich die Kirchen in der Gewissheit ihres Auftrags und ihrer Geschichte leisten, jetzt in Vorleistung zu gehen“, heißt es in einem Gastbeitrag des Autors für das evangelische Monatsmagazin „chrismon“ (Juni-Ausgabe). Die Kirchen seien dafür geschaffen, an der Spitze der Bewegung zu stehen.
„Der Kern des Christentums ist die Nächstenliebe“, fügte Hirschhausen hinzu. Vielleicht sei ein neues Wort dafür nötig. Sein Vorschlag: „Übernächstenliebe!“ Das könne man zeitlich und räumlich verstehen: „Unser Nächster, unsere Nächste, kann also auch 5.000 Kilometer weit weg sein oder 50 Jahre.“ Es gebe keine andere Institution, die das Denken über viele Generationen hinweg derartig in ihrer DNA habe wie die Kirchen, so Hirschhausen.
Hirschhausen ist auch zu Gast auf dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg vom 7. bis 11. Juni. Dort will er am Donnerstagabend durch eine „Klima-Entdeckungsreise“ führen.
Trauer um die kenianische Ökumenikerin Abuom

epd-bild/Thomas Lohnes
Genf (epd). Nach dem Tod der führenden Ökumenikerin Agnes Aboum haben Kirchen die Verstorbene und deren Werk gewürdigt. Die Kenianerin Abuom sei mit 73 Jahren in ihrem Heimatland nach kurzer Krankheit gestorben, teilte der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) am 1. Juni in Genf mit. Für den ÖRK erinnerte dessen Zentralausschuss-Vorsitzender Heinrich Bedford-Strohm an die Verdienste Aboums, für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) deren Ratsvorsitzende Annette Kurschus und Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber.
Als erste Frau und erste Afrikanerin in der Geschichte des 1948 gegründeten Weltkirchenrats wurde Abuom 2013 zur Vorsitzenden des Zentralausschusses gewählt. Sie amtierte als Vorsitzende des Leitungsgremiums bis 2022. Abuom war von 1999 bis 2006 Präsidentin des ÖRK für die Region Afrika.
Abuoms Nachfolger als Vorsitzender des ÖRK-Zentralausschusses, Bedford-Strohm, sprach von einer traurigen Nachricht. Er sagte über den Tod seiner Vorgängerin: „Wir werden ihre Liebe, ihre Weisheit, ihre Freundlichkeit, ihr Vertrauen und ihre Inspiration vermissen.“
Soziale Gerechtigkeit und Versöhnungsarbeit
Kurschus sagte, in der EKD bleibe Aboum in Erinnerung als jemand, der es gelungen sei, die ökumenische Bewegung zusammenzuhalten in der gemeinsamen Sache und im Handeln für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Bosse-Huber sagte, Aboums Gesicht habe die weltweite ökumenische Bewegung maßgeblich geprägt.
Die Sozialaktivistin Abuom promovierte an der Universität von Uppsala (Schweden) in Missionswissenschaft. Sie gehörte über Jahre zu den prominentesten Vertreterinnen der ökumenischen Bewegung und machte sich vor allem auf den Gebieten soziale Gerechtigkeit und Versöhnungsarbeit einen Namen. Sie beriet internationale Organisationen in Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und koordinierte soziale Aktionen für religiöse und zivilgesellschaftliche Verbände in Afrika.
Gegendenkmal zur Zerbster "Judensau" enthüllt

epd-bild/Jens Schlüter
Zerbst (epd). An der Ruine der St. Nicolai-Kirche in Zerbst (Sachsen-Anhalt) ist am 1. Juni ein Gegendenkmal zur Schmähplastik der „Judensau“ enthüllt worden. „Der Antisemitismus ist eine Schuld, die wir als Christenmenschen seit Jahrhunderten mit uns tragen“, sagte der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, bei der Enthüllung der Stele, die von dem Künstler Hans-Joachim Prager gestaltet wurde.
Der Kirchenpräsident nutzte die Gelegenheit zu einer grundsätzlichen Kritik an der Haltung der Kirche im Verhältnis zu den Juden. „Der Antisemitismus ist seit dem vierten Jahrhundert Teil der christlichen DNA“, sagte der leitende Geistlicher der anhaltischen Landeskirche. „Als Kirchenpräsident, aber auch ganz persönlich bitte ich alle Opfer um Vergebung - wohlwissend, dass das Leid damit nicht geschmälert wird“, sagte Liebig.
Der Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) betonte, die Diskussion sei vor allem durch eine ähnliche Schmähplastik an der Stadtkirche von Wittenberg angestoßen worden. „Wir können es nicht ungeschehen machen, wir müssen uns damit auseinandersetzen“, sagte der Bürgermeister. Die Stele stelle sich dem Betrachter buchstäblich bei der Betrachtung der Schmähplastik in den Weg und solle ein Ort werden, der zu Diskussionen anregt.
„Nicht tolerierbares Zeichen des Hasses“
Dazu rief auch der Künstler Prager auf. „Wir erhalten hier die Möglichkeit, in einen Diskurs einzutreten, der durch Worte in die Gesellschaft hineingetragen wird“, sagte er. Bei der Gestaltung des Denkmals sei ihm wichtig gewesen, „dass jeder Mensch an dieser Stelle spürt, dass er in seiner Individualität angenommen wird.“ Rund um die Stele könne ein Ort der Versöhnung, ein Friedensplatz entstehen.
Der Pfarrer der Kirchengemeinde St. Nicolai und St. Trinitatis in Zerbst, Lutz-Michael Sylvester, wünscht sich ebenfalls an der Stelle einen Ort der Begegnung und Verständigung. Die Schmähplastik bezeichnete er als nicht tolerierbares Zeichen des Hasses, das nicht länger unkommentiert bleiben dürfe.
Die 125 Zentimeter hohe Stele mit dem Titel „Reflexion“ wurde von einer Jury unter zehn Wettbewerbsbeiträgen ausgewählt. Das Preisgeld für den Siegerentwurf liegt nach Angaben der Landeskirche bei 1.000 Euro. Für die zweit- und dittplatzierten Entwürfe gab es je 500 Euro.
Das Kunstwerk ist als Lesepult gestaltet, wie es auch in einer Synagoge zu finden ist. An der Stirnseite ist der erste Artikel des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ angebracht. An allen vier Seiten sind die Namen der Zerbster Jüdinnen und Juden aufgeführt, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Darunter steht an der Stirnseite der Bibelspruch aus dem Alten Testament „Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde“.
Die Schmähplastik an der Kirche aus dem Jahr 1450, auf die sich das Gegendenkmal bezieht, zeigt eine Sau, an deren Zitzen Menschen saugen, die Juden darstellen sollen. Sie ist an einem Pfeiler auf vier Metern Höhe angebracht. Die Kirche aus dem 12. Jahrhundert wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Sie ist sie seitdem eine gesicherte Ruine mit offenem Kirchenschiff.
Osnabrücker Bischof Bode offiziell verabschiedet
Osnabrück (epd). Der im März zurückgetretene katholische Bischof Franz-Josef Bode aus Osnabrück ist am 4. Juni mit einem Gottesdienst im Dom St. Petrus offiziell aus seinem Amt verabschiedet worden. Bode hatte mit seinem Rücktritt unter anderem die Konsequenzen aus Vorwürfen gegen ihn im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche gezogen. Der 72-Jährige nannte als einen Grund den im September veröffentlichten Zwischenbericht zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum. Redner würdigten aber auch die Verdienste des Bischofs, der als Reformer galt.
Zum Auftakt des Gottesdienstes griff Bode noch einmal auf, was ihn zum Rücktritt bewogen hatte: Der Vorwurf der Pflichtverletzungen im Umgang mit sexualisierter Gewalt, Irritationen in der Mitarbeiterschaft und den Gemeinden. Bode sprach das Schuldbekenntnis vor Gott auf eigene Bitte allein und ohne Begleitung der Gemeinde. „Ich möchte nicht in ein anonymes Wir flüchten.“
In seiner Predigt blickte Bode auf seine 27-jährige Amtszeit als Diözesanbischof zurück und bat um Vergebung für alle „Fehler, Pflichtverletzungen, Nachlässigkeiten, Unentschiedenheiten und blinden Flecken“, die Menschen geschadet und sie verletzt hätten. „Besonders im Blick auf sexualisierte Gewalt habe ich mich leider mehr den Tätern als den Betroffenen zugewandt.“
„Ein großer Schatten über meinem Weg“
Gegen alle scheinbar einfache Lösungen habe er immer versucht, den Idealen von Glauben, Hoffen und Lieben zu entsprechen. „Dass mir das nur bruchstückhaft und unvollkommen gelungen ist, ist ein großer Schatten über meinem Weg“, sagte der Bischof. Trotz aller offenkundigen Fehler sei er dennoch dankbar für seine Jahre im Bischofsamt.
Bode zählte zum Präsidium des Reformprozesses „Synodaler Weg“. Noch kurz vor seinem Rücktritt hatte er die Möglichkeit von Segensfeiern für homosexuelle oder wiederverheiratete Paare im Bistum auf den Weg gebracht. Das Ringen um Entscheidungen im Synodalen Weg, auch angefochten und enttäuscht von den römischen Reaktionen, nannte er als Belastungen, die wie auch seine Gesundheit zu seinem Rücktritt beigetragen hätten.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, würdigte Bode als „einen eindrucksvollen Priester, Theologen und Bischof“. Es sei ihm gelungen, ängstliche Enge in der Kirche zu überwinden, den richtigen Ton und eine verständliche Sprache zu finden, die viele Menschen angesprochen habe. Zu seinen Stärken zähle auch, dass er über Fehler im Umgang mit sexualisierter Gewalt offen und selbstkritisch gesprochen habe. „Es war ein Ringen in ihm, eine innere Zerrissenheit und eben auch eingestandenes Unvermögen, der bischöflichen Pflicht im Ganzen nachgekommen zu sein.“
Meister würdigt ökumenisches Miteinander
Der hannoversche evangelische Landesbischof Ralf Meister sagte, er habe Bode als einen Menschen kennengelernt, der Spaltungen überwinden wolle. „Sowohl innerhalb seiner Kirche als auch im ökumenischen Miteinander“, fügte er laut Manuskript in seinem Grußwort an. Im ökumenischen Dialog brauche es eine ehrliche Sprache. „Franz-Josef Bode ist für mich ein ökumenischer Freund, weil er diese Ehrlichkeit fand.“
Seit 2017 war Bode auch stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Mit seinem Rücktritt endete die Amtszeit des dienstältesten amtierenden Bischofs in Deutschland. Bode wurde 1991 zunächst Weihbischof im Erzbistum Paderborn. Seit 1995 leitete er das Bistum Osnabrück, das sich von der Nordseeküste über Ostfriesland, das Emsland und das Osnabrücker Land bis nach Bremen erstreckt. In dem Gebiet leben rund 532.000 katholische Christen.
Papst Franziskus hatte Bodes Rücktrittsgesuch zum 25. März angenommen. Seitdem leitet Weihbischof Johannes Wübbe als Diözesanadministrator das Bistum.
DFB-Pokalfinale: Kirchen rufen zu Fairplay und Gewaltlosigkeit auf

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Bei einem ökumenischen Gottesdienst zum DFB-Pokalfinale in Berlin haben die beiden großen Kirchen zu Fairplay bei Spielern und Zuschauern aufgerufen. „Wir wollen bei aller Leidenschaft um Fairness beten, um ein gutes Miteinander - auch wenn wir im Spiel Gegner sind“, sagte der Sportbischof der Deutschen Bischofskonferenz, der Passauer Bischof Stefan Oster, am 3. Juni in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. In dem Pokalfinale im Berliner Olympiastadion standen sich am Abend die Bundesliga-Mannschaften von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gegenüber, Leipzig gewann mit 2:0.
„Wir kämpfen und beten auch darum, dass das Spiel frei bleibt von Rassismus, von Doping und Wettbetrug - und vor allem von Gewalt“, mahnte der Bischof. Er bitte um den Segen Gottes, „damit alles, was das Spiel so schön macht, für uns alle heute in den Vordergrund tritt - und alles, was geeignet ist, das Spiel hässlich zu machen, heute draußen bleiben möge.“
Der traditionelle ökumenische Gottesdienst zum DFB-Pokalfinale stand unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Wir“. Der Sportbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Thorsten Latzel, betonte in seiner Predigt die Gemeinsamkeiten von Glauben und Sport. Für beides brauche es Engagement, Arbeit und Einsatz sowie Können, Genialität und Strahlkraft, sagte der rheinische Präses.
An dem Gottesdienst wirkten den Angaben zufolge zudem unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf sowie Fanvertreter von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt mit.
"Prost und Amen"

epd-bild/Nancy Heusel
Landringhausen (epd). Philipp Müller (31) hat an diesem Abend im wahrsten Sinn des Wortes alle Hände voll zu tun. Mit beiden Händen balanciert er zehn Gläser Pils, um sie von der Theke unter der Empore nach draußen zu seinen Kumpels zu bringen. „Das ist unsere Männergruppe, wir nennen sie Boßelgruppe“, erzählt der Baumaschinentechniker aus Landringhausen bei Hannover. Alle sind heute zur Dorfkirche gekommen, um ihr Feierabendbier zu nehmen. Denn hier wartet im Juni ein ganz besonderes Event: Die evangelische Ortsgemeinde hat die kleine Kirche in eine Kneipe auf Zeit verwandelt.
„Kneipenkirche“ nennt sich das Projekt, das drei Diakoninnen aus der Region und eine Kirchenvorsteherin ins Leben gerufen haben. Beides passe gut zusammen, finden sie: „Kirche ist schon immer ein Ort der Begegnung und der Gemeinschaft gewesen“, betont Diakonin Carina Hausmann (41) in der Eröffnungsrede auf den Altarstufen. Deshalb haben die vier zusammen mit rund 50 ehrenamtlichen Helfern das Gotteshaus leergeräumt und Tischgruppen für rund 40 Personen hineingestellt. Unter der Orgelempore gibt es Bier und Wein, Kaffee oder Cola.
Ob es wirklich Deutschlands erste Kneipenkirche ist, wissen die vier nicht so genau. Aber eins ist sicher: „Wer Kneipenkirche googelt, findet nur uns“, sagt Diakonin Louisa Stölting (29). Gemeinsam mit den drei anderen Frauen lässt sie zur Eröffnung symbolisch die Gläser klingen. Und unter großem Applaus stimmen dann alle vier in den Slogan ein, den sie sich zuvor lange überlegt haben: „Prost und Amen“.
„Mal was anderes trinken als Abendmahlswein“
Wer die Kneipenkirche für ein reines Spaß-Projekt hält, liegt allerdings falsch. Der Aktion liegt ein ausgefeiltes Konzept zugrunde. Längst haben Louisa Stölting und die anderen festgestellt, dass viele Menschen in Deutschland sich inzwischen kaum noch trauen, die Schwelle einer Kirche zu übertreten. Bei einer Fahrt von Mitarbeitenden nach Magdeburg haben sie sich überlegt, was sie dagegen tun können. „Dort werden schon viele Kirchen wegen niedriger Mitgliederzahlen als etwas anderes genutzt“, sagt Stölting. „Da haben wir uns gedacht: Wir müssen es ja nicht so weit kommen lassen.“
Was als fixe Idee begann, nahm schließlich über Monate hinweg Gestalt an und fand immer mehr Fürsprecher. Eine kirchliche Stiftung spendierte sogar Geld für ein Kulturprogramm. So können in der Kneipenkirche jetzt Bands und ein Zauberkünstler auftreten. Geplant sind Karaoke, ein Table-Quiz, Figurentheater und ein Filmabend mit einem Regisseur. Blaue Leuchtstäbe sowie Lampions zwischen den hohen Kirchenfenstern sorgen dabei für Party-Ambiente.
Bei den rund 70 Premieren-Gästen kommt das an. „Dass man in einer Kirche mal was anderes trinkt als Abendmahlswein, ist schon toll“, sagt Olaf Wegener (55). Der Ingenieur ist mit dem Auto aus einem Nachbarort gekommen und hat sich deshalb kein Bier, sondern ein Alster bestellt. Seine Frau Karin Puy (54) pflichtet ihm bei: „Solange das alles in Maßen bleibt, warum nicht?“
Draußen an den Stehtischen nippen die Zwillinge Noel und Mia Gentzsch (16) an ihren Gläsern. Beide sind der St.-Severin-Kirche von Landringhausen konfirmiert worden. „Ich finde, das ist eine schöne Aktion“, sagt Noel. Klar, einige im Dorf hätten gesagt, das sei nichts für sie, ergänzt seine Schwester. „Aber das ist ja völlig OK.“ Sie selbst will jedenfalls wiederkommen und vielleicht ihre Freunde von der Boule-Gruppe mitbringen.
Insgesamt sei das Echo in dem 950-Einwohner-Dorf überwiegend positiv, freut sich die Kirchenvorsteherin, Köchin und Mitinitiatorin Theresa Müller (28): „Auch die Älteren sagen: Ich gehe zwar nicht unbedingt zum Rock-Abend, aber dafür vielleicht zum Quiz-Abend. Es ist für Groß und Klein alles dabei.“
Bis Ende Juni wird die Kneipenkirche jeden Donnerstag bis Sonnabend von 19 bis 23 Uhr ihre Türen öffnen. Die Kanzel, die wie ein Schwalbennest über dem Kirchensaal thront, bleibt bis dahin unbesetzt. Die Aktion solle Berührungsängste abbauen, und zwar ohne missionarischen Auftrag, betont Diakonin Stölting: „Wir führen keine Liste, wer am Ende in die Kirche eingetreten ist. Wir wollen einfach ein schönes Programm bieten für die Leute aus dem Dorf und aus unserer Region.“
"Wir wollten zeigen, dass wir viele sind"

epd-bild / Stephan Wallocha
Hamburg (epd). „Hallo, guten Abend!“ Haruna Mutari hält einem Paar, das abgehetzt zu spät zur Vorstellung kommt, die schwere Eingangstür des Hamburger Thalia Theaters auf und bittet sie freundlich herein. An ein paar Abenden in der Woche arbeitet der 44-Jährige Mann aus Ghana am Einlass des Theaters und begrüßt dort die Besucher. Als er 2012 nach Deutschland kam, war niemand da, der ihn begrüßt hätte.
Doch dann wurde Mutari Teil einer Gruppe von afrikanischen Flüchtlingen, die unter dem Namen „Lampedusa in Hamburg“ bundesweit Aufmerksamkeit bekam für ihren Kampf um ein Bleiberecht in Deutschland. Heute hat sich dieser Wunsch für Haruna Mutari und viele andere erfüllt.
Die Lampedusa-Flüchtlinge stammten aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern und hatten alle in Libyen gearbeitet. Als dort 2011 ein Krieg begann, mussten sie in Schlauchbooten über das Mittelmeer fliehen und landeten auf der italienischen Insel Lampedusa. Die dortigen Behörden schickten sie rasch weiter Richtung Norden.
Mutari war einer von ihnen. In Hamburg angekommen, lernte er im Winternotprogramm der Stadt weitere Männer kennen, die denselben Weg hinter sich hatten. Sie taten sich zusammen und machten auf sich aufmerksam. „Wir wollten zeigen, dass wir viele sind“, erzählt er.
Mutari, der gelernter Tischler ist, wollte gerne in Hamburg zur Schule gehen. Doch als das Winternotprogramm im April 2013 endete, hatten die etwa 300 bis 400 Lampedusa-Flüchtlinge nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf oder etwas zu essen. Am 2. Juni öffnete ihnen der Pastor der St. Pauli-Kirche, Sieghard Wilm, die Türen seines Gotteshauses. „Ich habe nicht geahnt, was ich damit auslöse. Ich dachte, es ginge um ein oder zwei Nächte, dann würde sich die Stadt schon melden“, erzählt Wilm.
Monatelang in der Kirche übernachtet
Doch die Stadt versuchte zunächst, die Sache auszusitzen. Mehrere Monate schliefen Mutari und etwa 80 weitere Männer in der Kirche. Der sie umgebende Garten wurde zu einem Ort, an dem die Flüchtlinge ihre Forderungen sichtbar machen und mit der Nachbarschaft ins Gespräch kommen konnten. „Es gab eine unglaubliche Welle der Solidarität in der ganzen Stadt“, erinnert sich Wilm.
Nach zähen Verhandlungen zwischen der Nordkirche und dem Senat machte die Stadt den Männern Ende Oktober das Angebot, ihre Fälle einzeln zu prüfen. Bis zur endgültigen Entscheidung über ihre Aufenthaltserlaubnis durften sie in Hamburg bleiben. „Dieses Angebot war viel substanzieller, als es vielleicht auf den ersten Blick gewirkt hat“, sagt Uwe Giffei, Rechtsberater bei der kirchlichen Beratungsstelle Fluchtpunkt. „Bischöfin Kirsten Fehrs hat damals das Maximale rausgeholt, was rauszuholen war.“
Das Hamburger Angebot habe den Menschen eine wirkliche Perspektive auf einen legalen Aufenthaltsstatus geboten - nach Ansicht von Giffei war das deutschlandweit einzigartig. Trotzdem waren viele Flüchtlinge skeptisch, weil sie sich für eine Aufenthaltserlaubnis für die gesamte Gruppe eingesetzt hatten. Noch heute gibt es Flüchtlinge und Unterstützergruppen, die unter dem Namen „Lampedusa in Hamburg“ für eine gerechtere Flüchtlingspolitik kämpfen.
Etwa 120 Menschen ließen sich auf die Einzelfallprüfung ein. Währenddessen besuchten sie Deutschkurse und fingen an zu arbeiten - weiterhin mit großer Unterstützung aus der Stadtgesellschaft. 100 von ihnen erhielten schließlich einen sicheren Aufenthaltsstatus.
Auch Haruna Mutari gehört dazu. Heute hat er zwei Kinder, lebt im Osten der Stadt und arbeitet in einem Saatengroßhandel im Hafen. Mit anderen Männern aus der Lampedusa-Gruppe habe er nicht mehr viel zu tun, erzählt er. Doch den Kontakt zum Thalia-Theater, das sich damals sehr engagiert hat, hält er durch seinen Minijob am Einlass ebenso aufrecht wie zur St. Pauli-Kirche, bei der er ab und zu als Küster aushilft.
Am Ende seiner Wünsche ist er aber noch lange nicht. Sein Traum ist es, wieder als Tischler zu arbeiten und selbst noch mehr Menschen in Not helfen zu können. In seinem Heimatland Ghana unterstützt er Bedürftige mit Spenden. Und wenn es in Hamburg kalt wird, kauft Mutari Decken und Schlafsäcke und verteilt sie an Obdachlose.
Gesellschaft
Zugunglück von Eschede: "Es gibt ein Davor und ein Danach"

epd-bild/Stefan Heinze
Eschede (epd). Heinrich Löwen sprach zum Auftakt mit leiser Stimme und ohne Mikrofon. Am Mahnmal mit den Kirschbäumen und der Inschriftenwand erinnerte er am Samstag in Eschede an das Zugunglück in dem niedersächsischen Ort vor 25 Jahren. Als eine „Zeitenwende“ bezeichnete der Sprecher der „Selbsthilfe Eschede“ die Katastrophe bei der Gedenkveranstaltung. „Seither ist unser Leben von diesem Unfall geprägt.“
Der heute 78-Jährige hat bei dem Unglück seine Frau Christl und Tochter Astrid verloren. Noch am Morgen des 3. Juni 1998 schien die Welt in Ordnung gewesen zu sein, erinnerte er sich. „Doch der ICE raste in die Katastrophe, er raste in den Tod.“ Zwischenzeitlich übertönten Züge seine Worte, die während der Gedenkstunde mit deutlich verminderter Geschwindigkeit vorbeifuhren. Seit dem Unglück sei nichts mehr wie vorher. „101 Menschen fehlen“, sagte Löwen. „Wir müssen es aushalten und ertragen, dass es so gekommen ist.“
Bischof Meister sprach Gebet
Bei dem Unglück am 3. Juni 1998 kamen 101 Menschen ums Leben. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt, als der ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ auf seiner Fahrt von München nach Hamburg wegen eines gebrochenen Radreifens entgleiste und in Eschede mit hohem Tempo gegen eine Straßenbrücke prallte. Neben Löwens Beitrag leiteten Worte der Zugbegleiterin Angelique Koch ein stilles Gedenken ein - um 10.58 Uhr, dem Zeitpunkt, an dem sich vor 25 Jahren die ICE-Katastrophe ereignete. Kränze wurden niedergelegt und der hannoversche Landesbischof Ralf Meister sprach ein Gebet.
Lange Zeit war das Verhältnis zwischen der Bahn und den Hinterbliebenen und Überlebenden vom Ringen um Entschädigung und eine juristische Aufarbeitung angespannt. Erst 2013 hatte mit Rüdiger Grube erstmals ein Bahnvorstand um Entschuldigung gebeten, daran erinnerten Redner auf dem Brückenplateau oberhalb der Gedenkstätte.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, unvermittelt seien vor 25 Jahren Menschen aus einem glücklichen, unbeschwerten Leben gerissen worden. „Es gibt kaum Worte für das Ausmaß, die Folgen und das Leid, das Opfer, Familien, Angehörige und Freunde dadurch erlitten haben.“ Das Unglück bleibe wie auch das vor einem Jahr in Garmisch-Partenkirchen eine Mahnung an alle Verantwortlichen, wachsam zu bleiben.
Wie bereits vor fünf Jahren erneuerte der amtierende Bahnchef Richard Lutz die Bitte um Entschuldigung noch einmal mit Nachdruck. Er spreche mit dem Gefühl großer Demut zu den Betroffenen, die darauf zu lange hätten warten müssen. Dass ein gemeinsames Gedenken möglich sei, sei alles andere als selbstverständlich. „Die Erinnerungen müssen extrem schmerzhaft für Sie sein“, sagte er. „Und sie werden es wohl auch immer bleiben.“ Auch für die Bahn bedeute die ICE-Katastrophe eine Zäsur. „Es gibt ein Davor und ein Danach.“
„Zeit heilt nicht alle Verletzungen“
Löwen sagte, Grubes Bitte um Entschuldigung sei ein großer Schritt hin zu einem Klima gewesen, das sich mittlerweile weiter verbessert habe. „Aber die Zeit heilt nicht alle Verletzungen.“ Auch die juristische Aufarbeitung sei eine Enttäuschung gewesen und habe den Betroffenen weiteren Schmerz zugefügt.
Die Präsidentin des Bayerischen Landtages Ilse Aigner (CSU) erinnerte daran, dass mehr als die Hälfte der Getöteten in Bayern in den Zug gestiegen waren. Niemand habe geahnt, dass der Abschied von ihnen dort für immer sein werde.
Viele Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr in Uniformen waren ebenso zu der Gedenkfeier gekommen wie Anwohner und Seelsorger. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) sagte, der Ort Eschede stehe nicht nur für Leid, „sondern auch für in der Katastrophe gelebte Mitmenschlichkeit und spontane Solidarität“.
Fast 2.000 Helferinnen und Helfer waren nach dem Unglück in Eschede im Einsatz. Erstmals hatte es ein umfassendes Nachsorgeangebot für die Retter gegeben. Auch die Dorfgemeinschaft engagierte sich. Der Name Eschede sei zwar für immer mit dem Zugunglück verbunden, sagte Bürgermeister Heinrich Lange. Aber er trage keinen Makel.
Glücklich dank Widerspruch

epd-bild/Heike Lyding
Frankfurt a.M. (epd). Als der dreijährige Salomon Korn mit seinen Eltern und seinem Bruder Benjamin nach dem Krieg in ein Lager von Holocaust-Überlebenden kommt, wird der Widerspruch in ihm wach. Der am 4. Juni 1943 im polnischen Lublin Geborene soll in Berlin-Schlachtensee einen Kindergarten besuchen, schleicht aber jeden Tag heimlich zum Fußballkick auf die Wiese. Als der Vater nach einiger Zeit den Eigensinn bemerkt, setzt es die erste Tracht Prügel. Doch der Junge bleibt widerständig.
Über ein weiteres Lager in Frankfurt-Zeilsheim gelangt die Familie nach Frankfurt am Main und wird dort ansässig. Der neunjährige Salomon und sein Bruder Benjamin werden für ein Jahr auf ein strenges jüdisches Internat in die Schweiz geschickt. Das Verbot am Sabbat-Feiertag hielt ihn nicht davon ab, es einem Kameraden nachzutun und Steine in eine Pfütze zu werfen, wie Korn erzählt. Zur Strafe mussten sich die Jungen nackt ausziehen und in die Pfütze setzen. Der Schulkamerad habe gelacht und in der Pfütze herumgespritzt. „Da habe ich viel gelernt“, sagt Korn. „Man kann die Dinge auch anders sehen.“
Mit Anfang 20 setzt Korn seinen Studienwunsch gegen die zunächst erfolgte Ablehnung durch die TH Darmstadt durch und wird Architekt. 1975 übernimmt er die Leitung eines Immobilienunternehmens der Familie und baut es aus, bis er sie 2008 an seinen Sohn Daniel übergibt. Daneben wird er zu einem der prominentesten Vertreter des Judentums in Deutschland.
Wollte nicht an Spitze des Zentralrats
1986 wird Korn in den Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt gewählt. Seit 1999 ist er als Nachfolger seines Mentors Ignatz Bubis Vorstandsvorsitzender und hat zahlreiche Ehrenämter inne. Zudem war er von 2003 bis 2014 Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, lehnte die Kandidatur für das Präsidentenamt aber ab. Er habe sich nicht den damit verbundenen Sicherheitsmaßnahmen unterwerfen wollen, begründet er.
Der Glaube ist ihm mit dem Zweifel verbunden. „Wie kann Gott allmächtig sein und die unzähligen Galaxien des Universums geschaffen haben und gleichzeitig die Anbetung von Menschen brauchen?“, fragt Korn. Dies sei ein Widerspruch. „Der Zweifel ist mir mit zum Wichtigsten geworden, was mich treibt“, bekennt er. „Zweifel und Widerspruch bringen uns voran.“ Darauf beruhe auch die Demokratie, fügt er dankbar an.
Als jugendlicher Kinogänger zeigte er den Wunsch, Gutes und Böses klar identifizieren zu können. Besonders gerne habe er Cowboyfilme gesehen: „Da war von vornherein klar, die weißen Hüte sind die Guten, die schwarzen Hüte die Bösen, und die Guten werden siegen.“ In der deutschen Gesellschaft sind die Fronten dagegen nicht so klar geschieden.
„Sehe Entwicklung des Judentums in Deutschland positiv“
Die Verwicklung in den Nationalsozialismus sei in vielen Familien totgeschwiegen worden, sagt Korn. Der Antisemitismus sei zunächst abgetaucht, komme aber in der dritten Generation wieder mehr ans Tageslicht. Der Antisemitismus sei dreister geworden, wie Studien zeigten. Persönlich habe er Judenfeindlichkeit nicht zu spüren bekommen - er oder seine Familienangehörigen seien nie bedroht worden, sagt Korn. Deshalb habe er auch nie erwogen, Deutschland zu verlassen.
Ein Leitmotiv in Korns Reden ist die Frage, ob Juden in Deutschland wieder heimisch werden. Bei der Eröffnung des von ihm geplanten Frankfurter Gemeindezentrums 1986 sagte er: „Wer ein Haus baut, will bleiben, und wer bleiben will, erhofft sich Sicherheit.“ Die Sicherheit von Juden ist fragil geblieben. 2016 spricht Korn von „wachsender Hoffnung und vorsichtigem Vertrauen in die Weiterentwicklung jüdischen Lebens in Deutschland“. Dabei hat er nicht nur die Bedrohung durch Judenfeindlichkeit im Blick, sondern auch die Überalterung der jüdischen Gemeinden.
Zurück blickt Korn zufrieden: „Ich sehe die Entwicklung des Judentums in Deutschland positiv.“ Mit sich selbst ist er im Reinen: „Ich wüsste nicht, was ich im Nachhinein anders machen würde.“
Korns Alltag ist gefüllt von den Anliegen seiner Familie, seiner Frau, den beiden Söhnen und der Tochter sowie den neun Enkelkindern. Auch pflegt er einen langjährigen Freundeskreis. „Wir leben in Mitteleuropa auf einer Insel der Seligen“, ist er überzeugt. „Ich bin dankbar, dass ich in einem Land lebe, in dem Frieden herrscht, das die Demokratie pflegt und Armut bekämpft.“
Krüger für deutsch-israelisches Jugendwerk

epd-bild/Martin Scherag/Bundeszentrale fuer politische Bildung
Berlin (epd). Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, hat sich für mehr Begegnungen zwischen Deutschen und Israelis ausgesprochen. Begegnungs- und Dialognetzwerke sollten ausgebaut werden, sagte Krüger am 1. Juni in Berlin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dazu könne etwa das Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch, ConAct, in Lutherstadt Wittenberg zu einer Art Deutsch-Israelisches Jugendwerk ausgebaut werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung feiert am Freitag in Berlin mit einer Tagung und israelischen Gästen das 60. Jubiläum ihrer Israel-Studienreisen und das 75. Gründungsjahr des jüdischen Staates.
Krüger betonte, dass es auf politischer Ebene zwischen den Regierungen und Parlamenten schon „ein Fundament für eine nachhaltige Dialog- und Begegnungskultur“ gebe. Die Israel-Studienreisen der Bundeszentrale für politische Bildung würden davon unabhängig laufen: „Wir versuchen mit unseren Studienreisen alle Alters- wie Interessensgruppen und Kompetenznetzwerke in die Begegnung mit Israel zu bringen, um die beiden Gesellschaften osmotischer, durchlässiger zu machen, sich austauschen zu lassen.“
Mehr als 300 Israel-Reisen
Die 1963 ins Leben gerufenen Israel-Studienreisen der Bundeszentrale für politische Bildung waren nach eigenen Angaben eine Reaktion auf antisemitische Vorfälle im Westdeutschland: „Ziel war immer, Multiplikatoren durch eine unmittelbare Begegnung mit den Menschen ein differenzierteres Bild vom Leben und den Herausforderungen dieses Landes zu vermitteln“, sagte Krüger: „Diese Multiplikatoren kommen schlicht anders zurück, als sie hingefahren sind.“ Die direkte Begegnung sei eine andere Form politischer Bildung.
In den vergangenen sechs Jahrzehnten haben nach Angaben der Bundeszentrale mehr als 9.000 Menschen in rund 300 Reisen an Israel-Studienreisen teilgenommen. „Auch in schwierigen und zugespitzten Zeiten sind wir immer gefahren und haben dieses Angebot hochgehalten“, betonte Krüger.
Umfrage: Ein Drittel skeptisch gegenüber religiöser Vielfalt
Gütersloh (epd). Ein Drittel der Deutschen sieht religiöse Vielfalt offenbar skeptisch. 34 Prozent der Bundesbürger nehme religiöse Vielfalt in Deutschland als Bedrohung wahr, ergibt eine am 31. Mai in Gütersloh veröffentlichte Auswertung des „Religionsmonitors 2023“ der Bertelsmann Stiftung. Ein knappes Drittel sehe die Religionsvielfalt hingegen als Bereicherung (29 Prozent). 37 Prozent gaben an, dass weder das eine noch das andere zutreffe. Im Sommer vergangenen Jahres waren für den „Religionsmonitor“ bundesweit 4.300 Menschen befragt worden.
Grundsätzlich belege die Studie ein weiterhin hohes Maß an religiöser Toleranz, das aber im Vergleich zu 2013 leicht abgenommen habe, hieß es. 93 Prozent der Befragten bejahten die generelle Aussage, jeder solle die Freiheit haben, die Religion zu wechseln oder abzulegen. 80 Prozent sind demnach der Meinung, man solle gegenüber anderen Religionen offen sein. Zehn Jahre zuvor waren dies noch 89 Prozent.
„Das birgt Spaltungspotenzial“
Die Zahlen zeigten, dass die Pluralisierung sowie die Individualisierung des religiösen Bereichs deutlich zugenommen hätten, erklärte die Religionsexpertin der Bertelsmann Stiftung, Yasemin El-Menouar. „Das birgt Spaltungspotenzial“, mahnte sie. Gegenseitige Wertschätzung und gelingendes Miteinander seien kein Selbstläufer, sondern eine Aufgabe für Religionspolitik und Religionsgemeinschaften. Laut Studie können persönliche Kontakte in der Freizeit Brücken zwischen Angehörigen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften bauen.
1950 hätten noch fast 96 Prozent der Bundesbürger zu den beiden großen christlichen Konfessionen Katholizismus und Protestantismus gezählt, hieß es. Andersgläubige und Nichtreligiöse machten lediglich 4,4, Prozent aus. Laut „Religionsmonitor 2023“ ordneten sich inzwischen nur noch 50 Prozent der Befragten in Deutschland einem christlichen Glauben zu. Die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in Deutschland ist der Islam mit 8,5 Prozent. Danach folgen in den Religionsgruppen Hinduismus (1,3 Prozent), Buddhismus (0,9 Prozent) und Judentum (0,3 Prozent). Über ein Drittel der Deutschen (35,9 Prozent) sehe sich keiner Religionsgesellschaft zugehörig. Diese Zahlen wurden bereits im März 2023 veröffentlicht.
Innenministerium: Kinder von Grenzverfahren an EU-Grenzen ausnehmen
Die Bundesregierung will Kinder von Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen ausnehmen. Kritik kommt von der Union, von dem Kolaitionspartner FDP, aber auch von zahlreichen Künstlern, die eine grundsätzliche Änderung des Asylrechts fordern.
Frankfurt a.M. (epd). Vor dem EU-Innenministertreffen hat die Bundesregierung angekündigt, sich dafür einzusetzen, Kinder und Jugendliche sowie Familien mit Kindern von den Grenzverfahren an EU-Außengrenzen auszunehmen. Solche Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen soll es für Menschen mit geringer Aussicht auf Schutz in der EU geben, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums dem Evangelischen Pressedienst (epd) am 4. Juni bestätigte. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ darüber berichtet.
Indessen kritisierten die Union und zahlreiche Künstler die Pläne der Bundesregierung. Die EU-Innenminister beraten kommende Woche über eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems.
Der Sprecher des Innenministeriums sagte weiter, dass sich die Bundesregierung im Rahmen der Verhandlungen zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem für konsequenten Menschenrechtsschutz sowie rechtsstaatliche und faire Verfahren an den EU-Außengrenzen einsetze. „Menschen, die vor Krieg oder Terror geflüchtet sind, müssen weiterhin Schutz finden“, sagte er. Gleichzeitig gelte es, auf europäischer Ebene Migration nachhaltig zu ordnen und zu steuern sowie die irreguläre Migration zu begrenzen.
Kritik von der Union
Zuvor hatte Baerbock die Einhaltung europäischer Menschenrechtsstandards an den EU-Außengrenzen angemahnt. Es müsse sichergestellt werden, „dass niemand länger als einige Wochen im Grenzverfahren stecken bleibt, dass Familien mit Kindern nicht ins Grenzverfahren kommen, dass das Recht auf Asyl im Kern nicht ausgehöhlt wird“, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Kritik an den Plänen kam von der Union: Thorsten Frei (CDU), Parlamentsgeschäftsführer der Bundestagsfraktion, sagte dem „Tagesspiegel“: Familien mit Kindern aus dem Grenzverfahren an EU-Außengrenzen auszunehmen, weiche den Ursprungsvorschlag „an verschiedenen Stellen weiter“ auf. „Wenn man Familien von den Verfahren an den Außengrenzen ausnimmt, schwächt das den Ansatz“. Auf deren Bedürfnisse müsse und könne in den Verfahren selbst Rücksicht genommen werden.
Auch der liberale Koalitionspartner, die FDP, hält am ursprünglichen EU-Kommissionsvorschlag fest, wonach nur Kinder unter zwölf Jahren vom Grenzverfahren ausgenommen werden. „Eine menschenwürdige Versorgung aller Flüchtlinge und eine effiziente Durchführung der Asylverfahren an den EU-Außengrenzen muss gewährleistet und sichergestellt sein“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem „Tagesspiegel“: „Wenn diese Regeln gelten, dann braucht es auch keine Debatte zu möglichen Ausnahmen, die eine Einigung in Europa wieder nur gefährden würden.“
Appell von Prominenten
Derweil kritisierten zahlreiche Prominente und Künstler die Asyl-Politik der Bundesregierung und forderten humanitäre Verbesserungen des Asylrechts. „Statt pragmatisch und unbeirrt an wirksamen Lösungen festzuhalten, droht der migrationspolitische Aufbruch in einer populistischen Debatte zu ersticken“, heißt es in dem Brief, der von der Hilfsorganisation „Leavenoonebehind“ initiiert wurde. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem der Musiker Herbert Grönemeyer, der Moderator Klaas Heufer-Umlauf, die Schriftstellerin Sibylle Berg sowie die Schauspielerin Katja Riemann und die Band Kraftklub.
Hintergrund ist das bevorstehende EU-Innenministertreffen in Luxemburg. Dort soll unter anderem über Verschärfungen bei den Verfahren an den EU-Außengrenzen für Migranten beraten werden. Die Pläne zum europäischen Asylrecht stoßen in der Opposition und bei Menschenrechtlern auf scharfe Kritik: Sie protestieren, dass mit dem Verfahren an der Außengrenze ein Zustand der Rechtlosigkeit geschaffen werde.
Brand in einem Asylbewerberheim mit einem Todesopfer
Nach einem Brand mit einem Toten in einer Geflüchtetenunterkunft in Thüringen ermittelt die Kriminalpolizei. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte mit Bestürzung auf die Nachricht.
Apolda (epd). Bei einem Brand in einem Asylbewerberheim im thüringischen Apolda ist ein Mensch zu Tode gekommen. Der Brand war nach Angaben der Thüringer Polizei am frühen Morgen des 4. Juni gegen fünf Uhr im Wohnbereich der Geflüchtetenunterkunft ausgebrochen. 250 Personen, darunter viele Kinder, hätten evakuiert werden müssen, zehn von ihnen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Ende der Löscharbeiten sei in dem Gebäude ein Leichnam gefunden worden.
Ein neunjähriger ukrainischer Junge werde seit dem Brand vermisst, teilte die Polizei weiter mit. Ob es sich bei dem Leichnam um den vermissten Neunjährigen handelt, könne aber mit abschließender Sicherheit erst nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung festgestellt werden.
Die Kriminalpolizei ermittle derzeit die Brandursache. Die Staatsanwaltschaft Erfurt habe zudem ein sogenanntes Todesfallermittlungsverfahren eingeleitet.
Innenminister: Brandursache schnell klären
Zur Höhe des Sachschadens an dem Gebäude und zu den individuellen Sachschäden der Bewohner könne noch keine Auskunft getroffen werden. Die Bewohner werden nach Angaben des Thüringer Integrationsministeriums in einer Halle im ostthüringischen Hermsdorf untergebracht.
Politiker von Bund und Land reagierten mit Bestürzung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schrieb auf Twitter, „diese schreckliche Nachricht macht mich sehr traurig. Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Geflüchteten, die hier wohnten“. Die Sicherheitsbehörden des Bundes ständen mit der Thüringer Polizei in ständigem Austausch und jederzeit zur Unterstützung bereit.
Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erklärte sein Beileid mit den Eltern und Angehörigen des toten Kindes. Die Brandursache müsse jetzt schnell geklärt werden, sagte Maier. Die Kriminalpolizei ermittle „mit Hochdruck.“ Maier dankte zudem den zahlreichen Rettungskräften, die das Feuer zügig unter Kontrolle bekommen hätten.
Die Thüringer Integrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) machte sich vor Ort ein Bild und sprach von einem erschütternden Ereignis. „Besonders dramatisch ist, dass ein Kind gestorben ist. Mein Mitgefühl gilt insbesondere seiner Familie, aber auch den Verletzten“, sagte sie.
Zahl der Einbürgerungen in Deutschland um 28 Prozent gestiegen
Wiesbaden (epd). In Deutschland sind im vergangenen Jahr rund 168.500 Menschen eingebürgert worden. Das waren 28 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt am 30. Mai in Wiesbaden auf der Grundlage noch vorläufiger Ergebnisse mit. Seit 2002 seien innerhalb eines Jahres nicht mehr so viele Einbürgerungen registriert worden, hieß es weiter.
Syrerinnen und Syrer machten 2022 mit einem Anteil von 29 Prozent die größte Gruppe der Eingebürgerten aus. Insgesamt wurden 48 300 syrische Staatsangehörige eingebürgert, dies waren mehr als doppelt so viele wie 2021 (19.100). Sie waren im Schnitt 24,8 Jahre alt und zu zwei Dritteln männlich. Vor ihrer Einbürgerung hielten sie sich durchschnittlich 6,4 Jahre in Deutschland auf.
Bei Syrern gab es auch den mit Abstand deutlichsten Anstieg bei Einbürgerungen (plus 29.200), gefolgt von ukrainischen (plus 3.700), irakischen (plus 2.400) und türkischen (plus 2.000) Staatsangehörigen. Eingebürgert wurden den Angaben zufolge Menschen mit 171 unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten.
Zu den Voraussetzungen für die Einbürgerung zählen unter anderem ausreichende Sprachkenntnisse, ein gesicherter Lebensunterhalt und in der Regel eine Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren. Ehegatten und minderjährige Kinder können dabei ohne Mindestaufenthaltsdauer miteingebürgert werden.
"Geo Barents" bringt rund 600 Flüchtlinge in Bari an Land
Frankfurt a.M. (epd). Mit Hunderten aus Seenot geretteten Menschen hat die „Geo Barents“ in Italien angelegt. Die 606 Männer, Frauen und Kinder seien im Hafen von Bari an Land gegangen, teilte die Hilfsorganisation '„Ärzte ohne Grenzen“, die das Rettungsschiff betreibt, am 31. Mai auf Twitter mit. Die Mannschaft der „Geo Barents“ hatte die Flüchtlinge und Migranten am Samstag von einem überfüllten Boot gerettet.
Das Mittelmeer zählt zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind seit Beginn des Jahres bereits rund 1.100 Menschen beim Versuch der Überfahrt gestorben oder werden vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein.
Gewaltsame Proteste in Leipzig
Das Wochenende in Leipzig war von schweren Ausschreitungen linksradikaler Gruppen überschattet. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die sächsische Linksfraktion will eine Sondersitzung des Innenausschusses.
Leipzig (epd). Das Wochenende in Leipzig war überschattet von massiven Ausschreitungen linksradikaler Gruppen. Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten mit mehr als fünf Jahren Haft hatte die linke Szene bundesweit für den 3. Juni zu einem „Tag X“ in die sächsische Stadt mobilisiert. Trotz eines von der Stadt verhängten Demonstrationsverbots kam es im Süden der Stadt zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. Schwerpunkt war der Stadtteil Connewitz. Eine für den Abend des 4. Juni angemeldete weitere Demonstration „gegen Polizeigewalt“ wurde von der Stadt ebenfalls verboten.
In den Nächten zu Samstag und Sonntag griffen Hunderte Vermummte Polizisten mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik an, errichten Barrikaden und zündeten sie an. Zudem attackierten sie ein Polizeirevier in Connewitz. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und setzte Räumpanzer und Wasserwerfer ein. Über der Stadt kreisten Polizeihubschrauber.
Am Samstag kesselten Einsatzkräfte nach einer genehmigten Demonstration mehr als 1.000 Menschen über Stunden ein und nahmen die Personalien auf. Die letzte Identität sei am Sonntagmorgen kurz nach fünf Uhr festgestellt worden, teilte die Polizei mit.
Am Sonntagnachmittag bilanzierte die Polizei rund 50 verletzte Polizeibeamte. Auch bei den Versammlungsteilnehmern habe es ein unbekannte Anzahl von Verletzten gegeben.
Bis zu 50 Personen seien zudem in Gewahrsam genommen worden Bei knapp 30 Menschen prüfe die Staatsanwaltschaft Haftanträge. Bereits am Samstag waren gegen fünf Männer Haftbefehle wegen Landfriedensbruch erlassen worden. .
Kritik an Einkesselung
Zudem wurde laut Polizei bei den Ausschreitungen mindestens ein Medienvertreter angegriffen. Dabei soll es sich um einen freien Fotografen handeln, der unter anderem für die „Bild“ arbeitet.
Unterstützung erhielt die sächsische Polizei von Einsatzkräften aus zwölf Bundesländern und der Bundespolizei. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte am Sonntag, wer Steine, Flaschen und Brandsätze auf Polizisten werfe, müsse dafür konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU sagte, die massiven Angriffe auf die Einsatzkräfte habe bestätigt, „dass das Vorgehen von Polizei und Stadt sowie Staatsanwaltschaft und Gerichten richtig war“. Die Stadt Leipzig hatte die „Tag X“-Demonstration mit der Begründung verboten, dass ein unfriedlicher Verlauf zu befürchten sei. Das Verbot wurde später von mehreren Gerichten bestätigt.
Kritik am Vorgehen von Stadt und Polizei kam von Linken, SPD und Grünen im sächsischen Landtag. Der SPD-Innenpolitiker Albrecht Pallas warf der Polizeiführung eine „provozierenden Herangehensweise“ vor, die zur Eskalation beigetragen habe. Der Grünen-Abgeordnete Valentin Lippmann sagte, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit sei in Leipzig „faktisch entkernt“ worden.
Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Kerstin Köditz, kritisierte besonders die stundenlange Einkesselung. Die „Herstellung menschenunwürdiger Bedingungen ist weder verhältnismäßig noch ein Beitrag zur Deeskalation“, sagte sie. Die Linke werde deshalb eine Sondersitzung des Innenausschuss im Landtag beantragen.
Kalt, süß - und gesundheitlich zumeist unbedenklich
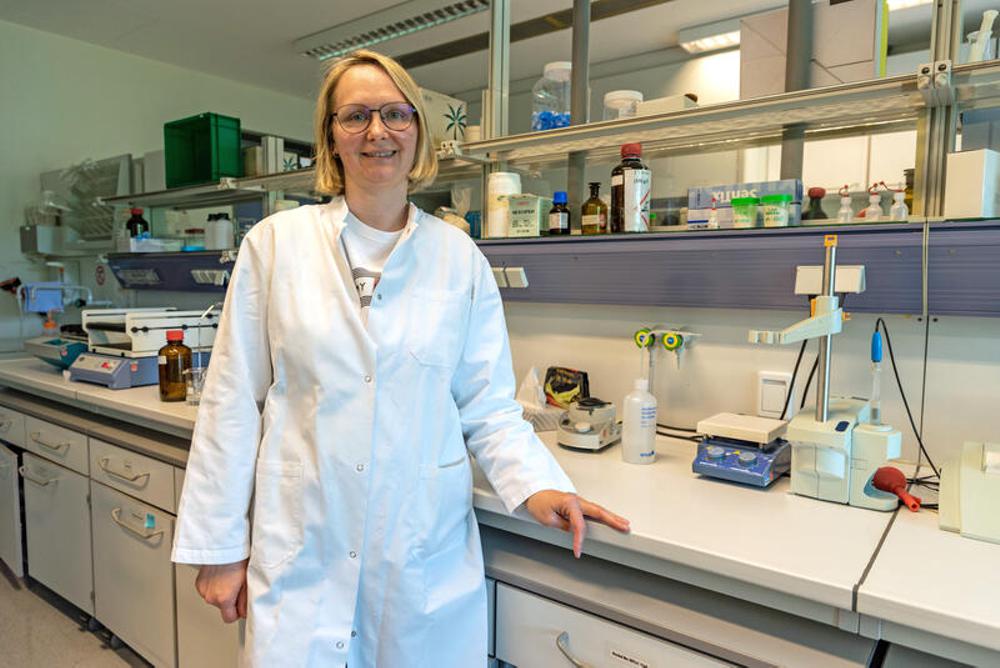
epd-bild/Fabian Steffens
Oldenburg (epd). Tropfen für Tropfen fügt Birte Moorth einer Probe in einem Reagenzglas Aceton hinzu. Langsam hellt sich die trübe Flüssigkeit auf, bis sie völlig klar wird. Nun kann die Chemisch-technische Assistentin den Zuckergehalt der Probe bestimmen. Sie untersucht Speiseeis im Labor des Niedersächsischen Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg oder einfach kurz, Laves. Alles im Dienste von großen und kleinen Leckermäulern. Laut den Statistikern konsumierte jeder Mensch in Deutschland im vergangenen Jahr durchschnittlich 8,1 Liter Speiseeis.
Ob Erdbeere, Vanille, Schokolade oder Gurke-Tonic bis Lakritze-Himbeere. Früher oder später landet jede Eissorte als Probe auf dem Labortisch von Svetlana Hermann. Sie ist Lebensmittelchemikerin beim Laves. Aus rein wissenschaftlichem Interesse probiert sie auch ungewöhnliche Sorten. „Einmal habe ich ein Weißbier-Eis probiert. Das wäre besser im Glas geblieben“, sagt sie und lacht. Besonders exotisch sei wiederum ein Eis aus der Durian-Frucht gewesen. „Die Frucht macht ihrem deutschen Namen alle Ehre: Stinkefrucht. Sie riecht nach faulen Zwiebeln.“ Obwohl die Frucht im asiatischen Raum beliebt sei, hätten die Behörden dort vielerorts den Verzehr in Bussen und Bahnen aus gutem Grund verboten.
Lieblingseis der Deutschen mit vielen Beanstandungen
Hermann prüft die Proben auf die korrekte Kennzeichnung sowie die verwendeten Zuckerarten und Zusatzstoffe. „Entscheidend für die Bezeichnung ist der Milchfettgehalt“, erläutert sie. Milcheis, Sahneeis, Eiscreme oder Fruchteiscreme dürfen nur der Milch entstammendes Fett oder Eiweiß enthalten. Der Zusatz von pflanzlichen Fetten ist nicht zulässig. Milcheis muss mindestens 70 Prozent Milch enthalten, Sahneeis mindestens 18 Prozent Milchfett, Eiscreme mindestens zehn Prozent Milchfett. Die Bezeichnungen Sorbet, Fruchteis oder Wassereis sind nur für Eissorten ohne zugesetztes Fett erlaubt. Während ein Fruchtsorbet zu mindestens einem Viertel aus Früchten bestehen muss, genügt beim Wassereis die Kennzeichnung von Wasser, Zucker sowie die Geschmack gebenden und färbenden Zutaten.
Beanstanden muss Hermann am häufigsten ausgerechnet die Lieblingssorte der Deutschen: das Vanilleeis. „Ob echte Vanille, natürliches Aroma, Extrakt oder ausgekochte Schote verwendet wurde, können wir in hohem Maße prüfen.“ Echte Vanille wird aus den fermentierten Kapseln einer Orchideenart gewonnen und ist eines der teuersten Gewürze überhaupt.„ Ein Kilogramm könne 600 Euro und mehr kosten. “Da ist der sparsame Gebrauch schon verständlich", sagt Hermann. Insbesondere unter den industriellen Eiszubereitungen aus der Tiefkühltruhe sei zwar wenig, aber meist korrekt gekennzeichnetes echtes Vanilleeis zu finden.
„Lebensmittel in Deutschland sind sicher“
Mängel bei der Kennzeichnung gibt es eher bei den losen Proben aus den Eisdielen, führt Hermann aus. „Oft liegt es schlicht an der Unkenntnis in den Eiscafés.“ Laut Gesetz muss bei Speiseeis aus der Eisdiele keine Bezeichnung angegeben werden. In der Praxis stehen oft lediglich die Sorten auf den Schildern in den Auslagen. Aber auch diese Angaben müssen richtig sein und dürfen den Verbraucher nicht in die Irre führen. Hermanns Tipp an die Verbraucher: „Machen Sie sich keine zu großen Gedanken. Genießen Sie das Eis. Lebensmittel in Deutschland sind sicher.“
Was aber die Kundinnen und Kunden beherzigen sollten, ist der kritische Blick über den Eistresen, ergänzt die Sprecherin des Laves, Silke Klotzhuber: „Sieht es dort eher rumpelig aus? Wirkt das Wasser mit dem Eisportionierer so, als stehe es schon den ganzen Tag dort? Ist das Schwammtuch auf dem Tresen sauber?“ Denn nicht nur das Lebensmittel Speiseeis, sondern auch die dazugehörigen Werkzeuge seien anfällig für Keimbildung. Wenn alles sauber sei, „dann steht dem Genuss ohne Reue nichts im Wege“, sagt Klotzhober.
Soziales
Pflegeverband warnt wegen Fachkräftemangels vor massiver Pleitewelle
Schon bald könnten reihenweise Pflegebetriebe vor dem Aus stehen. Laut Pflegeverband drohen nicht ausgelastete Heime auch durch Fachkräftemangel. Patientenschützer warnen unterdessen: Pflegebedürftige können steigende Kosten kaum noch bezahlen.
Berlin (epd). Der Verband der privat betriebenen Pflegeeinrichtungen hat angesichts des akuten Fachkräftemangels vor einer massiven Pleitewelle in der Pflegebranche gewarnt. „Es besteht die große Gefahr eines Flächenbrandes“, sagte der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (BPA), Bernd Meurer, dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (30. Mai). Es mehrten sich die Berichte über Insolvenzen oder Betriebsschließungen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bemängelte unterdessen ein „verkorkstes gesetzliches System“.
Betroffen seien alle Träger, also nicht nur Familienunternehmen, sondern auch größere Betreiber und Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, sagte Meurer. Die Lage sei beängstigend. „Wir müssen davon ausgehen, dass das keine Einzelfälle mehr sind“, betonte der Verbandschef. „Dann bleiben die Pflegebedürftigen und ihre Familien in großer Zahl auf der Strecke.“
Fachkräftemangel drückt Belegungsquote
Meurer sagte, fast 70 Prozent der Mitgliedsunternehmen hätten in einer aktuellen Befragung angegeben, dass sie Sorgen über ihre wirtschaftliche Existenz in naher Zukunft hätten. Andere Studien kämen zu ähnlichen Ergebnissen. Als wesentlichen Grund für die angespannte Lage nannte Meurer den Fachkräftemangel. Dadurch könnten Heimplätze nicht belegt werden. Wenn die Belegung auf 80 Prozent abrutsche, sei ein Heim „kaum noch wirtschaftlich betreibbar“, erläuterte der Chef des Verbandes, der mehr als 13.000 ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen repräsentiert.
Meurer sprach von einem völlig leergefegten Arbeitsmarkt. „Die Pflegeeinrichtungen jagen sich nur noch gegenseitig das Personal ab“, sagte er. Er beklagte weiterhin bestehende hohe bürokratische Hürden bei der Gewinnung von ausländischen Fachkräften. „Je nach Bundesland dauert es weit mehr als ein Jahr, bis eine Fachkraft letztlich anerkannt ist. Und das in einem Mangelberuf“, kritisierte er.
Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, bemängelte die seit Jahren überproportional steigenden Ausgaben für Pflegebedürftige. „Schließlich müssen sie allein die Zeche eines verkorksten gesetzlichen Systems bezahlen. Denn die Betroffenen erhalten nur einen Festbetrag aus der Pflegeversicherung.“ Höhere Löhne, steigende Ausbildungsabgaben und Investitionen gingen allein zu ihren Lasten. „Bis zuletzt daheim leben, ist der einzige Ausweg aus der Misere. Auch das ist ein Grund, warum die Belegungszahlen rückläufig sind.“
Kinderschutzbund: Bei Kindergrundsicherung fehlt politischer Wille
Berlin (epd). Die neue Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, kritisiert mangelnden politischen Willen bei der Umsetzung der geplanten Kindergrundsicherung. „Die Gefahr besteht, dass nicht gezielt denen geholfen wird, die von Armut bedroht sind, sondern dass das Geld wieder breit gestreut wird, also wieder mit der Gießkanne verfahren wird“, sagte Andresen der Mediengruppe Bayern (2. Juni).
„Es fehlt nach wie vor am politischen Willen, ein umfassendes Konzept wie das der Kindergrundsicherung durchzusetzen“, betonte die Präsidentin des Kinderschutzbundes. Es könne auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten nicht im Interesse der Gesellschaft sein, einen so großen Anteil an Kindern und Jugendlichen in Armut aufwachsen zu lassen, sagte Andresen mit Blick auf den Anstieg der Kinderarmut. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen.
Für das altbekannte Vorurteil, dass Eltern das Geld, mit dem die Armut ihrer Kinder bekämpft werden soll, für sich selbst verwenden, gebe es keinerlei Belege. „Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Ich wüsste nicht, warum das nicht auch für arme Eltern gelten sollte“, sagte Andresen.
Paus „optimistisch, dass wir bald soweit sind“
Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hatte erklärt, sie setze auf eine zügige Einigung zur Einführung der Kindergrundsicherung. Sie sei „optimistisch, dass wir bald soweit sind“, sagte sie nach der Frühjahrstagung der Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder in Potsdam. Die Gespräche in der Ampel-Koalition zu Konzept und Finanzierung seien aber noch nicht abgeschlossen. Zentrale Stellschraube sei dabei die Frage, wie das Existenzminimum definiert werden soll.
Nach den Plänen der Koalition soll die Kindergrundsicherung soll ab 2025 ausgezahlt werden und bisherige Familienleistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und Unterstützungen für Bildung und Teilhabe bündeln. Zugleich sollen Zugangshürden für Familien abgebaut werden.
Rund 750 Sportler bei Inklusiven "Bethel athletics"
Bielefeld (epd). Rund 750 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland haben am 3. Juni am inklusiven Turnier „Bethel athletics 2023“ in Bielefeld teilgenommen. Das seien 130 mehr Teilnehmende als im Vorjahr, das noch von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei, sagte ein Bethel-Sprecher dem Evangelischer Pressedienst (epd). Das Treffen habe gezeigt, wie das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen ganz selbstverständlich gelebt werde.
Es sei eine gelungene Veranstaltung mit glücklichen Gewinnern gewesen, sagte Antje Pyl, die Bereichsleiterin des Bewegungs- und Sporttherapeutischen Dienstes Bethel, der das Sportlertreffen ausrichtet. Die Sportarten reichten von Judo über Leichtathletik und Schwimmen bis zum Volks- und Tandemlauf. Menschen mit schweren Behinderungen konnten zudem an zahlreichen wettbewerbsfreien Angeboten teilnehmen, dazu gehörten erstmalig Dartspiele. Das Sportfest wurde bereits zum 26. Mal ausgetragen.
Ausgerichtet werden die „Bethel athletics“ vom Bewegungs- und Sporttherapeutischen Dienst Bethel in Kooperation unter anderem mit dem Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen, dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.
Die ersten „Bethel athletics“ gingen im Jahr 1997 aus der Organisation eines bundesweiten Leichtathletik-Sportfestes der Special Olympics hervor. Zunächst richteten sich die „Bethel athletics“ nur an Menschen mit Behinderungen, inzwischen gibt es inklusive Wettkampfdisziplinen.
Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel mit Hauptsitz in Bielefeld zählen zu den größten diakonischen Werken in Europa. Durch Bethel-Angebote an Standorten in acht Bundesländern werden jährlich rund 230.000 Menschen behandelt, betreut, gefördert, ausgebildet oder beraten.
Medien & Kultur
Neue Sicht auf ukrainische Kunst

epd-bild/Guido Schiefer
Köln (epd). Der russische Angriff auf die Ukraine hat nicht nur die europäische Sicherheitsarchitektur ins Wanken gebracht. Auch vermeintliche Gewissheiten in der Kunst scheinen plötzlich auf tönernen Füßen zu stehen. „Der Begriff 'Russische Avantgarde' ist eine Erfindung des westlichen Kunstmarktes“, erklärt der Kunsthistoriker Konstantin Akinsha, Ko-Kurator der Ausstellung „Ukrainische Moderne 1900-1930 & Daria Koltsova“ am Kölner Museum Ludwig. Viele Jahre lang seien Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine fälschlicherweise in diese Kategorie gepackt worden. Doch die Wahrheit sei sehr viel komplexer.
Das sieht auch das Museum Ludwig so, das über eine umfangreiche Sammlung von Werken der „Russischen Avantgarde“ verfügt. Nun nimmt das Museum eine Neubewertung der Kunst der Moderne aus der Ukraine vor. Zu sehen sind bis zum 24. September rund 90 Gemälde und Arbeiten auf Papier. Darunter sind Bestände aus der Museumssammlung sowie zahlreiche Leihgaben aus dem Nationalen Kunstmuseum der Ukraine und dem Museum für Theater-, Musik- und Filmkunst der Ukraine, die auf diese Weise auch vor russischen Angriffen geschützt werden. Die Ausstellung war zuvor in abgewandelter Form in Madrid zu sehen und wandert anschließend weiter nach Brüssel, Wien und London.
Das Museum Ludwig beschäftigt die Idee einer Ausstellung zur ukrainischen Moderne schon seit mehr als zwei Jahren. Aber erst nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hätten die konkreten Arbeiten an der Schau begonnen, erklärt Museumsdirektor Yilmaz Dziewior. „Und sie entstand unter sehr schwierigen Bedingungen“, ergänzt Akinsha. Russische Angriffe und Stromausfälle etwa hätten die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen aus den ukrainischen Partnermuseen erschwert.
Eigenständigkeit der ukrainischen Kunstszene
Die Ausstellung streicht die Eigenständigkeit der ukrainischen Kunstszene des frühen 20. Jahrhunderts heraus. Zu sehen sind Arbeiten von bekannten Künstlern wie Kasimir Malewitsch oder El Lissitzky, deren Verbindungen zur Ukraine bislang wenig beachtet wurden. Vorgestellt werden aber auch Künstlerinnen und Künstler wie Alexandra Exter, Oleksandr Bohomazow, Wolodymyr Burljuk oder Wasyl Jermilov, die die ukrainische Kultur mitprägten, im Westen allerdings wenig bekannt sind.
Malewitsch etwa ist polnischer Abstammung, wurde aber in Kiew geboren und wuchs in der Ukraine auf. Seine ungegenständlichen Bilder sollen durch die Reduktion auf geometrische Formen der reinen Empfindung Ausdruck verleihen. Lissitzky, der im heutigen Belarus geboren wurde, kam 1918 nach Kiew. Dort beteiligte er sich an Aktionen der Kultur Lige, einer Organisation, die europäische Avantgarde und jüdische Kunsttradition verbinden wollte. Wahrscheinlich schuf Lissitzky hier seine ersten abstrakten Kompositionen. So etwa das in der Ausstellung gezeigte Gemälde, in das er einen Schnipsel aus einer jüdischen Zeitung eingearbeitet hat.
Zu sehen ist auch, wie ukrainische Künstlerinnen und Künstler Strömungen der europäischen Avantgarde aufgreifen und um Elemente ukrainischer Volkstradition erweitern. Inspiriert vom französischen Kubismus und dem italienischen Futurismus entstand die ukrainische Version des Kubo-Futurismus. Dawyd Burljuk etwa, der auch Teil der Münchner Künstlergruppe „Blauer Reiter“ war, verbindet in seinem farbenfrohen Gemälde „Karussell“ (1921) strenge geometrische Formen mit Tierdarstellungen und volkstümlichen Elementen.
Viele Künstler bei stalinistischen „Säuberungen“ ermordet
Die Ausstellung verdeutlicht auch, wie sehr die Kunst mit der wechselvollen Geschichte der Ukraine verknüpft war. Erst nach der Unabhängigkeit des Landes 1917 kann sich mit der Ukrainischen Kunstakademie eine eigene Ausbildungsstätte für die Kunst etablieren. Hier unterrichtet Mychalo Bojtschuk, um den sich eine ganze Schule von Malern bildet. Sie thematisieren das einfache bäuerliche Leben, aber auch Armut.
Die letzte in der Ukraine ausgebildete Künstlergeneration war vor allem von der neuen Sachlichkeit fasziniert. 1932 war jedoch Schluss mit künstlerischen Experimenten. Die Sowjetunion, deren Teil die Ukraine mittlerweile geworden war, verfügte den Sozialistischen Realismus als einzigen offiziellen künstlerischen Stil. Viele ukrainische Künstler, darunter auch Bojtschuk, wurden im Zuge der Stalinistischen „Säuberungen“ ermordet, viele ihrer Werke zerstört.
Einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft der Ukraine wagt das Werk der 1987 geborenen ukrainischen Künstlerin Daria Koltsova, das die Bilder der Moderne ergänzt. Ihre monumentale Glasinstallation beschäftigt sich mit dem kulturellen Erbe der Ukraine und den Möglichkeiten, es vor dem Krieg zu schützen.
Land gibt menschliche Überreste von Maori an Neuseeland zurück
Stuttgart (epd). Mit einer Zeremonie im Linden-Museum Stuttgart hat das Land Baden-Württemberg sterbliche Überreste von Vorfahren der Maori und Moriori an Neuseeland zurückgegeben. Die menschlichen Schädel und ein zeremonielles Essbesteck seien Teil der Sammlungen des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart und des Linden-Museums gewesen, teilte das Wissenschaftsministerium am 30. Mai in Stuttgart mit. Sie wurden an Vertreterinnen und Vertreter der Maori-Gemeinschaft und des „Te Papa Tongarewa“- Nationalmuseums von Neuseeland zurückgegeben.
„Endlich können wir die Überreste unserer Vorfahren dorthin zurückbringen, wo sie hingehören“, sagte Te Herekiekie Herewini vom Nationalmuseum. Trotz der langen Zeit, in der die menschlichen Überreste keine Verbindung zu ihrer Heimat hatten, bleibe deren kulturelle Verbindung „durch den Lauf der Zeit und die Entfernung“ bestehen.
Initiative mehrerer Museen
Mit der Rückgabe komme das Land seiner historischen Verantwortung nach, sagte Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne). Es sei auch ihr persönlich ein großes Anliegen, die „zahlreichen menschlichen Überreste, die ohne Zustimmung der Angehörigen oder gar gewaltsam aus den ehemaligen Kolonialgebieten entwendet wurden“, zurückzugeben.
Für die Direktorin des Linden-Museums Stuttgart, Inés de Castro, ist die Repatriierung nach Neuseeland ein wichtiger Schritt in einem Prozess der Aufarbeitung kolonialen Unrechts.
Die Zeremonie war Teil einer größeren Initiative zur Rückführung von Vorfahren nach Neuseeland aus deutschen Museen. Unter der Leitung von Te Herekiekie Herewini werden menschliche Überreste auch aus den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim, dem Grassi-Museum Leipzig, der Universität Göttingen, dem Römer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim und dem Museum Wiesbaden an Neuseeland übergeben.
Medienforscher kritisiert Präsentationsform der "Tagesschau"
Frankfurt a.M. (epd). Der Medienwissenschaftler Hermann Rotermund kritisiert, dass sich zentrale Präsentationsformen der „Tagesschau“ im Ersten seit den 50er Jahren kaum verändert hätten. Statt Ereignisse zu erklären oder die Berichtsfolge zu moderieren, verläsen die Sprecherinnen und Sprecher Zusammenfassungen der redaktionell ausgewählten Ereignisse, schreibt Rotermund in einem Beitrag für den Fachdienst epd medien. „Der Tonfall ist sanft-autoritär und lässt keinen Zweifel darüber zu, dass es so und nicht anders in der Welt zugeht.“
Diese Form der Nachrichtenaufbereitung habe im internationalen Vergleich fast ein Alleinstellungsmerkmal, schreibt Rotermund. Bei der britischen BBC seien die Präsentatoren zugleich als Journalisten erkennbar und machten Gesprächsangebote, anstatt als „Verkünder unangreifbarer Wahrheiten“ zu fungieren. Die „Tagesschau“-Redaktion lege dagegen offenbar Wert auf die Vermeidung des Dialogs: „Die Sendung vermittelt den Eindruck einer Kurzandacht in der Wohnzimmerkapelle.“
In vielen Filmbeiträgen und Sprechermeldungen der „Tagesschau“ fänden sich „kaum Eigenrecherchen außerhalb von institutionellen Bezügen“, moniert der Medienwissenschaftler. Entsprechend tauche vor allem der Typus des Sprechers oder Akteurs einer Organisation auf. Die Bildspur illustriere die gesprochenen Texte und habe keine eigene informative Funktion.
„Solange diese Rituale funktionieren“
Durch den selbst auferlegten Formatzwang würden letztlich alle Ereignisse nivelliert. „Auch echte Katastrophen können durch die mit Stereotypen gesättigten Aufarbeitungen ihren Schrecken verlieren“, schreibt Rotermund. Die standardisierten Berichte der „Tagesschau“ lieferten insbesondere „die Bestätigung der unermüdlichen Tätigkeit der ins Bild gerückten Akteure“. Sie vermittelten den Eindruck, „dass die Welt nicht völlig in Unordnung sein kann, solange diese Rituale funktionieren“.
Die „Tagesschau“ um 20 Uhr ist die meistgesehene Nachrichtensendung in Deutschland. Im Jahr 2022 schalteten im Schnitt 10,1 Millionen Menschen im Ersten, in den Dritten und weiteren Programmen ein. Zuständig ist die Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell mit Sitz beim NDR in Hamburg.
Rotermund war von 2004 bis 2013 Professor für Medienwissenschaft an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Von 2013 bis 2015 leitete er das Projekt Grundversorgung 2.0 an der Leuphana Universität Lüneburg. Bei der ARD hatte er von 1996 bis 1998 die Projektleitung für „ARD.de“ und verantwortete von 1997 bis 2000 das Projektmanagement des ARD-Onlineauftritts.
Ghanaische Schriftstellerin Ama Ata Aidoo gestorben
Nairobi (epd). Die ghanaische Schriftstellerin und Feministin Ada Ata Aidoo ist tot. Sie starb am 31. Mai nach kurzer Krankheit, wie die Familie mitteilte. Die 81-Jährige war nicht nur eine der bekanntesten afrikanischen Autorinnen, sondern auch Professorin und in den 1980er-Jahren Bildungsministerin ihres westafrikanischen Heimatlandes. Später lebte und arbeitete sie in Simbabwe und den USA.
Aidoo beschäftigte sich in ihren Büchern mit den anhaltenden Auswirkungen des Kolonialismus und den Spannungen zwischen afrikanischen und westlichen Gesellschaften und Traditionen. Sie war dafür bekannt, dass ihre Frauenfiguren selbstbewusst und selbstbestimmt ihr Leben gestalteten. So wie sie selbst. Geboren wurde sie 1942 in der britischen Kolonie Gold Coast. Als sie 1965 im Alter von 23 Jahren ihr Theaterstück „The Dilemma of a Ghost“ schrieb, war sie die erste afrikanische Frau, deren Theaterstück verlegt wurde.
„Du hast uns immer aufgerüttelt“
Ihr Roman „Changes“ wurde auch ins Deutsche übersetzt und erschien unter dem Titel „Die Zweitfrau“. Darin erzählt Aidoo die Geschichte einer gebildeten Frau in der ghanaischen Hauptstadt Accra, die sich von ihrem Ehemann trennt, und sich in einen Mann verliebt, der schon verheiratet ist. Immer wieder hinterfragte sie gesellschaftliche Rollen und einfache, stereotype Zuschreibungen. 1992 wurde sie dafür mit dem Commonwealth Writer‘s Prize ausgezeichnet.
Aidoo hat Menschen über Grenzen und Generationen hinweg inspiriert. Die ugandische Feministin Rosebell Kagumire schrieb auf Twitter in Erinnerung an Ata Ama Aidoo: „Du hast uns immer wieder aufgerüttelt, um uns daran zu erinnern, was der Kolonialismus uns angetan hat und was er heute noch schwarzen Menschen hinterlässt. Du hast geschrieben, du hast gesprochen, du hast gekämpft. Mögen deine Lektionen für uns nie verloren gehen.“
In den letzten Jahren ihres Schaffens schrieb Ama Ata Aidoo vor allem Gedichte und Kinderbücher. Heute sind ihre Bücher in vielen westafrikanischen Ländern Schullektüre.
Deutsch-Französischer Medienpreis für Slimani und Goldschmidt
Saarbrücken (epd). Die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani und der deutsch-französische Autor Georges-Arthur Goldschmidt erhalten in diesem Jahr den Großen Deutsch-Französischen Medienpreis. Beide stünden kompromisslos für Toleranz und kulturelle Vielfalt, sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutsch-Französischen Journalistenpreises und Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, am 1. Juni in Saarbrücken. Der Medienpreis wird zusammen mit dem Deutsch-Französischen Journalistenpreis am 14. September in Berlin vergeben.
„In Zeiten von Hass, Intoleranz, Fake News und der dadurch abnehmenden Bereitschaft zum offenen Diskurs sind es vor allem Kunst und Kultur, die uns einen Spiegel vorhalten und so die Chance eröffnen können, das Trennende zu überwinden und wieder aufeinander zuzugehen“, sagte Grasmück. Slimani verdeutliche in ihren Werken, wie die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts das Privatleben und bis heute die Identität vieler Menschen präge und nach wie vor die Ursache von Konflikten sei. In ihrer aktuellen Trilogie erzähle sie mit großer Einfühlsamkeit ihre eigene Familiengeschichte, die ihren Ursprung im Elsass während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg hat.
Veränderung von Gesellschaften unter dem Druck des Autoritären
Georges-Arthur Goldschmidt hat den Preisstiftern zufolge trotz Flucht und Vertreibung zeitlebens seinen Optimismus nicht verloren. Der 95-Jährige bleibe daher als Überlebender und Zeitzeuge des Nationalsozialismus auch für künftige Generationen eine wichtige Stimme und Informationsquelle. Grasmück sagte, dass Goldschmidts Bücher über seine ursprünglich jüdische Familie sowie über seinen eigenen Lebensweg „eine eindrucksvolle Schilderung“ seien, wie Gesellschaften sich unter dem Druck des Autoritären verändern und das Böse die Oberhand gewinne. Der Autor sei auch als Literaturkritiker und Übersetzer tätig, hieß es. Ein Austauschprogramm zur Förderung junger Übersetzerinnen und Übersetzer trage seit zwei Jahrzehnten seinen Namen.
Der undotierte Große Deutsch-Französische Medienpreis wird alljährlich an Persönlichkeiten und Organisationen vergeben, die sich in besonderer Weise um die europäische Verständigung verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Simone Veil, Alfred Grosser, Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, die Hilfsorganisation SOS Méditerranée, Jürgen Habermas und das Ehepaar Beate und Serge Klarsfeld. Im vergangenen Jahr wurden die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Künstler Anselm Kiefer ausgezeichnet.
Der Deutsch-Französische Journalistenpreis (DFJP) wurde 1983 gestartet. Mitglieder sind unter anderem das ZDF, France Télévisions, Arte, Radio France, die „Saarbrücker Zeitung“ und das Deutsch-Französische Jugendwerk. Der SR ist Federführer.
Walter-Lübcke-Preis für Katrin Eigendorf und Wolfhager Schule
Wolfhagen (epd). Die ZDF-Journalistin Katrin Eigendorf und die Walter-Lübcke-Schule im nordhessischen Wolfhagen sind am 1. Juni mit dem Walter-Lübcke-Demokratie-Preis 2022 ausgezeichnet worden. Sie lebten und verkörperten in beeindruckender Weise die Werte, die Walter Lübcke vertreten und vorgelebt habe, sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bei der Preisverleihung. Er sei ein aufrechter und mutiger Demokrat gewesen, der sich unermüdlich für Freiheit, Toleranz und Respekt eingesetzt habe. Die hessische Landesregierung verleiht den undotierten Preis im Gedenken an den 2019 von einem Rechtsextremisten ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten.
Der Ministerpräsident würdigte Eigendorf für ihren „fortwährenden journalistischen Einsatz im Namen der Demokratie“. Als Reporterin berichte sie oft unter Einsatz ihres Lebens über das Grauen des Krieges. Glaubwürdig schaffe sie ein unmittelbares Bewusstsein für dessen Auswirkungen. Dabei schaffe sie es, den Opfern von Krieg, Vertreibung und Unterdrückung Gehör zu verschaffen und eine Stimme zu geben. „Sie ist ein Sprachrohr für die Menschen. Als mutige Journalistin verdient sie unser aller Respekt“, betonte Rhein.
Die 1962 im nordrhein-westfälischen Tönisvorst geborene Eigendorf war nach dem Volontariat beim WDR in den vergangenen drei Jahrzehnten als Auslandskorrespondentin für ARD, ZDF und RTL im Einsatz und berichtete unter anderem über den Krieg in der Ukraine. Für ihre Reportagen wurde sie mehrfach ausgezeichnet.
„Zeichen gegen menschenfeindliche Ideologie“
Große Anerkennung zollte Ministerpräsident Rhein auch der Walter-Lübcke-Schule: Mit ihrer Umbenennung habe die ehemalige Wilhelm-Filchner-Schule „ein starkes Zeichen für die Demokratie und gegen menschenfeindliche Ideologie gesetzt“. Die Schule in der Heimat des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten bekenne sich mit der Wahl ihres Namens zu Toleranz und Weltoffenheit, positioniere sich gegen die Ausgrenzung von Menschen und trage Lübckes Vermächtnis weiter.
Der Walter-Lübcke-Demokratie-Preis wird seit 2020 alle zwei Jahre an Persönlichkeiten und Institutionen, die sich besonders für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie engagieren. Erste Preisträger waren 2020 Robert Erkan, der sich um die Betreuung der Hinterbliebenen der Opfer des Hanauer Anschlags verdient gemacht hatte, die Journalistin Dunja Hayali und das „Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus - für demokratische Kultur in Hessen“.
Walter Lübcke war in der Nacht auf den 2. Juni 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha im Landkreis Kassel erschossen worden, nachdem er sich engagiert für die Aufnahme von Flüchtlingen eingesetzt hatte.
Ewald Frie gewinnt Deutschen Sachbuchpreis 2023
Frankfurt a.M., Hamburg (epd). Der Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises 2023 heißt Ewald Frie. Der 60-jährige Historiker werde für sein Werk „Ein Hof und elf Geschwister. Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland“ ausgezeichnet, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, am 1. Juni bei der Preisverleihung in der Hamburger Elbphilharmonie. Frie erhielt 25.000 Euro, die sieben anderen Nominierten jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr wurde das Werk von Stephan Malinowski „Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration“ ausgezeichnet.
Frie habe in seinem Buch eine „persönliche und überraschende Perspektive“ auf den Abschied vom bäuerlichen Leben eingenommen, würdigte die Jury. Am Beispiel seiner Familie aus dem Münsterland habe er ein tiefes und gleichzeitig zugängliches und unterhaltsames historisches Sachbuch verfasst. Diese Alltagsgeschichte gehe von leicht zu übersehenden Details aus und entwickele große Gedanken. Sie sei ein „inspirierendes Beispiel für innovative Geschichtsschreibung“.
Auswahl aus 231 Titeln
Die sieben Jurymitglieder hatten insgesamt 231 Titel aus 128 Verlagen gesichtet, die seit Mai 2022 erschienen sind. In die Endauswahl der preiswürdigen Bücher kamen außer dem Gewinner: Omri Boehm, Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität, Teresa Bücker, Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit, Judith Kohlenberger, Das Fluchtparadox. Über unseren widersprüchlichen Umgang mit Vertreibung und Vertriebenen.
Ebenfalls in der Auswahl kamen Meron Mendel, Über Israel reden. Eine deutsche Debatte, Hanno Sauer, Moral. Die Erfindung von Gut und Böse, Martin Schulze Wessel, Der Fluch des Imperiums. Die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte, Elisabeth Wellershaus, Wo die Fremde beginnt. Über Identität in der fragilen Gegenwart.
Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels verleiht den Preis für ein „herausragendes, in deutscher Sprache verfasstes Sachbuch, das Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt“ seit 2021. Schirmfrau der Auszeichnung ist Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne), Hauptförderin die Deutsche Bank Stiftung.
Filme der Woche
How to Blow Up a Pipeline
Basierend auf dem kontrovers diskutierten, gleichnamigen Sachbuch erzählt Daniel Goldhaber von einer fiktiven Aktivisten-Gruppe, die sich zusammentun, um eine Ölpipeline in die Luft zu jagen. Der Film folgt ihren akribischen Vorbereitungen und der nervenaufreibenden Durchführung der Aktion. In Rückblenden werden die Motivationen der Teilnehmer aufgefächert. Alle sind in irgendeiner Form persönlich von den Folgen des Klimawandels betroffen und haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie weit Aktivismus gehen darf. So entsteht ein packender Thriller und gleichzeitig eine kluge Auseinandersetzung mit aktuellem Umweltaktivismus.
How to Blow Up a Pipeline (USA 2022). R.: Daniel Goldhaber. B.: Ariela Barer, Jordan Sjol, Daniel Goldhaber (nach einer Vorlage von Andreas Malm). Mit: Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage, Forrest Goodluck, Sasha Lane, Jayme Lawson, Marcus Scribner, Jake Weary, Irene Bedard, Olive Jane Lorraine. Länge: 106 Minuten. FSK: ab 16, ff. FBW: keine Angabe.
The Adults
Drei entfremdete Geschwister stehen im Mittelpunkt der Tragikomödie vom in Deutschland bislang noch wenig bekannten Independent-Regisseur Dustin Guy Defa. Eric (Michael Cera) kommt nach mehreren Jahren Abwesenheit erstmals in die heimische Kleinstadt zurück, in der seine beiden Schwestern Rachel (Hannah Gross) und Maggie (Sophia Lillis) nach wie vor leben. Obwohl Eric sich nicht für seine Schwestern zu interessieren scheint, verschiebt er immer wieder seine Abreise. Während die im Haus der verstorbenen Eltern lebende Rachel allem mit Sarkasmus und Bitterkeit begegnet, versucht Maggie die verlorene Nähe der Geschwister wiederzubeleben. Fast unscheinbar wirkendes, aber gerade deswegen authentisch berührendes Familiendrama mit verspieltem Witz.
The Adults (USA 2023). R. u. B.: Dustin Guy Defa. Mit: Michael Cera, Hannah Gross, Sophia Lillis, Wavyy Jonez, Anoop Desai. Länge: 91 Minuten. FSK: ab 12, ff. FBW: keine Angabe.
Medusa Deluxe
Bei einem Friseurwettbewerb wird einer der Beteiligten tot und skalpiert aufgefunden. Niemand darf nun das Gelände verlassen und die Verbliebenen rätseln, wer der Mörder war. Und da die Polizei auf sich warten lässt, nehmen einige die Suche schließlich selbst in die Hand. Eine klassische Krimi-Konstellation, die allerdings gänzlich ungewohnt inszeniert wird. Schrille Figuren, skurrile Szenen und extravagante Outfits. So steht bei der rasanten Komödie letztlich auch weniger der Kriminalfall im Vordergrund, sondern das Feiern einer Subkultur und ihrer spektakulären Styles.
Medusa Deluxe (Großbritannien 2022). R. u. B.: Thomas Hardiman. Mit: Clare Perkins, Anita-Joy Uwajeh, Kae Alexander, Harriet Webb, Darreel D'Silva. Länge: 101 Minuten. FSK: ab 12, ff. FBW: keine Angabe.
Nostalgia
Nach über 40 Jahren kehrt Felice (Pierfrancesco Favino) in seine Heimatstadt Neapel zurück, um seine Mutter ein vielleicht letztes Mal zu sehen. Einst musste er als jugendlicher Ganove fliehen, mittlerweile ist er erfolgreicher Bauunternehmer in Kairo. Die Rückkehr lässt ihn in nostalgischen Erinnerungen schwelgen, rührend kümmert er sich um seine kranke Mutter und sie holen versäumte Zeit nach. Doch auch seine dunkle Vergangenheit holt ihn irgendwann ein. Spannungsvoll erzählt der Film von einer späten Rückkehr und lässt dabei die Atmosphäre Neapels zu einer weiteren Hauptrolle des Films werden.
Nostalgia (Italien/Frankreich 2022). R.: Mario Martone. B.: Mario Martone, Ippolita Di Majo (nach einer Vorlage von Ermanno Rea). Mit: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi. Länge: 117 Minuten. FSK: ab 12, ff. FBW: keine Angabe.
Entwicklung
Hoffen auf Mosambiks erste Fahrradstraße

epd-bild/Stefan Ehlert
Maputo/Quelimane (epd). In dieser Stadt dominiert bereits heute das Fahrrad das Straßenbild: Vor einer roten Ampel drängt sich ein Pulk von Radfahrern vor wenigen Autos. Die meisten Räder haben einen Fahrgast auf dem gepolsterten Gepäckträger. Auch im Hafen von Quelimane im Osten Mosambiks warten Fahrradtaxis auf die Passagiere der Fähre.
Quelimane mit seinen 400.000 Einwohnerinnen und Einwohner ist die Hauptstadt der Provinz Zambezia. Nur hier, 1.500 Kilometer nördlich der Hauptstadt Maputo, gibt es einen Radweg, den einzigen in ganz Mosambik.
Vor 15 Jahren habe der Fahrrad-Boom eingesetzt, berichtet der Chef der örtlichen Zentralbibliothek, Janota José Manuel. Heute diene das Rad vor allem dem Transport von Personen von einem Ort zum anderen, sagt er. Davon könnten die Fahrer der Radtaxis leben. „Es kostet nicht viel, und am Ende profitieren wir alle davon, weil es unsere Umwelt schützt.“
Keine Gangschaltung, keine Federung, kein Licht
Für umgerechnet 20 Cent nutzt Manuel täglich ein Fahrradtaxi, von denen es nach Behördenangaben in Quelimane mehr als 5.000 gibt. Bei Temperaturen von über 30 Grad Celsius ist der Job hart, zumal die reparaturanfälligen Importräder weder über eine Gangschaltung, noch eine Federung verfügen. Auch die Beleuchtung fehlt, obwohl viele „Taxistas“ auch nachts unterwegs sind.
Quelimanes Bürgermeister Manuel de Araújo möchte sie deshalb mit Warnwesten ausgestattet sehen, am besten auch mit Helmen. Das Vorstandsmitglied der oppositionellen Partei Renamo sieht das Fahrrad als entscheidendes Element einer gerechteren Stadtentwicklung. Zum Interview erscheint er an Krücken - Folge eines Fahrradunfalls, als er mit dem US-Botschafter durch seine Stadt geradelt war.
Nach seinem Amtsantritt vor zwölf Jahren kam Araújo zu dem Schluss, dass in seiner Stadt Fußgänger und Radfahrer deutlich zu kurz kamen gegenüber motorisierten Fahrzeugen. „Die Autofahrer sind von der fixen Idee besessen, dass die Straße für sie reserviert sei“, sagt er. „Aber die Mehrheit sind Fußgänger, dann kommen die Radfahrer und dann erst die Autos.“
In Maputo hingegen beherrschen nach wie vor die privaten Pkw den Verkehr. Aus Sicht des Ethnologen Joaquín Romero de Tejada, der für die staatliche Agentur „Agência Métropolitana“ die Verkehrsströme in der Hauptstadt analysiert, liegt das daran, dass viele Menschen sich ein Haus oder eine Hütte im Umland bauten, ohne daran zu denken, wie sie zur Arbeit in die Stadt kommen. Zugleich sei die Gesellschaft sehr hierarchisch. „Wenn ich ein Auto besitze, bin ich im öffentlichen Raum privilegiert und fühle mich gegenüber allen anderen Transportmitteln überlegen“, sagt er.
Autos haben weiter Vorfahrt
Im Ballungsraum Maputo müssen sich der „Agência Métropolitana“ zufolge täglich Hunderttausende Menschen mit Bussen und Minibussen aus dem Umland in die Stadt bewegen, ohne dass es eine einzige dafür reservierte Busspur gäbe. Ein erster Versuch, eine solche auf den breiten Alleen in Maputo zu markieren, scheiterte vor ein paar Jahren, angeblich am fehlenden Geld. Auch bei der nagelneuen vierspurigen Umgehungsstraße unterblieb jeder Versuch, dem Autoverkehr Platz für Busse oder Fahrräder wegzunehmen.
Maputo sei von Verhältnissen wie in Quelimane sehr weit entfernt, bemängelt etwa die Lehrerin Mariig Hamon. Die Franco-Kanadierin reiste über Weihnachten mit dem Tourenrad durch das bergige, zentralafrikanische Ruanda. Dort würden Radfahrer und -fahrerinnen respektiert. In Maputo dagegen bange sie auf dem Rad um ihr Leben. „Ich schreie die Autofahrer oft an, weil sie mich nicht wahrnehmen“, sagt Hamon. „Sie denken, nur sie selbst seien der Verkehr und ein Rad habe auf der Straße nichts verloren.“
Verkehrsminister Mateus Magala hat angekündigt, bis 2026 im Raum Maputo erste Busspuren und Radwege zu bauen. Rund 250 Millionen US-Dollar der Weltbank sollen dafür eingesetzt werden. Manuel de Araújo drückt bei der Umgestaltung seiner Stadt stärker aufs Tempo. Noch in diesem Jahr werde er in Quelimane die erste Straße für den motorisierten Verkehr dauerhaft sperren lassen. Es wäre Mosambiks erste Fahrradstraße.
"Ich bekomme jeden Tag Todesdrohungen"
In Uganda gilt nun eines der schärfsten Anti-Homosexuellen-Gesetze weltweit. In bestimmten Fällen sieht es sogar die Todesstrafe vor. Der Verabschiedung ging eine Hasskampagne gegen sexuelle Minderheiten voraus.
Kampala (epd). Steven Kabuye hat Angst um sein Leben. „Ich bekomme jeden Tag Todesdrohungen“, sagt der LGBT-Aktivist aus Uganda am Telefon. Ein persönliches Treffen ist nicht möglich. Seit Anfang des Jahres, als der Hass gegen queere und homosexuelle Menschen in dem ostafrikanischen Land stärker wurde, versteckt er sich. Das Risiko seinen Aufenthaltsort preiszugeben, will er nicht eingehen.
Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Hetze am 29. Mai, als Ugandas Präsident Yoweri Museveni seine Unterschrift unter das neue Anti-LGBT-Gesetz setzte. Das Regelwerk gilt als eines der schärfsten weltweit. Bei bestimmte Fällen, etwa bei gleichgeschlechtlichen Handlungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen, ist die Todesstrafe möglich.
Die ugandische Menschenrechtsanwältin Justine Balya berichtet, dass seit Monaten gezielt Stimmung gegen sexuelle Minderheiten gemacht worden sei. Religiöse und kulturelle Oberhäupter hätten „sehr viel Energie investiert, um ein bestimmtes Narrativ aufzubauen, das die Menschen aufgewühlt hat“, sagt die Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation HRAPF.
Kritik an christlichen Fundamentalisten
„Es ist den Menschen wieder und wieder erzählt worden, dass Homosexuelle nicht nur unmoralisch, sondern auch Vergewaltiger sind“, sagt Balya. „Die Menschen haben Angst um ihre Kinder, um sich selbst, sie sind besorgt und wütend.“ Ein Narrativ, das Hass geschürt hat: Seit der Verabschiedung des ersten Gesetzesentwurfs durch das Parlament im März haben gewaltsame Übergriffe und Verhaftungen Aktivisten und Menschenrechtlern zufolge stark zugenommen.
Wo genau die Ursprünge dieser Hetze liegen, ist Balya zufolge schwer zu sagen. Sie ist jedoch überzeugt, dass christliche Fundamentalisten aus den USA wie die Organisation „Family Watch International“ dazu beigetragen haben. Die Organisation steht für Homophobie und setzt sich für den „Schutz und die Förderung“ der „gottgegebenen natürlichen Familie“ ein und organisiert auch Konferenzen in afrikanischen Ländern. Balya spricht von einem „gut organisierten Netzwerk“, das nicht nur in Uganda, sondern in ganz Afrika versuche, Homophobie zu verbreiten.
Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern wurden auch in Uganda Schwule, Lesben, bisexuelle und transidente Menschen bereits vor der Verabschiedung des neuen Gesetzes staatlich verfolgt. So sah die noch aus der britischen Kolonialzeit stammende Gesetzgebung lange Haftstrafen für gleichgeschlechtliche Handlungen vor.
Mit der Unterzeichnung des neuen Gesetzes ließ sich Museveni zunächst Zeit. Nachdem im März das Parlament das Anti-Homosexualitätsgesetz hatte, machte der Staatschef zunächst einige Änderungsvorschläge. Zuletzt sei die Unterschrift für ihn jedoch alternativlos gewesen, sagt Balya. Sie glaubt, dass die Bevölkerung eine Ablehnung des Gesetzes nicht verstanden hätte. Dafür sei die Hetze der vergangenen Monate zu wirksam gewesen.
Hoffnung auf die Justiz
Zudem habe es sich bei dem Gesetzesentwurf um einen Vorschlag aus dem Parlament gehandelt. Treffe der Präsident keine Entscheidung, könne gemäß der ugandischen Verfassung das Parlament das Gesetz mit einem Votum von zwei Dritteln der Abgeordneten in Kraft setzen. Eine Verabschiedung ohne Musevenis Zustimmung hätte kein gutes Bild abgegeben, sagt Balya. Hinzu kommt: Der seit 37 Jahren regierende Präsident nutzte in den vergangenen Wochen jede Gelegenheit, um selbst gegen sexuelle Minderheiten zu hetzen.
Selbst die drohenden Sanktionen der internationalen Gemeinschaft haben Museveni nicht von der Unterzeichnung abhalten. US-Außenminister Antony Blinken kündigte an, Visabeschränkungen unter anderem für ugandische Beamte zu prüfen. Auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) erklärte, das Gesetze habe Auswirkungen auf die Arbeit internationaler Partner vor Ort, „die wir nun gemeinsam prüfen müssen“.
In Uganda hofft Steven Kabuye derweil darauf, dass das Gesetz doch noch von einem Gericht gekippt wird. „Der einzige Weg, der uns jetzt noch bleibt, ist vor Gericht zu gehen“, sagt der LGBT-Aktivist. Die Anwältin Balya ist überzeugt, dass das Regelwerk einer juristischen Prüfung nicht standhalten wird. „Die Frage ist, wie wir bis dahin sicherstellen können, dass die Menschen am Leben bleiben“, sagt sie.
Verhandlungen für Waffenstillstand im Sudan vorerst gescheitert
Seit eineinhalb Monaten bekämpfen sich im Sudan die Befehlshaber der Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz. Nun sind die jüngsten Bemühungen für einen Waffenstillstand vorerst gescheitert.
Nairobi/Khartum (epd). Die Gespräche für einen Waffenstillstand im Sudan sind gescheitert. Die Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien seien vorerst ausgesetzt, erklärte die US-Regierung, die gemeinsam mit Saudi-Arabien vermittelt, am 2. Juni. Derweil warnte das Rote Kreuz vor einem Anstieg der Fluchtbewegung aus dem afrikanischen Land. Hunderttausende Sudanesinnen und Sudanesen sind demnach seit Beginn der Kämpfe ins Ausland geflohen.
Gemeinsam mit Saudi-Arabien hatten die USA seit Anfang Mai in der saudi-arabischen Stadt Dschidda versucht, einen anhaltenden Frieden zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen „Rapid Support Forces“ (RSF) zu vermitteln. Getroffene Vereinbarungen über Waffenruhen wurden von beiden Seiten jedoch immer wieder gebrochen.
Auf Twitter erklärte die US-Botschaft im Sudan, die Armee und die RSF seien weiterhin verpflichtet, sich an die Vereinbarung zur Ermöglichung humanitärer Hilfe sowie an die bis Samstag geltende Waffenruhe zu halten. Die Verhandlungen aber würden erst wieder aufgenommen, wenn beide Seiten zu Gesprächen ernsthaft bereit seien.
330.000 Menschen vor der Gewalt geflohen
US-Außenminister Antony Blinken kündigte außerdem Sanktionen für Verantwortliche des Konfliktes an. Vorgesehen sind demnach Visa-Beschränkungen und wirtschaftliche Sanktionen für Unternehmen, deren Gewinne in die Finanzierung von Militär und RSF fließen.
Nach Angaben des Roten Kreuzes sind bisher mehr als 330.000 Menschen vor der Gewalt geflohen. Die Mehrheit der Geflüchteten seien Kinder und Frauen, sagte der Afrika-Regionaldirektor der Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC), Mohammed Mukhier. Im Sudan herrsche ein Mangel an Nahrungsmitteln, Wasser, Medizin und anderen Gütern. Die IFRC brauche insgesamt 100 Millionen Schweizer Franken (102 Millionen Euro), um die humanitäre Hilfe für die Menschen im Sudan und für die Flüchtlinge zu finanzieren.
Hintergrund der Gewalt im Sudan ist ein Streit um die Macht zwischen dem Armeeführer Abdel Fattah al-Burhan und dem Befehlshaber der Miliz „Rapid Support Forces“ (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, genannt „Hemeti“. Hunderte Menschen sind nach UN-Angaben seit Beginn der Kämpfe ums Leben gekommen.
Burkina Faso laut Hilfsorganisation am meisten vernachlässigte Krise
Frankfurt a.M./Oslo (epd). Erstmals führt der Sahel-Staat Burkina Faso die Liste der vernachlässigten Krisen des Norwegischen Flüchtlingsrates an. Mehr als zwei Millionen Menschen hätten dort in den vergangenen fünf Jahren ihre Heimat verlassen müssen, erklärte die Hilfsorganisation am 1. Juni in Oslo. Dabei werde über die Krise in dem von Konflikten geprägten afrikanischen Land in Medien kaum berichtet.
Die internationale Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Oslo veröffentlicht die Liste der vergessenen Krisen seit sieben Jahren. Dabei werden humanitäre Krisen und Vertreibung anhand von drei Kriterien untersucht: der Finanzierung der humanitären Hilfe, der Medienberichterstattung sowie politischen und diplomatischen Initiativen zur Lösung der Krise.
Sieben von zehn Ländern in Afrika
Wie auch im vergangenen Jahr liegen sieben der zehn am meisten vernachlässigten Krisenländer in Afrika. In der Demokratischen Republik Kongo (Platz zwei) führen die Fachleute unter anderem den andauernden Konflikt im Osten des Landes auf. Auch im Sudan, Mali, Burundi, Kamerun und Äthiopien leiden der Analyse zufolge viele Menschen unter Gewalt und einer starken Unterfinanzierung humanitärer Hilfsprogramme.
Ebenfalls auf der Rangliste vertreten sind die lateinamerikanischen Länder Kolumbien (Platz drei), Venezuela (Platz fünf) und El Salvador (Platz neun). Insgesamt hat die Hilfsorganisation nach eigenen Angaben 39 Krisen analysiert.
Die Hilfsorganisation kritisierte, dass durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ohnehin vernachlässigte Krisen noch weiter in Vergessenheit geraten seien. So litten Hilfsprogramme etwa unter fehlenden Finanzmitteln, weil Hilfsgelder für die Ukraine umgewidmet worden seien und für andere Katastrophen fehlten.
Brasilianisches Parlament stimmt für Gesetz gegen Indigenen-Rechte
Berlin, São Paulo (epd). Mit der Billigung eines Gesetzes zur Einschränkung von Indigenen-Rechten hat das brasilianische Abgeordnetenhaus Präsident Luiz Inácio Lula da Silva eine schwere Niederlage beschert. 283 Parlamentarier stimmten am 30. Mai für die Initiative, 155 dagegen, wie das Nachrichtenportal „G1“ berichtete. Das Gesetz kann vorerst nicht in Kraft treten, da die Grundlage dafür noch vor dem Obersten Gericht geprüft wird. Doch die Abstimmung gilt als Schwächung für Lula, der sich im Wahlkampf für eine Stärkung der Rechte der Urvölker eingesetzt hatte.
Das umstrittene Vorhaben stammt noch aus der Zeit des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, der die wirtschaftliche Ausbeutung im Amazonas-Regenwald vorantreiben wollte. Das Projekt „Marco temporal“ basiert auf einer umstrittenen juristischen Stichtagsregelung, die etwa Großgrundbesitzer so auslegen, dass indigene Völker nur dort Land beanspruchen können, wo sie bereits vor der Verfassung von 1988 lebten. Allerdings wurden viele Urvölker von ihrem ursprünglichen Land vertrieben und hätten so nie eine Chance auf Rückkehr. Außerdem könnten Eindringlinge, die indigene Gebiete zurückgeben mussten, Anspruch auf Entschädigung verlangen.
Ministerin ruft zu Protest auf
Die Regelung würde mehr Rechtssicherheit für Landbesitzer schaffen und Bauern vor Enteignung schützen, argumentieren dagegen Befürworter, darunter vor allem die mächtige Agrarlobby in Brasilien. Das Oberste Gericht analysiert seit Jahren, ob diese Gesetzesauslegung verfassungsgemäß ist. Der jetzt vom Parlament verabschiedete Gesetzentwurf wird nun zunächst dem Senat zur Bestätigung weitergeleitet. Danach könnte auch Lula noch sein Veto einlegen.
Indigenen-Ministerin Sônia Guajajara sprach auf Twitter von einem schweren Angriff auf die Rechte der Indigenen. Sie rief die indigenen Völker zu Protesten gegen das Gesetz auf.
Präsident Lula hatte bei Amtsantritt im Januar eine Abkehr dieser Politik versprochen. Im April unterzeichnete er Dekrete, die erstmals seit 2018 wieder Indigenen-Schutzgebiete auswiesen. Das Dekret garantiert den Ureinwohnern die ausschließliche Nutzung der natürlichen Ressourcen auf diesen Gebieten. Das Land darf nicht verkauft werden, auch Bergbau ist untersagt. Insgesamt verfügt Brasilien über 732 Indigenen-Gebiete, die rund 14 Prozent des Staatsterritoriums ausmachen.
Termine
14.6. Evangelische Akademie Baden
Online Unsupervised Thinking / Unüberwachtes Denken Künstliche Intelligenz und ihre Folgen - Ansatzpunkte für eine transformative Gestaltung am Beispiel des „Reallabors Robotische KI“.
7.-9.7. Evangelische Akademie Tutzing
Politisches Christentum und christliche Politik. Motive - Herausforderungen - Grenzen. An wen richtet sich das politische Engagement des Protestantismus? Die gesellschaftliche Öffentlichkeit, die politischen Entscheidungsinstanzen, das kirchliche Publikum? In welchen historischen, ökumenischen, interreligiösen sowie internationalen Kontexten steht es? In wessen Namen spricht, wer im Namen des Christentums seine Stimme erhebt? Sind die politischen Positionierungen der evangelischen Kirche prognostizierbar geworden? Ist das eine Stärke oder eine Schwäche?
17.-18.7. Evangelische Akademie Bad Boll
Familienfreundlicher Strafvollzug Ist ein Elternteil in Haft, dann ist das für die ganze Familie, insbesondere für die Kinder, eine enorme Belastung. Aber Kinder und Angehörige von Inhaftierten haben auch in diesem Fall ihre Bedürfnisse und ihre Rechte! Lassen diese sich in unserem Strafvollzug einlösen? Wie lassen sich auch während einer Haftzeit familiäre Bindungen aufrechterhalten? Wie könnte ein „familienfreundlicher Strafvollzug“ aussehen?

