 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2023 - 21.04.2023
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2023 - 21.04.2023
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2023 - 21.04.2023
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2023 - 21.04.2023

seit 40 Jahren gibt es das Kirchenasyl in Deutschland. Dieser zeitlich befristete Schutz in einer rechtlichen Grauzone wird noch immer gebraucht, um drohende Abschiebungen zu verhindern. So auch im Fall der libanesischen Familie Khaskiyeh in Grünstadt an der Weinstraße. Sie ist nach dem beendeten Kirchenasyl jetzt im Asylverfahren und hofft auf Anerkennung: „Wir fühlen uns hier in Sicherheit und leben in Frieden“, sagt Ilham Khaskiyeh, „wir können nicht zurückgehen.“
Das Problem ist bereits akut, doch die Lage wird sich laut Experten noch verschärfen: Schon heute lebt nur ein Teil der deutschen Senioren in altersgerechten und auch bezahlbaren Wohnungen. Und mit dem Älterwerden der Baby-Boomer wird der Kampf um Wohnraum weiter zunehmen, wie aus einer Studie des Pestel-Instituts hervorgeht. Doch der Bau neuer Wohnungen kommt nicht voran.
Die Diakonie blickt aus Anlass ihres 175-jährigen Bestehens mit einer Fachtagung auf ihre Geschichte zurück. Die zeigt Licht und Schatten, wie der Historiker Hans-Walter Schmuhl als einer der Referenten im Interview mit epd sozial sagt. Zwar seien die Missstände der NS-Zeit weitgehend aufgearbeitet, doch auch heute drohten in der diakonischen Arbeit Gefahren. Etwa in der Pflege. Wenn die personellen Ressourcen zu knapp seien, „dann besteht immer ein großes Risiko für Zwang und Gewalt“.
Die Caritas in Frankfurt am Main animiert obdachlose Menschen gezielt zu Sport und Bewegung. Im Projekt „Mach mit!“ geht es um Erfolgserlebnisse. „Und darum, dass man etwas schaffen kann, wenn man sich dafür anstrengt“, erzählt Projektleiter Peter Schmitt. epd sozial hat die Gruppe bei einer Tour im Naturpark Spessart begleitet.
Wer als Arbeitnehmer über Jahre hinweg freiwillige Zahlungen von Urlaubs- und Weihnachtsgeld bekommt, hält das schnell für selbstverständlich. Das muss nicht so sein. Aber: Wenn der Arbeitgeber bestimmte Vorgaben nicht beachtet, können diese Sonderzuwendungen schnell zur Pflicht für ihn werden, wie jetzt das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entschieden hat.
Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitterkanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.
Ihr Dirk Baas

Grünstadt, Berlin (epd). Ilham Khaskiyeh und ihre drei Kinder haben einen großen Schritt für ein Leben in Deutschland geschafft. Das Kirchenasyl ist vorüber, nun läuft das Asylverfahren. Die Familie aus dem Libanon lebt in einer Unterkunft für Asylbewerber im pfälzischen Grünstadt an der Weinstraße. „Jetzt will ich Deutsch lernen und arbeiten“, sagt die alleinstehende Frau, die mit ihren minderjährigen Kindern einen langen Leidensweg hinter sich hat, in fließendem Englisch.
Zwei Monate und drei Tage lang fanden die 46-jährige Libanesin und ihre Kinder Mohammed (17), Rihan (15) und Jihan (11) Schutz im Gemeinderaum der protestantischen Kirchengemeinde im etwa 20 Kilometer entfernten Maxdorf. Der kleinen Flüchtlingsfamilie, die vor zwei Jahren über Italien nach Deutschland einreiste, drohte die Rückführung dorthin. „Wir fühlen uns hier in Sicherheit und leben in Frieden“, sagt Ilham Khaskiyeh, „wir können nicht zurückgehen.“
Beschämt erzählt die ehemalige Büroleiterin, die auch für die Vereinten Nationen arbeitete, warum sie ihre Heimat verlassen musste: Dort sei sie zahlreichen Anfeindungen und auch gewaltsamen Übergriffen ausgeliefert gewesen. Sie flüchtete mit ihren Kindern per Schiff nach Italien. Die Behörden hätten sie dort in einem abgelegenen Bergdorf in unhaltbaren Zuständen untergebracht, sagt Khaskiyeh: „Es gab kaum zu essen und zu trinken.“ Als eine ihrer Töchter krank wurde, habe es keine ärztliche Hilfe gegeben.
In ihrer Verzweiflung machte sich die Familie auf den Weg nach Deutschland, die Behörden wiesen ihr schließlich eine Wohnung in einem Flüchtlingswohnheim in Grünstadt zu. Schnell integrierten sich die Libanesen in die Stadtgemeinschaft, die Kinder fanden Freunde und besuchen seither das örtliche Gymnasium. Doch dann drohte ihnen die Rückführung in das Erstaufnahmeland Italien.
Die evangelische und katholische Kirche in der Region organisierten daraufhin ein Kirchenasyl in der Kirchengemeinde Maxdorf. Die „Leininger Initiative gegen Ausländerfeindlichkeit“ (LIGA) stand beratend zur Seite. Zahlreiche Kirchengemeinden sammelten Spenden für den Lebensunterhalt der Familie, eine fünfköpfige Helfergruppe kümmerte sich um sie. Die Schülerschaft des Grünstadter Gymnasiums demonstrierte mit Plakaten auf der Straße, damit ihre Mitschüler nicht abgeschoben werden: „Wir lieben Euch!“
Das Kirchenasyl solle Flüchtlingen bei drohender Abschiebung als „letzter, legitimer Versuch“ einen zeitlich befristeten Schutz gewähren, erläutert Helmut Guggemos, der Flüchtlingsbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz. Ziel sei es, dass die Ausländerbehörden erneut sorgfältig deren Situation prüften: Bei humanitären Härten könnten Flüchtlinge dann auf ein Asylverfahren und gegebenenfalls ein Bleiberecht hoffen.
Vor 40 Jahren gewährte eine evangelische Kirchengemeinde in Berlin das erste Kirchenasyl in Deutschland. Das „kleine Schutzelement Kirchenasyl“ habe seither vielen Tausend Menschen das Leben gerettet, berichtet die Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ mit Sitz in Berlin. Zurzeit seien 511 Kirchenasyle mit 786 Personen bekannt, 154 davon Kinder. 90 Prozent der Kirchenasyle seien sogenannte Dublin-Fälle, bei denen Flüchtlingen eine Abschiebung in ein europäisches Erstaufnahmeland droht.
Beim Kirchenasyl, das Gemeinden den Ausländerbehörden melden müssen, handeln die Kirchen in einer rechtlichen Grauzone: Der Staat toleriert es, kann es aber auch beenden, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dafür keine Grundlage sieht. Immer wieder gibt es in Deutschland Abschiebungen aus dem Kirchenasyl, Strafverfahren gegen kirchliche Amtsträger und Durchsuchungen in Pfarrhäusern.
Unverständlich ist es für Bernd Frietsch, den Sprecher der LIGA in Grünstadt, dass Ilham Khaskiyeh und ihre Familie als traumatisierte Schutzbedürftige nach Italien abgeschoben werden sollten. Das Bundesamt habe es trotz nachgewiesenen Härtefalls abgelehnt, das Asylverfahren in Deutschland durchzuführen. Als Reaktion auf das erfolgreiche Kirchenasyl sei die Familie zudem in einer deutlich schlechteren Wohnung untergebracht worden, kritisiert er. Ein Leben in Italien oder gar in ihrem Heimatland wäre für die Khaskiyehs unzumutbar, ergänzt Pfarrer Stefan Fröhlich aus Maxdorf, in dessen Gemeindehaus die Familie wohnte.
Mohammed, Rihan und Jihan sind froh, dass ihr Asylverfahren jetzt in Deutschland läuft und sie wieder die Schule besuchen können. Während des Kirchenasyls hätten sie Schulkameraden online mit den Hausaufgaben versorgt, berichten sie. Mohammed will nach dem Abitur Elektrotechnik studieren, Rihan träumt davon, Kriminalkommissarin zu werden, und das „Küken“ Jihan „weiß noch nicht so recht“, was sie nach der Schule einmal machen will.
Dankbar sind die vier Khaskiyehs für das Kirchenasyl - auch wenn es sich manchmal „wie ein Gefängnis“ anfühlte, wie Mohammed sagt. Denn während des Kirchenasyls dürfen die Geflüchteten die Räume nicht verlassen. „Ohne die Kirchen wäre meine Zukunft in Sicherheit unmöglich.“
Frankfurt a.M., Berlin (epd). Die großen christlichen Kirchen in Deutschland wollen Geflüchteten bei unzumutbaren humanitären Härten weiter in ihren Räumen Asyl gewähren. Aus christlicher Motivation heraus sei dieses ein letztes Mittel, um in Einzelfällen eine Abschiebung zu verhindern, sagte Ulrike La Gro, Sprecherin der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche mit Sitz in Berlin, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Vor 40 Jahren wurde das erste Kirchenasyl in einer evangelischen Kirche in Berlin gewährt.
Für viele Flüchtlinge sei das Kirchenasyl nach oft jahrelanger Flucht und Trauma die letzte Möglichkeit für eine bessere Zukunft für sich selbst und ihre Familien, sagte La Gro. In der EU solle es unbedingt gerechtere Mechanismen der Verteilung von Geflüchteten geben. „Auch wenn es auf europäischer Ebene momentan keine Mehrheiten dafür gibt, befürworten wir ein Modell, in dem Kosten geteilt werden und ankommende Flüchtlinge Wahlmöglichkeiten haben, wo in der EU ihr Asylverfahren durchgeführt wird“, sagte La Gro.
Viel zu oft werde die Chance, die Migration auch in Form von Flucht biete, für die Gesellschaft verkannt, sagte die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft. Neben einzelnen Verbesserungen für bereits im Land lebende Geflüchtete baue auch Deutschland mit an einer „Festung Europa“: Diese wehre an den EU-Außengrenzen Menschen ab, dränge sie zurück und wolle die Aufnahme und den Flüchtlingsschutz „auslagern“, sagte La Gro.
Der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ sind derzeit 511 Kirchenasyle mit 786 Personen bekannt, 154 davon seien Kinder. Die Zahl der Geflüchteten sei in den vergangenen Monaten gestiegen. Die allermeisten Menschen im Kirchenasyl erhielten später einen Schutzstatus, ein Bleiberecht in Deutschland, sagte La Gro.
Berlin (epd). Die Zahl der Geflüchteten im Kirchenasyl ist in den vergangenen Monaten gestiegen. Mittlerweile seien der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ 511 Fälle mit 786 Betroffenen bekannt, sagte Geschäftsführerin Genia Schenke am 14. April dem Evangelischen Pressedienst (epd). Im November 2022 seien es bundesweit noch 314 Fälle mit 508 Betroffenen gewesen.
Der Anstieg sei aber nicht so hoch, wie die Zahlen erscheinen ließen, ordnete Schenke ein: „Mehrere Kirchenasyl-Netzwerke vor Ort haben nun erst Zahlen nachgeliefert, so dass sie nun erst in der Statistik auftauchen.“ Andererseits gebe es durchaus eine erhöhte Nachfrage. Die Netzwerke berichteten, dass sie viele Schutzsuchende abweisen müssten.
Über die Gründe für die hohe Nachfrage nach Kirchenasyl konnte Schenke keine Angaben machen. „Das wäre reine Spekulation“, sagte sie. Allgemein sei es aber so, dass auf einen erhöhten Zuzug von Flüchtlingen mit zeitlicher Verzögerung eine erhöhte Nachfrage nach Kirchenasyl folge.

Berlin, München (epd). Die geplante Krankenhaus-Reform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) steht in der Kritik, seit die ersten Eckpfeiler bekanntwurden. Nun hat es Lauterbach schwarz auf weiß: Die Pläne der Regierungskommission sind nicht verfassungskonform, weil sie die Zuständigkeiten der Länder zu stark beschneiden würden. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest das von den Landesregierungen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein in Auftrag gegebene Rechtsgutachten des Augsburger Verfassungsrechtlers Professor Ferdinand Wollenschläger, das am 20. April in Berlin vorgestellt wurde.
Wollenschläger erläuterte, dass den Ländern bei einer Krankenhausreform „kraft Verfassungsrecht“ eigene und umfassende Gestaltungsspielräume „sowohl legislativer als auch administrativer Art“ bleiben müssten. In der Zusammenfassung seines 140-seitigen Gutachtens schreibt der Jurist: „Dass bundesweit Reformbedarf besteht oder eine bundeseinheitliche Regelung für wünschenswert erachtet wird, bedeutet (...) noch nicht, dass der Bundesgesetzgeber zur Reform berufen ist.“ Oder wie es an anderer Stelle heißt: „Dem Bund steht keine umfassende Gesetzgebungszuständigkeit für das Krankenhauswesen zu“, sondern nur „eine partielle“.
Kern der geplanten Krankenhausreform des Bundes ist eine Ergänzung der seit über 20 Jahren existierenden Fallpauschalen. Stattdessen soll das Vorhalten von Leistungen besser vergütet werden. Damit soll sich vor allem die Zahl unnötiger, aus wirtschaftlichen Überlegungen durchgeführter Eingriffe verringern. Auch soll es künftig eine Unterteilung der Krankenhäuser in verschiedene Versorgungslevel geben. Kleinere Kliniken mit niedrigerem Versorgungslevel sollen sich auf eine Grundversorgung konzentrieren, während die komplexeren Eingriffe vor allem in großen, entsprechend spezialisierten Kliniken stattfinden sollen.
Das verfassungsrechtliche Problem sieht Wollenschläger darin, dass der Bund zuerst die Versorgungslevel festlegen will - dadurch werden also Vergütungsrahmen für die einzelnen Kliniken festgelegt, die wiederum maßgeblich für das sind, was ein Krankenhaus anbieten kann. Diesen Vergütungsregelungen komme also „erhebliche Planungsrelevanz zu“, sagte der Verwaltungsjurist. Damit wäre die „Planungsbefugnis der Länder“ in einem Ausmaß beschnitten, dass diese kaum noch Gestaltungsspielräume hätten. Eine Lösung könnte sein, dass die neuen Vergütungsregeln „an den krankenhausplanerischen Versorgungsauftrag anknüpfen“.
Die drei unionsgeführten Landesregierungen - und vor allem die für Gesundheit zuständigen Minister - sehen sich durch das Gutachten in ihrer Kritik an Lauterbachs Reformplänen bestätigt. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte, eine Krankenhausreform sei zwar wichtig, aber man setze sich eben auch für eine „bestmögliche und flächendeckende medizinische Versorgung der Menschen in unseren Ländern ein“. Bei einer „zentral von Berlin aus gesteuerten Reform“ könne man nicht mitgehen. Es brauche „einen offenen Dialog auf Augenhöhe“ zwischen Bund und Ländern und eine Korrektur des Reformvorhabens, sagte Holetschek.
Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte, er sei froh, dass Lauterbach mittlerweile angekündigt habe, „keine 1:1-Umsetzung der Vorschläge“ anzustreben, sondern mit den Ländern zusammenzuarbeiten. Man sehe das Gutachten Wollenschlägers „auch als Bestätigung“, mit der Umsetzung der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen fortzufahren.
Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) sagte, die drei Länder wollten „keinesfalls eine Reform verhindern, sondern - ganz im Gegenteil - einen Erfolg der Reform ermöglichen.“
Aber die geplante Reform des Bundes würde nicht nur die Krankenhausfinanzierung neu regeln, sondern auch Vorgaben zur Krankenhausplanung machen, die massiv in die Planungshoheit der Länder eingreifen. „Insbesondere bei der Festlegung von Strukturvoraussetzungen wird die Kompetenz und Erfahrung der Länder benötigt, die ihre regionalen Besonderheiten kennen“, so der Minister. Mindestkriterien, die von Bundesebene aus mit dem Gießkannenprinzip verabschiedet werden, bergen aus seiner Sicht insbesondere in nicht elektiven Bereichen das Risiko einer Unterversorgung ländlicher Regionen.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) begrüßte die Bestätigung, dass die Krankenhausplanung letztverantwortlich in der Hoheit der Bundesländer liegt. Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß sagte, die Landeshoheit über die Krankenhausplanung müsse gewahrt werden. „Die Autoren bestätigen das verfassungsrechtliche Primat der Krankenhausplanung der Länder vor der Kompetenz des Bundes in Vergütungsfragen.“
Der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) würdigte die Klarstellung und unterstrich, dass die Hoheit der Länder für die Krankenhausplanung bei den anstehenden Reformen nicht nur aus juristischen, sondern auch aus versorgungspraktischen Gründen gewahrt bleiben müsse. Geschäftsführerin Bernadette Rümmelin: „Der Versorgungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung ist von Region zu Region unterschiedlich. Dem kann nur eine Krankenhausplanung gerecht werden, die von den Ländern verantwortet und ausgestaltet wird.“ Wo bundeseinheitliche Vorgaben unverzichtbar seien, müssten die Ländern ausreichend Handlungsspielräume haben, um sie an die regionalen Gegebenheiten anzupassen.
Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandess, rief Bund und Länder auf, die Kliniklandschaft gemeinsam zu reformieren. „Dabei sind bundeseinheitliche Leistungsgruppen und Leistungsbereiche aus unserer Sicht unverzichtbar, um Planung und Finanzierung endlich gleichgerichtet auf die bedarfsnotwendigen Strukturen auszurichten.“ Die Länder könnten auf Basis der Leistungsgruppen künftig konkrete Versorgungsaufträge für die Kliniken festlegen. Diese seien dann auch eine geeignete Grundlage für die Entscheidung, welche Kliniken künftig die Fallzahl-unabhängigen Vorhaltepauschalen für bedarfsnotwendige Leistungen erhalten.

München (epd). Die Gummibärchen kommen aus Fort Lauderdale in Florida und haben es in sich. Sie enthalten CBD, das steht für Cannabidiol, einem Stoff, der in der Cannabispflanze vorkommt. Er wirkt beruhigend, soll auch entzündungshemmend sein - und ist nicht verboten. Vom Verkauf von CBD-Produkten leben Läden wie der von Michael Vetter im hippen Münchner Glockenbach-Viertel.
Von außen sieht der Laden in der Hans-Sachs-Straße fast aus wie eine Drogerie. „Cannabis und mehr“ steht auf Englisch auf dem weißen Firmenschild. Seit gut zwei Jahren verkauft hier Inhaber Vetter allerlei legale Produkte. „Es geht dabei vor allem um die entspannende Wirkung“, sagt der 58-Jährige, und „die Leute nehmen das zum Einschlafen“. Säuberlich aufgereiht stehen CBD-Kekse, Cannabis-Wein, Hanföl für die Haut und Cannabis-Drinks mit Ingwer und Curcuma in den Regalen. „Meine Kundschaft ist zwischen 18 und 89 Jahre alt“, berichtet Vetter.
Auf die Idee mit dem Cannabis-Laden kam der selbstständige Drucktechniker in der Corona-Krise. Als die Kundschaft wegbrach, suchte er nach neuen Wegen. Vom Laden alleine leben könne er nicht, das sei noch immer eher ein zweites Standbein. Seine Hoffnung auf den legalen Verkauf von Cannabis, wie er im Koalitionsvertrag der Ampel fixiert ist, hat sich jetzt ad hoc zerschlagen. Denn Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Pläne, den Verkauf der Droge in bestimmten Läden oder Apotheken flächendeckend zu erlauben, zunächst auf Eis gelegt.
Cannabis-Verkauf soll dem Minister zufolge in den nächsten fünf Jahren nur in regionalen Modellprojekten möglich sein. Doch noch ist offen, wo diese Versuche stattfinden sollen und ob und wie sich mögliche Händler beteiligen können.
Michael Vetter kann sich zwar vorstellen, mit seinem Laden in fünf Jahren in den legalisierten Verkauf einzusteigen, sagt aber auch: „Das hängt von den Vorgaben des Gesetzes ab.“ Ginge es nach ihm, dann sollte es keine Abgabe der Droge an unter 21-Jährige geben und die Kunden sollten nur eine begrenzte Menge pro Monat kaufen können. Den Schwarzmarktpreis für ein Gramm „Gras“ schätzt er aktuell auf 12 bis 16 Euro pro Gramm, was aber viele 16-Jährige nicht davon abhalte zu „kiffen“.
Um diese Jugendlichen kümmert sich bei der Münchner Drogenberatungsstelle Condrops der Abteilungsleiter für die Jugendsucht- und Familienhilfe, Siegfried Gift. Er ist einer von mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Condrops mit ihren über 70 Einrichtungen. Und was hält Gift von der Legalisierung von Cannabis? Hätte man ihn das vor zehn Jahren gefragt, so die Antwort, „hätte ich gesagt, wir brauchen neben Alkohol nicht noch eine legale Droge“. Heute habe sich seine Sicht auf die Dinge geändert.
Die kontrollierte Abgabe von Haschisch an Erwachsene unter strengen Auflagen sei richtig. Denn die Kriminalisierung verhindere die soziale Integration und das Aufsuchen von Hilfsangeboten. Gift sagt: „Zum Schaden durch den Drogenkonsum kommt noch die Strafverfolgung hinzu.“ Und deren Folgen wie Haft, Führerscheinverlust, Schulverweis oder Jobkündigung. Wichtig sei auch, dass die Qualität des Cannabis kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet ist: „Die Abgabeorte müssen weit weg von Schulen liegen“, fordert Gift.
Die künftige Legalisierung von Cannabis lässt bereits neue Geschäftsideen blühen. So denken bereits Bauern über den professionellen Anbau von Hanfpflanzen nach - und es gibt es mittlerweile schon einen „Cannabis Verband Bayern“.
Der Deutsche Hanfverband hegt weiter die Hoffnung auf eine möglichst schnelle Freigabe des Verkaufes von Cannabis. Sprecher Georg Wurth dazu: „Während wir über die Details der Marktregulierung diskutieren, wird immer noch alle drei Minuten ein Strafverfahren gegen einen Cannabiskonsumenten wegen ein paar Gramm oder ein paar Pflanzen eröffnet. Seit dem Antritt der Koalition waren es schon über 200.000 Verfahren.“ Endlich habe die Ampel begriffen, dass das nicht akzeptabel ist. „Jetzt muss schnellstmöglich ein konkreter Gesetzentwurf vorgelegt werden. Jedes weitere Strafverfahren gegen einfache Konsumenten ist eins zu viel“, so Wurth.
Die Abkehr von einem umfassenden Legalisierungsgesetz zugunsten von räumlich begrenzten Modellregionen sieht man beim DHV jedoch deutlich kritischer: "Kein konkretes Legalisierungsgesetz in Brüssel vorzulegen und prüfen zu lassen, ist ein Fehler. Ohne ein formelles Notifizierungsverfahren bleibt es die Ampel-Regierung, die den Plan beerdigt, nicht die EU”, so Wurt.
Frankfurt a.M., Offenbach (epd). Die Städte Frankfurt am Main und Offenbach wollen sich beim Bundesgesundheitsministerium als regionales Modellprojekt für Cannabis bewerben. „Wir begrüßen, dass die Bundesregierung dazu konkrete Pläne vorgestellt hat“, erklärten der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer und seine Offenbacher Amtskollegin, Bürgermeisterin Sabine Groß (beide Grüne), am 14. April. „Mehr ist momentan offensichtlich nicht möglich - leider. Das darf uns allerdings nicht daran hindern, das Mögliche jetzt umzusetzen“, fügte Majer hinzu.
Nach den Plänen der Ampel-Koalition soll künftig der private Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene legal sein. Außerdem soll der Anbau von bis zu drei Pflanzen erlaubt werden. Nicht kommerzielle Clubs oder Vereine dürfen Cannabis anbauen und die Produkte ausschließlich an die Mitglieder abgeben. Den geplanten Verkauf in dafür bestimmten Geschäften oder Apotheken wird es zunächst nicht geben.
Mit Blick auf die ausstehende Gesetzesregelung aus Berlin seien noch viele rechtliche Fragen zu klären, sagte Groß. „Der Schutz von Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen ist mir dabei ein besonderes Anliegen und deshalb unterstütze ich das Engagement aus Frankfurt, um hier gemeinsam voranzukommen.“ Die Offenbacher Stadtverordnetenversammlung hatte 2021 beschlossen, sich zusammen mit Frankfurt um ein Cannabis-Modellprojekt zu bemühen.
„Gerade was den notwendigen Jugendschutz angeht, kann man sich von unserer nachweislich erfolgreichen Präventionsarbeit in Frankfurt und Offenbach durchaus eine Scheibe abschneiden. Wir sind für ein Modellprojekt bereits sehr gut aufgestellt“, sagte Majer.
Nach Angaben des Gesundheitsdezernenten läuft derzeit in Frankfurt eine vom Drogenreferat in Auftrag gegebene Befragung zum Thema Cannabis und der geplanten staatlichen Regulierung. Ziel sei es, die Informations- und Hilfeangebote so aufzustellen, „dass sie den Bedarfen und Erwartungen der Bevölkerung entsprechen und damit die bestmöglichen Entscheidungen für den Jugend- und Verbraucherschutz getroffen werden“.
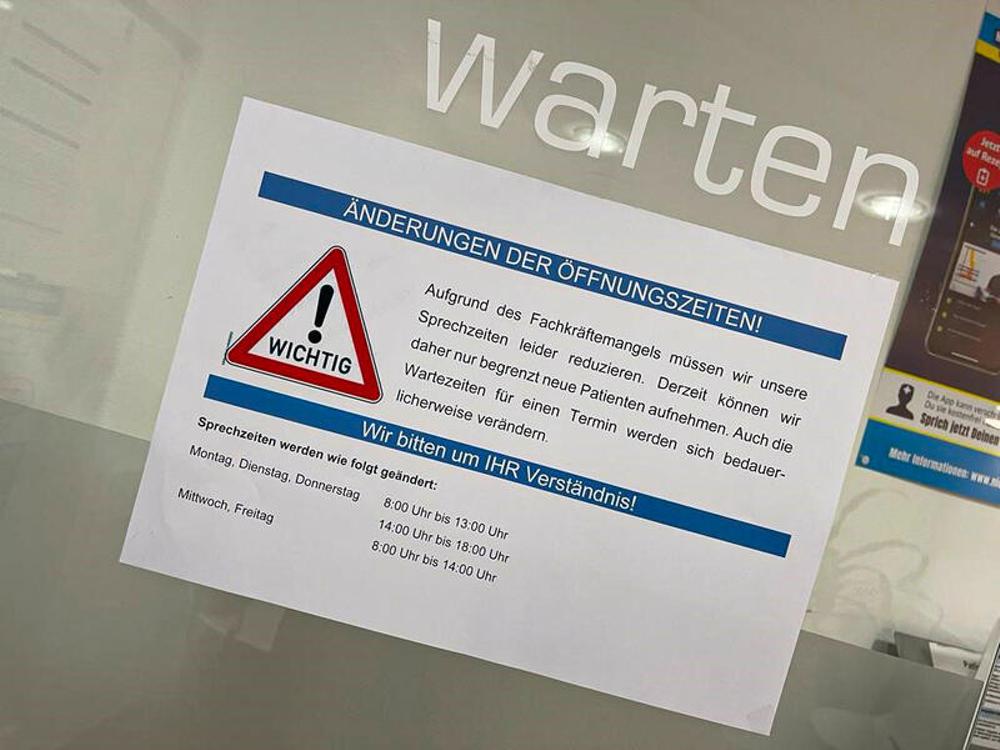
Berlin (epd). Der am 19. April in Berlin veröffentlichte DAK-Gesundheitsreport zeige, dass der Krankenstand in Mangelberufen überdurchschnittlich hoch sei, teilte die DAK mit. Besonders groß sei das Problem in der Alten- und Krankenpflege sowie in der Kinderbetreuung.
So habe der Krankenstand in der Altenpflege sieben Prozent, in der Kinderbetreuung und im Maschinenbau 6,8 Prozent und in der Krankenpflege 6,1 Prozent betragen. Der Durchschnitt für alle Berufe lag demnach bei 5,5 Prozent. Der Wirtschaftswissenschaftler Volker Nürnberg, der die Entstehung des Reports begleitete, sprach von einem Teufelskreis: „Hohe Fehlzeiten und Personalmangel bedingen einander und verstärken sich jeweils in den Effekten.“
Für den Gesundheitsreport befragte das Forsa-Institut repräsentativ nach DAK-Angaben zwischen Ende November und Ende Dezember 2022 mehr als 7.000 Beschäftigte. Zusätzlich wertete das IGES-Institut Daten aus dem Jahr 2022 von 2,4 Millionen DAK-Versicherten aus. Demnach gaben fast drei Viertel (74 Prozent) der Krankenpflegekräfte und fast zwei Drittel der Altenpflegekräfte (65 Prozent) an, ihre Arbeit mit dem vorhandenen Personal nur unter großer Anstrengung zu schaffen. In Branchen mit regelmäßigem Personalmangel gaben 70 Prozent der Befragten an, sie hätten in den vergangenen zwölf Monaten gearbeitet, obwohl sie krank waren. In Branchen ohne Personalmangel waren es nur 41 Prozent.
DAK-Vorstandsvorsitzender Andreas Storm sagte, die Zusammenhänge zwischen Personalmangel und Krankenstand seien viel größer als bislang vermutet: „Deshalb müssen wir schnell entgegensteuern.“ Storm schlug einen Runden Tisch mit Beteiligten aus Politik, Krankenkassen und Sozialpartnern vor.
Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, sprach von einem „Warnsignal“. Aufgaben des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsförderung müssten künftig in Pflegesatz- und Vergütungsverhandlungen berücksichtigt werden, forderte sie.
Die Studie mache deutlich, dass die Beschäftigten insbesondere in der Pflege überdurchschnittlich stark vom Personalmangel betroffen sind. Die vorhandenen Mitarbeitenden müssten zusätzliche Arbeiten übernehmen und die Vakanzen kranker Kolleginnen und Kollegen auffangen. Diese Mehrbelastung macht auch sie krank. „Zur Realität in der Pflege gehört auch, dass verantwortungsbewusste Mitarbeitende arbeiten, obwohl sie krank sind“, so Loheide weiter. Die Politik müsse die finanziellen Rahmenbedingungen für Entlastungen in der Pflege schaffen. Der vorliegende Entwurf für ein Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz von Bundesminister Lauterbach verdiene seinen Namen nicht, rügte die Diakoniechefin.
Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied, sagte in Berlin, die Ergebnisse der Studie seien alarmierend. "Dass eine dünne Personaldecke und hohe Arbeitsbelastungen Beschäftigte krank machen, sehen wir seit Jahren. Gerade im Gesundheits- und Pflegebereich existiert Personalmangel fast flächendeckend - mit fatalen Folgen für die Gesundheit der Beschäftigten. Ein hoher Krankenstand verschärft wiederum Personalengpässe und hält in der Folge Menschen davon ab, in Pflegeberufen arbeiten zu wollen.
„Um aus diesem Teufelskreis auszubrechen brauchen wir endlich mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen in den betroffenen Branchen“, so Piel. Dafür müssten die Arbeitgeber ihrer Verantwortung für den Gesundheitsschutz der Beschäftigten besser gerecht werden: „Arbeit muss so organisiert sein, dass für Aufgaben genug Zeit bleibt. Individuelle Bedürfnisse der Beschäftigten sollten immer zu Verbesserungen durch betriebliches Gesundheitsmanagement führen - und zwar unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.“

München (epd). In Deutschland fehlen einer Studie zufolge mehr als zwei Millionen seniorengerechte Wohnungen. Laut der Erhebung „Wohnen im Alter“, die am 17. April auf der Messe Bau in München vorgestellt wurde, benötigen aktuell rund 2,8 Millionen Haushalte mit Senioren altersgerechte Wohnungen. Nur 600.000 dieser Haushalte hätten derzeit entsprechende Räume zur Verfügung.
Das Problem werde sich innerhalb der nächsten 20 Jahre durch das steigende Bevölkerungsalter noch verschärfen, heißt es in der Studie des hannoverschen Pestel-Instituts, die im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) erstellt wurde. Als einer der Gründe für die „graue Wohnungsnot“ wurde angegeben, dass nur rund jede siebte Wohnung heute altersgerecht sei. Ein Großteil davon werde außerdem nicht von Älteren bewohnt. Häufig nutzten Familien Wohnungen ohne Schwellen, mit breiten Türen, Fluren und Räumen. „Barrierefreiheit ist ein Komfortmerkmal, und solche Wohnungen werden über den Preis vergeben, nicht nach Bedürftigkeit“, sagte der Leiter des Pestel-Instituts, Matthias Günther.
Er sprach von einem „Zwei-Komponenten-Problem beim Seniorenwohnen“: einem Mangel an altersgerechten Wohnungen und Altersarmut durch das Wohnen. Es sei zu befürchten, dass sich zwei Drittel der Senioren, die in einer Mietwohnung leben, bei steigenden Wohnkosten künftig immer mehr einschränken müssten, weil die Rente für den bisherigen Lebensstandard nicht mehr reiche. Das werde sich bereits bei den geburtenstarken Jahrgängen zeigen, die demnächst in Rente gehen.
Als „Armutsrisiko Nummer Eins“ nennt die Studie die Pflegebedürftigkeit im Alter. Im Schnitt koste eine stationäre Pflege heute rund 2.400 Euro pro Monat. „Mehr als die Hälfte der Seniorenhaushalte hat allerdings weniger als 2.000 Euro netto im Monat zur Verfügung. Am Ende ist es also ganz oft der Staat, der einspringen muss“, sagte Günther. Dieser müsse daher ein Interesse daran haben, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich zu Hause leben können. Das wiederum setze deutlich mehr altersgerechte Wohnungen voraus. Ein „Alterswohnprogramm für die Baby-Boomer“ fehle jedoch.
Günther kritisierte, dass die staatliche KfW-Bank anders als früher keine Zuschüsse mehr zum altersgerechten Umbau von Wohnungen anbiete. Zudem müsse es auch Förderprogramme für die Aufteilung von Ein- und Zweifamilienhäusern geben: „Es geht darum, beispielsweise in einem klassischen Einfamilienhaus zwei Wohnungen unterzubringen, mindestens eine davon seniorengerecht“, sagte der Studienleiter. Der Bund müsse mindestens eine halbe Milliarde Euro für altersgerechten Neu- und Umbau zur Verfügung stellen, so seine Forderung.
Mehr Geld des Staates forderte auch der BDB. Eine deutliche Aufstockung der Fördermittel sei notwendig. Bund und Länder müssten jetzt ein milliardenschweres „Krisenpaket Wohnungsbau“ schnüren, insbesondere für den Neubau von bezahlbaren Wohnungen und von Sozialwohnungen, sagte Präsidentin Katharina Metzger. Das Baumaterial dafür sei da: „Der Fachhandel kann liefern. Für nahezu alles, was gebaut werden soll, gibt es auch Baustoffe.“ Es komme jetzt darauf an, dass der Staat alles daransetzt, den Wohnungsbau durch die Krise zu bringen.
Die im Wohnungsbau führenden Verbände in Deutschland fordern unterdessen von der Bundesregierung 50 Milliarden Euro mehr für den Bau von Sozialwohnungen. Das Geld solle von Bund und Ländern in einem Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden, erklärten die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und sechs weitere Organisationen am 20. April auf ihrem diesjährigen Wohnungsbautag in Berlin. Nur mit den zusätzlichen Mitteln könne es gelingen, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen, hieß es.
Der Staat müsse zudem den Bau bezahlbarer Wohnungen mit Quadratmeter-Kaltmieten zwischen 8,50 Euro und 12,50 Euro massiv unterstützen. Für 60.000 Neubauwohnungen in dieser Legislaturperiode seien 22 Milliarden Euro zusätzlich erforderlich, erklärte das Verbändebündnis Wohnungsbau, dem unter anderem der Deutsche Mieterbund, der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe angehören.
Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) wies die Milliarden-Forderung der Verbände zurück. Sie könne die Forderung verstehen, sagte sie auf dem Wohnungsbautag. Aber ein Sondervermögen sei in Wirklichkeit ja „ein Batzen Schulden“, und die Staatsverschuldung müsse begrenzt werden. Zur Förderung für den sozialen Wohnungsbau sagte Geywitz, bis 2026 flössen 14,5 Milliarden Euro vom Bund, so viel wie seit Jahren nicht. Mit der Co-Finanzierung durch die Bundesländer werde man voraussichtlich auf eine Fördersumme von 36 Milliarden Euro kommen.

Berlin (epd). Im Rechtsausschuss des Bundestages stand am 18. April erneut das Containern auf der Tagesordnung. Der Ausschuss hatte Expertinnen und Experten eingeladen, um einen Vorschlag zur Entkriminalisierung des Containerns von Lebensmitteln hinterfragen zu lassen, den die Linke vorgelegt hat. Sie will dazu das Strafgesetzbuch ändern. Das Ziel des Entwurfs wurde zwar durchweg begrüßt, die Rechtsexperten bewerteten die Umsetzungsfähigkeit allerdings sehr unterschiedlich.
Um eine Strafbarkeit wegen Diebstahls auszuschließen, will die Linke von der Verfolgung dieser Taten abgesehen. Zu diesem Zweck solle ein Absatz 2 in den § 248a StGB eingefügt, der regelt, dass von der Verfolgung abzusehen ist, wenn sich die Tat auf Lebensmittel bezieht, die vom Eigentümer in einem Abfallbehälter zur Beseitigung deponiert oder anderweitig zur Abholung bereitgestellt wurden.
Einem Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zufolge wird mit dem Begriff „Containern“ das Entwenden von Lebensmitteln bezeichnet, die - etwa wegen einer Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums - entsorgt wurden. Komme es zu Anzeigen, wird das von Staatsanwaltschaften und Strafgerichten zumeist als Diebstahl nach Paragraf 242 Absatz 1 Strafgesetzbuch eingestuft. In der Praxis endeten viele Verfahren mit einer Einstellung oder einem Freispruch, hieß es.
Der Leipziger Rechtsanwalt Max Malkus, der von den Grünen als Sachverständiger vorgeschlagen, sagte, Containern sei kein Randproblem. Er teile nicht die Ansicht, dass Lebensmittel, in dem Moment, wenn sie im Mülleimer landen, zu Abfall werden, denn sie könnten wieder entwidmet werden. EU-Recht stehe seiner Ansicht nach einer Entkriminalisierung des Containerns nicht entgegen. „Sozialwidrig ist das Widmen von Lebensmitteln zu Abfällen, und nicht umgekehrt das Retten von Lebensmitteln“, so der Anwalt. Hier müsse man ansetzen, doch da sei bisher leider nichts passiert.
Jochen Brühl, Vorsitzender des Dachverbands Tafel Deutschland, begrüßte die gesellschaftliche und politische Debatte zum Umgang mit überschüssigen Lebensmitteln und damit auch zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung sowie die Auseinandersetzung mit möglichen gesetzlichen Regelungen in Deutschland. Auch Brühl, der ebenfalls auf Vorschlag der SPD teilnahm, rief die Politik auf, durch konkrete Maßnahmen und unter Einbeziehung der gesamten Wertschöpfungskette Containern überflüssig machen. Vor allem aber sollte niemand in Deutschland im Müll wühlen müssen, um an Lebensmittel zu kommen.
Elisa Kollenda, Ernährungsexpertin von der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland, die auf Vorschlag der SPD an der Anhörung teilnahm, betonte, die Entkriminalisierung des Containerns sei aus ökologischer und sozialer Sicht ein sinnvoller Schritt. Gleichzeitig packe der Vorstoß der Linksfraktion das Problem noch nicht an der Wurzel. Stattdessen sollte die Bundesregierung die Überschussproduktion und Verschwendung schon von Anfang und entlang der gesamten Lieferkette durch einen gesetzlichen Rahmen verhindern.
Mohamad El-Ghazi von der Universität Trier erklärte, der Gesetzentwurf bewirke keine echte Entkriminalisierung. Die vorgeschlagene Regelung sei prozessualer Natur, „denn die materielle Strafbarkeit bliebe bestehen“. Der Professor, der auf Vorschlag der SPD eingeladen wurde, sagte, die vorgeschlagene Regelung sei zu weit gefasst und schieße über das eigentliche Ziel hinaus. Es würden Ressourcen für ein Scheinproblem vergeudet, so der Jurist.
Der Bundestag hatte sich am 26. Januar erstmalig mit dem Gesetzentwurf befasst. Bereits in der 19. Wahlperiode gab es mehrere Initiativen mit dem Ziel, das Containern zu entkriminalisieren oder auf andere Weise die Verschwendung von noch verbrauchbaren Lebensmitteln zu verhindern - bislang ohne Erfolg.
Magdeburg (epd). Die verpflichtende Zahlung einer Ausbildungsvergütung für Pflegehelferinnen und Pflegehelfer in Sachsen-Anhalt wird gesetzlich geregelt. Das Kabinett hat am 18. April einen Gesetzentwurf zur landesrechtlichen Umsetzung dieser Ausbildungsvergütung beschlossen. Ab August soll die Ausbildung aus Landesmitteln vergütet werden. Dafür werden im Etat in diesem Jahr rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Die Ausbildungsvergütung soll sich an der Mindestausbildungsvergütung orientieren, die das Bundesministerium für Bildung und Forschung jährlich bekannt gibt. Für 2023 wurde die Mindestausbildungsvergütung auf 620 Euro festgelegt und ab dem Ausbildungsjahr 2024 mit 650 Euro kalkuliert.
Auf Bundesebene sei die Novellierung der Berufsgesetze geplant, mit der die Schulgeldfreiheit und die Zahlung einer Ausbildungsvergütung im Bereich der Gesundheitsberufe sichergestellt werden solle, hieß es. Für die Ausbildung als Pflegehelferinnen und Pflegehelfer ist in Sachsen-Anhalt die Schulgeldfreiheit bereits seit 2019 umgesetzt und wird durch das Sozialministerium übernommen. Derzeit ist noch offen, ob der Bund die rechtlichen Voraussetzungen für die Zahlung einer Ausbildungsvergütung für Pflegehelferinnen und -helfer regeln wird. Mit der landesrechtlichen Regelung will Sachsen-Anhalt bereits jetzt die Bedarfe decken.

Bielefeld (epd). Diakonie-Präsident Ulrich Lilie sowie Wissenschaftler haben für einen differenzierten Blick auf die 175-jährige Geschichte der Diakonie plädiert. In den 175 Jahren ihres Bestehens habe die organisierte Diakonie in Deutschland positive Traditionslinien hervorgebracht, aber auch Abwege beschritten, sagte Lilie am 20. April in Bielefeld. Das Jubiläum soll laut Lilie auch die Schattenseiten der Geschichte in den Blick nehmen. Auf einer Fachtagung der Diakonie warben Historiker dafür, den ursprünglichen Freiheitsgedanken diakonischer Arbeit wiederzuentdecken.
Der Historiker Norbert Friedrich plädierte für einen differenzierten Blick auf die patriarchischen Gründergestalten der Diakonie. Die patriarchalischen Strukturen würden heute oft kritisch gesehen, sagte der Historiker der Düsseldorfer Fliedner-Stiftung. Ohne die prägenden Persönlichkeiten wie Theodor Fliedner oder Johann Hinrich Wichern wäre die heutige Diakonie jedoch nicht so groß geworden.
Der Historiker Hans-Walter Schmuhl unterstrich die Ambivalenz der Sozialstaatlichkeit. So werde dadurch die soziale Arbeit weitgehend vom Staat refinanziert, im Gegenzug setze der Staat die fachlichen Standards, sagte der Bielefelder Historiker laut Redetext. Dadurch gingen aber auch freiheitliche Impulse in der Erziehungsarbeit verloren. Der ursprüngliche Arbeitsansatz diakonischer Arbeit, den einzelnen Menschen und seine Potenziale in den Blick zu nehmen, könne aber auch heute noch eine Inspiration sein.
Die Missstände in der Geschichte der Diakonie hält Schmuhl für weitgehend aufgearbeitet. Mit Blick auf die Vernichtungsaktionen der Nationalsozialisten gegen Menschen mit Behinderungen zeige die Forschung Versäumnisse der evangelischen Kirche und der Diakonie, hatte der Historiker vor Beginn der Fachtagung dem epd gesagt. Unter dem Titel „Ordnung und Freiheit - Ambivalenzen in der Geschichte der Diakonie“ befassen sich bis Freitag Expertinnen und Experten aus den Bereichen Geschichte, Diakoniewissenschaft und Theologie mit den Licht- und Schattenseiten der Diakonie-Geschichte.
Der Münchner Theologe Reiner Anselm verwies auf die religiösen Wurzeln des modernen Freiheitsbewusstseins. Der Aufruf des Reformators Martin Luthers, Buße zu tun, bedeute, die eigenen Vorstellungen und Interessen kritisch zu hinterfragen, sagte Anselm, der an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität München Theologie lehrt. Die besondere Leistungskraft des theologischen Freiheitsbegriffs bestehe darin, an dem Ideal der Freiheit des Einzelnen festzuhalten.
Die Bochumer Theologin Ute Gause warb in Bielefeld für eine stärkere Wertschätzung der Arbeit von Diakonissen. Diese hätten ihre Fähigkeiten einsetzen und in vielen Bereichen auch frei arbeiten können, sagte sie vor ihrem Vortrag zu diesem Thema in einem Interview auf der Interneseite der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Allerdings sei von ihnen auch eine starke Unterordnung verlangt worden. Zugleich sei der Schatz diakonischer Arbeit, den die Diakonissen verkörperten, noch nicht gehoben, sagte Gause, die an der Ruhr-Universität Bochum einen Lehrstuhl für Krichengeschichte innehat.
Vor 175 Jahren, im September 1848, regte der Hamburger Pfarrer und Anstaltsleiter des „Rauhen Hauses“, Johann Hinrich Wichern, beim ersten Evangelischen Kirchentag in Wittenberg die Gründung einer überregionalen protestantischen Hilfsorganisation an.
Ziel war es, die Arbeit der zahlreichen christlichen Initiativen und Vereine zu bündeln. Das war der entscheidende Impuls für eine neue, kirchliche „Innere Mission“, aus der über die Jahrzehnte der weitverzweigte evangelische Sozialverband entstand, der heute Diakonie heißt. Das 175. Jubiläum der Diakonie soll unter anderem im Herbst mit einem Festakt in Berlin gefeiert werden.

Bielefeld (epd). Das Treffen unter dem Titel „Ordnung und Freiheit - Ambivalenzen in der Geschichte der Diakonie“ beleuchtet die Licht- und Schattenseiten der Diakonie-Geschichte. Denn, so die Veranstalter, es wurden nicht nur positive Traditionslinien hervorgebracht, sondern auch Abwege beschritten. Mit Blick auf heute sagte Schmuhl, er sehe den Bereich der Altenpflege mit Sorge. Knapper werdende Mittel und Personal führten oftmals zu Missständen. Die Fragen stellte Holger Spierig.
epd sozial: Zum 175. Jubiläum rückt die Diakonie auch die Schattenseiten in den Fokus. Wie geht die Diakonie mit dunklen Kapiteln um?
Hans-Walter Schmuhl: Nach meiner Erfahrung geht die Diakonie nach einer anfänglichen Lernphase in den 1990er-Jahren inzwischen sehr offen und offensiv mit den dunklen Kapiteln ihrer Geschichte um. Es wird nicht abgewartet, dass von außen Dinge skandalisiert werden, sondern kritische Themen werden schon prospektiv angegangen. Vieles ist über den Weg der Auftragsforschung schon bearbeitet worden. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zum Beispiel haben sich in den 1990er-Jahren zunächst schwergetan, was die Aufarbeitung der NS-Euthanasie und die Rolle Bethels darin anging. Später bei den Themen Zwangsarbeit in diakonischen Einrichtungen während des Zweiten Weltkriegs sowie Gewalt in Behinderteneinrichtungen waren die v. Bodelschwinghschen Stiftungen dann aber mit die ersten diakonischen Einrichtungen, die das untersuchen ließen.
epd: Welche Rolle haben Kirche und Diakonie bei der Euthanasie der Nationalsozialisten gespielt?
Schmuhl: Es gibt hier zwei gegensätzliche Narrative: Zum einen gab es nach dem Krieg die Legende, nach der Kirchen sowie Diakonie und Caritas gegen die Aktion Widerstand geleistet hätten. Später gab es eine Gegenbewegung, die Kirchen und Diakonie vorwarf, Mitwisser und sogar Mittäter gewesen zu sein. Beides stimmt so nicht, wie wir mittlerweile wissen. Die Forschung ergibt inzwischen ein sehr differenziertes Bild.
epd: Wie sieht das aus?
Schmuhl: Man kann schon sagen, dass der Widerstand der evangelischen Kirche und der Diakonie zu spät kam. Es gab zwar Denkschriften und Protestnoten gegen die Aktion T4, dem systematischen Massenmord der Nationalsozialisten an Menschen mit Behinderungen. Aber man hat sich 1933 nicht klar gegen die Gesundheits- und Rassenpolitik des Nationalsozialismus positioniert. Im Bereich der Eugenik ist man sehr weit auf das Regime zugegangen und hat das Sterilisationsprogramm in den eigenen Einrichtungen willfährig mitgemacht. Das war ein grundlegender Fehler. Der Grundgedanke der Eugenik - Ausmerzung des Minderwertigen - ist so gegen den Grundgedanken der Inneren Mission gewesen, dass man damit seinen eigenen Auftrag verraten hat.
epd: Was waren bei der evangelischen Kirche die Gründe dafür?
Schmuhl: Das Versagen lag unter anderem daran, dass die evangelische Kirche nicht mit einer Stimme sprechen konnte. Das hatte mit dem Kirchenkampf zu tun, es gab eine tiefe Spaltung in den einzelnen Landeskirchen. Es hat aber auch mit der Organisation von Kirche und Diakonie zu tun. Es hat Einzelne gegeben, die mutig und relativ offen Kritik an der NS-Euthanasie geäußert haben. Andere, wie Fritz v. Bodelschwingh etwa, haben versucht, auf dem Weg der stillen Diplomatie etwas zu ändern. Aber es gab auf evangelischer Seite nicht die eine Stimme, die tonangebend gewesen wäre. Auf der katholischen Seite hatten die Bischöfe die Schlüsselposition, eine ganze Reihe deutscher Bischöfe sind da sehr offen aufgetreten.
epd: Wie haben sich in der Situation evangelische Einrichtungen konkret verhalten?
Schmuhl: Die Einrichtungen der Inneren Mission für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen standen vor einem Dilemma, als dann 1940/41 die großen Abtransporte im Rahmen der Aktion T4 stattfanden. Denn die meisten Transporte aus kirchlichen Einrichtungen galten offiziell als „normale“ Verlegungsaktionen. Wer etwas dagegen unternehmen wollte, hätte sich außerhalb des Gesetzes gestellt. Da hat man sich für eine Art teilnehmenden Widerstand entschieden. Das hat zwar dazu geführt, dass einzelne Kranke bewahrt worden sind. Eigentlich hat man aber kollaboriert, was den Abtransport der anderen anging.
epd: In vielen Einrichtungen der Jugendhilfe hat es in den 50er-70er Jahren körperliche, seelische Gewalt und auch Missbrauch gegeben. Wie schneiden diakonische Einrichtungen im Vergleich zu anderen Jugendhilfe-Einrichtungen ab?
Schmuhl: Die Gewaltverhältnisse, die etwa in Einrichtungen für Menschen mit geistigen Behinderungen oder in Fürsorgeerziehungseinrichtungen entstehen, haben mit bestimmten Anstaltsstrukturen zu tun. Die Frage der Trägerschaft ist da nicht so entscheidend. Einen Unterschied gibt es allerdings beim Selbstverständnis: Einrichtungen der Diakonie haben einen klaren christlichen Auftrag. Da gibt es eine erlebte Dissonanz bei dem Personal, das die Arbeit mit dem religiösen Anspruch in Einklang bringen muss. Das hat aber nicht zu einem Unterschied in der Behandlung der Bewohnerinnen und Bewohner geführt.
epd: Wie kam es zu diesem Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
Schmuhl: Im 19. Jahrhundert sind die Einrichtungen der Inneren Mission auf Initiativen der Zivilgesellschaft entstanden. Der Grundgedanke war, dass es „Reichgottesarbeit“ ist. Die Bewohner in den Einrichtungen sollen in die Lage versetzt worden, in freier Willensentscheidung das Wort Gottes anzunehmen. Deswegen gibt es eigentlich ein Grundprinzip der Freiheit. Niemand sollte gegen seinen Willen in einer solchen Einrichtung festgehalten werden, der freie Willen der Menschen sollte nicht unterdrückt werden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Einrichtungen der inneren Mission dann mehr und mehr in den Dienst staatlicher Sozialpolitik gestellt.
epd: Was hatte das für Folgen?
Schmuhl: Die Diakonie ist Teil sozialer Staatlichkeit und übernahm Aufgaben, die eigentlich der Staat machen soll. Das wird vom Staat auch refinanziert. Im Gegenzug büßt die Diakonie dadurch aber einen Teil ihrer eigenen Freiheit ein, Arbeit so zu tun, wie sie es richtig hielt. Dieses Grundproblem schwingt bis heute mit.
epd: Was bedeutet das konkret?
Schmuhl: Der Charakter der Arbeit hat sich in vielen Feldern schleichend verändert: Die Einrichtungen nahmen immer mehr Anstaltscharakter an. Besonders deutlich wird das in der Erziehungsarbeit: Als die neue Fürsorgeerziehung eingeführt wird, werden Rettungshäuser für verwahrloste Kinder und Jugendliche um 1900 nach Vorgaben des Staates zu geschlossenen Häusern. Daher musste man auf einmal die Türen abschließen und Gitter vor die Fenster machen.
epd: Ist Ihrer Einschätzung nach mit den bisherigen Studien alles an Missständen in der Diakonie aufgearbeitet oder gibt es noch Kapitel, die in den Blick genommen werden müssten?
Schmuhl: Die großen Konfliktfelder sind meiner Einschätzung nach ausgemessen. Ich erwarte nicht, dass noch etwas ganz Neues auftaucht, was zu einer völlig neuen Bewertung führen würde. Es gibt aber noch einige Bereiche, die weitgehend unerforscht sind. Ein Beispiel ist die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in den 50er und 60er Jahren, die aus der Sowjetischen Besatzungszone oder der DDR geflohen waren. Die galten in der BRD noch nicht als volljährig und waren deshalb in Anstalten untergebracht. Das war ein Arbeitsbereich, in dem es auch einige Missstände gegeben hat. Ein großes Thema aktuell sind die Kindererholungskuren in der Bundesrepublik wie auch in der DDR. Über diese Kurheime, bei denen auch die Diakonie beteiligt war, wissen wir noch sehr wenig.
epd: Was kann heute getan werden, damit Missbrauch oder Grenzverletzungen gar nicht erst entstehen können?
Schmuhl: Die Entstehung von Missständen, gerade auch von Gewaltverhältnissen in Einrichtungen, hat immer etwas mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu tun. Wenn die knapp sind, wenn in unzureichenden räumlichen Verhältnissen mit zu wenig oder schlecht ausgebildetem Personal eine große Gruppe von Menschen betreut werden muss, dann besteht immer ein großes Risiko für Zwang und Gewalt. Ich sehe mit großer Sorge den Bereich der Altenhilfe. Diakonie wäre gut beraten, sich frühzeitig politisch zu artikulieren und darauf hinzuweisen, dass bestimmte Bereiche unterfinanziert sind oder drohen, unterfinanziert zu werden. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es da zu Missständen kommen wird.
epd: Wo konkret sehen Sie Risiken?
Schmuhl: Zum Beispiel muss in Urlaubszeiten häufig auf Zeitarbeitskräfte zurückgegriffen werden, weil mit dem bestehenden Personalschlüssel Lücken in der Urlaubszeit nicht gefüllt werden können. Da können dann Mitarbeitende hineinkommen, die eigentlich nicht richtig ausgebildet und vorbereitet sind. Die müssen dann aber eigenverantwortlich eine Schicht machen. Das sehe ich mit großem Unbehagen. Hier müsste das System so ausgelegt sein, dass immer qualifiziertes Personal dabei ist. Der Bedarf an Menschen mit einer Pflegeausbildung wird deutlich zunehmen, zugleich gibt es einen Mangel an Nachwuchs. Niemand weiß, wie dieses Problem gelöst werden soll.

Frankfurt a.M., Mainaschaff (epd). Paul belegt sich sein Brötchen dick mit Schinken: Proviant für die anstehende Wanderung im Naturpark Spessart, etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto von der Frankfurter Innenstadt entfernt. Der ältere Herr ist bestens ausgestattet: Mit braunem Filz-Wanderhut und robusten Schuhen. Niemand würde denken, dass Paul obdachlos ist.
Seit ungefähr 20 Jahren lebt der Mann in Frankfurt auf der Straße, wie er mit zittriger Stimme erzählt, aktuell bei einem Bekannten im Wohnwagen. Aber auch das nur auf Zeit. In ein paar Wochen muss er wieder raus. Es sei auch kalt gewesen im Winter. Bei den Worten blickt er beschämt auf den Boden, bohrt seinen Wanderstock verlegen in die Erde.
Der leidenschaftliche Pilz-Sammler ist fast jedes Mal dabei, wenn Peter Schmitt von der Caritas Frankfurt zum Wandern einlädt. Einmal im Monat können sich Obdachlose und andere bedürftige Menschen dafür anmelden. Auch Fahrradtouren und Klettertraining stehen regelmäßig auf dem Programm des Projekts „Mach mit!“.
Die Angebote sollen Menschen wie Paul ihren Alltag erleichtern: „Bei unseren Projekten geht es um Erfolgserlebnisse. Dass man etwas schaffen kann, wenn man sich dafür anstrengt“, erzählt Projektleiter Schmitt. Das hätten viele aus der Bahn geworfenen Menschen über die Jahre vergessen, weiß er aus seiner langjährigen Erfahrung bei der Caritas. „Auch eine Wohnung fliegt nicht auf mich zu“, erklärt der Wanderführer den Wohnungslosen häufig.
Angemeldet haben sich heute nicht nur Menschen ohne ein Dach über dem Kopf. Frührentnerin Anke etwa hat einen festen Wohnsitz. „Darüber bin ich auch sehr dankbar“, betont sie und stützt sich auf ihrem Stock auf. „Aber bei anderen Wandergruppen komme ich nicht hinterher.“ Sie sei nicht mehr gut zu Fuß und verliere schnell ihr Gleichgewicht, erzählt Anke. „Hier weiß ich, dass mir sofort geholfen wird.“ Die Frührentnerin freut sich schon Wochen vor dem Termin auf die Wanderung, wie sie strahlend erzählt.
Die heutige Wanderung führt die sieben Hobbywanderer gut zehn Kilometer durch den Wald. Die Ausrüstung können sich die Teilnehmenden bei der Caritas ausleihen. Peter Schmitt verteilt vor dem Start außerdem Getränke und Snacks. Auf der Hälfte der Route gibt es eine Pause.
„Für uns ist so eine Strecke kein Problem. Aber für die Menschen hier ist das ein großer Erfolg, wenn sie das schaffen“, erklärt der Journalist Klaus Hofmeister, der sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Projekt engagiert und in seiner Freizeit gerne wandert und klettert.
„Was mich berührt sind tiefe Gespräche über Spiritualität. Zum Beispiel die Frage: Bin ich alleine oder bin ich nicht alleine?“, erzählt Hofmeister, während die Gruppe sich gerade für ein Erinnerungsfoto zusammenstellt. Einige Teilnehmenden hätten dem Journalisten auch schon von Gotteserfahrungen berichtet. Beim Wandern komme man viel eher ins Gespräch als an einem Tisch. Und, so seine Erfahrung: Die Menschen hätten weniger Hemmungen.
Das Zusammensein tut auch Ilaf gut. Der Mann kommt aus dem Irak und hat in Frankfurt einige Semester studiert. Dann kamen Geldsorgen. Er wurde depressiv, hatte sein Leben nicht mehr unter Kontrolle. „Ein Bruch“, wie der 50-Jährige sagt. „Ich hatte keinen geregelten Alltag mehr, musste Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen“, erzählt Ilaf. Einen festen Wohnsitz hat er nicht. Er habe bei den Touren schon viele gute Unterhaltungen geführt, sei froh darüber, Kontakte zu knüpfen. Der Teilnehmer von „Mach mit!“ resümiert: „Ohne das Projekt wäre ich wahrscheinlich wieder der Depression verfallen.“

Nürnberg (epd). Als sich die Türen zum Historischen Rathaussaal in Nürnberg öffnen, sind alle ganz still. Blinde Menschen werden bei der Führung „Rathaus für alle“ an dieser Stelle von Elisabeth Tenner an der Hand genommen und durch den großen Raum geführt. Die Schritte hallen, die Klimaanlage rauscht im Hintergrund, man spürt die Weite des 40 mal zwölf Meter großen Saals. Auch Sehende dürfen das mit ihr ausprobieren und mit geschlossenen Augen die Atmosphäre auf sich wirken lassen.
Bei der inklusiven Führung erkunden Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam das Rathaus. Dazu gehört auch ein Porträt des Oberbürgermeisters Marcus König (CSU) - selbstverständlich in Brailleschrift. Denn die macht nicht nur Texte für blinde Menschen lesbar, sondern auch Bilder: Die Gesichtszüge, Haare und Brille Königs heben sich vom weißen Papier ab, genauso wie Anzug, Krawatte und Amtskette. „Uns ist es wichtig, dass alle Menschen, die hier mitmachen, etwas davon haben“, sagt Elisabeth Tenner.
Die Rathaus-Tour ist Teil des Pionierprojekts „Kultouren für alle“, das von der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus in Nürnberg erarbeitet wurde. Es soll schon vor den eigentlichen Stadtführungen Menschen mit und ohne Behinderung zu Teams zusammenbringen: Gemeinsam bieten sie Führungen zu einem selbst gewählten Thema an. Neun dieser Führungen sind seit Projektbeginn 2021 entstanden, zum Beispiel im Germanischen Nationalmuseum, auf der Straße der Menschenrechte oder im Saal 600 im Memorium Nürnberger Prozesse.
Die Menschen, die diese Touren anbieten, sind keine ausgebildeten Stadtführerinnen und Stadtführer. Sie interessieren sich für das Thema und lernen in einer mehrwöchigen Ausbildung, wie Kulturvermittlung funktioniert und wie man einer Gruppe von Menschen begegnet.
Die Freundinnen Rita Heinemann und Elisabeth Tenner haben sich 2022 gemeinsam angemeldet. In ihrem Team haben beide eine Beeinträchtigung: Tenner ist schwerhörig, Heinemann gehbehindert. „Ich bin im Behindertenrat der Stadt Nürnberg und dort wurde das Projekt vorgestellt“, erzählt Tenner. Bei der Vorstellung war auch der Oberbürgermeister dabei, der selbst vorschlug, eine inklusive Führung an seinem Amtssitz anzubieten.
Heinemann setzt den Fokus in der Führung durch das Rathaus auf den barrierefreien Zugang zu den präsentierten Räumen. Sie erzählt von den Schwierigkeiten, in die massiven Steinwände der Ehrenhalle im Erdgeschoss einen Aufzug einzubauen und wie sie und ihre Mitstreiter es nach 15 Jahren geschafft haben, das Bauprojekt ins Rollen zu bringen. Heinemann arbeitet seit mehr als 25 Jahren als ehrenamtliche Stadträtin. „Ich kenne das Rathaus wie meine Westentasche“, erzählt sie, „und kann auch ein paar Geschichten mit den Leuten teilen, die in keinem Stadtführer stehen.“
So erfahren die Teilnehmenden, dass die Höhe der Nürnberger Bordsteine international als Vorbild für Barrierefreiheit gilt und dass man mit einem Schwerbehindertenausweis bevorzugt einen Termin im Rathaus bekommt. Im Plenarsaal erklären die Stadtführerinnen anhand von kleinen Spielfiguren die Aufgaben des Stadtrats und des Behindertenbeirats und geben Tipps, wo es in Nürnberg Informationen zu Inklusion gibt oder wo man kostenlos seine Wasserflasche auffüllen kann.
Bei Bedarf können Tenner und Heinemann jederzeit zur leichten Sprache wechseln. „Wir orientieren uns immer an den Bedürfnissen der Menschen in der Gruppe“, sagt Tenner. Das unterscheide sie von klassischen Stadtführungen.
Die Teilnehmenden sind nach der Führung positiv überrascht. „Ich konnte mir erst gar nichts darunter vorstellen“, gibt Klaus Wörner zu. „Aber die ganzen Erklärungen waren toll. Ich lebe seit 30 Jahren in Nürnberg und habe wirklich eine neue Verbindung zu dieser Stadt bekommen.“ Seine Frau Kirsten Wörner, die als Rollstuhlfahrerin teilgenommen hat, findet die Details zur Renovierung und dem historischen Rathaussaal besonders spannend. „Und natürlich ist es toll, dass es in so einem alten Gebäude einen Fahrstuhl gibt.“
Das Interesse an den Führungen steige, sagt Projektleiterin Diana Löffler vom Caritas-Pirckheimer-Haus. Wenn im Juni 2023 die Special Olympics World Games für tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung zum ersten Mal in Berlin stattfinden, ist Nürnberg eine der Gastgeberstädte. Dann werden auch Führungen der „Kultouren für alle“ im Programm zu finden sein, wie Löffler erzählt. Und, ergänzt sie: Andere Städte hätten sich bereits nach dem Konzept erkundigt.

Nürnberg (epd). Mit 114 Ausstellern aus sechs Ländern ist die Halle für die Werkstätten-Messe in Nürnberg derzeit gut gefüllt. Aber die diesjährige Ausgabe der Werkstätten-Messe 2023 bis zum 22. April ist die letzte Ausgabe ihrer Art. Seit 2006 fand die Fachmesse für berufliche Teilhabe und Leistungsschau der Werkstätten für behinderte Menschen im Messezentrum Nürnberg statt. Doch der ideelle Träger des Branchentreffs, die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM), ist auf der Suche nach einem neuen Format, wie die Verantwortlichen am 19. April bestätigten.
In Zukunft werde der Kongress-Teil als zentrale Austauschplattform gestärkt, der Ausstellungsbereich voraussichtlich deutlich kleiner. Ein neuer Messeplatz sei noch nicht gefunden. Der Vorstandsvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Martin Berg, stellte aber klar: „Nürnberg ist in der letzten Runde der Standortauswahl nicht mehr dabei.“
Die besten Jahre habe die Werkstätten-Messe 2013 bis 2015 mit teils über 200 Ausstellern und über 20.000 Besuchern gehabt, erinnert sich Berg. Doch die Produkte, die die Werkstätten aus dem ganzen Bundesgebiet präsentierten, wurden immer weniger gekauft. Für Aussteller etwa aus dem hohen Norden, die mit Schreinerarbeiten und anderen Einrichtungsprodukten angereist kamen, war der Auftritt zuletzt ein Draufzahlgeschäft.
Auch der bisherige Messeansatz, die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen in die breite Öffentlichkeit zu tragen, hat sich aus Sicht von Berg überlebt. „Wir wollen behinderte Menschen nicht präsentieren, sondern teilhaben lassen.“ Zudem stoße der inklusive Gedanke im Kongresspart an seine Grenzen. Zwar richten sich auch diesmal im Kongress viele der rund 100 Vorträgen an behinderte und nichtbehinderte Teilnehmer. „Manche Themen lassen sich in leichter Sprache nur in viel längerer Zeit darstellen.“
Die BAG WfbM hat nun ein Positionspapier vorgestellt zum digitalen Aufbruch für die bundesweit 700 Hauptwerkstätten, die an gut 3.000 Standorten 310.000 Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Berg sieht für die Werkstätten einen großen Nachholbedarf angesichts der fortschreitenden Digitalisierung. Aus Eigenmitteln könnten die Kosten für digitale Infrastruktur, etwa für computergesteuerte Maschinen mit Qualitätskontrolle durch Künstliche Intelligenz, nicht finanziert werden. Außerdem müssten sowohl die behinderten Beschäftigten als auch das Fachpersonal geschult werden.
Den Finanzbedarf für den digitalen Aufbruch der Werkstätten will Berg nicht beziffern. Bei 700 Werkstätten könnte allerdings schnell ein zweistelliger Millionenbetrag auf die Arbeitsagenturen oder Sozialträger zukommen. Es gehe aber nicht nur um eine einmalige Anschubfinanzierung, sondern Jahr für Jahr um eine verstetigte Finanzierung der digitalen Infrastruktur.
Der Geldsegen soll den sogenannten „Digital Gap“ verringern. Denn Menschen mit Behinderungen haben durchschnittlich weniger Zugang zu technischen Endgeräten oder Assistenzsystemen. Die digitale Teilhabe sei bislang alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dabei verspricht sich Berg durch einen digitalen Aufbruch neue Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Die Gefahr, dass Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, sieht der Verbandschef nicht. Im Gegenteil könnten digitale Kompetenzen auch den Einstieg aus den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt erleichtern.
Köln (epd). Angesichts der geplanten Beitragserhöhungen zur gesetzlichen Pflegeversicherung spricht sich der Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer-Organisationen (ACA) für ein nachhaltiges Konzept zur Finanzierung des Pflegewesens aus. Die ständige Anhebung der Beiträge könne die demografisch bedingten Herausforderungen einer alternden Gesellschaft alleine nicht abfedern, heißt es zur Begründung in einer am 18. April verbreiteten Mitteilung.
„Die Höhe des geplanten Anstiegs ist erheblich“, sagte der Bundesvorsitzende Andreas Luttmer-Bensmann. So betrage der geplante Anstieg zum Teil mehr als einen halben Prozentpunkt. „Das stellt eine große Belastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dar.“ Statt einfacher Erhöhungen brauche es eine weitergehende Debatte darüber, wie sich der gestiegene Finanzierungsbedarf in der Pflege in Zukunft solidarisch und sozial verträglich stemmen ließe.
„Es fehle an einem langfristigen Konzept für eine nachhaltige Finanzierung der Pflegeversicherung“, ergänzte Claudia Braun, Mitglied im ACA-Bundesvorstand. Schließlich werde der Finanzierungsbedarf von Pflegeleistungen angesichts einer alternden Gesellschaft in den kommenden Jahren noch zunehmen. „Vor diesem Hintergrund brauchen wir eine Auseinandersetzung darüber, ob und in welcher Höhe die Pflegeversicherung einen steuerfinanzierten Bundeszuschuss erhalten sollte.“ Das würde die solidarische Finanzierungsbasis der Pflege deutlich vergrößern und die bislang einseitigen Belastungen von Arbeitseinkommen verringern. Auch die mögliche Einbeziehung weiterer Einkunftsarten, insbesondere mit Blick auf Kapitaleinkommen, sollte kein Tabu sein, hieß es.
Bad Kreuznach (epd). Die Stiftung kreuznacher diakonie berichtet von guten Erfahrungen mit ihrem Modell der „TeleHebamme bei der digitalen Sprechstunde“. Das in der Hunsrück Klinik erprobte Verfahren bietet Schwangeren über drei Monate kostenlose Beratungen an. Über Telefon und Videochat stehen die Hebammen mit Mutter, Baby und manchmal auch dem Vater in Kontakt und beraten zu Themen wie Stillen, Ernährung, Gewicht, Bauchweh oder Babyschlaf, aber auch zur Rückbildung und Beckenbodentraining. Und: Die TeleHebamme kooperiert mit den Frühen Hilfen und vermitteln bei Bedarf auch weitere professionelle Unterstützungsangebote.
2021 wurde das Projekt ins Leben gerufe, das sich an Frauen wendet, die nach der Geburt keine aufsuchende Hebamme finden können. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden 140 Familien von den examinierten Hebammen Annika Frank und Katharina Maucher begleitet.
Beide sind sich der problematischen Situation bewusst, wenn Familien auf dem Land keine Hebamme für die Nachsorge finden: „Jede fünfte Frau ist betroffen und die Tendenz ist steigend. Gerade in ländlichen Gebieten kann eine Hebamme wegen größerer Entfernungen und langer Fahrstrecken weniger Familien betreuen. Rund 30 Prozent der Frauen blieben in den letzten Jahren in der Hunsrück Klinik nach der Geburt ohne Nachsorge-Hebamme. Eine umfangreiche Betreuung und Beratung ist aber für Frauen im Wochenbett sehr wichtig.“ Hier setze die TeleHebamme an. Mehrmals wöchentlich gibt es Sprechstunden. Dazwischen stehen die Hebammen per E-Mail oder Telefon für Fragen zur Verfügung.
Gefördert wird das Projekt aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz. Es läuft am 30. Juni in dieser Form aus. Jetzt läuft die wissenschaftliche Evaluation, die bis zum 1. Juni 2023 abgeschlossen sein soll.

Erfurt (epd). Die „freiwillige“ Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld kann für Arbeitgeber schnell zur Pflicht werden. Auch wenn die Zahlung solcher Sonderzuwendungen laut Arbeitsvertrag freiwillig sein und keinen „Rechtsanspruch für die Zukunft begründen“ soll, kann aus der regelmäßigen Zahlung dennoch ein gewohnheitsrechtlicher Anspruch entstehen, entschied das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt in einem am 17. April veröffentlichten Urteil.
Das betriebliche Gewohnheitsrecht wird als „betriebliche Übung“ bezeichnet und führt zu einem vertragsähnlichen Anspruch der Arbeitnehmer. Diesem Anspruch können Arbeitgeber indes entgehen, indem sie deutlich machen, dass etwa eine gezahlte Sonderzuwendung tatsächlich nur einmalig und freiwillig erfolgt ist. Das zu formulieren ist aber gar nicht immer so einfach.
Im Streitfall war der Kläger seit Mitte Juli 2014 in einem Unternehmen im Raum Villingen-Schwenningen beschäftigt. Laut seinem Arbeitsvertrag steht die Zahlung von Sonderzuwendungen, insbesondere Weihnachts- und Urlaubsgeld, „im freien Ermessen des Arbeitgebers und begründet keinen Rechtsanspruch für die Zukunft“.
In den Jahren 2015 bis 2019 zahlte der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern ohne weitere Erklärung jährlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld. 2019 erhielt der Kläger insgesamt rund 3.000 Euro brutto. Ein Jahr später gab es wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten keine Zuwendungen mehr.
Der Kläger meinte, dass ihm das Geld dennoch zustehe. Durch die wiederholte Zahlung über mehrere Jahre sei eine betriebliche Übung entstanden, so dass er nun einen Rechtsanspruch darauf habe. Der Freiwilligkeitsvorbehalt im Arbeitsvertrag sei unwirksam, so die Argumentation. Der Arbeitgeber vertrat dagegen die Auffassung, die Vertragsklausel der Freiwilligkeit sei wirksam und habe das Entstehen einer betrieblichen Übung verhindert.
Das BAG gab dem Kläger recht. Er habe Anspruch auf die Zahlung. Wiederhole ein Arbeitgeber regelmäßig eine bestimmte Verhaltensweise, könne eine „betriebliche Übung“ entstehen. Der Arbeitnehmer könne daraus verbindlich schließen, dass der Arbeitgeber ihm bestimmte Leistungen dauerhaft auch für die Zukunft gewähren wolle. So liege eine betriebliche Übung vor, wenn der Arbeitgeber mindestens dreimal vorbehaltlos eine Gratifikation an die gesamte Belegschaft gezahlt habe. Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Arbeitgeber weitere Zahlungen für die Zukunft eindeutig ausgeschlossen habe.
Eine betriebliche Übung liege im Streitfall vor, auch wenn die über Jahre gezahlten Beträge unterschiedlich hoch gewesen seien. Zwar hatte der Arbeitgeber im Arbeitsvertrag auf die Freiwilligkeit der Zahlung hingewiesen. Das sei jedoch unwirksam, befand das BAG. Denn mit der arbeitsvertraglichen Klausel schließe der Arbeitgeber Ansprüche generell aus, und zwar auch dann, wenn mit dem Arbeitnehmer später Individualvereinbarungen über Sonderzuwendungen getroffen werden. Künftige Individualvereinbarungen müssten aber möglich sein. Wegen der Unwirksamkeit der Klausel liegen eine betriebliche Übung und ein Anspruch auf die Sonderzahlung vor.
Bereits am 20. Februar 2013 hatte das BAG einem Arbeitnehmer ebenfalls Urlaubs- und Weihnachtsgeld wegen des Bestehens einer betrieblichen Übung zugesprochen. Hier hatte der Arbeitgeber einerseits im Arbeitsvertrag auf die Freiwilligkeit der Zahlung hingewiesen und darauf dass auch für die Zukunft kein Rechtsanspruch besteht, andererseits wurde die Sonderzuwendung laut Arbeitsvertrag „gewährt“. Das sei als feste Zusage zu verstehen, so das BAG. Wegen der Widersprüchlichkeit sei die Arbeitsvertragsklausel unwirksam.
Az.: 10 AZR 109/22 (Bundesarbeitsgericht Freiwilligkeitsklausel)
Az.: 10 AZR 177/12 (Bundesarbeitsgericht „gewährtes“ Weihnachtsgeld)
München (epd). Der Verkauf einer Haushälfte wegen einer Ehescheidung kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Steuerpflicht nach sich ziehen. Ein in Trennung lebender Ehepartner muss Einkommenssteuer zahlen, wenn die Immobilie innerhalb von zehn Jahren angeschafft und wieder verkauft wird und er nicht mehr dort wohnt, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am 13. April veröffentlichten Urteil. Das gelte auch für den Verkauf eines nur „hälftigen Miteigentumsanteils“, der im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung nach einer Ehescheidung von einem Miteigentümer an den anderen veräußert werde.
Im Streitfall hatten der aus Bayern stammende Kläger und seine frühere Ehefrau 2008 ein Einfamilienhaus gekauft und dort mit dem gemeinsamen Kind gelebt. Als die Ehe in die Krise geriet, zog der Ehemann 2015 aus. Anschließend wurde die Ehe geschieden. Während des Scheidungsverfahrens stritt sich das Paar um die Vermögensaufteilung. Als die Ehefrau dem Kläger die Versteigerung des Hauses androhte, verkaufte dieser im Jahr 2017 seinen Anteil an dem Haus an seine Ex. Diese bewohnte weiterhin zusammen mit dem Kind das Haus.
Als der geschiedene Ehemann seine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2017 abgab, forderte das Finanzamt Einkommenssteuer. Der Gewinn aus dem Verkauf des Miteigentumsanteil unterfalle der Einkommenssteuer. Dagegen klagte der Mann, doch sowohl eine Vorinstanz als auch die obersten Finanzrichter gaben dem Finanzamt recht.
Es handele sich um ein „steuerpflichtiges privates Veräußerungsgeschäft“. Der verkaufende Ex-Partner hätte „durchgängig zwischen Anschaffung und Veräußerung oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren“ im Haus wohnen müssen, um der Besteuerung zu entgehen. Da der Kläger jedoch ausgezogen sei, sei Einkommenssteuer fällig.
Eine Zwangslage, wie beispielsweise bei einer Enteignung oder einer Zwangsversteigerung, sah der BFH nicht. Zwar habe die geschiedene Ehefrau ihren Ex-Partner „erheblich unter Druck gesetzt“. Letztlich habe dieser aber seinen Anteil an dem Einfamilienhaus an seine geschiedene Frau freiwillig veräußert, hieß es.
Az.: IX R 11/21
Saarbrücken (epd). Eltern können für ihr Kind ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bedingungslos einen wohnortnahen Betreuungsplatz in einer Kita beanspruchen. Sie müssen auch nicht explizit nachweisen, dass sie auf den Betreuungsplatz besonders angewiesen sind, entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes in einem in Saarbrücken jetzt veröffentlichten Beschluss vom 22. März. Der Betreuungsplatz dürfe auch nicht von bestehenden Kapazitäten abhängig gemacht werden, befand das Gericht.
Geklagt hatten die Eltern zweier im Mai 2020 und im Oktober 2021 geborener Kinder. Sie hatten bei ihrer Kommune einen wohnortnahen Kita-Platz spätestens ab Oktober 2022 von täglich 6.30 Uhr bis 15.30 Uhr beantragt. Dem Antrag hatten sie noch Absagen mehrerer Kitas beigelegt. Sie seien jedoch auf den Kita-Platz angewiesen. Der Vater gab an, Vollzeit in einer Firma in Saarbrücken zu arbeiten, die Mutter wollte nach der Elternzeit wieder ihre Stelle im OP-Bereich eines Kreiskrankenhauses antreten. Die Kommune stellte jedoch keine Kita-Plätze zur Verfügung. Es gebe nicht genügend Plätze, hieß es zur Begründung.
Auch das Verwaltungsgericht lehnte den Eilantrag auf Zuweisung eines Krippenplatzes ab. So eilig scheine die Sache nicht zu sein, weil die Mutter zwischenzeitlich ihre Elternzeit bis zum 31. August 2023 verlängert habe, entschied das Gericht. Es sei „nicht ansatzweise glaubhaft gemacht“ worden, dass die Betreuungsplätze tatsächlich dringend benötigt würden.
Die dagegen beim OVG eingelegte Beschwerde hatte indes Erfolg. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz sei „unbedingt ausgestaltet“, so das Gericht. Dass Eltern darauf angewiesen sein müssen, sei nicht erforderlich. Nach dem Gesetz hätten Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.
Der Anspruch auf einen Kita-Platz dürfe auch nicht wegen fehlender Kapazitäten verwehrt werden. Denn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe müsse schlicht gewährleisten, dass vor Ort genügend Angebote an Fördermöglichkeiten in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bestehen.
Hier sei auch Eilbedürftigkeit gegeben. Denn es sei den Eltern nicht zuzumuten, dass sie bis zur Entscheidung in der Hauptsache mehrere Monate abwarten. Zudem habe die Mutter ihre Elternzeit nur vorsorglich für den Fall verlängert, das ihr tatsächlich kein Betreuungsplatzt zugewiesen werde.
Auch die Betreuungszeiten könnten die Eltern frei wählen, entschied das OVG. Das Gesetz sehe keine zeitliche Begrenzung vor. Hier könnten die Eltern aber nur eine Betreuung ab 7.00 Uhr verlangen, da ab diesem Zeitpunkt erst die Kitas regelmäßig öffnen.
Az.: 2 B 10/23
Dortmund (epd). Auch erheblich pflegebedürftige Sozialhilfebezieher können keine Beihilfe für einen Wäschetrockner beanspruchen. Auch wenn pflegebedingt besonders viel Wäsche anfällt, ist es den Betroffenen zuzumuten, diese im Trockenkeller oder auf einer zur Wohnung gehörenden Terrasse zu trocknen, entschied das Sozialgericht Dortmund in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 25. Januar.
Die bettlägerige und pflegebedürftige Klägerin mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 100 bezieht eine kleine Rente und zusammen mit ihrem ebenfalls schwerbehinderten Ehemann 901 Euro Pflegegeld. Sie sind ergänzend auf Sozialhilfeleistungen angewiesen.
Die Frau beantragte beim Sozialhilfeträger eine einmalige Beihilfe in Höhe von 600 Euro für die Anschaffung eines Wäschetrockners. Sie schwitze stark, werde über eine Sonde ernährt und sei auf Abführmittel angewiesen, so die bettlägerige Frau. Dadurch habe sie einen erhöhten Wäschebedarf. An heißen Tagen müsse sie aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit bis zu fünf Maschinen Wäsche waschen, die sie nicht richtig trocknen könne. Im Trockenkeller trockne die Wäsche nur sehr langsam.
Sowohl der Sozialhilfeträger als auch das Sozialgericht lehnten den Antrag jedoch ab. Ein Wäschetrockner sei für eine „geordnete Haushaltsführung“ nicht erforderlich, heißt es in dem Urteil. Die Sozialhilfe müsse im Rahmen der Erstausstattung nur notwendige Haushaltsgeräte wie Herd, Kochtöpfe, Staubsauger, Bügeleisen und Kühlschrank finanzieren.
Zwar habe die Klägerin wegen ihrer erheblichen Pflegebedürftigkeit einen erhöhten Wasch- und damit Trocknungsbedarf. Es sei ihr aber zuzumuten, ihre Wäsche im Trockenkeller und auf der Terrasse zu trocknen. Außerdem könne sie sich einen Wäschetrockner aus dem Regelsatz ansparen oder auch aus dem Pflegegeld finanzieren. Der Sozialhilfeträger habe ihr auch ein Darlehen für die Anschaffung angeboten, so das Gericht.
Az.: S 43 SO 169/21
Bonn (epd). Die Einstellung und Versetzung von Schul- und Kita-Assistenten kann auch in einem überwiegend karitativ tätigen Unternehmen mitbestimmungspflichtig sein. Können die Beschäftigten nur in geringem Umfang frei über Hilfemaßnahmen für die betreuten Kinder selbstständig entscheiden, darf die Arbeitgeberin sie nicht als sogenannte „Tendenzträger“ einstufen, für die das Betriebsverfassungsgericht und damit die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats nicht gelten, entschied das Arbeitsgericht Bonn in einem kürzlich veröffentlichten Beschluss vom 5. Januar.
Im Streitfall ging es um einen Träger von ambulanten Teil- und vollstationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Der bietet auch Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe an. Rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in Kita und Schule insbesondere als fachliche beziehungsweise reguläre Integrationsassistenten eingestellt.
Der Arbeitgeber entschied ohne Zustimmung des Betriebsrats, wer dafür eingestellt oder versetzt wurde. Er berief sich darauf, dass er wegen seiner überwiegend karitativen Tätigkeit als sogenannter Tendenzbetrieb gelte. Die Mitbestimmungspflicht nach dem Betriebsverfassungsgesetz gelte dann nicht für Arbeitnehmer, die als „Tendenzträger“ den karitativen Zweck des Unternehmens eigenverantwortlich umsetzen. Das sei bei den Kita- und Schulassistenten der Fall, so die Begründung.
Der Betriebsrat sah sich dadurch in seinen Mitbestimmungsrechten verletzt. Der Arbeitgeber hätte ihn bei der Einstellung und Versetzung der Kita- und Schulassistenten beteiligen müssen. Er legte eine Liste von knapp 60 namentlich genannten Beschäftigten vor, bei denen er eine Verletzung der Mitbestimmungspflicht geltend machte.
Das Arbeitsgericht entschied, dass es sich bei dem Unternehmen zwar um einen Tendenzbetrieb handele. Eine Mitbestimmungspflicht bestehe dann nicht für die Einstellung oder Versetzung von Arbeitnehmern, die als Tendenzträger den karitativen Zweck des Unternehmens eigenverantwortlich und selbstständig erfüllen.
Das sei hier aber nicht der Fall, so die Bonner Richter, die deshalb die Mitbestimmungspflicht des Betriebsrats als verletzt ansahen. Denn die Kita- und Schulassistenten könnten nur in enger Abstimmung mit den jeweiligen Gesamt-, Hilfe- und Teilhabeplänen sowie mit den jeweiligen Lehrern die Hilfemaßnahmen für die betreuten Kinder umsetzen. Sie könnten daher nicht „im Wesentlichen frei über die Aufgabenerledigung entscheiden“ und seien bei der Umsetzung der vom Arbeitgeber verfolgten Tendenz weisungsgebunden.
Az.: 3 BV 96/22

München (epd). Der Augsburger Diözesan-Caritasdirektor Andreas Magg (53) ist zum künftigen Landes-Caritasdirektor in Bayern gewählt worden. Er ist Direktor und geschäftsführender Vorstand des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg.
Magg übernimmt die Nachfolge von Prälat Bernhard Piendl (69), der in den Ruhestand geht. Der hatte das Führungsamt seit Januar 2012 inne. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagte Magg.
Magg wurde in Augsburg geboren und im Mai 2000 zum Priester geweiht. Vor seinem Studium der katholischen Theologie hatte er von 1986 bis 1989 die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK gemacht. 1993 holte er das Abitur nach, um Priester werden zu können.
Nach der Priesterweihe folgten jeweils zwei Jahre als Kaplan zunächst in Augsburg-Pfersee und dann in Ursberg, der Heimat des Dominikus-Ringeisen-Werkes für Menschen mit Behinderungen. Von 2004 an war er dort Pfarrer. Gleichzeitig promovierte er 2008 über den Gründer des Werks Dominikus Ringeisen (1835-1904).
2007 wechselte er zum Caritasverband für die Diözese Augsburg und wirkte dort zunächst als Assistent seines Amtsvorgängers Prälat Peter C. Manz. In dieser Zeit studierte er gleichzeitig an der Hochschule Ravensburg-Weingarten „Business Administration“ für Sozialmanagement und schloss das Zusatzstudium 2009 mit dem Master ab. Seit 2011 ist Magg Diözesan-Caritasdirektor. 2014 wurde er vom früheren Augsburger Diözesan-Bischof Konrad Zdarsa zum Domkapitular im Domkapitel des Bistums Augsburg bestellt. Seitdem leitete er auch die Hauptabteilung Caritas - Soziale Dienste des Bischöflichen Ordinariates.
Gabriele Britz hat das Bundesverfassungsgericht verlassen. Sie erhielt am 17. April von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Entlassungsurkunde ausgehändigt. Sie scheidet nach Ablauf ihrer zwölfjährigen Amtszeit aus dem Dienst. Für ihre Verdienste erhielt die Juristin aus den Händen von Steinmeier das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Professorin für Öffentliches Recht und Europarecht wurde im Dezember 2010 durch den Bundesrat zum Mitglied des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts gewählt. Seit 2001 ist sie Professorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ihre Nachfolgerin in Karlsruhe ist Miriam Meßling (50). Damit bleibt das Gericht auch künftig von acht Frauen und acht Männern besetzt.
Martin Winterberg (60), Pfarrer, wird neuer Leiter des Diakonischen Werks Duisburg. Winterberg übernimmt sein Amt im Juni. Der Theologe, der vom Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises mit der Leitung betraut wurde, wird die sozialpolitische Vertretung gegenüber Politik, Bürgerschaft und Öffentlichkeit übernehmen. Zudem fungiert er als Sprecher der Wohlfahrtsverbände in Duisburg und wird engen Kontakt zur Ökumenischen Bahnhofsmission halten, deren evangelischen Teil er mitverantwortet. Außerdem soll der neue Geschäftsführer diakonische Projekte initiieren und begleiten und als Bindeglied zwischen diakonischen Einrichtungen und Werken und dem Kirchenkreis wirken.
Sabine Lindau ist am 17. April als Vorständin des Diakonischen Werks Bayern verabschiedet worden. Die 1966 geborene Theologin und Betriebswirtin war seit Sommer 2020 Vorstandsmitglied des Verbandes und wird zukünftig eine Aufgabe im württembergischen Raum übernehmen. Der Vorsitzende des Diakonischen Rats, Pfarrer Jochen Keßler-Rosa, würdigte ihr großes Engagement, vor allem im Bereich der Migration: „Hier hat sich Sabine Lindau unermüdlich und mit Erfolg für eine angemessene Finanzierung eingesetzt.“ Sie war zuvor Geschäftsführerin der Münchner Bezirksstelle der Diakonie Bayern und Mitglied der Leitungskonferenz der Inneren Mission. Davor war sie knapp 20 Jahre in verschiedenen Funktionen bei der Inneren Mission München (heute Diakonie München und Oberbayern) tätig. Im Vorstand des DW Bayern verantwortete sie die Bereiche Integration, Migration und Flüchtlingshilfe sowie Kinder, Jugendliche, Familien und Frauen.
Michael Schmitt übernimmt im Mai die Geschäftsführung der Vinzenzkrankenhaus Hannover GmbH sowie des angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ). Das hat der Personalausschuss des Aufsichtsrates des Elisabeth Vinzenz Verbundes (EVV) beschlossen. Schmitt folgt auf Stefan Fischer, der das Haus seit November 2022 interimsweise führt. Er war zuletzt für die Ameos-Gruppe tätig und hat auf seinen bisherigen Stationen sowohl kommunale und freigemeinnützige als auch private Träger kennengelernt. In Hannover war er von 2008 bis 2014 als Kaufmännischer Geschäftsführer für ein Haus der Diakovere tätig und kennt daher die Besonderheiten einer Klinik mit christlichen Wurzeln sowie die Kliniklandschaft in und um Hannover. Das Vinzenzkrankenhaus hat 345 Planbetten in sieben Fachabteilungen und versorgt im Jahr mehr als 40.000 Patienten stationär und ambulant.
Werner Strube (65), seit 2013 Leiter des Bereichs Soziale Arbeit, ist nach 40 Jahren im Dienst der Caritas Rottenburg-Stuttgart in den Ruhestand verabschiedet worden. Als Referent für Behindertenhilfe, Leiter des Fachbereichs „Besondere Lebenslagen und Teilhabe“, stellvertretender Leiter des Kompetenzzentrums Sozialpolitik und als Leiter des Bereichs Soziale Arbeit habe derMünchner „ein unglaublich breites Spektrum an Aufgaben übernommen und diese unermüdlich durch seine hohe Expertise ausgefüllt“, würdigte Direktorin Annette Holuscha-Uhlenbrock sein langjähriges Engagement. Er habe die Entwicklung der Behindertenhilfe maßgeblich mitgeprägt. Strubes Nachfolge tritt am 1. Mai Olaf Kierstein-Hartmann (53) an. Der studierte Sozialpädagoge war zuletzt Geschäftsführer beim Baden-Württembergischen Handwerkstag.
Olaf Petzold, Mitglied der Geschäftsleitung im Diakoniewerk Simeon und Vorstand des Ev. Kirchenkreisverbandes Süd, geht zum Monatsende in den Ruhestand. 45 Jahre lang war Petzold in Neukölln im Dienst der Kirche tätig. 27 Jahre lang war er in der Magdalenengemeinde für die Jugendarbeit zuständig. 2005 wurde Petzold Geschäftsführer der Kindertagesstätten im Kirchenkreis Neukölln. Seit 2015 ist er Vorstand des Kirchenkreisverbandes Süd. Darüber hinaus ist er seit 2019 Mitglied der Geschäftsleitung des Diakoniewerks Simeon.
26.-27.4.:
Seminar „SystemsprengerInnen - Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 05251/2908-38
27.4.:
Webinar „Wie lebendige Netzwerkarbeit Ihren Spendenerfolg erhöht“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/98817-159
27.4.-2.5.:
Online-Fortbildung: „Einstieg ins Gemeinwesen: Grundlagen, Handlungsfelder, Methodenkoffer“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 0173/5105498
Mai
9.5.:
Online-Seminar „Einstieg in die Welt der öffentlichen Fördermittel - EU, Bund, Länder und Kommune“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/98817-159
9.-23.5.:
Online-Kurs: „Aufgaben und Pflichten ehrenamtlicher Aufsichtsräte“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-10
10.-12.5. Freiburg:
Seminar „Wenn das Miteinander zur Herausforderung wird - Fach- und Führungskräfte als Vermittelnde bei Konflikt und Mobbing“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700
11.5. München:
Seminar „Datenschutz im Gesundheitswesen“
der Unternehmensbeartung Solidaris
Tel.: 0251/48261-194
12.5. Berlin:
Seminar „Gefunden. Gebunden! Trends und Praxis in der Mitarbeiter:innen-Bindung“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/275828221
22.5.:
Online-Seminar „Die Dublin-III-Verordnung - Eine Einführung“
Tel.: 030/26309-139
23.-25.5.:
Fortbildung: „Aufsuchen statt Abwarten - Grundlagen Streetwork“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495