 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 43/2022 - 28.10.2022
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 43/2022 - 28.10.2022
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 43/2022 - 28.10.2022
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 43/2022 - 28.10.2022

Rekordpreise für Energie und zugleich immer heißere Sommer: Pflegeheime sind im Zugzwang, schnell klimaneutral zu werden. Etwa durch die energetische Sanierung von in die Jahre gekommenen Gebäuden. Das ist eine Mammutaufgabe, die viel Geld kostet. Doch Modernisierungen sind alternativlos. Einer zeigt, wie es funktioniert: Klaus Tschentscher, Geschäftsführer des diakonischen Seniorenzentrums Wolfhagen. Er plant für mehrere Millionen Euro eine komplette Sanierung samt neuer Heizung. Ein Interview über zurückhaltende Banken, fehlende Zuschüsse sowie steigende Zinsen und Baukosten.
Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan kam Mitte der 50er Jahre auf den Markt, rezeptfrei. Tausende Schwangere nahmen es, ihre Kinder wurden mit schwersten Fehlbildungen geboren. Vor 50 Jahren wurde zur Unterstützung der Opfer die Conterganstiftung gegründet. Sie hilft derzeit rund 2.500 Opfern des Arzneimittelskandals.
Die Ampel will den Cannabiskonsum legalisieren. Erste Eckpunkte liegen vor. Einige Mediziner sind skeptisch, Gesundheitsminister Lauterbach war es auch. Doch jetzt sagt er, damit würden der Schwarzmarkt zurückgedrängt und die Qualität von Cannabis kontrolliert. Das sei ein Fortschritt für den Gesundheits- sowie Kinder- und Jugendschutz. Doch Zweifel bleiben.
Eine Umfrage zeigt: Viele Jobcenter sind nicht gut erreichbar. Das hat Folgen, denn dadurch verschärfen sich die Probleme der Hilfesuchenden. Nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die die Umfrage in Auftrag gab, beobachten gut 60 Prozent der befragten Beratungsstellen, dass Hilfesuchende wegen der schweren Erreichbarkeit ihres Jobcenters Leistungen zu spät oder gar nicht gezahlt bekommen.
Lesen Sie täglich auf dem Twitter-Account von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf Twitter können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern lese ich auch Ihre E-Mail.
Dirk Baas

Frankfurt a.M. (epd). Wer durch den hellen Flur im Pflegeheim St. Michael in Schwalmtal-Waldniel im Caritas-Verband Aachen geht, kann den Beitrag des Hauses zum Klimaschutz schwerlich übersehen. Im hellen Flur hängt ein großer Flachbildschirm. Der zeigt einen überdimensionalen Stromzähler vor einem Dach voller Solarzellen. Dank 254 Solarpaneelen erzeugt das Heim für 80 Bewohner im Durchschnitt zwei Drittel seines Strombedarfes seit Ende 2021 selbst. Der Monitor zeigt, wie viel Saft die Photovoltaikanlage bereits geliefert hat - zum Wohle der Umwelt.
Fast 100.000 Euro hat die Caritas in die neue Technik investiert, die sich in sechs Jahren amortisiert haben soll. „Wir freuen uns, dass wir damit zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit beitragen können“, sagt Caritas-Vorstand Peter Babinetz.
In Wolfhagen in Nordhessen denkt man größer. Im Seniorenzentrum Wolfhagen, das zur Diakonie gehört, plant Geschäftsführer Klaus Tschentscher die energetische Sanierung des Heimgebäudes, das in den ältesten Teilen aus dem Jahr 1966 stammt. Drei Millionen Euro waren ursprünglich für die Dämmung von Wänden und Dach, für neue Fenster und Türen sowie für eine andere Heiztechnik kalkuliert, doch Inflation, höhere Zinsen und rasant gestiegene Baukosten werden dazu führen, dass das Projekt deutlich teurer wird.
Aber, sagt der Heimleiter dem epd sozial: „Die Sache ist alternativlos. Wir können nicht weiter Unsummen an Heizkosten bezahlen. Das ist langfristig zu teuer - sowohl für uns als auch für die Umwelt.“ Das ambitionierte Projekt muss allein durch KfW-Darlehen und Zuschüsse sowie durch eine Bank finanziert werden. Nur wenig Eigenmittel seien vorhanden, so Tschentscher - ein Grundproblem für viele gemeinnützige Träger. Zuschüsse von Bund oder Land? Fehlanzeige. „Abreißen und neu bauen, das wäre eine Alternative. Dann bräuchte ich aber mindestens 30 Millionen Euro. Und die habe ich nicht. Also geht es darum, den Altbau fit für die Zukunft zu machen“, so der Geschäftsführer.
Beide Projekte zeigen, dass die Branche längst begonnen hat, ihre betagten Immobilien für die Zukunft fit zu machen. Doch es sind oft nur isolierte einzelne Maßnahmen, die vor allem einen Vorteil haben: Sie sind bezahlbar, etwa energiesparende LED-Lampen zu nutzen, über Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder die Beleuchtung zu optimieren oder „kluge“ Thermostate an Heizkörpern zu montieren. Sinnvolle erste Schritte, so viel ist klar, die jedoch nichts an der gewaltigen Aufgabe ändern, Tausende von Altbauten zu dämmen, Wärmeschutzfenster einzubauen oder alternative Energiekonzepte zu realisieren.
Die Caritas als größter deutscher Wohlfahrtsverband hat beschlossen, bis 2030 klimaneutral zu sein. Sie ist an bundesweit 25.000 Standorten aktiv. Doch längst nicht überall wurden trotz unmissverständlicher Vorgaben aus dem Dachverband „die Veränderungstiefe sowie die erforderliche Geschwindigkeit hin zur Klimaneutralität erkannt“, heißt es in einem Artikel in der Fachzeitschrift „neue caritas“. Das dürfte sich jetzt ändern, sind sich die Expertinnen und Experten einig. Denn heißere Sommer mit Temperaturen über 40 Grad in Kombination mit explodierenden Energiepreisen als Folge des Krieges in der Ukraine sind wie ein Menetekel an der Wand.
Auch der Druck durch die Politik steigt. Die EU will bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein. Dazu müssen Unternehmen gemäß der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2024 detaillierte Informationen und Kennziffern zur Nachhaltigkeit vorlegen - anfangs nur große Firmen, doch ab 2026 werden davon auch viele Träger aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft betroffen sein.
Der Knackpunkt: Ohne diese Berichte gibt es am Kapitalmarkt kein oder nur teures Geld für Modernisierung oder Neubauten - ein kaum zu überschätzendes Problem, denn viel Eigenkapital haben gemeinnützige Träger in aller Regel nicht. „Der Kapitalmarkt wird zum Hebel für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele“ betont die Leiterin der Projektberatung Sozialimmobilien bei der BFS Service GmbH, Anja Mandelkow.
Auch Sozialverbände erhöhen den Transformationsdruck auf ihre Mitglieder, sich an den beschlossenen Klimazielen zu orientieren. So will die Diakonie mit ihren rund 5.000 Rechtsträgern bis zum Jahr 2035 und die Arbeiterwohlfahrt bis 2040 klimaneutral sein.
Blickt man isoliert auf die Pflegeheime, so wird überraschend deutlich, dass hier ein großes Potenzial zum Sparen von CO2 besteht. Nach Angaben aus dem Bundeswirtschaftsministerium liegen die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Pflegeplatz in einem Heim bei etwa 7,4 Tonnen im Jahr - und das Einsparpotenzial beträgt rund 15 Prozent davon. Durch Modernisierungen in sämtlichen Heimen könnten also mehr als 900.000 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden, so das Ministerium.
„Erfahrungsgemäß lassen sich etwa eine Einsparung von zehn Prozent der Energiekosten durch organisatorische und etwa 25 Prozent durch investive Maßnahmen wie zum Beispiel die Gebäudesanierung erreichen“, so Michael Vötsch, Vorstand bei der KATE Umwelt und Entwicklung in Stuttgart, dessen Unternehmen Diakonie und Caritas bei deren Projekt „Klimaschutz“ begleitet.
Ob und welche Maßnahmen für eine Einrichtung möglich und sinnvoll sind, muss professionell ermittelt werden. Stichwort Klimamanagement. Auch hier liegt laut Experten noch viel im Argen. Fest steht: Ohne eine grundlegende Analyse, einen systematischen Ansatz, wie das Ziel der Klimaneutralität erreichbar ist, ohne personelle Verantwortlichkeit für die Umsetzung und das stete Controlling seien die hochgesteckten Ziele kaum erreichbar.
Bleibt die Kernfrage der Finanzierung, um beim Klimaschutz voranzukommen. Hier sehen die Sozialverbände eindeutig die Politik in der Verantwortung: „Wünschenswert für die Träger der Langzeitpflege sind gezielte Förderungen von energetischen Maßnahmen, die zum Beispiel als dauerhaft und niederschwellig abrufbare Gelder in den Kommunen zur Verfügung stehen“, sagt Eva-Maria Güthoff, Vorsitzende des Verbandes katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD). Die Träger von Pflegeeinrichtungen bräuchten Sicherheit über die Finanzierung der nötigen Investitionen.
„Die vom Bund zur Verfügung gestellten Gelder für Klimaanpassungen im sozialen Sektor in Höhe von 15 Millionen Euro pro Jahr bis 2026 stehen in keinem Verhältnis zu den Bedarfen“, mahnt die Verbandschefin: „Die fehlende Planungssicherheit darf nicht zum Investitionshemmnis für den dringend notwendigen Klimaschutz werden.“
Das sieht auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der diakonischen Dienstgeber in Deutschland (VdDD), Christian Dopheide, so. Die diakonischen Unternehmen stünden zwar längst bereit, den Umstieg auf eine nachhaltige Wirtschaftsweise mitzugestalten. „Der Gesetzgeber muss dafür aber geeignete Rahmenbedingungen schaffen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Refinanzierung der nötigen Investitionen.“
Das Problem der Refinanzierung bestätigt auch die Diakonie Hessen. Sie sei der Grund, warum sich bisher nur wenige Einrichtungen auf den Weg zur Klimaneutralität gemacht hätten. Weil sie kaum Eigenmittel hätten und nicht sicher sein könnten, dass sie die Kosten durch den Investitionssatz refinanziert bekommen, scheuten sie sich davor, umfassend zu modernisieren. „Die steigenden Zinsen tun ihr Übriges. Aus diesem Grund haben große Teile der Einrichtungen mit älteren Baujahren einen Sanierungs- und Investitionsstau“, heißt es auf Anfrage.
Dazu kommen erschwerend die aktuellen Preisanstiege bei der Energieversorgung. In einer Umfrage der BFS Service GmbH gaben rund die Hälfte der über 1.000 Befragten an, dass Projekte aus den Bereichen Nachhaltigkeit und Immobilien gestoppt oder gänzlich abgebrochen werden mussten. Damit lägen dringend notwendige energetische Sanierungen von Bestandsbauten auf Eis.
„Träger und Organisationen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft wollen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Deutschland seine Nachhaltigkeitsziele erreicht“, unterstreicht Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Bank für Sozialwirtschaft, die die Erhebung in Auftrag gegeben hat. Dazu bedürfe es eines Investitionsspielraums, der jedoch in weite Ferne rücke, wenn die Einrichtungen nicht kostendeckend arbeiten könnten.
Völlig untätig ist die Bundesregierung beim Anschieben des Klimaschutzes jedoch nicht. 2020 hat das Bundesumweltministerium das Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“ mit einem Volumen von 150 Millionen Euro aufgelegt. Doch große Geldsummen gibt es hier in der Regel nicht. „Gefördert werden sowohl strategische Beratungsleistungen und die Erstellung umfassender Konzepte als auch investive Maßnahmen und Informationskampagnen und Bildungsangebote zur Anpassung an den Klimawandel in sozialen Einrichtungen“, so die zuständige Zukunft Umwelt Gesellschaft (ZUG) gGmbH in Berlin.
Die Resonanz auf das Förderprogramm sei enorm gewesen, berichtet das Ministerium. 2021 wurden 192 Anträge bewilligt. Und weil der Unterstützungsbedarf für Krankenhäuser, Kindergärten und Pflegestationen groß bleibe, soll das Förderprogramm nach 2023 fortgesetzt werden.
Aus gutem Grund: Der Klimawandel werde das Land noch sehr lange begleiten, betont die einstige Umweltministerin Svenja Schulze (SPD). Umso wichtiger sei es für die Sozialträger, sich für die Zukunft zu wappnen. Aber, da zeigt sich Schulze als Realistin: „Es fehlt oft die nötige Zeit, die man braucht. Es fehlt das Wissen und es fehlt das Geld.“

Wolfhagen (epd). Drei Millionen Euro für neue Fenster und Türen, Dämmung von Wänden und Dach und für eine neue Nahwärmeversorgung: Viel Geld für das Seniorenzentrum Wolfhagen mit seinen 131 Plätzen. Und ob die Summe überhaupt ausreicht, kann Klaus Tschentscher, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Wolfhagen in Nordhessen, nicht sicher sagen. Denn sowohl Zinsen wie Baupreise gehen weiter nach oben. „Die Sache ist alternativlos. Wir können nicht weiter Unsummen an Heizkosten bezahlen. Das ist langfristig zu teuer - sowohl für uns als auch für die Umwelt“, sagt Tschentscher. Die Fragen stellte Dirk Baas.
epd sozial: Die Energiepreise sind massiv gestiegen, die Sommertemperaturen erreichten Rekordhöhen. Das Mittel der Wahl für Pflegeheime heißt „energetische Sanierung“. Was haben Sie mit ihrem in die Jahre gekommenen Heim in Wolfhagen vor?
Klaus Tschentscher: Unser Ziel ist es, ein KfW-70-Haus zu werden. Vier Dinge sind es, die wir tun wollen, oder, wenn man so will, tun müssen. Geplant ist die Dämmung der Fassade, dann werden Fenster und Türen ausgetauscht, das Dach wird gedämmt und wir wollen vom Erdgas loskommen und sind mit einem Versorger im Gespräch, der uns zukünftig über ein Nahwärmenetz mit Wärmeenergie aus einer Holzhackschnitzelanlage beliefern wird. Denn klar ist auch: Das Heizen mit Erdgas ist nicht ökologisch.
epd: Sie heizen noch mit Erdgas?
Tschentscher: Ja. Eine Besonderheit gibt es aber: Die Stadtwerke betreiben hier bei uns im Keller ein Blockheizkraftwerk und produzieren so Strom, den auch wir nutzen. Aber günstiger wird das alles dadurch für uns nicht. Wir stellen den Raum zur Verfügung, das ist alles. Aber auch das ist natürlich keine nachhaltige Heizung. Unser Heim mit 131 Plätzen stammt mit seinen ältesten Teilen aus dem Jahr 1966. Im Pflegeheim befinden sich auch die Räume unseres ambulanten Pflegedienstes. Unser Angebot wird ergänzt durch ein Betreutes Wohnen im Gebäude gegenüber, aber das ist aus dem Jahr 2005. Da müssen wir nichts dran machen.
epd: Klingt nach einem ambitionierten Projekt ...
Tschentscher: Ja. Derzeit ist leider die Finanzierung noch nicht abschließend gesichert, aber wir sind zuversichtlich, dass wir für dieses sinnvolle Projekt auch die notwendigen Mittel erhalten. Problematisch dabei ist, dass die Prüfungen der Banken immer viel Zeit benötigen und dabei derzeit sowohl die Zinsen als auch die Kosten für die Baumaßnahmen steigen. Die ursprünglich veranschlagten drei Millionen Euro werden wir vermutlich nicht halten können.
epd: Sie planen schon seit über einem Jahr. Warum geht das nicht schneller?
Tschentscher: An uns liegt es nicht. Wir haben alles so schnell es ging vorbereitet. Wir haben einen Energieberater an unserer Seite, waren auch schon in Gesprächen mit den Banken wegen der Refinanzierung, aber dann hat uns die KfW ausgebremst. Sie hat ihre Zuschusspraxis geändert - zu unserem Nachteil. Das hat uns völlig überrascht, denn statt ursprünglich 40 Prozent gibt es jetzt nur noch 15 Prozent Zuschuss, aber dafür ein günstigeres KfW-Darlehen.
epd: Also geht es doch endlich voran?
Tschentscher: Ja, es geht voran. Aber ganz egal, wie die Konditionen dann am Ende des Tages im Detail aussehen, die Sache ist alterativlos. Wir können nicht weiter Unsummen an Heizkosten bezahlen. Das ist langfristig zu teuer - sowohl für uns als auch für die Umwelt.
epd: Zu Beginn des Jahres waren ja alle KfW-Förderungen ausgesetzt. Wegen hoher Nachfrage. Das hat Sie und Ihre Planung auch tangiert?
Tschentscher: Ja. Da war schon viel Unsicherheit im Spiel. Die KfW hat ja unter der alten Bundesregierung KfW-50-Häuser im Neubau gefördert. Im Prinzip ist das aber längst allgemeiner Baustandard. Und wegen der hohen Energiepreise wird heute ohnehin nach diesem Standard gebaut. Also war die Frage für den Bund und die KfW: Wieso soll das dann noch zusätzlich gefördert werden? Der Neubau ist aus meiner Sicht ohnehin nicht das Problem, sondern die vielen Altbauten, die Mietwohnungen ebenso wie die unsanierten Sozialimmobilien. Gebäude wie unser Heim. Abreißen und neu bauen, das wäre eine Alternative. Dann bräuchte ich aber mindestens 30 Millionen Euro. Und die habe ich nicht. Also geht es darum, den Altbau fit für die Zukunft zu machen.
epd: Wie ist Ihr heutiger Energieverbrauch und was soll die Sanierung an Einsparung bringen?
Tschentscher: Wir haben rund 1.000 Megawattstunden als Jahresverbrauch im Pflegeheim. Das ist schon eine Hausnummer. Davon entfallen etwa 100 Megawattstunden auf die Warmwassererzeugung und wir benötigen noch etwa 900 Megawattstunden für die Wärmeerzeugung. Laut Energieberater soll unser Verbrauch künftig um 70 Prozent niedriger sein. Wir hoffen, dass das auch so ist, denn das ist nur eine Vorausberechnung. Aber machen wir uns nichts vor: Wenn die Energiekosten weiter deutlich steigen, dann kann es für uns am Ende womöglich unter dem Strich beim Heizen noch teurer werden als vor der Sanierung.
epd: Reden wir über die Finanzierung. Woher kommt das Geld?
Tschentscher: Die Sanierung müssen wir alleine hinbekommen. Über Kredite und Zuschüsse. Es gibt weder Gelder für den klimaneutralen Umbau von der Landesregierung Hessen noch von der Landesdiakonie. Die berät und unterstützt etwa bei der Planung und hat auch Kontakte zu Experten, aber keinen eigenen Topf für Fördergelder.
epd: Also Darlehen von der KfW und von Banken?
Tschentscher: Ja, die Finanzierung läuft über die KfW. Sie gibt das Geld und legt die Konditionen fest und die Hausbank leitet das Geld an uns weiter. Die Hausbank muss also prüfen, ob wir das Geld zurückzahlen können. Wenn wir dann die Standards der KfW eingehalten haben, wird uns ein Zuschuss als eine Art Sondertilgung in Höhe von 15 Prozent gewährt. Eine Besonderheit in unserem Haus besteht darin, dass ganz formal unsere Stiftung den Umbau finanziert, weil sie Eigentümerin des Gebäudes ist. Die gemeinnützige GmbH betreibt das Seniorenzentrum und zahlt Miete an die Stiftung.
epd: Welche Rolle spielt bei der Planung und Finanzierung der Kostenträger?
Tschentscher: Der Kostenträger, das ist ein eher abstrakter Begriff. Genau genommen sind das alle Heimbewohner, die Pflegekassen und der zuständige Landkreis, also das zuständige Sozialamt. Für unsere Überlegungen zur Sanierung ist nur der sogenannte Investbetrag, also die Investitionskosten, wichtig. Dieses Geld bekommen die Heimträger für den Unterhalt des Gebäudes oder für Anschaffungen neuer technischer Anlagen. Den Investbetrag gibt es jetzt auch schon, aber da das Gebäude schon sehr alt ist, ist der Betrag auch vergleichsweise niedrig.
epd: Aber der würde doch dann steigen, wenn ihre Sanierung hoffentlich Ende 2023 beendet ist?
Tschentscher: Stimmt. Ich habe das mal ausgerechnet, denn ich wollte wissen, wie dann die Entgelte der Bewohnerinnen und Bewohner steigen. Ich möchte aber keine Ergebnisse nennen, denn das ist ja alles noch nicht spruchreif. Aber um einige Euro pro Tag wird dieser Betrag nach Abschluss der Arbeiten schon steigen. Aber man muss auch sehen, dass unsere Einrichtung an Attraktivität gewinnt und auch die heißen Sommer erträglicher werden. Aber klar, für unsere Bewohner ist das natürlich nicht schön.
epd: Kommt denn künftig auch mehr Geld vom Landkreis?
Tschentscher: Ja. Über einen dann steigenden Investbetrag. Diesen müssen dann alle Bewohnerinnen und Bewohner zahlen. Zum einen werden die Selbstzahler belastet und zum anderen tragen das die Sozialhilfeträger für die Menschen, die das nicht selbst zahlen können. Aber eben erst zeitverzögert. Erst im Jahr 2025, wenn alles abgerechnet ist, können wir bei Verhandlungen unsere Mehrkosten auf den Tisch legen. Darlehen und Tilgung müssen wir über den Investbetrag wieder reinbekommen. Anders geht es nicht. Wir haben den Landkreis auch schon vorab darüber informiert, was wir vorhaben. Da gibt es keine Bedenken, denn auch die Behörden wissen, dass man im Klimaschutz vorankommen muss.
epd: Warum ist das überhaupt ein größeres Problem, für Sanierungsprojekte an Geld zu kommen? Ein Pflegeheim, das gut ausgelastet ist und zahlende Bewohner hat, hat doch per se Bonität?
Tschentscher: Das sagen Sie. Aber die Banken schauen derzeit vermehrt auf die Risiken, die sich aus der gesamtwirtschaftlichen Situation ergeben. Die sagen nicht, tolle Sache, Altenpflegeheim, sicherer Kunde. Nein, nein. Ich habe da sehr viele betriebswirtschaftliche Auswertungen, Ergebnisvorschauen und Erläuterungen abgeben müssen. Aber wir sind in einem guten Gespräch, mir leuchtet das alles ein, was da gefordert wird. Aber es ist eben nicht mehr wie vor einem Jahr, als Geld nichts gekostet hat und die gesamtwirtschaftliche Lage entspannter war.
Berlin (epd). Der „Plan B“ wird nun doch nicht gebraucht: Nachdem das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Juli zunächst die Finanzierung für einzelne „innovative Klimaschutzprojekte“ gestrichen hatte, kam doch noch die Kehrtwende. Folglich kann nun, wenn auch mit deutlicher Verspätung, das gemeinsame Projekt „Klimaschutz in Caritas und Diakonie“ an den Start gehen. Ziel sei es, so die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände, möglichst viele ihrer Einrichtungen und Dienste klimaneutral zu machen.
Seit Ende 2020 arbeiten Caritas und Diakonie an diesem Vorhaben. Hierfür wurden vor dem zwischenzeitlichen Förderstopp bereits 100 Piloteinrichtungen ausgesucht. Das Ministerium gibt Geld für die Nationale Klimaschutzinitiative, aus der die finanzielle Förderung nun fließen soll. Die Mittel sind dazu gedacht, an den Standorten Klimaberaterinnen und -berater auszubilden und ein Klimamanagement einzuführen. Zudem sollen Handlungsleitlinien für die Bereiche Immobilien, Mobilität und Beschaffung erarbeitet sowie eine abgestimmte Klimaschutz-Strategie in Caritas und Diakonie entwickelt werden. Man setzt also auf den Multiplikatoren-Effekt.
Eigentlich sollte das dreijährige Programm schon im Sommer starten, doch noch immer ist offen, wann es wirklich losgehen kann. Christopher Bangert, Leiter des Referats Sozialwirtschaft der Caritas: „Aktuell befinden wir uns immer noch im Antragsstellungsverfahren, nachdem der Förderstopp aufgehoben worden ist. Der Ausgang und insbesondere der Starttermin ist also immer noch ungewiss. Das Projektkonzept ist unverändert.“ Er gehe davon aus, dass die meisten bereits ausgewählten Pilotstandorte dabei bleiben.
Caritas und Diakonie gehören laut Bangert zu den großen Immobiliennutzern und auch -eigentümern. „Es handelt sich überwiegend um energieintensive Gebäude, bei denen mit Modernisierungsmaßnahmen oftmals erhebliche CO2-Reduktionen und Energieeinsparungen möglich wären. Deshalb braucht es für beide Verbände einen ganzheitlichen Vorstoß, der auf die Veränderung von Bewusstsein, Strukturen, Abläufen und Finanzierungsmöglichkeiten abzielt und in die ganze verbandliche Breite wirkt.“
Beide Verbände setzen auf eine bundesweite Gesamtstrategie. Ziel sei unter anderem die Einführung eines Klimamanagements auf Einrichtungsebene. Im Projekt sollen die entsprechenden Prozesse erprobt werden, was in je 50 Einrichtungen von Caritas und Diakonie geschieht. Bangert: „Wegen der (noch) kaum vorhandenen Finanzierungsspielräume in der Regelfinanzierung von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und der anderen Einrichtungsbereiche besteht eine große Abhängigkeit von passenden Förderprogrammen.“
„Zusammen betreiben Caritas und Diakonie rund 60.000 Einrichtungen und Dienste in Deutschland, in denen geheizt, gekocht und Wäsche gewaschen wird, ambulante Pflegedienste legen Hunderttausende von Kilometern zurück und OP-Säle sind mit energieintensiven Geräten ausgestattet,“ erläutert Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Die sozialen Einrichtungen seien in doppelter Hinsicht ein ehrgeiziger Partner beim Klimaschutz. „Sie leisten nicht nur einen direkten Beitrag, um Emissionen in ihren Gebäuden und Diensten einzusparen. Sie arbeiten mit den Menschen und wirken so daran mit, die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen vor Ort zu befördern“, so der Präsident.

Remagen/Köln (epd). „Es lässt sich für alles eine Lösung finden.“ So formuliert Irmgard Wyborny ihr Lebensmotto. Die Remagenerin ist Contergangeschädigte mit verkürzten Armen - und muss über die Frage, was sie nicht allein schaffe, nachdenken. „Wenn ganz oben im Regal Bücher zu holen sind, dann brauche ich Hilfe“, antwortet die 61-Jährige dann. Wyborny arbeitet als Bibliothekarin für die Stadt Aachen. Und das mit Freude, wie sie betont.
Wyborny ist eine von rund 5.000 Betroffenen in Deutschland, die zwischen den Jahren 1956 und 1962 mit verkürzten Gliedmaßen oder geschädigten inneren Organen zur Welt kamen. Der Grund: Ihre Mütter hatten während der Schwangerschaft das damals als harmlos eingestufte Schlafmittel Contergan der Firma Grünenthal eingenommen. Erst Ende 1961 wurde das Mittel vom Markt genommen. Es war der Wirkstoff Thalidomid, der Schädigungen beim Ungeborenen hervorruft. Schon eine einzige Tablette reichte dafür aus. 40 Prozent der Kinder starben noch im Säuglingsalter.
„In den 1960er Jahren fand Inklusion nur durch Eigeninitiative statt“, blickt Wyborny auf ihre Kindheit zurück. Allein das Engagement ihrer Sonderschullehrerin habe sie davor bewahrt, in der Schullaufbahn „steckenzubleiben“: Die Pädagogin habe sie in einem kirchlichen Gymnasium untergebracht. In der Berufswahl habe man als Contergangeschädigte natürlich realistisch sein müssen, so sagt es die 61-Jährige: „Chirurgin hätte ich also nach dem Abitur nicht werden können.“ Sie studierte Bibliothekswesen. Und kann sich bis heute auf die Hilfe der bundesweiten Conterganstiftung verlassen. „Die Stiftung hat etwa durch ihre monatlichen Zahlungen viel für uns getan“, erklärt Wyborny.
Die heute dem Bundesfamilienministerium zugeordnete Stiftung mit Sitz in Köln war vor 50 Jahren, am 31. Oktober 1972, in Bonn als „Hilfswerk für behinderte Kinder“ gegründet worden. Das Stiftungskapital setzte sich zusammen aus 100 Millionen D-Mark, die die Firma Grünenthal nach einem juristischen Vergleich zahlte, und dem gleichen Betrag aus dem Bundeshaushalt. Seit 1997 erfolgt die Zahlung der vielfach erhöhten Renten komplett vom Bund. Seit der vierten Gesetzesänderung im Jahr 2017 wird der spezifische Bedarf Geschädigter durch Pauschalzahlungen gedeckt.
Der Conterganskandal sei eine Katastrophe gewesen, erklärt Dieter Hackler, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Der evangelische Theologe war bis 2014 Ministerialdirektor im Familienministerium. Aktuell sei die Stiftung für rund 2.500 Geschädigte im In- und Ausland zuständig, habe für sie eine Beratung aufgebaut und fördere bundesweit multidisziplinäre medizinische Kompetenzzentren. „Die Trauer der Betroffenen, ihre Leiden, ihre Schmerzen, ihre Verletzungen kann die Conterganstiftung jedoch nicht aufheben. Sie kann nur Ausdruck dafür sein, dass die Bundesrepublik Deutschland sich ihnen gegenüber in der Verantwortung sieht.“
Aktuell sehe die Stiftung sich durch das zunehmende Alter der Betroffenen vor neue Herausforderungen gestellt. „Auf die müssen wir reagieren“, sagt der Vorsitzende. Zum einen müsse man gewährleisten, dass die Betroffenen sachgerecht medizinisch versorgt blieben. Zum anderen dränge die Frage: „Welche Wohnformen sind im Alter für Menschen mit Einschränkungen und hohem Autonomiedenken angemessen, vor allem, wenn sie allein leben?“ Und drittens müsse eine psychosoziale Begleitung sichergestellt werden. „Zu diesen Themen berufen wir eine Expertenkommission unter Einbeziehung der Menschen mit Conterganschädigung ein.“
Zum Skandalthema von 2019, als Medien berichteten, die Conterganstiftung wolle Opfern in Brasilien die Rente streichen, erklärt Hackler: Die Stiftung sei dem Steuerzahler verpflichtet. Deshalb habe sie auch für diese 60 Betroffenen erst ein Anhörungsverfahren durchführen müssen. Er betont: „Die Conterganstiftung hat schließlich keinem Betroffenen die Rente entzogen, keine Zahlungen gekürzt oder Zuwendungen ausgesetzt.“
Seit Jahren kritisieren Opferverbände jedoch, dass die Stiftung nicht paritätisch besetzt ist. Aktuell arbeitet beispielsweise im dreiköpfigen Stiftungsvorstand nur eine Betroffene mit. Die Bundesregierung hat sich deshalb Ende 2021 in ihrem Koalitionsvertrag die „Prüfung einer Reform der Strukturen der Conterganstiftung zur Ermöglichung von mehr Mitsprache der Betroffenen“ zur Aufgabe gemacht.
Bei der Bibliothekarin Irmgard Wyborny jedenfalls ist keine Verbitterung zu spüren. „Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint“, sagt die 61-Jährige. Sie habe durch Contergan nicht wie viele andere innere Schäden davongetragen. Sie könne selbstbestimmt leben, sagt die Mutter zweier erwachsener Töchter: „Und das ist doch das Wichtigste.“
Frankfurt a.M. (epd). Die Firma Grünenthal schloss am 10. April 1970 mit den Eltern contergangeschädigter Kinder einen Vergleich, der bei Opfern sehr umstritten war. Das Unternehmen verpflichtete sich, 100 Millionen DM (51,1 Millionen Euro) für den Schadensausgleich zu bezahlen. Die betroffenen Eltern mussten im Gegenzug unterschreiben, auf sämtliche finanziellen Ansprüche gegen das Unternehmen zu verzichten. Viele Betroffene nahmen das Angebot an, auch weil der Druck hoch war, sonst womöglich ohne Zahlungen dazustehen. Das Geld floss in eine Stiftung, die unter anderem - zunächst niedrige - Renten zahlte.
Vorausgegangen war eines der größten Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik gegen führende Vertreter der Firma Grünenthal, es lief seit 1968 in Aachen vor dem Landgericht. Auf der Basis des Vergleichs wurde es im Dezember 1970 eingestellt.
Um die gerechte Verteilung der Gelder sicherzustellen, beschloss der Bundestag die Gründung einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, die am 31. Oktober 1972 unter dem Namen „Hilfswerk für behinderte Kinder“ ins Leben gerufen wurde - Vorläuferin der heutigen Conterganstiftung.
Die Stiftung wurde mit 100 Millionen DM von Grünenthal sowie 100 Millionen DM aus Bundesmitteln ausgestattet. Bis 2021 gab es sechs Änderungsgesetze, um etwa langfristig Rentenzahlungen abzusichern, den Kapitalstock zu erhöhen oder um statt individueller Leistungen jährliche Pauschalzahlungen an die Opfer zu ermöglichen.
Schon vor 50 Jahren war absehbar, dass die von Grünenthal gezahlten Beträge bei weitem nicht ausreichen würden, um den Bedürfnissen der Betroffenen in angemessenen Umfang gerecht zu werden. Im Jahr 2009 zahlte Grünenthal noch einmal 50 Millionen Euro in die Stiftung ein. Aber der Mammutanteil kommt aus Bundesmitteln.
Bis heute hat die Stiftung an die Geschädigten 2,8 Milliarden Euro ausgezahlt. Mit dem Stand von Juli 2022 leben weltweit insgesamt 2.518 von der Conterganstiftung anerkannte Betroffene, davon 2.270 Menschen in Deutschland und 248 im Ausland.
Die Stiftung ist zudem auf einem anderen Feld aktiv: Jährlich fließen drei Millionen Euro in den Aufbau von medizinischen Kompetenzzentren. So sollen die Beratungs- und Behandlungsangebote und damit die Lebenssituation für thalidomidgeschädigte Menschen verbessert werden. Und: Das dort vorhandene Fachwissen soll auch den niedergelassenen Ärzten zugänglich sein. Bisher sind acht Kliniken in diesem Netzwerk zusammengeschlossen. Bundesweit sollen es zehn Einrichtungen werden.
2012 gründete Grünenthal die Grünenthal-Stiftung zur Unterstützung von Conterganopfern und hat darin die seit 2011 bestehende eigene Härtefall-Initiative integriert. Ziel sei es, Projekte zu fördern und zu entwickeln, die über die finanzielle Unterstützung der Conterganstiftung hinausgehen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Sachleistungen.
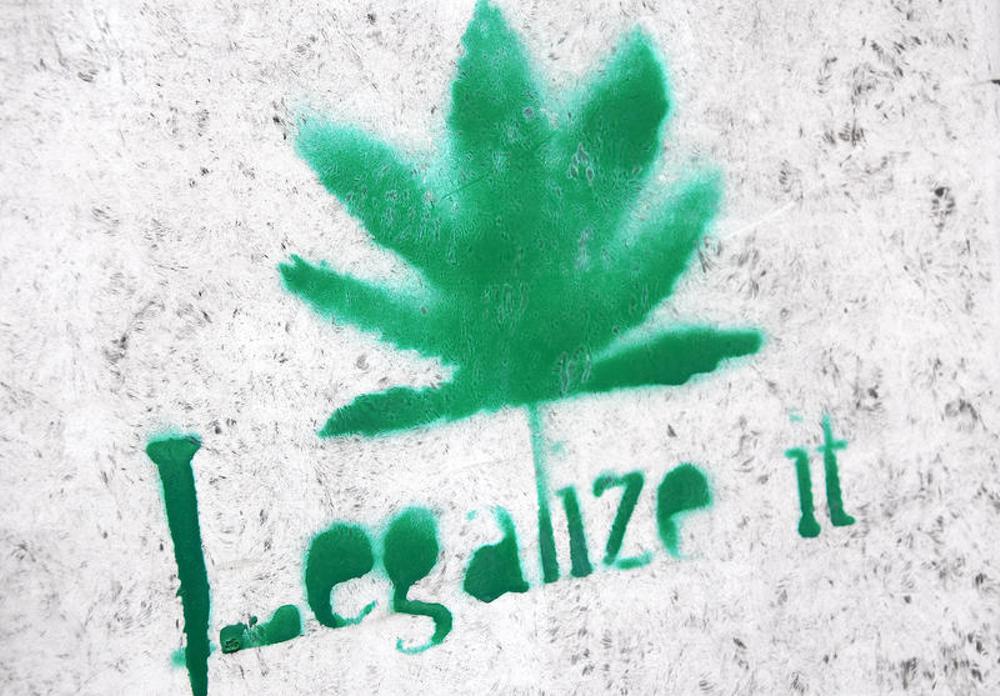
Berlin (epd). Die Bundesregierung hat sich auf Eckpunkte für die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland geeinigt. Wie aus am 26. Oktober vom Kabinett verabschiedeten Eckpunkten hervorgeht, sollen Erwachsene künftig straffrei 20 bis 30 Gramm der Droge besitzen und in begrenztem Maß auch selbst Cannabis anbauen dürfen. Der Verkauf soll staatlich kontrolliert werden.
Damit würden der Schwarzmarkt zurückgedrängt und die Qualität von Cannabis kontrolliert, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der die Pläne damit als Fortschritt für den Gesundheits- sowie Kinder- und Jugendschutz verteidigte.
Die Zahl der Cannabis-Konsumenten sowie der THC-Gehalt stiegen, sagte Lauterbach in Berlin, der nach eigenen Worten früher selbst ein Gegner der Cannabis-Legalisierung war. Auch angesichts dieser Entwicklung habe er seine Meinung geändert. Man brauche einen neuen Ansatz, sagte er.
Den Eckpunkten zufolge soll der Cannabis-Konsum künftig grundsätzlich nicht mehr dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Für Erwachsene sollen Erwerb und Konsum legal sein, unabhängig vom Gehalt von Tetrahydrocannabinol (THC). Die Substanz sorgt für die berauschende Wirkung beim Kiffen. Wegen des Risikos für Gehirnschädigungen bei Heranwachsenden wird aber erwogen, für unter 21-Jährige den THC-Gehalt zu begrenzen. Verkauft werden soll Cannabis nur in lizenzierten Geschäften.
Für unter 18-Jährige bleiben Besitz und Konsum von Cannabis verboten, sollen aber nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Stattdessen Jugendliche bei einem Verstoß zur Teilnahme an einem Frühinterventions- oder Präventionsprogramm verpflichtet werden können. Geplant sei eine vollständige Entkriminalisierung, sagte Lauterbach. Wenn die neue Regelung in Kraft tritt, sollen auch laufende Ermittlungs- und Strafverfahren eingestellt werden.
Das wird nach Lauterbachs Einschätzung aber frühestens 2024 der Fall sein. Die Materie sei komplex, sagte er. Zudem hat die Bundesregierung entschieden, ihre Pläne schon im Stadium vor dem konkreten Gesetzentwurf der EU-Kommission zur Prüfung vorzulegen. Sie ist unsicher, ob die Legalisierungspläne mit EU-Regelungen vereinbar sind. Erst wenn Brüssel grünes Licht gibt, will Lauterbach sich an den konkreten Entwurf machen. Das letzte Wort hat dann der Bundestag.
SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag angekündigt, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einzuführen. Aus den Koalitionsfraktionen gab es nach der Kabinettsentscheidung ein unterschiedliches Echo. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther lobte die Eckpunkte als „sehr gute Grundlage“.
Gesundheits- und Jugendschutz bekämen endlich Vorrang. „Die jahrzehntelange Prohibition hat die Risiken nur verschärft. Mit der Legalisierung wird die Kriminalisierung von Millionen Konsumierenden beendet“, so die Grüne. „Der THC-Gehalt muss klar deklariert werden, damit die Konsumierenden wissen, was sie bekommen. Es geht ja auch niemand in eine Kneipe und bestellt ein Glas Alkohol, ohne zu wissen, ob Bier oder Wodka drin ist.“
Die FDP-Parlamentarierin Kristine Lütke wertete sie dagegen als „immer noch zu restriktiv“. Sie kritisierte die Mengengrenze für den Besitz. „Das finden wir falsch, denn wir regulieren ja auch nicht, wie viel Wein oder Bier jemand besitzen darf“, sagte die drogenpolitische Sprecherin der Liberalen. Neben lizenzierten Abgabestellen forderte sie zudem, den Cannabis-Handel auch online und für Lieferdienste zu erlauben.
Martin Schirdewan, Vorsitzender der Linkspartei, sagte, das Legalisierungskonzept für Cannabis müsse alltagstauglich werden. „Durch den Druck aus der Zivilgesellschaft sind wir einen großen Schritt weiter auf dem Weg, bedarfsgerechte Strukturen zu schaffen: Der Rückzieher bei THC-Obergrenzen ist eine Voraussetzung, um den Cannabis-Schwarzmarkt trockenlegen zu können“, so der Parteivorsitzende. Aber der Weg sei noch lang: „Eine Regelung zu sogenannten Cannabis-Social-Clubs fehlt in den Eckpunkten genauso wie Grenzwerte zur Fahrtüchtigkeit.“
Harsche Kritik an den Plänen kam von Ärztevertretern. „Es ist erschreckend, dass sich ein Gesundheitsminister, der zugleich Arzt ist, für die Legalisierung einer Droge einsetzen muss“, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der Funke Mediengruppe. Der Konsum von Cannabis sei nicht harmlos. „Man darf dem Cannabiskonsum nicht das Mäntelchen der Ungefährlichkeit umhängen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. Er äußerte Zweifel daran, dass die Legalisierung von Cannabis dabei hilft, „die Drogenkriminalität einzudämmen und die Umstiege auf härtere Drogen zu verhindern“.
Der Bund Deutscher Kriminalbeamter begrüßt die geplante Cannabis-Legalisierung in Deutschland. „Wir befürworten grundsätzlich eine Entkriminalisierung von Konsumentinnen und Konsumenten aller Betäubungsmittel“, sagte der Bundesvorsitzende Dirk Peglow den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Zudem unterstrich Peglow die Bedeutung von Prävention: „Mögliche Steuereinnahmen aus dem Verkauf sollten in bundesweite, unbefristete Aufklärungs- und Präventionskampagnen fließen.“ Lehrerinnen und Lehrer müssten in die Lage versetzt werden, diese nachhaltig an den Schulen anbieten zu können.
Berlin (epd). Eine wachsende Zahl von Rentnerinnen und Rentner bezieht zusätzlich zur Rente Leistungen aus der sozialen Grundsicherung. Wie aus Angaben des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, erhielten im Juni dieses Jahres bundesweit fast 628.600 Menschen im Rentenalter Grundsicherungsleistungen. Das etwa 51.000 Menschen mehr als noch im Juni 2021.
Wie aus den Daten, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegen, weiter hervorgeht, bezogen mehr Frauen als Männer Grundsicherung im Alter. Ende Juni lag die Zahl der älteren Empfängerinnen bei rund 354.700, die der Empfänger bei rund 273.900.
Die Zahl der auf Grundsicherung angewiesenen Rentnerinnen und Rentner steigt seit 20 Jahren nahezu kontinuierlich. Ende 2003 lag sie nach den Daten des Statistischen Bundesamtes bei rund 257.700, Ende 2013 dann bereits bei rund 497.400. 2014 überstieg die Zahl erstmals die Marke von einer halben Million. Ende vergangenen Jahres bezogen knapp 588.800 Menschen oberhalb der Altersgrenze Grundsicherung, Ende März dieses Jahres waren es mehr als 594.000.
„Altersarmut steigt und steigt“, erklärte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch angesichts der Statistik. Die Ampel-Koalition müsse mehr tun, damit „Rentnerinnen und Rentner durch den Winter kommen“. Er forderte, die Preise für Strom und Gas vor dem Winter zu deckeln und die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für kleine bis mittlere Renten zu erhöhen.
Zudem forderte er eine Reform der Grundrente. „Die Bundesregierung sollte angesichts der Zehn-Prozent-Inflation die unzureichende Grundrente in eine armutsfeste, solidarische Mindestrente in Höhe von 1.200 Euro umwandeln“, sagte Bartsch.

Berlin (epd). Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat Eckpunkte für ein modernes Einwanderungsgesetz zur Ressortabstimmung vorgelegt. Deutschland brauche qualifizierte Fachkräfte, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, sagte Heil dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dazu brauche es auch deutlich mehr Fachkräfteeinwanderung. Die Koalition wolle den Weg dafür freimachen, „um kluge Köpfe und helfende Hände“ für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Das Bundeskabinett soll im ersten Quartal 2023 die notwendigen Gesetzesänderungen beschließen.
In dem Eckpunktepapier, das dem epd vorliegt, heißt es, dass die Fachkräfteeinwanderung künftig auf drei Säulen gestützt werden soll. Das Ministerium spricht darin von einer Fachkräfte-, einer Erfahrungs- und einer Potenzialsäule. Wie bisher auch bleiben die Blaue Karte der EU für Hochschulabsolventen und die nationale Aufenthaltserlaubnis für Fachkräfte mit einem deutschen oder in Deutschland anerkannten Abschluss die zentralen Elemente der Einwanderung (Fachkräftesäule). Eine neue Regelung soll aber vorsehen, dass eine Fachkraft künftig jede qualifizierte Beschäftigung ausüben kann. Eine Mechanikerin soll demnach auch als Logistikerin arbeiten können.
Einwanderer, die mindestens zwei Jahre Berufserfahrung und einen in ihrem Herkunftsland staatlich anerkannten Berufsabschluss haben, sollen es künftig auch leichter haben, in Deutschland zu arbeiten (Erfahrungssäule). Für IT-Kräfte sollen die Einwanderungsbedingungen dem Papier zufolge noch weiter verbessert werden. Sie konnten bislang schon ohne anerkannten Abschluss nach Deutschland kommen, nun soll die Gehaltsschwelle abgesenkt werden. Zudem müssen sie keine Deutschkenntnisse mehr nachweisen.
Eine sogenannte Chancenkarte soll es Menschen erleichtern, nach Deutschland einzuwandern, die keinen Arbeitsvertrag haben (Potenzialsäule). Interessenten können die „Chancenkarte“ erhalten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen: ausländischer Abschluss, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse oder ein Voraufenthalt in Deutschland.
Die konkreten Voraussetzungen, für den Erhalt der „Chancenkarte“ würden erst im Gesetzgebungsverfahren festgelegt. Dieses wiederum beginne erst nach der Verabschiedung der Eckpunkte durch das Kabinett, teilte ein Sprecher des Arbeitsministeriums mit.
Der von Heil bereits häufiger angekündigte sogenannte Spurwechsel ist in dem Papier nicht enthalten. Dieser soll Asylbewerbern ermöglichen, durch die Aufnahme einer Arbeit eine gesicherte Perspektive in Deutschland zu bekommen. Laut dem Sprecher soll es hierzu eine gesonderte Ressortabstimmung geben. Dabei handele es sich um eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung laut Aufenthaltsgesetz, das in die Zuständigkeit des Bundesinnenministeriums falle.

Lengerich (epd). Peter Kossen sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), das Arbeitsschutzkontrollgesetz „hat nicht erkennbar zu einer veränderten Haltung gegenüber den Menschen geführt, die in der Fleischindustrie schwerste Arbeiten verrichten“. Die Unternehmen täten nur das, wozu das Gesetz sie zwinge, kritisierte er: „Das bedeutet: Festanstellung der Arbeitenden nur in Schlachtung und Zerlegung und sporadische Beseitigung der erbärmlichsten Wohnmängel, wenn die Öffentlichkeit hinschaut.“
Das Gesetz war im Jahr 2020 auf den Weg gebracht worden, als nach massenhaften Corona-Infektionen in Schlachthöfen und Zerlegebetrieben die oft schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen für die größtenteils aus Südosteuropa stammenden Arbeitsmigranten zutage traten. Seit dem 1. Januar 2021 sind Werkverträge verboten, Leiharbeit ist nur noch in Ausnahmen erlaubt. Ausgenommen ist das Fleischerhandwerk.
Laut Kossen ist die Dichte der großen deutschen Fleischbetriebe in Ostwestfalen, im Münsterland und im Oldenburger Land besonders hoch. Sie nutzten gesetzliche Schlupflöcher, um Arbeitsmigrantinnen und -migranten weiterhin „abzuzocken“. „In der Weiterverarbeitung ist Leiharbeit erlaubt bis zu einem Anteil von acht Prozent und mit einem bestehenden Tarifvertrag“, sagt der Lengericher Pfarrer. In der Würstchen-Herstellung habe das zu großangelegten Umgehungsversuchen geführt. „Manche Würstchen-Hersteller behaupten, dass sie kein Fleisch weiterverarbeiten“, berichtete Kossen, Mitautor des neuen Buches „Ist das System Tönnies passé?“.
Die gesetzlich festgeschriebenen Kontrollen hält er für wenig effektiv. So habe sich auch an der Wohnsituation der Arbeitsmigranten nichts verbessert. Da Menschen ohne Deutschkenntnisse und wenig Geld auf dem engen Wohnungsmarkt keine Chance hätten, sei die vom deutschen Arbeitgeber vermittelte „Bruchbude mit Wuchermiete oft das einzige 'Angebot', das sie bekommen“, beklagte der Pfarrer, der mit seinem gemeinnützigen Verein „Aktion Würde und Gerechtigkeit“ seit vielen Jahren Arbeitsmigranten rechtlichen Beistand leistet.
Bei gemeinsamen Razzien am 24. und 25. Oktober sind Nordrhein-Westfalen und die Niederlande gegen ausbeuterische Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der Grenzregion vorgegangen. Bei der Kontrolle von 42 Wohnungen in fünf Immobilien im Kreis Borken war erstmals auch der rumänische Arbeitsschutz beteiligt, wie Heimat- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am 26. Oktober in Düsseldorf mitteilte.
Entdeckt wurden bei den Kontrollen am 24. und 25. Oktober in Gronau und Südlohn rund 30 Brandschutzmängel, zum Teil eine starke Vermüllung der Unterkünfte mit Schimmelbildung, fehlende Stromversorgung, Überbelegung sowie Matratzenmieten zwischen 300 und 400 Euro. Leiharbeiter berichteten von noch ausstehenden Löhnen.
Erfurt (epd). Das 9-Euro-Ticket hat einer Studie zufolge die Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe von Menschen mit geringen Einkommen wesentlich verbessert. Das vergünstigte Nahverkehrsticket habe vermehrte Sozialkontakte und mehr Aktivitäten außer Haus ermöglicht, lautet das Ergebnis einer am 24. Oktober veröffentlichten Untersuchung des Instituts „Verkehr und Raum“ der Fachhochschule Erfurt. Insgesamt habe das bundesweit auf drei Monate befristete Angebot einkommensschwachen Menschen mehr Lebensqualität beschert.
So habe das Ticket einen Zugang zu Mobilitätsangeboten ermöglicht, die finanzschwache Haushalte vorher nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzen konnten. Bei der Erhebung habe sich bestätigt, dass ein Großteil der Befragten während des Ticketbesitzes häufiger unterwegs gewesen sei. Dieser Effekt sei insbesondere in den unteren Einkommensschichten sichtbar geworden.
Die Studie wurde im August 2022, dem letzten der drei Monate, in Form einer schriftlichen Haushaltsbefragung durchgeführt. In sechs ausgewählten Erfurter Stadtteilen ließ die Fachhochschule Erfurt 6.000 Fragebögen verteilen. Davon seien 1.157 Fragebögen ausgefüllt zurückgesendet und ausgewertet worden.
Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen ein bundesweit gültiges und monatlich kündbares 49-Euro-Ticket als Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket auf den Weg bringen. Die Finanzierung ist jedoch noch unklar.
Berlin (epd). Auszubildende von Gesundheitsfachberufen müssen in Berlin künftig kein Schulgeld mehr zahlen. Zum Start des im Herbst beginnenden Ausbildungsjahres sei die Schulgeldfreiheit für die Gesundheitsfachberufe vollständig umgesetzt worden, erklärte Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am 21. Oktober in Berlin.
Auch Schulen in freier Trägerschaft seien Vereinbarungen angeboten worden, um einen Verzicht auf Schulgelder zu ermöglichen. Der Senat habe dafür 3,5 Millionen Euro für 2022 und vier Millionen Euro für 2023 im Doppelhaushalt zur Verfügung gestellt.
Damit könnten die noch rund 900 Berliner Auszubildende in den Gesundheitsfachberufen, deren Schulen keine Kooperationsvereinbarungen mit Kliniken abgeschlossen haben, rückwirkend zum Beginn dieses Ausbildungssemesters vom Schulgeld befreit werden. Im Ergebnis würden dann alle 3.350 Berliner Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe kein Schulgeld mehr bezahlen müssen.
Gote hofft, damit die Attraktivität der Ausbildungen zu steigern. Sie sprach von einem Meilenstein, „um die gesundheitliche Versorgung der Menschen in Berlin auch in Zukunft zu sichern“. Damit sei eine wesentliche Hürde gefallen, um eine Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren.
Auch andere Bundesländer verfahren bereits so. So wurde in Hessen das Schulgeld für Schüler etwa der Diätassistenz, Ergotherapie, Logopädie, Medizinisch-technischen Assistenz und Podologie gestrichen. Thüringen hatte das Schulgeld ebenfalls abgeschafft, dann aber auch Kostengründen teilweise wieder eingeführt. Auch Rheinland-Pfalz übernimmt künftig das Schulgeld für angehende Ergotherapeuten, Logopäden, Masseure oder Medizinisch-technischen Assistenten, die sich an privaten Schulen ausbilden lassen.
Hannover (epd). Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die Eigenanteile bei den Pflegekosten zu begrenzen. „Eine Entlastung von Familien mit pflegebedürftigen Menschen ist dringend erforderlich“, sagte Behrens am 21. Oktober in Hannover. Ein wichtiger Grund für das erhöhte Armutsrisiko von pflegenden Angehörigen seien die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel.
Behrens reagierte mit ihrer Forderung auf eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, die zu dem Ergebnis kommt, dass jeder fünfte pflegende Angehörige von Armut bedroht ist. Sowohl in der stationären als auch in der ambulanten Pflege kommt es nach Angaben der Ministerin zu erhöhten Eigenanteilen für die Pflegebedürftigen. „Wir erleben nun, wie schnell es mit dem System der Teilkaskoversicherung in der Pflege zu sozialen Schieflagen kommen kann.“
Behrens forderte die „bislang nur unzureichend begrenzten Eigenanteile“ in der Pflege stärker und dauerhaft zu begrenzen. Dazu müssten mehr Bundesmittel bereitgestellt werden.
Niedersachsen hat den Angaben zufolge mit Schleswig-Holstein eine Länderinitiative in der Arbeits- und Sozialministerkonferenz gestartet. Mit dem im September mehrheitlich gefassten Beschluss werde der Bund aufgefordert, Maßnahmen zur Entlastung der Familien umzusetzen, hieß es. Unter anderem solle der Zuschlag, mit dem die Eigenanteile der Pflegebedürftigen reduziert werden, im ersten Jahr auf 25 Prozent, im zweiten Jahr auf 50 Prozent und ab dem dritten Jahr auf 70 Prozent erhöht werden, fordern die beiden Bundesländer.
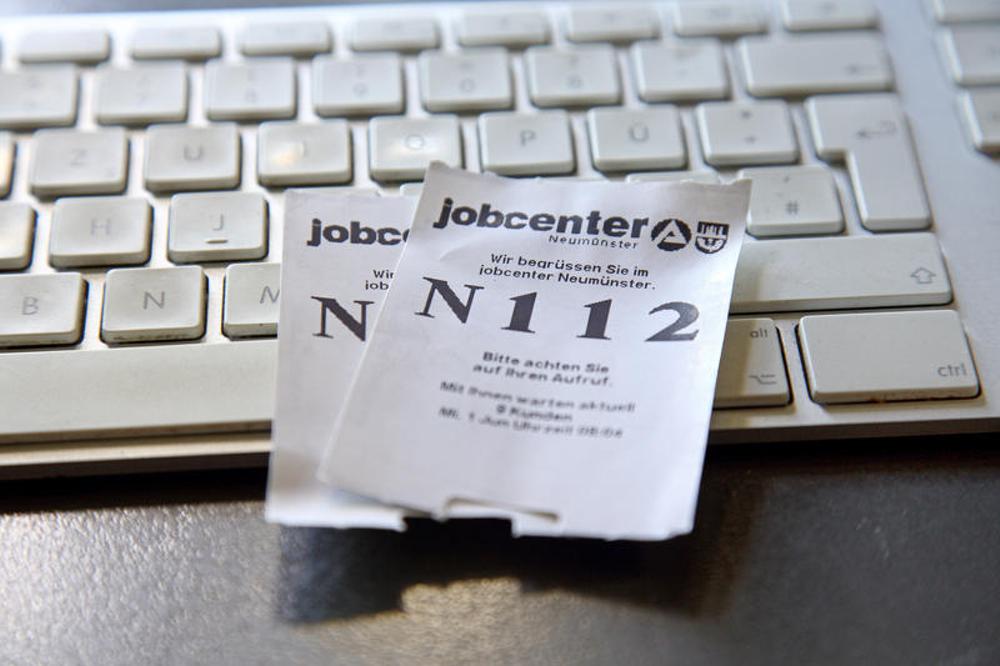
Berlin (epd). Der am 24. Oktober in Berlin veröffentlichten Erhebung zufolge beobachten gut 60 Prozent der befragten Beratungsstellen, dass Hilfesuchende wegen der schweren Erreichbarkeit ihres Jobcenters Leistungen zu spät oder gar nicht gezahlt bekommen.
Den Betroffenen fehlten Informationen, und es werde ihnen die Einhaltung von Fristen erschwert. Zugesandte oder eingeworfene Unterlagen kämen zu spät oder gar nicht bei den Behörden an, berichten mehr als die Hälfte der Beratungsstellen. Wenn eine schnelle persönliche Klärung nicht möglich sei, verschärften sich die Probleme ihrer Klienten.
Ein Viertel der Jobcenter hätten auch im dritten Pandemiejahr keine regulären Öffnungszeiten. Knapp ein Drittel verfüge nicht über eine frei zugängliche Eingangszone, in der die Menschen ihre Unterlagen abgeben oder Informationen einholen könnten. 36 Prozent der Befragten klagen, das Jobcenter sei nur über eine zentrale Hotline erreichbar - mit langen Wartezeiten, ausbleibenden Rückrufen und unqualifizierten Auskünften.
Für die Beratungsstellen selbst resultiert aus der eingeschränkten Erreichbarkeit von Jobcentern und Arbeitsagenturen ein erhöhter Zeitaufwand für die Kommunikation mit diesen Behörden (80 Prozent), ein erhöhter Zeitaufwand pro Beratung (76 Prozent), eine erhöhte Beratungsfrequenz (55 Prozent), mehr Kriseninterventionen (53 Prozent) und insgesamt mehr Klientinnen und Klienten (52 Prozent).
Als konkrete Vorschläge für vor Ort umsetzbare Maßnahmen, die zu einer guten Erreichbarkeit auch in Pandemiezeiten beitragen können, nannten die sozialen Beratungsstellen etwa die Nennung von Ansprechpersonen mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse auf Bescheiden, die Einrichtung eines Notfalltresens, an dem täglich Dokumente gegen Empfangsbestätigung abgegeben werden können, die Einrichtung einer täglichen, persönlichen Notfallsprechzeit sowie einen Scanservice für Unterlagen, die direkt in die Fallakten eingepflegt werden.
BAGFW-Präsident Ulrich Lilie sagte, Hilfesuchende müssten sich darauf verlassen können, dass ihre Ansprechpersonen erreichbar seien. „Wegen der starken Inflation drohen immer mehr Menschen finanziell abzurutschen. Ihnen muss aber besonders schnell geholfen werden“, betonte der Präsident. Digitale Angebote und Telefon-Hotlines seien wichtige Zugänge, die die Erreichbarkeit in digitalen Zeiten verbesserten. Sie könnten das persönliche Gespräch und die Beratung jedoch nicht ersetzen. „Vor allem Menschen, die ihre Anliegen nicht digital oder telefonisch vorbringen können, weil sie nicht gut Deutsch sprechen, mit den digitalen Zugängen nicht zurechtkommen oder nicht richtig lesen und schreiben können, sind auf das persönliche Gespräch vor Ort angewiesen“, so Lilie weiter.
Für die Studie waren im Juni 2022 knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus über 600 Beratungsstellen der Verbände online befragt worden. Es handelt sich um Sozialberatungsstellen sowie spezielle Anlaufstellen, etwa für geflüchtete oder obdachlose Menschen. Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ. Der überwiegende Teil der Beratungsstellen ist in Nordrhein-Westfalen ansässig, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.
In der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege arbeiten die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammen. Gemeinsames Ziel von Caritas, Diakonie, Paritätischem, AWO, Deutschem Roten Kreuz und der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ist die Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Arbeit durch gemeinschaftliche Initiativen und sozialpolitische Aktivitäten.
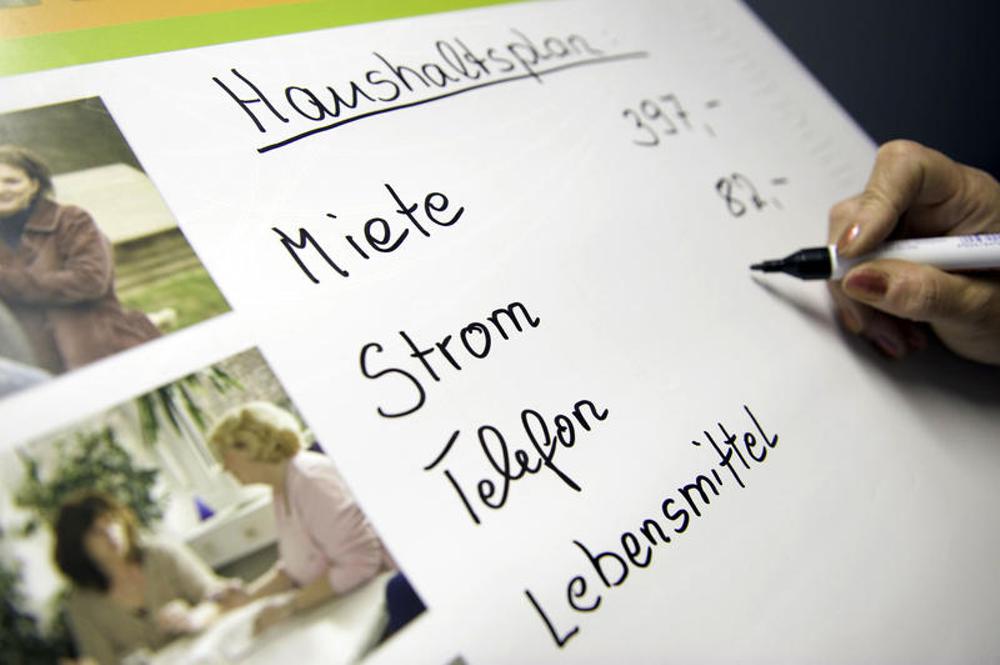
Berlin (epd). Der Paritätische Gesamtverband warnt wegen der Preissteigerungen vor erheblichen Einbrüchen bei den sozialen Diensten. Er stellte am 21. Oktober in Berlin die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage im eigenen Verband vor. Danach gaben fast die Hälfte (46 Prozent) der befragten Einrichtungen an, dass sie ohne Hilfe ihre Angebote noch höchstens ein Jahr aufrechterhalten könnten.
Dabei geht es um Pflegeheime und -dienste, Frauenhäuser, Beratungsstellen, Kindergärten und Obdachlosenunterkünfte. 90 Prozent der Einrichtungen, die sich an der Befragung beteiligten, sehen ihre Existenz in Gefahr. Auch die Krankenhäuser forderten erneut schnelle finanzielle Zusagen.
Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Ulrich Schneider, kritisierte, gemeinnützige Einrichtungen seien bei den bisher beschlossenen Entlastungen für Bevölkerung und Wirtschaft „stiefmütterlich behandelt“ worden. Die Gaspreisbremse werde überdies frühestens im Frühjahr wirksam werden und könne eine Verdopplung der Gaspreise nicht verhindern, sagte Schneider. Bund und Länder müssten sich deshalb nun über schnelle Hilfen verständigen.
Wegen der großen Verunsicherung bleibe keine Zeit, bis zum November zu warten, sagte Schneider mit Blick auf das nächste geplante Treffen der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im November, bei dem es um die Finanzierung weiterer Hilfen gehen soll.
Schneider forderte die Bundesregierung auf, die Schuldenbremse auszusetzen. Der 200-Milliarden-Stabilisierungsfonds, den der Bundestag beschlossen hat, werde nicht ausreichen. Allein für die Sozialbranche seien notwendige Hilfen in Höhe von 15 Milliarden Euro „durchaus realistisch“, sagte Schneider.
Gemeinnützige Träger könnten ihre Kostensteigerungen nicht einfach an ihre Klientinnen und Klienten weitergeben. Obdachlose, pflege- oder hilfsbedürftige Menschen gehörten zu den schwächsten Gruppen in der Gesellschaft. Einem Pflegeheim beispielsweise sei es außerdem nicht möglich, Energie zu sparen, indem die Heizung heruntergedreht werde, ergänzte Schneider.
Für die Umfrage waren bundesweit vom 21. September bis 17. Oktober 1.366 kleine, mittelgroße und große Einrichtungen unter dem Dach des Paritätischen befragt worden. Rund 70 Prozent erwarten allein bei den Heizkosten eine Verdoppelung der Ausgaben, 26 Prozent eine Verdreifachung. 60 Prozent der befragten Einrichtung rechnen mit einer Verdopplung der Stromkosten. Drei Viertel der Einrichtungen verzeichnen bereits zusätzliche Kostensteigerungen bei Lebensmitteln, Personalausgaben und Sachmitteln.
Angesichts der finanziellen Nöte warnen auch die Diakonie Deutschland und die Arbeiterwohlfahrt übereinstimmend vor einer Pleitewelle bei ihren sozialen Einrichtungen.
„Viele Träger stehen bereits jetzt mit dem Rücken zur Wand und befinden sich in einer finanziell prekären Situation. Wenn Einrichtungen in Insolvenz gehen und Angebote eingestellt werden müssen, weil die Kosten für Energie und Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlbar sind, ist das eine soziale Katastrophe“, sagte Ulf Hartmann, Vorstand des Paritätischen Baden-Württemberg. Zwingend notwendige Angebote, die von hunderttausenden Menschen im Land dringend gebraucht werden, würden wegbrechen.
„Der vorgesehene Hilfsfonds für soziale Dienstleister auf Bundesebene muss so ausgestaltet sein, dass Insolvenzen abgewendet werden“, sagte Hartmann. Auch die Kostenträger auf kommunaler Ebene müssten zu Nachverhandlungen bereit sein, „die auf realistischen Berechnungen beruhen“.
Der Deutsche Krankenhausverband (DKG) forderte ebenfalls „Klarheit und Planungssicherheit“ von der Politik. Bisher gebe es nur vage Ankündigungen, kritisierte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Henriette Neumeyer. Im Raum stünden Hilfen von vier Milliarden Euro für diesen Winter. Die Kliniken bräuchten aber eine längerfristige Planungssicherheit. Andernfalls drohten Insolvenzen, die zahlreiche Klinikschließungen zur Folge haben könnten, warnte Neumeyer.
„Der Gesundheitsminister muss jetzt klarstellen, dass die angekündigten Gelder nicht nur garantiert sind, sondern auch tatsächlich bei den Krankenhäusern ankommen. Schaufenstermilliarden nützen den Kliniken nichts. Für einen Großteil der Krankenhäuser bleibt die Lage extrem prekär“, so die Verbandschefin.
Inklusives Wohnen soll allen Menschen möglich sein, auch Menschen mit Behinderungen, proklamieren der Fachverband für Teilhabe und sieben weitere Organisationen. Sie haben neun Empfehlungen an die Politik herausgegeben. epd sozial dokumentiert den Text:
„Trotz des ausgegebenen Ziels der Ambulantisierung und Dezentralisierung ist die öffentliche Förderlandschaft zu Ungunsten inklusiver Wohnprojekte ausgerichtet. So können aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe nur “Wohnstätten für behinderte Menschen" (§ 30 Abs. 1, Nr. 6 SchwbAV) finanziert werden. Dies führt selbst bei der begrüßenswerten Konversion von Komplexeinrichtungen häufig zur Entstehung neuer besonderer Wohnformen mit bis zu 24 Bewohnern und Bewohnerinnen.
Die finanziellen Anreize stehen in Widerspruch zum gesetzten politischen Ziel. Wir fordern, dass der Einsatz öffentlicher Fördermittel konsequent an der Zielsetzung der Inklusion ausgerichtet wird. Sie sollten Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften bei der Schaffung von barrierefreiem und inklusivem Wohnraum unterstützen, Gemeinschaftsräume und Clusterwohnungen fördern sowie flexible Wohnmöglichkeiten passend zu sich wandelnden Lebenslagen anregen. Wichtig ist auch die Kombinierbarkeit verschiedener Förderungen, um eine soziale Durchmischung in Wohnungen, Häusern und Quartieren zu ermöglichen. Hierfür ist es notwendig, dass sozial geförderter Wohnraum auch durch Anbieter der Behindertenhilfe und andere Akteure angemietet und untervermietet werden kann.
Für inklusive Wohnmöglichkeiten müssen neben ausreichend barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum weitere Anforderungen erfüllt sein: Um Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf eine bedarfsgerechte Assistenz und Pflege außerhalb von besonderen Wohnformen zu ermöglichen, werden beispielsweise Clusterwohnungen, Assistenzzimmer und vieles mehr benötigt, die in der Regel nur im Neubau umsetzbar sind. Als gemeinnützig im Sinne der neuen Wohngemeinnützigkeit sollten deshalb insbesondere solche Wohnungsunternehmen gelten, die bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum schaffen sowie durch die Kooperation mit sozialen Trägern und privaten Initiativen zur Entwicklung von inklusiven Wohnformen beitragen.
Inklusive Wohnmöglichkeiten entstehen nicht einfach durch neue Gesetze. Wohnungsunternehmen fehlt das Wissen zu den Bedarfen, Anbieter der Behindertenhilfe sind häufig durch ihre bestehenden Strukturen und Verträge gehemmt und private Initiativen mit den komplexen Aufgaben oft überfordert. Damit die Inklusionswende gelingt, braucht es landesweite Fachstellen sowie eine bundesweite Koordination, die in Zusammenarbeit mit den vorhandenen Unterstützungsstrukturen alle relevanten Akteure zu inklusivem Wohnen informieren und beraten. Bestehende Beratungsstellen wie die Fachstelle Wohnen des Landes Baden-Württemberg oder die Regionalstellen von WOHN:SINN in Bremen, Dresden, Köln und München zeigen, dass die Entstehung inklusiver Wohnmöglichkeiten dadurch wirksam erleichtert werden kann.
Viele Menschen mit Behinderung, die beispielsweise in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, finanzieren ihre Miete über die Grundsicherung. Durch die steigenden Miet- und Baukosten sowie die Inflation ist es vielerorts unmöglich geworden, geeigneten Wohnraum für Menschen mit Behinderung zu finden beziehungsweise zu bauen. Steigende Mietniveaus von 35 Prozent sind keine Seltenheit. Die Differenz zwischen Mietpreis und Angemessenheit der Miethöhe verwehrt Menschen mit Behinderung den Zugang zu Neubauten, obwohl gerade diese häufig barrierearm sind.
Die Bundesregierung will die Grundsicherung durch ein „Bürgergeld“ ersetzen. Der Referentenentwurf hierfür sieht eine Karenzregelung von zwei Jahren vor, in denen die Kosten für Mietwohnungen grundsätzlich als angemessen angesehen werden. Wir halten das für nicht ausreichend und fordern dauerhaft, die Sätze für angemessenen Mietwohnraum bedarfsgerecht aufzustocken oder einen angemessenen Zuschlag für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Soweit kein als angemessen geltender Wohnraum zur Verfügung steht, sollen die tatsächlichen Wohnkosten erstattet werden.
In vielen inklusiven Wohnmöglichkeiten leisten junge Studierende und Auszubildende im Gegenzug für eine reduzierte Miete alltägliche Assistenz für ihre behinderten Mitbewohnerinnen beziehungsweise Nachbarn. Diese Erfahrung baut nicht nur Berührungsängste ab, viele von ihnen entscheiden sich auch für einen Beruf im sozialen Bereich - selbst, wenn sie vor dem Einzug andere Pläne hatten. Ein solches Engagement leistet damit einen nachhaltigen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung für Berufe im Pflege- und Sozialsektor.
Konzepte der Alltagsassistenz wie „Wohnen für Assistenz“ brauchen in Deutschland einen verlässlichen rechtlichen Rahmen, der sie im Hilfesystem verankert und sachdienliche Qualitätsanforderungen sicherstellt. Gerade in Hinblick auf den demografischen Wandel muss das Potenzial von ehrenamtlichem und nebenberuflichem Engagement sowie nachbarschaftlicher Hilfe gestärkt werden. Dies darf jedoch keinesfalls zulasten von Qualitätsstandards und der tariflichen Vergütung in der Eingliederungshilfe geschehen.
Mit dem Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe von der Fürsorge zur Selbstbestimmung und Teilhabe ändern sich auch die Anforderungen an Fachkräfte der Behindertenhilfe. In der Praxis inklusiver Wohnformen stehen sowohl die individuelle Assistenz von Menschen mit Behinderung als auch die Moderation des inklusiven Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderung in der WG, Hausgemeinschaft oder Nachbarschaft auf der Tagesordnung. Weil inklusive Wohnprojekte häufig einen Teil der Assistenz durch Laienkräfte wie Mitbewohnerinnen, Nachbarn oder Minijobbern abdecken (siehe 5.), sind oft weniger Fachkräfte als in vergleichbaren institutionellen Wohnformen nötig. Gleichzeitig sind die Anforderungen an die leitenden Fachkräfte besonders hoch, da sie den inklusiven Prozess koordinierenden und begleiten müssen.
Gutachten kommen zu dem Schluss, dass hierfür entsprechend akademisch qualifizierte Sozial- beziehungsweise Heilpädagogen notwendig sind. Die besonderen Anforderungen an Fachkräfte im inklusiven Wohnen müssen in Leistungsmodulen und -vereinbarungen der Kostenträger finanziell berücksichtigt werden und in den Lehrplänen von relevanten Ausbildungsstätten und Studiengängen Einzug erhalten.
Die durch das Bundesteilhabegesetz deutschlandweit geschaffenen Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB) sind für viele Menschen mit Behinderung wertvolle Lotsen im regionalen Angebot und eine hilfreiche Unterstützung bei Antragsstellungen. Regelmäßig finden Menschen mit Behinderung jedoch auch durch die Beratung der EUTB kein Wohnangebot, was ihren Wünschen und Bedarfen entspricht, vielfach, weil es kaum inklusive Wohnangebote gibt. In der Folge fühlen sie sich mit ihren Anliegen alleingelassen. Damit Teilhabeberatungsstellen ihrem Anspruch an Empowerment gerecht werden, sollten sie Betroffene und Angehörige weitergehend begleiten, mit Gleichgesinnten vernetzen und die Gründung von Projektgruppen unterstützen. Durch eine entsprechende Ergänzung des Förderauftrags des Bundesarbeitsministeriums kann die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung im Wohnen wirksam gestärkt werden.
Das mit dem Bundesteilhabegesetz reformierte SGB IX will personenzentrierte Leistungen zur Teilhabe sichern und die Entwicklung individueller Assistenzangebote fördern. Menschen mit intensivem Unterstützungsbedarf müssen hierbei umfassend berücksichtigt werden, damit diese inklusiv wohnen können. Dazu ist es notwendig, dass personenzentrierte Assistenzbedarfe anerkannt werden sowie eine Beteiligung der leistungsberechtigten Personen und deren Vertreter:innen am Teilhabe- und Gesamtplanverfahren umgesetzt wird. Die vorhandenen Bedarfsermittlungsinstrumente sollten weiterentwickelt und in Bezug auf die Personenkreise bedarfsgerecht angewendet werden.
Gerade in ambulanten Wohnformen ist die Inanspruchnahme der vollen Leistung der Pflegeversicherung und Eingliederungshilfe wichtig. Ein Aufrechnen beider Leistungsansprüche beziehungsweise Verschiebungen zwischen den Gesetzesbüchern gilt es zu klären. Leistungsberechtigte Personen sollten ebenfalls über die Nutzung des Persönlichen Budgets beraten werden, bei eingeschränkter Regiefähigkeit sollte eine Budgetassistenz bundesweit einheitlich zur Verfügung stehen und finanziert werden.
Inklusiv zu wohnen ist ein Recht, das jedem Menschen unabhängig von seinem Unterstützungsbedarf zusteht. Gerade Personen, die auch nachts auf Assistenz angewiesen sind, wird ein Leben in einer ambulant begleiteten Wohnform immer wieder durch Kostenträger verwehrt. Dass es funktionieren kann, zeigen Vorreiter wie die Hausgemeinschaft des Vereins inklusiv wohnen Köln.
Eine weitere Hürde in der nächtlichen Assistenz birgt das Arbeitszeitgesetz. Dieses sieht vor, dass bei Arbeitszeiten über sechs Stunden eine Pause von 30 Minuten, über neun Stunden eine Pause von 45 Minuten zu gewähren ist. Gerade bei Nachtwachen ist dies oft schwer oder gar nicht umzusetzen, weil sie in der Regel allein arbeiten, während einer Pause also tatsächlich in Arbeitsbereitschaft sind. Hierfür braucht es eine klare Regelung, die die Rechte der Arbeitnehmerinnen wahrt, aber auch eine Nachtwache außerhalb institutioneller Strukturen erleichtert."
Berlin (epd). Für Patientinnen und Patienten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung werden die Kosten für eine Begleitperson bei Behandlungen im Krankenhaus künftig übernommen. Wie die Bundesvereinigung Lebenshilfe am 24. Oktober in Berlin mitteilte, haben sie ab dem 1. November einen Rechtsanspruch auf Kostenübernahme durch Krankenkassen oder Träger der Eingliederungshilfe. „Wir sind froh, dass diese wichtige Unterstützung endlich auf sichere finanzielle Füße gestellt wurde“, sagte Ulla Schmidt, die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. Der VdK hält die berechtigte Personengruppe für zu eng gefasst.
Nach den Worten von Ulla Schmidt haben Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in Kliniken besondere Bedürfnisse. Die ungewohnte Umgebung und medizinische Eingriffe seien für sie oft beängstigend, die Kommunikation mit dem Klinikpersonal sei oft überaus schwierig. So könnten eklatante Versorgungsmängel auftreten, Diagnosen nicht gestellt und Therapien unmöglich werden.
Eine begleitende Vertrauensperson ist laut Schmidt eine wertvolle Hilfe. Sie könne schon durch ihre bloße Anwesenheit beruhigend wirken und sei in der Lage, bei sprachlich stark beeinträchtigten Patienten Verhaltensweisen richtig zu deuten.
Ab dem 1. November werden neben den Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung der Vertrauensperson nun auch die Kosten der Begleitung selbst übernommen. Leisten nahe Angehörige oder Bezugspersonen aus dem engsten persönlichen Umfeld des Patienten die Unterstützung, ist die Krankenkasse zuständig und gewährt Krankengeld zum Ausgleich des Verdienstausfalls. Sind es vertraute Unterstützungspersonen eines Leistungserbringers der Eingliederungshilfe, wird die Begleitung vom Träger der Eingliederungshilfe finanziert.
VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte, der Krankengeldanspruch an sich sei gut, aber der Personenkreis ist zu eng gefasst. „Krankengeld gibt es nur für die Begleitpersonen von Patientinnen und Patienten, die Eingliederungshilfe beziehen. Künftig muss auch die Assistenz für pflegebedürftige Menschen zum Beispiel mit Demenz mit aufgenommen werden.“ Gerade diese Gruppe sei aufgrund ihrer verschiedenen Einschränkungen auf eine Begleitung angewiesen, um überhaupt behandelt werden zu können.
Auch Eltern nichtbehinderter Kinder umfasse die neue Regelung nicht. „Viele Krankenkassen zahlen den bisherigen Verdienstausfall nicht mehr weiter. Dann kommt nur noch das Kinderkrankengeld in Frage. Doch das ist schnell ausgeschöpft. Vor allem, wenn Kinder länger und wiederholt zur stationären Behandlung begleitet werden müssen“, betonte Bentele.
Berlin (epd). Der Deutsche Verein fordert eine neue eigenständige Regelung auf Bundesebene außerhalb der bestehenden Sozialgesetzbücher zur Absicherung des Hilfesystems für von Gewalt betroffenen Mädchen, Frauen und ihre Kinder. Dazu habe er am 20. September Empfehlungen verabschiedet, heißt es in einer Mitteilung vom 24. Oktober. Sie sollen dazu beitragen, einheitliche Regelungen für ein bedarfsgerechtes, barrierefreies und diskriminierungsfrei zugängliches Hilfesystem zu entwickeln.
„Der Zugang zu Schutz und Unterstützung ist für von gewaltbetroffene oder -bedrohte Mädchen, Frauen und ihre Kinder zentral und muss in jedem Fall gesichert sein“, sagte Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge. Deutschland habe sich zur Umsetzung der Handlungsaufträge aus der Istanbul Konvention verpflichtet. „Es ist daher seine Aufgabe, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, den Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren sowie ein öffentliches Bewusstsein für die Thematik Gewalt gegen Frauen zu schaffen.“
Die neuen Empfehlungen knüpfen an das am 27. Mai 2021 veröffentlichte Positionspapier des (politischen) Runden Tisches „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ von Bund, Ländern und Kommunen an und formulieren konkrete Anforderungen an eine eigenständige Regelung auf Bundesebene. Voraussetzung für den Zugang zu Schutz und Beratung solle allein die Betroffenheit der Frauen und ihrer Kinder von Gewalt oder drohender Gewalt sein, unterstrich Stettter-Karp.
Sie verwies zudem auf den jüngst von einem unabhängigen Expertengremium im Auftrag des Europarats verfassten Bericht zum Stand der Umsetzung des Übereinkommens zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in Deutschland. Dieser zeige auf, wo weiterhin Handlungsbedarf besteht.
Berlin (epd). Die Psychologin Lale Akgün stellt das System Altenheim infrage. „Es spuckt Menschen aus der Gesellschaft aus und gibt ihnen das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden“, sagte die stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA) anlässlich des 60. Jubiläums des KDA dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Zwar gebe es gut geführte Heime, die seien aber in der Regel teuer, sagte Akgün. Statt in weit draußen im Grünen gelegenen Heimen sollten ältere Menschen eher in kleineren Wohneinheiten in den Zentren von Dörfern und Städten leben, in altersgemischten Nachbarschaften, wo sie in ihren gewohnten Netzwerken bleiben könnten. Erstrebenswert sei auch, dass Menschen im Alter so lange wie möglich zu Hause bleiben können, sagte die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete. Dabei müsse jedoch unbedingt eine Isolierung in den eigenen vier Wänden verhindert werden.
Seniorinnen und Senioren müssten außerdem vor extremen Kostenanstiegen in der Pflege geschützt werden, forderte Akgün. Das Kuratoriumsmitglied der KDA sagte, sie unterstütze die Idee des Sockel-Spitzen-Tauschs. Dabei zahlen Pflegebedürftige nur einen Sockelbetrag für ihre Pflege, die Pflegekassen den Rest. Derzeit ist es umgekehrt, was dazu führt, dass die Pflegebedürftigen Preissteigerungen alleine tragen müssen.
Akgün argumentierte auch für einen Sinneswandel in der Arbeitswelt. Nicht nur Kinder und Arbeit müssten unter einen Hut gebracht werden, sondern auch Pflege und Arbeit. Rund 80 Prozent der Pflegebedürftigen würden zu Hause betreut, oft von berufstätigen Angehörigen. „Das Alter ist nicht nur das Problem der Alten“, sagte Akgün.
Am 27. Oktober feierte das KDA in Berlin sein 60-jähriges Bestehen. Es wurde 1962 vom damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübcke und dessen Frau Wilhelmine gegründet. Das KDA berät Einrichtungen, Politik und Verwaltung und versteht sich dabei als unabhängige Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.
Essen (epd). Die generalistische Ausbildung für Pflegefachkräfte wird den Personalmangel in der Branche nach Ansicht von Silke Gerling vom Diakoniewerk Essen kaum beheben. „Ich bin skeptisch, ob es am Ende wesentlich mehr ausgebildete Kräfte geben wird“, sagte die Sprecherin der Ruhrgebietskonferenz Pflege dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zwar entschieden sich mehr junge Menschen in Nordrhein-Westfalen für eine Ausbildung in der Pflege. Aber die Abbrecherquote sei nach wie vor hoch.
Zudem sei abzuwarten, wie viele Auszubildende des ersten Jahrgangs unter dem neuen System die demnächst anstehenden Prüfungen bestünden und dann auch weiterhin im Pflegeberuf blieben.
Die seit Anfang 2020 geltende Generalistik soll den Berufseinstieg für junge Menschen attraktiver machen. Sie verbindet die bis dahin getrennten Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege, sodass die Absolventinnen und Absolventen in allen drei Bereichen arbeiten können. Die Zahl der Pflege-Auszubildenden nahm nach Einführung der neuen Ausbildungsordnung laut Ruhrgebietskonferenz Pflege um fast zehn Prozent zu. Mehr als 92 Prozent der Auszubildenden gäben an, nach Ende ihrer Ausbildung im Pflegeberuf arbeiten zu wollen.
„Aber das reicht nicht aus. Wir müssen deutlich mehr Menschen für diesen Beruf gewinnen“, sagte Gerling. Das werde nur mit Hilfe ausländischer Fachkräfte gehen. Deren Anerkennung gestalte sich aber noch zu schwierig. Ein Problem sei, dass ausländische Interessenten für die Pflegeassistenzausbildung keinen Aufenthaltstitel erwerben könnten, weil diese Ausbildung nur ein Jahr dauere.
Gerling kritisierte weiter, dass die Ausbildung für alle Pflegebereiche zwar nun gleich sei, die Bezahlung sich aber immer noch unterscheide. Die Träger von Einrichtungen der Altenpflege seien benachteiligt, weil die Fachkräfte dort weniger verdienten. „Wir leiden schon seit Jahrzehnten darunter, dass es da unterschiedliche Vergütungssystematiken gibt“, klagte Gerling. Die Erwartung, dass es im Zuge der Ausbildungs-Generalistik auch die Bezahlung angeglichen werde, habe sich bislang nicht erfüllt.
Die Politik sei gefragt, die gesamte Finanzierungssystematik der Pflege umzustellen, forderte Gerling, die beim Diakoniewerk Essen den Geschäftsbereich Behindertenhilfe, Senioren- und Krankenhilfe leitet.
Die Ruhrgebietskonferenz Pflege ist eine unabhängige Arbeitgeberinitiative, der nach eigenen Angaben 40 öffentliche und private Pflegeunternehmen mit rund 20.000 Beschäftigten aus dem ganzen Ruhrgebiet angehören. Am Freitag will die Initiative eine Zwischenbilanz zur generalistischen Pflegeausbildung ziehen.
Berlin (epd). Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) plädiert dafür, den sogenannten präventiven Hausbesuch als gesetzliche Krankenkassenleistung einzuführen. „Entscheidend für die Entwicklungszahlen des Pflegebedarfs wird künftig sein, ob und wie frühzeitig kritische Lebenslagen alter Menschen identifiziert werden, um notwendige Interventionen einzuleiten. Hier bietet sich das Konzept des Präventiven Hausbesuchs (PHb) an“, sagte Verbandschef Wilfried Wesemann am 26. Oktober in Berlin.
Der DEVAP hat ein Positionspapier mit zwei wesentlichen Kernforderungen zur Operationalisierung des Präventiven Hausbesuchs (PHb) veröffentlicht, heißt es weiter in der Mitteilung. Darin wird für das Konzept geworben. „Mit vergleichsweise geringen personellen und finanziellen Ressourcen können so die ambulanten und familiären Hilfestrukturen gestärkt, die Pflegebedürftigkeit verzögert und der Verbleib in der Häuslichkeit deutlich verlängert werden.“
Wesemann: „Schon heute wissen wir aus Berechnungen des Statistischen Bundesamts, dass in 30 Jahren mehr als 25 Prozent der deutschen Bevölkerung über 67 Jahre alt sein wird. Damit verbunden ist die Perspektive, dass deutlich mehr Ältere pflegebedürftig sein werden als die vier Millionen Pflegebedürftigen heute. Dem muss mit allen Mitteln entgegengewirkt werden“, so der DEVAP-Chef weiter.
Bereits im dritten Altenbericht von 2003 seien Präventive Hausbesuche bei alten Menschen als geeignete Methode beschrieben worden, um Risikofaktoren für Erkrankungen frühzeitig zu erkennen. Sie seien aber bislang nur in ganz wenigen kommunalen Hilfestrukturen verankert worden. Auch die Einführung des Präventionsgesetzes 2015 habe daran wenig ändern können.
Der DEVAP hat ein Positionspapier, in dem zwei Kernforderungen sowie Operationalisierungsschritte zum Präventiven Hausbesuch beschrieben werden. Das seien die Einführung eines jährlichen Präventiven Hausbesuchs für Menschen ab 75 Jahren und die Förderung sowie Finanzierung dieser Untersuchungen als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. „Der PHb sollte leistungsrechtlich im SGB V verortet werden, weil Prävention in die finanzielle Zuständigkeit der Krankenversicherung fällt“, so Wesemann weiter.
Stuttgart (epd). Die Evangelische Heimstiftung führt in allen ihren Einrichtungen eine Kommunikations-App für Angehörige ein. 20 Einrichtungen haben die App bereits im Einsatz - die anderen 80 Pflegeheime sollen in den kommenden Monaten dazukommen, teilte die Heimstiftung am 25. Oktober mit.
Bei der „myo-App“ eines Berliner Start-Ups können Mitarbeitende eines Pflegeheims Botschaften, Fotos und Videos von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Angehörigen in einem Chat teilen. Der Datenschutz und die Datensicherheit seien dabei gewährleistet.
Die Heimstiftung und „myo“ hätten eine besondere Entwicklungspartnerschaft, hieß es weiter: Die Erfahrungen und Rückmeldungen der Nutzer fließen direkt in die Weiterentwicklung der App ein, was ein Vorteil für beide Seiten sei. Die Kommunikationsapp „myo“ kommt nach eigenen Angaben in mehr als 400 Einrichtungen bisher zum Einsatz darunter neben der Evangelischen Heimstiftung auch beim Roten Kreuz und der AWO.

Potsdam (epd). Eine im Krankenhaus erlittene Nadelstichverletzung reicht als Beleg für eine Infektion mit einem Krankenhauskeim nicht aus. Denn lag nur eine einfache Infektionsgefahr in der Klinik vor und ist eine Ansteckung im Dienst mit antibiotika-resistenten Bakterien nicht wahrscheinlich, kann keine Berufskrankheit anerkannt werden, entschied das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg in Potsdam in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 10. August 2022.
Laut Berufskrankheitenverordnung können Infektionskrankheiten als Berufskrankheit anerkannt werden, „wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße besonders ausgesetzt war“. So sollen Versicherte, die beispielsweise im Krankenhaus oder in Kitas arbeiten, von einem besonderen Unfallversicherungsschutz bei Infektionskrankheiten profitieren.
Im konkreten Fall arbeitete die Klägerin, eine Krankenschwester, von 1991 bis Juni 2017 in der Notfallambulanz einer Klinik in Brandenburg. Dort versorgte sie Notfälle, nahm Patienten Blut ab und versorgte Wunden. Als sie sich im November 2016 in der Nachtschicht bei Aufräumarbeiten mit einer benutzten Spritze in den Finger stach, meldete sie das ihrem Arbeitgeber. Tests über eine mögliche Ansteckung mit Hepatitis-B und -C-Viren und auf HIV blieben negativ.
Als sie im Juni 2017 eine Hüftverletzung erlitt, wurde bei ihr eine Besiedelung mit einem MRSA-Krankenhauskeim festgestellt. Dabei handelt es sich um den Erreger Methicillinresistenter Staphylococcus aureus (MRSA). Die Bakterien sind gegen einige Antibiotika resistent. Die Krankenschwester wurde wegen der MRSA-Ansteckung stationär behandelt.
Die Beschäftigte sah in der erlittenen Nadelstichverletzung einen Arbeitsunfall und die Ursache für ihre MRSA-Infektion. Sie sei als Krankenschwester einer besonderen Infektionsgefahr ausgesetzt, so ihre Begründung. Sie beantragte bei der Berufsgenossenschaft die Anerkennung der MRSA-Infektion als Berufskrankheit. Wegen der MRSA-Besiedelung dürfe sie nicht mehr im OP arbeiten.
Der Arbeitgeber teilte mit, dass am Tag, an dem die Beschäftigte die Nadelstichverletzung erlitten hatte, kein MRSA-Fall in der Klink bekannt gewesen sei. Laut einer gewerbeärztlichen Stellungnahme sei es zwar im Zeitraum, in dem die Klägerin in der Notaufnahme arbeitete, zu einer Besiedelung mit MRSA gekommen. Die Ansteckung sei aber nicht beruflich, sondern privat ausgelöst worden. Denn die Beschäftigte habe wegen eines nicht beruflich bedingten Hörsturzes eine Kortisonbehandlung erhalten, bei dem das Immunsystem geschwächt worden sei.
Die symptomlose Besiedelung mit MRSA-Bakterien sei zudem gar keine Krankheit und damit kein regelwidriger Körperzustand, so dass eine Anerkennung als Berufskrankheit nicht möglich sei, stellte der Unfallversicherungsträger fest.
Weitere vom Sozialgericht und LSG beauftragte Gutachter konnten ebenfalls keinen ausreichenden Zusammenhang zwischen dem Nadelstich und der Ansteckung mit den Krankenhauskeimen feststellen.
Das LSG wies die Klage der Frau ab. Für die Anerkennung als Berufskrankheit müsse „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ die Infektion bei einer versicherten Tätigkeit stattgefunden und eine „Krankheit“ verursacht haben. Da sich der Ansteckungsvorgang häufig nicht mehr feststellen lasse, könne als Beleg auch ausreichen, dass die Klägerin bei ihrer Arbeit einer „Infektionsgefahr in besonderem Maße“ ausgesetzt war. Eine abstrakte „schlichte Infektionsgefahr“ genüge für die Anerkennung als Infektionskrankheit aber nicht.
Maßgeblich hänge es von der Durchseuchung des Umfelds der Tätigkeit ab, wie etwa zu den kontaktierten Personen, sowie von der Übertragungsgefahr, also der Art, der Häufigkeit und der Dauer der vom Versicherten verrichteten gefährdenden Handlungen, so das LSG.
Damals sei keine Besiedelung mit dem Erreger festgestellt worden. Zwar gehöre die Klägerin als Krankenschwester bei der Anerkennung von Infektionskrankheiten als Berufskrankheit zum besonders geschützten Personenkreis. Es sei aber zweifelhaft, ob sie bei ihrer beruflichen Tätigkeit bereits einer besonderen Infektionsgefahr ausgesetzt gewesen war. Ein direkter Kontakt zu einem MRSA-Patienten sei nicht belegt worden. Es gebe auch keine belegte erhöhte Durchseuchung in der Kliniknotaufnahme im Verhältnis zur Allgemeinbevölkerung.
Hinzu komme, dass die MRSA-Infektion wahrscheinlich von der Behandlung ihres Hörsturzes herrühre. Das liege jedoch im unversicherten privaten Lebensbereich der Klägerin, urteilte das LSG.
Az.: L 3 U 144/20 (Landessozialgericht Potsdam)
München (epd). Das einmal für Ausländer aus humanitären Gründen gewährte Aufenthaltsrecht führt während des laufenden Asylverfahrens nicht zu einem rückwirkenden Kindergeldanspruch. Während anerkannte Flüchtlinge Kindergeld ab einem Aufenthalt von sechs Monaten in Deutschland rückwirkend erhalten können, gilt das nicht für Ausländer, die aus humanitären Gründen oder wegen einer in ihrem Heimatland bestehenden Gefahr für Leib und Leben und damit als sogenannte subsidiär Schutzberechtigte anerkannt wurden, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am 20. Oktober veröffentlichten Beschluss.
Im konkreten Fall ging es um eine Mutter von zwei Kindern, die im November 2015 Asylanträge gestellt hatte. Während des laufenden Asylverfahrens erhielt sie von der zuständigen Kommune Asylbewerberleistungen. Ihr Asylantrag wurde zwar im Dezember 2016 abgelehnt. Die Frau und die Kinder wurden aber aus humanitären Gründen als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt. Im Februar 2017 erhielten sie einen Aufenthaltstitel.
Daraufhin beantragte die Kommune bei der Familienkasse die rückwirkende Kindergeldzahlung, um diese mit den zuvor gewährten Asylbewerberleistungen verrechnen zu können. Die Kommune berief sich darauf, dass anerkannte Flüchtlinge ebenfalls ab sechs Monaten ihres Aufenthalts in Deutschland rückwirkend Kindergeld erhalten können. Hier stand der Zeitraum Juli bis November 2016 im Streit.
Doch der rückwirkende Kindergeldanspruch besteht nicht für subsidiär Schutzberechtigte, entschied der BFH. Die Mutter könne für ihre Kinder erst Kindergeld ab dem Zeitpunkt erhalten, an dem ihr ein Aufenthaltstitel wegen ihres subsidiären Schutzstatus gewährt wurde.
Zwar sehe das Vorläufige Europäische Abkommen über Soziale Sicherheit (VEA) für anerkannte Flüchtlinge einen Anspruch auf Leistungen wie das Kindergeld vor, wenn diese sich seit mindestens im Bundesgebiet aufgehalten haben. Die Mutter und ihre Kinder seien aber keine anerkannten Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern subsidiär Schutzberechtigte. Ein rückwirkender Kindergeldanspruch komme damit nicht infrage.
Az.: III R 19/20
München (epd). Für Umsätze von Geldspielautomaten in Spielhallen wird weiterhin Umsatzsteuer fällig. Zwar sind seit Juli 2021 nach einer Gesetzesänderung Automatenspiele im Internet umsatzsteuerfrei, für vor Ort aufgestellte Geldspielautomaten können unter anderem wegen unterschiedlicher Spielsuchtrisiken die Umsätze aber besteuert werden, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am 20. Oktober veröffentlichten Beschluss entschied.
Bis zum 30. Juni 2021 waren Umsätze aus dem Betrieb von Geldspielautomaten in Spielhallen und bei sogenannten virtuellen Automatenspielen generell umsatzsteuerpflichtig. Doch dann hatte der Gesetzgeber zum 1. Juli 2021 festgelegt, dass virtuelle Automatenspiele der Rennwett- und Lotteriesteuer unterliegen und damit umsatzsteuerfrei sind.
Für aufgestellte Geldspielgeräte vor Ort wurde weiterhin Umsatzsteuer fällig, dafür aber keine Rennwett- und Lotteriesteuer erhoben. Hintergrund der Regelungen war, dass Online-Angebote hinsichtlich der Spielsucht anders einzustufen sind als Angebote etwa in Spielhallen.
Diese Ungleichbehandlung sei auch zulässig, entschied der BFH nun. Vor Ort und im Internet erzielte Umsätze mit Spielautomaten seien schon nicht vergleichbar. So gebe es unterschiedliche Ausschüttungsquoten, einen potenziell größeren Kundenkreis online und unterschiedliche Spielsuchtrisiken, so dass eine unterschiedliche Besteuerung möglich sei.
Az.: XI B 9/22 (AdV)
Celle (epd). Jobcenter müssen einer Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen zufolge keine Kosten für den Einbau eines separaten Stromzählers zur Erfassung der Warmwasserbereitung übernehmen. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, teilte das Gericht am Montag mit. Das Eilverfahren hatte ein 63-jähriger Mann aus Seevetal angestrengt.
Beim Jobcenter Harburg hatte der Mann ein Angebot eines Elektrikers über den Einbau eines Drehstromzählers in Höhe von rund 700 Euro vorgelegt. Er begehrte die Kostenübernahme, da die gesetzliche Warmwasserpauschale in seinem Falle nicht ausreiche. Nach einer neuen Rechtslage ab 2021 könnten höhere Warmwasserkosten nur noch vom Jobcenter übernommen werden, wenn der Verbrauch durch einen Zähler nachgewiesen sei.
Das Jobcenter lehnte den Antrag ab mit der Begründung, dass es an einer Rechtsgrundlage für einen solchen Kostenübernahmeanspruch fehle. Es handele sich weder um Kosten zur Sicherung des Lebensunterhalts, noch um einen unabweisbaren Mehrbedarf. Demgegenüber hielt der Mann die Kosten für unabweisbar, da nunmehr ein Nachweis über die Mehrkosten erforderlich sei.
Das Landessozialgericht bestätigte die Rechtsauffassung des Jobcenters. Der Gesetzgeber gehe davon aus, dass die Warmwasserpauschalen grundsätzlich auskömmlich seien.
Az.: L 11 AS 415/22 B ER
Essen (epd). Kommunen dürfen die Schulbegleitung für Kinder mit Behinderung nicht mit einem Ausschreibungsverfahren für mehrere Jahre nur an einzelne ausgewählte Träger vergeben. Ein solches Verfahren verstoße gegen den Grundsatz der Angebots- und Trägervielfalt, gegen das Wunsch- und Wahlrecht der betroffenen Kinder sowie ihrer Eltern und sei rechtswidrig, entschied das Landessozialgericht NRW in Essen in einem am 26. Oktober veröffentlichten Urteil.
Im konkreten Fall geht es um die Stadt Düsseldorf, die nach Angaben des Gerichts 2016 ein solches Vergabeverfahren durchführte. Sie erteilte zwei Wettbewerbern den Zuschlag, für die folgenden vier Schuljahre die Schulbegleiterinnen und -begleiter zu stellen.
Dagegen klagten Wohlfahrtsverbände, die zuvor auf Grundlage von Verträgen mit der Stadt ebenfalls Integrationshelfer für behinderte Kinder beschäftigt hatten und sich davon nun ausgeschlossen sahen. Das Sozialgericht Düsseldorf wies die Klage zunächst ab, das Landessozialgericht gab ihr in der Berufung statt.
Eine Ausschreibung verstoße gegen den Grundsatz der Angebots- und Trägervielfalt, bemängelte das Gericht. Zudem werde das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten in unzulässiger Weise beschnitten, wenn die Auswahl der Leistungserbringer auf wenige Ausschreibungsgewinner reduziert werde. Damit werde den leistungsberechtigten Kindern und ihren Eltern kein Entscheidungsspielraum mehr belassen, welche Schulbegleiter sie auswählen.
Die vom LSG zugelassene Revision gegen das Urteil ist bereits beim Bundessozialgericht anhängig (B 8 SO 12/22 R).
Az.: L 12 SO 227/19
Straßburg (epd). Eine Polizeikontrolle allein wegen der dunklen Hautfarbe eines Bahnreisenden weist auf eine diskriminierende Identitätsüberprüfung hin. Führt der Reisende an, dass er und seine Tochter offenbar wegen seiner ethnischen Herkunft von der Bundespolizei kontrolliert wurde, müssen deutsche Gerichte eine mögliche Diskriminierung und Verletzung des Rechts auf Privatleben prüfen, urteilte am 18. Oktober der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg.
Anlass des Rechtsstreits war eine Personenkontrolle der Bundespolizei am 26. Juli 2012 in einem Zug, der aus Tschechien nach Deutschland kam. In dem Waggon saß auch der in Berlin lebende deutsche Kläger indischer Abstammung mit seiner Tochter. Die Polizisten führten nur bei ihnen stichprobenhaft eine Identitätskontrolle durch und begründeten das damit, dass in dem Zug häufiger Zigaretten geschmuggelt würden. Einen konkreten Verdacht hatten die Beamten nicht gegen sie.
Der Mann fühlte sich diskriminiert. Er sei offensichtlich allein wegen seiner dunklen Hautfarbe kontrolliert worden. Andere Personen seien von der Kontrolle verschont geblieben. Vor deutschen Gerichten wollte er die Rechtswidrigkeit der Kontrolle feststellen lassen.
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) wies die Klage des Berliners als unzulässig ab. Identitätskontrollen nach dem Grenzübertritt seien weder ungewöhnlich noch stigmatisierend. Die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde hatte ebenfalls keinen Erfolg.
Doch damit wurde der Kläger in seinem Recht auf Achtung der Privatsphäre verletzt und auch gegen das Diskriminierungsverbot verstoßen, urteilte nun der EGMR. Ob der Kläger allein wegen seiner ethnischen Herkunft kontrolliert wurde, könne zwar nicht belegt werden. Werde jedoch ohne konkreten Anlass allein eine Person mit dunkler Hautfarbe von der Polizei kontrolliert, bestehe der Verdacht des sogenannten Racial Profilings, bei dem die Polizei zu kontrollierende Personen nach körperlichen und eth-nischen Merkmalen auswählt.
Das dürften Gerichte nicht ignorieren, forderte der EGMR. Zu prüfen sei, ob rassistische Motive, ethnischer Hass oder Vorurteile eine Rolle bei der Kontrolle gespielt haben. Hierzu hätten die Gerichte etwa die Polizisten und die Tochter als Zeugen anhören müssen. Weil der Kläger keine Entschädigung beantragt hatte, musste der EGMR auch keine Zahlung festlegen.
Az.: 215/19

Berlin (epd). Claudia Mandrysch wird nach einem Beschluss des Präsidiums der Arbeiterwohlfahrt (AWO) 2023 Vorständin des AWO-Bundesverbandes. Ab November wird Mandrysch zunächst in Teilzeit ihren Dienst beginnen und ab Januar in Vollzeit als Vorständin tätig werden.
Nach einer Ausbildung der Sozialen Arbeit und Weiterbildungen sammelte sie Praxiserfahrungen in der Sozial- und Suchttherapie. Danach war Mandrysch über viele Jahre als Führungskraft in der Wohlfahrtspflege tätig. Sie verfügt zudem über langjährige Erfahrung in der Führungskräfte- und Organisationsberatung. Mandrysch ist eine ehemalige Fußballspielerin. Für die Nationalmannschaft bestritt sie 1995 zwei Länderspiele.
Brigitte Döcker, Vorstandsvorsitzende des AWO-Bundesverbandes, begrüßte die Personalentscheidung des Präsidiums: „Mit Claudia Mandrysch gewinnen wir eine Kollegin im Bundesvorstand, die ihre Führungsqualitäten unter anderem in der Führung eines Trägers der Wohlfahrtspflege mit 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgewiesen hat.“
Die Arbeiterwohlfahrt gehört zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege. Sie wird bundesweit von mehr als 300.000 Mitgliedern, mehr als 72.000 ehrenamtlich engagierten Helferinnen und Helfern sowie rund 242.000 hauptamtlich Beschäftigten getragen.
Alexander Manz (41) ist seit Beginn der Monats Chef der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Mannheim. Der Betriebswirt hat seit 22 Jahren verschiedene Aufgaben bei dem Sozialverband erledigt. Einst kam er als Zivildienstleistender. Manz tritt die alleinige Nachfolge der Doppelspitze aus Rolf Lang und Angelika Weinkötz an. Beide verlassen den 650 hauptamtliche Mitarbeiter und 850 Mitglieder zählenden Wohlfahrtsverband, der Träger von 15 Sozialeinrichtungen ist.
Marcel Thum (57) ist neuer Vorsitzender des Kuratoriums des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden. Er wurde an die Spitze des Beirates gewählt und tritt die Nachfolge von Ursula M. Staudinger an, die nach zehn Jahren turnusgemäß aus dem Kuratorium ausscheidet. Thum lehrt an der Technischen Universität Dresden und ist Direktor der dortigen Niederlassung des ifo Instituts. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die politische Ökonomie, Finanzwissenschaften, der Arbeitsmarkt und die Demografie. Das BiB ist eine Ressortforschungseinrichtung des Bundes mit Sitz in Wiesbaden und einem Büro in Berlin. Ein 18-köpfiges Kuratorium begleitet dessen Forschung.
Markus Engstler, Würzburger Parasitologe, ist mit dem diesjährigen Memento Forschungspreis für vernachlässigte Krankheiten geehrt worden. Wie die Memento Koordination und das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ mitteilten, erhielt der Wissenschaftler am Biozentrum der Universität Würzburg die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Grundlagenforschung zum Erreger der Schlafkrankheit. Der Memento Preis wurde 2014 ins Leben gerufen. Ziel des Preises ist es, die Aufmerksamkeit auf die Gesundheitsbedürfnisse von Menschen in ärmeren Ländern zu lenken.
Hans Otto Thiele, ehemaliger Richter am Bundessozialgericht, ist tot. Er starb am 20. Oktober im Alter von 84 Jahren. Der gebürtige Kölner war nach zunächst in den höheren Dienst beim damaligen Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung eingetreten. Unterbrochen durch einen Studienaufenthalt beim Internationalen Arbeitsamt in Genf und eine Abordnung an das Bundesversicherungsamt in Berlin, war er bis zu seinem Wechsel an das Bundessozialgericht im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung tätig, zuletzt als Ministerialrat. Im März 1989 wurde Thiele zum Richter am Bundessozialgericht ernannt. Ab 1999 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2003 gehörte er als stellvertretender Vorsitzender dem für das Recht der gesetzlichen Unfallversicherung zuständigen 2. Senat an. Von 1993 bis 1998 war er Mitglied des Präsidiums des Bundessozialgerichts.
Wir haben Tagungen, Seminare, Workshops und Webinare aufgelistet, die aktuell geplant sind. Wegen der Corona-Epidemie sagen Veranstalter allerdings Termine auch kurzfristig ab. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, das zu beachten.
2.11. Hannover:
Fachtag: Wohlfahrt queer gedacht und queer gemacht
des Lesben- und Schwulenverbandes
Tel.: 030/78954778
3.-4.11.:
Online-Fortbildung „Keine Krise mit der Krise - Hilfreich bleiben auch in Ausnahmesituationen“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
7.11.:
Online-Kurs: „Rechtliche Beratung in der Wohnungslosenhilfe - Mehr GeRECHTigkeit auf der Straße“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
7.-11.11.:
Online-Veranstaltung „Digitalisierung in der Sozialwirtschaft: Wie viel digital muss sozial?“
der VRG Micros
Tel.: 0441/3907-118
17.11. Köln:
Seminar „Compliance Management im Sozialwesen“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 002203/8997-221
18.11.:
Online-Seminar „Kompetent online beraten per Video“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700
21.11. Filderstadt:
Fortbildung „Rechtliche Grundlagen in der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/488 37-495
22.11.:
Online-Seminar „Leichter als gedacht: Fördermittel einwerben & nachhaltige Finanzierung finden“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-10
22.-23.11.:
Online-Seminar: „Datenschutzmanagementsysteme in sozialen Einrichtungen“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbands
Tel.: 0761/2001700
23.11: Köln:
Seminar „Basiswissen Altenhilfe“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-199
23.11.:
Online-Seminar: „Wie wir Konflikte besser bewältigen“
Tel.: 030/26309-139
24.11.:
Online-Seminar: „Spurwechsel für Fachkräfte? Chancen für AsylbewerberInnen mit Qualifikationen aus dem Herkunftsland“
Tel.: 030/26309-139
28.-29.11. Berlin:
Fortbildung „Das operative Geschäft: Steuerung und Controlling in der Eingliederungshilfe“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
Seminar „Steuer-Update für Non-Profit-Organisationen“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-221
29.-30.11. Netphen:
Seminar „... und die Jugendlichen, die zu uns kommen, werden immer schwieriger“
Tel.: 030 26309-139
30.11.:
Online-Seminar „Der 'Worst Case'-Fall - anzeigepflichtige Straftaten und Suizidankündigung in der Online-Beratung“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700