 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 29/2023 - 21.07.2023
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 29/2023 - 21.07.2023
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 29/2023 - 21.07.2023
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 29/2023 - 21.07.2023

die Pflege im Heim wird immer teurer. Die Zuzahlungen sind in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen, wie eine Analyse der Ersatzkassen zeigt. Der Hauptgrund sind Lohnerhöhungen bei den Pflegekräften: Seit September müssen Einrichtungen, die mit den gesetzlichen Pflegekassen abrechnen wollen, Tariflohn zahlen. Bei Zuzahlungen, die im bundesweiten Schnitt 2.548 Euro pro Monat betragen, wird der Heimaufenthalt zur Armutsfalle. Sozialverbände dringen deshalb auf Entlastungen für die Betroffenen. Die Länder sollen sich an der Finanzierung der Investitionen beteiligen, fordern sie.
Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Deshalb tragen Hochrisikopatienten noch immer eine FFP-Maske - und müssen sich dafür „ständig in der Öffentlichkeit rechtfertigen“, klagt die Betroffene Karen Braun. Sie muss Kommentare ertragen wie: „Verbring doch den Rest deines Lebens im Keller.“ Braun hat mit Unterstützung der Stadt Würzburg eine Selbsthilfegruppe gegründet, die erste in Bayern. Das „Team Vorsicht“ trifft sich regelmäßig im Freien, so heben die Mitglieder ein wenig die selbst gewählte Isolation auf.
Seit September 2022 besteht in Deutschland für Arbeitgeber die Pflicht, die Arbeitszeiten ihrer Angestellten systematisch zu erfassen. Unbezahlte Überstunden sollen damit der Vergangenheit angehören. Wie die Vorschrift in der Sozialbranche umzusetzen ist, etwa in der aufsuchenden Familienhilfe oder der ambulanten Pflege, wo Arbeit oft außerhalb des Büros stattfindet, erklärt die Münchner Rechtsanwältin Alexandra Callies im epd-Interview.
Ausländer ohne Krankenversicherungsschutz haben im akuten Notfall Anspruch auf medizinische Behandlung auf Kosten des Sozialstaats. Selbst wenn die erkrankte Person kein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, kann sich die behandelnde Klinik die Kosten für die Notfallbehandlung von der Sozialhilfe wieder zurückholen, urteilte das Bundessozialgericht.
Lesen Sie täglich auf dem Twitteraccount von epd sozial Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Twitterkanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.
Ihr Markus Jantzer

Berlin, Frankfurt a. M. (epd). Wer einen Heim-Pflegeplatz braucht, muss aktuell mit einem Eigenanteil von 2.548 Euro pro Monat rechnen. Im Bundesdurchschnitt lagen die Preise für das erste Jahr im Heim um 348 Euro über denen des Vorjahres, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) am 18. Juli in Berlin mitteilte. Im zweiten Jahr werden 292 Euro mehr fällig, im dritten Jahr 236 Euro und nach drei Jahren 165 Euro.
Die Staffelung hat damit zu tun, dass die Pflegekassen seit 2022 mit der Aufenthaltsdauer steigende Zuschüsse zu den Kosten zahlen, die die Heimbewohnerinnen und -bewohner selbst tragen müssen. Der große Preissprung im Vergleich zum Vorjahr ist laut Ersatzkassenverband auf die gestiegenen Personalkosten zurückzuführen. Seit September 2022 müssen alle Heime, die mit den Pflegekassen abrechnen, ihr Personal mindestens in Höhe der geltenden Tarife bezahlen.
„Eine faire Bezahlung des Pflegepersonals und die Sicherstellung einer angemessenen Personaldecke in Pflegeheimen werden von uns ausdrücklich begrüßt“, sagte der Sprecher der vdek-Landesvertretung NRW, Christian Breidenbach. Es sei jedoch „inakzeptabel“, dass die steigenden Kosten zum Großteil von den Pflegebedürftigen getragen werden müssten. „Wenn der Aufenthalt im Pflegeheim von immer mehr Menschen nicht mehr bezahlt werden kann, ist das System grundsätzlich in Schieflage“, mahnte er. Notwendig sei deshalb „eine Lösung zur nachhaltigen Entlastung der Pflegebedürftigen, die nicht allein auf dem Rücken der Beitragszahler lastet“.
Heimbewohner zahlen nicht nur für ihre Pflege den Teil der Kosten selbst, der nicht durch die Pflegeversicherung abgedeckt ist, sondern auch für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten. So kommen die hohen Eigenanteile zustande: Für Unterkunft und Essen werden im Bundesdurchschnitt 888 Euro im Monat berechnet. Die Investitionskosten der Anbieter betragen laut vdek-Daten im Bundesdurchschnitt 477 Euro.
Carsten Göken, stellvertretender Leiter des vdek Niedersachsen, forderte vom Land eine Übernahme von Investitionskosten, etwa für Ausstattung und Instandhaltung der Heime, so wie dies im Krankenhaus-Sektor üblich sei. Auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte die Länder auf, ihren Teil dazu beizutragen, „die Zukunftssicherheit der Pflegeversicherung herzustellen“. Eine Übernahme der Investitionskosten entlaste jeden Heimbewohner um mehrere Hundert Euro im Monat, argumentierte auch die Caritas.
Ein Verbände-Bündnis, dem der Paritätische Gesamtverband, der Sozialverband Deutschland und der DGB angehören, setzt sich angesichts der ausufernden Kosten für eine Pflegevollversicherung ein. Fast ein Drittel der Heimbewohnerinnen und -bewohner sei inzwischen auf Sozialhilfe angewiesen, Pflegebedürftigkeit werde zur Armutsfalle, warnten die Akteure. Wilfried Wesemann, Vorsitzender des Deutschen Evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege (Devap) sagte: „Wir brauchen dringend ein Sofortprogramm, um die Situation für die Betroffenen zu verbessern.“
Vor dem Hintergrund der aktuellen Tarifentwicklung und der seit 1. Juli umzusetzenden neuen Personalbemessung in der Pflege sei davon auszugehen, dass der Eigenanteil bis zum Jahresende weiter ansteige, sagte Claudia Ackermann, Leiterin der vdek-Landesvertretung Hessen. „Die durch das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz ab 1. Januar 2024 geltende Erhöhung der Zuschläge durch die Pflegekassen dürften den Trend nur kurzfristig abmildern.“
Der Verband der Ersatzkassen berichtet regelmäßig über die Eigenbeteiligung der Heimbewohnerinnen und -bewohner in Deutschland. Die aktuelle Datenauswertung gibt den Stand von Anfang Juli dieses Jahres wieder.

Berlin (epd). Die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, erwartet von der Bundesregierung eine gründliche Überarbeitung der Rechtsgrundlagen gegen Diskriminierung. Sie stellte am 18. Juli in Berlin ein Grundlagenpapier mit ihren Vorschlägen vor. Sie zielen darauf, den Schutz vor Benachteiligungen im Alltagsleben zu erweitern und durchzusetzen.
Ataman sagte, Deutschland habe eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze in Europa. Die Menschen hätten es schwer, ihre Rechte durchzusetzen. Die Ampel-Koalition plant eine Reform des Gesetzes mit dem Ziel, den Schutz gegen Diskriminierung auszuweiten, hat bisher aber noch keinen Vorschlag vorgelegt.
Ataman dringt darauf, die sogenannte Kirchenklausel im Antidiskriminierungsrecht zu streichen. Die Streichung des entsprechenden Paragrafen im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes würde dazu führen, dass die Ausnahmeregelungen für Kirchen eingeschränkt würden.
Kirchen und als Körperschaften öffentlichen Rechts anerkannte Religionsgemeinschaften dürfen andere Kriterien an Beschäftigte anlegen als alle anderen Arbeitgeber. Zentral ist, dass die Religionszugehörigkeit entscheidend dafür sein kann, ob eine Bewerberin oder Bewerber in einer kirchlichen Einrichtung beschäftigt wird.
Eine 2016 vorgelegte Evaluation des AGG hatte bereits eine stärkere Differenzierung bei der Kirchenklausel vorgeschlagen. Das Gutachten legte nahe, dass im verkündigungsnahen Bereich Anforderungen an die religiöse Zugehörigkeit gerechtfertigt sein können, für Beschäftigte der Wohlfahrtsverbände der Kirchen wie Ärzte und Erzieherinnen aber die gleichen Regeln gelten sollten wie für Beschäftigte bei weltlichen Arbeitgebern. Die Evangelische Kirche und katholische Deutsche Bischofskonferenz (DBK) wollten den Ataman-Vorschlag nicht kommentieren.
Auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) erklärte der DBK-Sprecher, alle Bistümer bis auf zwei hätten das reformierte Arbeitsrecht umgesetzt, wonach die Loyalitätsvorschriften für Beschäftigte in katholischen Einrichtungen im vorigen Jahr gelockert worden waren. Kündigungen sind nur noch bei schweren Verstößen gerechtfertigt, nicht mehr hingegen allein deshalb, weil ein Geschiedener wieder heiratet oder mit einem gleichgeschlechtlichen Partner lebt.
Grundlage des Diskriminierungsschutzes ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das nach kontroversen Debatten 2006 eingeführt wurde. Danach darf niemand wegen seines Geschlechts, seiner ethnischen Herkunft, der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen Identität oder aus Gründen der Rasse benachteiligt werden. Damals wurde von den Gegnern des Gesetzes eine Klagewelle befürchtet.
Es ist anders gekommen: Ataman zufolge ergingen seitdem von rund 316.000 Zivil- und Arbeitsgerichtsentscheidungen nur 700 zu Fällen nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Demgegenüber geben in Umfragen aber 60 Prozent der repräsentativ Befragten an, schon einmal diskriminiert worden zu sein. Eine klare Mehrheit der Bevölkerung von 88 Prozent hält Diskriminierungsschutz für ein wichtiges Thema. Ataman sprach in Bezug auf die Rechtsdurchsetzung von der „Achillesferse des Gesetzes“.
Die Beauftragte fordert, die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen wegen Diskriminierung und sexueller Belästigung von zwei auf zwölf Monate zu verlängern und Verbandsklagen zuzulassen. Eine weitere hohe Hürde ist Ataman zufolge, dass jemand, der eine Diskriminierung vor Gericht bringen will, Indizien vorlegen muss. Absagen für Jobs oder Wohnungen werden aber häufig nicht begründet. Daher müsse es ausreichen, dass die Betroffenen glaubhaft machen, dass sie wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder etwa ihres Alters nicht zum Zuge gekommen seien.
Die Ampel-Koalition will das Gleichbehandlungsgesetz reformieren, um den Rechtsschutz zu verbessern, Schutzlücken zu schließen und den Anwendungsbereich des AGG auszuweiten. Ataman schlägt vor, weitere Merkmale zu prüfen, etwa Benachteiligungen wegen des sozialen Status' oder der Staatsangehörigkeit. Das würde etwa bedeuten, dass ein Vermieter Wohnungsbewerber nicht allein deshalb ausschließen dürfte, weil sie Sozialleistungen empfangen.
Berlin (epd). Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dürfen Arbeitgeber bei Stellenbesetzungen Bewerber nicht unterschiedlich wegen ihrer Religionszugehörigkeit behandeln. Für Religionsgemeinschaften selbst gibt es aber eine Ausnahme, die in Paragraf 9 des AGG - auch Kirchenklausel genannt - festgelegt ist.
Demnach ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder Weltanschauung zulässig, wenn etwa die Kirchenzugehörigkeit im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaft oder nach Art der Tätigkeit eine „gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt“. Unstrittig ist etwa, dass eine Kirche verlangen kann, dass ein von ihr beschäftigter Pfarrer selbst der Kirche angehört. Zunehmend umstritten ist aber, ob diese Voraussetzung auch bei Fachreferentinnen oder Krankenpflegern in jedem Fall gerechtfertigt ist.
Das Bundesarbeitsgericht sprach 2018 einer konfessionslosen Bewerberin, die beim Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung eine Referentenstelle nicht bekommen hatte, eine Entschädigung zu. Die endgültige Klärung liegt beim Bundesverfassungsgericht.
Eine 2016 vorgelegte Evaluation des 2006 inkraft getretenen AGG schlug eine stärkere Differenzierung bei der Kirchenklausel vor. Das Gutachten legte nahe, dass im verkündigungsnahen Bereich Anforderungen an die religiöse Zugehörigkeit gerechtfertigt sein können, für Beschäftigte der Wohlfahrtsverbände der Kirchen wie Ärzte und Erzieherinnen aber die gleichen Regeln gelten sollten wie für Beschäftigte bei weltlichen Arbeitgebern.

Ludwigsburg (epd). Die Kirche hat aus Sicht der Soziologin Johanna Possinger in der Familienarbeit einiges versäumt. Die Professorin für Frauen- und Geschlechterfragen in der Sozialen Arbeit an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg erklärt im Interview, was die Kirche hier künftig besser machen kann. Die Fragen stellte Susanne Schröder.
epd sozial: Frau Possinger, Sie haben zwei Jahre lang zu der Frage geforscht, was Familien heutzutage von Kirche brauchen. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse?
Johanna Possinger: Familien brauchen eine Kirche, die sie in ihrer Lebensrealität überhaupt erstmal wahrnimmt. Die einhellige Rückmeldung der 40 Befragten unserer Studie war, dass sie sich weder mit ihren Alltagsnöten noch in ihren jeweiligen Familienkonstellationen gesehen fühlen. Sie nehmen Kirche als weitgehend desinteressiert wahr. Dann wünschen sich Familien von Kirche mehr Angebote in ihrem Sozialraum, die ihnen im Alltag einen Mehrwert anbieten, ihnen also etwas abnehmen und sie entlasten. Schließlich hat Kirche für Familien einen großen Charme, weil sie Begegnungen anbietet. Austausch, Gemeinschaft und Unterstützung in Netzwerken schätzen Familien sehr - aber sie möchten, dass solche Angebote weltoffen gestaltet sind, mit einer Willkommenskultur für die verschiedensten Ansichten, Religionen und Lebensmodelle.
epd: Nehmen Familien Kirche im Konzert der Anbieter überhaupt noch wahr? Welche Andockpunkte kann Kirche nutzen?
Possinger: Wir haben bei allen Befragten festgestellt, dass Menschen einen neuen Zugang zu Glaubensfragen bekommen, wenn ein Kind unterwegs ist. Elternschaft wirft viele Fragen auf: Welche Werte und Weltanschauungen wollen wir unseren Kindern mitgeben? Sollen wir überhaupt etwas vorgeben? Welche Rolle spielt dabei die Konfession? Diese Phase im Leben junger Familien birgt total viel Potenzial für Kirche! Die Verunsicherung nach der Geburt des ersten Kindes ist so groß, die Fragen sind so zahlreich. Familien wären in dieser Phase sehr offen und auch dankbar für ortsnahe Angebote von Kirche. Das könnten Familiencafés oder Eltern-Kind-Gruppen oder Frühstücktreffs sein - ohne Anmeldung, einfach zum spontanen Vorbeikommen. Wir hören von Menschen in Kirchengemeinden, dass sie selbst über solche Angebote den Einstieg ins kirchliche Ehrenamt gefunden haben.
epd: Warum passiert in dem Bereich dann nicht viel mehr?
Possinger: Wir haben für unsere Studie auch 40 Gemeinden befragt, die bereits eine erfolgreiche Familienarbeit machen. Von den Hauptamtlichen hören wir, dass es oft ein langer Kampf ist, zum Beispiel Eltern-Kind-Gruppen als wichtigen Teil kirchlicher Arbeit in der Gemeinde zu etablieren. Da debattiert dann der Kirchenvorstand darüber, dass solche Gruppen nur Dreck und Lärm machen und dabei nicht mal in der Bibel lesen. „Das hat doch nichts mit Kirche zu tun“, ist eine verbreitete Ansicht, die exemplarisch für viele Gemeinden gilt.
Aber Bibelkreise sind nicht das, was die meisten Familien wollen. Viele sind oft durchaus offen für spirituelle Impulse - aber zugleich sehr sensibel gegenüber Missionierungsversuchen. Unsere Studie zeigt, dass Familien von Kirche beides brauchen: Gemeindearbeit mit Gottesdiensten und ähnlichem - und Gemeinwesenarbeit, die den Austausch und die Begegnung der Familien fördert mit lebensdienlichen Angeboten, die im Alltag entlasten und einen echten Mehrwert schaffen. Und da ist noch viel Bewusstseinsarbeit nötig.
epd: Woher kommt der nötige Perspektivwechsel in den Gemeinden, in den Landeskirchen?
Possinger: In den Gemeinden muss es eine Person in die Hand nehmen. Es braucht eine neue Prioritätensetzung und eine verbindliche Haltung dazu, dass Familien ein Schwerpunkt in der Arbeit werden sollen. Man muss prüfen, welche Angebote schon da sind, was noch fehlt, was gebraucht wird. Auf der Ebene der Landeskirchen braucht es ein Bewusstsein dafür, dass es Menschen gibt, die ein Angebot suchen, es aber nicht finden. Es braucht das Bewusstsein, dass man an dieser Stelle investieren muss, wenn Kirche in 20 oder 30 Jahren noch relevant sein soll.
Und es braucht einen politischen Willen, denn das kostet Geld. Und man muss natürlich Hauptamtliche für dieses Handlungsfeld schulen, familiensoziologisches Wissen in die Ausbildung integrieren. Die Jugendarbeit ist in der Kirche an vielen Stellen gut verankert. Aber von Familien spricht kaum jemand. Außerdem könnte man Gemeinden mit guter Familienarbeit vernetzen - das sind bislang meistens Einzelkämpfer. Man könnte Tagungen, runde Tische, Gütesiegel erfinden, um Anreize für diese Arbeit zu schaffen.
epd: Manche Gemeinden haben vielleicht Scheu, einen Eltern-Kind-Kurs anzubieten, den es genauso auch bei kommunalen Bildungsträgern gibt - weil sie es nicht für ihre Kernkompetenz halten …
Possinger: Für Familien geht es darum, passende Angebote in Wohnortnähe zu haben. Im ländlichen Bereich haben die Kirchen manchmal eine bessere Infrastruktur als andere Anbieter. Kirchengemeinden sollten solche „weltlichen“ Angebote einfach mal ausprobieren. Denn wenn man darauf wartet, die Kinder im Religionsunterricht zu gewinnen, ist es vielleicht schon zu spät. Man kann Familien nur durch Lebensbegleitung von Anfang an zeigen, dass Kirche für sie da ist. Das geht schon vor der Familiengründung los, zum Beispiel mit Angeboten für Paare, um sich gemeinsam über Lebensfragen klar zu werden. Spirituelle Fragen treiben Eltern um. In einer Eltern-Kind-Gruppe der Gemeinde kann man darüber sogar besser ins Gespräch kommen als bei einem kommunalen Anbieter. Das kann ein echter Mehrwert von evangelischer Familienarbeit sein. Ich kann Gemeinden nur ermutigen, mit Familien ins Gespräch zu kommen, nachzufragen, was sie brauchen, Angebote auszuprobieren und dann zu sehen, ob sie ankommen.
Berlin (epd). Die Sparvorgaben für den Bundeshaushalt treffen auch die Freiwilligendienste. In den kommenden beiden Jahren sollen die Mittel für die Jugendfreiwilligendienste und den Bundesfreiwilligendienst um insgesamt 113 Millionen Euro gekürzt werden, wie das Bundesfamilienministerium auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) bestätigte. Angesichts der Härte der Haushaltsverhandlungen hätten die nötigen Mittel für den bedarfsgerechten Ausbau der Dienste leider nicht gesichert werden können, erklärte das Ministerium.
Die Diakonie Deutschland rechnet vor, die Pläne bedeuteten einen Rückgang der Mittel um mehr als ein Drittel (35 Prozent). Vorständin Maria Loheide warnte, es drohe jede vierte Freiwilligenstelle wegzufallen. Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend (aej) erklärte mit Blick auf die Rhetorik der Ampel-Koalition, „gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fordern und gleichzeitig ein wichtiges Instrument kaputtzusparen, passt politisch nicht zusammen“.
Im Einzelnen sollen die Ausgaben für den Bundesfreiwilligendienst von 207 Millionen Euro in diesem Jahr auf gut 154 Millionen Euro im nächsten Jahr und 2025 noch einmal auf gut 134 Millionen Euro sinken. Den Jugendfreiwilligendiensten steht eine Etat-Kürzung von derzeit 120 Millionen Euro in zwei Schritten auf gut 80 Millionen Euro bevor. Diese betrifft das freiwillige soziale oder ökologische Jahr für junge Menschen im In- und Ausland. Im Bundesfreiwilligendienst können sich Erwachsene jeden Alters engagieren.
Das Ministerium erklärte, Aussagen zu zukünftigen Platzzahlen seien frühestens im Herbst 2023 möglich. Der in diesem Sommer startende Jahrgang an Freiwilligen könne aber noch „im vollen Umfang bis zum Ablauf im Sommer 2024 finanziert werden“. Im auslaufenden Freiwilligenjahr engagieren sich knapp 54.000 Jugendliche. Rund 36.000 Menschen leisten einen Bundesfreiwilligendienst.
SPD, Grüne und FDP hatten im Koalitionsvertrag angekündigt, sie würden die Plätze „nachfragegerecht ausbauen“. Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln hat nach eigenen Angaben keinen Überblick, wie viele Plätze es derzeit und künftig für wie viele Bewerberinnen und Bewerber gibt. Ein Sprecher sagte, die Interessenten richteten ihre Anfragen direkt an die Anbieter.
Die Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche, Anne Gideon, sagte dem epd, sie „bedaure sehr“, dass der Haushaltsplan des Bundes „massive Kürzungen“ vorsehe. „Kindergrundsicherung, Elterngeld und Freiwilligendienst dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden“, betonte Gideon angesichts der Streitigkeiten in der Koalition um den Etat von Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Wenn Menschen Freiwilligendienste leisteten, sei das gut für sie und die Gesellschaft, sagte Gideon.
Auch aus den Ampel-Fraktionen kommt Kritik. Die jugendpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Emilia Fester, sagte dem epd, die Koalition habe sich vorgenommen, die Freiwilligendienste zu stärken und durch ein höheres Taschengeld und Teilzeitmöglichkeiten attraktiver zu machen. Die Reformpläne lägen bereit, versicherte Fester: „Für die angemessene Finanzierung der Träger werden wir in den Haushaltsverhandlungen streiten.“
Der Bundestag berät nach der Sommerpause über den Bundeshaushalt für 2024, den das Kabinett bereits gebilligt hat. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte den Ministerien Sparvorgaben gemacht. Der familienpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Matthias Seestern-Pauly, äußerte sich ebenfalls kritisch, sieht die Verantwortung aber bei den Grünen. Er sagte dem epd, die Kürzungen von Familienministerin Paus seien „sehr schmerzlich“. Seine Fraktion werde sich „im Zuge der parlamentarischen Haushaltsberatungen genau anschauen, ob wir hier nicht noch zu Verbesserungen kommen können.“
Paderborn (epd). Nach einer erfolgreichen Unterschriftenkampagne muss sich der Petitionsausschuss des Bundestags mit der Forderung zur Stärkung des Freiwilligendienstes befassen. Die Kampagne „Freiwilligendienst stärken“ hat mehr als 100.500 Unterstützer gefunden, wie die Caritas Paderborn am 20. Juli mitteilte. Damit habe die Petition deutlich das Quorum von 50.000 Unterschriften überschritten. Im Herbst werde es eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestags geben.
Die zahlreichen Unterschriften machten deutlich, dass die aktuellen Bedingungen in den Freiwilligendiensten bereits länger nicht mehr tragbar seien, erklärte die Antragstellerin Marie Beimen, die aktuell ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Marienkrankenhaus Schwerte leistet. Dass die Bundesregierung die Freiwilligendienste zusammenkürzen wolle und in Kauf nehme, dass jeder vierte Platz in einer Einsatzstelle wegfalle, sei eine Katastrophe. „Wir werden bei unserer Anhörung ganz klarmachen: Wir brauchen jetzt eine Stärkung, keine Streichung“, erklärte sie.
Durch die geplanten Streichungen seien viele Einsatzstellen und Strukturen gefährdet, erklärte Beimen. Wenn jeder vierte Freiwilligenplatz wegfallen würde, wären das bundesweit rund 30.000 Freiwillige.
Im kommenden Jahr sollen der Caritas zufolge die Gelder für die beiden Freiwilligendienste, das Freiwillige Soziale Jahr und der Bundesfreiwilligendienst um 78 Millionen Euro gekürzt werden. Das entspreche rund 24 Prozent aller Bundesmittel, hieß es. Bis 2025 sollen die Mittel insgesamt sogar um rund 35 Prozent gekürzt werden.
Die Petition fordert unter anderem bessere Rahmenbedingungen für Freiwillige und deutlich mehr finanzielle Förderung der Freiwilligendienste im In- und Ausland durch den Bund und die Bundesländer. Die Kampagne „Freiwilligendienst stärken“ wird getragen von Freiwilligen verschiedener Dienste und Träger. Zu den Unterstützern gehört unter anderem auch die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe.

Würzburg, Wasserburg am Inn (epd). Karen Braun trifft sich mit anderen Menschen nur unter einer Bedingung: Das Treffen muss draußen stattfinden. Innenbereiche meidet sie seit März 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie. Die 58-Jährige bezeichnet sich selbst als „Corona-Vorsichtige“.
Um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, hat Braun in Würzburg die Selbsthilfegruppe „Team Vorsicht“ gegründet. Die Stadt hat sie dabei unterstützt.
Braun trägt ein grünes T-Shirt, eine graue Strickjacke und eine weite, legere Leinenhose. Ihre roten Haare trägt sie zu einem lockeren Zopf zusammengebunden. Um ihren Hals hängt eine weiße FFP-2-Maske.
Auf ihre Maske werde sie häufig angesprochen. „Wieso müssen sich Menschen, die freiwillig Maske tragen, ständig rechtfertigen?“, fragt sie. Schiefe Blicke und übergriffige Kommentare erhalte sie oft. In sozialen Medien sei der Ton noch rauer. „Da gibt es Kommentare wie ‚Verbring doch den Rest deines Lebens im Keller‘“, erzählt sie. Ob sie es manchmal vermisse, gemeinsam mit Freunden in ein Restaurant zu gehen? „Ja, schmerzlich“, sagt die Würzburgerin. „Ich fühle mich isoliert.“
Welche Folgen soziale Isolation auf die Psyche der Betroffenen haben kann, weiß Psychiater und Psychotherapeut Peter Zwanzger, Chefarzt am kbo-Inn-Salzach-Klinikum im bayrischen Wasserburg am Inn und Präsident der Gesellschaft für Angstforschung. „Mangelnde soziale Interaktion kann zu psychischen Problemen bis hin zu depressiven Verstimmungen führen“, sagt er, betont aber auch, dass sich hier keine Verallgemeinerung treffen lasse.
„Die Folgen fehlender Kontakte zu anderen Menschen sind von Person zu Person unterschiedlich“, sagt Zwanzger, der auch Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde ist. „Es ist elementar wichtig, soziale Kontakte zu Familie, Freunden und Bekannten zu pflegen.“ Das sei für die psychische Stabilität genauso wichtig wie gesunde Ernährung und Bewegung.
Bei Karen Braun kamen in der Pandemie zur Angst vor einer Ansteckung finanzielle Probleme hinzu. Sie ist selbstständige Musikerin und Stimmlehrerin. Seit dem Ausbruch der Pandemie arbeitet sie nicht mehr in Innenräumen, was zur Folge hat, dass sie den Großteil an Aufträgen ablehnen muss. „Das macht sich im Geldbeutel bemerkbar“, sagt sie.
Untätig sei sie dennoch nicht. Sie arbeitet ehrenamtlich in der Klinikseelsorge der Theresienklinik in Würzburg und bildet sich fort. Auf diese Idee kam sie durch ihre 20-jährige Arbeit als Musiktherapeutin auf der Palliativstation in einem Schweinfurter Krankenhaus.
Braun gehört nach eigenen Angaben aufgrund einer Vorerkrankung zur Hochrisikogruppe. Sie ist fünfmal geimpft. Bisher konnte sie eine Ansteckung mit dem Coronavirus vermeiden. Sie ist davon überzeugt, dass die Maske sie schützt.
Laut Infektiologin Janina Zirkel am Universitätsklinikum Würzburg wird bei nur zwei Prozent der Patienten mit Atemwegsinfektion aktuell SARS-CoV-2 nachgewiesen. „Die Gefahr einer Ansteckung ist aktuell niedrig, aber nicht gleich null“, betont sie. Zirkel empfiehlt Risikopatienten deshalb, in Gebäuden und bei Veranstaltungen mit vielen Menschen weiterhin eine Maske zu tragen.
An dem Café gehen an diesem Nachmittag viele Menschengruppen vorbei, lachen, unterhalten sich und starten ausgelassen ins Wochenende. Keiner von ihnen trägt eine Maske. Für Karen Braun und viele weitere Risikopatienten liegt der Weg zurück in diese Normalität noch in weiter Ferne.

Ludwigshafen (epd). Manchmal sind es die kleinen gemeinsamen Momente, die Kraft im Pflegealltag geben. „Edith, wollen Sie noch etwas Bananenbrei essen?“, fragt der Pfleger die ältere demenzkranke Dame in dem Lehrvideo. Bisher saß sie nur teilnahmslos am Tisch, doch nun blickt sie den Mann an, der ihr das Essen reicht und sagt freundlich lächelnd: „Nein“.
Der Pfleger in einem Altenpflegeheim „hat das Anschlussmoment“ gefunden, kommentiert die freie Pflegeberaterin Karola Becker. Oft seien nur 30, 40 Sekunden der persönlichen Zuwendung nötig, um zu altersverwirrten, pflegebedürftigen Menschen durchzudringen. Das gemeinsame Lachen tue gut - und gebe Pflegefachpersonen Kraft in ihrem aufreibenden Job, sagt Becker. „Wir müssen die Goldmine finden, die jeder in sich hat.“
Viele der 16 Pflegefachpersonen aus Rheinland-Pfalz, die in einem Raum der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen zusammengekommen sind, nicken zustimmend. Sie haben sich angemeldet für das seit April laufende Pilotprojekt „Pro* Pflege“. Anbieter sind das Forschungsnetzwerk Gesundheit der Hochschule und die Graduate School Rhein-Neckar, finanziell gefördert wird es vom Land Rheinland-Pfalz, der Unfallkasse Rheinland-Pfalz und der Franziskusstiftung für Pflege.
In mehreren Kurseinheiten erhalten die Teilnehmenden vor allem online Fachwissen von Pflegeexperten, wie sie ihre körperliche und seelische Gesundheit stärken, wie sie widerstandsfähiger - „resilient“ - werden können, sagt die Projektleiterin, die Pflegewissenschaftlerin Andrea Kuhn von der Hochschule.
Sie sagt, die Herausforderungen für die Fachleute im Beruf seien enorm: Viele seien aufgrund des massiven Personalmangels körperlich und psychisch überlastet, erkrankten und verließen nicht selten frustriert ihren Job. Rund 1,7 Millionen Menschen waren in Deutschland im Jahr 2022 laut Bundesagentur für Arbeit in der Pflege beschäftigt.
Das Resilienzprojekt wolle in einer „Verbindung von Berufsethos, Pflegefachlichkeit und Gesundheit“ die Pflegeprofis unterstützen, erklärt Kuhn. Zugleich solle die Pflegeversorgung gesichert werden. Vor allem die psychische Belastung von in der Pflege tätigen Menschen sei bisher vernachlässigt worden, sagt Kuhn. Viele opferten sich mit hohem beruflichem Elan für ihre Patientinnen und Patienten auf - oft bis in den Burnout.
Für menschliche Zuwendung im Pflegealltag „haben wir nur wenig Zeit“, bekräftigt Lisa Georgens vom Westpfalz Klinikum mit Sitz in Kaiserslautern, das ein Projektpartner ist. Viele überlastete Pflegefachpersonen plage das Gefühl, sich nicht ausreichend um die ihnen anvertrauten Menschen kümmern zu können. Zahlreiche angehende Fachpersonen seien dem Leistungsdruck nicht gewachsen und brächen ihre Ausbildung ab, berichtet Natalia Buchholz vom DRK-Bildungszentrum für Gesundheitsberufe in Hachenburg im Westerwald.
Geradezu überlebenswichtig sei es deshalb für Pflegerinnen und Pfleger, ihre persönlichen Ressourcen zu entdecken, sie zu bewahren und aus eigener Kraft eine innere Balance zu finden, betont Beraterin Becker. Dabei nutzt sie die Methode „Marte Meo“: Videosequenzen zeigen Situationen einer gelungenen Kommunikation mit Menschen mit Pflegebedarf auf. Diese positiven Erlebnisse seien motivierend, stärkten das Selbstwertgefühl von Pflegefachpersonen und erleichterten letztlich deren Arbeitsalltag.
Nötig sei zudem der Selbstschutz, macht Becker deutlich. Pflegefachpersonen am Limit müssten auch Grenzen setzen und nicht alle Arbeit auf sich nehmen. Dabei gehe es darum, das Tempo herunterzufahren und auch Angehörige von Menschen mit Pflegebedarf etwa bei der Essensvergabe mit einzubeziehen.

Bremen (epd). Mit einem Modellprojekt will die Stiftung Maribondo da Floresta in Bremen eine Hausgemeinschaft für Menschen mit und ohne Hilfebedarf gründen. Das von der Deutschen Fernsehlotterie geförderte Projekt der Altenhilfe wolle nach holländischem Vorbild einen Beitrag dazu leisten, den Pflegenotstand beispielhaft zu verringern, erläuterte am 19. Juli Initiator Erwin Bienewald und ergänzte: „Die Starken helfen den Schwachen, die jungen den alten hilfebedürftigen Bewohnern.“
Der Komplex unter dem plattdeutschen Namen „Dat nee Huus“ (Das neue Zuhause) steht auf dem Gelände des sozial-ökologischen Quartierprojektes Stadtleben Ellener Hof im Bremer Osten. Dazu gehören 22 barrierefreie Wohnungen in Größen zwischen 27 und 83 Quadratmetern. Das Haus ist fertig, die Mietparteien ziehen ab Oktober ein. Die Behandlungspflege übernimmt ein ambulanter Pflegedienst.
Wer zuverlässig 25 Stunden monatlich Aufgaben übernehme, wohne mietfrei, sagte Bienewald: „Zum Beispiel Ausflüge oder Arztbesuche begleiten, im Haushalt helfen, beim Aufstehen und Zu-Bett-gehen.“ Natürlich könnten auch Freunde, Verwandte und Nachbarn bei der Betreuung assistieren. Den hilfebedürftigen Menschen solle bei aller Unterstützung nichts weggenommen werden, was sie noch selbst können, nur weil es schneller gehen solle. „Hier sind keine Pflege-Module gefragt, sondern Zeit.“
Ausgangspunkt für das Projekt sei die Überlegung gewesen, wie ältere und behinderte Menschen wohnen und Unterstützung erfahren können, ohne über einen Umzug in ein Pflegeheim nachdenken zu müssen, schilderte Bienewald den Hintergrund. Vor dieser Frage hätten auch er und seine pflegebedürftige Partnerin Uschi gestanden. „Im Heim hätte ich sie besuchen dürfen, aber ein gemeinsames Wohnen wäre nicht mehr möglich gewesen.“
Zu denjenigen, die mit Unterstützungsbedarf einziehen, gehört Stephan Kelm. Der 29-Jährige ist in seiner Sehkraft stark eingeschränkt. „Ich brauche Hilfe, beispielsweise dabei, den Haushalt in Ordnung zu halten“, sagte Kelm. Er könne aber auch etwas beitragen, „zum Beispiel Gesellschaft“. Unterstützung leisten will Ulrike Mai-Wich (60). Sie komme aus Bremerhaven und ziehe mit ihrer Hündin ein.
Es gehe um Gemeinschaft, um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und um eine liebevolle menschliche Betreuung, bekräftigte Stiftungsgründer Bienewald. „Gemeinschaft wie auf einem Dorf mit Leuten, die füreinander da sind“, führte Projektleiter Stephan Hafner aus. „Wir wollen auch etwas gegen die Einsamkeit tun.“
Die Fernsehlotterie fördert „Dat nee Huus“ Bienewald zufolge mit rund 186.000 Euro: „Für den Aufbau und für die Ausbildung der Helfenden.“ Das Projekt sei der Versuch, eine neue Form der Betreuung und Pflege zu versuchen, „eine Form, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, nicht aber die Vorgaben einer Institution“.
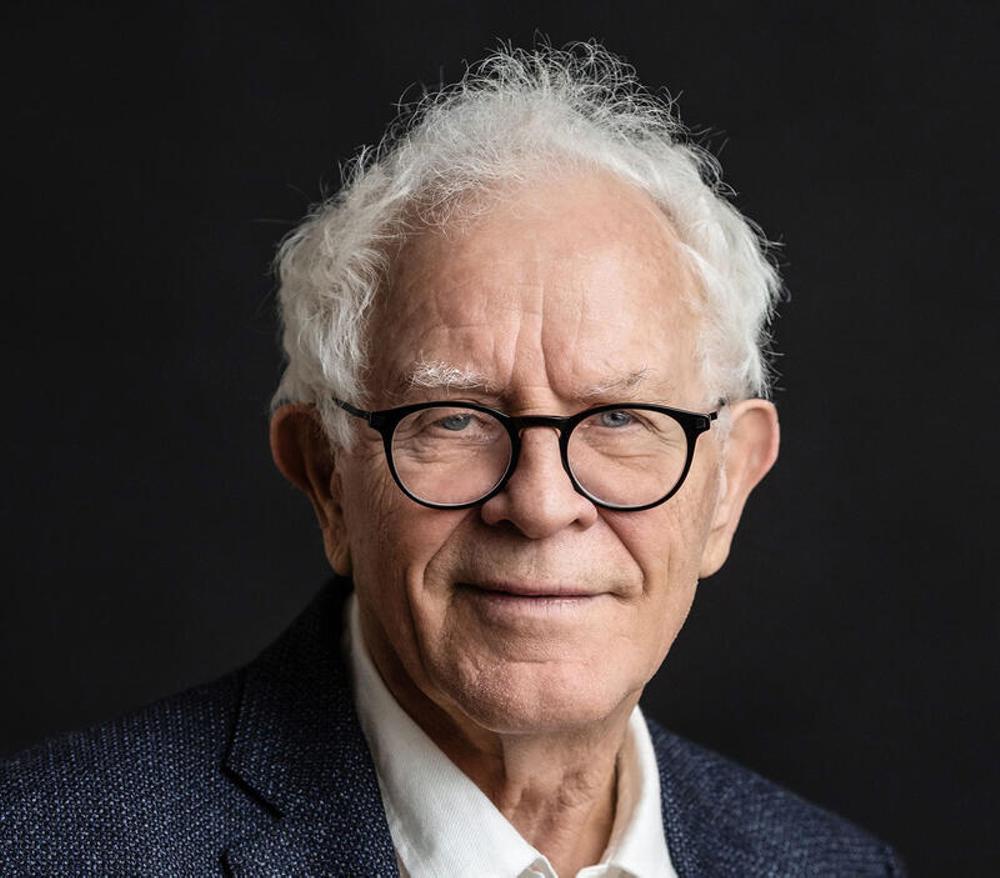
Gießen (epd). Der Gießener Soziologe Reimer Gronemeyer ruft dazu auf, bei der Betreuung Pflegebedürftiger neue Wege einzuschlagen. Es gebe die Idee einer „Caring Society“, sagte Gronemeyer dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dahinter stecke die Vorstellung einer gemeinschaftlichen Sorge um die Alten, „die sich nicht mehr gänzlich abhängig macht von professionellen und bezahlten Dienstleistungen“. Eine solche „Ars curandi“, eine Kunst des Pflegens, gebe es seit Anbeginn der Menschheit. Sie sei aber „unter die Räder einer gewinnorientierten Geschäftspflege geraten“.
„Wir sind bei der Pflege an einen Punkt gelangt, an dem keiner mehr einen Ausweg weiß“, sagte der emeritierte Professor für Soziologie. Die Zahl der Pflegekräfte sinke, die Zahl der zu Pflegenden steige. Die Heime stünden unter zunehmendem Finanzdruck, einige schlössen bereits Abteilungen. Familien hätten immer größere Probleme, den Heimplatz der pflegebedürftigen Angehörigen zu bezahlen und müssten dafür das Erbe aufbrauchen. „Die Debatte muss jetzt geführt werden, ob es andere Wege gibt“, sagte Gronemeyer.
Eine „Caring Society“ müsse gar nicht „das ganz große Ding sein“, sondern könne sich in „kleinen Bezügen verwirklichen“, zum Beispiel: bei großer Hitze bei der alten Nachbarin klingeln und schauen, ob sie genug trinkt, oder den Nachbarn mit kognitiven Einschränkungen zum Spaziergang abholen.
Ein Vorbild liefere die Aids-Bewegung in den 1980er Jahren, als Homosexuelle die ersten Hospize gründeten, die von Freundschaften getragen wurden. In Afrika existierten zahlreiche solcher informellen Hilfssysteme.
Es brauche dafür vor allem eine andere Haltung, sagte der Soziologe und Theologe: „Wir müssen uns selbst entdecken als Menschen, die handeln können.“ Ein schwer an Demenz erkrankter Mensch brauche weiterhin die professionelle Pflege, aber es gebe viele Zwischenstufen. Ein Heimleiter habe ihm berichtet, dass 20 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner seines Heimes nicht dort sein müssten. „Angesichts der Herausforderungen können wir reagieren mit: Ich will damit nichts zu tun haben. Oder mit dem Aufbruch in eine neue Vitalität.“

Bremen (epd). In der Küche duftet es nach Curry und Kurkuma, Aromen von Knoblauch und Zwiebeln drängeln sich dazwischen. An den Tischen wird geschält, gehackt und gerührt. Anastasia macht sich über die Zutaten für einen frischen Salat her und zerteilt Romana-Blätter, Rucola, Paprika, Gurke und Cherrytomaten in mundgerechte Stücke. Das 13-jährige Mädchen beteiligt sich am Diakoniekrankenhaus im Bremer Westen an einem einjährigen Programm unter dem Titel „Starke Kinder“ für Heranwachsende mit Übergewicht. Heute wird gekocht.
Der Nachmittag in einer Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Eltern zählt zu den Höhepunkten des Projektes. Dazu gehören auch eine ausführliche Ernährungsberatung, Hip-Hop und psychosoziale Begleitung. Beim Kochen machen alle alles, die Gemeinschaft ist Teil des Konzepts: schnippeln oder köcheln, Tische decken und zum Schluss abräumen und abwaschen.
Nach dem Salat als Vorspeise steht eine sommerliche Minestrone auf dem Menüplan, wahlweise ein Linsen-Curry mit Süßkartoffeln. Auf dem Buffet dampfen außerdem Ofenkartoffeln mit Zaziki, daneben stehen Gemüsestreifen mit Dip und als Dessert ein bunter Obstsalat und ein Himbeersorbet mit Agavendicksaft statt Zucker. „Den Agavendicksaft kannte ich noch gar nicht“, sagt Anastasia und freut sich über die kalorienärmere Alternative, die in geringen Mengen zum Süßen reicht.
„Die Kinder lernen hier mit viel Spaß, wie man gesund kocht“, erklärt Projektleiterin Angelika Junge. Sie erkunden die Zutaten, bekommen Übung im richtigen Umgang mit scharfen Messern und heißen Kochplatten. Obendrauf gibt es bei Bedarf Tipps zum Abschmecken. Wer an seiner Kochstation fertig ist, beginnt schon mal mit dem Abwasch oder schreibt Schilder für das Buffet, damit alle wissen, was es gibt.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit krankhaftem Übergewicht steigt neueren Untersuchungen zufolge bundesweit seit Jahren deutlich. „Corona hat das noch beschleunigt“, sagt Gesundheitswissenschaftlerin Junge. Die Pandemie sei ein Einfallstor für Ersatzhandlungen wie Essen gewesen, um Frust, Stress und Einsamkeitsgefühle zu kompensieren. So wuchs die Zahl der von extremem Übergewicht (Adipositas) betroffenen 6- bis 18-Jährigen zwischen 2011 und 2021 nach Daten der Kaufmännischen Krankenkasse Hannover um 33,5 Prozent. Bei der Teilgruppe der 15- bis 18-Jährigen erhöhte sie sich sogar um 42,5 Prozent.
Studien des Robert Koch-Institutes in Berlin zeigen: Die Zahlen für Übergewicht und Adipositas sind bei sozial benachteiligten Kindern noch deutlich höher. Ist das Übergewicht schon in jungen Jahren extrem, drohen gesundheitliche Folgen wie Bluthochdruck, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen oder auch Gelenkverschleiß und eine geringere Lebenserwartung. „Im Kindesalter werden die Grundsteine für eine gute Gesundheit im Erwachsenenalter gelegt“, betont Junge.
Ähnliche Angebote wie im Bremer Diakoniekrankenhaus gibt es auch anderswo. „Durch Dick und Dünn“ heißt beispielsweise das ambulante Schulungsprogramm an der Universitäts-Kinderklinik in Bonn. „Wichtig ist der eigene Antrieb, der Wunsch, etwas zu verändern“, bekräftigt Junge. Der ist bei Anastasia groß, auch weil sie aufgrund ihres Gewichtes in ihrer alten Schule gemobbt worden ist. Das ist jetzt nach einem Schulwechsel vorbei.
„Das sind Erfahrungen, die fast alle betroffenen Kinder und Jugendliche machen“, berichtet Projektleiterin Junge und betont: „Die Kinder haben eine Chance verdient.“ Viele Adipositas-Betroffene steckten in einem Teufelskreis aus geringem Selbstwertgefühl, Frust- und Trostessen, Unbeweglichkeit, Rückzug, Schuld- und Schamgefühlen. Aus diesen Mustern auszubrechen, sei schwer. Deshalb sei auch die psychologische Beratung wichtig. „Es ist toll, wie sich einige Kinder und Jugendliche in der Zwischenzeit entwickeln und deutlich selbstbewusster werden.“
Klar ist aber auch: Wunder gibt es nicht, Abnehmen ist mehr Marathon als Sprint. Schließlich kommt es darauf an, langfristig Lebensgewohnheiten zu verändern. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, werden deshalb auch die Eltern geschult. „Ihre Rolle ist nicht zu unterschätzen“, sagt Junge. „Die eigentliche Arbeit läuft ja zu Hause. Da geht es täglich um gesunde Ernährung, um Bewegung, auch darum, Grenzen zu setzen. Und bei allem ist es wichtig, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen zu stärken.“
Da hat sich bei Anastasia schon viel getan. Nach einigen Monaten mit den „starken Kindern“ lautet ihr Leitspruch: „Glaub an dich selbst und verfolge deine Träume.“

Bremen (epd). Das Modell der Ernährungspyramide gibt auf einen Blick und wissenschaftlich fundiert Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung. In Form einer Pyramide macht es klar, was bei der täglichen Wahl der Lebensmittel wichtig ist und was eher zurückhaltend gegessen und getrunken werden sollte. Die einzelnen Ebenen sind bei dem Modell des Bundeszentrums für Ernährung symbolisch in den Ampelfarben grün, gelb und rot hinterlegt.
Grün nimmt den Großteil der Pyramide ein und steht so auch für die Basis der Ernährung. Hier geht es um Lebensmittelgruppen, die täglich reichlich genossen werden sollten. Dazu zählen Getränke (idealer Durstlöscher: Leitungswasser sowie ungesüßte Früchte- oder Kräutertees) und pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Getreide und Getreideprodukte zum Sattessen.
Gelb steht für tierische Lebensmittel, die ergänzend und in Maßen gegessen werden können; Fleisch, Eier, Käse, Milchprodukte. Die rote Spitze der Pyramide enthält Fette und Öle sowie ganz oben Süßigkeiten und salzige Snacks für den sparsamen Genuss mit Bedacht.
Empfohlen werden beispielsweise zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse am Tag. Dabei verweist das Modell auf das Handmaß: Eine Portion sollte in eine Hand passen - wie ein Apfel - oder in beide Hände, die zur Schale geformt sind, beispielsweise für eine Menge Beeren.

Pforzheim/Bretten (epd). Mit Emojis kann man Gefühle ohne Sprache darstellen. Weil die Bildzeichen international bekannt sind, können Smiley und Co. auch bei der Integration von Migranten und Geflüchteten helfen.
Wie etwa in dem Emoji-Projekt der Evangelischen Landeskirche in Baden. Angesiedelt bei den psychologischen Beratungsstellen in Pforzheim und Bretten hilft es Flüchtlingsfamilien. Neben Sprachkursen und Elterncafés gibt es auch Angebote für Kinder und Jugendliche wie Theaterworkshops. Dort lernen sie, mit ihren Gefühlen umzugehen, und was sie gegen Traurigkeit, Angst oder Wut tun können.
Dabei helfen Bildzeichen-Karten mit lächelnden, traurigen oder wütenden Gesichtern. Damit falle es Kindern leichter, ihre Gefühle zu äußern, sagt die Psychologin Patricia Diaz-Bone von der Pforzheimer Beratungsstelle dem Evangelischen Pressedienst (epd). So sei es etwa beim Thema „Wut“ ganz wichtig, das Gefühl zu benennen und „die Wut rauszulassen“. Das könnte ein Herausschreien sein, das Drücken eines Wutballs, das Schlagen eines Boxsacks oder auch das Kämpfen mit Schaumstoffstangen.
Was für alle Kinder funktioniert, sei besonders wichtig für Kinder von Migranten und Geflüchteten. Denn die Eltern seien beschäftigt mit der eigenen Integration, „die Kinder laufen nebenher mit“, ergänzt die landeskirchliche Migrationsberaterin Regine Gnegel. Damit seien die belastenden Auswirkungen einer Flucht auf Kinder und Jugendliche aber nicht bewältigt.
Auch Probleme bei der Orientierung im fremden Deutschland und Diskriminierung könnten im geschützten Rahmen bearbeitet werden. Hilfreich sei dabei eine Art Notfallkoffer oder Schatzkiste, erläutert Gnegel. Sie seien gefüllt mit Spielsachen, Bildern von schönen Orten und Symbolen, aber etwa auch mit einem „Anti-Stress-Ball“.
An geflüchtete Familien würden hohe Integrationsanforderungen gestellt, erläutert Ursula Bank, landeskirchliche Beauftragte für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Sie seien alleingelassen mit traumatischen Erlebnissen und Verlusterfahrungen sowie der Sorge um zurückgelassene Angehörige. Geflüchtete Menschen verfügten über erstaunliche Fähigkeiten und Ressourcen, auf die sie jedoch nur unter förderlichen Bedingungen zugreifen können, erklärt Bank die Bedeutung der Beratungsarbeit.
Auch im Brettener Emoji-Projekt geht es um Spiel und Spaß, Freundschaften schließen, Sicherheit und Stabilität durch einen geschützten Rahmen und Rituale. Für die Erwachsenen werden Elterncafés und Elternabende angeboten, Sprachkurse und offene Sprechstunden.
Das Modellprojekt wurde 2019 in Leben gerufen und wird derzeit von der Evangelischen Hochschule Freiburg evaluiert. Die Ergebnisse sollen Ende September vorgestellt werden. In Bretten ist die Fortführung des Projekts bis Ende 2024 gesichert. Auch in Pforzheim soll es weitergehen. „Es ist toll“, sagen die Kinder dort und fragen, wann sie wiederkommen dürfen.

München (epd). Mit Beschluss des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom September 2022 besteht in Deutschland die Pflicht für Arbeitgeber, die Arbeitszeiten ihrer Angestellten systematisch zu erfassen. Das Urteil soll ein Schritt in Richtung eines verbesserten Arbeitsschutzes sein. Unbezahlte Überstunden sollen damit der Vergangenheit angehören. Die Münchner Rechtsanwältin Alexandra Callies gibt Aufschluss darüber, welche Veränderungen die Vorschrift nach sich zieht. Die Fragen stellte Stefanie Unbehauen.
epd sozial: Frau Callies, seit diesem Jahr gilt die Pflicht zur exakten Arbeitszeiterfassung. Droht Angestellten, die ihre Arbeitszeit nicht aufzeichnen, nun ein Bußgeld?
Alexandra Callies: Nein, Angestellte müssen kein gesetzliches Bußgeld befürchten, wenn sie ihre Arbeitszeit aktuell nicht aufzeichnen. Die Verpflichtung zur Durchführung einer korrekten Arbeitszeiterfassung betrifft den Arbeitgeber. Solange dieser nichts Entsprechendes anordnet, ist der Arbeitnehmer nicht in der Pflicht. Selbst bei einer Anordnung droht dem Arbeitnehmer kein Bußgeld.
epd: Wenn dem Arbeitnehmer bei Verweigerung kein Bußgeld droht - mit welchen Konsequenzen hat er dann zu rechnen?
Callies: Sobald der Arbeitgeber seine Angestellten dazu auffordert, die Arbeitszeit aufzuzeichnen, sind diese dazu verpflichtet. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und auch nach dem aktuell vorliegenden Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums vom 18. April zum Arbeitszeitgesetz können Arbeitgeber die Pflicht zur Aufzeichnung der Arbeitszeit auf ihre Angestellten übertragen. Nach außen verantwortlich bleibt aber trotzdem der Arbeitgeber.
Die Arbeitszeiterfassung wird mit einer solchen Weisung für die Angestellten Teil ihrer Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis. Wenn ein Arbeitnehmer diese Pflicht nach einer entsprechenden Weisung verletzt, indem er seine Arbeitszeit nicht erfasst, dann kann der Arbeitgeber ihn abmahnen und im Wiederholungsfalle sogar kündigen - wie bei anderen Pflichtverletzungen auch.
epd: Muss die Aufzeichnung zwingend digital erfolgen und wenn ja, muss der Arbeitgeber seinen Angestellten die technischen Möglichkeiten hierfür bereitstellen?
Callies: Das Bundesarbeitsgericht hat noch nicht entschieden, ob die Arbeitszeiterfassung digital erfolgen muss. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch bereits geurteilt, dass die Methoden zur Arbeitszeiterfassung zuverlässig, objektiv und zugänglich sein müssen. Diese Vorgabe ist auch in Deutschland anzuwenden. Ob beispielsweise eine jederzeit veränderliche Excel-Tabelle oder eine Zeiterfassung mittels Papier und Stift für diese Kriterien ausreichen, erscheint fraglich und ist derzeit unter Juristen noch umstritten.
Voraussichtlich müssen digitale Systeme - etwa über eine App oder eine Chipkarte - verwendet werden. Die Bereitstellung der technischen Möglichkeiten obliegt auf jeden Fall dem Arbeitgeber. Hier will der Gesetzgeber nun Klarheit schaffen: Nach dem aktuell vorliegenden Referentenentwurf zum Arbeitszeitgesetz ist beabsichtigt, grundsätzlich eine Pflicht zur elektronischen Erfassung einzuführen, wobei darunter nach dem Entwurf auch die Nutzung einer Excel-Tabelle fallen würde. Für Kleinunternehmen mit weniger als zehn Arbeitnehmern soll eine nichtelektronische Zeiterfassung weiterhin zulässig bleiben.
epd: Wie ist das Gesetz in der Sozialbranche umzusetzen, beispielsweise in der Familienhilfe oder der ambulanten Pflege, wo Arbeit oft außerhalb des Büros stattfindet?
Callies: Grundsätzlich gilt das Gleiche wie für alle anderen Arbeitnehmer auch. Eine Arbeitszeiterfassung mittels Stift und Papier, wie sie bislang häufig praktiziert wurde, wäre auch hier dann nur noch für Kleinbetriebe möglich. Wenn man davon ausgeht, dass in Zukunft eine digitale Erfassung erforderlich wird, lässt sich auch das mittels moderner technischer Systeme lösen. So kann zum Beispiel eine Handy-App verwendet werden, mittels derer der Arbeitnehmer flexibel von überall aus Beginn und Ende seiner Arbeitszeiterfassung steuern kann. Das Stellen eines entsprechenden Diensthandys ist Aufgabe des Arbeitgebers.
epd: Was ist bei der richtigen Aufzeichnung zu erwarten, damit Überstunden im Nachhinein abgebaut werden können?
Callies: Wer die Aufzeichnung der Arbeitszeit als Beweismittel nutzen möchte, um Überstunden abzubauen, muss neben den exakten Arbeitszeiten zusätzlich nachweisen, dass der Arbeitgeber die Überstunden angewiesen oder zumindest bewusst toleriert hat. Diese zweite Voraussetzung ist in der Praxis häufig die schwierigere. Wer also aktuell die Arbeitszeit noch mit Papier und Stift erfasst, sollte die Aufzeichnungen vom Vorgesetzten gegenzeichnen lassen. Bei einer digitalen Erfassung kann man sich dagegen meist darauf berufen, dass der Chef die Arbeitszeiten im System sehen konnte. Somit hat er die geleisteten Überstunden zumindest stillschweigend toleriert.

Beim diesjährigen Weltflüchtlingstag sind in der Berliner Passionskirche die Namen von mehr als 51.000 Kindern, Frauen und Männern vorgelesen worden, die seit 1993 auf ihrer Flucht nach Europa gestorben sind. Über 32 Stunden hinweg! Die Aktion „Beim Namen nennen“ machte auf das oft stille und namenlose Elend aufmerksam gemacht - und es wurde der Verstorbenen gedacht.
Anstatt sichere Fluchtwege nach Europa zu schaffen und an den EU-Außengrenzen eine schnelle Aufnahme und gerechte Verteilung aller Schutzsuchenden innerhalb der Europäischen Union zu organisieren, hat die Abschottungspolitik der EU einen neuen humanitären Tiefpunkt erreicht. Die EU-Innenministerinnen und -minister haben sich auf eine gemeinsame Position zur Reform des Europäischen Asylsystems verständigt, die die Asylverfahrensverordnung sowie Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung beinhaltet.
Im Kern geht es darum, dass ein für alle EU-Mitgliedstaaten verbindliches Verfahren zum Umgang mit Anträgen auf internationalen Schutz angewendet werden soll. Dabei sollen künftig Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden, um in sogenannten „Asylzentren“ schnellstmöglich zu prüfen, ob die ein Asylverfahren zulässig ist. Das betrifft alle Schutzsuchenden, die aus Ländern mit einer niedrigen Anerkennungsquote geflohen sind.
Darüber hinaus soll es für Schutzsuchende angewandt werden, die über einen potenziell „sicheren Drittstaat“ nach Europa geflüchtet sind. Diese Verfahren unterscheiden sich von den vollwertigen Asylverfahren gemäß Artikel 18 der EU-Grundrechtecharta. Sie stellen lediglich eine beschleunigte Vorprüfung dar, um festzustellen, ob die betroffene Person überhaupt ein Recht auf ein Asylverfahren hat oder ob sie in einen Staat außerhalb der EU abgeschoben werden soll.
Die zentrale Zielsetzung des internationalen Flüchtlingsschutzes, nämlich die inhaltliche Prüfung und Gewährung von Schutz für Schutzsuchende - und zwar eines jeden Einzelfalls - wird durch diese geplanten Grenzverfahren ausgehöhlt. Insbesondere dadurch, wenn Schutzsuchende keinen adäquaten Zugang zu einer anwaltlichen Vertretung oder verfahrensrechtlicher Beratung haben.
Während dieser Grenzverfahren, die bis zu sechs Monate dauern können, erfolgt eine haftähnliche Unterbringung nach dem „Prinzip der fiktiven Nicht-Einreise“. Die Antragstellenden gelten in dieser Zeit als nicht eingereist. Die europäischen Mitgliedsstaaten können selbst entscheiden, das Instrument der Grenzverfahren auf alle Personen, die über einen angeblich sicheren Drittstaat gekommen sind, auszuweiten. Gleichzeitig sollen die Kriterien für die Einstufung eines Landes als „sicher“ gelockert werden. Auch für syrische und afghanische Schutzsuchende könnte das bedeuten, dass sie beispielsweise in die Türkei abgeschoben werden und von dort aus wieder in Krieg und Verfolgung zurückkehren müssen.
Neben der Einführung von Grenzverfahren und der Ausweitung sicherer Drittstaaten sollen mit der Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung die Voraussetzungen für eine Verteilung von Schutzsuchenden innerhalb der Europäischen Union geschaffen werden. Die Zuständigkeit für Asylbewerberinnen und -bewerber bleibt aber prinzipiell bei den Staaten, in denen sie zuerst einreisen. Das ist auch bei der aktuellen, zurecht viel kritisierten Dublin-II Verordnung der Fall. Die Einführung der neuen obligatorischen Grenzverfahren wird zu einer noch höheren Belastung und Verantwortung für die Außengrenzstaaten führen.
Daneben soll zukünftig ein sogenannter „Solidaritätsmechanismus“ eingeführt werden, für den die Mitgliedstaaten eine bestimmte Zahl an Plätzen für die Verteilung zusichern. Staaten, die keine Schutzsuchenden aufnehmen wollen, können sich finanziell an dem „Solidaritätspaket“ beteiligen oder Personal und weitere Ressourcen zur Unterstützung der Grenzabwehr zur Verfügung zu stellen.
Eine wirksame Entlastung der Außengrenzstaaten kann damit jedoch nicht erreicht werden. Es wird zu einer Zunahme rechtswidriger Pushbacks sowie zu einer Ausweitung von politischen Deals mit menschenrechtsverletzenden Autokratien in Drittstaaten kommen - wie beispielsweise dem EU-Türkei-Deal, dem EU-Deal mit der libyschen Küstenwache sowie Rückführungen in libysche Folterlager und der neuesten EU-Vereinbarung mit Tunesien, das 100 Millionen Euro für sein „Grenzmanagement“ bekommt.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte betont, die Rechte von Geflüchteten zu stärken und das Sterben auf dem Mittelmeer zu bekämpfen. Doch weder das eine noch das andere wird durch die Auslagerung von Verantwortung an Staaten erreicht, die sich nicht an menschenrechtliche und demokratische Grundlagen halten.
Vielmehr führt diese Vorgehensweise zur Billigung schwerer Menschenrechtsverletzungen und der Zunahme illegaler Pushbacks. Trotzdem folgen keine Konsequenzen, keine strafrechtliche Verfolgung. Grenzschützer agieren zum Teil ohne jegliche Kontrollinstanz. Dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um einen systematischen Abbau von rechtsstaatlichen Prinzipien an den EU-Außengrenzen.
Die seit vielen Jahren zunehmenden Abschottungstendenzen der EU widersprechen nicht nur ihrem Gründungsgedanken. Das Missachten von menschenrechtlichen Standards hat bereits Einfluss auf unsere Gesellschaft genommen. Rechte Ideologien erstarken - und Grenzen von menschenrechtlichen Tabubrüchen werden weiter aufgeweicht. Kein Aufschrei, wenn wieder ein Flüchtlingsboot sinkt - es hat sich ein kollektives Gewöhnen an Grausamkeit eingestellt. Die sich in unseren Gesellschaften breitmachenden Abstumpfungstendenzen bei Missachtung von Rechtsstaatlichkeit und das Abschotten hinter Mauern vergiften unser humanitäres Zusammenleben.
Und: Die Grenzsicherung mit Waffengewalt verschiebt unsere Werte und Normen - schutzsuchende Menschen werden zum kriegerischen Feind gemacht. Die Abkehr von menschenrechtlichen Standards hin zu einer Verwertbarkeitsdebatte von Menschen für unsere Volkswirtschaft zeigt sich auch, wenn Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung im Ausland um Fachkräfte werben, während sie gleichzeitig Schutzsuchende und Seenotretter an den EU-Außengrenzen kriminalisieren.
Aktuell finden die trilogischen Gespräche - die Verhandlungen von EU-Parlament, Kommission und Rat statt. Die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament werden voraussichtlich zu einem Votum Anfang 2024 - und damit vor der Europawahl - führen. Bis dahin hat die Bundesregierung ihre selbst gesetzte Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag zu erfüllen und „auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem mit einer Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten voranzugehen und aktiv dazu beizutragen, dass andere EU-Staaten mehr Verantwortung übernehmen und EU-Recht einhalten“ (S. 141 des Koalitionsvertrages).

Neumünster (epd). Sozialkaufhäuser haben nach Meinung des Geschäftsführers der Diakonie Altholstein, Heinrich Deicke, heute eine andere Aufgabe als noch vor 20 Jahren. Die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen für den ersten Arbeitsmarkt stehe heute nicht mehr so sehr im Fokus. Mit Deicke sprach Nadine Heggen.
epd sozial: Herr Deicke, welche Funktion haben Sozialkaufhäuser?
Heinrich Deicke: Die Diakonie Altholstein hat das Projekt Sozialkaufhaus vor 20 Jahren gestartet. Damals hatten wir hohe Arbeitslosenzahlen. Uns als Diakonie waren seinerzeit drei Aspekte wichtig. Erstens die Qualifizierung: Wir wollten Menschen in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Zweitens Nachhaltigkeit, also die Wiederverwertung von gebrauchten Alltagsgegenständen. Und drittens der soziale Ansatz: Wir wollten günstige Einkaufsmöglichkeiten für Menschen schaffen, die staatliche Unterstützung zum Lebensunterhalt erhalten.
Der Bereich der Qualifizierung ist heute nicht mehr so sehr im Fokus, die Nachfrage und die Anzahl der Menschen, die auf günstigen Einkauf angewiesen sind, steigt jedoch. Das macht deutlich, dass es mehr Menschen gibt, die finanziell in einer schwierigen Lage sind. Das nehmen auch die Städte und Gemeinden wahr. Zusätzlich konnten wir im vergangenen Jahr die Kommunen dabei unterstützen, rund 120 Wohnungen für rund 400 Flüchtlinge auszustatten.
epd: Und welche Rolle spielt der Arbeitsmarktaspekt heute?
Deicke: Eine andere Rolle. An die Stelle der Qualifizierung ist mittlerweile die Beschäftigung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten getreten. Heute kommen Menschen, die zum Teil gesundheitlich eingeschränkt und schon sehr lange arbeitslos sind. Unsere Aufgabe ist es heute, die Menschen an einen strukturierten Tagesablauf zu gewöhnen. In der Regel sind die Teilnehmer ein halbes Jahr im Sozialkaufhaus beschäftigt, eine Verlängerung auf bis zu drei Jahre ist möglich.
epd: Schaffen Sie es in dieser Zeit, die Menschen für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren?
Deicke: Das ist nicht mehr das vorrangige Ziel der Maßnahme. Wir freuen uns, wenn es mal gelingt, aber es ist natürlich schwer. Eigentlich brauchen wir einen zweiten Arbeitsmarkt, der staatlich subventioniert ist und auf dem die Menschen dauerhaft beschäftigt werden. Die kurze Dauer der Maßnahme stellt für die Teilnehmer keine langfristige Perspektive dar.

Kassel (epd). Krankenhäuser müssen nicht versicherten Ausländern im medizinischen Notfall helfen und können einen Anspruch auf Übernahme der Behandlungskosten durch den Sozialhilfeträger haben. Wird ein mittelloser, nicht krankenversicherter EU-Bürger an einem Wochenende und damit außerhalb der Dienstzeiten des Sozialhilfeträgers eingeliefert, sind die Behandlungskosten des akuten Notfalls als sogenannte Überbrückungsleistungen zu übernehmen, urteilte am 13. Juli das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. Auf die Ausreisebereitschaft des Ausländers komme es hierfür nicht an.
Im konkreten Fall ging es um einen wohnsitzlosen Mann aus Polen. Krankenversichert war er nicht. Sozialhilfeleistungen hatte der mittellose und unter Betreuung stehende Mann nicht beantragt. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit Betteln.
Am Freitagnachmittag des 8. März 2019 wurde er wegen des Verdachts eines Herzinfarkts mit dem Rettungswagen in das Uniklinikum Aachen gebracht. Der Verdacht bestätigte sich nicht, sodass der Mann einen Tag später die Notaufnahme wieder verließ.
Die angefallenen Behandlungskosten in Höhe von 166,47 Euro wollte sich das Uniklinikum für die „Nothilfe“ von der Stadt als Sozialhilfeträger wieder zurückholen.
Nach dem Gesetz darf ein Krankenhaus Patienten in akuten Notfällen nicht abweisen. Eine Behandlungspflicht besteht dann auch für Menschen, die nicht krankenversichert sind. Damit Kliniken bei Patienten ohne Krankenversicherung nicht auf den Kosten der Notfallbehandlung sitzen bleiben, müssen sie grundsätzlich das Okay vom Sozialhilfeträger zur Kostenübernahme einholen.
Die Stadt Aachen lehnte das ab. Denn es habe keine vom Gesetz geforderte Behandlung einer „akuten Erkrankung“ vorgelegen. Es sei nur eine Diagnostik gemacht worden. Der Herzinfarkt habe sich nicht bestätigt. Der Patient habe auch über kein Aufenthaltsrecht verfügt, sodass allenfalls Überbrückungsleistungen für die Erstattung der Behandlungskosten in Betracht kämen. Hierfür müsse sich der Ausländer aber bereit erklären, innerhalb eines Monats auszureisen, was der Mann nicht getan habe. Die Folge sei, dass das Uniklinikum bei der Kostenübernahme leer ausgehe.
Doch das BSG sprach dem Klinikum die Kostenerstattung für die Notfallbehandlung zu. Verfügen Ausländer über kein gewährtes Aufenthaltsrecht, sei der Anspruch auf Sozialhilfe eingeschränkt. Ein Anspruch bestehe aber auf Überbrückungsleistungen, die auch die Behandlung „akuter Erkrankungen und Schmerzzustände“ umfassen. Der Herzinfarktverdacht sei als „akute Erkrankung“ anzusehen, der sofort abgeklärt werden musste.
Zwar sei der Gesetzgeber typisierend davon ausgegangen, dass Ausländer mit einem Anspruch auf Überbrückungsleistungen innerhalb eines Monats ausreisen. Kommen sie dem, wie im Streitfall, nicht nach, liege bei einer danach vorgenommenen akuten Notfallbehandlung jedoch ein Härtefall vor, für den der Sozialhilfeträger aufkommen müsse. Auf die Ausreisebereitschaft komme es dann nicht an. Da der Mann nach Dienstschluss des Sozialhilfeträgers in das Klinikum eingeliefert wurde, konnte in dem Eilfall auch nicht abgewartet werden, bis die Behörde über die Kostenübernahme entscheidet.
Trotz dieses Urteils bewegen sich Krankenhäuser bei der Frage der Kostenübernahme von Behandlungen nicht versicherter Patienten auf dünnem Eis. So hatte das BSG am 6. Oktober 2022 der Duisburger Helios-Klinik die Kostenübernahme für die Notfallbehandlung einer Bulgarin versagt.
Die Frau war wegen eines massiven Bluthochdrucks an einem frühen Montagmorgen stationär aufgenommen worden. Per Fax wurde die Stadt über die Aufnahme informiert und um Übernahme der Behandlungskosten gebeten. Die Klinik hatte sich mögliche Sozialhilfeansprüche von der Frau abtreten lassen. Nach der Behandlung verschwand sie, an der angegebenen Adresse war sie nicht gemeldet.
Das BSG urteilte, dass kein Erstattungsanspruch besteht. Es sei gar nicht klar, ob die Frau mittellos war. Da die Klinik an einem Montag den dienstbereiten Sozialhilfeträger informiert hatte, könne nur die Patientin mögliche Sozialhilfeansprüche als „Hilfe bei Krankheit“ gegenüber der Stadt geltend machen. Eine Abtretung der Ansprüche auf den Krankenhausträger - wie hier geschehen - sei gesetzlich nicht erlaubt.
Am 23. August 2013 urteilten die obersten Sozialrichter, dass Krankenhäuser als Nothelfer sich meist auch nicht die volle Krankenhausbehandlung erstatten lassen können. Werde für die Behandlung eines Patienten eine Fallpauschale abgerechnet, könne das Krankenhaus nur den tagesbezogenen Anteil erhalten, in dem es als Nothelfer tätig war. Für die restliche Zeit müsse der Patient mögliche Sozialhilfeleistungen einfordern.
Az.: B 8 SO 11/22 R (BSG, Überbrückungsleistungen)
Az.: B 8 SO 2/21 R (BSG, Abtretungserklärung)
Az.: B 8 SO 9/13 R (BSG, Fallpauschalen)
Karlsruhe (epd). Rollstuhlfahrer und andere Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ihre Begleitpersonen haben bei Flugreisen Vorrang beim Ein- und Ausstieg im Flugzeug. Verpasst ein Rollstuhlfahrer einen direkten Anschlussflug, weil er zuletzt aus dem Flugzeug aussteigen musste, muss die Fluggesellschaft die Kosten für ein Ersatzticket übernehmen und kann für die Flugverspätung auch zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet sein, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 18. Juli veröffentlichten Urteil.
Im Streitfall hatten ein Rollstuhlfahrer und seine Frau einen Flug von Frankfurt am Main nach St. Petersburg gebucht. In Budapest sollte das Paar umsteigen. Die Umsteigezeit betrug 45 Minuten.
Als das Paar in Budapest landete, durfte es trotz des Hinweises auf den Anschlussflug erst als Letzte aus dem Flugzeug aussteigen. Der Anschlussflieger wurde verpasst. Das Paar musste einen Ersatzflug buchen und kam mit zehnstündiger Verspätung in St. Petersburg an.
Das Landgericht Frankfurt am Main urteilte, dass Reisende mit eingeschränkter Mobilität sowie deren Begleitpersonen vorrangig beim Ein- und Ausstieg im Flugzeug behandelt werden müssen. Sie hätten Anspruch auf Kostenerstattung für die Ersatztickets, nicht aber auf eine Ausgleichszahlung wegen einer Flugverspätung. Der Anschlussflug sei ja nicht verspätet gewesen.
Der BGH hob dieses Urteil auf und verwies den Rechtsstreit an das Landgericht zurück. Die Fluggesellschaft sei dafür verantwortlich, dass das Paar zuletzt aussteigen musste und seinen Anschlussflug verpasst hat. Damit habe das Paar Anspruch auf die Ausgleichszahlung in Höhe von hier 400 Euro pro Person. Fluggesellschaften seien verpflichtet, Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie ihren Begleitpersonen „bei der Beförderung Vorrang einzuräumen“.
Allerdings bestehe der Anspruch auf Ausgleichszahlung nur, wenn der erste sowie der direkte Anschlussflug einheitlich gebucht wurden. Dies müsse das Landgericht noch einmal prüfen, urteilte der BGH.
Az: X ZR 84/22
München (epd). Kinderbetreuungskosten können nur für zum eigenen Haushalt gehörende Kinder als Sonderausgaben steuermindernd geltend gemacht werden. Es verstoße nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, wenn der Sonderausgabenabzug von der Haushaltszugehörigkeit des Kindes abhängig gemacht werde, entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am 13. Juli veröffentlichten Urteil. Dies gelte bei getrennt lebenden Ehepartnern, wenn der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seine Betreuungskosten durch den ihm gewährten steuerlichen Freibetrag decken könne.
Im konkreten Fall ging es um ein getrennt lebendes Ehepaar mit einer 2013 geborenen Tochter. Das Kind lebt im Haushalt der Mutter. Im Streitjahr 2020 besuchte die Tochter zunächst einen Kindergarten und anschließend den Hort der Grundschule. Die Betreuungskosten beliefen sich auf 598 Euro. Davon zahlte der klagende Vater die Hälfte.
Er machte seinen Teil der Betreuungskosten erfolglos als Sonderausgaben geltend. Pro Kind können zwei Drittel der Aufwendungen, höchstens 4.000 Euro, steuermindernd berücksichtigt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass das Kind zum eigenen Haushalt gehört. Das Erfordernis der Haushaltszugehörigkeit sei verfassungswidrig und verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz, meinte der Vater und klagte.
Dem widersprach der BFH. Der Gesetzgeber sei zu Recht davon ausgegangen, dass ein „Fremdbetreuungsaufwand typischerweise bei dem Elternteil anfällt, der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat“, urteilten die obersten Finanzrichter. Der Sonderausgabenabzug stehe dem Kläger daher nicht zu.
Zwar könnten auch bei dem Elternteil, in dessen Haushalt das Kind nicht lebt, Betreuungskosten anfallen. Das Einkommensteuergesetz gewähre für diese Betreuungsaufwendungen aber einen jährlichen Freibetrag in Höhe von 1.320 Euro (2023: 1.464 Euro). Eine Berücksichtigung der Betreuungskosten als Sonderausgaben sei nicht möglich, wenn der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seinen Freibetrag noch nicht ausgeschöpft habe. Dies sei hier der Fall gewesen.
Az.: III R 9/22
Essen (epd). Die Sozialhilfe darf eine überforderte behinderte Frau bei der Wohnungssuche nicht alleine lassen. Der Sozialhilfeträger ist zur Unterstützung verpflichtet, wenn eine behinderte Sozialhilfebezieherin ohne deutsche Sprachkenntnisse eine günstigere Wohnung suchen muss, ist entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in einem am 10. Juli veröffentlichten Urteil. Ohne diese Hilfe dürfe die Behörde sonst nicht die Unterkunftskosten senken, betonten die Essener Richter, die wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel zugelassen haben.
Im konkreten Fall ging es um eine in Georgien geborene Sozialhilfebezieherin. Bei ihr wurde ein Grad der Behinderung (GdB) von 70 sowie wegen ihrer Gehbeeinträchtigung das Merkzeichen „G“ festgestellt. Nach dem Tod ihres Ehemannes bewohnt sie allein eine 66 Quadratmeter große Wohnung. Da sie kaum über Deutschkenntnisse verfügt, hilft ihr ein Pflegedienstmitarbeiter aus Gefälligkeit bei Behörden- und Bankgeschäften.
Als der Sozialhilfeträger feststellte, dass die Frau seit dem Tod ihres Mannes in einer zu großen und damit unangemessenen Wohnung lebt, wurde sie zur Senkung der Unterkunftskosten aufgefordert.
Als die Frau dem nicht nachkam, übernahm der Sozialhilfeträger nur noch einen Teil der Miete. Offene Mietzahlungen für die Monate Juli bis Oktober 2017 in Höhe von jeweils 89 Euro sowie in Höhe von jeweils 95 Euro für die Monate November und Dezember 2017 zahlte die Klägerin aus ihrem Sozialhilfesatz.
Das LSG urteilte, dass der Sozialhilfeträger die Unterkunftskosten voll übernehmen muss. Denn bei der Frau „kommen mehrere Faktoren zusammen, die es ihr im Zusammenspiel unmöglich machen, ohne fremde Hilfe eine andere Wohnung anzumieten“. Wegen ihrer fehlenden Deutschkenntnisse und mangelnder Geschäftserfahrung sei sie nicht fähig, selbst eine Wohnung zu suchen. Wegen ihrer Gehbehinderung könne sie auch nicht selbstständig Wohnungsbesichtigungen durchführen.
In solch einem Fall dürfe die Behörde nicht die zu übernehmenden Unterkunftskosten absenken, sondern müsse vielmehr Unterstützung bei der Wohnungssuche bieten. Dazu gehöre etwa die Vermittlung einer geeigneten angemessenen Unterkunft oder zusätzliche Sozialleistungen, um einen Makler beauftragen zu können. Dass der Pflegedienstmitarbeiter bei der Wohnungssuche hilft, könne nicht verlangt werden. Die Hilfe bei Behörden- und Finanzangelegenen seien aus reiner Gefälligkeit erfolgt, auf die es keinen Anspruch gebe.
Az.: L 9 SO 429/21
Luxemburg (epd). Arbeitgeber sind verpflichtet, die Agentur für Arbeit bei einer Massenentlassung frühzeitig zu informieren. Erfüllen sie diese Pflicht nicht, hat das jedoch keine Konsequenzen für die Wirksamkeit der Kündigung. Die Mitteilung erfolge nur zu Informations- und Vorbereitungszwecken. Sie solle es der Behörde ermöglichen, sich einen Überblick über die Gründe sowie die Folgen der Entlassungen zu verschaffen, entschieden die Richter des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) am 13. Juli in Luxemburg.
Geklagt hatte ein Arbeitnehmer aus Deutschland, dessen Firma nach einem Insolvenzverfahren abgewickelt werden sollte und deshalb eine Massenentlassung veranlasste. Das Unternehmen hatte es versäumt, die Agentur für Arbeit frühzeitig darüber zu informieren. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt stellte zwar einen Gesetzesverstoß durch den Arbeitgeber fest, wandte sich aber mit der Frage an den EuGH, ob dieser Verstoß zur Nichtigkeit der Kündigung führe.
Die Richter in Luxemburg verneinten das. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, der Behörde Informationen über beabsichtigte Massenentlassungen mitzuteilen, diene nicht dazu, den Arbeitnehmern einen individuellen Schutz zu gewähren. Die frühzeitige Information solle der Arbeitsagentur vielmehr die Möglichkeit geben, sich auf eine Massenentlassung vorzubereiten.
Az.: C-134/22

Berlin (epd). Ab September rückt Helmut Schröder, bisher stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), auf die zweite Geschäftsführerposition neben Jürgen Klauber. „Damit setzen wir das bewährte Modell der Doppelspitze im WIdO fort“, sagte die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann.
Gleichzeitig wird David Scheller-Kreinsen neuer stellvertretender Geschäftsführer des WIdO. Der 41-jährige Krankenhaus-Experte war seit 2017 Leiter der Referate Stationäre Versorgung und Rehabilitation im AOK-Bundesverband. „Das WIdO als renommiertes Forschungsinstitut für mehr Qualität und Effizienz im Gesundheitswesen geht mit den aktuellen personellen Änderungen gut aufgestellt in die Zukunft“, verkündete Reimann.
Schröder ist seit 1996 beim WIdO. Zuvor war der Soziologe beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen e. V. (ZUMA) in Mannheim sowie dem Institut für Sozialforschung der Universität Stuttgart tätig. Seine Schwerpunkte beim WIdO waren die Bereiche Arzneimittel, Heilmittel, Betriebliche Gesundheitsförderung und Versorgungsforschung.
Der promovierte Volkswirt David Scheller-Kreinsen, ausgebildet unter anderem an der London School of Economics und an der Georgetown University in Washington D.C., ist Autor von zahlreichen Fachbeiträgen zu Fragestellungen rund um die Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens. Zuletzt hat er auch die fachliche Positionierung der AOK in der Diskussion um die Krankenhausreform maßgeblich mitgestaltet.
Vor seiner Tätigkeit beim AOK-Bundesverband war er mehrere Jahre an der Technischen Universität Berlin wissenschaftlich tätig und dann als Projektleiter beim GKV-Spitzenverband, dort unter anderem verantwortlich für die Entwicklung von Anwendungen zur Versorgungssteuerung und für die Simulation von Veränderungsprozessen in der stationären und ambulanten Versorgung.
Scheller-Kreinsen wird sich im WIdO unter anderem um die bisher von Klaus Jacobs verantworteten Zuständigkeiten kümmern und darüber hinaus seine Krankenhaus-Expertise einbringen.
Karlheinz Burger scheidet aus dem Vorstand der Diakonissen Speyer aus. Nach 25-jähriger Tätigkeit bei den Diakonissen Speyer, seit 2013 als Vorstandsmitglied und zuvor 14 Jahre als Justiziar und Syndikus verantwortlich für die Personal- und Rechtsabteilung der Diakonissen Speyer, verlässt Burger mit Wirkung zum 30. April 2024 die Diakonissen Speyer aus. Das Vorstandsmitglied ist derzeit für die Krankenhäuser, das Hilfefeld Menschen mit Behinderung, die Service- Gesellschaft und die Hauptverwaltung, Wirtschaftsabteilung, Personal und Recht sowie Bau und Technik, verantwortlich. „Unsere Zusammenarbeit im Vorstand ist geprägt von großem Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung. Ich bedauere daher sehr, dass Karlheinz Burger im nächsten Jahr seine Tätigkeit beenden wird“, sagte Vorstandsvorsitzende Oberin Sr. Isabelle Wien.
Andreas Dehlzeit ist neuer Geschäftsführer der BFS Service GmbH, einer Tochter der Bank für Sozialwirtschaft. Der Betriebswirt hat seine Tätigkeit zum 1. Juli aufgenommen. Er war zuvor Geschäftsführer der Bibby Financial Services GmbH. Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind der Ausbau des Neu- und Bestandsgeschäfts sowie die Weiterentwicklung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Die BFS Service GmbH ist mit rund 50 Mitarbeitenden, mehr als 1.500 Kunden und einem Ankaufsvolumen von mehr als 760 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 ein führender Factoringanbieter im Gesundheits- und Sozialwesen. Zweiter Tätigkeitsschwerpunkt der BFS Service GmbH sind umfassende Beratungsleistungen in den Bereichen Sozialwirtschaft, Sozialimmobilien und Gesundheitswirtschaft.
Michael Vilain (54) ist im Amt des Vizepräsidenten der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD) wiedergewählt worden. Er geht in seine zweite Amtszeit. „Standen die letzten vier Jahre unter den Vorzeichen von Haushaltskonsolidierung, Corona-Pandemie und Restrukturierung der Forschungs-Infrastruktur, freue ich mich, die Hochschule in den kommenden Jahren als Partner für das Sozial- und Gesundheitswesen weiter zu profilieren“, sagte Vilain. Er ist seit 2008 uunter anderem Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und geschäftsführender Direktor des Instituts für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft (IZGS) der EHD. Seine Forschungsschwerpunkte sind Nonprofit-Management, Zivilgesellschaft im Wandel, Netzwerke und Geschäftsmodelle der Zukunft.
Christian Könemann hat nach elf Jahren als Pressesprecher das Diakonische Werk Baden verlassen. Was er in Zukunft machen werde, wollte er auf Nachfrage nicht verraten. Könemann hatte die Leitung der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 2012 übernommen. Seitdem war er maßgeblich verantwortlich für die Ausrichtung der strategischen Kommunikation des Wohlfahrtsverbandes. Außerdem entwickelte er die Homepage und die Social-Media-Kanäle der badischen Diakonie weiter.
15.8. Köln:
Seminar „Vergütungssatzverhandlungen in der Eingliederungshilfe“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-519
16.8.:
Online-Seminar „Wie berichte ich nachhaltig?“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 0761/79186-35
24.8.:
Online-Kurs „Kita-Recht für Leitungskräfte“
der Paritätischen Akademie Hamburg
Tel.: 040/415201-66
28.-31.8. Berlin:
Fortbildung „Bundesrahmenhandbuch Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
30.8. Berlin:
Seminar „Grundlagen des Arbeitsrechtes in Einrichtungen der Sozialwirtschaft - Gestaltungsspielräume nutzen“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/98817-159
31.8. Berlin:
Seminar „Einfach empfehlenswert! MitarbeiterInnen als MarkenbotschafterInnen“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel. 030/275828221
31.8. Berlin:
Seminar „Datenschutz in sozialen Einrichtungen“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 0251/48261-173
31.8. Berlin:
Seminar „Betriebsverfassungsrecht aus Arbeitgebersicht“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/98817159
31.8.:
Webinar „Rechtliche Rahmenbedingungen und Grundlagen der Nachhaltigkeitsberichterstattung“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/98817-159
September
4.-5.9. Berlin:
Seminar „Recht auf Risiko?! Selbstschädigendes Verhalten von KlientInnen in der Assistenz“
der Bundesakademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 030/48837-495
4.-13.9.:
Online-Kurs „Grundlagen des strategischen Managements für die Sozialwirtschaft“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/275828227
5.9. Köln:
Seminar „Interne Revision bei gemeinnützigen Trägern“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-119
7.9. Köln:
Seminar „Kostenrechnung für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste“
der BFS Service GmbH
Tel.: 0221/98817-159
13.-14.9.:
Online-Seminar „Datenschutz und Social Media“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/2001700
22.9.:
Online-Seminar „Klimaziele identifizieren, validieren & kommunizieren“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/275828211