Kirchen
Bischof Bätzing zur Wahl: "Jetzt muss gehandelt werden"

epd-bild/Peter Jülich
Frankfurt a.M. (epd). Die Kirchen rufen nach der Bundestagswahl zu Zusammenhalt und Kompromissbereitschaft auf. „Der Wahlkampf ist vorüber, jetzt muss gehandelt werden“, forderte der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, sagte, die Tage und Wochen vor der Wahl seien geprägt gewesen von stark emotionalisierten Debatten, die die gesellschaftliche Stimmung aufgeheizt hätten. „Jetzt nach der Wahl stehen die Parteien der demokratischen Mitte vor der anspruchsvollen Aufgabe, mit diesem Wahlergebnis konstruktiv und verantwortungsvoll umzugehen“, erklärte die Hamburger Bischöfin am Sonntagabend.
Der Limburger Bischof Bätzing sagte der Tageszeitung „Welt“ (24. Februar): „Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler will eine Stärkung der demokratischen Mitte, was sich am Wahlergebnis zeigt. Ich hoffe, dass wir jetzt zügig eine stabile Regierung bekommen, die die Probleme anpackt.“ Extremistische Kräfte und solche, die trotz des völkerrechtswidrigen Angriffs auf die Ukraine mit Russland sympathisieren, dürften nicht den Ton angeben.
Mehr als 20 Prozent für AfD
Bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar wurden dem vorläufigen Ergebnis zufolge die Unionsparteien mit 28,6 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Die AfD kam auf 20,8 Prozent. Dem Bundestag gehören außerdem die SPD (16,4 Prozent), die Grünen (11,6 Prozent) und die Linke (8,8 Prozent) an. Alle weiteren Parteien scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,5 Prozent.
Die EKD-Ratsvorsitzende Fehrs sagte: „Die hohe Wahlbeteiligung zeigt: Viele Menschen wissen, wie wichtig es gerade in diesen unsicheren Zeiten ist, sich politisch zu beteiligen.“ Zugleich sei sie sehr besorgt darüber, dass extremistische Positionen größere Zustimmung gefunden haben als bei vorhergehenden Wahlen. Völkische Parolen und menschenverachtende Haltungen seien mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar.
Schuster erschrocken
Die hessen-nassauische Kirchenpräsidentin Christiane Tietz sagte: „Die Menschen setzen auf die Demokratie. Mit Sorge erfüllt mich, dass jede fünfte Stimme an eine populistische Partei ging. Umso wichtiger ist eine stabile Regierung in einer instabilen Welt“, sagte die evangelische Theologin am Sonntagabend. Viele Bürgerinnen und Bürger sehnten sich nach Orientierung und Hoffnung, nach äußerer und innerer Sicherheit.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte der „Welt“, er sei erschrocken über den Wahlerfolg der AfD, die ihren Stimmenanteil in nur drei Jahren verdoppelt habe. Es müsse alle umtreiben, „dass ein Fünftel der deutschen Wähler einer mindestens in Teilen rechtsextremistischen Partei ihre Stimme gibt, die sprachlich und ideologisch offen Verbindungen zum Rechtsradikalismus und Neo-Nazismus sucht, mit den Ängsten der Menschen spielt und ihnen nur scheinbare Lösungen anbietet“.
EKD-Bevollmächtigte: Haben mit Brief einen kritischen Punkt getroffen

epd-bild/Hans Scherhaufer
Berlin (epd). Dass das Verhältnis zwischen Kirchen und der CDU und CSU tieferen Schaden genommen hat, glaubt die Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nicht - und hofft, dass die Parteien nach der Wahl Kompromissfähigkeit beweisen.
epd: In wenigen Tagen wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie laufen diese Tage für Sie: Gibt es viele Abschiedstreffen?
Anne Gidion: Es ist eine besondere Situation. Am letzten Sitzungstag des Bundestags am 11. Februar haben wir eine ökumenische Abschieds- und Dankandacht gehalten für Abgeordnete, die ausscheiden. Es kamen Vertreter und Vertreterinnen aller Fraktionen, auch Abgeordnete, die sich noch einmal zur Wahl stellen. Die Atmosphäre dort hat mich berührt. Man spürt bei vielen die derzeit große Anstrengung. Ähnlich war es auch bei einem politischen Abendgebet, das wir gemeinsam mit dem Berliner Dom veranstaltet haben, bei dem Hermann Gröhe (CDU) gesprochen hat. Da gab es nachdenkliche Momente, wo ich die Kraft des Verbindenden von gottesdienstlichen Ritualen sehe, die auf eine andere Ebene bringen, was eine Debatte vielleicht gerade mühselig macht.
epd: Die Debatte am 11. Februar im Bundestag war hitzig, deutlich geprägt vom Wahlkampf. Und bei der Andacht davor sitzen die Politiker ganz anders beieinander?
Gidion: Ja, die Stimmung bei einer Andacht ist eine völlig andere. Ich würde sagen, die Menschen können dort eine ganz andere Version ihrer selbst sein, vielleicht auch in dem Gefühl: Wir müssen gerade mal einen kleinen Moment lang nicht streiten.
epd: Der Bruch der Ampel-Koalition hat zur vorgezogenen Neuwahl geführt. Gibt es etwas, das Sie richtig gut fanden an dieser Koalition?
Gidion: Der Anfang hat mir gut gefallen. Man hatte wirklich das Gefühl, die Beteiligten wollen ihre Unterschiedlichkeiten einbringen und gemeinsam etwas schaffen für dieses Land. Ich fand auch etliche Gesetzesvorhaben wichtig, etwa den Spurwechsel, also dass eine bestimmte Gruppe von Schutzsuchenden in Deutschland bleiben darf, wenn sie Arbeit finden, oder die Unterstützung von Freiwilligendiensten.
epd: Und was hat sie enttäuscht oder geärgert?
Gidion: Die Art des Auseinandergehens. Ich bedaure, dass dieses Signal zurückgeblieben ist: „Uns trennt mehr, als uns verbindet.“ Wir haben im Bundestag Parteien, die unsere demokratischen Grundpfeiler in Frage stellen und unterlaufen wollen. Umso mehr brauchen wir die Kompromissfähigkeit der Parteien der Mitte und die Entschlossenheit, zu zeigen, dass der demokratische Weg funktioniert.
epd: Jetzt arbeiten sich die Parteien teilweise sehr stark aneinander im Wahlkampf ab. Wie bewerten Sie den Stil des Wahlkampfs: Ist er so fair wie versprochen?
Gidion: Dieser Wahlkampf hat viele Facetten. Es gab Kanzlerkandidaten-Duelle, bei dem Menschen überwiegend sachlich miteinander geredet haben. Ich sehe originelle Wahlwerbung auf Instagram und gute Wahlaufrufe. Es gibt aber leider auch viel anderes, zum Beispiel Angriffe auf Wahlkämpfende auf der Straße. Das finde ich untolerierbar und brandgefährlich. So etwas führt dazu, dass noch weniger Leute den Mut haben, sich in dieser Weise politisch zu engagieren.
epd: Fehlen Ihnen Themen im Wahlkampf?
Gidon: Es ist auf jeden Fall problematisch, wie die ganze Klimathematik weggerutscht ist. Sie spielt im Wahlkampf praktisch keine Rolle, obwohl die Probleme nicht ansatzweise gelöst sind. Ein weiteres Thema ist die Pflege. Als alternde Gesellschaft steuern wir auf eine nicht mehr lösbare Pflegesituation zu. Und auch da hat wirklich niemand einen Masterplan. Stattdessen ist das Themenfeld Migration bestimmend.
epd: Sie und Ihr katholisches Gegenüber in Berlin, Karl Jüsten, haben vor der Abstimmung im Bundestag über Initiativen der Union für eine drastische Verschärfung des Asylrechts einen Brief an die Abgeordneten geschickt, der für viel Kritik in der Union gesorgt hat. Sind Sie zu weit gegangen?
Gidion: Wir haben eine Stellungnahme abgegeben, die es schon gab - zu einem Gesetzentwurf der Unionsfraktion, der längst eingebracht war und gar nicht mehr in die Abstimmung kommen sollte. Dann hat ihn plötzlich die AfD einbringen wollen, woraufhin die Union ihn dann doch selbst auf die Tagesordnung hat setzen lassen. In diese aufgeladene Situation haben wir die kirchlichen Positionen eingetragen. Wir wollten deutlich machen, wo die Initiativen rechtliche Probleme aufwerfen, aber auch, dass wir darin aus christlicher Überzeugung fehlgeleitete Vorstellungen entdecken. Auch vor einem gemeinsamen parlamentarischen Handeln mit der AfD zu warnen, war uns wichtig.
epd: Hat Sie die Wucht der Kritik überrascht?
Gidion: Ja, ich fand es erstaunlich, wie viele Reaktionen unsere Botschaft ausgelöst hat. Das zeigt, dass wir einen kritischen Punkt getroffen haben. Viele Menschen machen sich Sorgen um die Frage, wie man Migration und Integration besser gestalten kann. Ich kann nachvollziehen, dass man sich da rasche Lösungen wünscht. Aber zugleich muss man eben sicherstellen, dass man im geltenden Rechtsrahmen bleibt, europäisch beieinander und dass man den gesellschaftlichen Diskurs nicht vergiftet. Und nicht Migration an sich ist unser Problem - wir profitieren zum Beispiel extrem von zur Zuwanderung von Fachkräften -, sondern dass eine gute Integration Kraft und Ressourcen braucht, die oft fehlen.
epd: Fürchten Sie, dass das Schreiben Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit einem möglichen Kanzler Friedrich Merz haben könnte?
Gidion: In meinen zweieinhalb Jahren im Amt hatte ich viele gute Begegnungen mit Friedrich Merz, mit Carsten Linnemann und anderen Vertretern der Partei. In der Woche nach besagter Abstimmung im Bundestag haben wir zum CDU-Parteitag gemeinsam Gottesdienst gefeiert, uns den Friedensgruß gegeben und weitere Gespräche verabredet. Innerhalb der christlichen Familie kann auch mal gestritten werden.
epd: Teilen Sie die Sorge, dass die Abstimmung mit der AfD das Vertrauensverhältnis zwischen den demokratischen Parteien erschüttert hat und Koalitionsgespräche schwerer werden?
Gidion: Leichter gemacht hat es das bestimmt nicht. Aber gleichzeitig traue ich allen Beteiligten zu, dass sie nach der Wahl sagen: Um der Sache und der Verantwortung willen fangen wir noch einmal von vorn an.
epd: Laut Vorwahlumfragen wird die AfD-Fraktion im nächsten Bundestag deutlich stärker. Die EKD unterhält keine offiziellen Kontakte zu der in Teilen rechtsextremen Partei. Werden Sie diese Position noch einmal neu diskutieren müssen?
Gidion: Grundsätzlich sind alle Abgeordneten zu unseren geistlichen Angeboten eingeladen. Aber Gespräche sind kein Selbstzweck; wir werden wachsam und kritisch bleiben und menschenfeindliche Äußerungen nicht hinnehmen. Es geht uns um ernsthafte Auseinandersetzung. Und die wird es wieder geben.
Geraer Pfarrer kritisieren Stigmatisierung von Migranten
Gera (epd). Ostthüringer Pfarrerinnen und Pfarrer haben sich wenige Tage vor der Bundestagswahl für eine Gesellschaft des Vertrauens und Respekts ausgesprochen. In einem am 17. Februar in Gera veröffentlichten Appell erklärten die Erstunterzeichner, eine offene Gesellschaft lebe vom Respekt vor Leben und Würde aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion oder Geschlecht.
Die Autoren des Schreibens um die Geraer Pfarrer Barbara Lötzsch und Stefan Körner beklagen in ihrem Brief, dass Populisten auf extremistische Anschläge und zunehmende Radikalisierung mit simplen Antworten reagierten. Diese Gruppen begegneten komplexen Herausforderungen, indem sie bestimmte Menschengruppen marginalisierten. Dies führe zu einer Stigmatisierung von Migranten. Damit werde der soziale Frieden und die Demokratie in Deutschland gefährdet.
Die Geraer Geistlichen kritisierten, eine Stigmatisierung von Migranten in öffentlichen Debatten sei bis in die politische Mitte hinein zu beobachten. „Die Sprache ist enthemmt. Und in Folge enthemmter Sprache nehmen die Gewalttaten gegen Menschen mit Migrationsgeschichte rapide zu“, heißt es in dem „offenen Brief“. Migranten seien so zu Sündenböcken gemacht worden, deren Dasein als Gefährdung wahrgenommen werde und als Ursache für nahezu alle Fehlentwicklungen in Deutschland gelte.
Die Erstunterzeichner betonten, dass alle Menschen als Gottes Ebenbild und gleich an Würde geschaffen sind. Sie rufen zu einer Erneuerung des Vertrauens und der Solidarität auf. Die biblische Botschaft sei klar. Nur wer sich solidarisch für Menschen einsetze, handele für Christus.
Verfahren zu Streikrecht in kirchlichen Einrichtungen vertagt
Erfurt (epd). Die juristische Klärung der Zulässigkeit von Streiks in kirchlichen Kliniken vor dem Arbeitsgericht Erfurt verzögert sich um wenigstens neun Monate. Ein für den 19. Februar angesetzter Verhandlungstermin sei auf den 12. November verschoben worden, teilte die Diakonie Mitteldeutschland auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Halle mit. Geklagt hatten die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland und die Diakonie Mitteldeutschland. Damit wollen die Kläger die Gewerkschaften daran hindern, ihre Mitglieder und andere Arbeitnehmer zu Streiks oder anderen Arbeitskampfmaßnahmen am Hufeland-Klinikum in Weimar aufzurufen. Ein erster Gütetermin vor dem Arbeitsgericht blieb im August ohne Ergebnis.
Dem Rechtsstreit wird von beiden Prozessparteien deutschlandweite Bedeutung zugemessen. Beide Seiten streben eine grundsätzliche Klärung der Ausgestaltung des sogenannten Dritten Weges im kirchlichen Arbeitsrecht an. Dieser ergibt sich laut Diakonie-Vorstand Oberkirchenrat Christoph Stolte aus dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen. Konflikte würden nicht über Mittel des Arbeitskampfes, sondern durch ein verbindliches Schlichtungsverfahren gelöst. Stolte bedauerte, dass diese Klärung nicht vor Herbst erfolgen kann.
Ver.di argumentiert, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen des „Dritten Weges“ behinderten die Möglichkeiten der Gewerkschaftsarbeit in kirchlichen Einrichtungen. Möglicherweise ende das Verfahren erst vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe oder dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, kündigte ein Prozessvertreter bereits im August an.
Landeskirche künftig mit Namenszusatz
Berlin (epd). Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz präsentiert sich künftig mit dem Namenszusatz „Evangelisch im Osten“. Damit solle „das Glaubensprofil der Landeskirche und ihre Verwurzelung im Osten Deutschlands“ unterstrichen werden, teilte die kirchliche Pressestelle am 20. Februar in Berlin mit. Die Landeskirche trägt ihren derzeitigen Namen seit dem Zusammenschluss der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg mit der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz Anfang 2004.
Bischof Christian Stäblein betonte, der Name der Landeskirche sei „sehr lang und in der Kommunikation gelegentlich ein Hemmnis“. Mit dem neuen Namenszusatz werde nun „kurz und knapp“ wiedergegeben, „wer wir sind und wo wir sind“.
Stäblein erklärte, er hoffe, dies werde dazu beitragen, dass die Landeskirche „in der Öffentlichkeit noch sichtbarer und erkennbarer“ wird. Zugleich solle der Namenszusatz dazu einladen, „miteinander ins Gespräch zu kommen über unsere Identität und unser Selbstverständnis“.
Die Kirchenleitung habe sich für den Namenszusatz „Evangelisch im Osten“ entschieden, um mit wenigen Worten die Identität der Landeskirche und ihre Prägung durch die Geschichte der Region zu verdeutlichen, hieß es. Die Erfahrungen von Christinnen und Christen in der DDR seien durch besondere Herausforderungen geprägt gewesen, während die Kirche in Westdeutschland in einem demokratischen Umfeld gewirkt habe. Diese unterschiedlichen Erfahrungen spielten auch heute noch eine Rolle.
Bischof wirbt für Aufarbeitung der Corona-Pandemie

epd-bild/Heike Lyding
Berlin (epd). Der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein hat sich für eine kritische Aufarbeitung der Rolle der Kirche in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Es sei wichtig, jetzt mit Abstand zurückzublicken, sagte Stäblein am 20. Februar bei einer Veranstaltung in der Berliner Gethsemanekirche vor knapp 100 Zuhörern. Es sei nicht alles falsch, aber auch nicht alles richtig gemacht worden. Die Kirchenleitung habe versucht, den Gemeinden möglichst viele Freiheiten zu lassen, betonte Stäblein. Nach Mai 2020 habe es keine flächendeckenden Lockdowns mehr in der Landeskirche gegeben, sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.
Je nachdem, ob die Kirchenleitung mit ihren Maßnahmen zu mehr Freiheiten oder zu mehr Begrenzungen während der Pandemie tendierte, habe es immer wieder Stürme der Entrüstung von der jeweils anderen Seite gegeben habe, betonte der Bischof. Die Kirche habe jedoch stets versucht, für die Menschen da zu sein.
Stäblein kritisierte mit Blick auf die zeitweilige Schließung von Kitas und Schulen den Umgang mit Kindern in der Pandemie. „Hier hätten wir als Kirche viel lauter sein müssen“, sagte er. Auch in der Kommunikation sei viel falsch gemacht worden. Im Umgang mit Nicht-Geimpften habe es viele Verwerfungen gegeben.
Der Bischof warb dafür, sich in der Debatte über die Corona-Schutzmaßnahmen „wirklich zuzuhören“. Zu der Veranstaltung hatte eine Kirchengemeinde eingeladen. Neben Stäblein waren auf dem Podium unter anderem Betroffene und ein ehemaliger Krankenhausseelsorger. Im Publikum saßen zahlreiche Kritiker der Schutzmaßnahmen.
Altbischof Dröge: Kirche muss für wehrhafte Demokratie eintreten

epd-bild/Rolf Zöllner
Bonn (epd). Der frühere Berliner Bischof Markus Dröge hat die Christen aufgerufen, sich für eine wehrhafte Demokratie und gegen antidemokratischen Rechtspopulismus einzusetzen. „Wir brauchen mutige öffentliche Stimmen, die sich gegen Menschenverachtung stellen und Barmherzigkeit einfordern“, sagte der 70-jährige evangelische Theologe am 20. Februar laut Redetext in einem Vortrag in der Evangelischen Akademie im Rheinland in Bonn. Es gelte, humane Werte und die gleiche Würde aller Menschen gegen die völkische Ideologie der neuen Rechten und das „rechtsextremistische Gedankengut“ der AfD zu verteidigen.
„Der Kontrast zwischen dem, was in der AfD und ihrem Umfeld vertreten wird, und dem, wofür der christliche Glaube steht, kann größer nicht sein“, sagte der ehemalige Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die „in wesentlichen Teilen als rechtsextrem“ eingestufte AfD verfolge „das Ziel, unsere freie, demokratische Gesellschaft autoritär und völkisch umzugestalten, und zwar gegen den Geist des Grundgesetzes“. Wenn eine Partei die Menschenwürde und die Werte des Grundgesetzes nicht achte und sich anschicke, die Demokratie zu unterwandern, „dann muss Kirche das anmahnen“, sagte Dröge.
Die ostdeutschen Kirchen setzten sich bereits seit 2014 mit dem Erstarken des Rechtspopulismus und der AfD auseinander, sagte er weiter. So gebe es inzwischen klare Unvereinbarkeitsbeschlüsse: „Wer Parteimitglied der AfD ist, kann keine kirchlichen Ämter übernehmen und wird auch nicht bei der Kirche oder der Diakonie angestellt.“
Kirchen und Hilfswerke rufen wieder zum Klimafasten auf
Schwerte (epd). Unter dem Motto „So viel du brauchst“ laden evangelische Landeskirchen, katholische Bistümer und kirchliche Hilfswerke auch in diesem Jahr zum „Klimafasten“ ein. Die elfte Ausgabe der ökumenischen Aktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit startet am Aschermittwoch (5. März) und endet am Karsamstag (20. April), wie das Koordinationsteam der 24 evangelischen und katholischen Partner am 19. Februar in Schwerte mitteilte. In diesem Jahr lautet das Motto „Gemeinsam aufbrechen in die Zukunft - Klimaschutz in der Gemeinschaft“.
Die sieben Fastenwochen sind verschiedenen Schwerpunkten mit entsprechender Bibelstelle gewidmet. Zum Start geht es etwa unter dem Thema „Aufbruch. Neuland“ um Angst vor Veränderungen. In den sechs folgenden Wochen danach soll laut Veranstaltern eine Vision von einem klimaneutralen Deutschland im Jahr 2050 entworfen werden. Als Stichworte werden grüne Städte, solidarische Quartiere, nachhaltige Mobilität auf dem Land, Sharing Economy oder Kreislaufwirtschaft genannt.
22 Landeskirchen und Bistümer sind dabei
An der ökumenischen Initiative „Klimafasten“ beteiligen sich 22 Landeskirchen und Bistümer sowie die kirchlichen Hilfswerke „Brot für die Welt“ und Misereor. Ideen für ein Engagement im Umweltschutz und für Gerechtigkeit auch in Krisenzeiten finden sich auf der Website www.klimafasten.de.
Christinnen der Cookinseln haben Weltgebetstag-Liturgie verfasst
Stein (epd). Der Weltgebetstag der Frauen steht in diesem Jahr unter dem Motto „wunderbar geschaffen“. Die Liturgie für die weltweite Ökumene-Aktion am 7. März haben Frauen verschiedener Kirchen und Konfessionen der Cookinseln im Pazifik verfasst, wie das deutsche Weltgebetstag-Komitee in Stein bei Nürnberg am 20. Februar mitteilte. Die Cookinseln sind ein Staat im Südpazifik, zu dem 15 kleine Inseln mit 15.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gehören. Der Weltgebetstag wird seit knapp 100 Jahren begangen und am ersten Freitag im März in 150 Ländern gefeiert.
Das Weltgebetstag-Motto stamme aus dem biblischen Psalm 139 und lade zum Dank für das Geschenk des Lebens und der wunderbaren Schöpfung ein, die die Cookinseln präge, hieß es weiter. Das farbenprächtige Bildmotiv dazu stamme von den einheimischen Künstlerinnen Tarani Napa und Tevairangi Napa, die Mutter und Tochter seien. Thema der Liturgie seien allerdings auch die Schattenseiten - die Unterdrückung der Maori in der Kolonialzeit oder der heutige Exodus junger Leute, hieß es.
Größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen
Der Weltgebetstag der Frauen ist den Angaben zufolge die größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen weltweit. Jedes Jahr wird die Liturgie von einem anderen Land vorbereitet. 2024 war es Palästina, kommendes Jahr wird es Nigeria sein. In Deutschland nehmen jährlich rund 800.000 Menschen an den Gottesdiensten an diesem Tag teil. Der deutsche Weltgebetstag fördert 100 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten, um die Lebenssituation und Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen zu verbessern.
Erstes Nagelkreuzzentrum in Chemnitz
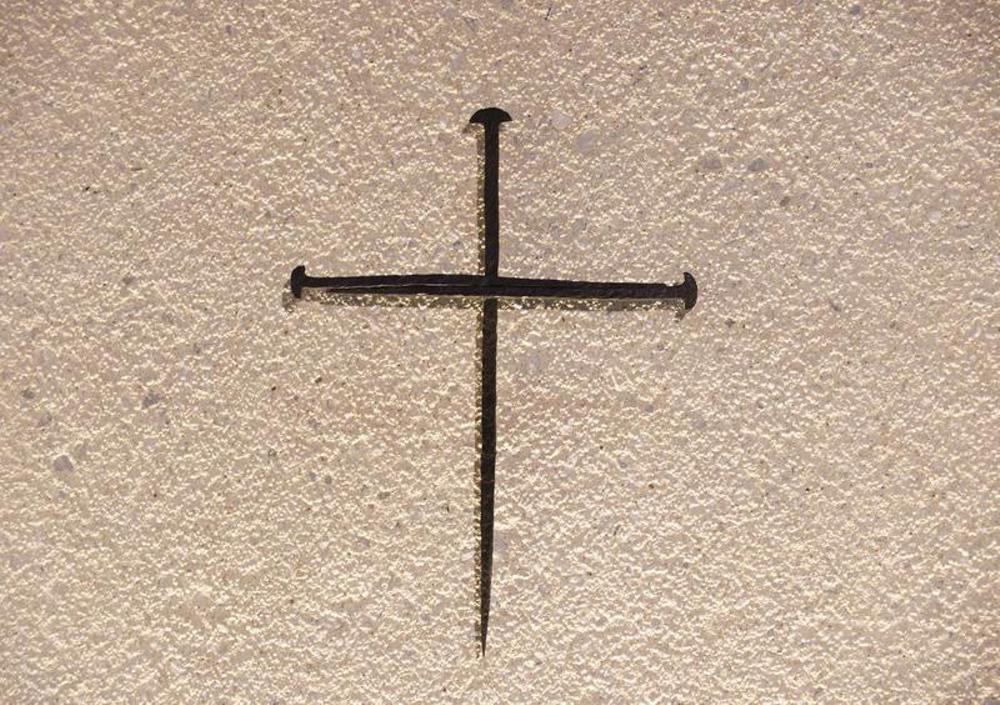
epd-bild/Dietrich Flechtner
Chemnitz (epd). Chemnitz erinnert am 5. März mit einem Friedenstag an die Opfer im Zweiten Weltkrieg und die Zerstörung der Stadt vor 80 Jahren. Ein Höhepunkt des Programms sei die Verleihung des Nagelkreuzes von Coventry an das neu gegründete ökumenische Nagelkreuzzentrum in der Chemnitzer Jakobikirche, sagte Pfarrer Stephan Tischendorf am 18. Februar in Chemnitz. Zum Gottesdienst wird der internationale Leiter der Nagelkreuzgemeinschaft und Dekan von Coventry, John Witcombe, erwartet.
Geplant sind zum Friedenstag außerdem am Vormittag eine Kranzniederlegung auf dem Städtischen Friedhof sowie tagsüber Ausstellungen, Gedenkwege sowie weitere Open-Air-Angebote in der Innenstadt, kündigte Sabine Kühnrich von der Arbeitsgemeinschaft Chemnitzer Friedenstag an. Auf dem Neumarkt soll eine Kundgebung unter dem Motto „Frieden stiften durch Versöhnung“ stattfinden, zu der auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet wird.
Bei Luftangriffen der Alliierten auf Chemnitz kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges kamen zwischen dem 6. Februar und dem 11. April 1945 rund 4.000 Menschen ums Leben. Rund 80 Prozent der Innenstadt wurden zerstört.
Die internationale Nagelkreuzgemeinschaft ist eine weltweite Bewegung für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Ausgangspunkt ist die Kathedrale im englischen Coventry, die 1940 von der deutschen Luftwaffe zerstört wurde. Tischendorf sagte, das Chemnitzer Nagelkreuz solle auch ausgeliehen werden, zum Beispiel an Schulen oder Institutionen, um dem Thema Versöhnung mehr Aufmerksamkeit zu geben.
Internationale Nagelkreuzgemeinschaft
Die Geschichte der Nagelkreuzgemeinschaft hat im Zweiten Weltkrieg begonnen. Am 14. November 1940 griff die deutsche Luftwaffe die englische Kleinstadt Coventry an. 550 Menschen starben, die Innenstadt und die spätmittelalterliche St. Michael's Kathedrale wurden zerstört.
Wenige Wochen später rief der Domprobst von Coventry, Richard Howard, zu Weihnachten bei einer landesweiten Rundfunkansprache aus der Kirchenruine dazu auf, nicht Rache, sondern Versöhnung zu üben. Als Zeichen dafür ließ er drei Zimmermannsnägel aus dem ausgebrannten Dachstuhl der Kathedrale zu einem Kreuz schmieden: dem „Cross-of-Nails“, zu deutsch: Nagelkreuz.
Schon kurz nach Kriegsende wurde eine Kopie dieses Nagelkreuzes an die Nikolaikirche in Kiel überreicht. Es folgten in den 1960er-Jahren deutsche Städte wie Münster, Hamburg und Berlin.
Den Gedanken einer weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft entwickelte der Domprobst von Coventry, Bill Williams (1914-1990). Heute gehören der Gemeinschaft in Deutschland dutzende Zentren an, weltweit sind es mehr als 200. Auch die Dresdner Frauenkirche, die Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und die KZ-Gedenkstätte Dachau gehören dazu. Am 5. März 2025 wird die Chemnitzer St. Jakobikirche aufgenommen.
Die Nagelkreuzgemeinschaft von Coventry versteht sich als internationales Netzwerk für Frieden und Versöhnung. Durch ihre Versöhnungsarbeit wollen die Gemeinden Wunden der Geschichte heilen, die Vielfalt der Kulturen betonen und Friedensarbeit leisten. Als Zeichen der Verbundenheit wird in den Nagelkreuzzentren in der Regel jeden Freitag um 12 Uhr das Versöhnungsgebet von Coventry gebetet. Im Mittelpunkt stehen die Worte „Vater vergib“, die Domprobst Richard Howard in die Chorwand der zerstörten Kathedrale meißeln ließ.
50.000 Euro für Berliner Zionskirche
Berlin/Bonn (epd). Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt die Restaurierung der Berliner Zionskirche mit weiteren 50.000 Euro. Das Geld solle für die Instandsetzung der Innenstützen unterhalb der Emporen und für die Restaurierung der Kanzel eingesetzt werden, teilte die Stiftung am 17. Februar in Bonn mit. Sie hat sich eigenen Angaben zufolge seit 1991 an verschiedenen Renovierungsmaßnahmen mit insgesamt über einer Million Euro beteiligt.
Die Zionskirche im Stadtteil Mitte wurde in den Jahren 1866 bis 1873 erbaut. Sie zählt zu den bekanntesten Gotteshäusern der Hauptstadt. Denkmalschützer sehen in ihr auch wegen der herausragenden Raumschöpfung ein wichtiges Bindeglied in der Entwicklung des modernen protestantischen Kirchenbaus in Preußen.
"Orgel des Monats" steht in Zeitz
Zeitz (epd). Die Rühlmann-Orgel in der St.-Michael-Kirche in Zeitz (Sachsen-Anhalt) ist „Orgel des Monats Februar“ der Stiftung Orgelklang. Die Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) fördert die Renovierung des Instruments mit 3.000 Euro, wie die mitteldeutsche Landeskirche am 17. Februar in Magdeburg mitteilte. Das Instrument muss demnach umfassend saniert werden. Insbesondere gehe es darum, die besondere, spätbarocke Klangfülle der Orgel zu rekonstruieren. Das Instrument wurde den Angaben zufolge im Jahr 1911 in der Werkstatt des Orgelbauers Wilhelm Rühlmann in Zörbig im heutigen Landkreis Anhalt-Bitterfeld gebaut.
In den 1950er Jahren sei die originale Disposition im neobarocken Stil umgeformt worden. Ziel der geplanten Restaurierung sei neben der Rückführung zum originalen Klang eine Erweiterung der Spielmöglichkeiten, hieß es.
Bereits im Herbst vergangenen Jahres sind laut Stiftung Orgelklang der Balg und die Windladen restauriert worden. Neben der Instandsetzung des Pfeifenwerks müsse vor allem der Holzwurm umfassend bekämpft werden. Hierfür werden den Angaben zufolge rund 773.000 Euro benötigt. Diese Summe sei aber noch nicht gesichert. Für mindestens 25 Euro könne im Internet eine Patenschaft für eine der mehr als 3.000 Orgelpfeifen erworben werden, hieß es.
Die Stiftung Orgelklang der EKD wurde 2007 unter dem Dach der Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland (Stiftung KiBa) gegründet. Seit ihrer Gründung habe die Stiftung Orgelklang über 240 Förderzusagen für die Sanierung von Kirchenorgeln in Höhe von gut 2,2 Millionen Euro gegeben, hieß es.
Katholischer Preis gegen Rassismus geht auch nach Pirna
Bonn/Pirna (epd). Die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) zeichnen vier Projekte mit dem Katholischen Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus aus. Der erste Preis würdigt eine internationale Frauengruppe des Caritas-Verbandes Minden für das Projekt „Frauen, die Mut machen“, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz am 18. Februar in Bonn mitteilte. Das Projekt setze darauf, Fluchterfahrungen von Frauen zur Sprache zu bringen.
Zudem werden zwei zweite Preise vergeben: Ausgezeichnet wird der Pfarrer Vinzenz Brendler aus der Pfarrei St. Heinrich und Kunigunde im sächsischen Pirna für die Präsentation der Ausstellung „Es ist nicht leise in meinem Kopf“. Auch der Verein „IN VIA München“ erhält eine Auszeichnung für das Projekt „Zuhause ankommen“. Pfarrer Brendler habe Zivilcourage gezeigt, anstatt sich dem lärmenden Mob zu ergeben, hieß es. Als das Landratsamt entschied, eine Ausstellung über Geflüchtete nicht zu zeigen, habe er die Räume der Pfarrei geöffnet, um dies doch noch zu ermöglichen. Das Projekt von „IN VIA München“ vermittelt bezahlbaren Wohnraum für Geflüchtete und Migranten.
Der Sonderpreis für Initiativen von Schulen und jungen Menschen geht den Angaben nach an die Maria-Ward-Realschule im bayerischen Burghausen, die dem Leitmotiv „Raum für Vielfalt - kein Platz für Rassismus“ folge. Die Preise sind insgesamt mit 12.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet am 6. Mai in Berlin statt. Die Auszeichnung wird seit 2015 alle zwei Jahre vergeben.
Brandstiftung an Wurzener Stadtkirche
Wurzen/Leipzig (epd). Ein 34-jähriger Mann hat laut Polizei an der Eingangstür der evangelischen Stadtkirche St. Wenceslai im sächsischen Wurzen versucht, einen Brand zu legen. Die Tat habe sich in der Nacht zum 21. Februar ereignet, teilte die zuständige Polizeidirektion Leipzig am 21. Februar mit. Ein Ausbreiten des Feuers sei aufgrund des sofortigen Eingreifens von Polizeibeamten verhindert worden.
Die Flammen konnten demnach gelöscht werden. Der Tatverdächtige sei zunächst vorläufig festgenommen worden. Allerdings werfen ihm die Ermittler vor, in der Vergangenheit in weiteren Kirchen in Wurzen versucht zu haben, Feuer zu legen. Wegen der Wiederholungsgefahr sei ein Haftbefehl erlassen worden. Dem Mann werde versuchte schwere Brandstiftung in drei Fällen vorgeworfen, hieß es.
Die Kirchentür von St. Wenceslai sei bei dem jüngsten Angriff leicht beschädigt worden, hieß es. Eine konkrete Schadenshöhe könne noch nicht beziffert werden.
In Wurzen war es vermehrt zu Angriffen auf Kirchengebäude gekommen, laut Polizei unter anderem auch in Form von Graffitis mit kirchenkritischen Parolen. Der Beschuldigte soll demnach neben der jüngsten Brandstiftung auch für eine weitere am 9. Februar verantwortlich sein.
Früherer Propst Karl-Heinrich Lütcke wird 85 Jahre alt
Berlin (epd). Der frühere Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Karl-Heinrich Lütcke, hat am 20. Februar sein 85. Lebensjahr vollendet. Der promovierte Theologe, der als leidenschaftlicher Konfliktvermittler und wichtiger Chronist der landeskirchlichen Geschichte gilt, war bis zu seinem Ruhestand 2005 zehn Jahre lang Propst der Landeskirche.
Karl-Heinrich Lütcke wurde am 20. Februar 1940 in Schleswig geboren. Nach dem Studium der klassischen Philologie und der evangelischen Theologie in Tübingen, Zürich und München und einer Promotion über den Kirchenvater Augustinus wurde er 1970 in Württemberg zum Pfarrer ordiniert. Anschließend war er am Predigerseminar in Stuttgart als Studienleiter tätig.
1977 berief ihn die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg zum Leiter der Bildungsabteilung ins West-Berliner Konsistorium. 1990 und 1991 übernahm er die Vakanzverwaltung des Propstamtes in der West-Berliner Kirche. 1995 wählte ihn die Synode zum Propst, das Amt hatte er von 1996 bis zum Ruhestand 2005 inne. Als Propst war Lütcke zugleich theologischer Leiter des Konsistoriums in Berlin und Stellvertreter des Bischofs.
Berliner Missionswerk mit neuer Leitung
Berlin (epd). Der promovierte Theologe Ulrich Schöntube wird neuer Direktor des Berliner Missionswerkes. Voraussichtlich zum 1. Juni tritt der 51-Jährige die Nachfolge von Christof Theilemann an, der Ende April in den Ruhestand geht, wie das Missionswerk am 17. Februar in Berlin mitteilte. Das 1824 gegründete Berliner Missionswerk unterhält weltweite Partnerschaften, engagiert sich in Entwicklungsprojekten, fördert den theologischen Austausch und unterhält ein eigenes Freiwilligenprogramm. Ein Beispiel für die Arbeit des Berliner Missionswerkes ist das Schulzentrum Talitha Kumi in Palästina. Dieses bietet 850 Kindern und Jugendlichen Bildung vom Kindergarten bis zum Abitur.
Ulrich Schöntube stammt aus Berlin. Seit 2006 ist er Pfarrer in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Zuletzt wirkte er als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Frohnau und war Ökumenereferent des Kirchenkreises Berlin-Reinickendorf. Zuvor war er unter anderem Direktor der Gossner Mission, mit der das Berliner Missionswerk kooperiert. Träger des Missionswerkes sind die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und die Evangelische Landeskirche Anhalts.
Theologin Ruck-Schröder kandidiert für Präses-Amt in Westfalen

epd-bild/Jens Schulze
Bielefeld/Hildesheim (epd). Die Hildesheimer Regionalbischöfin Adelheid Ruck-Schröder kandidiert für das Präses-Amt in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Die 58-jährige Theologin werde den Delegierten des Landeskirchenparlaments bei seiner Tagung im März zur Wahl vorgeschlagen, wie das Bielefelder Landeskirchenamt am 19. Februar mitteilte. Seit dem Rücktritt von Annette Kurschus von ihren Ämtern als westfälische Präses und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im November 2023 ist das Präses-Amt vakant.
Grund für den Rücktritt von Kurschus war mangelhafte Kommunikation im Zusammenhang mit einem Missbrauchsverdacht gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter aus ihrem Umfeld. Eine Neuwahl scheiterte im vergangenen November, nachdem der einzige Bewerber seine Kandidatur zurückgezogen hatte. Gegen ihn gab es laut Landeskirche Vorwürfe wegen grenzverletzenden Verhaltens in der Vergangenheit. Die Landeskirche wird derzeit vom Theologischen Vizepräsidenten Ulf Schlüter kommissarisch geleitet.
Einzige Kandidatin
Ruck-Schröder ist Regionalbischöfin im Sprengel Hildesheim-Göttingen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Sie ist die einzige Kandidatin, die sich in der Sondersitzung der westfälischen Landessynode am 29. März zur Wahl stellen wird.
Die am 1. Mai 1966 geborene Ruck-Schröder wuchs in Stuttgart auf. Nach dem Theologie-Studium in Tübingen und Berlin, das sie mit der Promotion abschloss, sammelte sie erste Erfahrungen als Pfarrerin in der westfälischen Gemeinde Havixbeck bei Münster. Anschließend war sie als Berufsschulpfarrerin im Saarland tätig, später wechselte sie nach Niedersachsen in eine Göttinger Gemeinde. Bevor sie 2021 Regionalbischöfin wurde, war sie sechs Jahre Leiterin des Predigerseminars im Kloster Loccum. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.
Ehrung für ersten Luther-Biografen Johann Mathesius
Wittenberg (epd). Das Lutherhaus in Wittenberg erinnert an den ersten Luther-Biografen Johann Mathesius. Am 28. Februar wird an der Fassade des Wittenberger Augusteums eine Gedenktafel für den Pfarrer und Reformator (1505-1565) angebracht, teilte die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt am 18. Februar in Wittenberg mit. An der feierlichen Enthüllung werden demnach Vertreter der Johann-Mathesius-Gesellschaft aus Markkleeberg bei Leipzig, der LutherMuseen und des Rotary Clubs Wittenberg teilnehmen, der die Tafel finanziert habe.
Der im sächsischen Rochlitz geborene Johannes Mathesius war den Angaben zufolge ein bedeutender Prediger und Autor. Er studierte demnach unter anderem Theologie in Ingolstadt und sei so stark von Martin Luthers (1483-1546) Schriften beeinflusst worden, dass er 1529 nach Wittenberg gezogen sei und dort studiert habe.
1532 wurde er nach Angaben der Luthergedenkstätten Rektor der Lateinschule in Joachimsthal im Erzgebirge, sei aber 1540 wieder als Student nach Wittenberg zurückgekehrt. Dort sei Mathesius Tischgenosse Luthers und der wichtigste Überlieferer der Tischreden des Reformators geworden, die er zwei Jahre lang aufgezeichnet habe.
Ab 1542 habe Mathesius wieder als Pfarrer in Joachimsthal gewirkt, wo er die lutherische Lehre verteidigt habe. In 17 Predigten habe er seiner Gemeinde, die vor allem aus Bergarbeitern bestanden habe, das Leben Luthers vorgestellt. Diese Predigten bildeten den Angaben zufolge die Grundlage für die erste Biografie über den Reformator mit dem Titel „Luthers Leben“, die 1566 erscheinen sei.
Theologe kritisiert Trumps "dreifache Schuldumkehr"

epd-bild/Matthias Dembski
Bremen (epd). US-Präsident Donald Trump betreibt aus Sicht des Friedensbeauftragten der Bremischen Evangelischen Kirche, Pastor Andreas Hamburg, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine „dreifache Schuldumkehr“. Das löse auch unter den Geflüchteten aus der Ukraine eine Sprachlosigkeit und eine Starre aus, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Niemand weiß, wie es weitergeht.“ Hamburg ist in der Ukraine geboren und seit 2018 Pastor der evangelischen St.-Markus-Gemeinde in Bremen.
Zur Schuldumkehr sagte der Theologe im Vergleich zur biblischen Erzählung vom barmherzigen Samariter, der einem Überfallenen hilft: „Jetzt kehrt der Samariter zurück und fordert von dem überfallenen Verwundeten, den er versorgt hat, das Geld zurück. Außerdem beschuldigt er ihn, die Misere selbst verursacht zu haben. Und schließlich liefert er ihn auch noch den Räubern aus. Das macht mich sprachlos.“
„Spielt Putin in die Karten“
Was dem durch den russischen Angriffskrieg traumatisierten Volk in der Ukraine Halt geboten habe, werde nun von Trump infrage gestellt, sagte Hamburg. „Das spielt Putin voll in die Karten, das ist doch krankhaft.“ Trump hatte am 19. Februar gesagt, der ukrainische Präsident sei ein „Diktator ohne Wahlen“. Er wies außerdem der Ukraine die Verantwortung für den Krieg zu mit der Formulierung, die Ukraine hätte diesen Krieg niemals zulassen dürfen, sondern einen Deal machen sollen. Trump wiederholte damit bekannte russische Propaganda-Narrative.
Er selber lasse sich dadurch nicht entmutigen, sagte Pastor Hamburg, der seit Kriegsbeginn vor drei Jahren aus Bremen viele Hilfstransporte für die Ukraine organisiert hat. „Ich merke, dass ich sehr trotzig bin und nun noch mehr Menschen in die Unterstützung einbeziehen möchte.“
Andreas Hamburg ist in der Ukraine geboren und hat als Russlanddeutscher deutsche Wurzeln. Er kam im Alter von 21 Jahren nach Deutschland. Nach einem Theologiestudium war er im Auftrag der bayerischen Landeskirche zehn Jahre Auslandspfarrer in Charkiw und Odessa für die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche der Ukraine, bevor er nach Bremen kam.
Nacht für kranken Papst Franziskus gut verlaufen
Rom (epd). Die Nacht ist für den kranken Papst Franziskus gut verlaufen. „Der Papst hat geschlafen und ruht sich aus“, heißt es in einer Mitteilung des Vatikans vom Morgen des 24. Februar. Der Zustand des 88-Jährigen ist nach wie vor kritisch. Am Abend zuvor hatte der Vatikan über eine „anfängliche, leichte Niereninsuffizienz“ berichtet, diese sei aktuell „unter Kontrolle“.
Franziskus wird seit dem 14. Februar im Gemelli-Krankenhaus in Rom behandelt, ursprünglich wegen einer Bronchitis. Zusätzlich wurde im Krankenhaus dann der Beginn einer beidseitigen Lungenentzündung festgestellt und die Behandlung des Papstes dementsprechend angepasst. Am Wochenende wurde über Atemnot-Anfälle berichtet. Franziskus wird daher über die Nase mit Sauerstoff versorgt.
Der Zustand des Pontifex wurde in der Mitteilung über seinen gesundheitlichen Zustand vom Sonntagabend als „wach“ und „gut orientiert“ beschrieben. Aufgrund der Komplexität des Krankheitsbildes und der notwendigen Wartezeit, bis die Therapien anschlagen, bleibe die Prognose aber weiter zurückhaltend.
Soziales
Mehr Geld im Spendentopf

epd-bild/Hannes von der Fecht
Berlin (epd). Die Deutschen haben im vergangenen Jahr rund 5,1 Milliarden Euro gespendet, zwei Prozent mehr als im Jahr davor. Der durchschnittliche Spendenbetrag stieg gegenüber dem Vorjahr um 3 auf 43 Euro, wie der Deutsche Spendenrat am 20. Februar in Berlin bei der Vorstellung der „Bilanz des Helfens 2024“ mitteilte.
Insgesamt gaben 16,7 Millionen Menschen im vergangenen Jahr Geld an gemeinnützige Organisationen, rund 300.000 weniger als 2023. Damit gab ein Viertel der deutschen Bevölkerung ab zehn Jahren (25,4 Prozent) mindestens einmal Geld an eine gemeinnützige Organisation, 0,4 Prozentpunkte weniger als im Jahr davor. 2005 lag die Spendenreichweite noch bei 51 Prozent.
Mit fast zwei Dritteln (60 Prozent) trug im vergangenen Jahr die Generation 60plus am meisten zum Spendenaufkommen bei. Die höchste Zuwachsrate gab es bei den 30- bis 39-Jährigen (plus 27 Prozent). Im Durchschnitt habe jeder Spender sieben Mal pro Jahr gespendet. Das meiste Geld wird traditionellerweise im Dezember gespendet, insgesamt 20 Prozent des Gesamtaufkommens.
Während im vergangenen Jahr in der Altersgruppe 70plus vier Prozent mehr gespendet wurde (im Durchschnitt 411 Euro pro Spender), ging das Spendenvolumen bei den 60-69-Jährigen um sieben Prozent zurück.
Deutliche Veränderungen gab es bei den bevorzugten Spendenzwecken. So erhielt etwa die Not- und Katastrophenhilfe mit 725 Millionen Euro rund 200 Millionen Euro weniger als vor einem Jahr (minus 22 Prozent). Einen kräftigen Rückgang gab es auch bei den Spenden für Geflüchtete (minus neun Prozent).
Leichte Anstiege verzeichneten die Bereiche Sport, Kultur, Denkmalpflege, Krankheit und Behinderung. Kirchliche Organisationen erlebten einen Zuwachs gegenüber 2023 um 18 Prozent auf 901 Millionen Euro. Regionale und nationale Projekte wurden in der Summe weiterhin stärker unterstützt als internationale Hilfsmaßnahmen.
Als mögliche Begründung für das gestiegene Spendenaufkommen verweist die Studie auf gestiegene Reallöhne und eine wieder leicht ansteigende positive Selbsteinschätzung der derzeitigen finanziellen Situation in Teilen der Bevölkerung. 61 Prozent schätzen ihre finanzielle Situation aber weiter als angespannt ein. Wichtigste Spendenbarriere der Nichtspender seien „Zweifel an der Transparenz und Effektivität von Wohltätigkeitsorganisationen“. An zweiter Stelle wurden zu geringe finanzielle Möglichkeiten genannt.
Laut Spendenrat übersteigt das Spendenaufkommen seit einem Jahrzehnt regelmäßig die Fünf-Milliarden-Euro-Marke. Die höchsten Spendeneinnahmen wurden mit 5,8 Milliarden Euro 2021 verzeichnet, unter anderem wegen der Flutkatastrophe in Deutschland und dem Krieg in der Ukraine.
Die „Bilanz des Helfens“ wird im Auftrag des Spendenrates vom Meinungsforschungsinstitut YouGov erstellt. Sie beruht auf einer repräsentativen, monatlichen Erhebung unter 10.000 privaten Verbrauchern ab zehn Jahren. Nicht enthalten sind Erbschaften, Unternehmensspenden, Spenden an politische Parteien sowie Großspenden von mehr als 2.500 Euro. Der Deutsche Spendenrat ist ein Dachverband von 74 Spenden sammelnden Organisationen.
Kälte sorgt für Ansturm auf Notübernachtungen

epd-bild/Rolf Zöllner
Berlin (epd). Die Berliner Notübernachtungen für Obdachlose geraten durch die kalten Temperaturen an ihre Belastungsgrenze. Einzelne Einrichtungen haben ihre Kapazitäten zur Aufnahme Bedürftiger erhöht, wie der Leiter der Koordinierungsstelle Berliner Kältehilfe, Jens Aldag, am 19. Februar dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte.
So hat die Stadtmission in ihrer Notübernachtung für Obdachlose am Containerbahnhof in Friedrichshain die Kapazität zu Wochenbeginn von 70 auf 120 Plätze erhöhen können. Die Sprecherin der Stadtmission, Barbara Breuer, nannte am Mittwoch die schnelle Genehmigung der Senatssozialverwaltung zur Genehmigung und Kostenübernahme der zusätzlichen Plätze vorbildlich. Auch die Johanniter haben inzwischen in der Notübernachtung in der Ohlauer Straße in Kreuzberg zusätzliche Feldbetten aufgestellt, sagte Aldag.
Bereits bei einer Gesamtauslastung der Kältehilfe-Einrichtungen von mehr als 90 Prozent seien einzelne Standorte überlastet, sagte der Kältehilfen-Koordinator. Hinzu komme, „je später die Nacht, umso schwieriger ist es für Einrichtungen, noch jemanden aufzunehmen“.
Laut Senatssozialverwaltung standen in der vergangenen Woche im Durchschnitt 1.178 Notübernachtungsplätze zur Verfügung. Davon waren im Schnitt 1.105 Plätze pro Nacht belegt, 73 blieben frei. Das war eine Auslastung von knapp 94 Prozent, teilte die Senatssozialverwaltung am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky mit. Das Motto laute nach wie vor: „Wer ein Bett braucht, bekommt auch eins!“ Die Übernachtungsplätze werden vor allem von Kirchengemeinden und freien Trägern zur Verfügung gestellt.
Mit Blick auf den stark nachgefragten Kältebus der Stadtmission, der Obdachlosen helfen und diese in Notübernachtungen fahren kann, appellierte Breuer an die Berlinerinnen und Berliner, Menschen auf der Straße, von denen sie annehmen, dass sie Hilfe benötigen, zunächst anzusprechen. Erst im zweiten Schritt sollte dann der Kältebus alarmiert werden. Es komme immer wieder vor, so Breuer, dass der Kältebus zu Menschen gerufen werde, die gar keine Hilfe wollten. Weiter kritisierte sie, dass es in den vergangenen Nächten auch Fälle gegeben habe, in denen Hilfsbedürftige, die vermeintlich obdachlos waren, von Rettungswagenbesatzungen und in Krankenhäusern abgewiesen wurden.
Aldag zeigte sich verwundert, dass angesichts von schätzungsweise mehr als 6.000 Obdachlosen in Berlin vergleichsweise wenige Menschen die Angebote der Kältehilfe wahrnehmen. Die „frohe Botschaft“ sei dabei, dass es in diesen kalten Tagen offiziell bislang keine Kältetoten zu beklagen gebe. Breuer rief dazu auf, verstärkt Schlafsäcke zu spenden. Diese würden gemeinsam mit warmen Getränken und Suppen vom Kältebus an Bedürftige verteilt.
Breites Bündnis dringt auf BAföG-Reform
Berlin (epd). Ein breites Bündnis dringt auf eine umfassende BAföG-Reform nach der Bundestagswahl. Die staatliche Studienfinanzierung sei ein zentrales Instrument, um Chancengleichheit beim Zugang zur Hochschule zu sichern. Doch noch immer sei diese nicht auskömmlich und zu wenige Studierende erhielten überhaupt BAföG, heißt es in einem am 17. Februar in Berlin veröffentlichten Eckpunktepapier.
Rund ein Drittel der Studierenden lebe in prekären Verhältnissen, heißt es in dem Aufruf. Unterzeichner sind die Initiative Arbeiterkind.de, der Bundesverband katholische Kirche an Hochschulen, das Deutsche Studierendenwerk, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die DGB-Jugend, der Verband der Evangelischen Studierendengemeinden in Deutschland, der Freie Zusammenschluss von Studentinnenschaften sowie die Gewerkschaften GEW und ver.di.
Die kommende Bundesregierung und der Bundestag müssten nach der Wahl vom Sonntag schnell eine umfassende BAföG-Reform angehen. Die staatliche Studienfinanzierung müsse dabei künftig die Kosten für Lebenshaltung und Ausbildung decken, lautet die Forderung.
Dazu müssten die Bedarfssätze auf ein existenzsicherndes Minimum angehoben werden. Ferner müssten Wohnkosten angemessen berücksichtigt werden. So sollte die Wohnkostenpauschale auf mindestens 440 Euro im Monat erhöht werden. Auch sollten Bedarfssätze und Freibeträge künftig automatisch an die Entwicklung von Preisen und Einkommen angepasst werden. Der Darlehensanteil müsse schrittweise reduziert werden, bis das BAföG wieder als Vollzuschuss ausgezahlt wird.
Thüringen will mehr ältere Menschen ans Internet heranführen
Erfurt (epd). Die Thüringer Landesregierung will Seniorinnen und Senioren beim Umgang mit digitalen Angeboten besser unterstützen. Internet und soziale Medien könnten die gesellschaftliche Teilhabe für alle Generationen zugänglich machen, sagte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) am 19. Februar in Erfurt. Entsprechende Unterstützungsangebote müssten flächendeckend und systematisch geschaffen werden.
Das Ministerium will die ältere Generation beispielsweise über speziell hierfür ausgebildete Mentoren mit den digitalen Angeboten vertraut machen. Ergänzend sollen ein flächendeckendes Seminarangebot oder thematische Seniorennachmittage der Zielgruppe die Angst vor dem Internet nehmen. Dabei müssten gleichermaßen die Chancen und Gefahren angesprochen werden, sagte Schenk. Spezielle Angebote sollen für Pflegeeinrichtungen und Häuser des betreuten Wohnens entwickelt werden.
Bereits seit Juli 2024 tourt den Angaben zufolge ein Infomobil mit transportablem Beratungsstand durch die Thüringer Städte und Dörfer und bringt digitale Bildungsangebote direkt zu den Menschen. Auf Marktplätzen, in Gemeindezentren und bei Veranstaltungen könnten Seniorinnen und Senioren auf diese Weise digitale Geräte ausprobieren, sich beraten lassen und Hemmschwellen abbauen. Für Schenk ist es wichtig, dass die Angebote zu den älteren Menschen hinkommen, die sich bislang oft alleingelassen fühlten.
Noch existieren diese Angebote nur in Form von Modellprojekten und damit nicht flächendeckend in Thüringen. Für 2026 sind Auswertungen der Projekte mit dem Ziel des Aufbaus einer Seniorenmedienstrategie geplant.
Europäisches Projekt erforscht Integration in Sozialunternehmen
Leipzig (epd). Europäische Forscherinnen und Forscher untersuchen in den nächsten vier Jahren in einer gemeinsamen Studie das integrative Potenzial von Sozialunternehmen. Im Fokus stehen Non-Profit-Organisationen wie Stiftungen, Genossenschaften oder Vereine, teilte das beteiligte Leibniz-Institut für Länderkunde am 17. Februar in Leipzig mit. Gefragt werde nach deren Beitrag im Kampf gegen soziale Ausgrenzung.
Besonderes Augenmerk liege auf der Rolle von Sozialunternehmen im Bereich der sozialen Arbeit in Regionen, die als „abgehängt“ gelten. Das Projekt mit Beteiligung des Leibniz-Institutes für Länderkunde in Leipzig will herausfinden, wie das Potenzial sozialer Unternehmen zugunsten von integrativen Dienstleistungen und Arbeitsplätzen gestärkt werden kann.
Geforscht wird nach Angaben des Leipziger Projektleiters Thilo Lang in acht europäischen Ländern, in denen das Armutsrisiko besonders hoch ist. Verglichen werden verschiedene Ansätze zur sozialen Inklusion, die öffentlich, privat oder sozial-kooperativ organisiert sind. Laut Lang ist es die erste große angelegte europäische Vergleichsstudie in diesem Bereich.
Das Projekt wird aus dem Programm Horizon Europe der Europäischen Union mit rund 3,4 Millionen Euro im Zeitraum von vier Jahren gefördert. Die beteiligten Teams kommen aus Belgien, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Irland, Norwegen und Österreich. Sie sind im Verbundvorhaben DICES (Driving Inclusive Care: Economic Democracy and Social Economy) vereint. Die Forschenden wollen auch politische Empfehlungen erarbeiten, hieß es.
Verbände: Ernährungsarmut hat Folgen für gesamte Gesellschaft
Berlin (epd). Mehrere Verbände mahnen eine höhere Aufmerksamkeit für das Problem der Ernährungsarmut in Deutschland an. Wenn Menschen sich keine gesunde Ernährung leisten könnten, habe dies „direkte Folgekosten und Konsequenzen für die Gesellschaft als Ganzes“, sagte Michael Stiefel von der Diakonie Deutschland in einer Online-Pressekonferenz am 19. Februar. Das Phänomen sei „nicht nur ein reines Armutsproblem“.
Stiefel verwies unter anderem auf schlecht ernährte Kinder, die sich in der Schule nicht konzentrieren könnten oder sogar Symptome von Mangelernährung hätten: „Das sind letzten Endes die Fachkräfte der Zukunft.“ Saskia Richartz vom Ernährungsrat Berlin unterstrich, ungesunde Ernährung ziehe Folgekosten etwa im Gesundheitssystem nach sich.
Richartz beklagte zugleich eine unzureichende Datenlage in Deutschland. Oft werde die Zahl von 13 Prozent der deutschen Bevölkerung genannt, die laut der EU-Statistikbehörde Eurostat nicht an mindestens jedem zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit finanzieren kann. Jedoch stamme diese Zahl aus dem Jahr 2023 und damit „vom Anfang der Lebensmittelinflation“, gab Richartz zu bedenken. Ernährungsarmut müsse von staatlicher Seite besser erfasst werden - andere Länder seien hier deutlich weiter.
Klar sei, dass die aktuell im Bürgergeld für Lebensmittel vorgesehenen Beträge nicht ausreichten, um sich gesund zu ernähren, sagte Sarah Brand vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Beim Menschenrecht auf Nahrung gehe es „nicht einfach nur um ein Mindestmaß an Kalorien“, sondern um den individuellen Bedarf für ein gesundes Leben.
Experten fordern Aufarbeitung von Missbrauch Behinderter in der DDR
Gewalt und Missbrauch gab es in Behinderteneinrichtungen der DDR und der Bundesrepublik. Eine Stiftung hat bis 2022 Betroffene unterstützt. Nun werden Forderungen nach einer besseren Aufarbeitung der Situation in der DDR laut.
Potsdam (epd). Der sexuelle Kindesmissbrauch in Behinderteneinrichtungen der DDR muss nach Überzeugung von Betroffenen und Experten besser aufgearbeitet werden. Betroffene hätten bis heute Schwierigkeiten, Anerkennung für erlittenes Leid und Unrecht zu bekommen, sagte die Sozialwissenschaftlerin und Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Julia Gebrande, am 18. Februar in Potsdam bei einem Fachgespräch zum Thema. Die Kommission war 2016 auf Beschluss des Bundestags eingesetzt worden.
Gebrande betonte, Grund für die Defizite sei auch eine „ideologisch motivierte Schweigepraxis“. Die Tabuisierung des Missbrauchs in der DDR wirke bis heute nach. Die Aufarbeitung könne Unrecht zwar nicht ungeschehen machen, aber zur Anerkennung von Unrecht führen. Anett Zimmermann, Betroffene von Missbrauch in der DDR, sagte, darüber zu sprechen helfe, die eigene Geschichte aufzuarbeiten und anderen Betroffenen Mut zu machen.
Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, betonte, Missbrauch und Gewalt habe es auch in Behinderteneinrichtungen in der BRD gegeben. Der entscheidende Unterschied bestehe jedoch darin, dass es in der BRD andere Kontroll- und Verfolgungsmöglichkeiten durch die unabhängige Justiz gegeben habe, sagte Dusel dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Dienstag: „Insofern gab es durchaus ein DDR-spezifisches Unrecht, da der Staat und die SED systematisch die Taten an Menschen mit Behinderungen vertuscht haben.“ Dort habe es so gut wie keine Kontrolle gegeben, was in den Einrichtungen stattfand, sagte Dusel bei dem Fachgespräch.
Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Maria Nooke sagte, die Erfahrungen der Betroffenen seien „in unserer Gesellschaft viel zu lange tabuisiert“ worden. Die Aufarbeitung stehe „leider noch ziemlich am Anfang“. Diese sei jedoch wichtig, um die Würde der Betroffenen zu wahren und zu ihrer Entstigmatisierung beizutragen. Sie sei auch Voraussetzung dafür, dass sich die Spirale sexualisierter Gewalt nicht fortsetze.
Der Medizinhistoriker Heiner Fangerau betonte, Betroffene hätten ein Recht auf Aufarbeitung. Die Dokumentation von Fällen sei in der DDR jedoch sehr lückenhaft. Das Thema sei von „täuschen, tarnen, vertuschen“ geprägt gewesen. Es sei wichtig, in Unterlagen auch zwischen den Zeilen zu lesen. Auch Stasi-Akten sollten in der Forschung herangezogen werden. Informationen zu Taten von Stasi-Leuten seien dort jedoch nicht zu erwarten. In jedem Fall sei wichtig, eine Kultur des Hinsehens zu schaffen, um weitere sexuelle Gewalt zu verhindern.
Dusel betonte, viele DDR-Akten zum Thema seien verschwunden oder schwer auffindbar. Die noch vorhandenen Akten müssten gesichert, Täterinnen und Täter identifiziert und Strukturen aufgedeckt werden, wo dies noch nicht geschehen sei. In der DDR seien Behinderteneinrichtungen oft isoliert und staatlich abgeschirmt gewesen. Dies habe Missbrauch begünstigt. Die gesellschaftliche Diskussion darüber sei bislang „unzureichend und schleppend“ verlaufen, sagte Dusel dem epd. Aufarbeitung und Forschung seien nötig, „um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und das Tabu zu brechen“.
Dusel: Missbrauch Behinderter in der DDR aufarbeiten

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin/Potsdam (epd). Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat eine bessere Aufarbeitung von Kindesmissbrauch in Behinderteneinrichtungen der DDR gefordert. Mit dem Ende der DDR vor 35 Jahren seien viele Akten dazu verschwunden oder schwer auffindbar, sagte Dusel dem Evangelischen Pressedienst (epd) anlässlich eines Fachgesprächs zum Thema am Dienstag in Potsdam. Es müsse deshalb mehr getan werden, damit „auch die Täterinnen und Täter identifiziert und Strukturen aufgedeckt werden“, wo dies bislang noch nicht geschehen sei.
epd: Vor einigen Jahren, 2021, wurde eine umfangreiche Studie über Missbrauch und Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie in der DDR und der Bundesrepublik veröffentlicht, für die unter anderem mehr als 1.500 Fallakten ausgewertet wurden. Was wurde seit der Studie von 2021 für Betroffene getan und erreicht?
Jürgen Dusel: Durch die „Stiftung Anerkennung und Hilfe“, die von Bund, Ländern und den Kirchen getragen wurde, erhielten Menschen, die in der DDR oder in der BRD in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben, endlich öffentliche Anerkennung und auch soziale Entschädigung. Diese Entschädigung - und das konnten bis zu 14.000 Euro sein - kann natürlich erfahrenes Leid nicht ungeschehen machen, aber sie hat auch einen symbolischen Wert. Sie zeigt deutlich an, dass eine Aufarbeitung stattfindet.
epd: Was hat die Stiftung, die von 2017 bis 2022 Betroffene unterstützt hat, noch erreicht?
Dusel: Die Stiftung existiert mittlerweile nicht mehr, sie war ja von vornherein als temporäres Projekt geplant. Sie hat die Initiative ihres überregionalen Fachbeirats, Gedenktafeln zu entwerfen und für deren Anbringen an Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu werben, umgesetzt. Und auch das ist eine wichtige Form der Anerkennung! Das erfahrene Leid darf nicht vergessen werden - auch, wenn viele Akten von damals nach der politischen Wende nicht mehr oder nur schwer aufzufinden waren. Diese einheitlichen Gedenktafeln sind übrigens barrierefrei, was ich besonders gut finde, sie enthalten eine Übersetzung in Leichter Sprache sowie in Brailleschrift.
epd: Wo sollte noch mehr getan werden?
Dusel: Beim Thema Gewaltschutz sind wir noch nicht am Ziel, aber mit dem Teilhabestärkungsgesetz wurde 2021 im Sozialgesetzbuch IX eine neue Regelung eingefügt, die die Einrichtungen zu Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt verpflichtet, insbesondere zu einrichtungsbezogenen Gewaltschutzkonzepten. Die Rechtsnorm sollte konkretisiert und um Mindeststandards ergänzt werden. Das hat leider in der nun endenden Legislaturperiode nicht mehr geklappt. Generell gilt, dass der Betrieb solcher Einrichtungen immer strukturelle Abhängigkeiten begünstigt und damit eine erhöhte Gefahr für Missbrauch mit sich bringt. Deshalb kommt der Deinstitutionalisierung auch beim Gewaltschutz eine wichtige Rolle zu. Auch mein Team und ich haben, zum Teil gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, Handlungsempfehlungen zum Gewaltschutz in Einrichtungen veröffentlicht.
epd: Wo sehen Sie weiteren Handlungsbedarf?
Dusel: Missbrauch und Gewalt hat es auch in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in der BRD gegeben. Der entscheidende Unterschied besteht aber darin, dass es in der BRD andere Kontroll- und Verfolgungsmöglichkeiten durch die unabhängige Justiz gegeben hat. Insofern gab es durchaus ein DDR-spezifisches Unrecht, da der Staat und die SED systematisch die Taten an Menschen mit Behinderungen vertuscht haben. Mit dem Ende der DDR sind auch viele Akten verschwunden oder schwer auffindbar. Deshalb ist hier die Forschung so wichtig, noch vorhandene Akten müssen gesichert werden und nicht nur die Opfer, sondern auch die Täterinnen und Täter identifiziert und Strukturen aufgedeckt werden, wo es bislang noch nicht geschehen ist. Um zu verhindern, dass dieses Unrecht sich wiederholt, muss die Erinnerungskultur gefördert werden. Auch brauchen wir verpflichtende Fortbildungen für Einrichtungspersonal zu Gewalt. Wir brauchen einen noch verbindlicheren und konkreteren Gewaltschutz, um Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen wirksam vor Gewalt zu schützen, zudem müssen heutige Einrichtungen stärker durch unabhängige Stellen kontrolliert werden.
epd: Welche besonderen Herausforderungen gibt es noch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR?
Dusel: In der DDR waren Behinderteneinrichtungen oft isoliert und staatlich abgeschirmt, was Missbrauch begünstigte. Eine gesellschaftliche Diskussion über die Zustände in den Einrichtungen der Behindertenhilfe fand bislang aus meiner Sicht unzureichend und schleppend statt. Auch hier gilt, die Vorgänge aufzuarbeiten, Forschung zu ermöglichen, um den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und das Tabu zu brechen. Wir müssen uns unserer Vergangenheit, auch der der DDR, stellen. Die Auseinandersetzung mit dem Geschehenen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber die Aufarbeitung ist Aufgabe und Pflicht der demokratischen Institutionen.
Probewahl zum Bundestag in Raum 4077

epd-bild/Karen Miether
Celle (epd). Der Wahlraum 4077 ist rund eine Woche vor der Bundestagswahl nur zu Übungszwecken eingerichtet. Doch die Bildungsbegleiterin Karin Mickoleit und die Arbeitsgruppenleiterin Kristin Herrmann nehmen ihr Amt als Wahlleiterinnen ernst. Bevor sie Maximilian Schnoor den Stimmzettel überreichen, muss der noch einmal zur Garderobe laufen, um seinen Ausweis aus der Jacke zu holen. „Ganz vergessen“, sagt der 32-Jährige. Doch er ist schnell wieder da, um geschützt von Blicken in der Wahlkabine seine zwei Kreuze zu machen.
Die Wahl, geheim und fast wie in echt, bildet an diesem Tag den Abschluss des Unterrichtes in den Räumen der Lobetalarbeit in Celle. Die diakonische Einrichtung für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung will dabei ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Berufsbildungsbereich und der Holzwerkstatt ermutigen, bei der Bundestagswahl ihr Stimmrecht wahrzunehmen. „Wer von ihnen hat schon mal gewählt?“, fragt die Berufsschullehrerin Regina Dickel und rund die Hälfte der rund zwanzig Frauen und Männer strecken die Arme hoch.
Verfassungsgericht gegen Wahlrechtsausschluss
Lange Zeit durften in Deutschland Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben, nicht an den Bundestagswahlen teilnehmen. Jahrelang kämpften die Bundesvereinigung Lebenshilfe und andere Verbände gegen diesen Ausschluss von damals rund 85.000 Menschen von der politischen Willensbildung. „Jeder, der wählen will, kann sich eine Meinung bilden und muss die Unterstützung erhalten, die sie oder er zum Wählen braucht“, sagt Lebenshilfe-Sprecher Peer Brocke. Anfang 2019 entschied schließlich das Bundesverfassungsgericht, dass der Wahlrechtsausschluss eine Form der Diskriminierung und verfassungswidrig war.
Wie wichtig das Wahlrecht ist, unterstreicht auch der Bildungsbegleiter Michael Morcinek in der Unterrichtsstunde in Celle, die er gemeinsam mit Dickel vorbereitet hat. Warum überhaupt neu gewählt werden muss und wer aktuell im Bundestag vertreten ist, wissen viele hier längst. Sie sind zwischen 18 und Anfang 60 Jahre alt und alle wahlberechtigt. Doch eine Frau zeigt sich unentschlossen, zur Wahl gehen will sie eher nicht. „Das ist eine freie Entscheidung“, sagt Morcinek. „Aber man sollte sich damit beschäftigen. Wenn ich ihn nicht probiere, weiß ich ja auch nicht, ob Milchreis mir schmeckt“, versucht er einen Vergleich zu ziehen.
„Würde nie rechtsextreme Partei wählen“
Dass es um Fragen geht, die hier alle betreffen, machen Morcinek und Dickel anhand der Parteiprogramme deutlich, die sie, soweit veröffentlicht, auch in leichter Sprache mitgebracht haben. Einige Parteien wollen sich für Inklusion einsetzen. Eine dafür, dass Menschen mit Behinderung in Zukunft mehr Einkommen oder Vermögen besitzen dürfen, ohne dass ihnen dadurch Sozialleistungen gekürzt werden.
Thorsten Harms verrät nicht, wem er im Raum 4077 seine Stimme gegeben hat. Für die echte Bundestagswahl steht sein Entschluss aber fest, wie er betont: „Ich habe mich für eine Partei entschieden, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt“, sagt der Werkstattmitarbeiter. „Niemals würde ich eine rechtsextreme Partei wählen“, fügt der kräftige Mann mit dem Kurzhaarschnitt an. „Man muss sich nur die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen angucken. Dann weiß man, wohin das führen kann.“
Seine Kollegin Petra Gilbert hat auf dem Wahlzettel einen bekannten Namen entdeckt. „Ach der Henni Otti“, erfindet sie kurzerhand einen Spitznamen für den Celler CDU-Abgeordneten Henning Otte. „Den kenne ich doch“, sagt die 58-Jährige. Als sie im Café der Behinderteneinrichtung gearbeitet habe, sei er dort zu Gast gewesen. Sie fand ihn sympathisch und erwägt, ihm ihre Stimme zu geben. Der direkte Draht, findet sie, kann nicht schaden.
Parteiprogramme in leichter Sprache
Zu informieren, ohne zu beeinflussen, das haben sich Regina Dickel und Michael Morcinek für diesen Tag vorgenommen. Informationen zur Wahl und den Parteiprogrammen in leichter Sprache haben unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung und die Lebenshilfe herausgegeben. Ortsvereine der Lebenshilfe organisierten vielfach auch Diskussionsrunden mit Kandidierenden, wie Sprecher Peer Brocke erläutert.
Gemeinsam mit dem Verein „Tadel verpflichtet“ hat die Lebenshilfe zudem die Broschüre „Demokratie schützen - Gefährliche politische Ideen erkennen“ veröffentlicht, in der sie erläutern, wie rechtspopulistisches Gedankengut zu erkennen ist. Im Unterricht in Celle gibt einer zu erkennen, dass er auch über die AfD mehr erfahren will. „Die grenzen Behinderte aus!“, gibt sein Nachbar zu bedenken. Auch Brocke sagt, die Werte der Lebenshilfe seien mit einer Wahl der AfD nicht vereinbar. Unter anderem spreche sich die Partei gegen Inklusion an Schulen aus. „Sie widerspricht dem Kern unserer Anliegen.“
Wie Wählen leichter geht
Millionen Wahlberechtigte mit Lese- und Schreibproblemen stehen bei Wahlen vor Problemen, trotz Angeboten in Leichter Sprache. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung sieht Handlungsbedarf.
Hamburg (epd). Barbara Reindl ist viel beschäftigt. Die Übersetzerin für Leichte und Einfache Sprache blättert sich durch eng bedruckte Wahlbenachrichtigungen und Merkblätter. „Ich muss Kompliziertes einfach machen“, sagt die 62-jährige Hamburgerin. Seit Wochen gibt sie in Norddeutschland Workshops zur Bundestagswahl am 23. Februar und zur Hamburger Bürgerschaftswahl am 2. März. Sie hilft damit Menschen mit Lernschwierigkeiten, seelischen Beeinträchtigungen und fehlenden Sprachkenntnissen, aber auch Assistenzen, die mit Leichter Sprache arbeiten. Reindl: „Ich erkläre zum Beispiel in einfachen Worten, was genau gewählt wird, wie eine Wahl abläuft und was in Wahlbenachrichtigungen steht.“
Ihre Kurse sind ausgebucht. „Viele denken, dass die Wahl etwas ganz Selbstverständliches ist. Das stimmt aber nicht“, sagt die Sprachexpertin. Menschen, die schlecht lesen und schreiben können oder vielleicht nicht in Deutschland geboren wurden, fühlen sich bei Wahlen unsicher. „Das fängt schon bei den farbigen Umschlägen an und der Frage, welcher Zettel wo hineingehört“, sagt die Sprachwissenschaftlerin. Auch Bezeichnungen wie „Versicherung an Eides statt“ seien für sie eher abschreckend. In ihren Workshops baut Reindl eine Wahlkabine auf und spielt die Wahlabläufe ganz praktisch durch. Reindl: „Das gibt Teilnehmenden viel Sicherheit.“
„Entwicklung eher negativ“
Wie groß das Problem ist, zeigt die sogenannte Leo-Studie der Universität Hamburg aus dem Jahr 2018: Demnach können 6,2 Millionen Menschen in Deutschland nicht richtig lesen und schreiben. „Unsere Untersuchung hat gezeigt, dass das Leben mit geringer Literalität mit Ausgrenzungen und großen Unsicherheiten im Alltag verbunden ist“, erklärt Anke Grotlüschen, Leo-Studienleiterin und Professorin für Lebenslanges Lernen. Zwei Drittel hätten große Schwierigkeiten, politische Fragen zu verstehen und einzuschätzen. Grotlüschen: „Auch die aktuellen Befunde jüngerer OECD-Studien zeigen, dass die Entwicklung im Bereich Schriftsprachkompetenz eher negativ verläuft.“
Mittlerweile stellt sich die Politik darauf ein. Auf den Internetseiten von SPD, CDU/CSU, FDP, Grünen und Linken finden sich die Wahlprogramme auch in Leichter Sprache, bei der AfD fehlt dieser Service. „Es gibt immer mehr gute Informationsangebote zur Wahl in Leichter Sprache“, sagt Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung. Bereits seit Jahren bietet die Bundeszentrale für politische Bildung in ihrer inklusiven Reihe „einfach Politik“ Webseiten, Hefte, Hörbücher und ein Lexikon an. Zur aktuellen Bundestagswahl wurden 45.000 Hefte in einfacher Sprache verschickt.
Angebote vielen nicht bekannt
Insgesamt sei das Bewusstsein für die Notwendigkeit solcher barrierefreier Angebote gewachsen, urteilt der Behindertenbeauftragte. Jetzt gelte es, diesen Trend zu verstetigen. Noch seien zum Beispiel Parteien nicht zur Barrierefreiheit ihrer Wahlprogramme verpflichtet. „Hier sollte der Gesetzgeber nachbessern“, sagt Dusel.
Woran es zudem hapert, sei die praktische Umsetzung, beobachtet Übersetzerin Reindl: „Viele Menschen wissen nichts von den Angeboten in Leichter Sprache.“ Problematisch findet sie auch die regionalen Unterschiede bei den Wahlunterlagen. Während in Hamburg Anschreiben und Wahlbenachrichtigung in eher Einfacher Sprache und übersichtlich gestaltet sind, strotzen die Schreiben im niedersächsischen Uelzen nur so von eng geschriebenen Sätzen mit komplizierten Formulierungen. „Hier gibt es wohl noch wenig Bewusstsein für barrierefreie Sprache,“ sagt Reindl, die in Uelzen gleich 30 Teilnehmende im Workshop hatte.
Leichte Sprache nutzt dagegen kurze Sätze und bekannte Wörter. Zusammengesetzte Wörter werden mit Bindestrich getrennt, schwierige Begriffe immer erklärt und Inhalte auf das Wesentliche verknappt. Dabei geht es Reindl in ihren Wahl-Workshops nicht nur um Informationen, sondern auch um politische Teilhabe. Sie möchte den Menschen vermitteln, dass Politik etwas mit ihrem Leben zu tun hat und sie ihr Wahlrecht nutzen sollten. Reindl: „Jede Stimme ist wichtig.“
Mehr geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit
Wiesbaden (epd). Im vierten Quartal des vergangenen Jahres sind rund 43 Prozent der schutzsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland erwerbstätig gewesen. „Im Frühjahr 2024 lag der Vergleichswert noch bei 30 Prozent und im Sommer 2022 bei 16 Prozent“, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) auf Grundlage eigener Berechnungen am 24. Februar in Wiesbaden mit. Die Übergangsraten in die Erwerbstätigkeit hätten sich demnach im dritten Jahr des Aufenthalts geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland gegenüber den ersten beiden Jahren spürbar erhöht. Vor drei Jahren, am 24. Februar 2022, begann Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Die Daten des BiB basieren den Angaben zufolge auf einer neuen Befragung im Rahmen einer Studie, die seit Kriegsbeginn zweimal jährlich die immer gleichen ukrainischen Geflüchteten zu ihrer Lebenssituation in Deutschland befragt. An der mittlerweile fünften Erhebung haben zwischen Ende Oktober und Dezember 2024 insgesamt 2.700 Personen teilgenommen. Die Daten sind hochgerechnet, gewichtet und repräsentativ.
Hohe Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme
Aus den aktuellen Ergebnissen geht hervor, dass zunehmend mehr Schutzsuchende in den Arbeitsmarkt gelangen, die bislang aufgrund der Teilnahme an Sprachkursen nicht erwerbstätig sein konnten. Unter den bisher noch nicht erwerbstätigen Ukrainerinnen und Ukrainern zeigt sich außerdem eine weiterhin hohe Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme: „Rund 24 Prozent von ihnen geben an, sofort eine Beschäftigung aufnehmen zu wollen, weitere 45 Prozent streben dies innerhalb der nächsten zwölf Monate an“, wie Studienleiter Andreas Ette sagte.
Eine Herausforderung bleibe aber das häufig erforderliche Sprachniveau. „Zwar haben etwa drei Viertel der Schutzsuchenden aus der Ukraine mindestens einen Sprachkurs abgeschlossen, aber erst 27 Prozent haben das für viele Berufe erforderliche Sprachniveau B2 bescheinigt bekommen“, teilte das BiB mit.
Mehr Väter als Mütter berufstätig
Darüber hinaus würden mit 57 Prozent mehr als die Hälfte der ukrainischen Frauen mit Kindern die elterliche Sorge ihrer Minderjährigen in Deutschland alleine wahrnehmen. Zwischen Vätern und Müttern gebe es einen deutlichen Unterschied in der Erwerbstätigkeit: Fast zwei Drittel der Väter (63 Prozent), die mit Kindern unter sechs Jahren im Haushalt leben, seien erwerbstätig. Bei Müttern sei es mit 23 Prozent nicht einmal jede Vierte. „Sobald der Sorgeaufwand für die Kinder sinkt, reduziert sich der Abstand zwischen den Geschlechtern: Väter mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren sind zu 57 Prozent erwerbstätig, bei Frauen sind es 46 Prozent.“
Studie belegt Nutzen von Drogenkonsumräumen

epd-bild/Peter Jülich
Berlin (epd). Drogenkonsumräume können laut einer Studie Leben retten und Infektionen verhindern. Das geht aus der ersten bundesweiten Erhebung zur Nutzung dieser Einrichtungen hervor, wie die Deutsche Aidshilfe am 18. Februar in Berlin mitteilte. Im Jahr 2023 wurden in den Konsumräumen 650 Drogennotfälle bewältigt. „Anders als auf der Straße endete aufgrund der professionellen Hilfe in solchen Einrichtungen keiner tödlich“, hieß es.
Insgesamt fanden in den geschützten Räumen demnach mehr als 650.000 Konsumvorgänge statt, darunter 230.000 Injektionen. „Da in diesen Einrichtungen für jeden einzelnen Konsum sterile Spritzen und Utensilien ausgegeben werden, wird die Übertragung von HIV oder Hepatitis komplett verhindert“, so die Aidshilfe.
Längere Öffnungszeiten
Doch die Erhebung zeige auch, „dass wir dringend mehr dieser Einrichtungen brauchen - in allen Bundesländern und mit längeren Öffnungszeiten“, sagte Sven Warminsky vom Vorstand der Deutschen Aidshilfe. Die Untersuchung wurde von der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, der Bundesarbeitsgemeinschaft Drogenkonsumräume und der Deutschen Aidshilfe vorgelegt. An der Umfrage beteiligten sich 29 der 32 Drogenkonsumräume in Deutschland. Insgesamt nutzten im Jahr 2023 rund 18.500 Menschen deren Angebote, hieß es.
Außerhalb der Einrichtungen sehe die Realität anders aus: 2.277 drogenbedingte Todesfälle registrierte das Bundeskriminalamt 2023. Das waren mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor und so viele wie nie zuvor. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen unter Drogenkonsumentinnen und -konsumenten steige seit 2010.
Zugang zu Hilfsangeboten
Derzeit gibt es den Angaben zufolge Drogenkonsumräume nur in 8 der 16 Bundesländer. Neben dem sicheren Konsum böten sie zudem einen wichtigen Zugang zu Hilfsangeboten. 52.000 Beratungen fanden hier 2023 statt, oft mit Weitervermittlung in die Substitutionsbehandlung, Entgiftung oder andere Therapien. „Drogenkonsumräume sind eine Brücke in das Hilfesystem und tragen dazu bei, die gefährlichen Folgen von Abhängigkeitserkrankungen zu minimieren, bis hin zum Ausstieg aus der Sucht“, erklärte Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Strafvollzug der Deutschen Aidshilfe.
"Das Herz aufmachen und da sein"
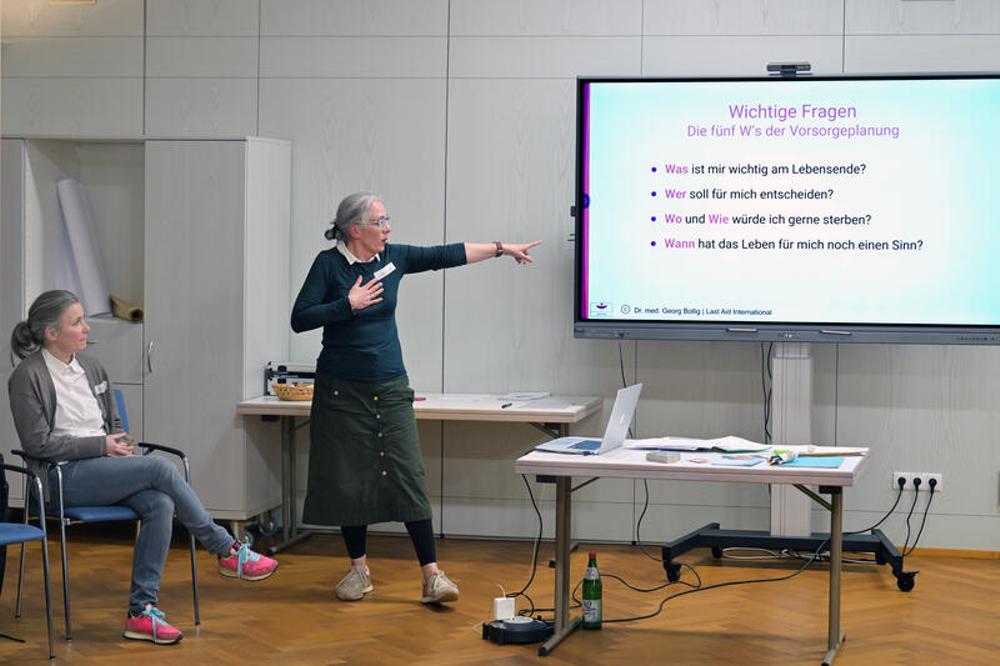
epd-bild/Klaus Landry
Speyer (epd). Manfred ist unsicher, ob er alles richtig gemacht hat. Als seine Schwiegermutter im Sterben lag, befeuchtete er ihre Lippen mit einem in Wasser getränkten Waschlappen. „Sie suckelte ganz stark daran“, erzählt der Rentner. Die Frau starb kurz darauf - bis heute macht er sich bittere Vorwürfe, dass sie vielleicht starken Durst verspürt habe und er dies nicht erkannte. Gemeinsam mit seiner Nichte besucht Manfred deshalb an einem Nachmittag einen „Letzte-Hilfe-Kurs“, den die Diakonissen Speyer anbieten.
Jeder Autolenker hat einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, um im Notfall helfen zu können. Doch wie man mit Sterbenden umgeht, da herrsche bei vielen Menschen Unsicherheit, berichten Dörte Kaufmann und Caroline Byrt. Die beiden Kursleiterinnen geben einfühlsam praktische Tipps, wie man Menschen auf ihrem letzten Weg beistehen kann. Die vierstündige Fortbildung mit jeweils 45-minütigen Modulen im Speyerer Diakonissenmutterhaus ist ausgebucht: 23 Frauen und Männer sitzen im Halbkreis zusammen. Peter will seiner krebskranken Mutter beistehen. Elisabeth fragt sich, was sie „richtig und was falsch“ im Umgang mit sterbenden Angehörigen gemacht habe.
„Können nicht viel falsch machen“
„In der Begleitung von Sterbenden können Sie nicht viel falsch machen“, spricht Dörte Kaufmann den Teilnehmenden Mut zu. Sie ist Pflege- und Hospizfachkraft im Hospiz am Wilhelminenstift der Diakonissen in Speyer - dem ältesten Hospiz in Rheinland-Pfalz. Ziel des Kurses sei es, den Teilnehmenden Hilfen für eine ganzheitliche Begleitung von Sterbenden an die Hand zu geben: Dabei gehe es „um eine Linderung von Leiden und um Erhaltung von Lebensqualität“, ergänzt die Lehrerin Caroline Byrt, die auch ehrenamtliche Hospizbegleiterin ist. „Letzte-Hilfe-Kurse“ gibt es seit zehn Jahren in Deutschland sowie in 23 Ländern weltweit. Ideengeber ist der Schleswiger Palliativmediziner Georg Bollig.
Vor allem gehe es darum, „das Herz aufzumachen und da zu sein“, sagt Kursleiterin Byrt. Menschen sollten nicht einsam und ohne Beistand sterben müssen. Oft reiche es, Sterbenden am Bett die Hand zu drücken, ihnen etwas zu Trinken zu reichen, mit ihnen zu sprechen oder zu beten. Wichtig sei es, dabei auf deren Wünsche einzugehen und Zeichen zu deuten: Wenn eine Person sich stumm abwende oder Speisen und Getränke ablehne, müsse man dies akzeptieren. „Hören Sie zu, geben Sie keine Ratschläge“, sagt Pflegerin Kaufmann.
Im Zweifel „vom Bauchgefühl leiten lassen“
Rechtzeitig, so raten die Kursleiterinnen, solle für eine Sterbebegleitung vorgesorgt werden: Wollen die Betroffenen zu Hause oder in einem Hospiz sterben, welche Formen des Beistands stellen sie sich vor in ihren letzten Stunden? Darüber sollte man mit sterbenden Angehörigen oder Freunden sprechen - und auch über den Fall des eigenen Todes. Hilfreich seien etwa eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht.
Im Zweifelsfall solle man sich bei der Begleitung Sterbender „vom Bauchgefühl leiten lassen“, sagt Kursleiterin Kaufmann. Und für Entspannung bei den Betroffenen sorgen, damit sie das schwindende Leben loslassen könnten. Eine stille Umgebung, gewohnte Rituale wie eine angezündete Kerze, ein gesungenes Lied oder auch ein Gebet könnten Sterbende stützen.
Auf einem Tisch haben Bryt und Kaufmann Wattestäbchen und Gläser mit Ölen und Butter mit Fruchtgeschmack ausgebreitet. Die Teilnehmenden des Kurses testen selbst, wie wohltuend es ist, die Lippen damit zu befeuchten. Sterbende leiden häufig unter Durst und Mundtrockenheit, erläutern die Kursleiterinnen. Mundpflege sei angenehm und könne das Leiden lindern. Wenn Sterbende eine Person nicht mehr erkennen, dürfe man das nicht persönlich nehmen.
„Heiliger Moment“
Wichtig sei es, bei der Begleitung von Sterbenden eigene Ruhephasen zu suchen und sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. „Halten Sie aus und gehen Sie weg, wenn es Sie überfordert“, sagt Kaufmann. „Aber kommen Sie zurück.“ Der Sterbeprozess sei ein intimer, ja ein „heiliger Moment“, betonen die Kursleiterinnen. Wichtig sei es, einen geliebten Menschen auch loszulassen und sich Zeit zum Trauern zu nehmen. Das Sterben könne für Betroffene erlösend und für die Hinterbliebenen tröstlich sein. Als ihr Opa friedlich gestorben sei, habe sie das schöne Gefühl gehabt, „abgeben zu können“, erzählt Kursteilnehmerin Bianca.
„Was bleibt von mir, wo geht meine Seele hin?“, fragt ein anderer Kursteilnehmer. Auf existenzielle Fragen, die am Sterbebett aufkommen können, sollte man aufrichtig antworten, antwortet Pädagogin Byrt. Und auch sagen: „Ich weiß es nicht.“ Angehörige sollten eine Sterbebegleitung nicht ganz allein stemmen, sondern sich Hilfe von Nachbarn, Freunden, Ärzten, Pflegestützpunkten oder Hospizdiensten holen, ergänzt Pflegerin Kaufmann. „Beziehen Sie das ganze 'Dorf' mit ein.“
Gesellschaft
Angriff im Holocaust-Mahnmal: Verdächtiger in Untersuchungshaft

epd-bild/Ralf Maro
Berlin (epd). Eine mutmaßlich antisemitisch motivierte Messerattacke im Holocaust-Mahnmal hat am Wochenende für Erschütterung in Berlin gesorgt. Ein 30-jähriger Tourist aus Spanien war im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 19-jähriger Syrer, der als anerkannter Flüchtling in Deutschland lebt. Er wurde noch am 21. Februar in der Nähe des Tatorts festgenommen. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, ist er seit 22. Februar in Untersuchungshaft.
Laut Polizei und Generalstaatsanwaltschaft hat der Verdächtige ausgesagt, dass seit einigen Wochen in ihm der Plan gereift sei, „Juden zu töten“. Vor diesem Hintergrund sei auch der Tatort gewählt worden. Bei der Festnahme fand die Polizei nach eigenen Angaben bei dem 19-Jährigen einen Gebetsteppich, einen Koran, einen Zettel mit Koran-Versen und dem Datum vom 21. Februar sowie die mutmaßliche Tatwaffe. Dies deute auf eine „religiöse Motivation“ hin, hieß es. Ob eine psychische Erkrankung vorliege, sei Gegenstand der Ermittlungen.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) dankte auf der Plattform X Polizei und Rettungskräften, die neben dem schwer Verletzten auch schockierte Augenzeugen versorgt hatten. „Gleichzeitig steht für mich fest: Wer in Deutschland Schutz haben will, greift keine Menschen mit dem Messer an“, schrieb Wegner.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete die Tat als „abscheuliches und brutales Verbrechen“. Der Täter müsse mit aller Härte des Gesetzes bestraft und direkt aus der Haft abgeschoben werden. „Wir werden alle Wege nutzen, um Gewalttäter wieder nach Syrien abzuschieben“, sagte sie. Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne), sagte, jeglicher Antisemitismus „gehört mit allen Mitteln bekämpft“. Es dürfe dabei keine blinden Flecken geben.
Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sagte, die Tat offenbare eine ideologische Gedankenwelt des Täters, die häufig nicht verstanden werde: „Die Verachtung der Erinnerung an die Schoah und der Hass auf Juden gehen Hand in Hand mit der fundamentalen Ablehnung unserer westlichen Werte und sind oft der ideologische Kern islamistisch motivierter Täter“, sagte Schuster.
Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte dem Berliner „Tagesspiegel“: „Die Tat macht nicht nur erneut die tödliche Gefahr von Judenhass deutlich, sondern zeigt auch, dass jeder Mensch Opfer einer antisemitischen Gewalttat werden kann.“ Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein verurteilte den antisemitisch motivierten Messerangriff: „Ich bin geschockt über diese schreckliche Untat an diesem Ort der Erinnerung mitten in unserer Stadt“, erklärte Stäblein am 22. Februar. Seine Gedanken und Gebete seien bei dem Verletzten, den Angehörigen und Freunden. „Antisemitische Angriffe bedrohen unsere Gesellschaft, bedrohen uns alle“, sagte der Bischof der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Stäblein forderte, es müsse schnell geklärt werden, „wie sich der Täter islamistisch radikalisieren konnte“. „Jeder religiöse Extremismus pervertiert die Religion“, unterstrich er.
Der Beschuldigte war laut Polizei und Generalstaatsanwaltschaft 2023 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er hat seinen Wohnsitz in Leipzig. Das Opfer musste nach dem Angriff notoperiert und zeitweise in ein künstliches Koma versetzt werden. Den Angaben zufolge befindet sich der Mann mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.
Hanau: Bundespräsident ruft zum Eintreten gegen Rassismus auf

epd-bild/Tim Wegner
Hanau (epd). Der Bundespräsident, das Land Hessen und die Stadt Hanau haben am 19. Februar gemeinsam mit Angehörigen der neun Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020 in Hanau gedacht. Neben Politikern nahmen Vertreter des Islamischen Vereins Hanau, der Kurdischen Gemeinde Deutschland, der evangelischen und katholischen Kirche sowie der jüdischen Gemeinde an der Gedenkfeier teil. Rednerinnen und Redner riefen zum Kampf gegen menschenfeindliche Ideologien auf und mahnten Politik und Behörden an ihre Verantwortung.
„Es ist an uns, für ein gutes Miteinander zu sorgen, jeden Tag und immer wieder aufs Neue“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die rechtsextremistisch motivierten Morde von Hanau seien ein Anschlag auf das friedliche Zusammenleben im Land gewesen. „Sie waren ein Anschlag auf unsere offene Gesellschaft und unsere liberale Demokratie - genau wie die vermutlich islamistisch motivierten Anschläge der vergangenen Monate, zuletzt erst vor wenigen Tagen in München“, sagte Steinmeier. Er bedauere zutiefst, dass einige Angehörige der Ermordeten nach der Tat den Eindruck hatten, den Staat erst zur Aufklärung drängen zu müssen.
Steinmeier mahnte: „Unser demokratischer Rechtsstaat muss wachsam und achtsam sein, und er muss alles tun, um alle Menschen zu schützen, die hier leben - ganz egal, woher sie kommen, woran sie glauben oder wen sie lieben.“ Viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte erlebten Angst, wenn sie nach den jüngsten Anschlägen gerade in diesen Tagen vermehrt Misstrauen und Ausgrenzung erführen.
„Deutschland und Hanau schulden mir ein Kind“
Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. „Es macht mich sehr betroffen, dass der Staat die Tat nicht verhindern konnte“, sagte er. „Sie ist Mahnung, jede Form von Gewalt und Hass zu bekämpfen.“ Hass sei eine reale Gefahr, er sei heute auch zu einem „politischen Geschäftsmodell“ geworden, warnte Rhein. Hass gedeihe schleichend, durch Schweigen und durch Gleichgültigkeit. "
„Der 19. Februar 2020 hat eine tiefe Wunde in das Gesicht unserer Stadt geschlagen“, sagte Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). „Die Trauer bleibt, aber sie muss zur Quelle einer Kraft werden, um noch engagierter für Toleranz, Respekt und ein Miteinander einzutreten.“ Die Stadt errichte ein „Amt für Sozialen Zusammenhalt“ und ein „Haus für Demokratie und Vielfalt“. Kaminsky hob hervor: „In einer Welt, die oft von Spaltung und Konflikt geprägt ist, sind Liebe und Mitgefühl die einzigen richtigen Antworten. Hass und Gewalt bringen nur mehr Leid.“ Den Einwohnern aus 140 Nationen in Hanau sage er: „Sie sind Bürger unserer Stadt!“
Die Angehörigen am Rednerpult setzten unterschiedliche Akzente. „Dieses Ereignis ist ein Schandfleck in der Geschichte Hanaus und auch Deutschlands. Deutschland und Hanau schulden mir ein Kind“, rief Emis Gürbüz. Sie machte die Stadt für die Ausführung des Anschlags verantwortlich. Cetin Gültekin, der seinen Bruder verlor, lenkte den Blick auf die Gegenwart: Menschen würden im Wahlkampf wegen ihrer Herkunft oder ihres Aufenthaltsstatus unter Generalverdacht gestellt und zum Sündenbock gemacht, kritisierte er.
„Liebe ist stärker als Hass“
Serpil Temiz Unvar berichtete, dass die aufgrund der Ermordung ihres Sohnes gegründete Bildungsinitiative Ferhat Unvar Jugendliche anleite, 80 bis 90 Workshops im Jahr an Schulen und anderen Einrichtungen zu halten. Sie sensibilisierten für Menschlichkeit und Mitgefühl und gegen menschenfeindliche Ideologien. „Liebe ist stärker als Hass“, sagte Unvar. Said Etris Hashemi, der seinen Bruder verlor und selbst verletzt wurde, erinnerte daran, dass Hanau kein Einzelfall sei. „Rassismus fällt nicht vom Himmel“, sagte er.
Am Vormittag hatte eine Trauerfeier auf dem Hanauer Hauptfriedhof stattgefunden. Kirchen verschiedener Konfessionen und die Jüdische Gemeinde gedachten in Gedenkfeiern der Opfer des Anschlags und baten um Frieden, Versöhnung und Akzeptanz. Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Hanauer acht junge Männer und eine junge Frau aus rassistischen Gründen erschossen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.
Streit in Hanau um Gedenken an Anschlag
Hanau (epd). Nach der Gedenkfeier am fünften Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau hat sich in der hessischen Stadt ein Streit um die Form des künftigen Erinnerns entzündet. Die Hanauer Stadtkoalition von SPD, CDU und FDP kündigte aufgrund der Rede einer Mutter eines Opfers an, dass es derartige Gedenkveranstaltungen in Hanau nicht mehr geben werde. Bei der Feier im Kongresszentrum am 19. Februar hatten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) und vier Angehörige von Opfern vor zahlreichen Gästen gesprochen.
Am 19. Februar 2020 hatte ein 43-jähriger Hanauer acht junge Männer und eine junge Frau aus rassistischen Gründen erschossen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Emis Gürbüz hatte ihre Rede auf der Gedenkfeier mit den Worten begonnen: „Dieses Ereignis ist ein Schandfleck in der Geschichte Hanaus und auch Deutschlands. Deutschland und Hanau schulden mir ein Leben.“ Seit 40 Jahren geschähen rassistische Morde in Deutschland, ohne dass etwas wirksam dagegen unternommen worden sei. Die Stadt Hanau sei am Tod der neun Ermordeten schuldig. „Es hätte keine Fehler geben dürfen, ich akzeptiere keine Entschuldigung“, sagte Gürbüz.
„Gedenkveranstaltung missbraucht“
„Bei allem Verständnis für die Trauer über den Verlust ihres Sohnes, was Frau Gürbüz von der Stadt Hanau, dem Land Hessen und der Bundesrepublik Deutschland an Respekt und Achtung einfordert, muss sie auch gegenüber Bund, Land, Stadt sowie den anderen Opferfamilien aufbringen“, sagte der Vorsitzende der Hanauer FDP-Fraktion, Henrik Statz, laut einer Mitteilung vom 21. Februar. Die Rede sei eine Ohrfeige für alle Familien, die trotz ihrer Trauer wieder zurück ins Leben finden wollten, den Blick in die Zukunft richteten und sich engagierten, damit Hass und Hetze in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. „Frau Gürbüz hat mit ihren Aussagen am 19. Februar leider genau das Gegenteil betrieben. Sie hat die Gedenkveranstaltung missbraucht, um rückwärtsgewandt zu spalten und die schreckliche Tat zu instrumentalisieren“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Pascal Reddig.
Die antirassistische Initiative 19. Februar Hanau, die Angehörige der Opfer unterstützt, reagierte am Samstag auf die Mitteilung der Stadtkoalition: „Wir sind entsetzt und enttäuscht, dass die Worte einer Betroffenen zum Anlass genommen werden, über die Erinnerung an den rassistisch motivierten Anschlag von Hanau zu entscheiden“, hieß es auf Instagram. Jede Familie gehe unterschiedlich mit Verlust, Trauer und Schmerz um. „Mitten in diesem Schmerz, zwei Tage nach dem Jahrestag, ist es unangemessen und verletzend, auf diese Weise behandelt zu werden.“
Steinmeier: "Die Ukraine ist nicht allein"
Berlin (epd). Anlässlich des dritten Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Opfer des Krieges gedacht. „Wir trauern mit den Familien. Und wir senden eine klare Botschaft: Die Ukraine ist nicht allein“, teilte Steinmeier in einer Videobotschaft am 24. Februar in Berlin mit. Am 24. Februar 2022 begann der vollumfängliche russische Überfall auf die Ukraine. Millionen Menschen mussten fliehen.
Die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpften nicht nur um ihr Territorium, sagte Steinmeier weiter. „Sie kämpfen für Demokratie, für Selbstbestimmung, für ein freies Europa - all die Werte, die auch für uns fundamental sind. Der Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer verdient unsere tiefste Anerkennung.“
„Ukraine entschieden unterstützen“
Steinmeier bekräftigte zudem die deutsche militärische Unterstützung für die Ukraine: „Frieden und Freiheit in Europa verlangen von uns, dass wir die Ukraine entschieden unterstützen.“ Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine - „mit humanitärer Hilfe, mit Schutz für Geflüchtete, mit militärischer Unterstützung.“
Den Angaben zufolge soll Steinmeier am Montag per Videoschalte an einem Gipfeltreffen in Kiew teilnehmen, zu dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zahlreiche Staats- und Regierungschefs wichtiger Unterstützerstaaten und Vertreter der Europäischen Union eingeladen hat.
Drei Jahre Ukraine-Krieg: Rotes Kreuz mahnt mehr Hilfe an
Berlin (epd). Drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mahnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die humanitäre Situation der Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Von den 36 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seien 13 Millionen auf Unterstützung angewiesen, sagte der Leiter der Internationalen Zusammenarbeit, Christof Johnen, am 19. Februar in Berlin.
Johnen zufolge sind nicht nur die Menschen an den Frontlinien auf Hilfe angewiesen, sondern Ukrainerinnen und Ukrainer im ganzen Land. Das DRK unterstützt das Ukrainische Rote Kreuz unter anderem bei der mobilen Gesundheitsversorgung. 130 rollende Arztpraxen fahren nach einem festen Zeitplan über die Dörfer, um auch die ländliche Bevölkerung zu versorgen. So konnten laut Johnen rund 50.000 Menschen im vergangenen Jahr behandelt werden. Der Krieg begann am 24. Februar 2022 mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.
Auch in Deutschland betreut das DRK geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Rund eine Million von ihnen leben derzeit im Land, doch anders als andere Geflüchtete sind sie meist privat untergebracht. Deshalb habe das DRK weniger direkte Erkenntnisse über ihre Situation, gab der DRK-Leiter für Jugend und Wohlfahrtspflege, Joß Steinke, zu bedenken: „Insgesamt ist unser Eindruck aber, dass die Menschen hier angekommen sind.“
Dank der sogenannten EU-Massenstromrichtlinie haben Ukrainerinnen und Ukrainer einen unmittelbaren Zugang zur Gesundheitsversorgung, einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und zum Wohnungsmarkt. Diesen Zugang wünschen sich das DRK und andere Wohlfahrtsverbände auch für andere Geflüchtete.
Plötzlich dreimal so viele Kinder

epd-bild/Tim Wegner
Frankfurt a.M. (epd). Emilia hat Geburtstag, sie wird vier Jahre alt. Kinder und Erzieherinnen sitzen um einen Tisch mit Brot, Käse, Obst und Marmelade und singen „Zum Geburtstag viel Glück“. Auf Deutsch. Ansonsten hört man im Souterrain der katholischen Kirchengemeinde St. Bonifatius im Frankfurter Stadtteil Bonames viel Ukrainisch. Denn hier betreibt der Ukrainische Verein Frankfurt am Main eine provisorische Kinderbetreuung.
In diese Betreuung kommen Kinder, die noch keinen Betreuungsplatz haben. „Am Anfang dachten wir, das ist nur für ein paar Monate“, erinnert sich Roksolana Rakhletska. Sie ist im Vorstand des Ukrainischen Vereins und lebt schon seit 15 Jahren in Deutschland. Nun dauere dieses anfängliche Provisorium schon fast drei Jahre. Neben der Kinderbetreuung in der Gemeinde St. Bonifatius ist der Verein auch Träger zweier Kitas und einer Samstagsschule, die bereits seit 20 Jahren besteht.
Kinderzeichnung mit Bombe
Nicht immer geht es so fröhlich zu wie bei Emilias Geburtstag. Rakhletska zeigt eine Kinderzeichnung. Schwarz ist die einzige Farbe auf dem Bild. Es zeigt ein Haus, rechts darüber einen tiefschwarzen Kreis. „Eine Bombe“, erläutert Rakhletska. Nachdem der siebenjährige Andrii mit seinem Bild fertig war, hätten sie den Tisch reinigen müssen: „Er hat so stark gemalt, dass die Farbe durchs Papier ging.“
Russlands Bomben und Projektile zerstören nicht nur Häuser. In den Häusern sterben Zivilisten, Männer fallen an der Front. Rakhletska sagt, auch in die Kindergärten und in die Schule gingen Kinder, deren Papas nie mehr wieder nach Hause kommen. Der Verein arbeite mit zwei Psychologinnen zusammen, die aus der Ukraine stammten und die für solche Fälle ausgebildet seien. Sie bearbeiteten mit den Kindern und mit deren Müttern die Trauer und Verzweiflung.
Das Hauptaugenmerk des Vereins aber gilt der Pflege der ukrainischen Sprache und Kultur. Für dieses Ziel engagieren sich viele aus der ukrainischen Gemeinschaft ehrenamtlich. Beispielsweise Iryna Khudenko, die vor ihrer Flucht aus der Ukraine ein Unternehmen mit 73 Mitarbeitern leitete. Nun betreut sie hier Kinder, ebenso wie Alisa Hniedo, die in Mainz Politikwissenschaft studieren will. Oder wie Andrii Kazmirchuk, der im Brotberuf Sportlehrer an einer Privatschule ist. Für die Kinder, sagt Rakhletska, sei Kazmirchuk als männliche Bezugsperson enorm wichtig: „Ihnen fehlen die Väter.“
„Beim Lernen ganz auf mich gestellt“
Die älteren Kinder gehen neben dem normalen Unterricht auf die Samstagsschule. Nicht immer mit viel Elan, räumt Olga Shendrya ein. Sie ist Leiterin der beiden Kitas, ihre Tochter besucht die Schule. „Manchmal will sie samstags nicht hin“, berichtet Shendrya. „Aber wenn sie nachmittags wieder kommt, hat es ihr doch immer gefallen.“ Schließlich treffe sie Freundinnen und Freunde dort.
Offensichtlich gefallen hat es auf der Schule auch Evelina Parukh. Sie war 15 Jahre alt, als sie floh. Das deutsche Schulsystem habe sie nicht überzeugt, berichtet sie: „Ich kam in eine Integrationsklasse und war beim Lernen ganz auf mich gestellt.“ Aber in die ukrainische Samstagsschule kommt sie auch heute noch, allerdings nicht mehr als Schülerin. Sie ist Volontärin dort und leitet die Tanz-AG.
Das sei nicht untypisch, sagt Rakhletska: „Viele wollen nach der Schulzeit den Kontakt nicht verlieren und fragen, ob sie bei uns anfangen können.“ Rakhletska ist neben ihrem Vorstandsamt im Verein auch Leiterin der Schule und Lehrerin für Ethnografie.
„Nicht nur warten“
Bei Beginn des russischen Überfalls 2022 waren es rund 100 Kinder, kurz danach hatte sich deren Zahl mehr als verdreifacht. Mittlerweile besuchen rund 550 kleine Ukrainerinnen und Ukrainer die beiden Kindergärten und die Schule des Vereins.
Wie ihre Zukunft aussieht, können die meisten Ehrenamtlichen nicht genau sagen. Viel hänge davon ab, wann und wie der Krieg endet, sagen sie. Aber eine Sache sei dabei wichtig, sagt Kitaleiterin Shendrya: „Etwas zu tun. Nicht nur zu warten, was die Zukunft vielleicht bringt.“
Ende der Bezahlkarte für Asylbewerber gefordert
Potsdam/Hannover (epd). Unterstützer von Geflüchteten fordern in einer bundesweiten Erklärung ein Ende der Bezahlkarte für Asylbewerber. „Gemeinsam sagen wir Nein zur Bezahlkarte und fordern den sofortigen Stopp ihrer Einführung“, heißt es in der Erklärung, die am 20. Februar nach einer Tagung in Hannover von den Flüchtlingsräten von Niedersachsen und Brandenburg verbreitet wurde. Die Bezahlkarte sei diskriminierend und wirke sich nachteilig auf das Zusammenleben sowie die Stimmung in den Städten und Gemeinden aus, erklärten sie: „Mit ihr wird sich die strukturelle Ausgrenzung von Geflüchteten weiter verfestigen und die Gesellschaft in den Städten und Gemeinden weiter nach rechts kippen.“
Die Kritik richtet sich vor allem gegen die Regelung, dass Geflüchtete mit den Karten nur einen begrenzten Betrag an Bargeld abheben dürfen. In 13 Bundesländern liegt die Grenze bei 50 Euro, in drei Ländern sind höhere Abhebungen möglich. In Bayern gelten besonders strenge Regeln.
Am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, soll erstmals ein bundesweiter dezentraler Aktionstag gegen die Bezahlkarte stattfinden. Die Ausgabe der Bezahlkarte hat in den meisten Bundesländern zum Jahreswechsel begonnen. Der Bundestag hatte im April die Einführung einer Bezahlkarte für Menschen beschlossen, die im Asylverfahren oder mit einer Duldung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Beabsichtigt ist damit, irreguläre Migration einzudämmen und Geldüberweisungen in Herkunftsstaaten und an Schlepper zu unterbinden.
Dublin-Zentrum in Brandenburg startet im März
Potsdam (epd). Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Brandenburgs Ressortchefin Katrin Lange (beide SPD) wollen die Abschiebung von Schutzsuchenden, die keinen Anspruch auf Asyl in Deutschland haben, beschleunigen. Dazu werde in Eisenhüttenstadt bei der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg ein sogenanntes Dublin-Zentrum eingerichtet, heißt es in einer am 17. Februar von den beiden Ministerinnen in Potsdam unterzeichneten Vereinbarung zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Es soll am 1. März seine Arbeit aufnehmen.
Dabei gehe es vor allem um die schnelle Rückführung nach Polen. Es handelt sich nach Hamburg um das zweite Dublin-Zentrum in Deutschland. Die Zentren sollen für eine beschleunigte Abschiebung von Menschen sorgen, für deren Asylgesuch ein anderer EU-Staat zuständig ist. Benannt sind sie nach dem Dublin-Abkommen zwischen den EU-Staaten, das die Zuständigkeiten für Asylanträge regelt.
Ziel sei die Überstellung von Menschen, insbesondere nach Polen, innerhalb von zwei Wochen. Zur Beschleunigung der Verfahren werde die Zentrale Ausländerbehörde in die Koordinierung mit den zuständigen Behörden in Polen eng eingebunden. Die Vereinbarung sieht auch vor, dass „jeder Dublin-Fall“ mit dem Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgeschlossen ist. Möglich seien dann nur noch befristete Sachleistungen.
Das Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt umfasst zwei Gebäude, eines für alleinreisende Frauen und für Familien, das andere für alleinreisende Männer. Es gebe insgesamt Platz für bis zu 250 Personen.
Land will Abschiebehaftplätze bei Arnstadt schaffen
Erfurt (epd). Thüringen möchte schnellstmöglich bis zu 37 landeseigene Abschiebehaftplätze einrichten. Hierfür solle die bisherige Jugendarrestanstalt bei Arnstadt im Ilm-Kreis leer gezogen und umgebaut werden, sagte Migrationsministerin Beate Meißner (CDU) im Anschluss an eine Sitzung der Landesregierung am 18. Februar in Erfurt. In einem ersten Schritt sollen im laufenden Jahr zunächst zehn Abschiebehaftplätze in dem Gebäudekomplex geschaffen werden.
Meißner rechnet für den Umbau des bisherigen Gebäudes für den offenen Vollzug im Jugendarrest mit Kosten in Höhe von zwei Millionen Euro. In dieser Summe seien auch die Kosten für den Umzug des bisherigen Jugendarrests in ein benachbartes Gebäude enthalten, das seit sechs Jahren leer steht. Für die folgenden Jahre veranschlagt die Landesregierung laufende Kosten in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro jährlich.
Meißner begründete die Entscheidung des Thüringer Kabinetts mit den jüngsten Anschlägen von Aschaffenburg, Magdeburg und München. Die Einrichtung sei ein dringend notwendiger Schritt, um einen Wechsel in der Migrationspolitik einzuleiten. In Thüringen seien 334 Abschiebungen im vergangenen Jahr gescheitert, weil ausreisepflichtige Personen nicht angetroffen wurden.
Bislang nutzt Thüringen für Abschiebungen eine Gewahrsamseinrichtung im rheinland-pfälzischen Ingelheim mit. Dort waren demnach im vergangenen Jahr an insgesamt 378 Tagen Ausreisepflichtige aus Thüringen untergebracht. Zeitweise habe weiterer Platz angemietet werden müssen, hieß es im Januar auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd).
Flüchtlingsrat kritisiert Pläne für Abschiebehaftanstalt
Erfurt (epd). Der Flüchtlingsrat Thüringen kritisiert die Pläne der Landesregierung zum Aufbau von Abschiebehaftplätzen als Symbolpolitik. Abschiebehaft sei ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen, die keine Straftat begangen haben, erklärte die Sprecherin des Vereins, Juliane Kemnitz am 20. Februar in Erfurt. Thüringen solle nicht in Freiheitsentzug investieren, sondern in eine menschenwürdige soziale Teilhabe. Bislang ist dem Flüchtlingsrat eigenen Angaben zufolge keine Abschiebung im Freistaat bekannt, die an fehlenden Haftplätzen gescheitert ist. Die Argumentation der Landesregierung, eigene Haftplätze im Freistaat könnten die Verfahren beschleunigen, sei somit widerlegt.
Die Pläne der Landesregierung setzen laut Kemnitz einzig auf Abschreckung und zielen auf die Stigmatisierung von Schutzsuchenden ab. Daher sei es umso wichtiger, Betroffene besser über ihre Bleiberechte zu informieren. Der Flüchtlingsrat verwies auf Untersuchungen, wonach jede zweite Anordnung für eine Abschiebehaft nicht den rechtlichen Anforderungen entspreche. Abschiebehaft dürfe immer nur das letzte Mittel sein.
Am Dienstag hatte die Thüringer Landesregierung den Umbau des Hafthauses für den offenen Vollzug an der Jugendstrafanstalt bei Arnstadt zu einer Gewahrsamseinrichtung für ausreisepflichtige Geflüchtete beschlossen. Hier sollen voraussichtlich bis 2026 bis zu 37 Haftplätze für Abschiebungen geschaffen werden.
Rund 35.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Thüringen
Erfurt (epd). Aktuell leben rund 35.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Thüringen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine seien rund 49.000 Geflüchtete aus dem osteuropäischen Land im Freistaat aufgenommen worden, teilte das Büro der Migrationsbeauftragten des Freistaats, Mirjam Kruppa, am 21. Februar in Erfurt mit. Etwa 14.000 Geflüchtete seien inzwischen wieder zurückgegangen oder in andere Bundesländer oder das Ausland verzogen.
Rund 30 Prozent der Geflüchteten sind laut Kruppa Kinder unter 18 Jahren. Viele davon seien nur mit ihrer Mutter geflohen. Ende 2024 arbeiteten bereits fast 30 Prozent der ukrainischen Geflüchteten im erwerbsfähigen Alter im Freistaat. Und jeden Monat steige die Zahl der ukrainischen Erwerbstätigen beträchtlich. „In Thüringen nahm ihre Zahl im letzten halben Jahr Monat für Monat um rund 200 zu“, teilte die Beauftragte unter Verweis auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit mit.
Für die Beauftragte ist es beeindruckend, zu erfahren, was gerade die Frauen leisten. Der Krieg zerstöre ihre Heimat. Die Angst um Ehemänner, Väter und Söhne an der Front gehöre ebenso wie die Sorge um zurückgelassene Eltern oder Freunde zum Alltag. Gleichzeitig kümmerten sich die Frauen darum, in Deutschland Fuß zu fassen. Das koste unglaublich viel Kraft, sagte Kruppa.
Am 24. Februar 2022 hatte Russland die Ukraine angegriffen und seither das Land mit einem zerstörerischen Krieg überzogen. Über 10,5 Millionen Menschen sind laut Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen vor den russischen Bomben auf der Flucht. Davon leben 6,3 Millionen Menschen mittlerweile in anderen europäischen Staaten.
In Berlin leben 54.000 Ukrainer
Berlin (epd). Drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine leben in Berlin rund 54.000 aus dem Land Geflüchtete. Davon seien rund 60 Prozent Mädchen und Frauen, teilte die Senatssozialverwaltung am 21. Februar in Berlin mit. Jeder fünfte Geflüchtete sei unter 18 Jahren. Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) dankte am 21. Februar allen Berlinerinnen und Berlinern, die bei der Aufnahme der Kriegsflüchtlinge geholfen haben. Senat, Bezirke, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiteten eng zusammen, damit die Ukrainer hier eine neue Heimat fänden.
In Deutschland haben demnach bis heute rund 1,2 Millionen Menschen Zuflucht gesucht. Berlin sei dabei weiter ein wichtiger Ankunfts- und Transitort für Geflüchtete aus der Ukraine. Mehr als 470.000 Ukrainerinnen und Ukrainer hätten in den vergangenen drei Jahren Berlin erreicht. Nur ein Teil ist in der Stadt geblieben.
Seit Kriegsausbruch im Februar 2022 ist die Zahl der Beschäftigten mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Berlin laut Senatssozialverwaltung um 13.570 auf aktuell 19.900 Menschen angestiegen, darunter 88 Prozent sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.
Für Angebote im Rahmen des Gesamtkonzeptes für Geflüchtete und des Aktionsplans Ukraine seien zusätzlich in den vergangenen drei Jahren vom Land rund 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Zudem hätten einzelne Senatsverwaltungen sowie Bezirke eigene Mittel für Projekte eingesetzt. Absehbar würden auch in nächster Zeit Menschen aus der Ukraine in Berlin ankommen, „hier leben und Teil der Berliner Gesellschaft werden“, hieß es.
Holocaust-Überlebender Turski gestorben

epd-bild/Thomas Lohnes
Berlin (epd). Der Holocaust-Überlebende und Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Marian Turski, ist tot. Der polnische Journalist starb im Alter von 98 Jahren, wie das Auschwitz-Komitee am 18. Februar mitteilte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier drückte in einem Kondolenzschreiben an die Tochter des Verstorbenen am 19. Februar sein Mitgefühl aus: „Wir verlieren mit Marian Turski einen wahren Freund und einen großen Kämpfer um Erinnerung - nicht um ihrer selbst willen, sondern damit nicht wieder geschieht, was geschehen ist.“
Der Bundespräsident erinnerte an bewegende Begegnungen mit Turski, insbesondere beim Gedenken zum 80. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung am 27. Januar. Steinmeier betonte, dass das von Turski formulierte „elfte Gebot“ - „Sei nicht gleichgültig!“ - bewahrt werde. Seine Rede zum Gedenktag der Befreiung in Auschwitz könne als "Leitstern für den Einsatz für Vielfalt, gegen Antisemitismus, Rassismus und Populismus dienen. Steinmeier hob vor allem Turskis Einsatz für die Erinnerung an die Schoah und für Versöhnung zwischen Deutschland und Polen hervor.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bezeichnete Turski als Menschen „von unfassbarer Güte, Mut und Kämpfergeist“. Sie sei unendlich dankbar, dass sie „einige lehrreiche, berührende und stets mit Wärme gefüllte Begegnungen mit ihm haben durfte“, sagte Roth. Sie hob hervor, dass Turski nicht nur als „Mahner gegen das Vergessen, den Hass und die Unmenschlichkeit“ fehlen werde, sondern auch als Mensch.
Christoph Heubner, der Vizepräsident des Komitees, würdigte Turski für die Überlebenden des NS-Konzentrationslagers Auschwitz als „Freund, Bruder und Leidensgefährten“. Turski sei in aller Welt als wirkmächtiger Vertreter ihrer Erinnerungen und als Stimme ihrer ermordeten Angehörigen gehört worden. Bis in seine letzten Lebenstage hinein habe er als Journalist und Zeitzeuge die politischen Entwicklungen mit zunehmender Sorge verfolgt. „Er war bestürzt angesichts des europaweiten Aufflammens antisemitischer und rechtsextremer Ideologien und der rhetorischen Gewalt, mit der die Repräsentantinnen und Repräsentanten dieser Ideologien besonders junge Menschen zu radikalisieren versuchten“, sagte Heubner.
Marian Turski wurde als Jugendlicher gemeinsam mit seiner Familie im Ghetto von Lodz inhaftiert und von dort nach Auschwitz deportiert. Nach dem Todesmarsch aus Auschwitz wurde er als junger Mann in Theresienstadt befreit. Im Konzentrationslager Auschwitz wurden zwischen 1940 und 1945 mindestens 1,1 Millionen Menschen ermordet. Das Lager wurde zum Symbol der nationalsozialistischen Judenverfolgung.
Weitere Gegenstände aus Buchenwald aus Menschenhaut

epd-bild/Fabian Neeser
Weimar/Baltimore (epd). Der Kriminalbiologe Mark Benecke hat für weitere Gebrauchsgegenstände aus den Sammlungen des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald nachgewiesen, dass sie aus menschlichen Hautstücken angefertigt wurden. Darunter befinden sich ein weiterer Lampenschirm und eine Taschenmesser-Hülle. Am 20. Februar stellte der Kölner Wissenschaftler seinen Abschlussbericht erstmals auf der Tagung der American Academy of Forensic Sciences im US-amerikanischen Baltimore vor.
epd: Nach der Zwischenpräsentation zu Artefakten aus Menschenhaut in Buchenwald haben Sie weitergeforscht. Wie sind Sie weiter vorgegangen? Welche und wie viele Gegenstände, Fragmente haben Sie weiter untersuchen lassen?
Mark Benecke: Wir haben 2024 noch ein weiteres Stückchen eines Lampenschirms und eine Taschenmesser-Hülle aus England erhalten. Kurz vor dem Abschluss des Projekts haben wir außerdem einen weiteren Lampenschirm bekommen. Er wurde direkt nach der Pressekonferenz in der Gedenkstätte Buchenwald in Westdeutschland gefunden und unserem Labor übergeben.
epd: Was haben die Untersuchungen ergeben?
Benecke: Leider sind alle diese Gegenstände auch aus Menschenhaut. Das haben vergleichende mikroskopische Untersuchungen mit Menschenhaut sowie Erbgutuntersuchungen zweifelsfrei ergeben.
epd: Wo konnten sie Entwarnung geben?
Benecke: Es hatte sich im Zwischenbericht ja angedeutet, dass der Schrumpfkopf vermutlich nicht menschlichen Ursprungs sein dürfte. Aber zunächst war die Untersuchung der Haare nicht eindeutig genug. Vieles sprach für ein Pferd. Daher habe ich auch hier noch einmal Erbgut untersucht und untersuchen lassen. Jetzt steht fest: Es handelt sich um Ziegen-Haut und -haar, die entsprechend in Form gebracht wurden. An dieser Stelle hatte übrigens meine Frau Recht: Ihr war früh aufgefallen, dass die Haare, die Ohr-Öffnung und anderes nicht zu einem Menschen passen. Sie muss es wissen. Sie verfügt über eine Ausbildung als staatlich geprüfte Kosmetikerin.
epd: Was konnten Sie nicht klären?
Benecke: Ein präpariertes Herz mit angeblicher Schussverletzung gehört ebenfalls zu den nach der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald in dessen Pathologischer Abteilung vorgefundenen Präparaten. In dem Herz aus der Sammlung konnten wir nach sehr, sehr vielen Versuchen in mehreren Speziallaboren aber kein Erbgut finden. Aber ich konnte es anhand alter Fotos als das echte, „damalige“ Herz aus der alten Sammlung eindeutig zuordnen. Es ist also „geschichtlich“ gesehen durch Fotovergleich auch als menschlich bestimmt.
epd: Was hat das Projekt gekostet?
Benecke: Es hat sehr viel Zeit und Geld gekostet. Ich habe alles selbst bezahlt, da ich für diese Untersuchung einfach kein Geld nehmen wollte. Unglaublich wichtig war dabei der Sammlungsleiter der Gedenkstätte, der die ganzen alten Quellen und Fotos kannte sowie das sehr gründlich arbeitende Labor, das einen Arbeitsschwerpunkt auf verarbeiteter Haut - meist natürlich von Tieren - hat. Es war anstrengend, teuer und zwischendurch dachte ich, wir packen es nicht mehr. Aber nachdem auch die Untersuchung von Hitlers Schädel und Zähnen in Moskau ein Wahnsinnsaufwand war, und da ich die Wahrheit einfach liebe, haben wir es alle gemeinsam geschafft.
epd: Sind die forensischen Untersuchungen damit abgeschlossen?
Benecke: Ja. Ganz ehrlich: Ich glaube, dem Sammlungsleiter der Stiftung und mir ist das Ganze auch doch näher gegangen, als wir dachten. Es ist gut, dass es jetzt dauerhaft geklärt und der „Deckel zu“ ist.
epd: Wird es ein Nachfolgeprojekt geben? In Buchenwald oder anderswo?
Benecke: Auch hier ein: „Leider ja.“ Ich habe gerade erst eine Anfrage aus Syrien erhalten. Die Ukraine ist auch ein möglicher Kandidat. Genozide gibt es immer.
epd: Sind die Personen bekannt, aus deren Haut die untersuchten Gegenstände gefertigt wurden? Ließe sich das überhaupt genetisch klären?
Benecke: Es gäbe eine Möglichkeit: Dazu müssten wir in die riesigen Familien-Stammbaum-Daten schauen. Der Sammlungsleiter und ich haben bisher entschieden, das nicht zu tun. Vermutlich bleibt es auch dabei. Manche Dinge sollten besser ruhen. Nur zu dem durchschossenen Herzen ist mit dem tschechischen politischen Häftling Jiri Horejsi (1920-1942) ein Name überliefert. Aber hier haben wir, wie gesagt, kein verwertbares Erbgut mehr vorgefunden.
epd: Fast zum Ende noch eine Frage zu den Anfängen des Projekts: Wie kamen sie auf das Thema?
Benecke: Mein Augenmerk auf Spuren aus Konzentrationslagern ist auf einer Sitzung erwacht: Im Jahr 2005 berichtete ein Kollege bei einer Tagung der American Academy of Forensic Sciences (AAFS), dass er Seife erhalten habe, die aus einem Konzentrationslager und aus Menschenfett gekocht sein könnte. Wir überlegten damals, wie sich das nachweisen ließe. Ohne diese Gesprächsrunde wäre ich vielleicht gar nicht auf die Spuren in Buchenwald gekommen.
epd: Und noch mal zu heute: Welche Reaktionen haben Sie in der grundsätzlich streitfreudigen Wissenschaftscommunity nach Veröffentlichung der Zwischenergebnisse erreicht? Gab es Widerspruch?
Benecke: Es herrschte zunächst Totenstille. Dann aber kam eine Überraschung: Die American Academy of Forensic Sciences, bei der ich schon seit den 1990er Jahren Mitglied bin, hatte meine Einreichung für die Konferenz gesehen und zum ersten Mal in meinem Leben beschlossen, meine Redezeit zu verlängern. Sonst wird sie eher gekürzt, um mehr Vorträge pro Sitzung einbauen zu können. Ich hatte nicht einmal danach gefragt. Jetzt wird der Vortrag mit über hundert Fotos nicht in einem Sonderteil der Tagung stattfinden, sondern auf der größten Veranstaltung dort, der sogenannten „Last Word Society“. Das freut mich sehr, weil mich so besonders viele fachliche Anmerkungen erreichen werden.
Weitere rechtsextreme Verdachtsfälle bei sächsischer Polizei
Dresden (epd). Im zweiten Halbjahr 2024 sind bei der sächsischen Polizei 20 neue Verdachtsfälle mit Bezug zum Rechtsextremismus aufgedeckt worden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der sächsischen Linken-Abgeordneten Juliane Nagel hervor, die am 19. Februar in Dresden veröffentlicht wurde. Demnach werden Bediensteten unter anderem rassistische und antisemitische Äußerungen zur Last gelegt, die im dienstlichen Rahmen gefallen sein sollen, sowie verfassungsfeindliche Statements in sozialen Medien. Zudem seien von Polizeikräften der Nationalsozialismus verharmlost, verbotene Parole verwendet und der Hitlergruß gezeigt worden.
Fast alle Fälle hätten sich im Bereich der Polizeihochschule in Rothenburg in der Oberlausitz ereignet, hieß es. Der dortige Rektor Dirk Benkendorff war im Dezember überraschend abberufen worden. Ihm wurde laut damaligen Medienberichten unter anderem Untätigkeit im Umgang mit Problemen wie diskriminierenden und rechtsextremen Vorfällen vorgeworfen.
Bei einem im August 2024 bekannt gewordenen Fall soll der betreffende Polizist möglicherweise über mehrere Jahre einschlägige rechtsextreme Äußerungen getätigt haben - und zwar im Unterricht, der offenbar in den Zuständigkeitsbereich der Hochschule der Polizei fällt. Nach Angaben der Linken-Fraktion sind seit 2020 aufgrund von Anfragen der Partei mehr als hundert rechtsextreme Verdachtsfälle bekannt geworden.
Anklage gegen terrorverdächtigen Reichsbürger in Thüringen erhoben
Jena (epd). Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 60-jährigen Deutschen wegen der Unterstützung der sogenannten Kaiserreichsgruppe erhoben. Wie ein Behördensprecher am 17. Februar mitteilte, soll der Südthüringer die Gruppe durch die Rekrutierung weiterer Mitglieder und Sympathisanten unterstützt haben. Auch habe er Telegram-Gruppen der als terroristisch eingestuften Organisation verwaltet.
Die Gruppe plante bis zu ihrer Zerschlagung im April 2022, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik gewaltsam zu stürzen und durch ein autoritär geprägtes Regierungssystem nach dem Vorbild der Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 zu ersetzen. Zu den Zielen der Gruppe gehörte unter anderem die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unter Einsatz von Waffen. Gegen die Hauptakteure der Gruppe wurde im Januar 2023 Anklage beim Oberlandesgericht Koblenz erhoben. Die Verhandlung dauert derzeit noch an.
Laut Generalstaatsanwaltschaft hat der mutmaßliche Südthüringer Mittäter einem der Rädelsführer seine Beteiligung an der Herbeiführung eines bundesweiten Stromausfalls zugesagt, der möglicherweise zu hunderten Toten etwa in Gesundheitseinrichtungen hätte führen können. Die Taten des Angeklagten seien von Anfang 2022 bis zur Zerschlagung der Gruppe im April 2022 erfolgt.
Der Angeklagte ist laut Generalstaatsanwaltschaft der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie der Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund verdächtig. Der Angeklagte befindet sich derzeit auf freiem Fuß.
Kleinere Kontrollkommission für Verfassungsschutz
Potsdam (epd). Die Parlamentskommission zur Kontrolle des brandenburgischen Verfassungsschutzes soll künftig nur noch drei Mitglieder haben. Dies sieht ein gemeinsamer Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und BSW vor, der am 19. Februar in Potsdam veröffentlicht wurde. Zwei Sitze sollen demnach an die Koalition, ein Sitz an die Opposition gehen. Die AfD, die in Brandenburg seit 2020 als rechtsextremer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hätte damit keinen Anspruch auf einen Sitz in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Der Opposition gehört neben der AfD auch die CDU an.
Der Antrag steht am 26. Februar auf der Tagesordnung des Landtags. Laut Verfassungsschutzgesetz des Bundeslandes beschließt das Parlament über die Größe der Kommission, die neun Mitglieder nicht übersteigen soll, sowie über ihre Zusammensetzung. Die parlamentarische Opposition muss laut Gesetz angemessen vertreten sein.
In der vergangenen Legislaturperiode von 2019 bis 2024 war die AfD bei Wahlen zur Besetzung der Kommission in Brandenburg mit allen Kandidaten gescheitert. Das Landesverfassungsgericht hatte nach einer AfD-Klage bestätigt, dass der Landtag keine Personen in dem Gremium akzeptieren muss, zu denen kein Vertrauen besteht.
Derzeit ist weiter die bisherige Kontrollkommission im Amt. Im Gesetz heißt es dazu, die Kommission übe ihre Tätigkeit über das Ende einer Wahlperiode hinaus solange aus, bis der nachfolgende Landtag eine neue Kommission gebildet hat. Dadurch gehören dem Gremium derzeit neben dem SPD-Abgeordneten Uwe Adler vier Personen an, die keine Mitglieder des Landtags mehr sind.
Antisemitismus-Beauftragter soll "zeitnah" ernannt werden
Erfurt (epd). Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen wartet auf die Ernennung eines neuen Beauftragten für den Schutz jüdischen Lebens im Freistaat. Ihm seien einige Namen genannt worden, sagte der Vorsitzende der Landesgemeinde, Reinhard Schramm, dem Evangelischen Pressedienst (epd). Doch wichtiger als der Name des Beauftragten sei für ihn, dass die Person dann auch die nötige Zeit für das Amt mitbringe. Bis Dezember hatte der vormalige Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin Immanuel Hoff (Linke), das Amt ausgefüllt. Seitdem ist die Position vakant.
Die Staatskanzlei erklärte auf Anfrage, die Ernennung eines Antisemitismusbeauftragten sowie die zukünftige Ausgestaltung dieser zentralen Funktion werde derzeit „mit der gebotenen Sorgfalt“ vorbereitet. Für die Ernennung gebe es noch keinen Termin, sie werde „zeitnah“ erfolgen, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Auch stehe bisher nicht fest, welchem Ressort der Landesregierung der Beauftragte zugeordnet werde.
Ein Vakuum bestehe nicht. Grundsätzlich seien der Kampf gegen Antisemitismus und der Schutz jüdischen Lebens Chefsache im Freistaat. Daher seien sowohl Ministerpräsident Mario Voigt als auch der Chef der Staatskanzlei, Stefan Gruhner (beide CDU), für die Anliegen der Landesgemeinde schon jetzt jederzeit ansprechbar.
Der Beauftragte für den Schutz jüdischen Lebens in Thüringen ist Ansprechpartner für die Belange jüdischer Gruppen, aber auch für Behörden, Kirchen- und Moscheegemeinden sowie Bildungseinrichtungen. Der Beauftragte koordiniert auch ressortübergreifend die Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung des Antisemitismus.
Tausende Menschen demonstrieren gegen Sparhaushalt in Berlin
Berlin (epd). Mehrere Tausend Menschen haben am 22. Februar vor dem Roten Rathaus in Berlin gegen die Sparpolitik des Senats protestiert. Reden und Plakate wendeten sich gegen die Kürzungen im Sozialbereich sowie bei Kultur und Bildung. Zur Demonstration aufgerufen hatte das Bündnis „Berlin ist unkürzbar“, das durch die Einsparungen den sozialen Zusammenhalt in der Stadt gefährdet sieht. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmenden auf 5.000.
Ende November vergangenen Jahres hatte der Senat Einsparungen für 2025 in Höhe von rund drei Milliarden Euro beschlossen. Für die Haushalte 2026 und 2027 seien bereits weitere Kürzungen in Höhe von 800 Millionen Euro angekündigt, hieß es im Protestaufruf, dem sich zahlreiche Initiativen, Verbände und Gewerkschaften angeschlossen hatten.
Diakonie-Vorständin Andrea Asch hatte zuvor erklärt, den Trägern sozialer Einrichtungen gehe langsam die Luft aus. Stellen könnten nicht nachbesetzt werden, die Eigenanteile würden ständig wachsen, Einrichtungen stünden vor dem Aus.
Das Bündnis „Berlin ist unkürzbar“ wirft dem Senat vor, „in einem intransparenten Hauruckverfahren“ Kürzungen beschlossen zu haben. Das Bündnis wirft der Regierungskoalition von CDU und SPD zudem vor, sich der Diskussion über eine Verbesserung der Einnahmenseite für den Berliner Haushalt zu verweigern. „Wir fordern eine solidarische Finanzierung von Sozialem, Kultur, Bildung, Wissenschaft und Klimaschutz“, hieß es im Protestaufruf.
Özdemir: Für Freiheit der Wissenschaft eintreten

epd-bild/Rolf Zöllner
Halle (epd). Bundesforschungsminister Cem Özdemir (Grüne) hat dazu aufgerufen, die Freiheit der Wissenschaft zu stärken. Es sei ihm wichtig, alle Zweifel auszuräumen, die unter der vorherigen Hausleitung des Bundesforschungsministeriums entstanden seien, sagte er am 21. Februar laut Redemanuskript in Halle. Özdemir nahm dort an der Einführung der neuen Präsidentin der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Bettina Rockenbach, teil.
Özdemir bezog sich damit auf seine Amtsvorgängerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Diese hatte im vergangenen Jahr Konsequenzen für Hochschullehrer geprüft, die pro-palästinensische Proteste unterstützt hatten. Dafür war die damalige Ministerin heftig kritisiert worden.
Ihm sei es von Anfang an darum gegangen, Vertrauen wiederherzustellen, betonte Özdemir. Es gelte, die Freiheit der Wissenschaft unmissverständlich zu schützen. Er verwies auf die Regierung von US-Präsident Donald Trump, die aus seiner Sicht an den Säulen der Gewaltenteilung säge und die Wissenschaft bedränge.
Auch anderenorts gerate die Wissenschaft in Bedrängnis, beklagte der Forschungsminister. Forschung werde instrumentalisiert, unbequeme Forscher würden „mundtot“ gemacht. „In solchen Zeiten müssen wir für die Wissenschaft und ihre Freiheit beherzt eintreten“, forderte Özdemir.
Die Leopoldina bezeichnete er als „elementaren Baustein des deutschen Wissenschaftssystems“ und als „staatstragend“. Sie sei ein „Think Tank“ aus Spitzenforschern, der als Berater der Politik sowie als internationaler Repräsentant der deutschen Wissenschaft benötigt werde.
Die neue Präsidentin der Leopoldina, Bettina Rockenbach, sagte in ihrer Antrittsrede, sie betrachte die Gesellschaftsberatung als Schwerpunkt ihrer künftigen Arbeit. Sie forderte laut Redemanuskript, die Wissenschaft sollte die für eine politische oder gesellschaftliche Entscheidung besonders relevanten Tatsachen und Entscheidungskriterien verständlich kommunizieren.
Gesellschaftsberatung dürfe hingegen nicht missverstanden werden als direkte Partizipation der Bürger bei der Erarbeitung von Stellungnahmen. Zudem dürfe die Wissenschaft Bürger nicht darüber belehren, wie sie sich in einer Art wissenschaftlich betreutem Leben zu verhalten hätten, betonte die neue Präsidentin.
Die Gegenwart sieht Rockenbach durch Stichworte wie „multiple Krise“, „Zeitenwende“ oder „Transformation“ gekennzeichnet. In diesen Zeiten müsse die Leopoldina ihre Empfehlungen so darstellen, dass ihre Adressaten sie nachvollziehen könnten. „Womöglich erreichen wir damit, das Verständnis von Wissenschaft als Einübung einer vernünftigen Haltung in einer Welt der Zielkonflikte zu fördern“, meinte Rockenbach.
Die Professorin für Verhaltensökonomie an der Universität Köln ist ab 1. März neue Präsidentin der Leopoldina mit Sitz in Halle. Ihre Amtszeit beträgt fünf Jahre. Sie folgt auf den Klimaforscher Gerald Haug. Die 1652 gegründeten Wissenschaftsvereinigung Leopoldina mit ihren rund 1.700 Mitgliedern aus nahezu allen Wissenschaftsbereichen vertritt die deutsche Wissenschaft im Ausland und berät Politik sowie Öffentlichkeit.
Förderung für Frauen-Professuren
Potsdam (epd). Vier Hochschulen in Brandenburg sind für ihre Gleichstellungskonzepte gewürdigt worden. Ein Begutachtungsgremium der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern habe die Universität Potsdam, die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, die Fachhochschule Potsdam und die Technische Hochschule Wildau wegen ihrer Konzepte für ein Förderprogramm ausgewählt, teilte das Wissenschaftsministerium am 21. Februar in Potsdam mit.
Bundesweit seien insgesamt 56 Hochschulen ausgewählt worden, hieß es. Bund und Länder stellen den Angaben zufolge für das Förderprogramm insgesamt 320 Millionen Euro über eine Laufzeit von acht Jahren zur Verfügung.
Die Hochschulen könnten nun bis zum 30. September 2026 Anträge für bis zu drei Anschubfinanzierungen für die Erstberufung von Frauen auf unbefristete W2- oder W3-Professuren stellen, hieß es. Die Universität Potsdam und die Fachhochschule Potsdam seien zudem zu „Gleichstellungsstarken Hochschulen“ gekürt worden. Damit sei die Förderung einer zusätzlichen Stelle für eine Nachwuchswissenschaftlerin verbunden.
Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) erklärte, die Förderung aus dem „Professorinnenprogramm 2030“ sei ein wichtiger Beitrag zu Chancengleichheit und Wettbewerbsfähigkeit. Es sei wichtig, hochqualifizierten Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen beste Perspektiven und Karrierewege zu ermöglichen. Das „Professorinnenprogramm 2030“ wurde den Angaben zufolge im November 2022 von der Wissenschaftskonferenz beschlossen. Ziel ist unter anderem, Frauen auf dem Weg zur Lebenszeitprofessur zu fördern.
Wohnungsbau: Berlin reagiert zurückhaltend auf Merz und Scholz
Berlin (epd). Die Berliner Landespolitik hat zurückhaltend auf die Forderung der Kanzlerkandidaten von Union und SPD nach einer Wohnbebauung des Tempelhofer Feldes reagiert. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bekräftigte im Berliner „Tagesspiegel“ (18. Februar), dass er an seiner bisherigen Haltung festhält: „Ich bin für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes, denn wir brauchen dringend neuen Wohnraum in Berlin.“ Auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) will demnach am bisherigen Verfahren festhalten: „Ich habe mich immer für eine maßvolle Randbebauung ausgesprochen, allerdings nicht gegen den Willen der Bevölkerung.“
CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte sich am 16. Februar in einer Fernsehdebatte für eine Bebauung der innerstädtischen Fläche ausgesprochen, obwohl dies bei einem Volksentscheid 2014 abgelehnt worden war. Wörtlich sagte der CDU-Politiker: „Wenn die Bürgerinnen und Bürger sich weigern, dann muss die Politik bereit sein, auch gegen den erklärten Willen der Nachbarschaft zu sagen, wir weisen das als Bauland aus und werden dort bauen.“ Der Bundeskanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte ergänzt: „Wir sind einer Meinung.“
Nach Überzeugung von Berlins Regierungschef Wegner bleibt das Tempelhofer Feld auch dann ein einzigartiges Areal, wenn am Rand Wohnungen entstehen würden. Er sei überzeugt, „dass es für eine klare Konzeption auch eine breite Mehrheit in Berlin geben wird.“ Wirtschaftssenatorin Giffey hält eine Bürgerbeteiligung in einem Dialogverfahren samt internationalem Konzeptwettbewerb für erforderlich.
Demokratie-Forum auf Leipziger Buchmesse
Leipzig (epd). Die Leipziger Buchmesse lädt auch in diesem Jahr zu einem „Forum Offene Gesellschaft“ ein. Diskutiert werden Fragen und Herausforderungen der Gegenwart, wie die Buchmesse am 20. Februar in Leipzig mitteilte. Eingeladen seien Autorinnen und Autoren sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Medien.
Das Gesprächsforum für Toleranz, Vielfalt und Offenheit findet zum dritten Mal auf der Buchmesse statt. Beteiligt sind unter anderem das Aktionsbündnis Verlage gegen Rechts, die Bundeszentrale für politische Bildung, die Friedrich-Naumann-Stiftung, das PEN-Zentrum Deutschland und das Recherchekollektiv Correctiv.
Themen sind der wachsende Rechtsextremismus, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und der Klimawandel. Zu Gesprächen werden unter anderem der ehemalige Berliner Kultursenator Klaus Lederer (parteilos) und die Autorin Jenaba Samura erwartet sowie der Überlebende des Terroranschlags von Hanau, Said Etris Hashemi, und die russische Autorin Irina Rastorgueva. Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. März statt. Gastland ist in diesem Jahr Norwegen.
Potsdamer Gedenkstätte wird 30 Jahre alt
Potsdam (epd). Die Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam begeht in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum: Gefeiert werde das 30-jährige Bestehen der Gedenkstätte in einem ehemaligen Gerichtsgebäude mit NS- und Stasi-Haftanstalt, teilte die Einrichtung am 20. Februar in Potsdam mit. Außerdem werde das zehnjährige Bestehen der Stiftung für die Gedenkstätte begangen. Das Doppeljubiläum soll am 15. Juli mit einem Sommerfest gefeiert werden.
Mithilfe von Förderung durch die Stadt und das Land Brandenburg sei am historischen Ort ein modernes zeithistorisches Museum entstanden, hieß es. Der Stiftung sei es zudem seit 2021 zudem gelungen, mehr als eine Million Euro Drittmittel einzuwerben, darunter allein im vergangenen Jahr rund 400.000 Euro.
In diesem Jahr ist den Angaben zufolge eine neue Ausstellung mit dem Titel „Das graue Elend von Potsdam“ geplant. Sie soll das sowjetische Untersuchungsgefängnis Lindenstraße in den Blick nehmen, das von 1945 bis 1952 in dem Gebäudekomplex seinen Ort hatte. Dafür seien trotz schwieriger russischer Archivsituation auch Namen von mehr als 1.700 Inhaftierten der sowjetischen Zeit ermittelt worden, hieß es. Die Ausstellung soll ab dem 26. September gezeigt werden.
2024 besuchten den Angaben zufolge fast 20.000 Menschen die Gedenkstätte Lindenstraße, darunter rund 8.400 Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet. Am inklusiven Bildungsprojekt „Vergangenheit verstehen“ hätten sich mehr als 400 Menschen aus Behindertenwerkstätten „von Wismar an der Ostsee bis Kamenz an der deutsch-tschechischen Grenze“ beteiligt, hieß es.
Bundesverwaltungsgericht verhandelt zu Klage der BDS-Bewegung
Leipzig (epd). Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt am 26. März über eine Klage der mutmaßlich antisemitischen BDS-Bewegung. Diese wehrt sich gegen einen Beschluss des Bundestages von 2019 mit dem Titel „Der BDS-Bewegung entschlossen entgegentreten - Antisemitismus bekämpfen“, wie das Gericht am Freitag in Leipzig mitteilte. Darin stellte das Parlament unter anderem fest, dass die politische Bewegung keine Räumlichkeiten und Einrichtungen nutzen dürfe, die unter Bundestagsverwaltung stehen. (BVerwG 6 C 6.23).
Der Bundestag begründete den Beschluss damit, dass die „Boycott, Divestment and Sanctions“-Bewegung sich antisemitisch äußere, das Existenzrecht Israels infrage stelle und zum Boykott Israels aufrufe. Solche Organisationen oder Projekte sollen laut Bundestag finanziell nicht gefördert werden, auch nicht von Ländern, Städten und Gemeinden.
Die BDS-Bewegung ruft laut Bundestag auch in Deutschland zum Boykott israelischer Waren und Dienstleistungen, israelischer Kunstschaffender, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Sportlerinnen und Sportler auf. Dies führe „in seiner Radikalität zur Brandmarkung israelischer Staatsbürger jüdischen Glaubens als Ganzes“, hieß es. Die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung seien antisemitisch.
Die transnationale Bewegung hatte vor dem Verwaltungsgericht Berlin Klage gegen den Bundestagsbeschluss erhoben. Das Gericht wies diese als teilweise unzulässig und unbegründet ab. Die Kläger legten Berufung ein. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als nächste Instanz sah sich für den Fall nicht zuständig.
Wissenschaftsminister des Jahres gewählt
Bonn (epd). Die Hamburger Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne), ihr Ressortkollege aus Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann (SPD), und die Brandenburger Ressortchefin Manja Schüle (SPD) sind vom Deutschen Hochschulverband ausgezeichnet worden. Fegebank wurde von den Mitgliedern des Verbands erneut zur „Wissenschaftsministerin des Jahres“ ernannt. Mit der Note 2,31 wurde Fegebank in einer Online-Abstimmung bundesweit am besten bewertet, wie der Verband am 17. Februar in Bonn mitteilte.
Nach 2020 und 2023 führt sie das Ranking 2024 zum dritten Mal an. Ihre Ehrung erfolge im Rahmen der Gala der Deutschen Wissenschaft am 31. März in Berlin statt. Mitglieder des Hochschulverbands bescheinigten Fegebank in Kommentaren ein „beeindruckendes, starkes Engagement für die Wissenschaft“ gepaart mit „Kompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Pragmatismus“, hieß es.
Der zweite Platz ging an Armin Willingmann (SPD), Wissenschaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt. Dritte wurde die brandenburgische Ministerin Manja Schüle (SPD). 2.335 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben laut Hochschulverband an der Online-Umfrage vom 11. November bis 13. Dezember 2024 teilgenommen.
Universitäten vereinbaren gemeinsames Energiemanagement
Erfurt (epd). Thüringens Hochschulen planen ein einheitliches Energiemanagementsystem. Eine entsprechende Vereinbarung sei am 17. Februar zwischen dem Thüringer Wissenschaftsministerium, den Hochschulen des Landes und weiteren Partnern geschlossen worden, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Ziel sei die Verringerung von Emissionen an klimaschädlichem Kohlendioxid bis hin zur Klimaneutralität.
Bis Ende des kommenden Jahres soll laut Ministerium ein einheitliches Messsystem an den Hochschulen etabliert werden, das die Gebäudetechnik und den Energieverbrauch kontinuierlich kontrolliert und optimiert. So ließen sich durch Maßnahmen wie eine effizientere Einstellung der Heizungs- und Lüftungsanlagen oder den Einbau intelligenter Thermostatventile Einsparungen von durchschnittlich bis zu 20 Prozent erzielen.
Mit dem Thüringer Klimagesetz hat sich der Freistaat das Ziel gesetzt, die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Ihre neun Hochschulen spielen dabei eine zentrale Rolle. Allein im Jahr 2019 verursachten sie durch den Verbrauch von Wärme und Strom den Ausstoß von rund 21.800 Tonnen Kohlendioxid. Das entspreche dem Fünffachen der CO2-Emissionen aller kommunalen Gebäude einer Stadt wie Weimar, sagte der Behördensprecher.
Bis 2030 soll dieser Wert um über 12.000 Tonnen CO2 mehr als halbiert werden. Die größten Einsparpotenziale an den Hochschulen liegen laut Ministerium dabei in der Wärmeversorgung, gefolgt von Dienstreisen und dem Stromverbrauch. Für die verbleibenden Restemissionen will das Land einen Kompensationsbetrag zahlen.
Entwicklung & Umwelt
Untersuchungsausschuss bemängelt Versäumnisse beim Afghanistan-Abzug

epd-bild/Christian Ditsch
Berlin (epd). Eine fehlerhafte Lageeinschätzung, Uneinigkeit zwischen den Ministerien und zu viel Bürokratie beim Ortskräfteverfahren: Der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses Afghanistan, der am 18. Januar dem Bundestag übergeben wurde, zeigt viele Versäumnisse der Bundesregierung beim Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan auf. Trotz unterschiedlicher Perspektiven der Fraktionen sei man mit Ausnahme der AfD-Fraktion zu gemeinsamen Ergebnissen gekommen, sagte der Ausschussvorsitzende Ralf Stegner (SPD).
Der Abzug der Bundeswehr nach dem rund 20-jährigen Einsatz ist laut Stegner trotz lang andauernder Unklarheit über den genauen Zeitpunkt „geordnet“ verlaufen. Während der Evakuierungsmission zwischen dem 16. und dem 27. August 2021 hatte die Bundeswehr insgesamt 5.347 Personen aus 45 Nationen aus Kabul ausgeflogen. Allerdings hat Stegner zufolge während der sich verschärfenden Krise eine gemeinsame Lageanalyse der beteiligten Ressorts der Bundesregierung gefehlt. Zwar hatte der Bundesnachrichtendienst die Lage in Afghanistan korrekt eingeschätzt, aber nicht die Geschwindigkeit, mit der die Taliban das Land zurückeroberten.
Kritik am Umgang mit afghanischen Ortskräften
Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Erndl (CSU) hält es deshalb für notwendig, künftig auch mögliche andere Szenarien auszuarbeiten, damit alle Beteiligten besser vorbereitet sind. Ebenso wie die FDP-Fraktion fordert die Unions-Fraktion einen nationalen Sicherheitsrat, der die einzelnen Lagebilder zusammenfasst und eine Richtung vorgibt. Die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni sieht das Problem woanders: Es habe nicht an Foren für einen Austausch gefehlt, vielmehr habe es „ganz massiv an politischer Führung gemangelt“.
Der Abschlussbericht kritisiert außerdem den Umgang mit den afghanischen Ortskräften. So ist es nach Einschätzung der SPD-Fraktion den Ressorts nicht gelungen, frühzeitig angemessene Verfahren und Notfallpläne für die lokalen Kräfte zu entwickeln, die für die Bundeswehr und andere deutsche Institutionen gearbeitet hatten. Nach Ende der Luftbrücke im August 2021 blieben Tausende zurück oder konnten erst zu einem späteren Zeitpunkt ausreisen.
Zwischen Sicherheitsinteressen und Fürsorgepflicht
Zudem habe es damals vor allem im Innenministerium Abwägungen zwischen Sicherheitsinteressen und der Fürsorgepflicht gegeben, die Stegner zufolge „zu bürokratisch“ ausgefallen sind. Endl hingegen verteidigte das damalige Bestehen des Innenministeriums auf eine individuelle Sicherheitsüberprüfung. Diese habe sich auch im Nachhinein als richtig bewiesen.
Der am 13. Februar beschlossene, rund 1.400 Seiten umfassende Bericht enthält neben einem gemeinsamen Verfahrens- und Feststellungsteil fünf Fraktionsvoten anstelle eines üblichen gemeinsamen Bewertungsteils. Abgesehen vom Votum der AfD-Fraktion enthalten die übrigen Voten in den Kernaussagen ähnliche Schlussfolgerungen.
Der im Juli 2022 eingesetzte Untersuchungsausschuss sollte die Umstände des Bundeswehr-Abzugs aus Afghanistan und der militärischen Evakuierungsaktion aus Kabul im August 2021 aufklären. Die radikalislamischen Taliban hatten damals nach dem Abzug der internationalen Truppen überraschend schnell die Hauptstadt zurückerobert. Der Untersuchungsausschuss vernahm insgesamt 111 Zeuginnen und Zeugen, darunter Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihren Nachfolger Olaf Scholz (SPD), der im Sommer 2021 Vizekanzler und Finanzminister war.
Mit der Bratsche aus dem Armenviertel

epd-bild/Birte Mensing
Nairobi (epd). Aus den offenen Fenstern schallen Trompetenmelodien, im Hof sitzt eine Geigenschülerin mit ihrem Lehrer - und unter einem Vordach haben zwei Posaunistinnen Platz genommen: Jedes Wochenende wird aus der katholischen St.-John-Schule im Slum Korogocho in Nairobi eine Musikschule. Im hintersten Gebäude, in dem Klassenzimmer, das der größten Müllhalde der kenianischen Hauptstadt am nächsten ist, packt Dennis Ngige seine Bratsche aus. „Bratsche spielen bringt mich in eine andere Welt“, sagt er: „Musik ist friedlich.“
Der 23-Jährige begrüßt seine drei Schüler, die heute zum Unterricht gekommen sind. Seit sieben Jahren ist Ngige jeden Samstag und Sonntag mit dem Programm „Ghetto Classics“ hier. Als Jugendlicher kam er, um Musik zu lernen. Heute unterrichtet er die Jungen und Mädchen aus Korogocho. „Im Slum aufzuwachsen bedeutet, Drogen, Bandenkriminalität ausgesetzt zu sein. Das hier war mein Entkommen“, sagt der Musiker. Sein Vater hat lange auf der Müllhalde gearbeitet, das Müllsortieren sichert Tausenden Familien in Nairobi das Überleben.
Geld mit Privatstunden verdient
Etwa die Hälfte der fünf Millionen Einwohnerinnen und Einwohner Nairobis lebt in Slums, Korogocho ist einer davon. 200.000 Menschen sind hier beheimatet, auf eineinhalb Quadratkilometern. In den dicht besiedelten Stadtteilen gibt es keine offizielle Wasser- oder Stromversorgung. Vieles ist improvisiert. Staatliche Sozialprogramme gibt es kaum.
Die Strukturen, die Menschen arm halten, sind schwer zu ändern. Doch „Ghetto Classics“ bringt junge Menschen aus Korogocho an Orte und in Kreise, die ihnen traditionell verwehrt wurden.
So war es auch bei Ngige. 2017 hatte er mit Blockflöte angefangen, eigentlich wollte er Geige spielen, wie sein Bruder. Dann bekam er eine Bratsche in die Hand und verliebte sich in ihren warmen Klang. Seitdem hat er im Nationalen Jugendorchester gespielt und im „Nairobi Orchestra“, dem ältesten und größten Orchester in Kenia. Mit dem Unterricht für „Ghetto Classics“ verdient er nun ein wenig Geld, ebenso wie mit Privatstunden bei Familien in wohlhabenderen Vierteln. Außerdem hat er regelmäßig Auftritte mit seinen Kollegen vom Streichquartett, die auch alle aus Korogocho kommen.
Wachsende Musikindustrie
„Ghetto Classics“ sei Teil und Katalysator der wachsenden Musikindustrie in Kenia, sagt Eric Ochieng, der das Musikprogramm in Korogocho leitet. Mittlerweile hat „Ghetto Classics“ auch Ableger im Slum Mukuru kwa Reuben und in der kenianischen Küstenstadt Mombasa. Ein Orchesterprogramm für öffentliche Schulen gibt es ebenfalls. Mehr als 1.000 Kinder erreichen sie damit aktuell.
Die Instrumente werden von Unterstützerinnen und Unterstützern aus aller Welt gestiftet und in den Räumlichkeiten des Programms aufbewahrt. Nur wer schon lange dabei ist, darf auch mal eins mit nach Hause nehmen. Ngiges Bratsche ist eine Dauerleihgabe vom deutschen Cellisten Thomas Tüschen, der mit seinem Ensemble Medici das Projekt schon seit vielen Jahren fördert.
Jeden Tag übt Ngige, um sich an Universitäten im Ausland für ein Musikstudium zu bewerben. Manch ein „Ghetto Classics“-Schüler hat es geschafft und ein Stipendium bekommen. Lameck Otieno etwa studiert jetzt in den USA Bratsche und Architektur, die Perkussionistin Charity Faith studiert in Polen, der Pianist Teddy Otieno in Großbritannien.
Traum von der großen Bühne
Getragen wird „Ghetto Classics“ von der kenianischen Stiftung „Art of Music Foundation“. Deren Gründerin Elisabeth Njoroge hat das Programm gemeinsam mit Levi Wataka ins Leben gerufen, dem Dirigenten des „Nairobi Orchestra“. Für ihn zeigt „Ghetto Classics“, dass man durch kollektive Anstrengungen nachhaltige Strukturen schaffen kann. „Die Kraft der Musik besteht darin, dass Menschen sie gemeinsam spielen oder einander zuhören müssen“, sagt Wataka, der viele Jahre das Nationale Jugendorchester geleitet hat.
Dennis Ngige sagt, die Musik habe ihn gelehrt, kritisch zu denken und zu hinterfragen, warum die Gesellschaft ungerecht ist. Das Musizieren hat ihn für Auftritte schon nach Tansania gebracht, ebenso wie nach Uganda und an viele Orte in Kenia. Doch heute spielt er mit seinem 15-jährigen Schüler Justus Nzomo „Hänschen klein“. Das Zusammenspiel mit anderen mache ihm Spaß, sagte Nzomo - und er ist froh über den Zugang zu Instrumenten, die sonst für ihn unerreichbar sind.
Mit anderen Schülern übt Ngige schon Stücke von Johann Sebastian Bach. Gemeinsam träumen sie von einer Musikkarriere, die sie aus dem Klassenzimmer neben der Müllhalde auf große Bühnen bringt.
Sahel-Militärs entdecken die Kultur

epd-bild/Martina Zimmermann
Ségou (epd). Der Fluss Niger glitzert silberfarben in der Sonne. In der Ferne fährt eine Piroge mit Fischern vorbei. Ein paar Meter vom Ufer entfernt ist auf dem Wasser eine riesige Bühne aufgebaut. Der Auftakt zum 21. Ségou'Art-Festival Anfang Februar ist hochoffiziell: Zwanzig Minister aus Mali, Niger und Burkina Faso sind dabei. Trommler und Tänzer wirbeln mit ihren akrobatischen Vorführungen Staub auf.
Das traditionelle Festival in Malis viertgrößter Stadt Ségou steht im Zeichen politischer Umwälzungen. Die Schirmherrschaft hat General Assimi Goïta übernommen, der seit 2020 Chef einer Übergangsregierung ist. Er hat 2025 zum „Jahr der Kultur“ ausgerufen. Im Rahmen des Festivals unterzeichneten die Sahelstaaten Mali, Niger und Burkina Faso ein Kulturabkommen.
„Gleiche Geschichte und gleiche Kultur“
In allen drei Ländern haben sich in den vergangenen Jahren Militärs an die Macht geputscht. Im Sommer 2023 gründeten die Staaten die Sahelallianz, ein Verteidigungsbündnis. Nun werde die Allianz auf die Kultur ausgeweitet, erklärt Malis Außenminister Abdoulaye Diop in Ségou: „Unsere Länder teilen die gleiche Geschichte und die gleiche Kultur.“ Es sei sehr wichtig, dass „unsere Völker ihre Identität kennen“.
So ist das Ségou'Art Festival der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Kulturveranstaltungen im Sahelraum. Als nächstes Event steht ab 22. Februar das Filmfestival Fespaco in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou an.
Bis heute warnt das Auswärtige Amt vor Reisen nach Mali. Doch sei die Lage in den letzten Monaten besser geworden, behaupten die Malier, die aus allen Landesteilen nach Ségou gekommen sind. Schätzungsweise 40.000 Besucher bummeln während des einwöchigen Festivals durch die Stadt. Kinder verkaufen Luftballons, Frauen bieten Bananen an, Männer tragen Waren durch die Gegend. Niemand stört sich an den Soldaten in Tarnkleidung, die überall mit Maschinenpistolen positioniert sind. Einige tragen olivfarbene Masken, die nur die Augen freilassen.
Auch politische Botschaften im Sinn der Machthaber
Der Designer Mamadou Fofana schlendert in einer traditionellen, braun-gemusterten Baumwollhose und einem hellen Hemd Richtung Festival. Er zeigt sich zufrieden mit den politischen Verhältnissen. „Wenn ein Teil des Landes brennt, leidet das ganze Volk“, erinnert der 27-Jährige an unruhigere Zeiten: „In manchen Jahren konnte das Festival nicht auf dem Nigerfluss stattfinden wie heute.“ Die Militärs hatten ihren Staatsstreich auch damit begründet, dass die gewählten Regierungen die Sicherheitslage nicht verbessert hätten.
Die auf dem Festival ausgestellten Kunstwerke verbreiten zum Teil politische Botschaften im Sinn der Militärregierung. In der „Halle der Sahelstaaten“ etwa geht es um das Thema „Frieden“. Abdul Rasmane Ouedraogo aus Burkina Faso ist Maler und Gendarm, er posiert in Uniform vor seinen Gemälden. Eines seiner Werke trägt den Titel „Tag des Sieges für die Sahel-Allianz“. Es zeigt einen Soldaten, der die Finger zum Victory-Zeichen hebt - in der einen Hand die Waffe, in der anderen eine Fahne der „Vereinten Sahelstaaten“: „Das zeigt, dass der Krieg mit einem Sieg beendet wurde“, sagt der Künstler mit Blick auf die vergangenen Jahre, die von Kämpfen zwischen Tuareg-Rebellen, Dschihadisten und Armeen bestimmt waren.
Kaum Kritik an politischer Instrumentalisierung
Aber in den 100 Ausstellungssälen sind auch internationale Größen der zeitgenössischen afrikanischen Kunst präsent, etwa Abdoulaye Konate aus Mali und Barthélémy Toguo aus Kamerun. Es sei kein Festival der „Forderungen der Sahelallianz“, betont Toguo: „Dieses Fest soll den Afrikanern verständlich machen, dass ihre Kultur gleichwertig ist mit denen der anderen Völker dieser Welt.“
Gegründet und 20 Jahre lang geleitet hat das Festival der heutige malische Kulturminister Mamou Daffé, der auf den Veranstaltungen wie ein Rockstar empfangen wird. „Unsere Aufgabe ist es, Gelegenheiten zu schaffen, auf denen sich die Bevölkerung austauschen kann“, sagt Daffé: „Kultur schafft Sinn, Wohlstand und Entwicklung.“
Die Schirmherrschaft der von russischen Söldnern unterstützten Militärregierung stellt für die Festival-Teilnehmer offensichtlich kein Problem dar: Die politische Instrumentalisierung der Kultur stößt kaum auf Kritik.
Der Sahel-Experte Ulf Laessing von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung empfiehlt einen differenzierten Blick: Man dürfe die kulturpatriotische Rhetorik „nicht überbewerten“. „Die Regierungen profitieren von antifranzösischen Ressentiments in ganz Westafrika“, sagt er in Bezug auf die frühere Kolonialmacht Frankreich, die an Einfluss verliert. Die aktuellen Machthaber „profilieren sich mit dem neuen Bündnis als neue Kraft in Afrika, in der Tradition der Panafrikanisten.“ Politischer Überschwang gehöre bei jedem Festival dazu.
"Die Stimmen befreien"
Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit, hat die Berliner Humboldt-Universität mehrere hundert historische Tonaufnahmen Kriegsgefangener aus dem Ersten Weltkrieg an Tunesien übergeben. Das Projekt ist für viele Beteiligte eine Premiere.
Tunis (epd). Mounir Hentati hatte Gänsehaut, als er die Aufnahmen zum ersten Mal hörte. So schildert der damalige Leiter des in Tunis ansässigen Zentrums für arabische und mediterrane Musik (CMAM) seine Eindrücke von vor 25 Jahren. Bei einer Veranstaltung des Phonogramm-Archivs in Berlin kam er erstmals in Kontakt mit Tonaufnahmen, auf denen tunesische Zwangsrekruten sprechen und singen. Sie hatten im Ersten Weltkrieg für die französische Kolonialmacht gekämpft und waren in Brandenburg interniert.
„Das hat mich nicht nur sehr bewegt, sondern natürlich auch mein Forscher-Interesse geweckt“, sagt Hentati. Doch damals sei die Zeit noch nicht reif gewesen. Erst nach dem politischen Umbruch in Tunesien 2011 kam Bewegung in die Angelegenheit.
Wissenschaftler machten Aufnahme in brandenburgischem Lager
Jetzt wurden 445 digitalisierte Tonaufnahmen des Lautarchivs des Helmholtz-Zentrums für Kulturtechnik von der Berliner Humboldt-Universität an die Phonothek des CMAM übergeben. Zu hören sind Lieder, Geschichten und Gedichte von Gefangenen aus Nord- und Westafrika. Die Texte und Gesänge wurden während des Ersten Weltkriegs im sogenannten Halbmondlager Wünsdorf-Zossen (Brandenburg) aufgenommen.
In dem Lager waren muslimische Kriegsgefangene aus den französischen und britischen Kolonien interniert. Sie sollten überzeugt werden, zu desertieren, sich den Armeen des Kaiserreichs und des damals mit Deutschland verbündeten Osmanischen Reichs anzuschließen. Der Sprachwissenschaftler Wilhelm Doegen sammelte dort Tonaufnahmen, um die Sprachen zu katalogisieren. Diese mehr als 3.000 Aufnahmen bildeten den Grundstock des Lautarchivs.
Die Gefangenen wurden „mehr oder weniger vor den Trichter gezwungen, hatten gar keine Wahl”, erklärt Michael Willenbücher vom Lautarchiv. Damals “stand der Inhalt der Aufnahme und die Subjektivität der Aufgenommenen gar nicht im Vordergrund". Was sie sagten, wurde erst viel später transkribiert und übersetzt.
Versteckte Botschaften
Viele hätten versucht, versteckte Botschaften in den Aufnahmen unterzubringen, erläutert die Kulturhistorikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Projekts, Alia Mossalem. „Ihnen wurde zum Beispiel aufgetragen, ein Volksmärchen zu erzählen, und dann haben sie einige Elemente geändert, um über ihre eigene Situation als Kriegsgefangene zu sprechen.“
Für viele Beteiligte ist das Projekt „Towards Sonic Resocialization“ zum Umgang mit kolonialem Erbe in Klangarchiven eine Premiere. So auch für den Geldgeber, das Zentrum Deutsche Kulturgutverluste (ZDK), das sich sonst in erster Linie mit Rückgabe entzogenen Kulturguts aus jüdischem Besitz beschäftigt. Es ist das erste Mal, dass Tonaufnahmen und keine Objekte im Mittelpunkt der Restitution stehen.
Doch an wen man diese überhaupt zurückgeben kann, war auch für die Forschenden eine schwierige Frage. „Es sind mehr als nur Objekte. Es sind Geschichten von Menschen. Von Menschen, deren Großeltern in den Krieg zogen und nie zurückkamen“, sagt Kulturhistorikerin Mossalem. „Das ist eine Familiengeschichte, die weggenommen wurde, die Geschichte eines ganzen Landes.“ Deshalb sei es umso wichtiger, die Stimmen zu befreien.
„Koloniales Verhältnis brechen“
Die Wahl sei auf Tunis als Kooperationspartner gefallen, weil dort der Zugang für Betroffene und Interessierte am einfachsten sei. Die Phonothek verfügt nun über uneingeschränkte Nutzungsrechte und kann die Aufnahmen und die dazugehörige Dokumentation Forschenden, Kunstschaffenden und der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.
Michael Willenbücher vom Lautarchiv der Humboldt-Uni betont, die Autonomie über die Daten sei ihm sehr wichtig. „Wir wollen damit das koloniale Verhältnis brechen. Wir stellen die Daten zur Verfügung, damit die Kooperationspartner freie Hand haben, damit zu arbeiten, wie sie das für richtig halten.“ Neben Tunesien arbeitet das Projekt mit Institutionen im Senegal und auf Madagaskar zusammen.
Mounir Hentati, der im Ruhestand weiter als Berater für das Musikzentrum CMAM arbeitet, hofft, dass dieses Projekt nur der Anfang ist. Tunesien müsse sich einem wenig beachteten Kapitel seiner Geschichte widmen, ebenso die ehemaligen Kolonialherren.
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wegen Putschversuchs angeklagt
Berlin/São Paulo (epd). Brasiliens Generalstaatsanwaltschaft hat den rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro wegen versuchten Staatsstreichs angeklagt. Sie wirft dem 69-Jährigen vor, nach seiner Abwahl im Oktober 2022 mit Verbündeten einen Putsch gegen seinen Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva geplant zu haben, wie die Tageszeitung „Folha de São Paulo“ am 18. Februar berichtete. Neben Bolsonaro sind 33 weitere Personen angeklagt, darunter ehemalige Kabinettsmitglieder und hochrangige Militärs.
Die Staatsanwaltschaft folgt mit ihrer Anklage einer Empfehlung der Bundespolizei, die seit zwei Jahren umfassend ermittelt hatte. Die Ermittler werfen Bolsonaro die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor, mit der der Staatsstreich ausgeführt werden sollte. Bolsonaro hat bis heute seine Wahlniederlage gegen den Linkspolitiker Lula nicht anerkannt.
Höchststrafe 43 Jahre Haft
Wenn das Gericht die Vorwürfe als ausreichend anerkennt, kommt es zu einer Anklage gegen Bolsonaro. Die Höchststrafe beläuft sich laut „Folha de São Paulo“ auf 43 Jahre Haft. Darüber hinaus könnte Bolsonaro lebenslang von politischen Ämtern ausgeschlossen werden. Aktuell darf er für die Dauer von acht Jahren für kein politisches Amt kandidieren.
Hintergrund der Ermittlungen sind Ausschreitungen am 8. Januar 2023, als Bolsonaro-Anhänger den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in Brasília stürmten und zum Teil verwüsteten.
Generalstaatsanwalt Paulo Gonet wirft dem Ex-Präsidenten vor, die kriminelle Vereinigung zusammen mit Ex-Verteidigungsminister Walter Souza Braga Netto angeführt zu haben. Beide akzeptierten, ermutigten und führten Handlungen aus, die einen Angriff auf den demokratischen Rechtsstaat darstellten, wie es in der Anklageschrift heißt. Bolsonaro weist die Vorwürfe zurück.
Lula sollte vergiftet werden
Zu den Plänen der Gruppe gehörte es laut Staatsanwaltschaft auch, Lula zu vergiften und den Richter des Obersten Gerichtshofs, Alexandre de Moraes, zu erschießen. Bolsonaro habe von der Ausarbeitung des Plans gewusst und ihm sogar zugestimmt, schreibt die Staatsanwaltschaft.
Unter den Angeklagten sind 23 hochrangige Militärs sowie unter anderem Ex-Justizminister Anderson Torres und der ehemalige Chef des Kabinetts für institutionelle Sicherheit, Augusto Heleno. Ex-Verteidigungsminister Braga Netto wurde bereits im Dezember festgenommen. Er soll die treibende Kraft hinter der Putschplanung gewesen sein
US-Regierung treibt Schließung von Entwicklungsbehörde voran
Washington (epd). Die von Präsident Donald Trump betriebene Zerschlagung der US-Entwicklungsbehörde USAID schreitet voran. Bis auf wenige Beschäftigte würden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beurlaubt, teilte USAID am 23. Februar mit. Ausgenommen seien nur Beschäftigte auf Schlüsselpositionen. Zugleich würden rund 1.600 Menschen in den USA entlassen.
Die Mitteilung erfolgte zwei Tage, nachdem ein Richter in Washington eine Gewerkschaftsklage gegen die Beurlaubungen zurückgewiesen hatte. Zahlreiche Hilfsprogramme wurden seit Trumps Amtsantritt im Januar bereits eingestellt. Der Präsident und sein Berater Elon Musk haben die Arbeit von USAID grundsätzlich infrage gestellt.
Studie: Einfluss des Klimas auf Wasserhaushalt wenig bekannt
Dürre, Überschwemmungen, umgekippte Seen: Deutschland hat nach Ansicht von Klimaforschern eine Wasserkrise. Allerdings stehen die Wissenschaftler offenbar noch oft allein mit diesem Wissen, wie eine Umfrage zeigt.
Berlin (epd). Die Deutschen wissen einer Studie zufolge zu wenig über den Einfluss des Klimawandels auf die Verfügbarkeit von Wasser. Das ist das Ergebnis der Analyse „Was denkt Deutschland über Wasser“, die am 18. Februar in Berlin vorgestellt wurde. Achim Spiller von der Universität Göttingen sprach als einer der Studienautoren von „gesellschaftlicher Wasserblindheit“.
Einerseits bestehe große Wertschätzung für und Sorge um Wasser. So gaben 87,1 Prozent der Befragten in der Studie an, die Gesellschaft achte zu wenig oder eher zu wenig auf das Wasser. Zugleich fehle aber das Wissen um die Effekte des Klimawandels wie Dürren und Hochwasser, sagte Spiller. Wasser steht demnach auf der Liste der wichtigen Themen bei den Menschen auf Rang sechs, hinter den Themen Wirtschaftskrise, Klimawandel, Migration, Kriege und Energiekrise.
Auch die realistische Einschätzung des eigenen Wasserverbrauchs falle den Menschen schwer. Relativ einfache, Geld sparende Wassermaßnahmen wie die Nutzung von Sparknöpfen bei Spül- und Waschmaschinen würden von fast der Hälfte nicht genutzt. Nur etwa 20 Prozent, vornehmlich Frauen, dächten, dass Wasser ernsthaft knapp ist.
Für die repräsentative Studie wurden im Sommer vergangenen Jahres im Auftrag der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung 1.019 Bürger ab 16 Jahren befragt. Demnach sieht knapp die Hälfte (47 Prozent) den Klimawandel als Bedrohung für die Wasserversorgung in Deutschland. Zehn Prozent davon rechnen mit einer sehr starken Gefährdung. Fast vier von zehn Befragten seien sich über das Ausmaß der Gefährdung unsicher.
Dieter Gerten vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erklärte bei der Vorstellung der Studienergebnisse, es gebe in Deutschland bei den Niederschlagsmengen beträchtliche regionale Schwankungen. Die Tendenz gehe aber zu mehr Dürren und Starkregenereignissen.
Anna Brehm, Nachhaltigkeitsreferentin der Heinrich-Böll-Stiftung, plädierte für eine bessere Wissenschaftskommunikation und mehr politische Bildung. Seit 2021 sei fast jedes Jahr ein Hochwasserjahr gewesen. Auch die vorangegangenen Dürrejahre 2018 bis 2020 seien vielen noch lebhaft in Erinnerung. Daher würden laut Studie Schutz- und Präventionsmaßnahmen sehr breit unterstützt: „Das ist ein Politikfenster, das wir nutzen müssen für politische Lösungen.“ Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass das Konzept eines sogenannten „Wasserfußabdrucks“, der den Wasserverbrauch des eigenen Lebensstils abbildet, weitgehend unbekannt ist.
Laut Studie ist die Wasserthematik als Krisenthema relativ neu. In den Ergebnissen spiegelten sich daher noch Unsicherheiten und ungefestigte, spontane Meinungen. Dies zeige sich etwa in der fehlenden Gewichtung, welche der drei Probleme Hochwasser, Dürre und Wasserverschmutzung am dringlichsten anzugehen sind. Ein Grund dafür ist möglicherweise, dass der Großteil der Bevölkerung in Deutschland bisher selbst nicht stark mit Wasserproblemen konfrontiert war, so die Studie. Die meisten Betroffenen mit einem Anteil von zwölf Prozent habe es beim Hochwasser gegeben.
Umweltbundesamt: Deutschland hat erstmals alle Grenzwerte eingehalten
Dessau-Roßlau (epd). Im vergangenen Jahr hat Deutschland erstmals alle Grenzwerte zur Luftreinhaltung eingehalten. Wie das Umweltbundesamt (UBA) am 20. Februar in Dessau-Roßlau mitteilte, war 2024 das erste Jahr, in dem die europäische Luftqualitätsrichtlinie voll erfüllt wurde. Dies zeige eine vorläufige Auswertung der Messdaten der Bundesländer und des Umweltbundesamtes von bislang rund 600 Messstationen.
Für Stickstoffdioxid (NO2) wurde den Angaben zufolge der Jahresmittelgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erstmals an allen Messpunkten nicht überschritten. Beim Feinstaub habe Deutschland bereits das siebte Mal in Folge die Schwellenwerte eingehalten.
UBA-Präsident Dirk Messner sagte, diese Entwicklung sei kein Selbstläufer, sondern Ergebnis gezielter Maßnahmen zur Luftreinhaltung. Insbesondere Partikelfilter in Autos und schärfere Abgasnormen hätten einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von Emissionen geleistet. Hinzu kämen weitere Maßnahmen wie die Elektrifizierung von Bussen oder das Vermeiden von Verkehrstaus.
Dennoch bedürfe es weiterer Anstrengungen, betonte Messner. Die geltenden Grenzwerte seien mehr als 20 Jahre alt und entsprächen nicht mehr aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfehle deutlich niedrigere Richtwerte.
Zudem sei Ende 2024 die überarbeitete europäische Luftqualitätsrichtlinie in Kraft getreten. Mit dieser werden laut Messner ab dem Jahr 2030 strengere Grenz- und Zielwerte europaweit bindend. Langfristig sollen sie komplett an die WHO-Grenzwerte angepasst werden, hieß es.
Umwelthilfe: Mehr Städte heben Parkgebühren an
Berlin (epd). Die Parkgebühren für Anwohner sind nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe in den vergangenen drei Jahren in vielen deutschen Städten gestiegen. Wie die Organisation unter Berufung auf eine eigene Abfrage am 22. Februar mitteilte, haben seit der letzten Erhebung im Jahr 2022 insgesamt 41 Städte die Gebühren angehoben. Am teuersten ist demnach das Anwohnerparken in Bonn mit 360 Euro pro Jahr, am günstigsten in Berlin, wo ein Anwohnerparkausweis nur 10,20 Euro pro Jahr kostet.
Die Umwelthilfe findet die Parkgebühren in deutschen Städten im Durchschnitt nicht hoch genug. 66 Städte verlangten maximal 31 Euro pro Jahr, hieß es. Viele Städte verschleuderten öffentlichen Raum zu Billigpreisen, erklärte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Die Umweltschutzorganisation fordert eine Mindestparkgebühr in Höhe von 360 Euro pro Jahr sowie zusätzliche höhere Gebühren für große SUV und andere besonders große Fahrzeuge. Die Einnahmen sollen in den Ausbau von Bus und Bahn sowie Rad- und Gehwegen fließen, fordert die Umwelthilfe.
Nach Bonn erheben der Umwelthilfe zufolge Tübingen, Münster, Koblenz, Freiburg, Kaiserslautern, Trier und Ulm die höchsten Anwohnerparkgebühren. Für weniger als 20 Euro im Jahr kann man in Teilen von Bremerhaven und Weißenfels das Auto abstellen. Für die Erhebung wurden den Angaben zufolge die Gebühren in 107 deutschen Städten erfragt, darunter alle Großstädte sowie mindestens die fünf größten Städte eines Bundeslands.
Studie: Milliardäre sind die größten Klimaverschmutzer
Berlin (epd). Ein Milliardär in Deutschland verursacht laut einer Studie in fünf Minuten so viele klimaschädliche Emissionen wie ein Durchschnittsbürger im ganzen Jahr. Die 30 reichsten Deutschen waren im Jahr 2023 für rund 23 Millionen Tonnen Kohlendioxid verantwortlich, wie aus der am 19. Februar in Berlin veröffentlichten Analyse hervorgeht, die von der Klima-Allianz Deutschland in Auftrag gegeben wurde. Das entspreche etwa den jährlichen Emissionen der Tierhaltung in Deutschland.
Die Studie wurde von DIW Econ, der Consulting-Agentur des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, erstellt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten neben den Mobilitätsemissionen von Superreichen, beispielsweise durch Privatjet-Flüge, auch den CO2-Fußabdruck ihrer unternehmerischen Aktivität.
Der Untersuchung zufolge gehen rund 99 Prozent der Emissionen der Superreichen auf deren Unternehmensbesitz zurück. Die Emissionen von Yachten und Privatjets der Superreichen überstiegen mit 378 Tonnen pro Milliardärin oder Milliardär die durchschnittlichen Pro-Kopf-Mobilitätsemissionen um ein Vielfaches. „Um diese Menge zu emittieren, müsste ein typischer Familien-Pkw über 3 Millionen Kilometer fahren, was rund 75 Erdumrundungen entspricht“, heißt es in der Studie.
Die politische Geschäftsführerin der Klima-Allianz, Stefanie Langkamp, kritisierte die Belastung von Menschen mit wenig Geld etwa über CO2-Abgaben und Steuern, „während Milliardäre mit ihren Investitionen in fossile Industrien die Klimakrise weiter verschärfen“.
Nationaltheater Weimar unterstützt Moorsanierung auf Rügen
Weimar (epd). Das Deutsche Nationaltheater (DNT) und die Staatskapelle Weimar haben eine finanzielle Patenschaft für die geplante Wiedervernässung eines Moores auf der Insel Rügen übernommen. Das Ökosponsoring solle die Kohlendioxid-Emissionen ausgleichen, die sich derzeit im Kulturbetrieb nicht vermeiden ließen, teilte das Theater am 18. Februar in Weimar mit. Die Sanierung des Moor-Biotops trage zudem dazu bei, während der kommenden 30 Jahre rund 300 Tonnen des schädlichen Treibhausgases einzusparen.
Bei dem Moor handelt es sich den Angaben zufolge um den Erlenbruch „Sagarder Bach“ im Nationalpark Jasmund. Das 0,4 Hektar kleine Kesselmoor könne nach erfolgter Wiedervernässung jährlich etwa zehn Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden.
Das finanzielle Engagement des DNT stellt laut dem Klimaschutz-Ministerium Mecklenburg-Vorpommern sicher, dass das Moor für mindestens 30 Jahre in einen guten ökologischen Zustand gebracht wird. Zugleich schaffe das Theater einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche gefährdete Arten.
Das Sponsoring-Projekt in einer Gesamthöhe von 5.000 Euro ist für das Theater laut deren Geschäftsführerin Sabine Rühl das erste seiner Art. Weitere könnten folgen. Bei der Wahl des konkreten Projekts habe die Überlegung im Vordergrund gestanden, auf welche Weise die verursachten Treibhausgasemissionen infolge von Gastspielaktivitäten ihres Hauses ausgeglichen werden können. Die Wahl auf ein Moor sei aufgrund der herausragenden Rolle dieser Biotope als effiziente Kohlenstoffspeicher gefallen, sagte Rühl.
Brandenburg plant weitere Hochwasserschutz-Maßnahmen
Potsdam (epd). Seit der verheerenden Oderflut von 1997 sind in Brandenburg fast 900 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert worden. Im vergangenen Jahr seien dafür rund 26 Millionen Euro eingesetzt worden, teilte das Umweltministerium am 19. Februar in Potsdam mit. 2025 seien Investitionen in ähnlicher Größenordnung geplant. Vorgesehen seien unter anderem verschiedene Maßnahmen an der Elbe in der Prignitz, an der Schwarzen Elster in Herzberg und der Lausitzer Neiße in Guben.
Dass Brandenburg 2024 von mehreren Hochwasserereignissen betroffen war, zeige, dass Schutzmaßnahmen trotz der klimabedingt vermehrt auftretenden Trockenphasen weiter vorangebracht werden müssten, hieß es. Eine Vielzahl weiterer Vorhaben befinde sich derzeit in der Planung. Dazu gehörten neben reinen Deichbaumaßnahmen auch Planungen für Deichrückverlegungen.
Zusätzlich würden jährlich rund neun Millionen Euro für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen ausgegeben, hieß es weiter. Darunter seien knapp zwei Millionen Euro pro Jahr, die zur Vorbeugung und Beseitigung von Wühltierschäden an Deichen und Gewässern eingesetzt würden.
Die Zunahme und Verbreitung der Tiere führe zu gehäuften Schäden an Deichen und Uferböschungen, betonte das Ministerium. Deshalb seien auch sogenannte Entnahmen von Bisam und Nutria an Deichen und anderen wasserwirtschaftlichen Anlagen durch Tötung der Tiere weiter erforderlich. Im Jagdjahr 2023/2024 seien der Streckenstatistik der obersten Jagdbehörde zufolge insgesamt 256 Bisam und 4.821 Nutria entnommen und getötet worden.
Vier sächsische Wölfe mit Sender unterwegs
Dresden (epd). Vier Wölfe in Sachsen senden derzeit Daten zur wissenschaftlichen Auswertung. Es handele sich um eine Fähe und einen Rüden des Rudels Daubitz II sowie deren gemeinsame Tochter aus dem Wurf im Jahr 2023, teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am 20. Februar in Dresden mit. Der vierte Wolf, der mit einem Senderhalsband ausgestattet wurde, sei ein Rüde des neuen Rudels Weißkeißel. Alle vier Tiere senden damit ihre Daten aus dem nördlichen Landkreis Görlitz.
Dass zeitgleich drei Wölfe aus einem Rudel besendert werden konnten, sei bisher einmalig in Sachsen, hieß es. Die Senderdaten liefern Informationen zu Dynamiken in den Wolfsrudeln. Die Radiotelemetrie ist eine in der Wildtierforschung übliche wissenschaftliche Methode zur Gewinnung von Erkenntnissen über Raumnutzungsmuster sowie über die räumliche Ausbreitung und Lebensweise frei lebender Tiere. Unter Betäubung wird den eingefangenen Tieren ein Halsbandsender angelegt.
Seit 2019 wurden laut Landesamt in Sachsen 17 Wölfe mit Sendern ausgestattet. Gründe für das Ausbleiben von Daten sind defekte oder verloren gegangene Halsbänder oder aber der Tod eines Tieres. In Sachsen sind laut Landesamt aktuell 43 Wolfs-Territorien nachgewiesen. Dabei handelt es sich um 37 Rudel und sechs Paare. Bevorzugte Lebensräume sind Ostsachsen und Nordsachsen.
Medien & Kultur
Jenseits von Fake News
Der wiedergewählte Donald Trump versetzt auch die Medien in Schockstarre. Direkte Drohungen des US-Präsidenten gegen einzelne Journalisten und Klagen sind an der Tagesordnung.
Washington (epd). Donald Trumps „Shock and Awe“-Politikstil, der Kritikern mit Dekreten im Rekordtempo den Boden unter den Füßen wegzieht und die Opposition lähmen soll, hat in den ersten Amtswochen des wiedergewählten US-Präsidenten auch die Medien gepackt. Mit Fox News und den sozialen Medien im Rücken weiß das Team um Trump, wie man die Branche vor sich hertreibt.
Redaktionen werden überwältigt mit Aufregern und Dekreten, von einem belächelten Erlass für eine nationale Strategie gegen Papierstrohhalme bis hin zu Verordnungen zum Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und zu Massenabschiebungen „Illegaler“.
„Flood The Zone“
Fehlinformationen überfluten die Landschaft. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, nannte die Verteilung von Kondomen im Wert von 50 Millionen Dollar im Gaza-Streifen als Beweis für Korruption bei der Entwicklungsbehörde USAID, der inzwischen die Auflösung droht. Und Trump behauptete, USAID habe „Fake News“-Medien Geld gegeben für positive Artikel über die Demokraten.
Sichtbare Solidarität der Medienunternehmen untereinander bleibt in dieser Gemengelage meist aus. Etwa, wenn Reporter der Associated Press (AP) vom Oval Office ausgeschlossen werden, weil die Nachrichtenagentur den Golf von Mexiko nicht „Golf von Amerika“ nennt.
Der rechtspopulistische Berater Steve Bannon, der während Trumps erster Amtszeit zeitweise als Chefstratege im Weißen Haus arbeitete, gilt als Urheber der Aussage, man müsse „die Zone überfluten“ („all we have to do is flood the zone“). Politiker sollten demnach so viel Unerhörtes und Aufregendes in die Welt setzen, dass der Journalismus nicht mitkommt. In einem Interview mit der Plattform „semafor.com“ äußerte sich Bannon Anfang Februar zufrieden. „Es hat funktioniert“, sagte er. „Die Medien sind in einer vollständigen, totalen Kernschmelze.“
Thema Inflation zurückgedrängt
Trump wird in der medialen Berichterstattung kaum zur Rechenschaft gezogen. Als tragendes Thema galt im Wahlkampf der Unmut über die steigenden Lebensmittelpreise. „Beginnend am Tag eins werden wir die Inflation stoppen“, versprach Trump. Das ist nicht passiert. Die „New York Times“ erläuterte nun, Trump habe seinen Ton zum Thema Inflation „gemäßigt“. Und Vizepräsident J.D. Vance darf beim TV-Sender CBS beschwichtigen, Rom sei auch nicht an einem Tag erbaut worden.
Mitunter droht Trump Journalisten direkt. Der „Washington Post“-Kolumnist Eugene Robinson müsse „umgehend entlassen“ werden, forderte er auf seiner Plattform Truth Social. Robinson hatte kritisch über Trump und Musk berichtet.
Auch Klagen gehören zum Repertoire des US-Präsidenten. Von CBS verlangt er 20 Milliarden Dollar Schadenersatz, weil die Sendung „60 Minutes“ während des Wahlkampfs ein Interview mit der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris so geschnitten habe, dass sie in einem positiveren Licht erscheine. Der Facebook-Konzern Meta und der TV-Sender ABC brachten Trump bereits erfolgreich mit Geldzahlungen dazu, Klagen beizulegen.
Streit bei der „Washington Post“
Der von Trump ernannte Chef der Kommunikationsbehörde FCC, Brendan Carr, setzt unter anderem das nicht-kommerzielle Hörfunknetzwerk NPR unter Druck, über das sich republikanische Politiker seit Jahren beschweren. Die Sender werden mit Spenden, Regierungsgeldern und Sponsoring von Unternehmen finanziert. Carr ist gegen staatliche Finanzhilfen und will mögliche Gesetzesverstöße prüfen. Zudem lehnt er eine im Kongress diskutierte Finanzierung von NPR und dem nicht-kommerziellen TV-Netzwerk PBS aus Steuergeldern ab.
Auch bei der „Washington Post“ halten die Konflikte an. Medienberichten zufolge stornierte die Hauptstadtzeitung eine für die dritte Februarwoche von zwei Bürgerrechtsverbänden bestellte und als Mantelumleger geplante Werbeanzeige gegen Tech-Milliardär und Trump-Intimus Elon Musk. Die „Post“ habe die Entscheidung nicht begründet, erklärte der betroffene Bürgerrechtsverband „Common Cause“ auf seiner Webseite. Vor wenigen Wochen erst hatte die „Washington Post“ eine Karikatur über ihren Eigner, den Amazon-Gründer Jeff Bezos, nicht gedruckt. Zeichnerin Ann Telnaes reichte ihre Kündigung ein.
Tarifeinigung bei Deutschlandradio: Acht Prozent mehr Gehalt
Berlin/Köln (epd). Die rund 1.400 fest angestellten und freien Beschäftigten des Deutschlandradios erhalten eine Gehaltserhöhung von acht Prozent. Zudem haben sich die Gewerkschaften ver.di und der Deutsche Journalistenverband (DJV) nach monatelangen Tarifverhandlungen mit dem Sender auf zusätzliche Einmalzahlungen und höheres Urlaubsgeld verständigt, wie ver.di am 21. Februar in Berlin mitteilte.
Die Gehälter und Honorare steigen laut ver.di ab Januar 2026. Darauf einigten sich die Gewerkschaften mit dem in Berlin und Köln ansässigen Sender am Mittwochabend. Schon ab Mai dieses Jahres soll die sozial gestaffelte Erhöhung des Urlaubsgeldes um 30 bis 41 Prozent gelten, ausgenommen davon sind Führungskräfte. Angestellte erhalten Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 3.800 Euro, Auszubildende, Trainees und Volontäre 1.900 Euro und freie Mitarbeiter 2.500 Euro.
Die Vereinbarung gilt rückwirkend ab April 2024 und läuft bis Dezember 2026. Neben weiteren einzelnen Verbesserungen gibt es für Angestellte einmalig in diesem Jahr noch einen zusätzlichen freien Tag.
Ver.di-Verhandlungsführer Matthias von Fintel erklärte, die Tariferhöhung beim Deutschlandradio falle „im Verhältnis zu anderen Sendern in der ARD und dem ZDF vergleichbar stark aus“. Auch DJV-Justiziarin Hanna Möllers zeigte sich erleichtert darüber, dass „Deutschlandradio letztlich das Einsehen hatte, dass die Gehälter und Honorare in Zeiten anhaltender Inflation nicht stagnieren dürfen“. Auch wenn die Erhöhung den Reallohnverlust nicht vollständig ausgleiche, betrachten die Gewerkschaften das Ergebnis als großen Erfolg.
Noch keine Entscheidung im RBB-Kündigungsverfahren Augenstein
Berlin (epd). Im Rechtsstreit über die Kündigung des früheren RBB-Produktions- und Betriebsdirektors Christoph Augenstein durch den Sender ist das Ergebnis weiter offen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg werde am 17. April eine Entscheidung verkünden, sofern der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und Augenstein zuvor keine einvernehmliche Lösung finden, teilte das Gericht nach der mündlichen Verhandlung am 20. Februar in Berlin mit. (AZ: 5 Sa 478/24)
Gegenstand der Berufungsverhandlung am Donnerstag waren nach Gerichtsangaben unter anderem Fragen der Wirksamkeit der Beendigung des Dienstverhältnisses, der Rückzahlung erhaltener Zahlungen sowie der Leistung von Ruhegeld, Schadensersatz und Schmerzensgeld. Der RBB hatte Augenstein im Februar 2023 außerordentlich gekündigt. Im Januar 2024 hatte das Arbeitsgericht dessen Klage dagegen im Wesentlichen stattgegeben.
Der RBB hatte laut Gericht unter anderem damit argumentiert, dass das Dienstverhältnis nichtig sei, da die vertraglich festgelegte Ruhegeldregelung überhöht und damit sittenwidrig sei. Außerdem hatte der Sender Augenstein wegen diverser Pflichtverletzungen außerordentlich gekündigt.
Der RBB will mit der Klage laut Gericht bereits geleistete Zahlungen zurückerhalten und hat Augenstein Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Der Vorwurf laute, Augenstein habe sich eine Zulage für den ARD-Vorsitz vom RBB gewähren lassen, obwohl die Wahrnehmung dieser Funktion bereits durch die Grundvergütung abgegolten gewesen sei. Augenstein geht laut Gericht gegen die Kündigung vor und klagt auf Zahlung unter anderem von Ruhegeld.
BSW-Fraktion will Podcast starten
Potsdam (epd). Brandenburgs BSW-Fraktion will einen Podcast über die eigene Politik starten. Dafür sei der ehemalige RBB-Inforadio-Moderator Dietmar Ringel gewonnen worden, teilte die BSW-Fraktion am 19. Februar in Potsdam mit. Ringel war ab 1998 für das Inforadio des heutigen Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) tätig, moderierte dort unter anderem die sonntägliche Diskussionssendung „Forum“ und ist seit rund einem Jahr im Ruhestand.
In der DDR war Dietmar Ringel in der Wendezeit 1989 mit 32 Jahren zum Intendanten des Jugendsenders „DT64“ gewählt worden. Zuvor hatte eine Belegschaftsversammlung der bisherigen Leitung des Senders das Misstrauen ausgesprochen.
Der Podcast „LT25 - Brandenburger Politik ohne Filter“ soll den Angaben zufolge Ende März oder Anfang April starten und zunächst zweimal im Monat erscheinen. Der BSW-Fraktionsvorsitzende Niels-Olaf Lüders erklärte, damit sollen unter anderem die eigene Politik erklärt und bundespolitische Entwicklungen eingeordnet werden. Geplant sei, dafür Gäste aus Land und Bund einzuladen.
Berlinale: Goldener Bär für "Dreams (Sex Love)"

epd-bild/Hans Scherhaufer
Berlin (epd). Mit der Vergabe der begehrten Bären und einem Publikumstag ist am Wochenende die Berlinale zu Ende gegangen. Der Film „Dreams (Sex Love)“ erhielt bei den 75. Internationalen Filmfestspielen Berlin den Goldenen Bären. Die norwegische Produktion wurde am 22. Februar bei der Berlinale-Preisgala in der Bundeshauptstadt geehrt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) dankte der neuen Leiterin Tricia Tuttle für die Ausrichtung der diesjährigen Berlinale.
„Die Berlinale glänzt wieder, hierzulande wie international. Sie hat mit einem sehr starken Programm, das die ganze Vielfalt des Films international gezeigt hat, Filmschaffende aus der ganzen Welt nach Berlin geholt“, erklärte Roth am 23. Februar. Die „ganze Kraft und Magie des Kinos“ seien zu erleben gewesen. Insgesamt wurden bei der 75. Berlinale 240 Filme gezeigt.
Im Preisträgerfilm „Dreams (Sex Love)“ geht es um eine 17-Jährige, die sich in ihre Lehrerin verliebt und ihre Erlebnisse zu Papier bringt. Als ihre Mutter und ihre Großmutter die Aufzeichnungen entdecken, weicht ihr Entsetzen über die intimen Beschreibungen allmählich der Bewunderung für deren literarischen Wert. Das Drehbuch schrieb Dag Johan Haugerud, der auch die Regie führte.
19 Filme waren im Wettbewerb der Berlinale zu sehen, die am 13. Februar gestartet war. Präsident der Internationalen Jury war der US-Regisseur und Produzent Todd Haynes. Unter den Wettbewerbsfilmen feierten 17 Produktionen ihre Weltpremiere in Berlin. Den Goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk erhielt die schottische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton schon bei der Eröffnungsgala. Bei der Abschlussgala wurden von der Internationalen Jury zudem sieben Silberne Bären vergeben.
Der Große Preis der Jury ging an den Film „The Blue Trail“, eine Farce des Brasilianers Gabriel Mascaro auf alternde Gesellschaften, der zudem auch den Preis der Ökumenischen Jury erhielt. Den Preis der Jury erhielt das argentinische Roadmovie „The Message“, für das Ivan Fund Regie führte und das Drehbuch schrieb.
Mit dem Silbernen Bären für die beste Regie wurde der Chinese Huo Meng ausgezeichnet. Sein Film „Living the Land“ wirft einen Blick auf den tiefgreifenden sozioökonomischen Wandel in der Volksrepublik China in den 1990er Jahren.
Den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle bekam Rose Byrne. Für die beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle zeichnete die Jury den Iren Andrew Scott aus, der in dem amerikanisch-irischen Film „Blue Moon“ zu sehen ist.
Das beste Drehbuch im Berlinale-Wettbewerb wurde aus Sicht der Internationalen Jury vom Rumänen Radu Jude für den Film „Kontinental '25“ geschrieben. Den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung erhielt die Regisseurin Lucile Hadzihalilovic. Sie nahm die Auszeichnung für die außergewöhnliche Zusammenarbeit des Filmteams bei der französisch-deutschen Produktion „La Tour de Glace (The Ice Tower)“ entgegen.
Der Dokumentarfilm „Khartoum“ über fünf Menschen und ihre Erlebnisse im Krieg im Sudan erhielt den diesjährigen Friedensfilmpreis auf der Berlinale. Den Amnesty Filmpreis bekam der deutsche Film „Die Möllner Briefe“.
Meditation über die Liebe
Im winterlichen Berlin konnte die Berlinale noch mehr Besucher anlocken als im vergangenen Jahr, wobei sich erneut kein klares Festivalzentrum bildete. Das norwegische Liebesdrama "Dreams (Sex Love)" erhielt überraschend den Goldenen Bären.
Berlin (epd). Das war nicht unbedingt zu erwarten gewesen: „Dreams (Sex Love)“ des Norwegers Dag Johan Haugerud hat den Goldenen Bären der 75. Berlinale gewonnen. Ein Film, den bei den Vorab-Prognosen kaum jemand auf dem Zettel hatte. „Dreams (Sex Love)“ ist Teil einer Trilogie, die im Frühjahr unter dem Übertitel „Oslo Stories“ in die deutschen Kinos kommt. Erzählt wird die Geschichte der 17-jährigen Johanne (Ella Øverbye), die sich in ihre Lehrerin verliebt und Liebeskummer, Sehnsüchte und Fantasien in einem literarischen Tagebuch festhält, auf das schließlich ihre Mutter und Großmutter stoßen.
Der Film sei eine Meditation über die Liebe und vereine klare Beobachtung, kluge Kamera und perfekte Performance, erklärte Jurypräsident Todd Haynes in seiner Laudatio. Neben dem Goldenen Bären erhielt „Dreams (Sex Love)“ auch den von internationalen Kritikern vergebenen Fipresci-Preis und den Gilde Filmpreis vom Verband AG Kino.
Keinen Preis bekam der von einigen als Favorit gehandelte Dokumentarfilm „Timestamps“. Regisseurin Kateryna Hornostaj hat für den Film unterschiedliche Schulen in der Ukraine besucht und den Alltag der Kinder und Jugendlichen inmitten des Ausnahmezustands festgehalten. Auch wenn „Timestamps“ rein filmisch nicht unbedingt innovativ ist, die teils zerstörten Klassenräume zu sehen und zu erleben, wie die Schüler routinemäßig bei Luftalarm in den Schutzraum gehen, beschäftigt nachhaltig.
Ein weiterer Kritikerliebling war der brasilianische Film „The Blue Trail“, der eine Dystopie entwirft, in der alle Menschen ab einem Alter von 75 Jahren in eine Kolonie verfrachtet werden. Ein Schicksal, dem Protagonistin Tereza (Denise Weinberg) zu entkommen versucht. Gekonnt pendelt der Film zwischen sozialkritischem Realismus und wunderschönen, meditativen Bildern des Amazonas. Dafür gab es einen Silbernen Bären (Großer Preis der Jury) und den Preis der Ökumenischen Jury.
Dominiert wurde der diesjährige Wettbewerb vor allem von kleinen Filmen mit spannenden erzählerischen und ästhetischen Ansätzen, von denen jedoch wenige wirklich herausstachen. Nicht selten gingen die Meinungen stark auseinander. Dies war beispielsweise bei „The Ice Tower“ von Lucile Hadzihalilovic der Fall, in dem eine 16-Jährige aus einem Waisenhaus in den Bergen ausbricht, Unterschlupf in einem Filmstudio findet und sich zu der Hauptfigur, der Schneekönigin, hingezogen fühlt. Während einige den Film für fehlende dramaturgische Prägnanz kritisierten, lobten andere die visuelle Gestaltung mit magisch-eisigen Winterbildern. Bei der Gala gab es letztendlich einen Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung.
Relativ einig dürfte man sich beim Preis für die beste darstellerische Leistung sein, den die Australierin Rose Byrne entgegennehmen durfte. Sie brillierte in „If I Had Legs I’d Kick You“ als Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs und setzte sich damit unter anderem gegen Ethan Hawke durch, der in „Blue Moon“ den Songwriter Lorenz Hart spielt. Anstelle von Hawke wurde dessen Spielpartner Andrew Scott für die beste darstellerische Leistung in einer Nebenrolle geehrt. Weitere Silberne Bären gingen an den argentinischen Film „The Message“ (Preis der Jury), den chinesischen Beitrag „Living the Land“ (Beste Regie) und „Kontinental 25“ von Radu Jude (Bestes Drehbuch).
Ein weiterer Film mit besonderem politischem Hintergrund war die Dokumentation „Holding Liat“, die in der Sektion Forum lief und den Dokumentarfilmpreis der Berlinale erhielt. Brandon Kramer begleitet in „Holding Liat“ die Familie der israelischen Friedensaktivistin Liat Beinin Atzili, die am 7. Oktober 2023 von der islamistischen Terrororganisation Hamas entführt wurde. Viele hätten davon abgeraten, eine solche Geschichte zu erzählen, weil sie nicht in eine einfache Kategorie passe, erklärte der Regisseur. Doch genau aus diesem Grund müsse sie erzählt werden.
Nach den auch auf dieser Berlinale wieder in den Fokus geratenen Kontroversen um Israelfeindliche Positionen ist die Ehrung für „Holding Liat“ auch ein Zeichen, dass die Berlinale sich nicht einseitig, sondern auf vielfältige Weise mit den Konflikten im Nahen Osten auseinandersetzt.
Eine notwendige Zumutung
Berlinale 2025: Fünf Jahre nach dem Hanau-Attentat zeigt eine Dokumentation den Kampf der Hinterbliebenen um Aufarbeitung. Außerdem: Richard Linklaters Wettbewerbsbeitrag "Blue Moon".
Berlin (epd). Vor genau fünf Jahren, am 19. Februar 2020, erschoss ein Rechtsextremer in Hanau neun junge Menschen in Bars. Den Hinterbliebenen und ihrem Kampf um Anerkennung und Aufarbeitung widmet sich die Dokumentation „Das Deutsche Volk“ (Kinostart: Herbst 2025) von Marcin Wierzchowski, der in der Sektion „Berlinale Special“ seine Premiere feierte.
Mehr als vier Jahre begleitete der Regisseur die Familien der Ermordeten, vor allem die Eltern des getöteten Hamza Kurtović, den Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin, die Mutter von Sedat Gürbüz und den Vater von Vili Viorel Paun. In seiner 132 Minuten langen, in Schwarz-Weiß gedrehten, unkommentierten Dokumentation lässt er der Wut und Trauer der Angehörigen, aber auch ihrem unermüdlichen Engagement gegen das Vergessen viel Raum. Das ist zuweilen im besten Sinne eine emotionale Zumutung, etwa wenn die Familien erzählen, wie sie in den Stunden nach dem rassistischen Attentat versucht haben, ihre Kinder zu erreichen und erst erfahren, was geschehen ist, als ein Polizist eine Liste der Opfer mit den Worten einleitet: „Und jetzt diejenigen, die es nicht geschafft haben“.
Die Dokumentation zeigt, wie die Eltern sich an ihrer Trauer abarbeiten, die Handys ihrer Kinder weiterhin täglich aufladen, an ihren Schuhen riechen oder die blutige Kleidung aufbewahren. Man beobachtet mit zunehmendem Erstaunen die Hilflosigkeit der deutschen Behörden, einen empathischen Umgang mit den Hinterbliebenen zu finden und eine transparente Aufklärung voranzutreiben. Anklagend die Fragen der Angehörigen: Warum war der Notausgang der Bar verschlossen, in der der Attentäter anfing zu schießen? Wieso hatte ein psychisch auffälliger Täter noch einen Waffenschein? Warum lagen die Leichen der Opfer teilweise 20 Stunden am Tatort? Es irritiert, wenn diese Fragen mit ungefilterter emotionaler Wucht an überforderten Mandatsträgern abprallen, die sich nicht anders zu helfen wissen, als sich hinter Phrasen und Beschwichtigungen zu verschanzen.
Die Doku kulminiert in der Debatte, wo das Denkmal für die Opfer in Hanau aufgestellt werden soll. Auf dem zentralen Marktplatz, wo es sich die Familien wünschen, lehnen es Stadtrat und Oberbürgermeister ab, weil „die Hanauer“ das nicht akzeptieren würden. „Aber unsere Kinder waren doch auch Hanauer!“, ruft die Mutter des getöteten Sedat Gürbüz verzweifelt und Hamza Kurtovićs Vater Armin fordert: „Man muss die Leute mit dieser Tat konfrontieren, jeden Tag.“ Ein erschütterndes Zeitdokument.
Gänzlich unzeitgemäß präsentiert sich hingegen Richard Linklaters „Blue Moon“ im Wettbewerb um den Goldenen Bären: ein Kammerspiel über den amerikanischen Broadway-Texter Lorenz Hart (bis zur Unkenntlichkeit maskiert: Ethan Hawke), der am Abend des 31. März 1943 im New Yorker Restaurant Sardi’s einem Empfang beiwohnt, bei dem sein ehemaliger Partner, der Komponist Richard Rodgers (Andrew Scott) seinen bis dahin größten Erfolg feiert - das Musical „Oklahoma!“; ausgerechnet das erste Werk, das ohne den notorischen Trinker und Neurotiker Hart entstanden ist.
Regisseur Linklater, bekannt für seine Langzeit-Experimente wie „Boyhood“ (2014) oder die „Before“-Trilogie (1995-2013), verliert sich in einem ambitionierten Dialogstück, in dem Hart als eloquente Nervensäge dargestellt wird, der frivol-sexistische Pointen aus der Hüfte schießt und in wehleidiger Theatralik mit der unerfüllten Liebe zur bildhübschen, aber naiven Elizabeth Weiland (Margaret Qualley) hadert. Trotz der virtuosen Dialoge und zahlreicher cleverer popkultureller Referenzen (von „Casablanca“ bis „Stuart Little“) letztlich ein altbackener Film voller Klischees, dem außer einer ambivalenten Hommage an eine US-Showlegende nichts Tiefsinniges einfällt. „Wer will harmlose Kunst?“, fragt Hart an einer Stelle und man wünscht sich, Richard Linklater hätte die Antwort.
Zentralrat "fassungslos" nach Vorfall auf Berlinale
Berlin (epd). Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat mit scharfer Kritik auf Israel-feindliche Äußerungen auf der Berlinale reagiert. „Dass zu Hamas-Parolen Beifall aufbraust, macht fassungslos“, schrieb der Zentralrat im Kurznachrichtendienst X. Nach Medienberichten ermittelt inzwischen der Staatsschutz nach einem Vortrag des Regisseurs Jun Li am 15. Februar in der Berliner Urania.
In dem Redebeitrag hieß es demnach unter anderem, Millionen von Palästinensern erstickten unter Israels brutalem Siedlerkolonialstaat. Deutschland wurde vorgeworfen, einen „Genozid“ an den Palästinensern zu unterstützen. Zu hören war in dem Beitrag auch die umstrittene propalästinensische Parole „From the river to the sea“. Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle hat den Vorfall laut Medienberichten bedauert, der sich unter anderem über soziale Netzwerke verbreitet hatte.
Der Zentralrat der Juden schrieb auf X, vor der Berlinale sei das Gespräch mit den Veranstaltern gesucht worden. „Wir waren uns einig, wie mit diesem klaren Israelhass und israelbezogenen Antisemitismus umzugehen ist.“ Es werde davon ausgegangen, „dass ein solches Verhalten entsprechend sanktioniert wird“.
Der Regisseur Jun Li hatte in der Berliner Urania eine Rede des Schauspielers Erfan Shekarriz vorgelesen, der in seinem Film „Queerpanorama“ mitspielt. Der Film wurde am 15. Februar auf der Berlinale gezeigt. Bereits auf der Preisgala der Berlinale im vergangenen Jahr hatten propalästinensische Bekundungen und massive Vorhaltungen gegen Israel für heftige Kritik gesorgt.
Intendant Lilienthal kündigt weitere Proteste gegen Kürzungen an

epd-bild/Hans Scherhaufer
Berlin (epd). Der künftige Intendant der Berliner Volksbühne, Matthias Lilienthal, hat weitere Proteste gegen Kürzungen im Kulturbereich durch den Berliner Senat angekündigt. Er werde „mit allen Mitteln“ gegen die Streichungen vorgehen, sagte Lilienthal der „Berliner Zeitung“ (19. Februar): „Ich werde zeitweise bei meiner Familie ausziehen, ein Zelt im Abgeordnetenhaus aufschlagen und auf jeden, der da rein will, einquatschen, bis meine Forderungen erhört sind.“ Der 65-Jährige sagte, die Volksbühne sei „zu Unrecht überproportional geschröpft“ worden. Er gehe davon aus, „dass da deutlich nachgebessert wird“. Die Volksbühne muss in diesem Jahr mit zwei Millionen Euro weniger auskommen.
Lilienthal warf dem Senat vor, „die Ausstrahlung der Kultur und der Szene für diese Stadt“ zu unterschätzen: „Ich stimme der Analyse von Joe Chialo, dass die Kultur bisher übersubventioniert war, nicht zu.“ Berlins Kultursenator Chialo (CDU) müsste eigentlich sehen, dass die Volksbühne unterfinanziert ist, sagte Lilienthal mit Blick auf vergleichbare Kulturbetriebe wie etwa das Hamburger Thalia-Theater. Es gebe kulturelle Aufgaben in der Hauptstadt, „für die man den Bund in die Pflicht nehmen kann“, ergänzte er.
Lilienthal kündigte an, dass er sich verstärkt um Drittmittel und Sponsoring kümmern werde. „Und dann werde ich alles im Abgeordnetenhaus versuchen, meinen sehr penetranten Charme spielen lassen.“ Mit Blick auf andere Einrichtungen, die auch von Sparbeschlüssen betroffen sind, sagte er: „Ich gehe davon aus, dass wir ein gemeinsames Solidaritätscamp aufschlagen.“
Schriftsteller in der Ukraine: Patriotisch, aber pessimistisch
Ukrainische Autoren haben drei Jahre lang gegen die russischen Truppen in ihrem Land gekämpft, teils nur mit Worten, teils an der Front. Viele starben. Alle sehnen sich nach Frieden, doch kapitulieren will keiner.
Frankfurt a.M., Kiew (epd). Drei Jahre nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hat der Krieg die Schriftsteller des Landes längst eingeholt. Statt der schönen Literatur widmen sie sich der Politik, thematisieren in Sachbüchern, Essays, Kommentaren und Social-Media-Posts die schrecklichen Folgen des Konflikts. Seit US-Präsident Donald Trump aber vor wenigen Tagen erklärte, dass er direkte Friedensgespräche mit dem Aggressor Wladimir Putin aufnehmen will, scheint der Kampfgeist der Intellektuellen einer „Atmosphäre der Unsicherheit“ zu weichen. So erlebt es jedenfalls der Autor Andrej Kurkow in Kiew.
„Es sieht so aus, als ob 2025 ein entscheidendes Kriegsjahr wird“, sagte Kurkow dem Evangelischen Pressedienst (epd), „aber unter den Ukrainern herrscht nicht viel Optimismus“. Der Schriftsteller verfolgt die Bemühungen Trumps zunächst über die Köpfe der Ukrainer hinweg mit viel Skepsis. Trump werde höchstens einen Waffenstillstand erreichen, so Kurkow, nicht aber ein dauerhaftes Friedenskommen, das der Ukraine Souveränitätsgarantien und unveränderliche Grenzen gebe.
Mehr als 100 Schriftsteller getötet
Viele ukrainische Autoren sind inzwischen nicht mehr nur „Chef-Erklärer“ ihrer Nation (Suhrkamp-Lektorin Katharina Raabe); sie sind selbst zu Aktivisten und Soldaten geworden. In den zurückliegenden drei Jahren haben Kurkow zufolge mehr als 100 Schriftsteller und Dichter der Ukraine ihr Leben verloren, die meisten bei Kämpfen. Kurkow, der von 2018 bis 2022 auch PEN-Präsident seines Landes war, berichtet, viele nicht kämpfende Autoren hätten die Armee unterstützt, etwa Andriy Lyubka aus Uzhhorod, der Spenden für mehr als 250 Jeeps und Pick-ups für die Front auftrieb.
Oder der Schriftsteller Juri Andruchowytsch („Die Lieblinge der Justiz“, „Der Preis unserer Freiheit“). Er warf Russland vergangenes Jahr in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) vor, einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine zu führen. Das von ihm gegründete Untergrund-Kulturzentrum „Vagabondo-Zirkus“ in Iwano-Frankiwsk wurde zum Treffpunkt für geflohene Künstler.
Serhij Zhadan, Friedenspreis-Träger des Deutschen Buchhandels 2022, tut seit fast einem Jahr Dienst in der ukrainischen Armee. Von Beginn des Krieges an half er in Charkiw, Kinder zu evakuieren, er verteilte Lebensmittel, gab Konzerte und Lesungen in U-Bahn-Schächten, lieferte Material an das Militär. Der 50-Jährige steht damit pars pro toto für die Mehrheit ukrainischer Autorinnen und Autoren.
„Zwischen roher Kraft und Poesie“
Als Zeuge der schrecklichen Zerstörungen und als politischer Kommentator postete er fast täglich öffentlich auf Facebook. Poesie, Videos von der Front und Crowdfunding wechselten sich hier ab. „Zhadans Texte pendeln zwischen roher Kraft und Poesie“, schrieb die „Neue Zürcher Zeitung“ (NZZ), das Medium sei egal. Sein zur Buchmesse 2022 erschienenes Buch „Himmel über Charkiw“ bestand aus einer Sammlung von FB-Posts der ersten 100 Kriegstage. Nun hat Zhadan seinen Account verriegelt, einsehbar ist er nur für 41 Freunde.
Die ukrainische Literatur spielt nach Einschätzung Andrej Kurkows in der Ukraine selbst heute nur noch eine geringe Rolle. Das sei in den ersten beiden Jahren nach der russischen Invasion anders gewesen. „Die Bücher über den Krieg werden immer noch veröffentlicht, aber sie werden jetzt weniger gelesen“, sagte der 63-Jährige, der in St. Petersburg geboren wurde und seit langem in Kiew lebt. Stattdessen bevorzugten die Leser ausländische Belletristik, die sie von der düsteren Realität etwas ablenke. Kurkow konstatiert eine „Müdigkeit“ in der ukrainischen Gesellschaft.
Zahlreiche Bücher ins Deutsche übersetzt
In Deutschland und der Schweiz erscheinen indes in diesem Frühjahr wieder neue Bücher bekannter ukrainischer Autoren; einige haben zum literarischen Schreiben zurückgefunden. Von Serhij Zhadan, der schon 2024 mit „Chronik des eigenen Atmens“ neue Gedichte veröffentlichte, erscheint im März „Keiner wird um etwas bitten“ (Suhrkamp). Es ist ein Band mit Geschichten, die den ukrainischen Alltag inmitten von Bedrohung, Tod und Zerstörung schildern, „literarisches Dokument einer neuen Realität“, wie der Verlag ankündigt. Von der in Berlin lebenden FAZ-Kolumnistin Katja Petrowskaja kommt exakt am dritten Jahrestag des Kriegsbeginns (24. Februar) ein Buch mit Texten aus dem Krieg heraus: „Als wäre es vorbei“ (ebenfalls Suhrkamp).
Andrej Kurkow („Graue Bienen“, „Samson und Nadjeschda“, Diogenes) hat jetzt den Roman vollendet, den er 2022 erst einmal hat liegen lassen. Kurkow, dessen Muttersprache Russisch ist, hat ihn auf Russisch geschrieben; aber veröffentlicht wird er in ukrainischer Sprache. „Buchhandlungen möchten keine Bücher auf Russisch verkaufen, daher machen russische Publikationen für die Verlage keinen Sinn“, sagt der Autor. Offizielle Einschränkungen gebe es nicht.
Kurkow, der Sachbücher und Kinderliteratur auch in ukrainischer Sprache verfasst, möchte seine Romane aber auch weiterhin auf Russisch schreiben, der Sprache, in der er von Kindheit an fühlt und denkt. Der dritte Band seiner „Samson“-Reihe wird voraussichtlich im Herbst bei Diogenes erscheinen.
Luthergedenkstätten untersuchen ihre Sammlung auf NS-Raubgut
Wittenberg (epd). Die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt lässt ihre Sammlung auf Kulturgüter untersuchen, die in der NS-Zeit enteignet wurden. Bis Ende des Jahres werde der Historiker und Provenienzforscher Patrick Bormann die Anschaffungen der Stiftung zwischen 1933 und 1945 analysieren, teilte die Stiftung am 19. Februar in Wittenberg mit. Dazu zählten Zeugnisse aus der Reformationszeit und Gegenstände der Luther-Rezeption. Vor allem sollen Handschriften und historische Drucke geprüft werden, hieß es. Ermöglicht werde die Recherche durch Projektmittel des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg.
Laut Projektleiterin Anne-Katrin Ziesak, Leiterin der LutherMuseen in Wittenberg, werden Objekte untersucht, die in der NS-Zeit von der damaligen „Lutherhalle“ erworben wurden. Dies war bis 1997 der Name des heutigen Lutherhauses mit seiner reformationsgeschichtlichen Ausstellung. Der damalige Direktor Oskar Thulin sei NSDAP-Mitglied und Mitglied des Wittenberger Stadtrats gewesen. Die Leitung der Lutherhalle müsse also durchaus als regimenah verstanden werden, sagte Ziesak.
Eine erste Auswertung der Inventarbücher von 1933 bis 1945 habe weitere Verdachtsmomente ergeben, sagte Bormann. Unter den dort angegebenen Verkäufern habe man Personen entdeckt, die bereits im Kontext des NS-Raubguts auffällig geworden seien. Das seien genug Indizien für eine Untersuchung, sagte der Historiker.
Das Projekt und seine Ergebnisse werden den Angaben zufolge öffentlich dokumentiert und in Datenbanken eingestellt. Die Provenienzforschung befasst sich mit der Herkunft von Kulturgütern.
Deutsches Nationaltheater plant Themenwoche zu Buchenwald
Weimar (epd). Das Deutsche Nationaltheater in Weimar gedenkt der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 80 Jahren mit einer Themenwoche. Vom 29. März bis 6. April beleuchte die Spielstätte an verschiedenen Orten in Weimar aktuelle Fragen zur Erinnerungskultur auf diskursive, interaktive und künstlerische Weise, teilte eine Theatersprecherin am 20. Februar in Weimar mit. Geplant sind den Angaben zufolge Eigenproduktionen, Gastspiele, szenische Lesungen, eine Diskursreihe sowie drei Neuinszenierungen. In allen Formaten sollen die Ursachen und Folgen des Nationalsozialismus erörtert werden.
Den Auftakt der Themenwoche bildet den Angaben zufolge die Premiere des Tanzprojekts „Plasma und Penicillin“ am 29. März. Darin setzen sich der Choreograf Louis Stiens und sein Ensemble mit der Perspektive der US-amerikanischen Fotografin Lee Miller auf die Verwüstungen des Dritten Reichs auseinander. Im Theaterspiel „Drahtwolken“ des Kollektivs „machina eX“ übernehmen die Zuschauer die Rolle von Mitarbeitenden eines „Zentrums für Zeitsichtungen“. Sie werden beauftragt, die Geschichte von drei Zwangsarbeitenden in Weimar zu ermitteln.
Als dritte Neuproduktion präsentiert das Theater Mieczysław Weinbergs Oper „Die Passagierin“. Das Werk nähert sich dem Grauen in Auschwitz aus einer doppelten Erinnerungsperspektive. Die geschönten und unvollständigen Bekenntnisse einer ehemaligen KZ-Aufseherin werden mit der von den Häftlingen erlittenen Gewalt konfrontiert. Die Themenwoche wird von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und dem Bundesfinanzministerium gefördert.
Eisenacher Bachhaus präsentiert Ausstellung in Jerusalem
Eisenach (epd). Das Bachhaus Eisenach begleitet ab dem 17. März zum bereits zehnten Mal das jährliche Bachfest des Jerusalem Baroque Orchestra mit einer Ausstellung in der israelischen Hauptstadt. Im Mittelpunkt des diesjährigen Festivals stehe das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach (1685-1750), teilte ein Museumssprecher mit. Dementsprechend erläutere die kleine Ausstellung des Bachhauses dessen Geschichte mit fünf Originalobjekten und einem Film auf Englisch und Hebräisch.
Die Ausstellung des Bachhauses im Foyer des Veranstaltungszentrums des Christlichen Vereins junger Männer in Jerusalem erklärt laut Bachhaus die Entstehung des Werks. So habe der Komponist bekanntermaßen sein Weihnachtsoratorium aus verschiedenen Huldigungsmusiken an den sächsischen Adel zusammengesetzt, die er in den Vorjahren komponiert hatte.
Die Ausstellung zeigt neben einem Faksimilé von Bachs Autograph zwei Original-Libretti dieser Vorläufer-Kantaten und drei Kupferstiche zum Thema. Wie Bachs Verfahren des Umdichtens von Musik zu neuen Anlässen genau funktionierte, erklärt ein Trickfilm auf Englisch und Hebräisch.
Zu Bachs Zeit, auch darauf weist nach Museumsangaben die Ausstellung hin, scheint sein Werk weniger erfolgreich gewesen zu sein. Nur eine Aufführung verteilt über die Weihnachtsfeiertage 1734/35 ist belegt. Nach Bachs Tod dauerte es immerhin noch bis 1857, bis die Berliner Singakademie es erstmals wieder aufführte.
Weimars Gärtner kämpfen um ihr Weltkulturerbe
Auf bis zu 50 Millionen Euro schätzt die Klassik Stiftung Weimar den Sanierungsbedarf in ihren Parkanlagen. Nicht alles lässt sich ersetzen. Denn Baum ist nicht gleich Baum. Historische Parks sind Kompositionen voller Symbole und Bedeutungen.
Weimar (epd). Die Schwarzerle im Weimarer Ilm-Park wurzelt direkt am Flussbett - und doch ist sie nicht gesund. „Wasser hat sie genug“, sagt Andreas Pahl von der Direktion Schlösser, Gärten und Bauten der Klassik Stiftung Weimar: „Aber die starke Sonneneinstrahlung im Sommer macht ihren Blättern zu schaffen.“ Und dieser Baum sei nur einer von vielen, die seinem 30-köpfigen Gartenteam Sorge bereiten.
Jedes Jahr müssten mehr tote Äste ausgeschnitten werden, sagt Pahl: „Gerade im Winter sieht man das ganze Ausmaß.“ Er zeigt auf eine Baumgruppe hinter der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. In einer Höhe von rund 15 Metern sind dort viele Kronen gekappt worden. Die kranken Bäume schaffen es nicht mehr, die oberen Äste mit Wasser zu versorgen. Im Sommer deckt das Blattgrün die Schäden gnädig zu.
Über rund 48 Hektar erstreckt sich der Park an der Ilm. Als einzigartiger Landschaftsgarten am Rand der Weimarer Altstadt ist er Bestandteil des Unesco-Weltkulturerbes. Herzog Carl August (1757-1828) und Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) verwirklichten hier ihre gartenkünstlerischen Ideen. Sie schufen ein begehbares Kunstwerk mit abwechslungsreichen Landschaftsbildern, Parkarchitekturen und Sitzgelegenheiten.
„Die Parkanlagen der Klassik Stiftung sind durchkomponierte Gartenkunstwerke“, sagt Pahl. Die Bäume seien bewusst nach Wuchs, Farbe, Blattform und Blüte ausgesucht worden, um bestimmte Bilder und Stimmungen zu erzeugen. Vielen Familien in der Stadt ist der Park gerade an warmen Sommertagen heute der liebste Teil im klassischen Weimar.
Viele Bäume seien inzwischen an der Schwelle ihrer natürlichen Lebenserwartung angekommen, betont Pahl. Daneben aber beobachteten die Gärtner, dass Buchen, die früher ab etwa 120 Jahren als alt galten, heute schon deutlich vor der Zeit absterben. Noch schlimmer sehe es bei den Fichten aus. Besonders traurig sind für Pahl Fälle, wie der einer Eiche, die von Goethe seinerzeit geschätzt wurde - und die es bald nicht mehr geben wird.
Inzwischen muss die Stiftung allein für die nötigsten Ausgaben in den Parks, zu denen auch der Park Belvedere, der Tiefurter Park und einige kleinere Gärten gehören, Aufträge in Höhe von jährlich rund 500.000 Euro ausschreiben. Der Mehrbedarf dort muss bei anderen Projekten in Gesamtetat der Stiftung eingespart werden.
Seitdem mit Unterstützung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien eine Bestandserhebung, eine Art Gesundheitsaltas, des Baumbestands der Stiftung aufgestellt wurde, weiß der Abteilungsleiter Gartenbau der Stiftung, Stephan Herbarth, dass diese Summen für die Parksanierungen in den kommenden Jahren weiter steigen werden.
„Wir haben in unseren Parks einen Sanierungsbedarf in Höhe von 50 Millionen Euro“, schätzt Herbarth. Die Klimaschäden im Bestand seien enorm und endeten nicht bei den Bäumen. Erst im vergangenen Jahr drohte im Tiefurter Park ein Hang wegen Austrocknung abzurutschen.
Und längst nicht alles lässt sich reparieren. So erinnert Andreas Pahl daran, dass es in Landschaftsparks des 18. und 19. Jahrhunderts nicht nur um die Optik ging. „Wir können anstelle klimaempfindlicher Eichen südländische Arten nachpflanzen, und dann sieht das ähnlich aus“, sagt er. Aber die Symbolik gehe dabei bisweilen verloren.
Denn in der Gartenbaukunst dieser Epoche sind Bäumen laut Pahl bestimmte Eigenschaften zugesprochen worden. Im Zusammenspiel mit Sichtachsen und Parkbauwerken seien solche Symbole genutzt worden, um Gefühle oder Bedeutungen zu transportieren. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Trauerweide, die für Trauer und Schmerz steht, aber auch ein Symbol der Wiedergeburt ist. Die Eiche steht für Stärke und Macht. Blutbuchen wurden oft als Landmarken gesetzt, die Beständigkeit und Langlebigkeit ausdrücken sollten.
Doch gerade Blutbuchen leiden besonders unter dem Klimawandel. „Dort, wo solche Bäume nicht mehr zu ersetzen sind, verliert der Park ein Stück seiner Bedeutung als kulturhistorische Komposition“, sagt Pahl. Gerade in einem Unesco-Park sei das eine besonders schmerzhafte Entwicklung.
Dresdner Ausstellung "Freiheit. Eine unvollendete Geschichte"
Dresden (epd). Mit der Entwicklung von Freiheitsbegriffen beschäftigt sich eine neue Ausstellung des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Unter dem Titel „Freiheit. Eine unvollendete Geschichte“ werde ab 20. Juni unter anderem nach der Vereinbarkeit von Individualität und gesellschaftlicher Solidarität gefragt, teilte das Museum am 17. Februar in Dresden mit. Ziel sei, eine Verständigung über Freiheit zu befördern. Die Ausstellung ist bis zum 31. Mai 2026 in Dresden zu sehen.
Ein Teil der Schau sei den Transformationen in Ostdeutschland, Polen und Tschechien nach 1990 und den besonderen Konstellationen am Ende des Kalten Krieges gewidmet. In Zusammenarbeit mit Institutionen aus Polen und Tschechien werde über die Beschaffenheit und Wirkung heutiger Freiheitsbegriffe reflektiert. Schirmherrin der Dresdner Ausstellung ist die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth (Grüne).
Angesichts von unübersichtlichen und brisanten gesellschaftspolitischen Situationen gerate der Freiheitsbegriff auch in der Gegenwart unter Druck, hieß es. Dies sei vor allem dann der Fall, wenn akute Krisen ein schnelles, gemeinsames Handeln erforderten. Beispiele dafür seien der Klimawandel, die Corona-Pandemie oder die militärische Unterstützung der Ukraine. Kooperationspartner für die Dresdner Ausstellung sind das Europäische Solidarnosc-Zentrum in Danzig, das Museum für Gegenwartskunst in Breslau und die Nationalgalerie in Prag.
Erfurt zeigt archäologische Funde in neuer Dauerausstellung
Erfurt (epd). Das Stadtmuseum Erfurt präsentiert seit 21. Februar archäologische Funde aus dem Stadtgebiet in einer neuen multimedialen Dauerausstellung. Ein Schwerpunkt liege dabei auf der Wissensvermittlung, sagte Direktor Hardy Eidam am 20. Februar in Erfurt. Erzählt werde immer auch die Geschichte hinter den Objekten. Jedes der rund 75 ausgewählten Exponate kann dabei über die Medienstationen ausgewählt und dadurch in seiner Vitrine beleuchtet werden. Texte und Fotos berichteten ergänzend über Fundsituationen, Bedeutungen und Geschichte der Objekte.
Erstmals seit mehr als zehn Jahren wird auch der sogenannte Erfurter Brakteatenschatz wieder gezeigt. 1994 wurde im Norden der Stadt ein Topf mit mehr als 1.200 hauchdünnen Silbermünzen aus dem 13. Jahrhundert ausgegraben. Die einzelnen Münzen zeichneten sich durch ihre detailreichen Motive aus, die in der Ausstellung auf Bildschirmen stark vergrößert betrachtet werden können.
Wichtig war den Kuratoren nicht nur die Präsentation der Objekte, sondern auch ein Einblick in die Tätigkeit der Archäologen. Eine Abteilung der Ausstellung nimmt laut Kuratorin Gudrun Noll-Reinhardt den Besucher mit auf den Weg hinter die Kulissen der Grabungsarbeit. Das beginne mit Informationen zur Bauvoranfrage für die Fund-Grundstücke und ende bei der wissenschaftlichen Bearbeitung der Exponate.
Die digitale Präsentation erlaube Aktualisierungen zu den Exponaten nahezu in Echtzeit, sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht werden. Auch sei geplant, ab dem Frühjahr Fotoserien und Funde laufender Grabungen in der Ausstellung zu präsentieren.
Friedenstein präsentiert Fächer aus aller Welt
Gotha (epd). Die Friedenstein-Stiftung Gotha präsentiert bis zum 4. Mai ausgewählte Fächer aus ihren Sammlungen im Herzoglichen Museum. Das Angebot sei ein Beitrag zum Jubiläumsjahr anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung der Stadt vor 1.250 Jahren, teilte eine Sprecherin am 21. Februar mit.
Die Stiftung besitzt eigenen Angaben zufolge eine der bedeutendsten musealen Fächersammlungen Deutschlands. Der historische Bestand gehe im Wesentlichen auf Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg (1772-1822) zurück. Der kunstsinnige Regent trug laut eines Inventars aus späterer Zeit wohl mehr als 230 Fächer zusammen, die ihm vor allem sein Londoner Exportagent Joseph Meyer (1796-1856) vermittelte. In der englischen Handelsmetropole erwarb dieser zwischen 1817 und 1820 zahlreiche Objekte für das einst berühmte „Chinesische Cabinett“ seines Gothaer Landesherrn, darunter auch eine Vielzahl kostbarer Fächer.
Dieser Sammelleidenschaft ist laut Stiftung die Vielfalt des Bestandes zu verdanken. Er umfasst unterschiedliche Fächerformen, Materialien und Bearbeitungen und Stücke verschiedener Herkunft. Darunter befinden sich etwa italienische Grand Tour- und chinesische Exportfächer.
Eine großzügige Dauerleihgabe der Ute-Michaels-Stiftung in München bereichert seit 2010 die Gothaer Sammlung. Mehr als 600 Fächer und Fächeretuis der berühmtesten „Éventaillistes“ ergänzen den historischen Bestand. Die Sammlung umfasst Fächer unter anderem aus Frankreich, England, Deutschland, Italien, Spanien, Japan sowie Russland und den USA.
Chemnitzer Ausstellung zur freien Kunstszene in der DDR
Sie haben sich in der Natur zum Zeichnen getroffen und Bäume mit Mullbinden umwickelt: Die Künstlergruppe Clara Mosch aus dem früheren Karl-Marx-Stadt galt als legendär. Eine Ausstellung in Chemnitz würdigt nun ihre Arbeit.
Chemnitz (epd). Die Chemnitzer Kunstsammlungen widmen der freien Kunstszene der 1970er und 1980er Jahre in der DDR eine eigene Ausstellung. Erstmals werde die Geschichte der „Galerie Oben“ und der Künstlergruppe Clara Mosch im Kontext vorgestellt, sagte die Generaldirektorin der Kunstsammlungen, Florence Thurmes, am 18. Februar in Chemnitz. Beide Initiativen waren in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) aktiv und zogen Publikum aus der gesamten DDR an.
Gezeigt werden bis Februar 2026 laut der Kuratorin Marie Winter zahlreiche Fotos, Grafiken, Postkarten und Plakate sowie Originaldokumente. Die Ausstellung trägt den Titel „Künstlerische Freiräume in Karl-Marx-Stadt“. In den Kunstsammlungen Chemnitz befindet sich nach eigenen Angaben umfangreiches Material zu den beiden unabhängigen Projekten außerhalb des staatlichen Kunstbetriebs.
Um der Vielfalt der Exponate gerecht zu werden, werden laut Winter Teile der Ausstellung alle drei Monate gewechselt. Karl-Marx-Stadt war in den 1970er und 1980er Jahren ein Zentrum der freien Kunstszene in der DDR. Sowohl die „Galerie Oben“ als auch die Künstlergruppe Clara Mosch seien für unkonventionelle Ausstellungen, Veranstaltungen und Aktionen bekannt geworden, sagte Winter.
Die „Galerie Oben“ wurde 1973 eröffnet. Schnell avancierte sie laut Winter zu einem herausragenden Ort, an dem Besucherinnen und Besucher eine für die DDR-Zeit ungewöhnlich große Vielfalt an künstlerischen Stilen entdecken konnten. Die 1977 gegründete Künstlergruppe Clara Mosch nutzte einen kleinen leer stehenden Laden im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg als Galerie und Ort experimenteller Kunst. Ihre unkonventionellen Aktionen hätten „Legendenstatus“ erreicht, sagte Winter.
Zur Gruppe Clara Mosch gehörten Carlfriedrich Claus, Thomas Ranft, Dagmar Ranft-Schinke, Michael Morgner und Gregor-Torsten Schade. Der Titel wurde aus Buchstaben der Namen der fünf Mitglieder zusammengesetzt. Die Gruppe veranstaltete auch sogenannte Plenairs. Die kollektiven Künstlerreisen dienten dem Austausch und der Vernetzung von Gleichgesinnten. Gearbeitet wurde dabei in der Natur, etwa an der Ostsee.
Oft seien auf den Reisen Künstlermappen der Gruppe Clara Mosch entstanden, sagte Winter. Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Arbeiten seien weitere Vorhaben finanziert worden. Bekannt wurde auch eine Aktion, um auf das Waldsterben aufmerksam zu machen. Die Gruppe wickelte dabei Mullbinden um Bäume.
Gregor-Torsten Schade sagte zur unkonventionellen Kunst der Gruppe: „Wir haben dem Staat etwas entgegengesetzt.“ Vor allem habe der Humor in den Aktionen und Werken das repressive System gebrochen. Doch es habe auch viele staatliche Repressionen gegeben. Unter anderem wurden Aktionen von der DDR-Staatssicherheit beobachtet. Schließlich löste sich die Gruppe 1982 auf.
In der „Galerie Oben“ gab es bis 1989 zahlreiche Veranstaltungen, Jazz-Abende und experimentelle Musik ebenso wie klassische Konzerte und Verkaufsauktionen. Das Angebot versammelte vor allem auch junges Publikum. Besonders großer Beliebtheit erfreuten sich laut Winter die sogenannten Mittwochsveranstaltungen, die kostenlos waren und an manchen Abenden bis zu 150 Menschen anzogen.
Wolfgang Tillmans stellt in Dresden aus
Dresden (epd). Arbeiten des zeitgenössischen Fotografen und Künstlers Wolfgang Tillmans sind vom 8. März an im Dresdner Albertinum zu sehen. Die Ausstellung mit dem Titel „Weltraum“ sei ein Querschnitt seines vielfältigen Schaffens, teilten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am 21. Februar mit. Zu erleben seien „Bildwelten abstrakter Fotografie, die aus dem physischen Experimentieren mit Licht, Papier und Chemie entstehen“.
Den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zufolge ist es seit Jahren die erste große Schau mit Werken von Tillmans in einem deutschen Museum. Die Arbeiten seien von elektronischer Musik der 1990er Jahre ebenso inspiriert wie von aktuellen technologischen Entwicklungen. Zu sehen seien auch neue Arbeiten, die seit 2022 entstanden sind und erstmals in einer Institution gezeigt werden.
Zu Tillmans' Schaffen gehörten unter anderem Porträts von Zeitgenossen und seriell entwickelte Landschaftsbilder sowie temporäre Skulpturen mit Objekten des Alltags, hieß es. Die Ausstellung mit Arbeiten des 1968 in Remscheid geborenen Künstlers ist bis zum 29. Juni im Albertinum zu sehen.
Tillmans schaffe Werke, die auf einzigartige Weise erlauben, das menschliche Zusammenleben zu beobachten. „Mit seiner gesteigerten Aufmerksamkeit für die Dinge, die ihn und uns umgeben, lassen uns seine ikonischen Fotografie-Installationen, seine Video-, Text- und Musikarbeiten sowie seine Künstlerbücher die Welt durch seine Augen sehen“, hieß es. Seit fast vier Jahrzehnten wachse Tillmans' Bilderkosmos kontinuierlich. Der 56-jährige Künstler lebt in Berlin und London.
Fotoausstellung über späte DDR
Cottbus (epd). Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst zeigt ab März eine Ausstellung über die späte DDR und die Umbruchzeit der frühen 90er Jahre. Unter dem Titel „An den Rändern taumelt das Glück“ werden am Standort Dieselkraftwerk Cottbus mehr als 360 Fotografien gezeigt, teilte das Museum am 21. Februar mit. Die Ausstellung eröffne eine neue Perspektive auf die Zeit. Sie ist vom 1. März bis zum 11. Mai zu sehen.
Gezeigt würden Werke renommierter Fotokünstlerinnen und Fotokünstler sowie beinahe vergessener Fotografinnen und Fotografen, die in der DDR lebten und arbeiteten, hieß es. Ergänzt werde die Ausstellung durch Sichtweisen ausländischer Fotografinnen und Fotografen, die das Land aus einer externen Perspektive dokumentierten.
Das Spektrum der ausgestellten Bilder reiche von dokumentarischen Praktiken über inszenierte Kompositionen bis hin zu experimentellen Fotografien und Fotofilmen, hieß es. Die Ausstellung stelle künstlerisch-dokumentarische Fotografie in Beziehung zu sozial-dokumentarischen Arbeiten. Dabei rücke stets der Mensch in den Mittelpunkt, „als Individuum, als Teil einer Gemeinschaft und im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart“. Dies ermögliche eine facettenreiche Auseinandersetzung mit dem damaligen Alltag und den politischen Umbrüchen der Zeit.
Gezeigt werden Angaben zufolge unter anderem Arbeiten von Christiane Eisler, Margit Emmrich, Christine Furuya Gössler, Ingrid Hartmetz, Ilse Ruppert, Einar Schleef, Jim Schütz und Gabriele Stötzer. Die Ausstellung war zuvor bereits in Weimar zu sehen.
Bund gibt Menzel-Zeichnung an jüdische Erben zurück
Berlin (epd). Der Bund hat eine Kreidezeichnung von Adolph von Menzel (1815-1905) an die Erben des Breslauer Unternehmers und Kunstsammlers Leo Lewin (1881-1965) zurückgegeben. Wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am 21. Februar in Berlin mitteilte, hatten die Nazis das Werk Lewin verfolgungsbedingt zwischen 1935 und 1941 entzogen. Über Umwege sei das Kunstwerk in den Besitz des Bundes und zur Kunstverwaltung des Bundes gekommen. Zuletzt befand sich die DIN A 4-große Studie zu einem preußischen Offizier als Leihgabe im Kupferstichkabinett der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Roth bekräftigte den Willen der Bundesregierung, NS-Raubkunst an die Erben zurückzugeben: „Wir wollen gerechte und faire Lösungen im Sinne der Opfer des nationalsozialistischen Deutschlands.“ Lewin hatte die Zeichnung 1928 zusammen mit 51 weiteren Werken Adolph von Menzels von der Königlichen Nationalgalerie in Berlin im Tausch gegen Arbeiten von Max Slevogt (1868-1932) aus seiner Sammlung erworben.
Bereits vor Beginn der NS-Herrschaft waren Lewin und sein Textilunternehmen den Angaben zufolge Ziel antisemitischer Anfeindungen in der völkischen Presse. Nach 1933 sei er etlichen nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen, die zum schrittweisen Verlust seines Vermögens führten. Unter dem Druck der Verhältnisse habe Lewin Teile seiner Kunstsammlung unter anderem in mehreren Auktionen verkauft. Nach der Enteignung seines Unternehmens im April 1938 musste er 1939 nach Großbritannien fliehen. Sein in Deutschland verbliebenes Vermögen wurde beschlagnahmt.
Wo abstrakte Kunst den Schmerz der Welt abbildet

epd-bild/Hans-Jürgen Bauer
Düsseldorf (epd). Bracha Lichtenberg Ettinger geht es um das gefährdete Leben von Frauen, Müttern und Mädchen. Die israelische Malerin zeigt zum ersten Mal in einer Einzelausstellung in einem deutschen Museum ihre abstrakten Gemälde und Zeichnungen. „Die Abstraktion muss den Schmerz der Welt treffen“, betonte die Künstlerin und ausgebildeten Psychoanalytikerin am Donnerstag im Vorfeld der Schau, die so heißt wie sie selbst. „Bracha Lichtenberg Ettinger“ bis zum 31. August im Museum K21 in Düsseldorf zu sehen
Oft empfinde sie abstrakte Kunst als zu kühl, zu wenig mitfühlend, sagte Lichtenberg Ettinger. Sie wolle aber im Gegenteil Mit-Leid hervorrufen, „Com-Passion“, ein Leid, das Schmerzen kennt und Menschen verbindet.
Ihre kleinformatigen Bilder komponieren oft Frauengesichter und weibliche Körper. Fotos dienten ihr dabei als Vorlage, sagt sie, besonders Abbildungen von Frauen unmittelbar vor ihrem Tod, etwa vor den Gaskammern in Auschwitz. Bracha Lichtenberg Ettinger stammt nach eigenen Angaben aus einer deutsch-jüdischen Familie. Ihre Großmutter wurde in Auschwitz ermordet. Ihre Eltern, die auch auf einem Bild eines bearbeiteten Fotos zu sehen sind, konnten aus dem Ghetto in Lodz rechtzeitig nach Palästina fliehen. Ihre Tochter wurde dort im März 1948 wenige Monate vor der Gründung des Staates Israel geboren. Als Künstlerin nennt sie sich BRACHA: „Das hebräische Wort heißt Segen“, mit dieser Bedeutung habe sie sich lange beschäftigt.
„Alles benötigt meine Fürsorge“
Die meisten ihrer Werke sind in Violett- und Rot-Tönen gehalten. Manchmal zitiert sie Kunstwerke, etwa den „Schrei“ von Edvard Munch oder „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ von Vermeer van Delft. Auch Spuren italienischer Kunst seien zu finden, da das eine ihrer wichtigsten Inspirationsquellen sei. Viele Bilder wirken, als hätten sie eine gewebte Struktur. Diesen Effekt erreiche sie, indem sie Ölfarben Asche beimenge, erläuterte die Künstlerin.
Geschichten von Religionen und Mythen durchziehen sowohl ihre Bilder als auch ihre Lebenshaltung. Als Beispiel nennt sie die Geschichte von Kain und Abel. Gott sage nach der Erzählung der Bibel zu den Brüdern: „Wenn Du wohl tust, trägst Du den anderen.“ Dieses fürsorgliche Tragen anderer Menschen sei ihr Prinzip: „Alles benötigt meine Fürsorge“. Sie hoffe, fügt sie hinzu, dass Betrachterinnen und Betrachter diese Haltung in den Bildern erkennen könnten.
Deutschland für eigene Ausstellungen bisher gemieden
Geburt und Tod bestimmen die Gedankenwelt der Künstlerin, die in Tel Aviv und Paris lebt und nach wie vor als Psychoanalytikerin arbeitet. Der Mensch sei nie nur im Hinblick auf den Tod zu verstehen, sondern immer als geborenes Wesen. Gebärende Frauen, wiederum in abstrakten Werken angedeutet, sind Themen mehrerer Bilder. Eine ganze Serie ist nach der griechischen Sagengestalt Eurydike genannt. Als Orpheus sie nach ihrem Tod aus dem Totenreich befreien wollte, widersetzte er sich aber dem Gebot, sich nicht nach ihr umzudrehen. So starb Eurydike ein zweites Mal. „Das geht uns oft so im Leben, dass wir aufgrund von eigenen Erinnerungen oder Urteilen anderer Menschen im übertragenen Sinn sterben und wieder geboren werden.“ Aus solchen Prozessen entstehe die Lebenslust. Auch davon erzähle ihre Kunst.
Wegen der Geschichte ihrer jüdischen Familie habe sie Deutschland für eigene Ausstellungen bisher gemieden, sagt Lichtenberg Ettinger. Da die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen aber aus einer Sammlung von Bildern des Malers Paul Klee hervorging, den die NS-Diktatur ins Exil getrieben habe, eigne sich dieses Museum für ihre Werke: „Verwandlung ist hier überall präsent.“
Bundesstiftung Baukultur wird 25 Jahre alt
Potsdam (epd). Die Bundesstiftung Baukultur begeht in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsprogramm stehe unter dem Titel „Demokratie und Räume“, teilte die Stiftung am 21. Februar in Potsdam mit. Am 9. September sei dazu ein Symposium im ehemaligen Plenarsaal des Bundestags in Bonn geplant. Dazu lade die Stiftung gemeinsam mit dem Bundesbauministerium und dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein.
Thematische Schwerpunkte des Jubiläumsprogramms sind den Angaben zufolge unter anderem das menschen- und klimagerechte Bauen und Umbauen, gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land sowie der Zusammenhang zwischen Demokratie und Räumen. Auch die Transformation im Bauwesen und die baukulturelle Bildung würden in den Blick genommen, hieß es.
Vor 25 Jahren wurde nach Stiftungsangaben auf Anregung vor allem von Architekten unter Beteiligung des Bundesbauministeriums und des damaligen Kulturstaatsministers der Bundesregierung die „Initiative Architektur und Baukultur“ gegründet. Daraus ging 2006 die Bundesstiftung Baukultur hervor, die seit 2008 ihren Sitz in Potsdam hat. Vorstandsvorsitzender ist seit 2013 der Architekt und Stadtplaner Reiner Nagel.
Die Stiftung trete als unabhängige Einrichtung für hochwertiges Planen und Bauen ein, hieß es. Ziel sei, die gebaute Umwelt als wichtigen Faktor für Lebensqualität zu einem gemeinschaftlichen Anliegen zu machen.
Intendant der Händel-Festspiele gestorben
Halle (epd). Der Intendant der Händel-Festspiele in Halle, Bernd Feuchtner, ist tot. Er starb unerwartet im Alter von 75 Jahren, wie die Stadt Halle und die Stiftung Händel-Haus am 19. Februar gemeinsam mitteilten. Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) sagte, die Nachricht habe bei ihm große Trauer ausgelöst. Die Stadt Halle sei ihm zu großem Dank verpflichtet und werde ihn und seine Schaffenskraft in bester Erinnerung behalten.
Feuchtner hatte bis zuletzt die Stiftung Händel-Haus geleitet. Seit Mai 2023 war er zugleich Intendant der jährlichen Händel-Festspiele. Er habe dieses Amt in einer schwierigen Phase angetreten und sich der neuen Aufgabe mit Leidenschaft und großem Einsatz angenommen, betonte Geier.
Sachsen-Anhalts Kulturstaatssekretär Sebastian Putz (CDU) würdigte den Verstorbenen für sein „unermüdliches Engagement“ und seine „künstlerische Vision“. Damit habe er das kulturelle Leben des Landes bereichert. „Seine Arbeit hat nicht nur die Festspiele, sondern auch das Ansehen Sachsen-Anhalts als Zentrum der Barockmusik gestärkt“, hob Putz hervor. Mit ihm verliere man einen leidenschaftlichen Förderer der Musik.
Feuchtner wurde 1949 in Nürnberg geboren. Er studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Geographie in Frankfurt am Main. 1986 veröffentlichte er ein Standardwerk über den russischen Komponisten Dimitri Schostakowitsch (1906-1975). Später arbeitete er als Musikkritiker und -redakteur unter anderem für die „Frankfurter Rundschau“, die „Süddeutsche Zeitung“ und den Hessischen Rundfunk. Danach war er als Operndirektor unter anderem in Heidelberg und Salzburg tätig.
Uni Jena digitalisiert das europäische Kulturerbe
Jena (epd). Die Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligt sich an der europaweiten Kartierung und Digitalisierung des Kulturerbes auf dem Kontinent. Ziel des Projekts sei, die inzwischen große Zahl an dreidimensional digital erfassten Monumenten und Kulturobjekten zu sichern und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, teilte die Hochschule am 19. Februar mit.
Schon heute lassen sich laut dem Projektleiter für Jena, Sander Münster, historische Bauwerke virtuell als dreidimensionale Ansichten auf dem Smartphone oder am Rechner betrachten. Mithilfe von historischen Rekonstruktionen könnten etwa Touristen, die sich beispielsweise Jena anschauen, auch nicht mehr erhaltene Orte nacherleben.
Laut Münster gibt es bereits viele dieser Angebote. Die Datensätze seien jedoch auf den unterschiedlichsten Servern gespeichert und nicht oder nicht einheitlich katalogisiert. Dies erschwere es, die Angebote zu nutzen. In einem ersten Schritt plant das europaweite Projekt die 3D-Inhalte in bereits bestehenden Datenpools digital aufzubereiten.
In einem zweiten Schritt wollen die Forscher Lücken im Bestand schließen, die etwa auch dadurch entstehen, wenn fehlende Schlagworte eine Identifikation des Gegenstands erschweren. Bei der einheitlichen Kartierung soll laut Münster auch Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen.
Auf diese Weise sollen beispielsweise auf Pilgerpfaden wie dem Jakobsweg auch nicht mehr erhaltene Wegstationen digital sichtbar werden. Andere Inhalte könnten in musealen Schulprojekten zum Einsatz kommen oder Wissen über historische Handwerksarbeiten erlebbar machen.
Franz-Hessel-Preis erstmals auf Leipziger Buchmesse
Leipzig (epd). Der deutsch-französische Franz-Hessel-Preis für zeitgenössische Literatur wird in diesem Jahr erstmals auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Geehrt werden jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin der französischsprachigen und der deutschsprachigen Literatur, teilte die Buchmesseleitung am 17. Februar in Leipzig mit. Sie seien meist im Nachbarland noch wenig bekannt, ihre Werke weitgehend noch nicht übersetzt. Die Auszeichnung ist mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Die Übergabe findet am 28. März im Congress Center Leipzig statt.
Seit 2010 wird der Preis gemeinsam von den deutschen und französischen Kulturministerinnen und -ministern ermöglicht. Namensgeber ist der Schriftsteller und Übersetzer Franz Hessel (1880-1941), der mit seinem Leben und Werk ein Vermittler zwischen beiden Ländern und Kulturen war. Verliehen wird der Preis alternierend in Deutschland und Frankreich.
Federführend sind die deutsche Stiftung Genshagen und die Villa Gillet in Frankreich. Die Vergabe soll dazu beitragen, „herausragende Literatur über die Ländergrenzen hinweg zu präsentieren sowie den literarischen und intellektuellen Dialog zwischen Deutschland und Frankreich zu vertiefen“, hieß es. Aktuell ermöglichen die Auszeichnung die deutsche Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) und französische Kulturministerin Rachida Dati.
In der Endrunde sind Zora del Buono mit „Seinetwegen“ und Andre Kubiczek mit „Nostalgia“ sowie mit Werken in französischer Sprache Helene Gaudy („Archipels“) und Beata Umubyeyi Mairesse („Le convoi“). Die Leipziger Buchmesse findet vom 27. bis 30. März statt.
Ehrenbürgerwürde für Freiherr Speck von Sternburg
Leipzig (epd). Der Kunstmäzen Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg hat am 17. Februar die Ehrenbürgerwürde der Stadt Leipzig erhalten. Damit wurde sein jahrelanges Engagement für Kunst und Kultur sowie für Vereine und Institutionen gewürdigt, wie die Stadtverwaltung Leipzig mitteilte. Der 90-jährige Freiherr Speck von Sternburg sei zudem ein nationaler und internationaler Botschafter der Stadt Leipzig.
Die Ehrenbürgerwürde wurde ihm im Rahmen eines Festaktes im Alten Rathaus an seinem 90. Geburtstag verliehen. Der Mäzen habe maßgeblichen Anteil daran, dass die bedeutende Kunstsammlung seines Ururgroßvaters, Maximilian Freiherr Speck von Sternburg, als unkündbare Dauerleihgabe dem Museum der bildenden Künste in Leipzig zur Verfügung steht und damit auch der Öffentlichkeit erhalten bleibt, hieß es.
Zudem hatte er den Angaben zufolge Grundstücke des Schlossparks Lützschena angekauft, um eine öffentliche Nutzung des Parks zu erhalten. Freiherr Speck von Sternburg gehört außerdem zu den Gründungsmitgliedern des Vereins Kinderhospiz Bärenherz Leipzig, für den er sich aktiv einsetzt.
Die Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung der Stadt Leipzig. Sie wird an Menschen vergeben, die sich in herausragender Weise um das Gemeinwohl und die Stadt Leipzig verdient gemacht haben.
Der Leipziger Stadtrat hatte im November beschlossen, die DDR-Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns und Freiherr Speck von Sternburg zu ehren. Oltmanns hatte bereits im Januar die Ehrenbürgerwürde erhalten. Gewürdigt wurde sie für ihr jahrzehntelanges Engagement für das Erbe der friedlichen Revolution.
Abriss der Dresdner Carolabrücke soll beginnen
Dresden (epd). Die teilweise eingestürzte Dresdner Carolabrücke wird nun doch schneller abgetragen als zunächst erwartet. In den vergangenen Tagen seien mehrere Spanndrähte gebrochen, teilte die Stadtverwaltung Dresden am 21. Februar mit. Daraus habe sich eine neue Gefährdungslage ergeben. Der geordnete Abbruch der Brücke müsse schnellstmöglich erfolgen.
Auf ein langwieriges Vergabeverfahren werde wegen der akuten Gefahr des Einsturzes verzichtet, hieß es. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) erklärte: „Es ist Gefahr in Verzug.“ Derzeit würden die Restsicherheiten der Brücke schwinden. Ein Gutachten hatte bereits im Dezember ergeben, dass die am 11. September 2024 teilweise eingestürzte Carolabücke komplett abgerissen werden muss.
Die aktuellen Spanndrahtbrüche stehen laut Stadtverwaltung sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit den hohen Temperaturschwankungen der sonnigen Wintertage mit sehr kalten Nächten. Falls es zu keinen weiteren Schadensereignissen kommt, soll die Durchfahrt von Schiffen auf der Elbe für dringende Transporte unter ständiger Überwachung ermöglicht werden.
Die Direktvergabe für den Abriss erfolge zeitnah, hieß es. In Vorbereitung der Abbrucharbeiten sind für Montag und Dienstag Drohnenüberfluge im Bereich der Carolabrücke zur Unterstützung der Kampfmittelsondierung in der Elbe geplant.
Vor den neuerlichen Brüchen der Spanndrähte wäre laut Stadtverwaltung eine europaweite Ausschreibung des Brückenabbruchs rechtlich notwendig gewesen. Mit der neuen Gefahrenlage habe sich die Situation jedoch geändert, eine Direktvergabe sei nun möglich, hieß es.
Filme der Woche
Heldin
Anhand einer Nachtschicht verdeutlicht „Heldin“ die ganz normale Ausnahme-Arbeit in einem Krankenhaus. Im Mittelpunkt steht Floria (Leonie Benesch), die auf einer chirurgischen Station eines Schweizer Krankenhauses arbeitet. Der Alltag ist kräftezehrend, überall sind Patienten und Patientinnen, denen man gerecht werden muss, immer wieder werden die Abläufe von einfachen Wünschen und akuten Notfällen unterbrochen. Gemeinsam haben Benesch, Regisseurin Petra Volpe und Kamerafrau Judith Kaufmann hart daran gearbeitet, dass man glaubt, dass hier Leute am Werk sind, die alle Handgriffe und Wege Hunderte Male am Tag absolvieren. Der Film fängt die Hektik, den Stress und die Verantwortung ein, die der Beruf mit sich bringt. Er ist spannend wie ein Thriller und auf unterschiedlichsten Ebenen berührend. Gleichzeitig hat er eine wichtige Botschaft: Der personelle Notstand in der Pflege gehört dringend auf die politische Agenda.
Heldin (Deutschland/Schweiz 2025). Regie und Buch: Petra Volpe. Mit: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Selma Adin. Länge: 92 Min. FBW: besonders wertvoll. Film des Monats der Jury der Evangelischen Filmarbeit.
Like A Complete Unkown
Es herrscht große gesellschaftliche Aufruhr in den 1960er Jahren. Mittendrin: Der 19-jährige Bob Dylan (Timothée Chalamet). Seine Heimat in Minnesota hat das Ausnahmetalent zurückgelassen und tobt sich nun im New Yorker West Village kreativ aus. Mit der Gitarre bewaffnet, versucht Dylan in der Umbruchszeit seinen eigenen Weg zu finden und Beziehungen zu knüpfen. Als er 1965 auf dem Newport Folk Festival mit einer E-Gitarre auf die Bühne steigt, verändert sich die Musikwelt für immer. Das Biopic über Dylans frühe Jahre, den Weg zum Star eigener Ordnung und die Rebellion gegen die Vereinnahmung durch Musikindustrie und dogmatische Fans glänzt mit einem herausragenden Timothée Chalamet in der Hauptrolle, der die Songs selbst interpretiert. Diese starken Performances und die große Rolle, die die Musik einnimmt, machen den Film sehenswert.
Like A Complete Unkown (USA 2024). Regie: James Mangold. Buch: Jay Cocks, James Mangold. Mit: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning. Länge: 140 Min.
Sing Sing
John „Divine G“ Whitfield (Colman Domingo) sitzt wegen Mordes 24 Jahre im Hochsicherheitsgefängnis Sing Sing ein. Der Gefängnisalltag ist trüb. Johns Lichtblick ist das Theaterprogramm. Hier, im Häftlingstheater, kann John auf der Bühne der Alltagsträgheit entkommen und die Wände des Gefängnistrakts für einen Moment vergessen. Als dann der eigenwillige Clarence „Divine Eye“ Maclin (spielt sich selbst) der Theatergruppe beitritt, gerät die kreative Routine aus dem Gleichgewicht, denn dieser will lieber Komödien spielen. Durch die dokumentarisch anmutende Ästhetik und ein großartiges Ensemble aus echten Ex-Häftlingen bekommt der Film eine seltene Authentizität und rohe Emotionalität. Berührend, humorvoll und eindringlich erzählt er von der Kraft der Kunst.
Sing Sing (USA 2023). Regie: Greg Kwedar. Buch: Greg Kwedar, Clint Bentley. Mit: Colman Domingo, Clarence Maclin, Paul Raci, Sean San José. Länge: 107 Min.
Bridget Jones - Verrückt nach ihm
Renée Zellweger kehrt in ihre Paraderolle der Bridget Jones zurück. Seit dem Tod ihres Mannes Mark (Colin Firth) vor vier Jahren kümmert sich die alleinerziehende Mutter fürsorglich um ihre Kinder, den neunjährigen Billy und die vierjährige Mabel. Ihre gutherzigen Freunde unterstützen sie dabei unbeirrt. Durch die Hilfe ihres Umfelds beflügelt, wagt sich Bridget wieder in die Arbeitswelt. Schnell wird ihr aber klar, dass der Balanceakt zwischen Kariere, Familie und dem aufblühenden Liebesleben stetig schwieriger wird. Ihr ehemaliger Liebhaber Daniel Cleaver (Hugh Grant) und der liebreizende junge Roxster (Leo Woodall) buhlen um Bridgets Aufmerksamkeit. Ähnlich wie die Hauptfigur hat auch der Film ein wenig Anlaufschwierigkeiten, findet dann aber mit gewollten Peinlichkeiten und charmanten Momenten seinen Groove.
Bridget Jones - Verrückt nach ihm (USA/Großbritannien/Frankreich 2025). Regie: Michael Morris. Buch: Helen Fielding, Abi Morgan. Mit: Renée Zellweger, Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Eiiofor, Leo Woodall. Länge: 124 Min.

