 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 18/2024 - 03.05.2024
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 18/2024 - 03.05.2024
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 18/2024 - 03.05.2024
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 18/2024 - 03.05.2024

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Suizidrate senken. Dazu müsse das Thema „aus der Tabuzone“ herausgeholt werden, sagte er bei der Vorstellung der neuen Suizidpräventionsstrategie der Bundesregierung. Geplant ist eine bundesweite Koordinierungsstelle für Beratungs- und Kooperationsstellen. Auch soll gemeinsam mit den Ländern eine zentrale Krisendienst-Notrufnummer eingerichtet werden. Kirchen und Verbände begrüßten die Pläne, forderten aber auch mehr Präventionsangebote. Zudem pochten sie auf die Verabschiedung eines verbindlichen Suizidpräventionsgesetzes: „Ein Strategieplan ersetzt keine gesetzlichen Regelungen“, so das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken.
Als eine Pflegekraft in einem Berliner Seniorenheim jüngst Polizei und Feuerwehr alarmierte, weil bei ihrer Ablösung Fachpersonal für die Nachtschicht fehlte, sorgte das bundesweit für Schlagzeilen. Die Einrichtung sieht darin einen bedauerlichen Einzellfall. Doch das scheint nicht so zu sein. Fachleute bestätigen die oft schlechte Personalausstattung in Nachtdiensten. Im Interview mit epd sozial sagt Peter Koch, Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe: „Uns fehlen schon mehr als 30 Prozent Personal.“ Und: „Es gibt sicherlich Fälle, in denen eine Besetzung des Nachtdienstes auch in anderen Einrichtungen schwierig ist und teilweise mit Unterbesetzung gefahren werden muss.“
Für Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch passen rechter Extremismus und die Beschäftigung bei der Diakonie nicht zusammen: „Wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen.“ Darüber gibt es nun eine Debatte. Arbeitsrechtler betonen, dass die Mitgliedschaft und das Engagement für eine Partei keine Kündigungsgründe seien. Es könne aber Fälle geben, in denen Beschäftigten mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten.
Kinder und Jugendliche, die an Diabetes Typ I leiden, können nur unter besonderen Umständen den Grad einer Schwerbehinderung erlangen. Dazu ist nach einem Urteil des Landessozialgerichtes Celle eine „gravierende Beeinträchtigungen ihrer Lebensführung“ nötig. Es komme auf die Gesamtbetrachtung aller Lebensbereiche an. Dabei seien „strenge Anforderungen“ anzulegen. Gute Schulnoten, eine altersgerechte Lebensführung und viele Freunde sprechen dem Gericht zufolge eher gegen solch eine schwerwiegende Benachteiligung.
Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre[Mail(mailto:dbaas@epd.de).
Ihr Dirk Baas

Berlin (epd). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Suizidrate senken. Das Thema müsse „aus der Tabuzone“ herausgeholt werden, sagte er am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung der Suizidpräventionsstrategie der Bundesregierung. Zwar hätten sich die Zahlen seit den 80er Jahren fast halbiert, trotzdem seien die Selbsttötungen mit rund 10.000 pro Jahr immer noch hoch.
Um Betroffene zu erreichen und das Thema Suizid zu enttabuisieren, kündigt Lauterbach unter anderem eine Aufklärungskampagne und eine zentrale Krisendienst-Notrufnummer an, die gemeinsam mit den Ländern eingerichtet werden soll. Darüber hinaus sieht die Strategie vor, dass Fachkräfte im Gesundheitswesen für das Thema mit speziellen Schulungen sensibilisiert werden. Alle Beratungs- und Kooperationsangebote sollen von einer bundesweiten Stelle koordiniert werden.
Die Präventionsangebote sollen sich vor allem auf die betroffenen Hochrisikogruppen ausrichten, sagte Lauterbach. Dazu gehören etwa ältere Männer, die schon vorher psychische Probleme hatten. Diese Gruppe erreiche man beispielsweise in Krankenhäusern oder Seniorenheimen. Auch Menschen, die bereits einmal einen Suizidversuch unternommen haben, seien gefährdet. Für diese Menschen brauche es „eine systematische Betreuung“, kündigte Lauterbach an.
Neben Präventions- und Informationsangeboten kündigte der Gesundheitsminister auch praktische Maßnahmen, wie eine mögliche Reduktion der Packungsgrößen von Schmerzmitteln oder Schutzvorrichtungen wie hohe Zäune an leicht zugänglichen Brücken, Hochhäusern oder Bahnübergängen an. Hierzu sollen mithilfe eines pseudonymisierten Suizidregisters Orte festgestellt werden, an denen Menschen besonders häufig Suizid begehen oder es versuchen.
Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, Ute Lewitzka, zeigte sich alarmiert über die hohen Suizidzahlen. 2022 seien diese um fast zehn Prozent angestiegen. „Die Zahlen zeigen uns, dass die bestehen Angebote und Hilfen nicht ausreichen“, sagte Lewitzka. Es gebe zwar schon viele regionale Angebote, diese seien aber oft zeitlich befristet finanziert. Sie forderte deshalb eine klare Verantwortungsübernahme für eine auskömmliche Finanzierung der Präventionsangebote und eine zeitnahe gesetzliche Verankerung der Präventionsstrategie.
Auch die Diakonie forderte die Regierung auf, die Suizidprävention verbindlich zu regeln. „Eine Strategie allein hilft Menschen mit Suizidgedanken nicht“, sagte Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch: „Wir brauchen jetzt ein Gesetz, das die Infrastruktur für eine wirksame Suizidprävention schafft.“
Um Menschen in Lebenskrisen besser zu erreichen, müssten bestehende Angebote gesichert und ausgebaut werden. Dazu zählt laut Schuch zum Beispiel die Telefonseelsorge, die rund um die Uhr für anonyme Gespräche bereitsteht, jedoch einen hohen Bedarf wahrnimmt, den sie nicht vollständig abdecken könne. Ein weiteres wichtiges Angebot, das es bisher nur in drei Bundesländern gebe, seien psychiatrisch-psychosoziale Krisendienste für Menschen mit Suizidgedanken und anderen psychischen Krisen.
Auch der katholischen Kirche reicht die vorgestellte Präventionsstrategie nicht aus. Der Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe, Prälat Karl Jüsten, und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) drängten ebenfalls auf eine gesetzliche Verankerung der Strategie. „Die heute veröffentlichte Strategie des Bundes zur Suizidprävention liefert zwar erste wichtige Bausteine für die Stärkung der Prävention in Deutschland. Ein Strategieplan ersetzt aber keine gesetzlichen Regelungen“, sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp.
Das ZdK erwarte, „dass Herr Lauterbach bis zum Sommer ein Gesetz zur Suizidprävention vorlegt, wie es der Deutsche Bundestag im Juli 2023 mit großer Mehrheit gefordert hat“. Aus Sicht des ZdK ist ein nachhaltiger Ausbau von professionellen sowie ehrenamtlichen Beratungs- und Hilfsangeboten wesentlich. Dazu zähle ein deutschlandweiter Präventionsdienst unter Einbezug von Telefonseelsorge, sozialpsychiatrischen Diensten und weiteren Versorgungseinrichtungen. Menschen mit Suizidgedanken und ihre Angehörigen sollten laut ZdK rund um die Uhr Anlaufstellen haben, die online und telefonisch erreichbar sind: „Für Menschen mit schwersten, todbringenden Erkrankungen muss das Palliativ-Angebot ausgebaut werden.“
Lauterbach kündigte an, das Suizidpräventionsgesetz in den kommenden Monaten vorlegen zu wollen. Der Bundestag hatte im vergangenen Juli mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Bundesregierung bis Ende Januar ein Konzept zur Vorbeugung und bis Ende Juni auch ein Suizidpräventionsgesetz vorlegen soll.
Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts nehmen sich in Deutschland jährlich fast 10.000 Menschen das Leben. Somit ist die Anzahl der Suizide mehr als dreimal so hoch wie die der Verkehrstoten. Im Jahr 2022 stieg die Anzahl der Suizide von 9.215 im Vorjahr auf 10.119.

Hannover, Berlin (epd). Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie Deutschland haben den jüngst vorgestellten Entwurf für ein Anti-Missbrauch-Gesetz begrüßt. Man unterstütze mit Nachdruck, dass die staatlichen Strukturen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt und zu deren Aufarbeitung deutlich gestärkt werden sollen, heißt es in einer am 29. April veröffentlichten Stellungnahme von EKD und Diakonie.
EKD und Diakonie „tun dies in der Verantwortung dafür, dass auch in der evangelischen Kirche und der Diakonie vielen Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Personen sexualisierte Gewalt angetan wurde. Die Aufklärung, Aufarbeitung und Anerkennung dieser Gewalt wie auch die Unterstützung und Beteiligung der betroffenen Personen sind bleibende Herausforderungen, denen sich die evangelische Kirche und Diakonie stellen“, ist in der Stellungnahme zu lesen.
Zugleich stellen Kirche und Diakonie aber auch Lücken in dem Entwurf fest. Das gelte insbesondere für die sehr wichtigen staatlichen Standardsetzungen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt. „Zwar muss jede Institution, in der (...) sexualisierte Gewalt ausgeübt wurde, ihrer Verantwortung zur Aufarbeitung und Unterstützung betroffener Personen nachkommen. Nur der Staat aber kann gesamtgesellschaftlich verbindliche Standards setzen und so eine einheitliche und umfassende Aufarbeitung und Prävention sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft vorantreiben und die Anerkennung erlittenen Unrechts gestalten“, heißt es in dem Papier. Hier bleibe der Entwurf jedoch leider hinter dem zurück, was die öffentliche Diskussion im Vorfeld erwarten ließ.
Die Bevollmächtigte der EKD in Berlin, Anne Gidion, und Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch, plädieren in der Stellungnahme für eine Aufnahme von Regelungen zu finanziellen Anerkennungsleistungen in das Gesetz. „Hier wäre es aus unserer Sicht hochbedeutsam, gesamtgesellschaftliche Standards für Anerkennungsleistungen in allen Kontexten zu definieren, in denen sexualisierte Gewalt stattfindet“, heißt es in dem Papier.
Und weiter: „Die aktuellen Fragen zur Neuregelung von Anerkennungsleistungen für Betroffene in Evangelischer Kirche und Diakonie könnten durch gesetzliche Standards, die gesamtgesellschaftlich gelten, eine wichtige Fundierung erhalten. Diese gesetzlichen Standards würden eine rechtssichere Gestaltung solcher Leistungen unterstützen.“ Daneben sei es wichtig, dass Betroffene aus allen gesellschaftlichen Kontexten einen Zugang zu Anerkennungsleistungen erhalten: „Für Betroffene wäre dies ein wichtiges Signal, dass sie gesamtgesellschaftlich das Recht auf Anerkennung erlittenen Unrechts haben.“
EKD, Diakonie und Betroffenenvertreter diskutieren schon seit Längerem im sogenannten Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt über eine Neuregelung der Anerkennungsleistungen, die zu einer Vereinheitlichung innerhalb der 20 Landeskirchen und der Diakonie-Landesverbände führen soll.
Das Bundesfamilienministerium hatte Mitte April einen Entwurf für ein „Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ veröffentlicht. Kern des Gesetzes ist die Aufwertung und gesetzliche Verankerung des Amtes der Missbrauchsbeauftragten sowie die dauerhafte Einrichtung des Betroffenenrats und der Aufarbeitungskommission bei der oder dem Missbrauchsbeauftragten. Der Entwurf soll voraussichtlich Ende Mai im Bundeskabinett beraten werden.
Die bei der Missbrauchsbeauftragten angesiedelte Unabhängige Aufarbeitungskommission begrüßt den Entwurf ebenfalls, dringt aber auf die Erweiterung der Rechte für Betroffene und der Handlungsmöglichkeiten der Kommission. Die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission, Julia Gebrande, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), wenn man ein Recht auf individuelle Aufarbeitung verankern wolle, müssten Betroffene „Zugang zu all den Akten bekommen, die über ihre Person angelegt wurden“. Außerdem müssten „sie unterstützt werden, um die Informationen dann gut einordnen zu können“. Der Gesetzentwurf sieht ein Akteneinsichtsrecht bei Jugendämtern vor und auch fachliche Unterstützung für die Betroffenen. Unklar ist, ob die Finanzierung ausreicht.
Die Aufarbeitungskommission fordert in ihrer Stellungnahme, dass das individuelle Recht auf Aufarbeitung ausdrücklich im Gesetz verankert werden soll. Im Entwurf ist das nicht der Fall. Die Kommission begrüßt, dass ihr Aufgabenbereich ausgeweitet werden soll, kritisiert aber, dass dies mit der bisherigen Ausstattung nicht möglich sei.
Als wichtige Verbesserung würdigt die Aufarbeitungskommission die Berichtspflicht an Bundestag, Bundesrat und Regierung, der die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus künftig nachkommen muss. Die Ampel-Koalition hatte sich darauf verständigt, um das Amt aufzuwerten und die Politik regelmäßig mit dem Thema zu befassen. Eine solche Berichtspflicht brauche es auch für die Kommission, sagte Gebrande dem epd, „weil den Berichten der Betroffenen damit mehr Gewicht verliehen wird“.

Berlin (epd). Die Forscherin Julia Gebrande legt den Finger in die Wunde: In Deutschland fehlen einheitliche Standards, wie die Aufarbeitung von Missbrauch erfolgt. Die liege immer noch in der Verantwortung der Institutionen. „Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Betroffenenbeteiligung und wie sie organisiert wird“, so die Expertin. Die Fragen stellte Bettina Markmeyer.
epd sozial: Gibt es in Deutschland eine unabhängige Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Kirchen und anderen Institutionen?
Julia Gebrande: Es ist in Deutschland sehr uneinheitlich, wie Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs stattfindet. Wir haben einen Flickenteppich unterschiedlichster Formen von Aufarbeitungsprojekten und von Aufarbeitungsprozessen in den Institutionen. Die eine, unabhängige Aufarbeitung gibt es nicht, weil dieser Prozess den Institutionen selbst überlassen ist. Für die beiden großen christlichen Kirchen gilt zwar die gemeinsame Erklärung mit der Unabhängigen Beauftragten, und für den Sport ist das zukünftige Zentrum für Safe Sport zuständig - jedoch ist die konkrete Aufarbeitung immer noch in der Verantwortung der Institutionen. Deshalb war es das Anliegen unserer Kommission, verbindliche Standards für die Institutionen zu formulieren, die aufarbeiten wollen. Unabhängigkeit ist dabei die wichtigste Voraussetzung. Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Betroffenenbeteiligung und wie sie organisiert wird.
epd: Warum fordert die Aufarbeitungskommission ein Akteneinsichtsrecht
Gebrande: Vielen Betroffenen, die sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigen, fehlt Wissen in ihrer Biografie, zum Beispiel über die Täter und Täterinnen oder die Rolle von Angehörigen und Behörden. Wenn man ein Recht für Betroffene auf individuelle Aufarbeitung verankern will - wie es im geplanten Gesetz angelegt ist - bedeutet das auch, dass Menschen Zugang zu all den Akten bekommen, die über ihre Person angelegt wurden. In der Praxis ist es jedoch wichtig, dass sie unterstützt werden durch Fachkräfte, um überhaupt den Zugang zu bekommen und um die Informationen dann gut einordnen zu können.
epd: Was brauchen Betroffene, die der Aufarbeitungskommission ihre Geschichte anvertrauen, am dringendsten?
Gebrande: Viele Betroffene berichten uns, dass sie zum ersten Mal darüber reden, was ihnen widerfahren ist. Deshalb ist es ganz wichtig, dass sie einen geschützten Raum zur Verfügung haben und sicher sein können, dass ihre Geschichte hier in guten Händen ist. Dazu gehört, dass ihnen geglaubt wird und dass sie die Möglichkeit haben, von ihren Erfahrungen selbstbestimmt zu erzählen. Sehr viele Betroffene wünschen sich, dass mit diesen persönlichen Erfahrungsberichten etwas geschieht: dass Konsequenzen gezogen werden, dass Empfehlungen ausgesprochen werden für die Gesellschaft und an die Politik. Sie sagen: Ich möchte meine Geschichte erzählen, damit so etwas nie wieder passiert, wie das, was mir widerfahren ist.

Gent (epd). Die Kommission und die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wollen die vereinbarte Asylrechtsverschärfung so schnell wie möglich umsetzen. Die Kommission stellt den Staaten dafür beratende Teams zur Seite, um sie bei den nächsten Schritten zu unterstützen, wie EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am 30. April zum Abschluss der europäischen Innenministerkonferenz im belgischen Gent erklärte.
Im Juni will die Kommission zudem einen Stufenplan für die Umsetzung der Reform vorlegen. Dies geschehe drei Monate vor dem eigentlichen Zeitplan, betonte Johansson. Bis Januar 2025 müssen die EU-Staaten dann nationale Pläne zur Umsetzung vorlegen.
Nach jahrelangen Verhandlungen hatte das EU-Parlament am 10. April die umstrittene Reform des EU-Asylsystems gebilligt. Das Gesetzespaket sieht unter anderem vor, dass Schutzsuchende direkt nach der Einreise in die EU eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Dafür sollen die Menschen zunächst in Zentren an der Grenze kommen. Auch sollen Asylsuchende mit geringer Bleibechance schneller und direkt von den EU-Außengrenzen abgeschoben werden. Dahinter stehen die sogenannten Grenzverfahren. Kritiker befürchten daher systematische Haft an den Außengrenzen.
In Rumänien und Bulgarien würden derzeit Pilotprojekte umgesetzt, die im Grundsatz bereits die Grenzverfahren anwendeten, erklärte Johansson. Beide Staaten zeigten „beeindruckende Ergebnisse“. Die Zahl der irregulär Einreisenden sei in Rumänien um 97 Prozent gesunken.
Die belgische Staatssekretärin für Asyl und Migration, Nicole de Moor, nannte als Aufgabe für die kommenden Wochen eine Bestandsaufnahme. Belgien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die EU-Staaten sollen demnach eine Bewertung vornehmen, was sie an Geldern, Infrastruktur oder Trainings brauchen, um die neuen Regeln erfolgreich umzusetzen. Erst anschließend könne man zum Beispiel beantworten, ob weitere Zentren für Screening und Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen gebaut werden müssten.
Die Generaldirektorin der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Amy Pope, begrüßte die EU-Asylreform bei ihrem Besuch in Gent. Die IOM wolle der EU bei der Umsetzung helfen, „um ein resilienteres Migrations- und Asylsystem zu schaffen“, sagte Pope. Dieses müsse aber auch die Rechte von Migranten und Menschen auf der Flucht schützen. Sie sprach sich für „ganzheitliche Lösungsansätze“ aus, bei denen „sichere und reguläre Migrationswege eine wesentliche Ergänzung“ darstellen müssten.
Die Mitgliedsstaaten haben nun eigentlich zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales Recht umzusetzen. Aber auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte eine möglichst rasche Umsetzung an. „Für Deutschland kann ich ganz klar sagen: Wir möchten die notwendigen Anpassungen sehr viel schneller vornehmen“, sagte Faeser am Rande der EU-Innenministerkonferenz. „Das gemeinsame europäische Asylsystem ist der Schlüssel, um Migration zu steuern und endlich zu einer gerechten Verteilung zu kommen. Das wird auch uns in Deutschland und unsere Kommunen in Deutschland entlasten“, sagte sie.
Konkret gehe es in Deutschland um die Anpassung von Gesetzestexten, die Verbesserung des Informationsdatenaustauschs für die Fingerabdruckdatenbank „Eurodac“ und darum, Menschen ohne Bleiberecht schneller in ihre Heimatländer abzuschieben. Die Ministerin kündigte zudem eine Fortsetzung des deutschen Engagements bei der europäischen Grenzschutzagentur Frontex an.
Der Sonderbeauftragte der katholischen Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen, Stefan Heße, kritisierte die EU-Asylreform hingegen. „Zu befürchten ist, dass die humanitären Spielräume dadurch enger werden“, sagte der Hamburger Erzbischof am Dienstag auf dem achten Katholischen Flüchtlingsgipfel in Köln. Dies zeige sich unter anderem daran, dass unschuldige Menschen, darunter auch Kinder, unter haftähnlichen Bedingungen an den EU-Außengrenzen festgehalten werden könnten.
Der Ruf nach einer immer stärkeren Auslagerung des Flüchtlingsschutzes in ärmere Regionen dieser Welt sei geradezu grotesk, kritisierte der Bischof. Denn die Mehrzahl aller Geflüchteten werde ohnehin nach wie vor in Ländern des Globalen Südens aufgenommen. Die EU verhandelt derzeit Migrationsabkommen unter anderem mit Tunesien, Ägypten und Mauretanien.
Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Europäischen Kommission in der EU rund 1,1 Millionen Asylanträge gestellt. Das seien 18 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mainz, Büchenbeuren (epd). Es müssen dramatische Szenen gewesen sein in einer von der evangelischen Kirche angemieteten Wohnung im Hunsrück: Als Polizeibeamte bei einem nächtlichen Einsatz einen syrischen Kurden im Kirchenasyl festnehmen wollten, habe der Mann verzweifelt Widerstand geleistet und sei im Gerangel die Treppe hinuntergestürzt, berichtet die Büchenbeurer Pfarrerin Sandra Menzel. Schließlich habe der Flüchtling sich selbst verletzt, um nur nicht nach Dänemark abgeschoben zu werden. Zwei Monate sind seit der Räumung des Kirchenasyls vergangen, aber erst jetzt hat die evangelische Kirche den Fall öffentlich gemacht - weil die Ereignisse für den Syrer verheerende Folgen hatten. Er sitzt inzwischen im Gefängnis.
Der Kirchenkreis sei besonders überrascht gewesen, dass das Kirchenasyl bei einem nächtlichen Polizeieinsatz ohne jedwede vorhergehende Kontaktaufnahme geräumt worden sei, ärgert sich der Superintendent des Kirchenkreises Simmern-Trarbach, Markus Risch: „Das entspricht nicht den Absprachen mit den Landeskirchen.“ Obwohl den Kirchen keine gesetzlichen Sonderrechte zustehen, wird das Kirchenasyl meist respektiert. Auch die in Sachen Kirchenasyl erfahrenen Verantwortlichen in Büchenbeuren sind erschüttert. Pfarrerin Menzel spricht von einem Skandal.
Dänemark zeichnet sich in der Flüchtlingspolitik seit Jahren durch eine beispiellose Härte aus: Die Regierung verfolgt das erklärte Ziel, die Anzahl der Asylanträge „auf null“ zu reduzieren. Noch dazu ließ das Königreich in jüngster Vergangenheit systematisch den Schutzstatus von Syrern widerrufen und versucht, die Menschen zu einer sogenannten freiwilligen Ausreise in das Bürgerkriegsland zu zwingen. Wer nicht „freiwillig“ ausreist, kann auf unbefristete Dauer in gefängnisartigen Lagern einquartiert werden, solange eine Abschiebung nicht möglich ist. Auch der aus Büchenbeuren abgeholte syrische Kurde, der nach Kirchenangaben zuvor jahrelang unauffällig in Dänemark gelebt, gearbeitet und Steuern gezahlt hatte, stand urplötzlich vor dem Nichts.
Die Zahl der Kirchenasyle ist 2023 weiter gestiegen. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wurden im vergangenen Jahr 1.514 Fälle gemeldet, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Clara Bünger vom März dieses Jahres hervorgeht. Im Jahr davor lag die Zahl der gemeldeten Kirchenasyle demnach bei 1.243, 2021 gab es 822 Fälle.
Weil immer mehr verzweifelte Asylbewerber um Aufnahme ins Kirchenasyl bitten, müsse mittlerweile vielen Hilfesuchenden abgesagt werden, berichtet Superintendent Risch: „Wir prüfen sehr streng.“ Im Fall des kurdischen Kriegsdienstverweigerers habe der Kirchenkreis sich aufgrund der außergewöhnlichen Umstände für eine Aufnahme entschlossen. Durch das Kirchenasyl sollte Zeit gewonnen werden, die Situation des Mannes nochmals durch die deutschen Behörden prüfen zu lassen. Und eigentlich waren sich die verantwortlichen Kirchenleute sicher, dass sich zumindest in diesem Fall das detaillierte Falldossier nicht einfach mit Textbausteinen beantwortet werden würde. Immerhin hätte der Flüchtling - wären für seinen Fall die deutschen statt die dänischen Behörden zuständig - sein Leben völlig unbehelligt weiterführen können, da niemand in Deutschland den Schutzstatus von Syrern infrage stellt und der Mann nichts getan habe, was in Deutschland eine Straftat darstellen würde.
Die Kreisverwaltung Neuwied wirft ihrerseits dem Kirchenkreis vor, sich nicht an die Regeln für das Kirchenasyl gehalten zu haben: „Der Betroffene war vollziehbar ausreisepflichtig und ist dessen Ausreiseverpflichtung nicht nachgekommen, sodass diese zwangsweise durchgesetzt werden musste.“ Zum Ablauf der Räumung will sich der Kreis auf Nachfrage nicht äußern.
In Rheinland-Pfalz, wo sich die Landesregierung öffentlich weiter zu einer „humanitär ausgerichteten Flüchtlingspolitik“ bekennt, gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Polizeieinsätze gegen Kirchenasyle, vereinzelt strebten Kommunalbehörden sogar eine Strafverfolgung von Pfarrerinnen und Pfarrern an. In jüngster Zeit konnten die meisten Fälle einvernehmlich geregelt werden.
Das Mainzer Integrationsministerium räumt auf Nachfrage ein, vorab über das Vorgehen des Kreises informiert worden zu sein: „Nachdem die zuständige Ausländerbehörde bereits einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss für das von der Kirche genutzte Wohnhaus erlangt hatte, bestand hier kein Anlass mehr, das gerichtlich bereits als rechtmäßig erkannte Vorgehen der Behörde fachaufsichtlich anders zu bewerten.“
Nach dem Polizeieinsatz kam es immerhin zu Krisengesprächen zwischen Landesregierung, kommunalen Spitzenverbänden und Kirchen. „Alle Beteiligten stimmten darin überein, dass dazu eine frühzeitige und vertrauensvolle Kommunikation zwischen der asylgewährenden Kirchengemeinde und der zuständigen Ausländerbehörde von entscheidender Bedeutung ist“, heißt es dazu aus dem Integrationsministerium.
Im Fall des Syrers hilft das Versprechen, besser zu kommunizieren, nicht mehr. Wie Okka Senst vom Unterstützerkreis aus Büchenbeuren berichtet, kam der Mann nach der aus Behördensicht erfolgreichen „Rücküberstellung“ in Dänemark vor Gericht. Weil er das Ausreiselager unerlaubt verlassen habe, sei er zu zehn Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft habe mittlerweile Revision gegen das Urteil eingelegt, weil es zu milde sei.
Berlin (epd). Der Bundesrat hat am 26. April für eine Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht gestimmt. Damit hat die Bezahlkarte nun eine Rechtsgrundlage. Beraten wurden auch noch andere Initiativen der Länder zu sozialen Themen. Hier ein kompakter Überblick:
Für Verbesserungen beim BAföG: Der Bundesrat hat sich am 26. April 2024 mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 29. Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) befasst. In seiner Stellungnahme kritisierte er, dass der finanzielle Rahmen in Höhe von 150 Millionen Euro, den der Haushaltsausschuss des Bundestages vorgegeben hatte, nicht ausgeschöpft wurde. Es wäre möglich gewesen, die geplante Studienstarthilfe auf alle Studienanfänger auszudehnen, weil man davon ausgehen könne, dass jeder, der BAföG beziehe, bedürftig sei. Das Prüfen weiterer Voraussetzungen und Nachweise für die Zahlung der Pauschale koste zusätzlich Geld und Zeit.
Außerdem bemängelt die Länderkammer, dass mit der Reform die Bedarfssätze nicht an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst werden. Gerade junge Menschen seien von der Inflation und den steigenden Mieten besonders betroffen. Die Bedarfssätze müssten auf Bürgergeld-Niveau angehoben und die Wohnkostenpauschale erhöht werden.
Gleicher Mutterschutz für Selbständige: Selbständige sollen nach dem Willen des Bundesrates während der Schwangerschaft und nach der Entbindung die gleichen Mutterschutzleistungen erhalten wie Arbeitnehmerinnen. Dies fordert die Länderkammer von der Bundesregierung in einer Entschließung, die auf eine Initiative von Nordrhein-Westfalen und Hamburg zurückgeht.
Der Bundesrat begründet seine Forderung mit dem immer noch auffällig niedrigen Anteil von Frauen bei Unternehmensgründungen und in der Geschäftsführung von Start-Ups sowie kleinen und mittleren Unternehmen. Die deutsche Rechtsordnung enthalte Regelungen für Arbeitnehmerinnen, Beamtinnen und Richterinnen - nicht jedoch für Selbständige. Es müssten gleichwertige Verhältnisse in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geschaffen werden, um den Frauenanteil unter den Selbständigen zu erhöhen. Daher sei es notwendig, die bestehenden Nachteile für selbständige Schwangere oder Mütter in der Zeit nach der Entbindung abzubauen, um so einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern zu leisten.
Strategie für bessere Versorgung mit Arzneimitteln gefordert: In einer Entschließung fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, mit einer nationalen Strategie und gesetzlichen Regelungen die Versorgung mit Arzneimitteln - insbesondere von Kindern und Jugendlichen - nachhaltig zu verbessern. Die Entschließung geht auf eine Initiative von Baden-Württemberg und Bayern zurück und verweist auf Erfahrungen mit knappen Kinderarzneimitteln im Winter 2022/2023. Auch heute bestünden weiterhin zahlreiche Versorgungsengpässe, heißt es in der Begründung.
Um Engpässe zukünftig zu verhindern, seien Vorschriften für den Import und die Lagerhaltung dringend notwendiger Medikamente, insbesondere für Vor-Ort-Apotheken, zu lockern. Zudem müsse es möglich sein, dass die Restbestände von nach einem festgestellten Versorgungsmangel eingeführten Arzneimitteln auch später noch für einen gewissen Zeitraum abverkauft werden dürfen. Nach Ansicht der Länder brauche es zusätzlich mehr Handlungsspielraum für Apotheken beim Austausch von Arzneimitteln. Auch sollen Apotheken in der Lage sein, nach Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt von verordneten, nicht vorrätigen Wirkstoffen abweichen dürfen, wenn diese nicht auf der Substitutionsausschlussliste stehen.
Verordnung zur Personalbemessung in Krankenhäusern zugestimmt: Die Länderkammer stimmte der Verordnung über die Grundsätze der Personalbedarfsbemessung in der stationären Krankenpflege (PPBV) der Bundesregierung zu. Auf deren Basis sollen Krankenhäuser ihren Personalbedarf auf allen Normalstationen für Erwachsene und Kinder sowie auf Intensivstationen für Kinder ermitteln und an das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus übermitteln. Anhand dieser Daten soll festgestellt werden, wie sich die vorhandene Ist-Personalbesetzung zur Soll-Personalbesetzung verhält, die mit Hilfe der PPR erfasst wurde.
Ziel ist es, eine bedarfsgerechte Pflege von Patientinnen und Patienten sicherzustellen und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte im Krankenhaus zu verbessern. So soll gewährleistet werden, dass auch in Zukunft genügend Fachkräfte im Bereich der Pflege zur Verfügung stehen. Bereits im Jahr 2019 hatten sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat und die Gewerkschaft ver.di auf die Einführung des Pflegepersonalbemessungsinstruments PPR 2.0 verständigt und dieses im Jahr 2023 erprobt. Die Ergebnisse der Erprobung flossen in die Verordnung ein.

Berlin (epd). Viele Studierende finden nur schwer bezahlbaren Wohnraum. Welche sozialen Folgen das hat und wie das Studierendenwerk entgegenwirken will, erklärt die Präsidentin des Werks, Beate A. Schücking im Interview des Evangelischen Pressedienstes (epd). Mit ihr sprach Stefanie Unbehauen.
epd sozial: Frau Schücking, das neue Semester hat begonnen, doch viele Studierende finden kaum noch bezahlbaren Wohnraum. An wen können sich Studierende wenden, die noch keine Bleibe gefunden haben und wie unterstützt sie das Studierendenwerk?
Beate A. Schücking: Die 57 Studierendenwerke in Deutschland tun auch dann sehr viel, wenn ihre rund 196.000 Wohnheimplätze, die sie bundesweit anbieten, belegt sind. Sie betreiben beispielsweise Online-Wohnbörsen und motivieren private Vermieterinnen und Vermieter, an Studierende zu vermieten. Zum Sommersemester ist die Nachfrage nach Wohnheimplätzen bei den Studierendenwerken etwas geringer als zum Beginn eines Wintersemesters, weil mehr als 90 Prozent aller Studiengänge im Wintersemester beginnen. Es lohnt sich, beim Studierendenwerk vor Ort zu klären, ob vielleicht noch ein Wohnheimplatz frei ist. Das Wohnheim des Studierendenwerks ist die preisgünstigste Wohnform außerhalb des Elternhauses mit einer durchschnittlichen Warmmiete von 280 Euro im Monat.
epd: Was tun Sie auf politischer Ebene, um den Bau weiterer Studierendenwohnheime voranzutreiben?
Schücking: Wir arbeiten intensiv daran, dass mehr bezahlbarer Wohnraum für Studierende geschaffen und erhalten wird. Wir konnten bewirken, dass der Bund über das Programm „Junges Wohnen“ nun zum ersten Mal seit fast 40 Jahren den Bau von Studierendenwohnheimen wieder bezuschusst. So werden in den kommenden Jahren 500 Millionen Euro Finanzhilfen jährlich allein des Bundes fließen, damit mehr bezahlbarer Wohnraum für Studierende geschaffen wird. Darüber hinaus sind die Länder dazu aufgefordert, das Programm mit eigenen Mitteln zu flankieren. Das ist ein wichtiges Aufbruchsignal und kann mittel- und langfristig etwas Abhilfe schaffen, wenn die Länder kräftig mitfördern und das Programm insgesamt verstetigt wird.
epd: Bis diese Bauprojekte realisiert werden, kann noch einige Zeit vergehen. Das Problem ist aber dringend. Woran liegt es, dass aktuell nicht mehr Studierendenwohnheime gebaut werden und Bauprojekte teilweise jahrelang ruhen?
Schücking: Zunächst einmal will ich festhalten: Die Studierendenwerke wollen bauen, und sie können bauen - übrigens sehr erfolgreich seit mehr als 100 Jahren, und heute auch unter schwierigsten konjunkturellen Entwicklungen. Sie bieten an den Hochschulen rund 196.000 Wohnheimplätze in rund 1.700 Studierendenwohnheimen. Aber sie haben als gemeinnützige, nicht-profitorientierte Organisationen mit staatlichem Sozialauftrag ein anderes Geschäftsmodell als etwa privatrechtliche Investoren. Die Studierendenwerke wollen möglichst sozialverträgliche, bezahlbare Mieten erzielen, die sich, wenn möglich, an der BAföG-Wohnkostenpauschale orientieren, die 360 Euro im Monat beträgt. Solche Mieten können die Studierendenwerke nur schaffen, wenn die staatliche Förderung stimmt und die Studierendenwerke für Neubau und Sanierung staatliche Zuschüsse bekommen.
epd: Das BAföG sieht monatlich 360 Euro für Wohnkosten vor. Dabei kostet aktuell bereits ein WG-Zimmer in München im Durchschnitt 760 Euro, bundesweit sind es 479 Euro. Wird Studieren immer mehr zu einem Privileg?
Schücking: München ist die teuerste Hochschulstadt Deutschlands. Dort müssen Studierende im Schnitt 400 Euro mehr für ein WG-Zimmer ausgeben, als das BAföG dafür vorsieht. Das ist eine Entwicklung, die mir große Sorgen bereitet. Auf dem freien Markt wird es für Studierende immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden - übrigens erst recht für internationale Studierende. Für mich findet über die Miete eine Art der sozialen Auslese statt. Die Studienwahl droht abhängig zu werden davon, wo ich mir die Miete als Student oder Studentin noch leisten kann. Zugespitzt formuliert: Die Kinder aus vermögenden Haushalten studieren an den Top-Hochschulen in den teuren Metropolen, diejenigen aus einkommensschwächeren Familien sollen aufs platte Land ausweichen - das wäre eine sozial- und bildungspolitische Bankrotterklärung. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist eine brennende soziale Frage, nicht allein für die rund 2,9 Millionen Studierenden in Deutschland. Sie konkurrieren auf den freien Wohnungsmärkten mit anderen sozialen Gruppen um den wenigen bezahlbaren Wohnraum, etwa mit jungen Familien, Geringverdienenden und älteren Menschen.
epd: Inwieweit sehen Sie hier die Bundesregierung in der Pflicht?
Schücking: Wir brauchen auf jeden Fall ein politisches Gegensteuern auf zwei Ebenen: Das Bund-Länder-Programm „Junges Wohnen“ muss verstetigt werden. Und wir brauchen dringend eine Erhöhung der BAföG-Wohnkostenpauschale sowie der BAföG-Sätze generell. Am besten wäre eine automatische Anpassung der Sätze an die Entwicklung von Preisen und Einkommen.
epd: Viele Studierende entscheiden sich aufgrund der hohen Mieten dazu zu pendeln und ziehen heute durchschnittlich später aus als noch vor einigen Jahren. Wird jungen Menschen dadurch die Möglichkeit genommen, selbstständig zu werden?
Schücking: Ja. Das Studium sollte eine Phase sein, in der man auf eigenen Füßen steht, sich in einem neuen Umfeld zurechtfindet und neue soziale Kontakte knüpft. Das ist eine prägende, wichtige Sozialisationserfahrung, weit über die Bildungsbiografie hinaus. Man kann aber den jungen Menschen, die wegen der horrenden Mieten in den Hochschulstädten auch während des Studiums im Elternhaus bleiben, keinen Vorwurf machen. Sie handeln ökonomisch und rational richtig, auch wenn ich mir als Ärztin und Psychotherapeutin für sie etwas anderes wünschen würde. Nach der 22. Sozialerhebung zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden, erhoben im Sommer 2021, wohnt rund ein Viertel der Studierenden zu Hause.
epd: Ab dem Wintersemester 2024/2025 soll eine Studienstarthilfe von 1.000 Euro eingeführt werden für Erstsemester aus Familien, die Bürgergeld, Wohngeld oder andere Sozialleistungen beziehen. Halten Sie das für einen guten Vorstoß, um sozialer Ungerechtigkeit entgegenzuwirken?
Schücking: Ja. Wir begrüßen dieses neue Instrument ausdrücklich. Es ist gut, wenn bedürftige Studierende für die oft hohen Kosten, die zum Beginn eines Studiums anfallen - Mietkautionen, Laptop, Einschreibegebühren - staatliche Unterstützung bekommen. Nur müssen der Bund und die Länder dafür sorgen, dass die Auszahlung der Studienstarthilfe über die BAföG-Ämter der Studierendenwerke auch unkompliziert und schnell funktioniert. Wir haben schon jetzt in den BAföG-Ämtern eine Notlage: zu wenig Fachpersonal und eine völlig unzureichende, den Namen nicht verdienende Digitalisierung.

Kassel (epd). Viele Menschen in Deutschland halten körperliche Bestrafung in der Erziehung immer noch für richtig, wie eine repräsentative Studie zeigt, an der sich der Kinderschutzbund beteiligt hat. Die Sozialpädagogin und Referatsleiterin der Fachberatung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Uta Weber, warnt eindringlich vor den Folgen. Die Fragen stellte Helga Kristina Kothe.
epd sozial: Frau Weber, wie wird gewaltfreie Erziehung definiert?
Uta Weber: Es bedeutet, dass Eltern keine Gewalt gegenüber Kindern anwenden dürfen. Gewaltfreie Erziehung basiert auf gegenseitigem Vertrauen. Vertrauen entsteht, wenn das Gegenüber mich und meine Art zu reagieren versteht. Nur in einer vertrauensvollen Atmosphäre können Kinder gesund aufwachsen.
epd: Körperliche und sexualisierte Gewalt sind augenscheinlich. Welche Macht haben Sprache, abwertende Bemerkungen, Liebesentzug, Kontrollzwang oder andere Formen emotional übergriffigen Verhaltens?
Weber: In der Tat, bei Kinderschutz und Kindeswohl denken die meisten erstmal an körperliche und sexualisierte Gewalt. Alle Formen von Gewalt können eine fatale Wirkung haben. Gerade die vermeintlich kleinen und versteckten Übergriffe im Alltag werden oft übersehen und heruntergespielt. Jede Form von Gewalt hat in der Erziehung nichts zu suchen und ist mit nichts zu rechtfertigen.
epd: Wie beeinflusst Gewalt die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen?
Weber: Die Auswirkungen von Gewalt wirken sich bei jedem Kind anders aus. Grundsätzlich sind die Folgen von Gewalt in der Erziehung bei jungen Kindern am gravierendsten und können sich auf das gesamte Leben deutlich auswirken. Ganz kleine Kinder haben keine Möglichkeiten, sich vor Gewalt zu schützen.
epd: Wie kann es gelingen, andere dafür zu sensibilisieren, hinzusehen, zu handeln und Hilfe zu holen?
Weber: Genau so, wie wir es gerade tun. Das Thema immer wieder in die Öffentlichkeit tragen und ein Bewusstsein für Gewalt schaffen, an dem schwierigen Thema zu rütteln und hierüber Menschen bewegen, nicht wegzuschauen, sondern genauer hinzuschauen, wenn im eigenem Umfeld Gewalt geschieht. Es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, welche Folgen schon allein ständiges Anschreien für Kinder haben kann. Gewalt hinterlässt immer Spuren, auch wenn diese für uns nicht immer sichtbar sind.
epd: Welche Anlaufstellen gibt es für Kinder, die Hilfe brauchen und für Erwachsene, die helfen wollen?
Weber: Grundsätzlich beraten und informieren die Jugendämter vor Ort. Auf der Website des Fachverbands der Beratungsstellen kann online nach einer Beratungsstelle in Wohnortnähe gesucht werden. Ebenso ist eine kostenfreie Onlineberatung mit ausgebildeten Fachkräften möglich.
epd: Was kann dazu beitragen, Gewalt in Kinderbetreuungseinrichtungen zu verhindern?
Weber: Kitas und Träger müssen Kinder- und Gewaltschutzkonzepte in den Kitas fest etablieren und einen sicheren Umgang mit der Meldung und Bearbeitung von Kinderschutzfällen haben. Wir als Referat Fachberatung bieten hierzu kontinuierliche Prozessbegleitung an und können bedarfsorientiert unterstützen.
Mannheim (epd). Die Leistungen der Pflegeversicherung wie Pflegegeld und Rentenpunkte helfen privat Pflegenden, ihnen entstehende Nachteile am Arbeitsmarkt größtenteils auszugleichen. Allerdings senkten sie auch die Anreize zu arbeiten, wie Wissenschaftler des ZEW Mannheim und RWI Essen in einer empirischen Studie herausfanden. Die Erhebung basiert den Angaben nach auf Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Hierbei wurde die Gruppe der 55- bis 67-jährigen Frauen ausgewählt, weil diese in der Regel noch in der Lage ist, auf dem Arbeitsmarkt aktiv zu sein und zwei Drittel der privaten Pflegeleistungen erbringt.
Zum Forschungshintergrund heißt es: "In Zukunft müssen immer mehr Menschen in Deutschland gepflegt werden. Meist sind es Angehörige und Freunde, die sich um pflegebedürftige Personen kümmern. Das verursacht immense Kosten aufgrund geringerer Arbeitsstunden, Einkommen und Renten. Die Forschenden wollten daher wissen, ob die Kassenleistungen die persönlich entstehenden Nachteile kompensieren können. Denn die familiäre Pflege hat immense persönliche Kosten auf dem Arbeitsmarkt zur Folge. Arbeitszeiten werden reduziert bis hin zum Verlassen des Arbeitsmarkts. Das wirkt sich negativ auf das Einkommen und die spätere Rente aus.
„Ohne die Leistungen der Pflegeversicherung würde viel weniger Pflegearbeit geleistet. In einer alternden Gesellschaft, die zudem mit einem Fachkräftemangel in der Pflege zu kämpfen hat, ist das essenziell“, urteilte Björn Fischer, Ko-Autor der Studie und Junior Research Associate am ZEW-Forschungsbereich „Arbeitsmärkte und Sozialversicherungen“. Die persönlichen Kosten der Pflege seien jedoch immens.
Deswegen ist es nach seinen Worten auch weiterhin wichtig, dass die Pflegeversicherung die persönlichen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt und der Rente weitestgehend ausgleicht. "Die Politik sollte die Pflegeversicherung unbedingt beibehalten. Schließlich ist es sinnvoll, diejenigen zu unterstützen, die die Pflegebedürftigen bereits kennen und freiwillig Hilfe leisten. Sonst bräuchte es viel mehr Fachkräfte.
In Deutschland werden 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen daheim versorgt. Davon werden wiederum 80 Prozent vor allem von Angehörigen und Freunden gepflegt. Mit rund zwei Drittel leisten Frauen den größten Anteil der privaten Pflege. Dabei hat die Pflege immense persönliche Kosten auf dem Arbeitsmarkt zur Folge. Pflegegelder und Rentenpunkte der Pflegeversicherung fangen einen großen Teil der kurzfristigen und langfristigen persönlichen Arbeitsmarktkosten der Pflege auf. Auch für die Gesellschaft entstehen durch die private Pflege Kosten, da kurz- aber auch langfristig weniger (Erwerbs-)Arbeitsstunden geleistet werden. Zusätzlich erhöhen auch die Leistungen der Pflegeversicherung die gesamtgesellschaftlichen Kosten, da sie auch die Arbeitsanreize reduzieren.
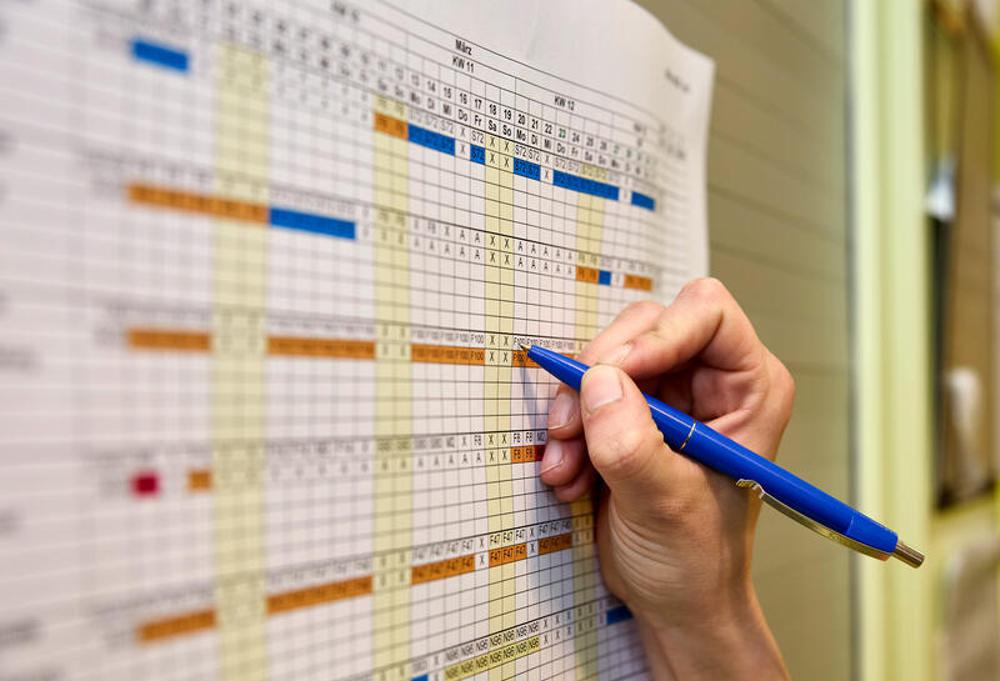
Frankfurt a. M., Berlin (epd). Der Noteinsatz von Rettungskräften und Polizei am 15. April in einem Pflegeheim der Domicil-Unternehmensgruppe in Berlin-Lichtenberg mit 170 Bewohnerinnen und Bewohnern schlug bundesweit hohe Wellen. So mancher sah darin nicht weniger als das Menetekel einer sich unaufhaltsam zuspitzenden Pflegekrise. Zwar hat sich die Aufregung längst gelegt. Aber noch immer stellt sich die Frage, ob dieses Ereignis als kurioser Einzelfall abgetan werden kann.
Die Gewerkschaft ver.di will genau das verhindern und weist auf die grundsätzlichen, politisch bedingten Probleme im System der Langzeitpflege hin: „Es ist unerträglich, dass so etwas vorkommt“, sagte Gisela Neunhöffer, stellvertretende Landesfachbereichsleiterin für Pflege in Berlin und Brandenburg, bei einer eilig anberaumten Anhörung zu dem denkwürdigen Vorfall im Berliner Abgeordnetenhaus.
Gut daran sei nur, dass durch den Vorfall der Personalmangel in den Pflegeheimen in den Fokus des politischen Interesses rücke. „Dieser Fall muss Anlass sein, die grundsätzlichen Probleme in den Blick zu nehmen und politisch zu handeln“, erklärte die Gewerkschafterin.
Der Berliner Senat, die Pflegekassen und die Leistungserbringer müssten jetzt Vereinbarungen treffen, wie Personalstandards auf Landesebene festgelegt und wirksam kontrolliert werden. Eine Mitschuld an den nächtlichen Zuständen in Pflegeheimen sieht Neunhöffer bei der Politik. Vor allem auf Landesebene bestehe Handlungsbedarf. Die Personalvorgaben für die Pflegeheime werden zwischen den Pflegekassen und den Verbänden der Leistungserbringer auf Landesebene in sogenannten Landesrahmenverträgen festgelegt. „In diesen Plänen muss festgeschrieben werden, wie viel Personal für die Patienten tatsächlich pro Schicht anwesend sein muss“, so die Gewerkschafterin.
Wie viel oder besser, wie wenig Personal tatsächlich nachts vor Ort ist, lässt eine Umfrage des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) aus dem Vorjahr erkennen. Befragt nach der Personalbesetzung in den Diensten zu ungünstigen Zeiten wurden beruflich Pflegende aus dem Krankenhaus und der stationären Langzeitpflege. Knapp 3.500 Antworten wurden ausgewertet. Erschreckendes Ergebnis: 55 Prozent der Befragten versorgten 20 bis 40 Menschen im Nachtdienst, aber fast ein Fünftel kreuzte die Zuständigkeit für 80 Personen und mehr an.
Dass das keine Momentaufnahme, sondern die Regel sei, gaben mehr als 93 Prozent der Pflegekräfte an: die Angaben entsprächen dem Durchschnitt des vergangenen Monats. Die Anschlussfrage nach einer etwaigen Unterstützung verneinten rund 39 Prozent, etwas mehr, 46 Prozent, haben immerhin mindestens eine Pflegehilfsperson an der Seite.
„Leider bestätigen die Daten zu Teilen unsere Befürchtungen“, sagte DBfK-Präsidentin Christel Bienstein. „Die Zahlen zeigen eine erhebliche Belastung der beruflich Pflegenden mit einer viel zu hohen Zahl von Bewohnern, um die sie sich nachts kümmern müssen. So kann man niemandem gerecht werden, geschweige denn gut und sicher pflegen.“
„Bei den Ursachen addiert sich eins zum anderen: natürlich gibt es einen Pflegepersonalmangel, auch weil die Bezahlung in der Langzeitpflege trotz etlicher Steigerungen und den Tariftreuevorschriften immer noch unter der im Krankenhaus liegt. Auf der anderen Seite gibt es große private Träger, die im Streben nach hoher Rendite Personalkosten sparen, wo sie nur können“, teilte der DBfK auf Anfrage mit.
„Das zugrundeliegende Problem ist leider nicht neu“, sagte David Kröll vom BIVA Pflegeschutzbund dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Wir hören oft von knapp besetzten Stationen, Problemen bei der Übergabe oder von zu wenigen Fachkräften, die mit Hilfskräften zu viele Bewohnerinnen und Bewohner versorgen müssen. Sprich: man hält die Versorgung - insbesondere nachts - mehr schlecht als recht aufrecht.“
In den vergangenen Jahren wurden die Probleme laut Kröll tendenziell schlimmer, denn Heimbewohnerinnen und -bewohner seien durchschnittlich stärker pflegebedürftig als früher, denn heute bleibt man, solange es geht, zu Hause: „Das bedeutet, dass besonders nachts mehr zu tun als früher, als zumindest ein Teil der Bewohnerschaft durchgeschlafen hat und nachts keine Hilfe benötigte.“
Schnell zu lösen seien diese akuten Personalprobleme nicht, sagte Kröll. Auf der Suche nach Abhilfe diskutierten Expertinnen und Experten meist ein Bündel an Maßnahmen, die größtenteils frühestens mittelfristig wirken können: Verbesserung der Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung und Tarifbindung, Förderung von Qualifikation, internationale Rekrutierung sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen und Aufwertung des Pflegeberufs. „Eigentlich müsste alles gleichzeitig umgesetzt werden, sprich: Eine umfassende strukturelle und finanzielle Reform der Pflegeversicherung müsste her, für die es auch Vorschläge gibt.“
Das sieht auch Peter Koch so. Weil die Personaldecke in der Heimpflege generell knapp sei, bereiteten nicht nur die Nachtschichten Probleme, so das Vorstandsmitglied der Landesgruppe Baden-Württemberg des Bundesverbandes Pflegemanagement, der Geschäftsführer der Gaggenauer Altenhilfe ist. „Uns fehlen aktuell schon mehr als 30 Prozent Personal.“ Deshalb gebe „es sicherlich Fälle, in denen eine Besetzung des Nachtdienstes auch in anderen Einrichtungen schwierig ist und teilweise mit Unterbesetzung gefahren werden muss“. Die Anwesenheit einer verantwortlichen Pflegefachperson werde jedoch in der Regel sichergestellt. „Ich denke, die Nachtdienstvorgaben sind für ein Pflegeheim mit einer durchschnittlichen Bewohnerschaft ausreichend, problematischer stellt sich hier der Tagdienst dar“, so Koch.
Auch die oft diskutierte Absenkung der Fachkraftquote biete keine Lösung, betont der Vorstand: „Das Thema grassiert in den Medien und wird primär von Arbeitgeberverbänden befeuert.“ Man habe aber nicht nur einen Pflegefachkraftmangel, sondern in manchen Regionen schlicht einen Personalmangel. „Eine Absenkung der Fachkraftquote kann nur mit einer Stärkung der Basis der qualifizierten Helfer einhergehen, an denen es jedoch auch fehlt.“

Gaggenau (epd). Peter Kochs Aussage überrascht, waren doch zuletzt vor allem die Nachtschichten in den öffentlichen Fokus geraten: „Uns fehlen schon mehr als 30 Prozent Personal. Ich denke, die Nachtdienstvorgaben sind für ein Pflegeheim mit einer durchschnittlichen Bewohnerschaft ausreichend, problematischer stellt sich hier der Tagdienst dar.“ Auch die oft diskutierte Absenkung der Fachkraftquote biete keine Lösung: Die könne nur mit einer Stärkung der Basis der qualifizierten Helfer einhergehen, an denen es auch fehle. Die Fragen stellte Dirk Baas.
epd sozial: Jüngst machte bundesweit die Meldung die Runde, dass in einem Berliner Pflegeheim Feuerwehr und Polizei anrückten, weil die Nachtschicht nicht mit genügend Fachkräften besetzt werden konnte. Ist der Fall aus Lichtenberg ein einzelner oder kommt es öfter vor, dass Nachtschichten nicht „richtig“ besetzt sind, aber nur niemand darüber spricht?
Peter Koch: Es gibt sicherlich Fälle, in denen eine Besetzung des Nachtdienstes auch in anderen Einrichtungen schwierig ist und teilweise mit Unterbesetzung gefahren werden muss. Die Anwesenheit einer verantwortlichen Pflegefachperson wird jedoch in der Regel sichergestellt. Im Idealfall werden bei Unterbesetzungen die zuständigen Heimaufsichtsbehörden in Kenntnis gesetzt.
epd: Was sind die Ursachen der knappen Schichtbesetzung? Sind es nur die fehlenden Fachkräfte oder ist es auch der Sparkurs der Träger beim Personal, sodass bei Ausfällen die Fachkraftquote gerissen wird?
Koch: Wir sind in einer Zeit angekommen, da die Personaldecke flächendeckend sehr eng ist. Ausfallkonzepte wie Springer-Pools, die von der Politik als Allheilmittel angepriesen werden, sind nur in sehr geringem Umfang und dann meist nur bei größeren Trägern vorhanden. Es mag sicher einige Träger geben, die beim Personal versuchen einzusparen, jedoch sind sie durch die engen Personalvorgaben durch die unterschiedlichen Personalverordnungen der Länder zu einem festen Betreuungsschlüssel pro Nacht verpflichtet.
epd: Wie lässt sich ein Fall wie der in Berlin vermeiden?
Koch: Es ist erforderlich, konsequent nettobasierte Personaleinsatzplanungen vorzunehmen. Manche Einrichtungen arbeiten mit Rufbereitschaft oder im Ausnahmefall mit Springer-Pools. Aufgrund der engen personellen Ausstattung der Einrichtungen und der sich daraus ergebenden finanziellen Risiken wird es zukünftig immer mehr zu schwierigen Situationen kommen. Denn wird nicht das in den Pflegesatzvereinbarungen vereinbarte Personal vorgehalten, können Plätze nicht belegt werden und die Refinanzierung kippt. Bei einer aktuellen Ausfallquote in der Pflege, von allein durch Krankheit bei rund zehn Prozent, ist die Dauerspirale nur schwer zu durchbrechen.
epd: Sind die Vorgaben für die Nachtversorgung generell ausreichend oder sehen Sie hier Reformbedarf
Koch: Es ist ein generelles Problem der ausreichenden Personalbesetzung in den Einrichtungen. Wenn wir uns das „Rothgang-Gutachten“ anschauen, welches die Basis der Personalbemessung darstellt, fehlt uns aktuell schon mehr als 30 Prozent Personal. Ich denke, die Nachtdienstvorgaben sind für ein Pflegeheim mit einer durchschnittlichen Bewohnerschaft ausreichend, problematischer stellt sich hier der Tagdienst dar.
epd: Wie errechnet sich exemplarisch die Schichtbesetzung eines Heimes?
Koch: Das kann ich am Beispiel Baden-Württemberg zeigen, das Land mit den aktuell besten Personalschlüsseln. Bei Einrichtungen mit 60 Bewohnern, was heute im Bereich der Hausgemeinschaftenkonzepte eine gängige Einrichtungsgröße ist, sind laut LPersVO BA-Wü mit dem Schlüssel 1:45 zwei Mitarbeiter im Nachtdienst vorzuhalten. Das heißt, um das abzudecken, müssen 4,2 Vollzeitkräfte im Nachtdienst vorgehalten werden. Die Einrichtung hat bei einer durchschnittlichen Belegung rund 24 Vollzeitkräfte zur Verfügung, ergo stehen nach Abzug des Nachtdienstes noch rund 19,8 Vollzeitkräfte zur Verfügung. Rechnen wir das auf die einzelne Schicht in einem Haus zusammen, stehen pro Schicht im Tagdienst für 60 Bewohner 6 Vollzeitkräfte zur Verfügung (bei Krankheitsquote von Prozent), gehen wir von einer Krankheitsquote von zehn Prozent aus, sind es noch 5,1 Vollzeitkräfte pro Schicht.
epd: Stichwort Fachkraftquote: Immer mehr Heime schaffen sie nicht und müssen Teilbereiche schließen oder die Belegung stark zurückfahren? Das kann doch eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein, bei allem Wunsch nach guter Pflegequalität. Was wäre die Lösung?
Koch: Das Thema grassiert in den Medien und wird primär von Arbeitgeberverbänden befeuert. Wir haben aber nicht nur einen Pflegefachkraftmangel, sondern in manchen Regionen schlicht einen Personalmangel. Eine Absenkung der Fachkraftquote kann jedoch nur mit einer Stärkung der Basis der qualifizierten Helfer einhergehen, wie es auch nach der Personalbemessung (PeBeM) geplant ist. Die Anforderungen an das Personal in Pflegeeinrichtungen ist in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Wir sind mit immer komplexeren Pflegesituationen konfrontiert. Hier bedarf es weiterhin einer hohen Fachlichkeit. Die Pflegefachpersonen müssen in die Lage versetzt werden, ihre Vorbehaltsaufgaben und die Aufsicht über das Hilfspersonal auszuüben. Das ist nur mit einer besseren personellen Ausstattung möglich. Jeder Pflegefachperson immer mehr Verantwortung aufzubürden, ohne den Rahmen entsprechend zu gestalten, dieser auch gerecht werden zu können, führt zu immer mehr Frust.

Berlin (epd). Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch hat versucht, einer Äußerung über die AfD Schärfe zu nehmen, zugleich aber deutlich gemacht, dass Extremismus bei Diakonie-Beschäftigten nicht geduldet wird. Damit reagierte er am 30. April in Berlin auf Reaktionen nach einem Interview, das er den Zeitungen der Funke Mediengruppe gegeben hatte. Schuch hatte erklärt, AfD-Parteigänger, die sich menschenfeindlich äußern, sollten nicht bei Einrichtungen der evangelischen Wohlfahrt arbeiten: „Wer sich für die AfD einsetzt, muss gehen.“
Arbeitsrechtler erklärten, die Mitgliedschaft und das Engagement für eine Partei seien kein Kündigungsgrund. Es könne aber Fälle geben, in denen Beschäftigten mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten.
Der Diakonie-Präsident hatte erklärt, wer in die AfD eintrete oder für sie kandidiere, identifiziere sich mit der Partei. „Wer zum Beispiel Zuwanderer als bedrohliche Menschenmasse bezeichnet, hat bei der Diakonie keinen Platz. Oder: Wenn behinderte Menschen bei uns das Gefühl haben, die Mitarbeiter würden sie abwerten, dann muss man sich von solchen Beschäftigten trennen“, sagte er den Funke-Zeitungen. Bislang sei der Diakonie Deutschland jedoch kein Fall einer Entlassung in diesem Zusammenhang bekannt.
Den Beschäftigten müsse zunächst in Gesprächen deutlich gemacht werden, dass für menschenfeindliche Äußerungen in Diakonie-Einrichtungen kein Platz sei. „Aber wenn das nichts ändert, muss es arbeitsrechtliche Konsequenzen geben“, sagte der Diakonie-Präsident den Funke-Zeitungen. Er begründete seine Haltung mit dem Schutz der Menschen, die sich der Diakonie anvertrauen. Sie müssten sich sicher fühlen können, erläuterte Schuch im Verlauf des Tages auf Nachfrage. Viele kämen aus verletzlichen Gruppen, etwa Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftige oder Geflüchtete.
Der Bochumer Arbeitsrechtler und Experte für kirchliches Arbeitsrecht, Jacob Joussen, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), allein aus einer Parteimitgliedschaft könnten keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen folgen. „Weder darf der Arbeitgeber danach fragen, noch ist eine Parteimitgliedschaft ein Kündigungsgrund“, erklärte er. Es drohten auch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn der Beschäftigte für eine Partei zu einer Wahl antritt oder für sie wirbt, so Joussen. Eine Grenze werde aber möglicherweise überschritten, wenn ein Mitarbeiter, der eindeutig der Kirche zuzuordnen ist, etwa auf einer Veranstaltung gegen Ausländer hetze und damit die Grundwerte seines Dienstgebers und seine Loyalitätspflichten verletze. Dies sei im Einzelfall zu prüfen.
Der Verband der Diakonischen Dienstgeber (VdDD) erklärte, es gehe darum, ob Beschäftigte mit ihren Äußerungen oder Aktivitäten das christliche Menschenbild in Frage stellten oder verletzten. Ein Sprecher des Verbandes sagte dem epd, wenn dies der Fall sei, müsse nach dem kirchlichen Arbeitsrecht das Gespräch gesucht werden. Ändere die Person ihr Verhalten nicht, seien arbeitsrechtliche Schritte möglich.
Auf Anfrage erklärte der Deutsche Caritasverband, derzeit berate eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern des Verbandes mit Verantwortlichen der deutschen Bistümer über konkrete arbeitsrechtliche Fragen, die sich aus extremistischen, rassistischen oder anderweitig menschenfeindlichen Positionen von Mitarbeitenden ergeben könnten.
Die Diakonie Deutschland ist der Bundesverband der Diakonischen Werke der evangelischen Landes- und Freikirchen sowie von Fachverbänden. Zur Diakonie gehören rund 33.000 Einrichtungen wie Pflegeheime, Krankenhäuser, Kindertagesstätten, Beratungsstellen und Sozialstationen mit rund 627.000 Beschäftigten und etwa 700.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Berlin, Hamburg (epd). 60 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Eigentlich. Im Fall des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), das am 29. April einen runden Geburtstag hatte, lässt wohl niemand die Korken knallen. Die Zukunft des FSJ sei von Mittelkürzungen durch den Bund bedroht, beklagen Sozialverbände. Die Rede ist von einem „Desaster“.
Der Deutsche Caritasverband forderte am 29. April in Berlin eine gesetzlich gebundene Finanzierung durch Bund. Und fragt: Was ist uns Engagement in Deutschland wert? „Erst ein Rechtsanspruch kann eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung der Freiwilligendienste garantieren, unabhängig von Sparhaushalten“, sagte Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, zur Begründung der Forderung: „Ohne eine verlässliche Finanzierung ist die notwendige Struktur in den Einrichtungen und Diensten der Träger auf Dauer nicht zu halten.“
Sobald es einen gesetzlichen Rechtsanspruch gebe, könnten Träger, Einrichtungen und Freiwillige sicher sein, dass jeder einzelne Freiwilligendienst mit einem verpflichtenden Kostenzuschuss finanziert wird. Das gibt laut Caritas Einrichtungen Planungssicherheit, etwa im Hinblick auf die Finanzierung der pädagogischen Begleitung. Und auch diejenigen, die den Freiwilligendienst leisten, könnten sich auf die Finanzierung ihres Taschengelds für ihren meist 12-monatigen Einsatz verlassen. Auf die derzeit unsichere Finanzierung wurde auch bei einem deutschlandweiten ein Aktionstag am 29. April unter dem Motto „#keinehalbensachen“ aufmerksam gemacht.
Die Freiwilligendienste sind laut Caritas eine Erfolgsgeschichte in Deutschland. Das Interesse an diesem freiwilligen Engagement wachse von Jahr zu Jahr. Das zeigten die Teilnehmendenzahlen. Im Startjahr 1964 machten rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein FSJ. Im Jahr 2022 waren es rund 46.830 junge Menschen, die ein FSJ absolvierten. Insgesamt engagieren sich heute rund 100.000 Freiwillige pro Jahr im BFD, FSJ, FÖJ und den internationalen Freiwilligendiensten.
Die Bedeutung der Freiwilligendienste für die Gesellschaft könne kaum hoch genug eingeschätzt werden, sagte der Vorstandsvorsitzende des Verbandes diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD), Ingo Habenicht in Bielefeld. „Soziales Engagement eröffnet Erfahrungshorizonte, die für jeden prägend sind. Zudem wirkt es dem Auseinanderdriften unserer Gesellschaft entgegen. Deshalb befürworte ich ein soziales Pflichtjahr.“
Für das Sozialunternehmen Diakoneo aus Bayern sagte die Vorständin Bild, Verena Bikas, die jährlich bis zu 80 Freiwilligen seien eine wertvolle Unterstützung: „Sie entlasten hauptberufliche Kräfte, weil sie praktische, zusätzliche Tätigkeiten übernehmen. In ihrem Freiwilligenjahr können sie sich in sozialen Arbeitsfeldern ausprobieren, erhalten einen praxisnahen Einblick und entscheiden sich vielleicht für einen gesellschaftlich wichtigen, wertvollen und sinnerfüllenden Beruf.“ Allerdings sei eine höhere Förderung dringend nötig, um die in den letzten Jahren gestiegenen Mehrausgaben kompensieren und die Qualität erhalten zu können.
Im Herbst vergangenen Jahres wurden in letzter Minute Haushaltskürzungen für 2024 abgewendet. Jetzt drohe für das kommende Jahr eine schwere Lücke, warnt der Paritätische Wohlfahrtsverband: „Für 2025 sind im Bundeshaushalt für die Freiwilligendienste Mittelkürzungen von ca. 25 Prozent geplant.“ Von den Kürzungen wäre allein beim Paritätischen Hamburg bis zu einem Viertel der Einsatzstellen betroffen.
„Setzen sich die Planungen durch, fielen viele Kräfte weg, die etwa in Kitas, Seniorenheimen, Jugendeinrichtungen oder in der Suchthilfe im Alltag unterstützen und zusätzliche Angebote machen können, wie zum Beispiel Spaziergänge, Begleitung bei Arztbesuchen, Musik- oder Spieleangebote oder einfach nur Zuhören“, warnt Kristin Alheit, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hamburg.
In den Einrichtungen der Diakonie Hamburg leisten nach Angaben des Diakonischen Werks jedes Jahr rund 1.000 zumeist junge Menschen einen Freiwilligendienst. Die angekündigten Kürzungen für die Freiwilligendienste wirkten sich bereits jetzt aus, heißt es. Das Diakonische Werk spricht von 7,5-prozentigen Kürzungen für den neuen FSJ-Jahrgang, der ab September startet, und von Kürzungen um 25 Prozent für den Bundesfreiwilligendienst ab Anfang 2025. Für den Jahrgang ab Sommer 2025 stünden im FSJ sogar weitere Kürzungen von 35 Prozent gegenüber 2023/2024 im Raum. Die Kürzungen würden die Zahl der Plätze in den Freiwilligendiensten deutlich reduzieren, die Vielfalt der Einsatzstellen einschränken und die erreichbaren Zielgruppen verkleinern.
„Freiwilligendienste ermöglichen einen Perspektivwechsel, persönliche Bildung, gesellschaftliches Engagement und auch berufliche Orientierung. Sie sind für junge Menschen ein Geschenk“, so Welskop-Deffaa. „Anstelle der erprobten Freiwilligendienste einen Pflichtdienst einzuführen, wie es immer wieder diskutiert wird, halte ich für falsch. Wir müssen das Erfolgsmodell der Freiwilligenjahre ausbauen und mit einem Rechtsanspruch weiterentwickeln.“
Ein Rechtsanspruch, zu dem die Schüler und Schülerinnen rechtzeitig beraten werden, ermutige die Entscheidung für ein freiwilliges Gesellschaftsjahr und erleichtere die Wahl zwischen zivilen Freiwilligendiensten, Katastrophenschutz und Bundeswehr. Vor allem: Er respektiert die Selbstbestimmung der jungen Menschen. „Zusammenhalt lässt sich nicht verordnen.“

Täglich leisten Fachkräfte in der Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie, Heilerziehungspfleger, Heilpädagoginnen, Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Ergotherapeutinnen Großartiges in ihrem beruflichen Einsatz. Ihre Arbeit ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung ihr Recht auf Teilhabe nach den Prinzipien der UN-Behindertenrechtskonvention sowie des Bundesteilhabegesetzes in Deutschland umsetzen können. Doch leider sehen sich viele Leistungserbringer der Eingliederungshilfe zunehmend mit Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen und Ausbildungsplätzen konfrontiert.
Die Auswirkungen des Fachkräftemangels in den Einrichtungen der Behindertenhilfe werden immer gravierender. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die der Evangelische Fachverband für Teilhabe (BeB) unter seinen Mitgliedseinrichtungen durchgeführt hat. Die große Mehrheit der Befragten gab an, im ersten Halbjahr 2023 stark von den Auswirkungen des Fachkräftemangels betroffen zu sein. So bleiben 60 Prozent der offenen Fachkräfte-Stellen länger als sechs Monate unbesetzt. Dieser dramatische Personalmangel hat nicht nur organisatorische Konsequenzen, sondern wirkt sich auch direkt auf die Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen aus. Eine Mehrheit von 53 Prozent der Befragten bestätigt, dass die Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung dazu geführt haben, dass Einrichtungsplätze nicht wiederbesetzt werden konnten. Anfragen von Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen müssen also abgelehnt werden.
Der Personalmangel in der Eingliederungshilfe ist ein vielschichtiges Problem, das auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. Ein wesentlicher Grund ist der demografische Wandel. Mit einer Bevölkerung, die zunehmend altert, steigt auch der Bedarf an Eingliederungshilfe. Gleichzeitig tritt jedoch weniger junge Arbeitskraft in den Markt ein, was zu einem Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt. Ein weiterer Aspekt sind die Qualifikationsanforderungen. Die Arbeit in der Eingliederungshilfe erfordert oft spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten, die nicht jede Bewerberin mitbringt. Das erschwert die Rekrutierung geeigneter Mitarbeiter.
Bürokratische Hürden stellen ein weiteres Hindernis dar. Komplexe administrative Prozesse und bürokratische Aufgaben erhöhen die Arbeitslast der Mitarbeitenden und halten sie von ihrer eigentlichen Arbeit ab, was nicht selten zu Frustration und Unzufriedenheit führt. Nicht zuletzt trägt die mangelnde Anerkennung zur Attraktivität des Berufs bei. Die Arbeit in der Eingliederungshilfe wird oft nicht ausreichend gewürdigt oder anerkannt, wodurch das Berufsfeld für potenzielle Bewerber weniger attraktiv wird.
Wir als Evangelischer Fachverband für Teilhabe (BeB) fordern:
Berlin (epd). Die Kritik an der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angeschobenen Krankenhausreform reißt nicht ab. Jetzt wiederholen die katholischen Krankenhäuser ihre Einwände gegen den aktuellen Referenten-Entwurf. Sie sehen die Versorgung in der Fläche bedroht. Der ganze Reformprozess entpuppe sich als vertane Chance, die Krankenhausversorgung mit innovativen Ideen und neuen Ansätzen weiterzuentwickeln, heißt es in einer Mitteilung vom 26. April.
Bernadette Rümmelin, Geschäftsführerin des Katholischen Krankenhausverbands Deutschland, sagte, der Gesetzentwurf von Minister Lauterbach werde dem Anspruch einer soliden Reform nicht gerecht. Der Minister verfolge weiter nur das Ziel, die Versorgungslandschaft radikal auszudünnen und zu konzentrieren. „Gepaart mit dem weiterhin ungezügelten, kalten Strukturwandel droht damit ein massiver Kapazitätsabbau, der die Versorgungssicherheit deutschlandweit gefährdet“, so Rümmelin.
Insbesondere für die Menschen in ländlichen Regionen drohe eine massive Unterversorgung. Deutlich weitere Wege könnten gerade für ältere, chronisch erkrankte und weniger mobile Menschen zur unüberwindbaren Hürde werden. Auch die ambulante Versorgung wird nach ihren Worten nicht alle Patientinnen und Patienten auffangen können, zumal aus dem Gesundheitsversorgungs-Stärkungsgesetz (GVSG) die Regelungen zu den regionalen Gesundheitszentren und den Primärversorgungszentren herausgestrichen wurden. Außerdem drohten in der Geburtshilfe unverantwortliche Versorgungslücken.
„Schließlich bringt der Gesetzentwurf für die akut bestehende Finanznot der Kliniken keine nachhaltige Abhilfe. Die vorgesehenen Maßnahmen, wie beispielsweise zur Tarifkostenrefinanzierung und zur Anpassung der Landesbasisfallwerte, wirken sich nicht unmittelbar, sondern erst in der Zukunft aus“, rügte die Geschäftsführerin. Somit werde der unkontrollierte kalte Strukturwandel weitergehen. Um das zu verhindern, wäre beispielsweise eine Erhöhung der Landesbasisfallwerte und Psychiatrie-Entgelte rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023 um vier Prozent erforderlich.
Der Katholische Krankenhausverband Deutschland vertritt nach eigenen Angaben 267 Krankenhäuser an 340 Standorten sowie 54 Reha-Einrichtungen mit insgesamt 210.000 Mitarbeitenden.
Stuttgart, Karlsruhe (epd). Wohlfahrtsverbände warnen vor einer größer werdenden Spaltung der Gesellschaft. Unzufriedenheit und Verlustängste prägen nach Einschätzung von Caritas und Diakonie in Baden-Württemberg die gesellschaftliche Stimmung in Deutschland. Gleichzeitig beobachten die christlichen Wohlfahrtsverbände ein steigendes Anspruchsdenken einzelner Interessengruppen.
„Wir wollen Menschen in sozialen Notlagen stärken“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Oliver Merkelbach, am 25. April in Stuttgart. Diakonie und Caritas verstünden sich als „Anwälte“ benachteiligter Menschen. In einer Zeit knapper Kassen und des demografischen Wandels gerieten Bedürftige immer mehr aus dem Blick.
Verteilungsdebatten dürften jedoch nicht auf deren Rücken ausgetragen werden. Die Verbände verwahrten sich dagegen, Menschen mit Unterstützungsbedarf Schuld an ihrer Lage zuzuweisen. Diese Haltung gebe die reale Situation dieser Menschen „in keiner Weise wieder“, sagt Merkelbach. Sie benötigten vielmehr Unterstützung, um unabhängig von staatlichen Leistungen leben zu können.
Als wesentliche Bausteine zur Sicherung von Chancengleichheit nannte der Verbandsvertreter das Bürgergeld und die Kindergrundsicherung. „Mein Eindruck ist, dass die Politik sich selbst im Weg steht“, kritisierte Merkelbach parteipolitische Profilierung auf Kosten benachteiligter Menschen.
Kinderarmut sei das Zukunftsthema schlechthin, betonte der Caritasdirektor. Wer verschuldet, abhängig, alleinerziehend, arm oder geflüchtet sei, dem fehlten oft die Mittel, um das Leben „anzupacken“, führte Urs Keller aus. „Wir wollen Menschen ertüchtigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werkes Baden in Karlsruhe den Ansatz der Wohlfahrtsverbände.
Die gesellschaftlichen Herausforderungen seien für den Staat allein zu komplex. Zivilgesellschaftliche Partner stehen laut Keller in der Verantwortung für einen starken Sozialstaat. Der Vorstandvorsitzende verwies auf die Zusammenarbeit der Freien Wohlfahrt mit Kirchen, Wirtschaft, Kommunen, Mittelständlern, Vereinen und Privatpersonen.
Nur im Miteinander, nicht im Gegeneinander, könne der Sozialstaat gestärkt werden. „Wir müssen lernen, kreativ und kompetent an ein punktuelles Problem heranzugehen“, sagte Keller. Als positive Beispiele nannten die beiden Vorstandsvorsitzenden die Wohnrauminitiative der Caritas Rottenburg-Stuttgart und das Projekt „Kälteschutz für wohnungslose Menschen“ der Diakonie Baden.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Freiburg und der Hochschule seien binnen drei Monaten 600 Notunterkünfte beschafft worden. Die Wohnrauminitiative der katholischen Kirche Württemberg investiert für den Zeitraum von 2019 bis 2026 rund 8,2 Millionen Euro aus Kirchensteuern in die Vermittlung von Wohnraum. Die Kirche tritt hier als Bindeglied zwischen Wohnungssuchenden und potenziellen Vermietern leerstehender Wohnungen auf.
Bis heute wurden über die Wohnrauminitiative 1.340 Menschen und mehr als 600 Wohnungen vermittelt. Wohnungsnot ist eine der vielen Gründe für die Unzufriedenheit im Land. Die Bürger merkten sehr gut, wenn etwas versprochen wird, das man nicht einhalten kann, wie etwa die Ganztagsbetreuung in Schulen, führte Keller aus. „Demokratie und ein funktionierender Sozialstaat sind untrennbar miteinander verbunden“, mahnte der Oberkirchenrat. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Europa und drei Bundesländern in Ostdeutschland ergänzte Merkelbach: „Die Suche nach Sündenböcken ist ein gefährlicher Nährboden für die Demokratie.“
Berlin (epd). Die Diakonie Deutschland bietet Wählerinnen und Wählern eine Entscheidungshilfe zur Europawahl Anfang Juni an. Der evangelische Wohlfahrtsverband stellte am 30. April in Berlin seinen Sozial-O-Mat vor. Ziel ist es nach Angaben des Verbandes, die Wahlberechtigten über die sozialpolitischen Positionen der Parteien zu informieren und zur Stimmabgabe zu motivieren.
Analog zum Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung lässt sich mit dem Sozial-O-Mat der Diakonie ermitteln, welche Partei den eigenen sozialpolitischen Einstellungen am nächsten kommt. Von 35 Parteien, die zur Europawahl antreten, haben sich nach Angaben der Diakonie 29 Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum beteiligt und Antworten in fünf Themenfeldern geliefert.
Diakonie-Präsident Rüdiger Schuch sagte, der Sozial-O-Mat leiste einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung und zeige, dass es zwischen den Parteien teils erhebliche Differenzen in der Sozialpolitik gebe. „Es gibt eine wirkliche Wahl zwischen den Positionen“, betonte Schuch. Gerade in einem von Populisten und Extremisten aufgeheizten Klima sei es wichtig, eine gut begründete Wahlentscheidung zu treffen, betonte der Diakonie-Präsident. Die Diakonie sei parteipolitisch neutral, trete aber entschieden ein für das Grundgesetz, die Demokratie und eine offene Gesellschaft der Solidarität und Teilhabe.
Die Positionen der Parteien zu den Thesen des Sozial-O-Mat stammen von diesen selbst und wurden von der Diakonie nach eigenen Angaben nicht bearbeitet. Personalisierte Daten werden nicht gesammelt. Die Antworten der Nutzerinnen und Nutzer werden weder gespeichert noch veröffentlicht.

Celle (epd). Eine intensivierte Insulintherapie mit täglich mehrfachen Blutzuckermessungen bei einem an Diabetes erkrankten Kind oder Jugendlichen rechtfertigt noch nicht die Anerkennung einer Schwerbehinderung. Wenn das Kind gute Schulnoten habe, Freundschaften pflege und ein normales, altersgerechtes Verhalten zeige, weise das trotz der notwendigen Unterstützung durch Betreuungspersonen nicht auf „gravierende Beeinträchtigungen der Lebensführung“ hin, entschied das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen in zwei am 23. sowie am 24. April veröffentlichten Urteilen. Diese Einschränkungen seien aber für die Zuerkennung eines Grades der Behinderung (GdB) von 50 erforderlich, erklärten die Celler Richter.
Im ersten Verfahren war der zehnjährigen Klägerin, die an Diabetes Typ I erkrankt ist, ein Grad der Behinderung von 40 zuerkannt worden. Das Mädchen wollte jedoch einen GdB von 50 und damit die Anerkennung als Schwerbehinderte erreichen. Ihre Eltern verwiesen auf ihren Pflegegrad 2. Um einen stabilen Blutzuckerwert in der Grundschule zu gewährleisten, sei sie auf einen Integrationshelfer angewiesen. Seit der für die weiterführende Schule nicht mehr genehmigt worden sei, seien Konzentrationsschwierigkeiten und auffälliges Verhalten aufgetreten, so die Begründung.
Besuche bei Freunden seien nur in Begleitung eines Elternteils möglich, damit die Insulindosis stets sicher angepasst werden könne. Für die Therapie müsse ihre Tochter deutlich mehr begleitet und betreut werden, als das bei Gleichaltrigen üblich sei. Die erhebliche Beeinträchtigung der Lebensqualität begründe einen GdB von 50, so die Argumentation.
Im zweiten Fall führte der ebenfalls an Diabetes Typ I erkrankte 14-Jährige an, dass die Teilnahme an üblichen Freizeitaktivitäten einen erheblichen planerischen Aufwand erfordere. Er müsse sich viermal täglich Insulin spritzen, sei durch regelmäßig erhöhte Blutzuckerwerte an Nachmittagen in seiner Freizeit stark eingeschränkt und könne häufig nicht am Sportunterricht teilnehmen. Das und die beschränkte Lebensmittelauswahl führten zu einer gravierenden Beeinträchtigung in der Lebensführung. Der ihm zuerkannte GdB von 40 sei deshalb zu niedrig, meinte er.
In beiden Verfahren lehnte das Niedersächsische Landessozialamt einen GdB von 50 ab. Die Behörde verwies auf ein Urteil des Bundessozialgerichts vom 16. Dezember 2014. Die Kasseler Richter hatten im Fall eines erwachsenen Diabetikers geurteilt, dass es bei der Zuordnung eines GdB auf eine Gesamtbetrachtung aller Lebensbereiche ankomme. Es müssten „gravierende“ Einschränkungen in mehreren Lebensbereichen vorliegen. Dabei seien „strenge Anforderungen“ anzulegen.
Das LSG urteilte in beiden aktuellen Verfahren, dass die Kläger keinen GdB von 50 beanspruchen können. Nach der Versorgungsmedizin-Verordnung wird, so das LSG, bei Diabetikern, deren Therapie eine Unterzuckerung auslösen kann und bei denen die Lebensführung beeinträchtigt ist, je nach Ausmaß des Therapieaufwands und der jeweiligen Blutzuckereinstellung, ein GdB von 30 bis 40 anerkannt.
Ein GdB von 50 kann Diabetikern zuerkannt werden, die bei variierendem Blutzuckerspiegel mindestens vier Insulininjektionen täglich benötigen und die durch die „Auswirkungen des Diabetes insgesamt gesehen erheblich in der Lebensführung beeinträchtigt“ sind.
Zu den mit der Insulintherapie verbundenen Einschnitten müssten zusätzliche Faktoren hinzukommen, etwa wenn der Betroffene durch die schlechte Blutzuckereinstellung „in seiner Leistungsfähigkeit und damit in seiner Teilhabefähigkeit am Leben in der Gemeinschaft erheblich beeinträchtigt ist“. Einzelne Einschränkungen beim Reisen oder bei der Nahrungsaufnahme stellten noch keine ausgeprägte Teilhabebeeinträchtigung dar, so das Gericht.
Zwar könnten bei Kindern und Jugendlichen besondere Risiken bestehen. Starke psychische Probleme bis hin zu selbstverletzendem Verhalten seien eine mögliche Folge. Nur wenn diese Probleme tatsächlich aufträten, könne das zu einem GdB von 50 führen.
Demgegenüber seien die Kläger in der Schule beliebt, hätten viele Freunde, gute Noten und zeigten ein altersgerechtes Verhalten. Eine erforderliche elterliche Überwachung und Begleitung stelle dabei noch keine „gravierende Beeinträchtigung in der Lebensführung“ dar, befand das LSG. Wegen grundsätzlicher Bedeutung wurde die Revision zum BSG zugelassen.
Az.: L 13 SB 60/23 (LSG Celle, Kind mit Diabetes)
Az.: L 13 SB 90/23 (LSG Celle, Jugendlicher mit Diabetes)
Az.: B 9 SB 2/13 R (BSG)
Karlsruhe (epd). Festgelegte Zeiten für den Umgang zwischen einem getrennt lebenden Elternteil und seinen Kindern bedeuten nicht unbedingt ein Kontaktverbot für die übrige Zeit. Holt ein getrennt lebender Vater seine Kinder zu anderen als den ihm zugewiesenen Umgangszeiten von der Schule oder der Kita ab, kann die Mutter kein Ordnungsgeld oder gar eine Ordnungshaft als Strafe durchsetzen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 30. April veröffentlichten Beschluss. Nur wenn ein Kontaktverbot außerhalb der Umgangszeiten ausdrücklich vereinbart worden sei, seien Ordnungsmittel möglich, betonten die Karlsruher Richter.
Im konkreten Fall ging es um den Umgang eines getrenntlebenden Vaters mit seinen beiden sechs und acht Jahre alten Kindern aus dem Raum Darmstadt. Die Kinder leben bei der Mutter. Das Familiengericht entschied, dass der Vater zu den „regulären Betreuungszeiten“ Umgang mit den Kindern haben könne. Bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Umgangsregelung konnte ein Ordnungsgeld oder Ordnungshaft angeordnet werden.
Der Vater hielt sich nicht immer an die Umgangsregelung. Er holte ein Kind im Zeitraum von November 2022 bis Ende Januar 2023 insgesamt achtmal außerhalb der ihm zugewiesenen Zeiten ab. Teilweise blieb das Kind mehrere Stunden beim Vater, in einem Fall sogar drei Tage. Das Amtsgericht verhängte daraufhin zwölf Tage Ordnungshaft, denn der Vater habe außerhalb der Umgangszeiten keinen Kontakt zu dem Kind haben dürfen.
Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main hob diese Entscheidung auf und verhängte wegen des unpünktlichen Zurückbringens in zwei Fällen ein Ordnungsgeld von jeweils 250 Euro.
Der BGH bestätigte das Ordnungsgeld und lehnte ebenfalls die Ordnungshaft ab. Denn die vom Familiengericht getroffene Umgangsregelung beinhalte nur, wann der Vater Umgang mit seinen Kindern haben könne. Ein Kontaktverbot außerhalb der Umgangszeiten sei damit nicht festgelegt worden. Dies müsse in einer Umgangsregelung ausdrücklich und klar bestimmt werden. Daran fehle es hier, sodass Ordnungsgelder oder Ordnungshaft nicht verhängt werden könnten.
Az.: XII ZB 401/23
Celle (epd). Arbeitnehmer stehen bei einem unterbrochenen Arbeitsweg wegen Unwohlseins auf dem Weg nach Hause nicht mehr unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Denn nur wenn der Arbeitnehmer „vom Ort der Tätigkeit“ zurückfährt, besteht Unfallversicherungsschutz, entschied das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen in Celle in einem am 23. April veröffentlichten Urteil. Zudem sei für den Versicherungsschutz des Heimweges entscheidend, dass der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz zuvor auch erreicht hat.
Geklagt hatte ein Beschäftigter aus dem Raum Braunschweig. An einem Abend im August 2018 sollte er außerplanmäßig zur Nachtschicht fahren. Als er mehrere, hinter einem Traktor fahrende Autos überholte, kam es zu einem Unfall, bei dem er aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Er erlitt unter anderem eine Querschnittlähmung im Bereich der Halswirbelsäule. Die Polizei stellte fest, dass der Kläger sich zwar auf seinem Arbeitsweg, nicht aber in Richtung Arbeit, sondern in Richtung eigener Wohnung befunden hatte.
Der Kläger konnte sich an nichts erinnern. Ihm müsse unwohl geworden sein, sodass er krankheitsbedingt wieder nach Hause fahren wollte. Das sei wohl auch der Grund, warum er unkonzentriert gefahren sei. Der Behandlungsbericht des Krankenhauses ergab, dass der Kläger vor dem Unfall aller Wahrscheinlichkeit nach an einer Lungenentzündung erkrankt war, denn es wurden Keime gefunden. Der Mann wollte sich den Unfall von der Berufsgenossenschaft als versicherten Wegeunfall anerkennen lassen.
Der Unfallversicherungsträger lehnte das ab. Der Kläger habe sich in Fahrtrichtung seiner Wohnung befunden. Damit habe er seinen versicherten Arbeitsweg zum Betrieb unterbrochen.
Das bestätigte nun auch das LSG. Unter Versicherungsschutz stehe nur der unmittelbare Weg zur Arbeitsstätte und der Weg „von dem Ort der Tätigkeit“ zurück zur Wohnung. Hier habe der Kläger seinen Arbeitsplatz aber gar nicht erreicht. Ab dem Zeitpunkt der Rückkehr zur Wohnung stehe der Arbeitnehmer daher nicht mehr unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, so das Gericht.
Dass er seinen Arbeitsweg krankheitsbedingt unterbrochen und den Rückweg zu seiner Wohnung angetreten habe, sei eine „unversicherte eigenwirtschaftliche Handlung“. Irgendwelche Berührungspunkte zur betrieblichen Tätigkeit hätten eindeutig nicht bestanden, befand das LSG.
Az.: L 3 U 52/23
Potsdam (epd). Jobcenter dürfen Geldgeschenke für eine Pilger-Reise auf das Bürgergeld anrechnen. Das geht aus einer Entscheidung des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg zu einem Berufungsverfahren hervor, die am 25. April in Potsdam veröffentlicht wurde.
Geklagt hatte eine Familie aus Berlin, die vom Jobcenter unter anderem zwischen Juni 2018 und Dezember 2019 Arbeitslosengeld II, heute Bürgergeld, von insgesamt rund 22.600 Euro bezog. Im Mai 2018 erhielten die Kläger von einer pflegebedürftigen Nachbarin, um die sie sich regelmäßig kümmerten, 65.250 Euro als Geschenk überwiesen. Damit sollte den Klägern eine Reise nach Mekka ermöglicht werden.
Nach Hinweisen der Polizei auf die Abbuchung der hohen Summe vom Konto der Nachbarin forderte das Jobcenter die gewährten Sozialleistungen von der Familie zurück. Zur Begründung hieß es, die Familie sei nicht hilfebedürftig gewesen. Eine Klage der Familie gegen die Rücknahme der Bewilligungsbescheide durch das Jobcenter vor dem Sozialgericht blieb ohne Erfolg.
In dem Berufungsverfahren verwies die Familie darauf, dass es sich um eine zweckgebundene Schenkung gehandelt habe. Die Mekka-Reise, die sie zu fünft angetreten habe, habe insgesamt rund 55.600 Euro gekostet. Belege wurden dazu nicht vorgelegt. Zudem seien nach Rücksprache mit der Schenkerin 7.000 Euro für Zahnarztkosten sowie rund 3.000 Euro für die Tilgung von Schulden verwendet worden. Das Landessozialgericht wies die Berufung zurück und schloss sich der Argumentation der ersten Instanz an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Az.: L 18 AS 684/22

Berlin (epd). Es war ein einstimmiges Votum: Joachim Rock (50), Leiter der Abteilung Sozialpolitik und Europa sowie Leiter des Politischen Verbindungsbüros im Paritätischen Gesamtverband, tritt am 1. August die Nachfolge von Ulrich Schneider (65) als Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes an.
„Die Entscheidung für Herrn Dr. Rock halte ich fachlich, verbandspolitisch und persönlich für ausgezeichnet. Ich wünsche Joachim Rock eine gute und ruhige Hand, den Spirit des Paritätischen, den notwendigen Humor sowie auch jede Menge Unterstützung“, sagte Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands.
Rock ist Diplom-Verwaltungswirt (VFH) und Diplom-Politikwissenschaftler und wurde mit einer Dissertation zur Bedeutung des Beihilfenrechts für die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege promoviert. Nach dreijähriger Tätigkeit im Landeswohlfahrtsverband Hessen ist er seit dem 1. August 2001 in der Hauptgeschäftsstelle des Paritätischen in Berlin tätig. Im Anschluss an seine Arbeit als Referent der Gesamtverbandsvorsitzenden Barbara Stolterfoht war er zunächst als Grundsatz- und Europareferent im Paritätischen tätig.
Seit 2011 leitet Rock die Abteilung Sozial- und Europapolitik im Paritätischen Gesamtverband, seit 2022 darüber hinaus das Politische Verbindungsbüro des Verbandes. Nebenamtlich ist er seit 2009 als Dozent für Sozialmanagement tätig.
Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider scheidet Ende Juli aus seinem Führungsamt aus. Er war über 36 Jahre hauptamtlich für den Verband tätig. Künftig wird er als freier Autor und Berater tätig sein.
Stefan Pabst (58) hat am 1. Mai die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg, dem Zusammenschluss der Hamburger Wohlfahrtsverbände, übernommen. Er löst Jens Stappenbeck ab, der die Geschäfte des Vereins elf Jahre erfolgreich geführt hat und in den Ruhestand geht. Pabst ist promovierter Politikwissenschaftler. Er war zuletzt stellvertretender Abteilungsleiter beim Arbeiter-Samariter-Bund (Hamburg) GmbH.
Ludger Risse bleibt Vorstandsvorsitzender des Pflegerates Nordrhein-Westfalen. Neu gewählt wurden als Vize-Vorsitzende Desiree Owandner aus Wuppertal und Adrian Mysliwiec aus Neuss. Die beiden lösen Jutta Middeldorf aus Wuppertal und Dominik Zergiebel aus Münster im Amt ab. Beide hatten aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht erneut kandidiert. Mysliwiec gehört der Bundesfachvereinigung leitender Krankenpflegepersonen in der Psychiatrie an und ist in der Pflegedienstleitung in Neuss tätig. Owandner ist Delegierte der Schwesternschaft Wuppertal des Deutschen Roten Kreuzes. Die Pflegepädagogin ist in der Weiterbildung für Führungskräfte und Praxisanleitungen tätig. Der Pflegerat NRW wurde im Jahr 1999 als Landesarbeitsgemeinschaft der Pflegeverbände gegründet, um die Interessen der beruflichen Pflege in Nordrhein-Westfalen zu koordinieren und zu bündeln.
Udo Zippel, langjähriger Geschäftsführer von Eben-Ezer in Lemgo, ist aus seinem Dienst in den Ruhestand verabschiedet worden. Allein für die Stiftung Eben-Ezer war der Jurist 18 Jahre lang tätig. 2006 wechselte er vom Diakonischen Werk der Lippischen Landeskirche als kaufmännischer Vorstand nach Eben-Ezer. Anfang 2022 wurde er mit dem Zusammengehen von Eben-Ezer mit den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel zusätzlich Mitglied des Vorstandes von Bethel. Die 1862 gegründete Stiftung leistet ihre Dienste in der Region Lippe für rund 4.000 Menschen.
Peter Runck (63), langjähriger Geschäftsführer des Internationalen Bauordens, ist in Ludwigshafen in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet worden. Zugleich wurde sein Nachfolger, der katholische Theologe Philipp Schmitz, in sein Amt eingeführt. Der Sozialpädagoge Runck habe in seiner 23-jährigen Zeit als Geschäftsführer die Arbeit des Bauordens mit Sitz in Ludwigshafen „geprägt und ein stabiles Fundament gebaut“, würdigte der Vereinsvorsitzende Jonathan Mack. Er habe Projekte mit Minderheiten, Geflüchteten und mit jungen Strafgefangenen angestoßen. „Anpacken, statt nur zu reden“ sei dessen Motto gewesen. Der neue Geschäftsführer Schmitz stammt vom Niederrhein, hat eine kaufmännische Ausbildung und Erfahrungen in der kirchlichen Jugendarbeit.
Johannes Rasche (41), bislang Klinikgeschäftsführer des Helios Klinikums Schleswig, wird Regionalgeschäftsführer der Helios Region Nord. Er folgt auf Franzel Simon, der sich aus der Position zurückziehen und sich auf die kommissarische Klinikgeschäftsführung des Helios Hanseklinikums Stralsund sowie die Aufsichtsratsvorsitze der Helios Kliniken in Schleswig und Schwerin fokussieren wird. Rasche rückt zum 1. Mai auf die neue Position. Er kennt die Helios Region Nord schon lange. Der heute 41-Jährige startete Ende 2014 als Assistent der Klinikgeschäftsführung in der Helios Endo-Klinik und der Helios Klinik Cuxhaven.
Annette Kurschus (61), ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und westfälische Präses, ist mit einem Gottesdienst in ihr neues Amt in Bethel eingeführt worden. Die evangelische Theologin ist seit Anfang April Pastorin und Seelsorgerin in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld. Sie war am 20. November als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen zurückgetreten. Ihr wurde vorgeworfen, sie sei nicht ausreichend transparent mit einem Missbrauchsverdacht an ihrem früheren Arbeitsort Siegen umgegangen. Zu Kurschus' neuen Aufgaben in Bethel gehören die Leitung der Ethik-Kommission des großen Diakonie-Unternehmens sowie die Leitung des Hauses der Stille, eines Einkehrhauses mit theologischer Bildungsarbeit. Sie arbeitet zudem in der Seelsorge im Bethel-Hospiz „Haus Zuversicht“. Ihre Vortrags- und Predigttätigkeit kann sie weiterführen. Bethel ist eines der größten Diakonieunternehmen Europas.
Michael „Micco“ Dotzauer, Hamburger Gastronom, ist für sein Engagement zugunsten der Aids-Seelsorge und seinen Einsatz für die Rechte von Schwulen mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) überreichte ihm die Auszeichnung im Rathaus. Dotzauer organisiert im Rahmen der von ihm gegründeten Initiative „Die Paten - gemeinsam gegen Aids“ regelmäßig Spendenaktionen und Benefizveranstaltungen. Dotzauer wuchs in der DDR auf und engagierte sich bereits dort für die Rechte von Homosexuellen und gegen staatliche Repressionen. In Hamburg betrieb er von 2011 bis 2022 die „Contact Bar“ in St. Georg. Sein Engagement reicht von Benefizveranstaltungen für die Aids-Seelsorge über weitere LSBTIQ*-Initiativen bis zur Umsetzung des Denkmals für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Hamburg.
8.5.:
Online-Seminar „Sozialdatenschutz in der Kinder- und Jugendhilfe“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/2758282-27
14.-15.5. Fulda:
Seminar „Arbeitszeit, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700
22.-24.5. Frankfurt a. M.:
Fortbildung „Aufsuchen anstatt Abwarten - Grundlagen Streetwork“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 0174/3154935
27.5. Berlin:
Fortbildung „Berufliche Integrationsförderung für Jugendliche - Gelingender Übergang Schule Beruf“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/275828212
28.5.:
Online-Kurs: „Vielfaltsfähig führen - Einführung“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 0174/3154935
Juni
3.6.:
Online-Fachtag „Verhalten, das uns herausfordert ... aber wozu eigentlich? Systemische Ansätze aus Wissenschaft und Praxis“
Tel.: 0 7542/10-5300
3.6. Berlin:
Veranstaltung „Netzwerktreffen für kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-419
12.-13.6. Weimar:
Tagung „Läuft’s im Betreuungsrecht?“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-419
19.-21.6. Berlin:
Seminar „Präsenz und Rhetorik für Führungskräfte“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 03361/710943
21.6. Hamburg:
Seminar „Rote Zahlen in der stationären Altenhilfe“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-519
26.-28.6. Freiburg:
Seminar „Selbstwirksamkeit und Selbstfürsorge in herausfordernden sozialen Arbeitskontexten“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700