 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 41/2024 - 11.10.2024
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 41/2024 - 11.10.2024
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 41/2024 - 11.10.2024
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 41/2024 - 11.10.2024

nicht jede Frau findet in der Mutterschaft ihre Erfüllung. Das Thema beschäftigt die Forschung unter dem Stichwort „Regretting Motherhood“ seit rund zehn Jahren. Corina Linke-Voigt ist Mutter - und bereut es, sich für ein Kind entschieden zu haben. Sie sagt: „Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich denke, ohne Kind würde es mir psychisch besser gehen, da ich mich dann mehr auf mich selbst konzentrieren könnte.“ Doch eine Mutterschaft zu bereuen, ist nach wie vor ein Tabuthema. Für die Braunschweiger Soziologin und Autorin Christina Mundlos ist das kein Wunder. Es liege an strukturellen Problemen in der Gesellschaft, die Mütter mit ihren Aufgaben weitgehend alleine lasse, sagt sie.
Droht der gesetzlichen Pflegeversicherung bald die Pleite oder nicht? Gesundheitsminister Lauterbach bestreitet das, will aber dennoch in einigen Wochen ein Konzept für eine „große Pflegereform“ vorlegen. Bereits jetzt werden Warnungen davor laut, die Beiträge anzuheben. Längst ist klar, dass die Pflegekasse mehr Geld braucht, schon deshalb, weil die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigt. Fachverbände fordern vor dem Hintergrund der fehlenden Finanzmittel einmal mehr grundlegende Reformen, um die Pflege langfristig zu sichern und Betroffene bei den Kosten zu entlasten. epd sozial hat die Stimmen gesammelt.
Die „Aktion Mensch“, einst „Aktion Sorgenkind“, feiert ihren 60. Geburtstag. Das Anliegen, Menschen mit Behinderungen ein besseres Leben zu ermöglichen, überdauerte den Namenswechsel - und ist bis heute nicht erreicht. Aber, so heißt es, vieles habe sich zum Besseren gewandelt, auch wegen der mehr als 5,4 Milliarden Euro, die an soziale Projekte vergeben wurden. Man sei stolz darauf, mit den Fördermitteln „einen entscheidenden Beitrag zu mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung und die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen“ geleistet zu haben, erklärte der Vorstand der Aktion Mensch, Armin von Buttlar. Aber es bleibe noch viel zu tun: „Das Jubiläum ist auch ein Ansporn für die Zukunft.“
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg müssen Bürgergeldbezieher eine „realistische Chance“ haben, eine angemessene Wohnung mieten zu können. Kann das Jobcenter nicht nachweisen, dass eine „nennenswerte Zahl“ an Wohnungen auf dem Mietmarkt vorhanden ist, können die Hilfebezieher die Erstattung der Unterkunftskosten nach den Vorgaben des Wohngeldgesetzes plus einen Sicherheitszuschlag von zehn Prozent verlangen, urteilte das Gericht.
Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.
Ihr Dirk Baas

Rendsburg (epd). Könnte Corina Linke-Voigt die Zeit zurückdrehen, würde sie sich nicht noch einmal dazu entscheiden, Mutter zu werden. Und das, obwohl sie ihr Kind nach eigener Aussage liebt. „Ich habe ein sehr gutes und inniges Verhältnis zu meiner Tochter“, sagt die 46-Jährige. Wir tauschen unsere Gedanken aus, sie fragt mich oft um Rat."
Dennoch bereue sie es, Mutter geworden zu sein. „Es ist unglaublich anstrengend, gerade als Trennungsmutter“, berichtet die Steuerfachangestellte aus Schleswig-Holstein. „Ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem ich denke, ohne Kind würde es mir psychisch besser gehen, da ich mich dann mehr auf mich selbst konzentrieren könnte.“
Sie betont jedoch, dass ihr Kind keine Schuld daran trage: „Immer wenn der Gedanke in mir hochkommt, dass ich meine Mutterschaft bereue, denke ich auch immer daran, dass ich ihr das auf keinen Fall zeigen oder sie spüren lassen darf.“ Aufgetreten seien die Reuegedanken vor mehr als fünf Jahren, während der Trennung vom Vater ihrer Tochter. „Aufgrund des Stresses und der Streitigkeiten, die durch die Trennung entstanden sind, wurde mir bewusst, wie wahnsinnig angreifbar man ist, wenn man ein Kind hat“, sagt Linke-Voigt.
Seit der Trennung lebe ihre elfjährige Tochter beim Vater. Ihr Kind sei jedes zweite Wochenende bei ihr.
Die Soziologin und Autorin Christina Mundlos beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Regretting Motherhood. Sie sieht verschiedene Gründe als Auslöser. „Das Muttersein wird immer noch sehr verklärt, auch wenn die damit einhergehenden Belastungen und Einschränkungen oder auch Gefahren hier und da mal thematisiert werden“, sagt sie dem Evangelischen Pressedienst (epd). Letztendlich bleibe es bei der Thematisierung der negativen Seiten bei einem Kratzen an der Oberfläche, ohne dass nachhaltige Lösungen angeboten werden. „So nach dem Motto: Muttersein kann auch anstrengend sein, aber ein bisschen Me-Time mit einem Tee und etwas Yoga gleichen das aus.“ Das sei aber ein Irrtum, sagt die Soziologin.
Auch strukturelle Probleme seien dafür ausschlaggebend, dass manche Frauen ihre Mutterschaft bereuen. „Solange jede dritte Frau häusliche Gewalt erlebt, bei gemeinsamen Kindern die Gefahr besteht, bei einer Trennung die Kinder an den Täter zu verlieren, und 75 Prozent der Alleinerziehenden keinen oder zu wenig Unterhalt zur Versorgung der Kinder erhalten, lassen sich die Belastungen und Risiken der Mutterrolle nicht wegatmen“, stellt Mundlos klar.
Die Debatte zu „Regretting Motherhood“ werde seit etwa zehn Jahren geführt. Dabei seien die Bedingungen für Mütter laut Einschätzung der Expertin vorher schon schlecht gewesen. Die Problemlagen hätten sich lediglich verschoben. „Während es früher Frauen zum Beispiel nicht erlaubt war, ohne Einverständnis des Ehemanns erwerbstätig zu sein und es insbesondere in Westdeutschland auch fast keine Möglichkeiten der Kinderbetreuung gab, können Mütter heutzutage zwar erwerbstätig sein, zahlen dafür aber einen hohen Preis, da die Mehrfachbelastung größtenteils an ihnen hängen bleibt.“
Außerdem seien finanzielle und strukturelle Benachteiligungen damals wie heute ein großes Problem für Mütter. Über Regretting Motherhood zu sprechen, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Linke-Voigt wollte über ihre Situation sprechen und suchte sich Hilfe bei Anlaufstellen wie dem Jugendamt und der Familienberatung, doch dort habe sie keine guten Erfahrungen gemacht. „Ich habe nicht die Unterstützung erhalten, die ich mir erhofft hatte“, berichtet sie. „Ich wünsche mir, dass man nicht nur als Mutter gesehen wird, sondern auch als der Mensch, der man vorher war und dass man sich nicht ständig dafür rechtfertigen muss, auch eigene Bedürfnisse zu haben.“
Über die Social-Media-Plattform Instagram hat sie sich mit anderen Frauen vernetzt, denen es ähnlich geht, und tauscht dort Erfahrungen aus. „Ich habe das Gefühl, dass man als Trennungsmama etwas andere Voraussetzungen hat als als Mutter, die noch mit dem Vater des Kindes zusammen ist.“ Sie habe die Hoffnung, dass ihre Reuegedanken eines Tages verschwinden.
Frankfurt a. M. (epd). „Regretting Motherhood“ bezeichnet das Gefühl der Reue, das manche Mütter wegen ihrer Mutterschaft empfinden. Dabei wird nicht die Liebe zu den eigenen Kindern infrage gestellt, sondern die Lebensveränderungen und Einschränkungen, die mit der Mutterschaft einhergehen.
Die Auslöser hierfür sind vielfältig. Manche Mütter fühlen sich überfordert und unzufrieden mit der Rolle als Mutter, andere beklagen den Verlust ihrer Autonomie und Freiheit. Der gesellschaftliche Druck, der durch soziale Erwartungen und Normen entsteht, die Mutterschaft idealisieren und glorifizieren, kann ein verstärkender Faktor für Betroffene sein. Hauptmerkmale sind die emotionale Belastung rund um Reuegefühle, Traurigkeit oder Frustration über die Entscheidung, Mutter geworden zu sein, bis hin zu dem Wunsch, die Entscheidung rückgängig machen zu können.
Im Jahr 2015 sorgte die israelische Soziologin Orna Donath mit ihrer nicht repräsentativen Studie zu Regretting Motherhood für Aufsehen. Für ihre Erhebung befragte sie 23 israelische Mütter zu ihren Gefühlen gegenüber der eigenen Mutterrolle. Das Ergebnis: Obwohl sich die Mehrheit der Frauen für Kinder entschieden hatte, bereuten sie ihre Entscheidung im Nachhinein. Die Frage „Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, würden Sie dann noch einmal Mutter werden, mit dem Wissen, das Sie heute haben?“, beantworteten alle 23 Frauen mit „Nein“.
Besonders in Deutschland stieß die Studie eine kontroverse Debatte an. Unter dem Hashtag #regrettingmotherhood teilten viele Frauen ihre eigenen Erfahrungen mit. Auch das Marktforschungsinstitut YouGov machte zu dem Thema eine Umfrage. Demnach stimmten 20 Prozent der Aussage „Wenn ich mich heute noch einmal entscheiden könnte, würde ich keine Kinder mehr bekommen wollen“ zu. Die Gründe reichen von der Einschränkung der persönlichen Entfaltung über fehlende Betreuungsmöglichkeiten bis hin zu besseren Karrierechancen.
Die eigene Mutterschaft zu bereuen, ist nach wie vor ein Tabuthema. Durch die Stigmatisierung herrscht fehlende Akzeptanz für Frauen, die offen über ihre Reue sprechen. Zudem mangelt es an Angeboten wie psychologischer Unterstützung und sozialen Netzwerken, um mit den Gefühlen der Reue umzugehen.

Braunschwig (epd). Das Buch, so sagt Christina Mundlos im Gespräch mit epd sozial, hat ein unerschiedliches Echo ausgelöst. Viele Frauen begrüßten es, dass das Thema in die Öffentlichkeit gerückt wurde. Aber es gab auch weniger schöne Zuschriften. Die Fragen stellte Stefanie Unbehauen.
epd sozial: Frau Mundlos, Sie sind Autorin des Buchs „Wenn Mutter sein nicht glücklich macht - das Phänomen Regretting Motherhood“. Welche Resonanz erhielten Sie dazu?
Christina Mundlos: Die Resonanz zu meinem Buch ist ganz unterschiedlich. Es meldeten sich unzählige unglückliche Mütter bei mir. Viele waren erleichtert, zum ersten Mal zu merken, dass sie damit nicht allein sind. Einige hatten noch nie mit jemandem darüber gesprochen - die Älteste war inzwischen über 80 Jahre alt und hatte sich noch nie jemandem anvertraut. Darüber hinaus bekam ich aber auch Post mit Drohungen und Forderungen, zu dem Thema besser zu schweigen. Darunter waren auch fundamentalistische religiöse Schriften im Tenor „Frauen zurück an den Herd“.
epd: Frauen, die das Muttersein bereuen, berichten oft davon, dass sie sich das Leben mit Kind anders vorgestellt haben. Wird das Muttersein Ihrer Einschätzung nach in der Gesellschaft und auch in Medien oft zu sehr romantisiert und nicht realistisch genug dargestellt?
Mundlos: Das Muttersein wird immer noch sehr verklärt - auch wenn die damit einhergehenden Belastungen und Einschränkungen oder auch Gefahren hier und da mal thematisiert werden. Es bleibt letztlich auch bei der Thematisierung der negativen Seiten bei einem Kratzen an der Oberfläche, ohne dass nachhaltige Lösungen angeboten werden. So nach dem Motto: Muttersein kann auch anstrengend sein, aber ein bisschen Me-Time mit einem Tee und etwas Yoga gleichen das aus.
Einmal die Woche in Ruhe duschen zu können, ist aber kein Selfcare oder Me-Time. Und solange jede dritte Frau häusliche Gewalt erlebt, bei gemeinsamen Kindern die Gefahr besteht, bei einer Trennung die Kinder an den Täter zu verlieren, und 75 Prozent der Alleinerziehenden keinen oder zu wenig Unterhalt zur Versorgung der Kinder erhalten, solange lassen sich die Belastungen und Risiken der Mutterrolle nicht mit einem Namaste wegatmen. Da braucht es politische Maßnahmen.
epd: Die Gesellschaft hat oft hohe Erwartungen an Mütter. Viele Frauen versuchen, diesen gerecht zu werden, und haben dadurch häufig ein erhöhtes Stresslevel. Hat die gesellschaftliche Erwartungshaltung Ihrer Meinung nach einen Einfluss darauf, wieso manche Mütter ihre Mutterschaft bereuen?
Mundlos: Es gibt sowohl die Erwartungshaltung, überhaupt Kinder zu bekommen, und dann auch noch alle möglichen Erwartungen daran, wie Mütter zu sein haben. Dadurch haben wir zum einen Mütter, die ganz unabhängig von den Rahmenbedingungen ihre Mutterschaft bereuen. Die Vorstellung, dass jede Frau Mutter werden will und soll, ist falsch. Dennoch wird auf Frauen ohne Kinder sehr viel Druck ausgeübt, sie müssten Kinder bekommen wollen. Eine andere Gruppe von Müttern bereut ihre Mutterschaft, da sie unter den damit einhergehenden Belastungen, Diskriminierungen und Erwartungshaltungen an die Mutterrolle leiden.
epd: Das Phänomen Regretting Motherhood ist noch relativ neu. Denken Sie, dass das daran liegt, dass Frauen heutzutage häufiger berufstätig sind und dadurch eine Doppelbelastung haben? Oder liegt es daran, dass sich erst jetzt mehr Frauen trauen, darüber zu sprechen?
Mundlos: Die Debatte über Regretting Motherhood wird erst seit rund zehn Jahren geführt. Dabei waren die Bedingungen für Mütter auch früher schon sehr schlecht. Die Problemlagen haben sich nur verschoben. Während es früher Frauen zum Beispiel nicht erlaubt war, ohne Einverständnis des Ehemanns erwerbstätig zu sein und es insbesondere in Westdeutschland auch fast keine Möglichkeiten der Kinderbetreuung gab, können Mütter heutzutage zwar erwerbstätig sein, zahlen dafür aber einen hohen Preis, da die Mehrfachbelastung größtenteils an ihnen hängen bleibt. Außerdem sind finanzielle und strukturelle Benachteiligungen damals wie heute ein großes Problem für Mütter.
Darüber zu sprechen, ist ein erster wichtiger Schritt. Jedoch müssen nun politische Maßnahmen folgen wie beispielsweise die Verbesserung der finanziellen Absicherung - ganz besonders auch von Alleinerziehenden - oder die Umsetzung der Istanbul-Konvention, damit Gewaltschutz für Mütter und Kinder kein reines Lippenbekenntnis bleibt.
epd: Welchen Rat haben Sie für Frauen, die bereits Mutter sind, aber mit ihrer Rolle oder ihren Aufgaben zu kämpfen haben? Woran können sich diese Frauen wenden?
Mundlos: Früher habe ich Müttern geraten, Mitarbeit und Entlastung vom Partner einzufordern. Inzwischen berate ich Mütter seit fast 17 Jahren und muss resignierend feststellen: Viele Väter weigern sich rigoros, sich für die Bedürfnisse ihrer Kinder verantwortlich zu fühlen. Wir haben zudem eine hohe Scheidungsquote, sodass viele Mütter früher oder später alleinerziehend sind. Die Diskriminierung von Alleinerziehenden nimmt seit Jahren immer größere Ausmaße an. Das Risiko, in Armut zu landen, oder Nachtrennungsgewalt und auch institutionelle Gewalt durch Familiengerichte und Jugendämter zu erleben, ist bei einer Trennung enorm. Daher kann ich Frauen nur noch raten, keine Kinder zu bekommen. Für Mütter bleibt mir nur der Tipp, sich mit anderen Müttern zusammenzuschließen und die Politik in die Pflicht zu nehmen.

Berlin (epd). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Berichte über eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit der Pflegeversicherung zurückgewiesen. Zwar stehe die Pflegeversicherung derzeit „unter Beitragssatzdruck“, sagte er am 7. Juli in Berlin. Sie sei aber weder insolvent, „noch droht ihr die Insolvenz“, sagte der Minister. Die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen könnten sich auf die Leistungen verlassen. Demgegenüber halten Pflegekassen und Sozialverbände Beitragserhöhungen für unabwendbar, sofern der Bund die Pflegeversicherung nicht mit weiteren Steuergeldern stützt.
Lauterbach kündigte an, „in wenigen Wochen“ eine große Pflegereform vorstellen zu wollen. Dann werde er sagen, ob und in welchem Umfang die Beiträge zur Pflegeversicherung angehoben würden. Ob sie Anfang 2025 steigen, ließ er offen. Der Gesundheitsminister räumte ein, dass sich die Pflegeversicherung in einer schwierigen Lage befindet. Die Ausgaben stiegen, während die Einnahmen wegen der schwachen Konjunktur unbefriedigend seien, sagte er. Haupttreiber der Ausgaben seien die steigende Zahl der Pflegebedürftigen, die Anhebung der Pflegelöhne auf Tarifniveau und die 2022 eingeführten Zuschüsse aus der Pflegeversicherung an Heimbewohnerinnen und -bewohner.
Lauterbach reagierte damit auf einen Bericht des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“, wonach die Pflegeversicherung im Februar 2025 zahlungsunfähig sei, wenn nicht gegengesteuert werde. Dem Bericht zufolge diskutiert die Regierungskoalition bereits über eine Beitragserhöhung. Krankenkassen und Sozialverbände appellierten an die Regierung, höhere Beiträge abzuwenden. Sie verlangten, die aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung finanzierten fünf Milliarden Euro in der Corona-Krise müssten umgehend zurückgezahlt werden. Der Bund hatte die Pflegekassen verpflichtet, die pandemiebedingten Kosten für Pflegeeinrichtungen zu übernehmen.
Der Bund müsse die noch ausstehenden Beträge ausgleichen, forderte die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Doris Pfeiffer. Außerdem müsse der Staat die Sozialbeiträge für pflegende Angehörige übernehmen, die Pfeiffer allein für 2024 auf rund vier Milliarden Euro schätzte. Mit dem Geld „müssten wir nicht schon wieder über Beitragserhöhungen sprechen“, sagte Pfeiffer. Der GKV-Spitzenverband rechnet bis zum Jahresende mit einem Defizit von knapp 1,8 Mrd. Euro. Ohne Reformen wäre eine Anhebung der Beitragssätze um mindestens 0,25 Prozentpunkte zum Januar 2025 notwendig, damit die Pflegekasse zahlungsfähig bleibe, erklärte der Verband.
Der Krankenkasse DAK zufolge war die Verwendung von Beitragsgeldern während der Pandemie nicht zulässig. Geld aus der Pflegekasse dürfe nur eingesetzt werden, um den Versicherungsschutz der Beitragszahler zu gewährleisten. Die Kasse berief sich auf ein neues Rechtsgutachten. Würde die Summe 2024 zurückgezahlt, könne eine Betragserhöhung vermieden werden, erklärte auch die DAK.
Der Sozialverband VdK warnte, selbst eine Beitragserhöhung von bis zu 0,3 Prozentpunkten würde die Pflegeversicherung nur bis zum Frühjahr 2026 finanzieren. Präsidentin Verena Bentele forderte, auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige müssten in die gesetzliche Pflegeversicherung einzahlen. Maria Loheide, Vorständin für Sozialpolitik bei der Diakonie Deutschland, verlangte, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben und Pflegebeiträge auch auf Einkommen aus Kapitalerträgen und Mieteinnahmen zu erheben.
Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer VDAB, sagte in Berlin: „Dass die gesetzliche Pflegeversicherung sich kurz vor dem finanziellen Kollaps befindet, ist leider keine Überraschung.“ Der Ampel-Koalition sei die Problematik bereits zu Beginn ihres Amtsantritts bewusst gewesen und dennoch habe die Lösung immer nur darin bestanden, Finanzlöcher kurzfristig zu stopfen, anstatt eine nachhaltige Strukturreform auf den Weg zu bringen. „Es ist an der Zeit, keine weitergehenden Leistungsversprechen mehr abzugeben, sondern die Pflegeversicherung nachhaltig zu konstruieren und zu finanzieren.“
„Es ist paradox: Mit dem stambulanten Versorgungsmodell existiert ein Pflegekonzept, das nachweislich Kosten senkt und von Pflegebedürftigen über die Pflegefachleute bis zu den Kommunen von allen Beteiligten begrüßt wird“, sagte der Präsident des Arbeitgeberverbandes AGVP, Thomas Greiner, am 8. Oktober: „Doch anstatt angesichts der knappen Kassen der Pflegeversicherung dieses fertige Konzept unverzüglich, unkompliziert und flächendeckend einzusetzen, stehe es jetzt auf der Kippe. “Man kann den Eindruck gewinnen, Politik und Pflegekassen wollten in Wahrheit gar nicht sparen, sondern lieber weiterhin in die Taschen der Beitragszahler greifen, um ihre eigenen Löcher zu stopfen."
Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung beträgt 3,4 Prozent vom Bruttolohn. Kinderlose zahlen vier Prozent. In diesem Jahr rechnet die Bundesregierung Lauterbach zufolge mit 400.000 zusätzlichen Pflegebedürftigen, 2023 stieg ihre Zahl um 360.000. Insgesamt sind rund fünf Millionen Menschen auf Pflege angewiesen; mehr als drei Viertel werden von den Angehörigen versorgt.
Maria Loheide, Vorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland: „Jetzt rächt sich, dass die Bundesregierung eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung auf die lange Bank geschoben hat. Entgegen den Versprechungen im Koalitionsvertrag fehlen allein 5,9 Milliarden Euro, um die Kosten der Pandemie zu decken, die der Bund bis heute nicht erstattet hat. Auch die im Koalitionsvertrag vereinbarte Übernahme der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige hat die Bundesregierung bisher nicht bereitgestellt. Das Defizit kann nicht allein aus Beiträgen gedeckt werden, sondern muss aus Bundesmitteln finanziert werden. Wir sprechen uns dafür aus, die Einnahmeseite der Pflegeversicherung auf mehrere Schultern zu verteilen: Die Beitragsbemessungsgrenze sollte auf das Niveau der Rentenversicherung angehoben werden. Außerdem müssen bei den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern nicht nur Löhne und Gehälter, sondern auch andere Einkommensarten wie Kapital- und Mieterträge bei der Beitragsbemessung berücksichtigt werden.“
Wilfried Wesemann, Vorstandsvorsitzender des Deutschen evangelischen Verbandes für Altenarbeit und Pflege (DEVAP): „Zugesagte Bundesmittel etwa für versicherungsfremde Leistungen in Höhe von 5,9 Milliarden Euro während der Corona-Pandemie wurden bislang nicht zurückgezahlt. Insgesamt ist ein höherer Steuerzuschuss notwendig, um das System zu stabilisieren. Auch die Länder müssen mehr Verantwortung übernehmen, etwa durch die Übernahme von Investitionskosten. Zudem müssten Ausbildungskosten endlich aus den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen herausgerechnet werden und die Kosten für die medizinische Behandlungspflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen durch die Krankenkassen übernommen werden.“
Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer VDAB: „Dass die gesetzliche Pflegeversicherung sich kurz vor dem finanziellen Kollaps befindet, ist leider keine Überraschung. Der Ampel-Koalition ist die Problematik bereits zu Beginn ihres Amtsantritts bewusst gewesen und dennoch bestand die Lösung immer nur darin, Finanzlöcher kurzfristig zu stopfen, anstatt eine nachhaltige Strukturreform auf den Weg zu bringen. Es ist an der Zeit, keine weitergehenden Leistungsversprechen mehr abzugeben, sondern die Soziale Pflegeversicherung nachhaltig zu konstruieren und zu finanzieren.“
Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des SoVD: „Wir brauchen eine Pflegevollversicherung, die alle Kosten abdeckt und die Pflegebedürftigen spürbar entlastet. In diese Bürgerversicherung müssen alle einzahlen - auch Privatversicherte wie Selbstständige und Verbeamtete. Und wir sagen: Bei der Erhebung der Beiträge muss die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und damit auch weitere Kapitaleinkünfte herangezogen werden, wie Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung sowie Kapitaleinkommen. Der Bund muss endlich seiner Verantwortung bei der Refinanzierung der milliardenschweren versicherungsfremden Leistungen gerecht werden und die zur Pandemiebewältigung zweckentfremdeten Beitragsmittel zurückzahlen. Noch immer sind hier rund sechs Milliarden Euro nicht refinanziert.“
Verena Bentele, Präsidentin des VdK: „Die Pflegeversicherung muss umfassend reformiert werden, um immer weiter steigende Beiträge zu verhindern. Die Politik muss dafür sorgen, dass endlich alle Bürgerinnen und Bürger, also auch Beamtinnen und Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die Pflegeversicherung einzahlen. Dabei müssen alle Einkunftsarten in die Beitragsrechnung einbezogen werden. Versicherungsfremde Leistungen müssen durch Steuereinnahmen getragen werden und dürfen nicht die Pflegekasse belasten. Außerdem ist es dringend nötig, die Beitragsbemessungsgrenze, ebenso wie die der Krankenversicherung, auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung anzuheben.“
Kathrin Sonnenholzner, Präsidentin der Arbeiterwohlfahrt: „Es kann nicht sein, dass die Beitragszahlenden jetzt den pflegepolitischen Stillstand der letzten Jahre ausbaden müssen. Es gibt andere Lösungen als Beitragserhöhungen. Ohne eine echte Reform wird es die Pflegeversicherung nicht aus der Krise schaffen: Wir brauchen eine Deckelung der Kosten für Pflegebedürftige und vor allem die BürgerInnenversicherung, die alle Berufsgruppen und jede Einkommensart einbezieht. Zusätzlich dürfen versicherungsfremde Leistungen grundsätzlich nicht mehr über die Pflegeversicherung finanziert werden. Ein erster Schritt dahin - und eine schnelle finanzielle Entlastung - wäre die schnelle Rückzahlung der Pandemiekosten von 5,5 Milliarden Euro aus Steuermitteln.“
Anja Piel, DGB-Vorstandsmitglied: „Die Ampel muss jetzt die Pflege für alle sichern. Die angespannte Situation der Pflegeversicherung lässt kein weiteres Herumeiern mehr zu. Der finanzielle Notstand in der Pflegeversicherung kommt nicht überraschend, sondern hat sich seit langem abgezeichnet. Wenn die Bundesregierung jetzt nicht den Mut zu einer echten Reform aufbringt, ist im neuen Jahr schon nicht mehr geklärt, wer sich um die Großmutter, den Großvater oder die kranke Angehörige kümmern kann. Endlich ist eine Pflegeversicherung für alle einzuführen, die alle Pflege-Kosten übernimmt. Der wichtigste Schritt ist, die Eigenanteile in der Pflege so zu deckeln, dass Pflege bezahlbar bleibt.“
Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): „Die Politik der klebrigen Finger auf Kosten der Beitragszahler muss ein Ende haben. Ohne eine grundlegende und nachhaltige Strukturreform droht die Belastung der Arbeitskosten durch Pflegeversicherungsbeiträge in den kommenden Jahren erheblich weiter zu steigen. Laut OECD steht Deutschland in Europa auf Platz 2 bei der Belastung des Faktors Arbeit. Die Pflegekassen müssen die Mittel zurückerhalten, die sie aufgrund von gesetzlichen Vorgaben pandemiebedingt zusätzlich aufgewendet haben.“
Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes: „Wir brauchen jetzt umgehend eine Finanzreform, die die Liquidität der sozialen Pflegeversicherung kurzfristig sicherstellt und einer Anhebung des Beitragssatzes vorbeugt. Dazu gehört in erster Linie der immer noch ausstehende Ausgleich von Pandemie-Kosten in Höhe von 5,3 Milliarden Euro, die die Pflegeversicherung getragen hat. Außerdem braucht es einen Steuerzuschuss für versicherungsfremde Leistungen wie zum Beispiel die Rentenversicherungsbeiträge von pflegenden Angehörigen, was auch nochmal fast vier Milliarden Euro brächte. Bleibt die Bundesregierung weiter tatenlos, wird eine neuerliche Zusatzbelastung der Beitragszahlenden in Höhe von 0,2 bis 0,3 Beitragssatzpunkten unvermeidlich.“
Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes: „Zwei Sofortmaßnahmen zur kurzfristigen Stabilisierung der Pflegeversicherung liegen auf der Hand und sollten umgehend umgesetzt werden, um eine Beitragssatzanhebung abzuwenden: Die Pflegeversicherung sitzt immer noch auf rund 5,3 Milliarden Euro Sonderausgaben aus Coronazeiten, mit denen der Staat sie allein gelassen hat. Diese Mehrbelastung muss durch den Bund ausgeglichen werden. Außerdem wird die Pflege durch die Übernahme der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige massiv belastet. In diesem Jahr schon mit rund vier Milliarden Euro, in 2025 mit 4,5 Milliarden Euro und jährlich weiter ansteigend. Auch dies ist keine Aufgabe, die aus Beitragsmitteln, sondern eine staatliche Aufgabe, die aus Bundesmitteln zu finanzieren ist. Mit diesen rund neun Milliarden Euro müssten wir nicht schon wieder über Beitragserhöhungen sprechen und es gäbe ein Zeitfenster, um die Pflegeversicherung solide zu reformieren.“
Berlin (epd). Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat sich am 9. Oktober in Berlin mit einer fraktionsübergreifenden Initiative aus dem Bundestag zu vorgeburtlichen Tests auf eine Behinderung des Kindes beschäftigt. Die meisten Sachverständigen begrüßten den Antrag der Bundestagsabgeordneten, den zunehmenden Einsatz der Tests und die Auswirkungen nachzuverfolgen. Nach dem Willen der Abgeordneten soll ein Expertengremium die Ergebnisse auswerten und einen Bericht an den Bundestag verfassen.
Der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Josef Hecken, begrüßte den Vorstoß aus dem Bundestag ausdrücklich. Hecken erklärte, es gehe um ethische Grundfragen, zu denen sich der Bundestag verhalten müsse. Er habe das jahrelang angemahnt, da der Bundesausschuss selbst keine ethischen Wertentscheidungen treffen könne, sagte Hecken. Es zeichne sich eine Entwicklung ab, die die Politik und auch der Bundesausschuss nicht gewollt hätten: „Wir wollten keinen Massentest“, sagte er.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Krankenhäusern, Ärzten und Krankenkassen ist das zentrale Gremium in der Selbstverwaltung des Gesundheitswesens. Er steuert die Versorgung, indem er über die Kassenleistungen beschließt. Seit Juli 2022 werden von den Kassen nicht-invasive Pränataltests (NIPT) bezahlt, mit denen Trisomien festgestellt werden können, etwa das Down-Syndrom. Die Bluttests werden seit Jahren angeboten, mussten aber bis 2022 selbst bezahlt werden. Sie sind eine Alternative zu den sogenannten invasiven Testungen durch Fruchtwasseruntersuchungen oder die Messung der Nackenfalten des Ungeborenen, die in bis zu vier von 1.000 Fällen zu Fehlgeburten führen können.
121 Abgeordnete aus SPD, Union, Grünen, FDP und der Gruppe der Linken haben den gemeinsamen Antrag auf eine Überprüfung der Kassenzulassung für die Pränataltests im April in den Bundestag eingebracht. Nach Angaben der fraktionsübergreifenden Gruppe werden die Tests inzwischen bei mehr als einem Drittel der Schwangeren gemacht, obwohl sie nur bei entsprechenden Risiken im Rahmen ärztlicher Beratung eingesetzt werden sollen.
Die Verbände von Menschen mit Behinderungen sehen sich in ihren Befürchtungen bestätigt. Die Bundesgeschäftsführerin der Lebenshilfe, Jeanne Nicklas-Faust, geht davon aus, dass die Tests inzwischen bei 40 Prozent der Schwangerschaften eingesetzt werden. Sie kämen damit einer „Reihenuntersuchung“ gleich, erklärte sie. Dies sei politisch nicht gewollt. Vielmehr sei es darum gegangen, die Tests für alle zugänglich zu machen, nicht nur für Selbstzahler. Die häufige Anwendung könne dazu führen, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für Menschen mit einer Behinderung sinke, warnte Nicklas-Faust.
Die Schauspielerin Carina Kühne, die selbst das Down-Syndrom hat, bestätigte, dass die vorgeburtlichen Testungen bei ihr der Eindruck erzeugten, dass Menschen wie sie „nicht gewollt“ seien.
Der Verband der Frauenärzte erklärte, ein Zusammenhang zwischen dem Einsatz der Bluttests und der Zahl der Spätabtreibungen sei aus den vorliegenden Daten nicht herzustellen. Der Verband betonte, die Ärztinnen und Ärzte nähmen keinen Einfluss auf die Frauen. Es sei allein Sache der Schwangeren zu entscheiden, ob sie den Test wolle oder nicht.
Offen blieb die Frage, ob die Zahl der Abtreibungen im frühen Stadium der Schwangerschaft wegen der häufigeren Testungen gestiegen ist. Das Bundesgesundheitsministerium hatte dazu bis Ende 2023 noch keine Erkenntnisse, wie aus der Antwort auf eine Anfrage der Unions-Fraktion hervorgeht. Auch aus der Pränatalmedizin gibt es dazu bisher keine Zahlen.

Osnabrück, Berlin (epd). Die Zahl der Senioren in Deutschland, die zusätzlich zu ihrer Rente auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Das geht aus einer Übersicht des Amtes hervor, die von der Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) im Bundestag angefragt worden war und die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.
Im zweiten Quartal 2024 bezogen laut der Statistik 728.990 Senioren die sogenannte Grundsicherung im Alter. Das ist den Angaben zufolge ein neuer Höchstwert und bedeutet einen Anstieg um rund 37.000 gegenüber dem Vorjahr.
Im Juni 2023 hatten dem Bundesamt zufolge noch 691.820 Senioren Sozialhilfe bezogen. Im Vergleich zu 2015 bedeutet die aktuelle Zahl einen Anstieg um rund 39 Prozent - im Juni 2015 hatten 523.160 Menschen im Rentenalter Sozialhilfe erhalten. Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben Menschen, die eine bestimmte Altersgrenze, derzeit 67 Jahre, erreicht haben und deren Rente nicht für ihren Lebensunterhalt ausreicht. Außerdem erhalten auch Menschen ohne Rentenanspruch im Alter eine Grundsicherung. Dazu zählen beispielsweise Flüchtlinge.
Nach Darstellung der Deutschen Rentenversicherung bezogen Ende 2023 von den insgesamt rund 16,4 Millionen Menschen im regulären Rentenalter knapp 469.000 Rentnerinnen und Rentner zusätzlich eine Grundsicherung. Das entspreche einer Grundsicherungsquote von 2,9 Prozent, teilte die Rentenversicherung am Dienstag mit. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Anstieg 0,1 Prozent betragen.
Der Anstieg ist der Deutschen Rentenversicherung zufolge hauptsächlich auf Änderungen bei den Freibeträgen zurückzuführen: Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen, können seit Januar 2021 zusätzlich zur Rente Grundsicherung beantragen. Damit werde ein bestimmter Betrag der Rente bei der Grundsicherung nicht angerechnet. Der Freibetrag ist demnach von 2021 bis 2024 mit über 25 Prozent deutlich gestiegen. „Wer also mit seinem Einkommen bisher knapp über einem Grundsicherungsanspruch lag, kann durch den neuen Freibetrag anspruchsberechtigt werden“, schrieb die Deutsche Rentenversicherung.
Außerdem erhielten danach rund 221.000 Menschen im Rentenalter Ende 2023 Grundsicherung und keine Rente. Die Alters-Grundsicherung zahlt das Sozialamt. Den Anstieg in dieser Gruppe sieht die Rentenversicherung vor allem im Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine, die seit Juni 2022 eine Grundsicherung im Rentenalter beantragen.
BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht nannte den Befund den nächsten „Offenbarungseid für die Ampel“. Es sei beschämend, dass immer mehr Rentner zum Sozialfall würden, sagte sie der Zeitung. Das sei eine bittere Bilanz für Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). Die Dunkelziffer bei der Altersarmut liege vermutlich sogar deutlich höher, da sich „viele Senioren den demütigenden Gang zum Sozialamt“ ersparten.
Das Rentensystem in Deutschland sei eines der leistungsschwächsten in Europa, kritisierte Wagenknecht. „Es produziert millionenfach sozialen Abstieg im Alter.“ Als positives Beispiel nannte sie Österreich, wo ein langzeitversicherter Rentner im Schnitt 800 Euro im Monat mehr erhalte. Das müsse auch in Deutschland möglich sein.

Berlin (epd). Um auf Bundesebene einen Rahmen für bundesweite Qualitätsstandards in der Kitabetreuung zu setzen, braucht es aus Sicht des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesfamilienministerium, Sven Lehmann (Grüne), keine Grundgesetzänderung. Das sagte der Politiker am 7. Oktober in einer Sitzung des Petitionsausschusses des Bundestages.
„Der Bund kann über das SGB VIII den Rahmen setzen. Die Konkretisierung dieser Vorgaben obliegt dann aber den Ländern und Kommunen“, so Lehmann. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz würden die weiteren Schritte zu dem benötigten Qualitätsstandardgesetz vorbereitet: „Dann aber selbstverständlich in Verbindung mit den notwendigen Bundesmitteln.“
Unterdessen liegt dem Bundestag die Forderung der Länder vor, Korrekturen am Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vorzunehmen. In seiner Stellungnahme begrüßt der Bundesrat zwar das Ziel, „die Qualität in der frühkindlichen Bildung im Sinne der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet anzugleichen“. Das sei elementar für die Gesetzgebungskompetenz des Bundes und sei auch von den Ländern mit Blick auf ein langfristig angestrebtes Qualitätsentwicklungsgesetz unterstützt worden.
Kritik gibt es an dem Plan, bestimmte „identische oder ähnliche Maßnahmen in einem Land über die Bundesmittelfinanzierung als wertvolle Maßnahmen zur Kitaqualität“ anzuerkennen, andere jedoch nicht. So würden dann etwa in Nordrhein-Westfalen dadurch ursprünglich bundesweit finanzierte „SprachKitas“ keine zulässigen Maßnahmen der Qualitätsverbesserung darstellen, während das in anderen Ländern durchaus der Fall wäre. „Diese materielle Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte und Maßnahmen scheint hinsichtlich des angestrebten Ziels gleicher Standards im gesamten Bundesgebiet inkonsistent und sollte daher überdacht werden“, rügt der Bundesrat, der sich in seiner Stellungnahme noch zu vielen weiteren Aspekten des Gesetzentwurfes geäußert hat.
Hintergrund der Sitzung im Petitionsausschuss war eine öffentliche Petition, in der die Stärkung von Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Deutschland durch die Einführung bundesweiter Qualitätsstandards gefordert wird (ID 167142). Die Eingabe wurde auf dem Petitionsportal rund 25.000 Mal unterzeichnet. Gut 190.000 Unterstützerinnen und Unterstützer hat die Petition zudem auf dem analogen Wege mittels Unterschriftenlisten gefunden, hieß es im Ausschuss.
Die Petentin Katja Ross, als Erzieherin in Rostock tätig, erläuterte vor den Abgeordneten die vier konkreten Forderungen der Eingabe. Es gehe um bessere Mindestpersonalstandards, einen besseren Ausbau der Kitaplätze, eine bessere Fach- und Praxisberatung und mindestens eine Profilfachkraftstelle pro Kita, sagte sie. Mittelbare pädagogische Arbeit, Krankheits-, Fortbildungs- und Urlaubstage, so betonte Ross mit Blick auf die Mindestpersonalstandards, müssten in der Personalplanung stärker berücksichtigt werden. Die hierfür zu berücksichtigende Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte müsse auf wissenschaftlicher Grundlage festgesetzt werden. Zusätzlich müssten Kitas „in herausfordernden Lagen“ durch höhere Standards besonders unterstützt werden, forderte Ross.
Rahel Dreyer, Professorin für Pädagogik und Entwicklungspsychologie der ersten Lebensjahre an der Alice Salomon-Hochschule Berlin, verwies auf wissenschaftlich empfohlene Personalschlüssel in Kitas. „Die liegen bei unter-dreijährigen Kindern bei 1:3 und bei älteren Kindern bei 1:7,5“, sagte die Expertin, die die Petentin bei der Sitzung begleitete. In einigen Bundesländern sei man von diesen Schlüsseln, die zudem die Ausfallzeiten gar nicht einplanten, „weit entfernt“. Wenn aber die Personalschlüssel teils bei 1:17 im Krippenbereich lägen, „ist das pädagogisch nicht mehr zu verantworten“, sagte Dreyer.
Zur Fachkräftesituation im Kitabereich sagte Ross, es werde im Grunde ausreichend ausgebildet. „Die Frage ist, warum kommen diese Fachkräfte in der Praxis nicht an.“ Viele, so Ross, hätten schon während ihrer Ausbildung oder beim Studium die Erfahrung gemacht, „dass das katastrophale Bedingungen sind, unter denen sie nicht arbeiten wollen“.
Dreyer forderte die Politik auf, mehr Geld in den Bereich Fachkräftesicherung und -bindung zu investieren. Etwa ein Viertel der ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher würden in den ersten Jahren schon wieder das Berufsfeld verlassen. Als Gründe dafür würden sie unter anderem anführen, dass sie ihrem eigenen Anspruch an die Bildungsarbeit aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht gerecht werden könnten und es auch kaum Karrieremöglichkeiten innerhalb des Systems gebe, sagte die Erziehungswissenschaftlerin.
Die Situation rund um die Kitabetreuung stehe und falle mit den Fachkräften, bestätigte auch Staatssekretär Lehmann. Daher habe sein Ministerium im Mai auch die Gesamtstrategie zur Fachkräftegewinnung vorgestellt. Dabei gehe es um Schulgeldbefreiung und Fragen der Vergütung, um die Ausbildung attraktiver zu machen. Es gehe aber auch um verbesserte Umschulungsmöglichkeiten.
Als dritten Punkt führte Lehmann die Anerkennungsverfahren für Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen, die vereinfacht und auch berufsbegleitend ermöglicht werden müssten. „Das ist eigentlich der entscheidende Punkt“, machte er deutlich.

Berlin (epd). Die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland bleibt hoch. Bis zum August dieses Jahres ist laut dem am 8. Oktober in Berlin vorgestellten AOK-Fehlzeiten-Report 2024 bereits der Spitzenwert aus dem gesamten vorigen Jahr erreicht worden. Angesichts von Personalengpässen und Fachkräftemangel untersucht der Report untersucht auch, wie Arbeitgeber ihre Beschäftigten halten können.
Der Auswertung zufolge kamen bis zum August 225 Krankmeldungen auf 100 Versicherte, so viele wie im gesamten Jahr 2023. Die Autorinnen und Autoren des Reports gehen davon aus, dass die Zahlen bis Ende des Jahres noch steigen werden. Haupttreiber sind weiterhin Atemwegserkrankungen, gefolgt von psychisch bedingten Fehlzeiten. Psychische Leiden erhöhen den Krankenstand vor allem durch die lange Dauer von durchschnittlich 28 Tagen Arbeitsausfall. Wegen einer Atemwegserkrankung fehlen Beschäftigte hingegen im Durchschnitt nur sechs Tage.
Report-Mitautorin Johanna Baumgardt vom Wissenschaftlichen Institut der AOK führte die hohen Fehlzeiten auf zwei zentrale Faktoren zurück. Seit dem Beginn der Corona-Jahre sei der Krankenstand wegen der Zunahme an Infektionen und viralen Erkrankungen insgesamt höher. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2021 wurden knapp 160 Krankmeldungen pro 100 AOK-Mitglieder gezählt. Zum anderen führten Arbeitsverdichtung, Personalmangel und Mehrfachbelastungen zu einer steigenden Zahl beruflich bedingter psychischer Erkrankungen. Sie haben in den vergangenen zehn Jahren am stärksten zugenommen.
Der AOK-Report beschäftigt sich daher in diesem Jahr mit der Frage, wie Arbeitgeber die negativen Entwicklungen bremsen können. Den Erhebungen zufolge sind die Krankschreibungen niedriger, wenn die Beschäftigten eine höhere Bindung an ihr Unternehmen haben. Das ergab eine repräsentative Befragung von 2.501 Beschäftigten zwischen 18 und 66 Jahren durch das forsa-Institut.
Zu den wichtigsten Faktoren dafür zählen die Arbeitszufriedenheit, die Möglichkeit, seine Fähigkeit einsetzen zu können und betriebliche Angebote zur Gesundheitsförderung. Allerdings werden diese nur von jedem Zweiten auch in Anspruch genommen. Das könne deutlich verbessert werden, bilanzierte Baumgardt. Wo die Belastungen besonders hoch sind wie etwa in der Pflege, schaukeln sich die negativen Faktoren hingegen hoch: Personalmangel führt zu Überlastungen und einem hohen Krankenstand, weswegen wiederum Pflegekräfte besonders häufig angeben, ihre Branche verlassen zu wollen.
Die AOK-Vorstandsvorsitzende Carola Reimann sagte zu den Problemen in der Pflegebranche: „Man kann so auf Dauer nicht weiterarbeiten.“ Mit Blick auf die akuten Finanzprobleme in der Pflegeversicherung verlangte sie von der Bundesregierung „eine kurzfristige Lösung“. Der Bund müsse der Pflegeversicherung zumindest schnell die Milliarden-Hilfen zurückzahlen, mit denen während der Corona-Pandemie Pflegeeinrichtungen gestützt wurden.
Die während der Pandemie eingeführte und inzwischen auf Dauer eingerichtete Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung trägt der AOK-Chefin zufolge nicht zum dauerhaften Hoch bei den Krankmeldungen bei. Reimann wandte sich damit gegen eine Forderung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der angesichts des hohen Krankenstandes verlangt, die telefonische Krankschreibung wieder abzuschaffen. Reimann sagte, die Beschäftigten gingen offenbar verantwortungsvoll mit dieser Möglichkeit um.
Die Ermittlung des Krankenstandes für den Fehlzeiten-Report basiert auf Daten der rund 15 Millionen AOK-Mitglieder, die im Jahr 2023 in mehr als 1,6 Millionen Betrieben tätig waren. Der Bericht erscheint jährlich.
Berlin (epd). Nach Angaben des Wegweisers Demenz, der vom Bundesgesundheitsministerium herausgegeben wird, sind Depressionen und Demenz die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im Alter. Sie treten oft zusammen auf. „Gut jeder fünfte Mensch mit Demenz leidet auch an einer deutlichen depressiven Störung. Das belastet die Lebensqualität von Patientinnen, Patienten und Angehörigen erheblich. Außerdem erhöht die Kombination beider Erkrankungen das Risiko für Betreuungspersonen, selbst eine Depression zu entwickeln“, heißt es in einer Mitteilung vom 7. Oktober.
Depressionen und Demenzen beeinflussen sich den Angaben zufolge oft gegenseitig. Depressionen erhöhten das Risiko für Demenzen um das bis zu Sechsfache. Dieses Risiko sei größer als bei anderen chronischen Erkrankungen. Umgekehrt sei auch das Risiko für depressive Störungen bei Menschen mit Demenz deutlich erhöht. "Depressive Störungen beeinträchtigen die kognitiven Fähigkeiten, Alltagsfunktionen und soziale Kompetenz der Menschen mit Demenz zusätzlich und lassen sie noch 'dementer' erscheinen, so die Fachleute.
Die Diagnose, ob primär eine Depression oder eine Demenz vorliegt oder beides, sei nicht immer einfach. Für eine Demenz sprechen unter anderem folgende klinische Merkmale: Desorientiertheit, wonach sich Patientinnen und Patienten in ihrer Umgebung nicht mehr zurechtfinden. Die Unfähigkeit, Informationen aus ihrem Gedächtnis abzurufen, die nicht mehr gespeichert werden konnten. Und Störungen von Hirnfunktionen, die sich in Form von Sprach- und Bewegungsstörungen wie Aphasie und Apraxie bemerkbar machen.
Für eine zusätzliche schwerere Depression bei Demenz sprechen zum Beispiel Schuldgefühle, Suizidalität, Schlaflosigkeit, Gewichtsverlust, Unruhe und ausgeprägte Konzentrationsstörungen.
Den Expertinnen und Experten zufolge könne die erfolgreiche Behandlung der Depression Menschen mit Demenz ebenso helfen wie ihren Betreuerinnen und Betreuern. Bislang gelte, auf Grundlage einiger Studien mit nur wenig überzeugenden Ergebnissen, die Behandlung mit Antidepressiva als Therapie der ersten Wahl. Dennoch liege es nahe, dass es für die meisten Menschen mit Demenz und depressiver Störung angemessener und erfolgversprechender sei, nichtmedikamentöse Strategien zu wählen. „Antidepressiva sollten demnach beschränkt sein auf Patientinnen und Patienten mit schweren Depressionen, die das Risiko der Selbstverletzung oder gar eines Suizids bergen“, so die Empfehlung.
Bei leichten oder mittelschweren Depressionen sei eine psychotherapeutische Behandlung mindestens ebenso erfolgversprechend wie Antidepressiva und das Nebenwirkungsrisiko ist geringer. „Allerdings ist das psychotherapeutische Angebot für Menschen mit Demenz bei weitem noch nicht ausreichend“, so die Fachleute.
Nürnberg (epd). Nach einer Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird die wirtschaftliche Stagnation den Arbeitsmarkt 2025 in Mitleidenschaft ziehen. „Wir erwarten für das kommende Jahr einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in allen Bundesländern“, so Forscher Rüdiger Wapler. Laut der Studie falle er in Niedersachsen mit 0,8 Prozent am geringsten aus. „Den höchsten relativen Anstieg erwarten wir in Thüringen mit fünf Prozent“, so der Fachmann in einer Mitteilung vom 7. Oktober. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung steige nicht mehr in allen Bundesländern, die Arbeitslosigkeit nehme überall zu.
In Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen wird laut Wapler die Arbeitslosenquote stabil bleiben. In Ostdeutschland dürfte die Arbeitslosenquote im kommenden Jahr den Angaben nach um 0,2 auf 7,6 Prozent etwas stärker zunehmen als in Westdeutschland um 0,1 auf 5,7 Prozent.
In Mecklenburg-Vorpommern wird eine Zunahme der Jobsuchenden um 3,9 Prozent, in Sachsen und Bayern um jeweils 3,6 Prozent erwartet. Das entspricht in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern einem Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent gegenüber 2024, in Sachsen und Bayern um 0,2 beziehungsweise 0,1 Prozent.
Hingegen fallen die relativen Anstiege bei den Arbeitslosenzahlen in Niedersachsen mit 0,8 Prozent, in Bremen mit 1,0 Prozent und in Nordrhein-Westfalen mit 1,1 Prozent am geringsten aus. Nur in diesen Bundesländern bleibt die Arbeitslosenquote konstant. Während in Bayern weiterhin die niedrigste Arbeitslosenquote mit 3,8 Prozent im Jahr 2025 erwartet wird, weist Mecklenburg-Vorpommern mit 8,2 Prozent nach den Stadtstaaten Bremen mit 11,1 Prozent und Berlin mit 9,8 Prozent die dritthöchste Quote aller Bundesländer auf.
„Die Entwicklung von regionalen Ungleichheiten müssen wir insgesamt eher längerfristig betrachten“, führte Wapler aus. Wenn man zumindest die Spannweite der prognostizierten Arbeitslosenquoten von 11 Prozent in Bremen bis knapp 4 Prozent in Bayern anschaue, dann entspreche deren Differenz ziemlich genau dem, was wir schon in den letzten zehn Jahren beobachten. „In diesem Zeitraum lag immer die Arbeitslosenquote in Bayern am niedrigsten und in Bremen am höchsten“, so der Forscher.
Zugleich betonte der Fachmann mit Blick auf die untersuchten Siedlungsstrukturen: „Die Beschäftigung geht vor allem in den ländlichen Gebieten zurück, in städtischen Gebieten steigt sie weiterhin. Hohe Anstiege der Arbeitslosigkeit erwarten wir dagegen sowohl in den Großstädten als auch in den sehr dünn besiedelten ländlichen Kreisen. Hier können wir also nicht sagen, Stadt oder Land macht den Unterschied.“
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dürfte 2025 in Westdeutschland um 0,6 Prozent wachsen, während sie in Ostdeutschland stagniert. Am stärksten steigt die Beschäftigung in Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Hessen mit jeweils 0,8 Prozent. In Thüringen wird mit dem stärksten Beschäftigungsrückgang um 0,6 Prozent gerechnet, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 0,3 Prozent.
Auch wenn sich die meisten regionalen Arbeitsmärkte gemessen an der schwachen Konjunktur vergleichsweise gut halten, bleibt das wirtschaftliche Umfeld unsicher. „Eine schnellere Erholung des Konsums und ein stärkerer Außenhandel dürften positive Effekte bringen. Eskalieren Handelskonflikte oder nehmen die geopolitischen Spannungen weiter zu, könnte sich die Entwicklung in den regionalen Arbeitsmärkten verschlechtern“, erklärte Wapler.
Wiesbaden (epd). Auch mit Altersrente sind nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes noch viele Menschen erwerbstätig. Bei den Rentnerinnen und Rentnern im Alter von 65 bis 74 Jahren arbeiteten laut EU-Arbeitskräfteerhebung 2023 noch 13 Prozent, wie die Behörde am 7. Oktober in Wiesbaden mitteilte. Das sei bedenklich, so die Linke.
Männer gingen dabei häufiger einer Arbeit nach als Frauen, nämlich 16 beziehungsweise 10 Prozent. Auch Rentenbeziehende mit höherem Bildungsniveau arbeiteten häufiger: Von ihnen war demnach noch knapp jede oder jeder Fünfte (18 Prozent) erwerbstätig, bei Rentnerinnen und Rentnern mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsniveau waren es 11 beziehungsweise 12 Prozent.
Als Grund für eine Erwerbstätigkeit während des Rentenbezugs nannte ein Drittel finanzielle Notwendigkeit. Fast ebenso viele, nämlich 29 Prozent, gaben Freude an der Arbeit als Hauptbeweggrund an. 11 Prozent arbeiteten, weil dies für sie finanziell attraktiv war oder weil der Partner oder die Partnerin ebenfalls noch erwerbstätig war. Soziale Integration durch den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen war für 9 Prozent ausschlaggebend.
Die meisten arbeiteten mit reduziertem Stundenumfang. 40 Prozent gingen den Zahlen zufolge weniger als zehn Stunden die Woche einer Erwerbstätigkeit nach. Ein Viertel arbeitete zehn bis 20 Stunden. 16 Prozent der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner hatten aber auch eine Arbeitswoche mit mehr als 40 Stunden. Insgesamt arbeiteten mehr als zwei Drittel als abhängig Beschäftigte, weniger als ein Drittel war selbstständig tätig.
Matthias W. Birkwald, renten- und alterssicherungspolitischer Sprecher der Gruppe die Linke im Bundestag, sagte, viele Rentnerinnen und Rentner seien auf die Zuverdienste angeweisen, weil ihre Rente nicht zum Leben reiche. „Niemand darf gezwungen sein, im Alter weiterarbeiten zu müssen. Das ist aber bedauerlicherweise bittere Realität, denn fast jeder fünfte Rentner ist arm, und Frauen sind davon besonders betroffen.“ Er forderte, zur Vorbeugung von Altersarmut alle Renten sofort zusätzlich, einmalig und außerordentlich um zehn Prozent anzuheben, um wieder zu einem lebensstandardsichernden Rentenniveau von 53 Prozent zurückzukehren.

Bonn, Mainz (epd). Seit ihrer Gründung vor 60 Jahren hat die Aktion Mensch bundesweit mehr als 5,4 Milliarden Euro an soziale Projekte vergeben. Ziel sei, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung sowie von Kindern und Jugendlichen nachhaltig zu verbessern, erklärte die Förderorganisation am 7. Oktober in Bonn. Die Aktion Mensch wurde 1964, damals noch unter dem Namen Aktion Sorgenkind, vom Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) und den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege gegründet.
Auch 60 Jahre nach ihrer Gründung möchte die Aktion Mensch Menschen dazu ermutigen, gemeinsam eine barrierefreie Gesellschaft mitzugestalten, durch Engagement und durch Begegnungen. Denn noch immer verhinderten gesellschaftliche Missstände eine umfassende Teilhabe. Zu viele Sonderstrukturen und Benachteiligungen in allen Lebensbereichen verhinderten, dass Menschen mit Behinderung selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. „So übersehen immer noch zu viele Unternehmen trotz des Fachkräftemangels die Potenziale von Arbeitnehmern mit Behinderung oder auf dem Wohnungsmarkt mangelt es erheblich an barrierefreien Wohnungen“, heißt es in der Mitteilung.
Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie fördere die Aktion Mensch jährlich bis zu 8.500 Projekte für Inklusion, hieß es. Schwerpunkte seien dabei die Bereiche Arbeit, Freizeit, Bildung, Wohnen, Mobilität sowie die Barrierefreiheit. Zugleich sei die Aktion Mensch die größte nichtstaatliche Förderorganisation in der Kinder- und Jugendhilfe: In den vergangenen 20 Jahren seien Vorhaben in diesem Bereich mit über 367 Millionen Euro unterstützt worden. An Gewinner der Lotterie seien mehr als 3,9 Milliarden Euro ausgeschüttet worden.
Die Aktion versteht sich nach eigenen Angaben als „Plattform und Vernetzerin“ für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Man sei stolz darauf, mit den Fördermitteln „einen entscheidenden Beitrag zu mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung und die Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen“ geleistet zu haben, erklärte der Vorstand der Aktion Mensch, Armin von Buttlar. „Doch das Jubiläum ist auch ein Ansporn für die Zukunft, denn wir wissen: Knapp 80 Prozent der Menschen mit Behinderung sorgen sich um einen Bedeutungsverlust von Inklusion. Umso mehr wollen wir uns künftig noch stärker auf Inklusion von Anfang an fokussieren.“
Das ZDF ist bis heute Mitglied bei der Aktion Mensch, außerdem Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Die Gründung der Organisation erfolgte vor 60 Jahren als Reaktion auf den Contergan-Skandal, bei dem die Einnahme eines Schlafmittels durch Schwangere zu Fehlbildungen bei 5.000 Neugeborenen führte. Die ZDF-Fernsehshow „Vergißmeinnicht“ wurde demnach am 9. Oktober 1964 zur Geburtsstunde der damaligen Aktion Sorgenkind.
Ab 1981 kritisierten Initiativen behinderter Menschen die Darstellung von Behinderung durch die Aktion und den Fernsehsender. In dem Namen komme eine diskriminierende gesellschaftliche Haltung zum Ausdruck. Ab Mitte der 1990er Jahre seien Menschen mit Behinderung im Rahmen von Kampagnen der Aktion als selbstbewusste Akteurinnen und Akteure aufgetreten, die einen Umgang auf Augenhöhe forderten, hieß es. 2001 sei als „konsequenter Schritt“ die Umbenennung in Aktion Mensch erfolgt.

Gießen (epd). Fast alle Studierenden der Hochschule finden laut Monika Maria Möhring spätestens ein Jahr nach Studienende einen Job. Die Gründe fasste sie so zusammen: „26 Jahre Erfahrung im BliZ, 13 zum Teil langjährige Mitarbeitende, ein Riesen-Netzwerk, individuelle Betreuung.“
Aktuell unterstützt das BliZ an den THM-Standorten Gießen, Friedberg und Wetzlar etwa 200 Studierende mit Behinderung. Sie seien in „Mangelfächern“ im naturwissenschaftlich-technischen Bereich eingeschrieben, wo dringend Arbeitskräfte benötigt werden, etwa in der Logistik oder der Informatik, erläuterte Möhring. „Viele behinderte Studierende wechseln von anderen Unis zu uns.“ Auch die Promotion sei möglich.
„Der Campus in Friedberg ist überwiegend barrierefrei, alle Türen gehen sofort auf, es gibt viele Handläufe“, berichtete die Logistik-Professorin, die neben dem Fachbereich Management und Kommunikation auch das BliZ leitet. Die behinderten Studierenden erhielten einen Platz im Wohnheim und Unterstützung von ihren nicht behinderten Kommilitonen, die sie zu Sport, Veranstaltungen und Partys mitnehmen.
Für die regelmäßig etwa 30 blinden THM-Studenten konvertiere das BliZ pro Semester 5.000 Dokumente, damit sie in der Blindenschrift Braille oder mit dem Screenreader gelesen werden können. Techniker des BliZ setzten die Klausuren so um, dass sie hör- und fühlbar sind. Bei gelähmten Studierenden kämen vereidigte Schreiber zum Einsatz. Ein schwer an ALS erkrankter Student habe seine Abschlussarbeit immer dann auf Band gesprochen, wenn seine Krankheit es zuließ.
Das BliZ helfe auch beim Übergang in den Arbeitsmarkt. Es übernehme die Beantragung von Hilfen und stelle Arbeitgebern das Equipment zur Verfügung, „bis die Anträge durch sind“. Möhring, die selbst behindert ist und einige Jahre im Rollstuhl saß, betonte: „Je öfter Mitarbeiter mit Handicap in die Firmen kommen, umso mehr bauen sich die Bedenken der Arbeitgeber ab.“
Manche Absolventen seien so schwer behindert, dass sie sich kaum bewegen können. „Aber wir finden trotzdem jemanden, der sagt: Für unseren Zweck spielt es keine Rolle.“ Beim Jobeinstieg helfe das große Netzwerk, das sich das BliZ in den 26 Jahren seines Bestehens aufgebaut habe: „Wir fragen auch Ehemalige, ob bei ihnen in der Firma Werkstudenten gebraucht werden.“ Jedes Semester gehen laut Möhring zehn THM-Studierende mit Handicap an Hochschulen ins Ausland.
Seit einiger Zeit kämen vermehrt junge Menschen mit Autismus oder ADHS an die THM. „Man weiß heutzutage, wie Autisten oder Kinder mit ADHS beschult werden müssen“, erklärte Möhring. Sie schafften daher zunehmend das Abitur.

Stuttgart (epd). Die Zentrale Schuldnerberatung (ZSB) in Stuttgart ist eine der größten in Deutschland. 15 Schuldnerberater arbeiten hier in einer Einrichtung vereint, dazu kommen Verwaltungsmitarbeiter und etwa 15 Ehrenamtliche, teils Banker im Ruhestand. Einer der Berater ist Bernd Elsass. Im Durchschnitt hat ein Schuldner in der Beratung rund 15 Gläubiger.
Seit 20 Jahren berät Elsass überschuldete Menschen und kennt die klassischen Ursachen von Überschuldung: „Das sind Arbeitsplatzverlust, Krankheit sowie Trennung oder Scheidung.“ Die durchschnittliche Verschuldung derer, die zur Beratung kommen, lag 2023 bei gut 32.000 Euro. „Es können unter 10.000 Euro, aber auch 90.000 Euro sein“, sagt Elsass. Ein extrem schneller Weg zu hohen Schulden seien Online-Glücksspiele.
Rund 40 Prozent derer, die zur Beratung kommen, sind arbeitslos. Dieser Anteil ist seit vielen Jahren in etwa konstant. Doch zunehmend melden sich auch Berufstätige, ihr Anteil lag 2023 bei ebenfalls rund 40 Prozent. Ein großer tarifgebundener Stuttgarter Arbeitgeber finanziert für seine Mitarbeiter eine schnelle Beratung bei der ZSB. „Deren Anfragen haben deutlich zugenommen“, sagt Elsass. Durch die hohen Stuttgarter Mieten und die hohe Inflation kämen immer mehr Menschen mit ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr zurecht. Wenn Elsass in den Medien Arbeitgeberforderungen nach einer „Senkung der Lohnkosten“ hört, schrillen bei ihm die Alarmglocken.
Dabei steht die Region Stuttgart bundesweit betrachtet noch gut da: Im Oktober 2023, neuere Zahlen gibt es nicht, waren dort laut Creditreform 6,56 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren überschuldet, bundesweit waren es 8,15 Prozent - also in etwa jeder Zwölfte. Die Zahlen sind in letzter Zeit etwas gesunken, doch angesichts von Rezession und hoher Inflation erwartet Creditreform den Angaben nach einen erneuten Anstieg.
Schuldner sind laut Creditreform überwiegend mittleren Alters und männlich. Während in der Region Stuttgart 8,78 Prozent der 40- bis 49-Jährigen überschuldet sind, sind es nur 2,34 Prozent der Senioren ab 70. Einer Quote von 8,21 Prozent der Männer stehen 4,49 Prozent der Frauen gegenüber. Doch die Altersarmut wächst. „Nach Ende der Erwerbstätigkeit sinkt das Einkommen, aber die Kosten für Unterkunft und Energie steigen weiter“, sagt Elsass.
Er kennt den hohen Leidensdruck der Beratenen: „Überschuldung macht krank.“ Die allermeisten seien hoch motiviert und dankbar für die Unterstützung. „Ich will nie wieder in eine solche Situation kommen“, hört er oft. Durch die große Nachfrage liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Beratung bei rund sieben Monaten. Wenn der Verlust der Wohnung, eine Sperre von Strom oder Gas oder eine Kontopfändung droht, greift die ZSB aber sofort ein - die ausführliche Sozialberatung folgt dann später.
„Wir wollen nachhaltig helfen“, sagt Elsass. Das bedeutet, dass ab dem Beginn der Beratung keine neuen Schulden mehr aufgenommen werden dürfen. Ist der Haushalt nicht im Gleichgewicht, wird nach vermeidbaren Ausgaben und möglichen neuen Einnahmen gesucht: Besteht Anspruch auf Wohngeld? Unterhaltsverpflichtungen werden geklärt, Mahn- und Vollstreckungsbescheide geprüft: „Inkasso ist ein Geschäftsmodell, da können unzulässige Fantasiegebühren enthalten sein.“
Zum ganzheitlichen Ansatz der ZSB, über die eigentliche Entschuldung hinaus, gehört die Frage, wie die Schulden entstanden sind. Alle Berater sind Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter mit einer Zusatzausbildung als Schuldner- und Insolvenzberater. Besteht etwa eine Suchtproblematik, hilft die Kooperation mit anderen Beratungsstellen. Manche Jugendliche, beobachtet Elsass, hätten nie gelernt, mit Geld umzugehen. „Finanzkompetenz gehört an die Schule“, sagt er. Deshalb besucht das Präventionsteam der ZSB Berufsschulen und Azubigruppen. Ein weiteres Problem: „Manchmal werden Kredite zu leicht vergeben, es wird aggressiv für kreditfinanzierten Konsum geworben.“
Die ZSB wird gemeinsam von der „PräventSozial Bewährungshilfe“, der Caritas Stuttgart und der Evangelischen Gesellschaft (eva) getragen. Sie wird zum Großteil von der Stadt Stuttgart und von den Trägern finanziert, die Beratung ist für die Hilfesuchenden kostenlos. Elsass weiß, dass es auch kommerzielle Beratungen gibt, die mit kostenloser Beratung werben und mit Anwaltskanzleien verbunden sind. In solchen Fällen mahnt er zur Vorsicht. Zwar kann die Beratung über einen Beratungshilfeschein finanziert werden, wenn die Voraussetzungen vorliegen, dieser gelte aber nicht für einen eventuellen Insolvenzantrag. „Mancher Anwalt nimmt dafür 200 Euro, ein anderer 1.000 Euro.“
Die allermeisten Beratungen enden erfolgreich, ob mit einem Insolvenzantrag oder mit einem von den Gläubigern akzeptierten - mit Stiftungsmitteln unterstützten - Vergleich. Das sei seine größte Freude, sagt Elsass: wenn ein Mensch erleichtert aus der Beratung gehen kann - und in der Regel nie mehr wiederkommen muss.
Ahlhorn, Kr. Oldenburg (epd). Die insolvente Dietrich-Bonhoeffer-Klinik für suchtkranke Jugendliche ist aller Voraussicht nach gerettet. Die Einrichtung der Diakonie im Oldenburger Land in Ahlhorn geht zum 1. November in die Trägerschaft der diakonischen Leinerstift-Gruppe über, die ihren Sitz im ostfriesischen Großefehn hat, wie Insolvenzverwalter Berend Böhme am 7. Oktober in Ahlhorn mitteilte. Die Oldenburger Diakonie hatte Mitte Januar das Haus als insolvent melden müssen, nachdem Gehälter nicht mehr gezahlt werden konnten.
Die Klinik mit derzeit 48 Therapieplätzen ist die bundesweit größte ihrer Art. Alle 53 Mitarbeitenden könnten zu gleichen Bedingungen weiterbeschäftigt und alle Behandlungen fortgesetzt werden, betonte Böhme. Er sei froh, dass die Kassen den riesigen Bedarf an Therapieplätzen für junge Menschen erkannt hätten. „Spielentscheidend“ sei nun eine letzte Verhandlungsrunde mit der Rentenversicherung und den Krankenkassen am 21. Oktober, der er optimistisch entgegensehe. „Meine Zeit endet hier am 31. Oktober.“ Er dankte den Mitarbeitenden für ihre Unterstützung.
Um die Klinik fortführen zu können, wird laut dem Vorstand des Leinerstifts, Wolfgang Vorwerk, die Bettenzahl auf 60 erhöht. Außerdem werde sich die Altersstruktur der Patientinnen und Patienten ändern. Wurden bisher 14 bis 25 Jahre alte Patienten behandelt, sollen künftig Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren therapiert werden - in Ausnahmefällen auch bis zu 21-Jährige.
Das Leinerstift verfüge über große Erfahrung in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, erläuterte Vorwerk. Die Leinestiftgruppe beschäftige in Ostfriesland und dem Nordwesten Niedersachsens, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern rund 850 Menschen: „Der Verein sieht seine Aufgabe darin, zu helfen, seelische und soziale Beeinträchtigungen von Menschen und Familien zu überwinden oder solchen Gefährdungen vorzubeugen. Er fördert die Eingliederung von Menschen in die Gesellschaft“, heißt es auf der Homepage.
Auch die Chefärztin der Klinik, Angela Wenzel, zeigte sich erleichtert. Bundesweit gebe es ein massives Versorgungsproblem. Suchtexpertinnen und -experten schätzen die Zahl der suchtkranken Kinder und Jugendlichen zwischen Flensburg und Garmisch auf bis zu 240.000.
Wenzel zufolge werden immer mehr Kinder und Jugendliche suchtkrank. In der Regel konsumierten sie Cannabis und Alkohol - wobei Cannabis führend sei. In den meisten Fällen nutzen die Heranwachsenden mehrere Drogen parallel. „Das ist abhängig vom Angebot und dem Preis.“ Aktuell sei Lachgas ein großes Problem.
Außerdem beobachte sie mit großer Sorge die Freigabe von Cannabis an Erwachsene. Frei zugängliche Drogen wie Alkohol, Nikotin und nun auch Cannabis gerieten allzu leicht in die Hände von Kindern und Jugendlichen.
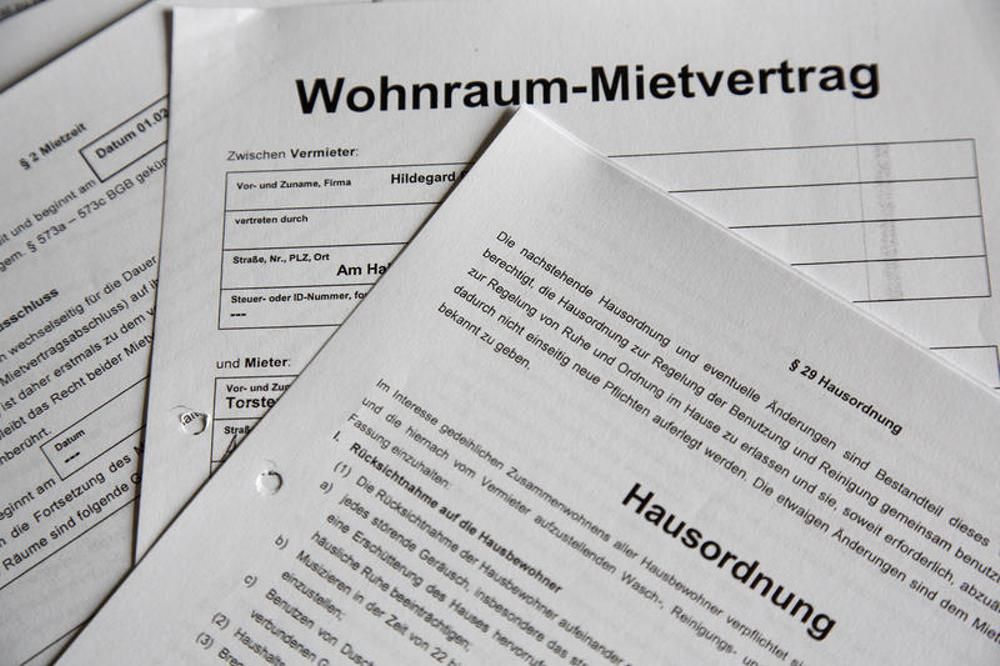
Potsdam (epd). Bürgergeldbezieherinnen und -bezieher müssen Wohnungen zu den vom Jobcenter festgelegten angemessenen Unterkunftskosten auch tatsächlich in „nennenswerter Zahl“ anmieten können. Die Behörde müsse die Verfügbarkeit von Wohnraum im jeweiligen Wohnungsmarkt nachweisen, indem sie die konkrete Anzahl der angebotenen und nachgefragten Wohnungen gegenüberstellt oder den Anteil geringverdienender Haushalte mit dem Anteil der für sie anmietbaren Wohnungen in der maximalen Größe vergleicht, entschied das Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg in einem am 26. September veröffentlichten Urteil.
Gelinge dieser Nachweis nicht, könnten Grundsicherungsempfänger die in der Wohngeldtabelle angeführten Mieten plus einen Sicherheitszuschlag von zehn Prozent beanspruchen, so die Potsdamer Richter.
Geklagt hatte ein in Berlin lebender Aufstocker von Hartz-IV-Leistungen, dem heutigen Bürgergeld. Der Mann bewohnte eine 63 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung. Das Jobcenter hielt im Streitzeitraum Juli 2015 bis Juni 2016 für einen Ein-Personen-Haushalt in Berlin eine Bruttowarmmiete von monatlich 449 Euro für angemessen. Die tatsächlichen Unterkunftskosten beliefen sich jedoch auf monatlich 584,08 Euro. Das Jobcenter hatte den Mann erfolglos zur Kostensenkung aufgefordert.
Der hielt die vom Jobcenter zugrunde gelegten angemessenen Mietkosten auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt für völlig unrealistisch. Er verwies auf eine Entscheidung des BSG vom 17. September 2020, wonach das Jobcenter die angemessene Wohnungsmiete nach einem „schlüssigen Konzept“ ermitteln müsse. Zu der von der Behörde festgelegten Kostengrenze müssten angemessene Wohnungen „auch tatsächlich in nennenswerter Zahl auf dem Markt allgemein zugänglich angeboten“ werden.
Das LSG hielt das Konzept, nach dem das Jobcenter die angemessene Miete ermittelt, für „nicht schlüssig“. Die Behörde könne sich daher nicht auf die von ihr ermittelte angemessene Miete als Obergrenze stützen. Der Kläger könne aber auch nicht die Übernahme der tatsächlichen Unterkunftskosten verlangen. Ihm stehe nur die in der Wohngeldtabelle für Alleinstehende vorgesehene Miete zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent zu, so das Gericht.
Die Angemessenheit der Unterkunftskosten sei in zwei Prüfungsschritten zu ermitteln. So habe das BSG in ständiger Rechtsprechung und auch am 30. Januar 2019 geurteilt, dass zunächst die abstrakt angemessenen Unterkunftskosten zu bestimmen seien. Damit müsse der als angemessen angesehene Wohnstandard, etwa bei der Wohnungsgröße, der Ausstattung und der Wohnlage, festgelegt werden. Für die so ermittelte Miete müsse der Grundsicherungsempfänger aber auch tatsächlich eine Wohnung finden können. Ist das der Fall, gelte diese abstrakte Mietpreisbremse.
In einem zweiten Schritt sei eine konkrete individuelle Angemessenheitsgrenze oberhalb des abstrakt angenommenen Mietpreises zu prüfen. So könnten Grundsicherungsempfänger etwa wegen einer Behinderung unter Umständen einen höheren Raumbedarf geltend machen.
Im jetzt entschiedenen Fall habe das Jobcenter nicht nachgewiesen, dass angemessener Wohnraum auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt „in nennenswerter Zahl“ zur Verfügung stehe. Was unter „nennenswerter Zahl“ zu verstehen und wie dieses nachzuweisen sei, habe das BSG bislang aber nicht definiert, erläuterte das LSG.
Eine Möglichkeit wäre, dass das Jobcenter bei der Frage, ob hinreichender bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, die konkrete Anzahl der angebotenen und nachgefragten Wohnungen im Streitzeitraum gegenüberstellt. Auch könnte der Anteil der geringverdienenden Haushalte, hier der Ein-Personen-Haushalte, mit den für sie anmietbaren angemessenen Wohnungen verglichen werden. Es müsse dann eine „realistische Chance“ auf Anmietung bestehen.
Diesen Nachweis habe das Jobcenter im konkreten Verfahren nicht erbracht. Trotz wiederholter Nachfragen habe die Behörde ihr Konzept zur Ermittlung der abstrakten Angemessenheitsgrenze selbst nicht erklären können, betonte das LSG. Weil die Angemessenheitsgrenze damit nicht gelte, müsse auf die Werte der Wohngeldtabelle zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von zehn Prozent zurückgegriffen werden.
Dem Kläger stehe daher ab Juli 2015 eine Bruttowarmmiete von jeweils 458,22 Euro und von Januar bis Juni 2016 von monatlich 541,82 Euro zu. Aufgrund von Gutschriften des Vermieters verringere sich der Anspruch für August 2015 auf 403,36 Euro und entfalle für den Monat November ganz.
Die vom LSG zugelassene Revision zum BSG in Kassel wurde inzwischen eingelegt. Dort ist das Verfahren unter dem Az.: B 4 AS 28/24 R anhängig.
Az.: L 14 AS 1570/20 (Landessozialgericht Potsdam)
Az.: B 4 AS 22/20 R (Bundessozialgericht, Angebot an tatsächlichem Wohnraum)
Az.: B 14 AS 24/18 R (Bundessozialgericht, Prüfschritte Angemessenheit)
Karlsruhe (epd). Eine Vorsorgevollmacht kann nach einer höchstrichterlichen Entscheidung nur bei erheblicher Gefahr für den Betreuten oder dessen Vermögen von einem Gericht wieder aufgehoben werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am 1. Oktober veröffentlichten Beschluss. Wenn keine Zweifel an der Redlichkeit des Bevollmächtigten bestünden, komme bei Mängeln in der Vollmachtausübung die Bestellung eines Kontrollbetreuers in Betracht, dessen Weisungen befolgt werden müssten.
Im konkreten Fall ging es um eine 78-jährige, an Alzheimer-Demenz erkrankte Frau aus Berlin. Sie hatte ihrem Nachbarn im September 2019 eine Generalvollmacht mitsamt Vorsorgevollmacht erteilt. Die Vollmacht wurde im November 2020 und im September 2021 erneuert. Allerdings wurde im August 2021 die Vollmacht mit anwaltlicher Hilfe widerrufen. Die Bank der dementen Frau akzeptierte daraufhin die Vollmacht des Nachbarn nicht mehr.
Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg bestellte daraufhin einen Berufsbetreuer, ordnete die Aufhebung der bisherigen Vollmachten an und verlangte die Herausgabe aller Vollmachtsurkunden. Das Landgericht Berlin bestätigte die Aufhebung der Vollmachten weitgehend. Zwar bestünden keine Zweifel an der Redlichkeit des Bevollmächtigten, dieser habe aber mehrere Mängel zu verantworten. So habe er nicht verhindert, dass die Frau von August 2020 bis März 2022 durch eine Vielzahl von Rechtsstreitigkeiten Anwaltskosten in Höhe von 125.000 Euro verursachte.
Der BGH hielt dies für rechtsfehlerhaft und verwies das Verfahren an das Landgericht zurück. Eine wirksame Vorsorgevollmacht könne nur bei erheblicher Gefährdung des Vollmachtgebers oder seines Vermögens gerichtlich aufgehoben werden. Hier habe es zwar Mängel bei der Vollmachtausübung gegeben, die Redlichkeit des Nachbarn sei aber nicht in Zweifel gezogen worden. Daher hätte ein Kontrollbetreuer bestellt werden müssen, der positiv auf den Bevollmächtigten einwirkt. Erst wenn zu erwarten sei, dass der Bevollmächtigte dessen Weisungen nicht befolgt, komme die Aufhebung der Vollmachten in Betracht.
Az.: VIII ZB 5/24
Karlsruhe (epd). Lesbische Paare müssen nach einer privaten Samenspende für eine Adoption des Kindes den Namen des Samenspenders preisgeben. Denn diesem müsse die Teilnahme am Adoptionsverfahren eröffnet werden, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in einem am 9. Oktober veröffentlichten Beschluss.
Im konkreten Fall ging es um zwei verheiratete lesbische Frauen mit Kinderwunsch. Um ihr Wunschkind zeugen zu können, nahmen sie die private Samenspende eines Mannes in Anspruch. Eine der beiden Partnerinnen wollte das am 24. Juli 2020 von ihrer Ehefrau geborene Kind adoptieren.
Vor dem niedersächsischen Amtsgericht Bersenbrück gab das Paar zwar an, die Kontaktdaten des Samenspenders zu kennen. Den Namen wollten sie aber nicht preisgeben, weil er auf keinen Fall namentlich benannt werden wolle. Sie fürchteten, dass der Mann später jeglichen Kontakt zum Kind ablehnen würde, sollten sie seinen Namen preisgeben. Als Beleg für die Zustimmung des Samenspenders und möglichen Vater des Kindes zur Adoption legten sie Fotos eines WhatsApp-Chat-Verlaufs vor.
Das Amtsgericht und auch das Oberlandesgericht Oldenburg wiesen den Adoptionsantrag ab. Der private Samenspender und mögliche Vater müsse am Adoptionsverfahren beteiligt werden und im Fall der Vaterschaft seine Zustimmung zur Adoption erteilen.
Dies bestätigte nun auch der BGH. Während bei einer von einer Samenbank erhaltenen Samenspende der Samenspender nicht am Adoptionsverfahren beteiligt werden müsse, sei dies bei einer privaten Samenspende anders. Der private Samenspender habe im Fall der Vaterschaft Anspruch auf Erlangung der rechtlichen Vaterschaft. Wolle hier die Partnerin der Kindesmutter das Kind adoptieren, müsse der Samenspender deshalb am Adoptionsverfahren beteiligt werden. Das Paar habe eine Mitwirkungspflicht bei der Benennung der Kontaktdaten. So könne das Familiengericht den Mann über das Verfahren informieren, damit er seine Rechte wahrnehmen könne.
Sehe dieser von der Feststellung der Vaterschaft ab, sei die Einwilligung in die Adoption nicht mehr erforderlich. Die Kopie von WhatsApp-Nachrichten könnten eine Einwilligung des Mannes in die Adoption aber nicht zweifelsfrei belegen. Allerdings könne das Adoptionsverfahren ohne Beteiligung des Samenspenders durchgeführt werden, wenn dieser anonym oder sein Aufenthaltsort dauerhaft unbekannt sei, entschied der BGH.
Az.: XII ZB 147/24
Frankfurt a.M. (epd). Häusliche Gewalt und Todesdrohungen eines Vaters gegen die Mutter ist auch eine Form der Kindesmisshandlung. Die von Kindern miterlebte Gewalt stellt eine Kindeswohlgefährdung dar und kann die Übertragung des alleinigen Sorgerechts auf die Mutter begründen, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am Dienstag, 1. Oktober veröffentlichten Beschluss.
Vor Gericht ging es um das Sorgerecht für die heute neun und fünf Jahre alten Kinder der inzwischen geschiedenen Eltern. Die Kinder leben seit der Trennung im Herbst 2020 bei der Mutter. Gegen den Vater wurde 2021 und ab Ende 2023 ein jeweils halbjähriges Näherungs- und Kontaktverbot verhängt. Grund dafür waren häusliche Gewalt und wiederholte Todesdrohungen gegen die Mutter. Die Kinder hatten die Angriffe auf ihre Mutter und die Drohungen des Vaters miterlebt.
Das Amtsgericht hatte daraufhin die gemeinsame elterliche Sorge für die Kinder aufgehoben und der Mutter das alleinige Sorgerecht übertragen.
Diese Entscheidung ist rechtmäßig, befand nun das OLG. Das Gesetz sehe die Übertragung der Alleinsorge auf einen Elternteil vor, wenn das „dem Wohl des Kindes am besten entspricht“. Hier spreche die vom Vater gegen die Mutter ausgeübte Gewalt gegen eine „für die Ausübung der elterlichen Sorge zwingend erforderliche Kommunikation auf Augenhöhe“. Das Gericht sah eine spezielle Form der Kindesmisshandlung, die die kindliche Entwicklung negativ beeinflussen könne, begründete das OLG seine Entscheidung.
Aufgrund der bedrohlichen Umstände sei es der Mutter auch nicht zuzumuten, sich regelmäßig mit dem Vater in sorgerechtlichen Fragen abzustimmen. Die „direkten Todesdrohungen sind keine Basis für die Ausübung der elterlichen Sorge“, betonte das OLG. Die Kinder hätten sich trotz ihres jungen Alters eindeutig gewünscht, dass die alleinige Sorge die Mutter ausüben solle.
Az.: 6 UF 144/24
Halle (epd). Der Grad der Pflegebedürftigkeit hängt von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen und der damit verbundenen eingeschränkten Selbstständigkeit eines Menschen ab. Allein die Schwere einer Erkrankung und Behinderung oder eine festgestellte Erwerbsminderung und ein Grad der Behinderung (GdB) sagen dagegen noch nichts über den Pflegebedarf und einen bestimmten Pflegegrad aus, entschied das Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt in einem am 30. September veröffentlichten Urteil.
Geklagt hatte ein voll erwerbsgeminderter Rentner mit einem GdB von 60. Neben körperlichen Beeinträchtigungen wie chronischen Rückenschmerzen bestehen bei ihm auch eine wiederkehrende depressive Störung und eine depressive Grundstimmung mit gelegentlichen Panikattacken. Aufgrund seiner vollen Erwerbsminderung, seines GdB von 60 und seiner psychischen Störungen beantragte er bei seiner Pflegekasse den für den Zeitraum April bis 31. August 2019 den Pflegegrad 2.
Die Pflegekasse sah nach mehreren Hausbesuchen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen die Voraussetzungen für den Pflegegrad 2 jedoch als nicht erfüllt an und lehnte den Antrag des Manns ab, der dann vor Gericht ging.
Das LSG wies die Klage nun ab. Bei der Bestimmung des Pflegegrads komme es auf die Schwere der Beeinträchtigungen in sogenannten sechs Modulen an. Dazu gehörten etwa die Bereiche Mobilität, die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten oder auch psychische Problemlagen. Je stärker die gesundheitlichen Beeinträchtigungen die Bewältigung des Alltags erschwerten, desto höher könne der Pflegegrad sein.
Zu berücksichtigen sei „allein die Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigungen, der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten“, urteilte das LSG. So begründe allein das Vorliegen einer psychischen Erkrankung noch keine Pflegebedürftigkeit. Gleiches gelte für das Vorliegen einer vollen Erwerbsminderung oder eines GdB von 60.
Das Gericht befand, dass der Kläger seinen Alltag trotz seiner Erkrankung gut bewältigen könne. Er habe im Streitzeitraum seinen Tagesablauf ohne fremde Hilfe nach seinen Gewohnheiten und Vorlieben einteilen und bewusst gestalten können. Die zeitliche und örtliche Orientierung war jederzeit gegeben. Medikamentös war er gut eingestellt. Die Voraussetzungen für einen Pflegegrad 2 lägen damit nicht vor, entschied das LSG.
Az.: L 1 P 2/22
Celle, Hannover (epd). Wer als Schöffe Grundsicherungsleistungen vom Jobcenter bezieht, muss die Tätigkeit beim Jobcenter angeben. Nicht gemeldete Schöffenbezüge können zur Rückzahlung von Grundsicherungsleistungen führen, wie das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle am 4. Oktober mitteilte. Das Urteil fiel bereits am 29. August.
Geklagt hatte den Angaben zufolge ein Ingenieur, der seit 2012 Grundsicherungsleistungen bezieht. Anderthalb Jahre später habe er am Landgericht eine Tätigkeit als Schöffe aufgenommen, was er dem Jobcenter jedoch nicht gemeldet habe. Für seinen Schöffendienst habe er dem Landgericht mitgeteilt, dass er als Bauingenieur und Energieberater ein Monatseinkommen von 3.500 Euro erzielt. Auf dieser Grundlage habe das Landgericht ihm rund 2.800 Euro als Zeit- und Verdienstausfallentschädigung gezahlt.
Nachdem das Jobcenter von den Zahlungen erfahren habe, forderte die Behörde unter Berücksichtigung der monatlichen Freibeträge rund 800 Euro an zu viel gezahlter Grundsicherung zurück. Dagegen klagte der Mann und führte an, ihm stehe für die Aufwandsentschädigungen ein Jahresfreibetrag von 2.400 Euro zu. Eine Erstattung halte er unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes für ausgeschlossen. Auch habe er wissentlich keine Entschädigung für Verdienstausfall beantragt. Vielmehr sei dem Landgericht bekannt gewesen, dass er Grundsicherungsempfänger sei. Auch das Jobcenter habe gewusst, dass er als Schöffe tätig sei.
Mit dieser Argumentation scheiterte der Ingenieur vor dem Landessozialgericht. Nach Ansicht des Gerichts ist lediglich ein Monatsfreibetrag von 200 Euro zu berücksichtigen. Erst 2023 sei mit dem Bürgergeld eine Neuausrichtung auf das Jahresprinzip erfolgt.
Auch auf den Vertrauensschutz könne sich der Kläger nicht berufen, da er dem Jobcenter unvollständige Angaben gemacht und lediglich im Rahmen eines allgemeinen Beratungsgesprächs mitgeteilt habe, dass er „vielleicht irgendwann“ als Schöffe tätig werden könnte. Dieses Vorgehen entspreche nicht den geforderten Anzeige- und Mitteilungspflichten.
Az.: L 11 AS 75/21

Bremen (epd). Seit dem 1. Oktober ist Johanna Kaste (38) neue Vorständin des Caritasverbands Bremen. Zuletzt leitete sie die Geschäftsstelle der Landesgruppe Bremen des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (bpa). Ihr Arbeitsschwerpunkt ist das Personalmanagement.
Johanna Kastes Vorgängerin Martina kleine Bornhorst übernimmt die Einarbeitung, bevor sie im April in den passiven Teil ihrer Altersteilzeit geht. Kaste bildet zusammen mit Caritasdirektor Martin Böckmann den hauptamtlichen Vorstand. Die studierte Gerontologin und Betriebswirtin leitete von 2018 bis 2024 die bpa-Landesgeschäftsstelle. Davor war sie Referentin für Alten- und Behindertenhilfe beim DRK-Landesverband Niedersachsen und Fachberaterin bei der Lebenshilfe Niedersachsen.
Die Caritas Bremen hat ihre Geschäftsstelle im Caritas-Zentrum Schwachhausen. Sie betreibt einen ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege, fünf stationäre Pflegeeinrichtungen und verschiedene Angebote in anderen Feldern der Sozialen Arbeit, darunter Übergangswohnheime für Geflüchtete, Wohngruppen für Jugendliche und Beratungsdienste. Der Verband beschäftigt nach eigenen Angaben 900 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von rund 39 Millionen Euro.
Christian Unzicker (46), medizinischer Geschäftsführer des Sozialkonzerns Diakovere in Hannover, tritt von seinem Amt zurück. Grund seien Differenzen in der bisher dreiköpfigen Geschäftsführung des Unternehmens, teilte der Aufsichtsrat von Diakovere am 9. Oktober mit. Den Angaben zufolge werden die beiden bisherigen Konzerngeschäftsführer Stefan David und Sabine Jung die Geschäfte zunächst zu zweit weiterführen. Diakovere ist mit rund 5.500 Mitarbeitenden der größte gemeinnützige Gesundheitskonzern in Niedersachsen. Es habe sich gezeigt, dass die Geschäftsführung in wichtigen Fragen zur Aufstellung des Unternehmens unterschiedliche Auffassung hatte, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Ulrich Anke: „Um sicherzustellen, dass diese Differenzen sich nicht negativ auf die Arbeit an der Unternehmensspitze auswirken, hat Christian Unzicker entschieden, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen.“ Unzicker ist Facharzt für Innere Medizin und Gesundheitsökonom. Er war seit 2023 medizinischer Geschäftsführer bei Diakovere.
Christian Link (49) und Andreas Nietzel (50) führen künftig gemeinsam das Klinikum Mainz (MKM) der Marienhaus-Gruppe. Mit Wirkung zum 15. Oktober übernimmt Link, der Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH, zusätzlich die Rolle des Co-Geschäftsführers des MKM. Co-Geschäftsführer Nietzel ist bisher der Personalchef der Marienhaus Gruppe. Nötig wird die Neubesetzung, weil der bisherige alleinige Geschäftsführer des MKM, Sascha Altendorf (48), das Unternehmen zum 31. Oktober 2024 verlassen wird. Die Marienhaus Stiftung ist einer der größten christlichen Träger von sozialen Einrichtungen in Deutschland. Zum Unternehmen zählen unter anderem elf Kliniken und 18 Pflegeheime. Der Träger beschäftigt zusammen rund 13.000 Mitarbeitende in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.
Eliane Lafendt aus Hamburg hat die Leitung des Seemannsclubs Duckdalben in Hamburg-Waltershof übernommen. Die Fachwirtin für Büro- und Projektmanagement leitete zuletzt die Geschäftsstelle des Bereiches Kita, Diakonie und Bildung des Kirchenkreises Hamburg-Ost. Seit der Gründung des Clubs habe sich die Verzahnung von diakonisch-seelsorgerischer und kaufmännischer Arbeit bewährt, hieß es. Neben Jörn Hille gehört Lafendt auch der Geschäftsführung der Deutschen Seemannsmission Hamburg-Harburg an. Lafendt übernimmt die Duckdalben-Leitung von Sören Wichmann, der zum 1. Juni den Club verlassen hatte. Übergangsweise hatte Hille, Leiter Bordbetreuung, seine Geschäfte übernommen. Der Seemannsclub Duckdalben wurde am 13. August 1986 als Einrichtung der Deutschen Seemannsmission Hamburg-Harburg gegründet. Er unterstützt und betreut Seeleute aus mehr als 100 Ländern und bietet verschiedene Dienstleistungen, Freizeitmöglichkeiten und eine Bibliothek an.
Alexandra Jung hat Anfang Oktober die Direktion des Ameos Klinikums Haldensleben in Sachsen-Anhalt übernommen. Bereits seit 2018 arbeitet sie in leitenden Funktionen im Krankenhausmanagement. Nun löste sie Christopher Arndt ab, in dessen Händen das Klinikum in den vergangenen Monaten lag. Jung hat Psychologie in Nordrhein-Westfalen und in Berlin studiert. Sie absolvierte Praktika und ein Trainee- und Managementprogramm in verschiedenen Krankenhäusern und sammelte Erfahrung im klinischen Alltag. Unter anderem war sie in den Helios Kliniken Erfurt, Bleicherode und Salzgitter tätig; in der Helios Klinik Blankenhain arbeitete sie als Geschäftsführungsassistentin. Zuletzt hatte sie die Geschäftsführerung am St. Johannes Krankenhaus in Kamenz inne.
Oktober
14.10. München:
Seminar „Die Beendigung und Änderung von Arbeitsverhältnissen“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-411
17.10. Mainz
Seminar „Rechnungslegung von WfbM - unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsergebnisses“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 0761/79186-19
30.10.:
Online-Workshop „Führungsstile und Führungsrolle - Selbstverständnis und praktische Umsetzung“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-23
November
4.11.:
Online-Seminar „Kirchliche Eigenbetriebe gestalten - Rechtsformen und betriebswirtschaftliche Steuerung“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 03361/710-943
5.-7.11.:
Online-Seminar „Fehlzeiten - Urlaub, Krankheit und Abwesenheitszeiten im Arbeitsrecht“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/36825-15
5.11.:
Online-Seminar „Erste Hilfe bei zerstrittenen Teams - In Ihrem Team gibt es Konflikte und Sie möchten sie klären?“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 03361 710 943
6.11. Münster
Seminar „Fit für die Nachhaltigkeitsberichterstattung“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-133
7.-8.11. Berlin:
Seminar „Wirkungsmanagement Intensivkurs: Strategien und Methoden“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/2758282-11
11.-13.11.
Online-Fachveranstaltung „Örtliche Zuständigkeit und Kostenerstattung - Fragen der wirtschaftlichen Jugendhilfe“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-220
13.11. Berlin:
Seminar „Der Krankenhaus-Jahresabschluss 2024 - Aktuelle Entwicklungen und Einzelfragen“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-133
19.11. Berlin:
Fallberatung „Kirchliche Besteuerung im Griff“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 0172/2883106
20.-21.11.:
Online-Fachveranstaltung „Forum Migrationssozialrecht und Integration“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-606
25.-26.11. Hannover:
Tagung „Zugang zur Gesundheitsversorgung - Nah-Niedrigschwellig-Interdisziplinär“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-419