 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2025 - 17.04.2025
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2025 - 17.04.2025
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2025 - 17.04.2025
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 16/2025 - 17.04.2025

noch gibt es die schwarz-rote Regierungskoalition nicht, da streitet sie schon. Es geht dabei auch um den Mindestlohn. Im Koalitionsvertrag steht, dass die unabhängige Mindestlohnkommission ein teilweise neues Verfahren anwenden soll, um zu ihrem Vorschlag für die Höhe der Lohnuntergrenze zu gelangen. Eine Lohnuntergrenze von 15 Euro pro Stunde sei damit bis 2026 „erreichbar“, heißt es in dem Vertrag. Kanzler in spe Friedrich Merz wies darauf hin, dass das nicht heiße, dass am Ende auch 15 Euro Mindestlohn herauskämen. Doch, sehr wohl heiße es das, antworteten ihm mehrere hochrangige SPD-Politiker. Experten von Wirtschaftsforschungsinstituten sehen durch die Debatte die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission beschädigt oder mindestens gefährdet.
Als vor mehr als 40 Jahren manche Fußballfans anfingen, sich in einer Art dritten Halbzeit gegenseitig zu verprügeln, entstanden die ersten Fansozialprojekte. Heute gibt es in Deutschland mehr als 70 davon, unter anderen getragen von Diakonie und Caritas. Sie arbeiten nicht nur gegen Gewalt an, sondern beispielsweise auch gegen Sportwettsucht. Fansozialarbeiter reden nicht gern öffentlich über ihre Arbeit. Denn Fußball-Ultras könnten schon ein versehentlich falsches Wort als Vertrauensbruch betrachten. Die Mitarbeiter zweier Fansozialprojekte in Würzburg und Paderborn haben epd sozial trotzdem einen Einblick erlaubt.
Viele Flüchtlinge kommen zuerst in EU-Ländern wie Italien oder Griechenland an und stellen dort ihren ersten Asylantrag. In diesen Staaten allerdings müssen sie mitunter in Notunterkünften bleiben und sich mit Schwarzarbeit über Wasser halten. Viele ziehen daher weiter nach Deutschland und stellen hier erneut einen Asylantrag. Dann aber droht ihnen die Rückführung in die Erstaufnahmeländer. In Schwarzarbeit oder Wohnungslosigkeit dort sehen deutsche Gerichte keine Gründe, die einer Abschiebung prinzipiell im Wege stünden.
Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.
Ihr Nils Sandrisser

Frankfurt a.M. (epd). Noch bevor sich die schwarz-rote Regierung gebildet hat, geht sie in einen ersten Schlagabtausch. Thema ist der Mindestlohn. Dessen Höhe von 15 Euro pro Stunde sei bis zum Jahr 2026 „erreichbar“, heißt es im Koalitionsvertrag. CDU-Chef Friedrich Merz hatte in der „Bild am Sonntag“ jedoch darauf hingewiesen, dass es dafür „keinen gesetzlichen Automatismus“ gebe.
SPD-Politiker hatten sich daraufhin für die Anhebung starkgemacht. Parteichef Lars Klingbeil sagte im „Bericht aus Berlin“ der ARD: „Wenn die Mindestlohnkommission sich an all die Kriterien hält, die mittlerweile auch in der Geschäftsordnung drinnen sind, dann erreichen wir 2026 die 15 Euro.“ Generalsekretär Matthias Miersch nannte die Mindestlohn-Erhöhung als im Koalitionsvertrag „gesetzt“. Der geschäftsführende Arbeitsminister Hubertus Heil sagte im ZDF-„Morgenmagazin“: „Für den Mindestlohn haben wir besprochen, dass wir die 15 Euro erreichen wollen im Jahre 2026, und das machen wir, indem die Mindestlohnkommission sich an die eigene Geschäftsordnung hält.“
Schließlich rief die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, Christiane Schönefeld, die Unabhängigkeit der Kommission in Erinnerung. Deren Mitglieder „unterliegen bei der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit keinen Weisungen“, teilte sie mit. Auch wenn es Kriterien für die Höhe der Lohnuntergrenze gebe, dürfe die Kommission im Rahmen einer Gesamtabwägung davon abweichen.
Der Gewerkschafter Stefan Körzell, der für den DGB-Bundesvorstand in der Mindestlohnkommission sitzt, kritisierte Merz. Die Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro sei „eine Willenserklärung der Bundesregierung, die den Orientierungsrahmen der Mindestlohnkommission beschreibt“, sagte Körzell. Es sei bitter, dass die Mindestlohn-Anhebung schon vor der formellen Bildung der Bundesregierung infrage gestellt werde. „Das richtet sich gegen sechs Millionen Menschen, die Mindestlohn beziehen“, sagte er. „Die haben das bitter nötig wegen der steigenden Preise.“
Hagen Lesch, Tarifexperte des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, sieht bereits in der Thematisierung der Lohnuntergrenze im Koalitionsvertrag ein gewisses Problem. „Es stehen eine Zahl im Raum und ein Zeitplan“, sagte Lesch dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Das bedeutet, dass die angeblich unabhängige Kommission unter Druck gesetzt wird.“
Problematisch ist laut Lesch zudem, dass die politische Debatte die Tarifautonomie beschädige. Ein zu hoher Mindestlohn könne viele Tarifverträge aushebeln, in denen Löhne unterhalb der Untergrenze stehen. „Dann würden wir Gefahr laufen, dass in manchen Branchen gar keine Tarifverträge mehr geschlossen werden“, sagt der Volkswirtschaftler. „Auch die Gewerkschaften sollten deshalb ein Interesse daran haben, dass die Kommission unabhängig bleibt.“
Nach Leschs Verständnis legt der Koalitionsvertrag keineswegs einen künftigen Mindestlohn fest. Nehme man 60 Prozent des Medianlohns als Maßstab, komme man tatsächlich in die Nähe der 15 Euro, erklärt er. Berücksichtige man hingegen die Entwicklung der Tariflöhne, lande man eher bei 14 Euro. „Das ist ein Korridor“, sagt Lesch, in dem die Kommission sich bewegen dürfe.
Die Kommission empfiehlt allerdings lediglich eine Mindestlohnhöhe, festgelegt wird sie anschließend von der Politik. Lesch kritisiert die Unsicherheit, die nun durch die Debatte entstanden sei: „Es fehlt ein klares Bekenntnis, dass man nicht eingreift, wenn das Ergebnis nicht passt“, sagt er.
Mattis Beckmannshagen, Arbeitsmarktexperte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, weist hingegen darauf hin, dass der Mindestlohn ein politisches Instrument sei, das eine demokratisch legitimierte Regierung auch einsetzen dürfe. „Das hat man beispielsweise schon 2022 gemacht, als der Mindestlohn auf zwölf Euro festgesetzt wurde“, erläutert er.
Allerdings räumt Beckmannshagen im Gespräch mit dem epd ein, dass die gegenwärtige Debatte die Unabhängigkeit der Mindestlohnkommission schon ein Stück weit infrage stelle. Würde eine Bundesregierung eine Empfehlung der Kommission einfach beiseite wischen, wenn sie ihr nicht passe, „dann wäre das sicher ein Affront“, sagt er. Diese Empfehlung einfach übernehmen müsse die Politik andererseits aber auch nicht: „Es kommt da viel auf die Kommunikation an.“ Zur aktuellen Debatte merkt Beckmannshagen an: „Es wäre sicher die elegantere Art, die Mindestlohnkommission einfach ihre Arbeit machen zu lassen.“
Frankfurt a.M. (epd). Die Höhe des Mindestlohns wird alle zwei Jahre von einer Kommission empfohlen, die sich aus je drei Vertreterinnen und Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften, einer Vorsitzenden und zwei beratenden Wissenschaftlern zusammensetzt. Bis Ende Juni muss die unabhängige Kommission der Bundesregierung einen Vorschlag für den Mindestlohn in den Jahren 2026 und 2027 machen.
Neu ist laut Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, dass die Kommission für ihren Vorschlag künftig nicht nur die Entwicklung der Tariflöhne, sondern auch den Orientierungswert von 60 Prozent des Bruttomedianlohns berücksichtigen soll. Das folgt der Europäischen Mindestlohnrichtlinie. Der Bruttomedianlohn ist nicht der Durchschnittslohn, sondern bedeutet, dass genau die Hälfte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr verdient und die andere Hälfte weniger. Auf diese Weise ist laut Koalitionsvertrag ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 „erreichbar“.
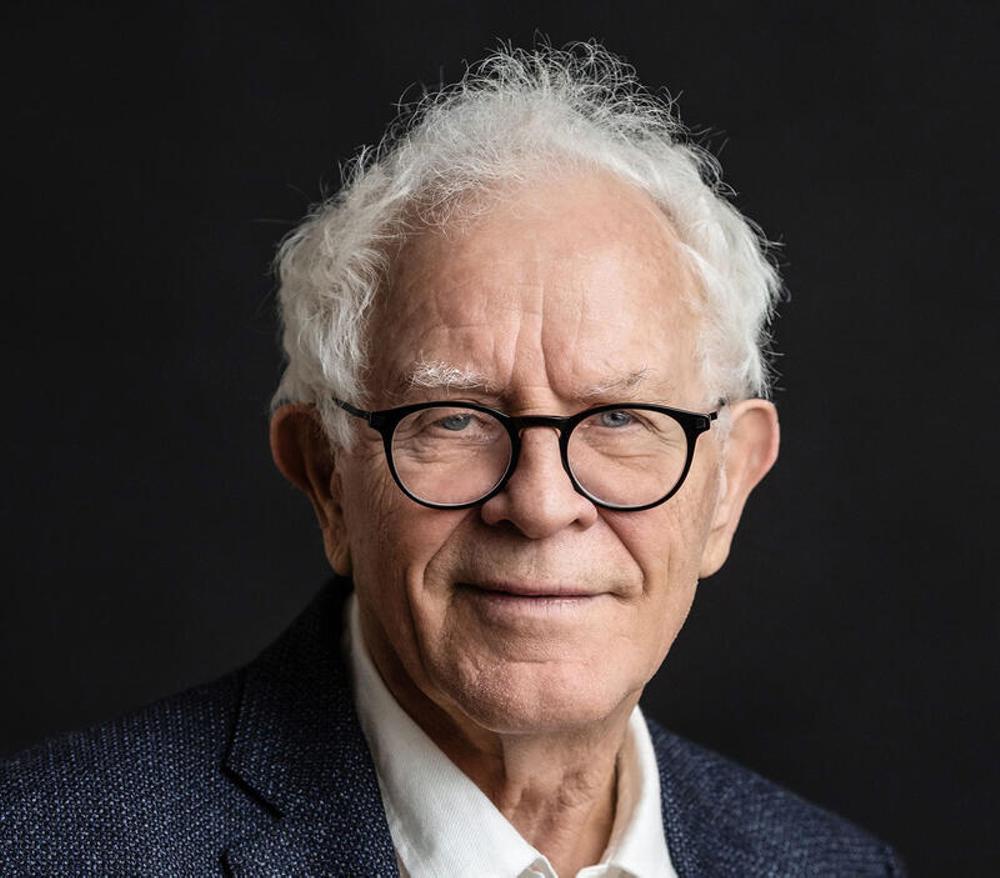
Gießen (epd). Der Gießener Soziologe und Theologe Reimer Gronemeyer befürchtet, dass alte Menschen immer stärker ins gesellschaftliche Abseits gedrängt werden. „Jungsein ist der Maßstab. Die Jungen haben die digitale Macht und die Mobilitätsvorteile“, sagte Gronemeyer dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Der Drive dieser Gesellschaft führt dazu, dass man nicht alt sein darf, dass von den Alten nichts zu erwarten ist.“
Es existiere eine „strukturelle Altersdiskriminierung“, schreibt der 85-Jährige in seinem aktuellen Buch „Die Abgelehnten“. Sie zeige sich zum Beispiel in der Benachteiligung insbesondere älterer Frauen in der Arbeitswelt - trotz Fachkräftemangels. „Sie werden rausgekickt, anstatt zu gucken: Gibt es nicht doch eine vernünftige Einbeziehung?“, so Gronemeyer.
Eine Untersuchung, die er zurzeit in der mittelhessischen Kleinstadt Laubach durchführe, zeige, wie sehr die Dörfer mittlerweile zu Schlaforten verkommen sind, ohne Kneipen, Gesangvereine, Metzger und Bäcker. Feststellbar sei eine „ungeheure Einsamkeit alter Leute“. Sie verschwänden in Heimen und auf Kreuzfahrtschiffen. „Das ist ein unglaublich armer Ersatz für ein sinnvolles Leben.“ Viele Ältere hätten das Gefühl, zu nichts mehr nütze zu sein.
In früheren Zeiten hätten die Alten Dinge gewusst, die für alle wichtig waren. Das sei vorbei und habe sich sogar ins Gegenteil verkehrt. „Das ist eine einmalige kulturelle Verarmung, und das kann nicht gutgehen.“ Denn die Fähigkeiten der Alten könnten in Zukunft noch gefragt sein, etwa im Handwerk oder im Gartenbau. In seinem Buch rät der emeritierte Soziologieprofessor dazu, die Gräben zwischen den Generationen zu überbrücken. Der Umgang zwischen Alt und Jung sei ein Gradmesser für die Humanität der Gesellschaft. „Man muss aufwachen und etwas in die Hand nehmen, Alte wie Junge“, sagte er.
Es gebe durchaus „kleine Pflänzchen, die durch den Beton wachsen“. So habe ein älterer Pfarrer in Laubach einen Treffpunkt gegründet und Leute zusammengebracht, die nun gemeinsam Hühner halten. „Solche Initiativen sind die Rettung in die Zukunft.“ Oft seien sie vom Engagement Einzelner abhängig. „Sie kosten meist nichts, aber die Profis dürfen sie nicht in die Hand bekommen.“
Es sei möglich, sich unabhängig vom Geld etwas Neues einfallen zu lassen. „Man muss die Menschen anpusten und die Glut der Empathie, die da ist, zum Brennen bringen. Eine andere Gesellschaft ist möglich. Es ist nur eine Papierwand, die uns davon trennt.“

Der Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit, verabschiedet im April 2024, bietet die Chance, einen wirklichen Beitrag zur Überwindung der Wohnungsnot und Wohnungslosigkeit in Deutschland zu leisten. Dieses Potenzial kann und sollte die neue Bundesregierung nutzen.
Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland ist sehr hoch, Tendenz steigend. Anfang 2024 lag sie bei rund 531.600 Personen. Diese Menschen leben auf der Straße, nächtigen bei Freunden oder Bekannten auf dem Sofa oder sind vorübergehend in kommunalen Notunterkünften oder Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe untergebracht. Ihnen fehlt nicht nur eine Wohnung, sie haben auch häufig Schwierigkeiten, Gesundheitsleistungen zu erhalten, und sie erfahren Gewalt und Diskriminierung. Ihre Rechte auf Wohnen, Gesundheit oder auf Schutz vor Gewalt sind massiv eingeschränkt.
Angesichts dieser Zahlen reagierte auch die Menschenrechtskommissarin des Europarates bei ihrem letzten Deutschlandbesuch: In Anbetracht des Wohlstands in Deutschland seien diese Zahlen nicht hinnehmbar, mahnte sie im März 2024.
Das Recht auf Wohnen zu gewährleisten, ist keine karitative Maßnahme, sondern Pflicht des Staates. Diese Pflicht ergibt sich aus den internationalen Menschenrechtsverträgen, etwa dem UN-Sozialpakt. Diese Verträge sind unmittelbar geltendes Recht, das sämtliche Staatsorgane bindet - auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.
Auch im Grundgesetz ist das Recht auf Wohnen verankert: Aus Art. 1 in Verbindung mit Art. 20 GG ergibt sich das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum, zu dem auch eine Unterkunft gehört. Viele Aspekte des Rechts auf Wohnen werden durch Gesetze geregelt, wie etwa Regelungen zum Kündigungsschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch, das Wohngeldgesetz oder die Sozialgesetzbücher.
Daraus folgt zwar nicht das Recht des Einzelnen auf Bereitstellung einer bestimmten Wohnung. Allerdings muss der Staat dafür sorgen, dass alle Menschen ihr Recht auf Wohnen wahrnehmen können, das heißt etwa: dass Wohnen bezahlbar bleibt, dass niemand wohnungslos wird und das wohnungslose Menschen schnellstmöglich wieder eine Wohnung finden. Dafür sollte der Staat eine Gesamtstrategie entwickeln und Regeln sowie Maßnahmen festlegen.
Auch wenn primär die Kommunen für die Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit zuständig sind. Mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) der alten Bundesregierung wurde anerkannt: Bund und Länder setzen maßgeblich die Rahmenbedingungen, unter denen die Kommunen agieren, etwa durch die Ausgestaltung der Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII, des Mietrechts oder sozialrechtlicher Ansprüche (Wohngeld, Kosten der Unterkunft) beziehungsweise durch die Wohnungs(bau)politik. Es geht also nur gemeinsam - in einem Dreiklang aus Bund, Ländern und Kommunen.
Der NAP erkennt auch an: Die Expertise der Wohnungsnotfallhilfe, Verbände, Wissenschaft und wohnungsloser Menschen ist essenziell für die Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit in Deutschland.
Neben diesem Potenzial muss aber auch gesagt sein: Der bisherige NAP hat erhebliche Schwächen. Die Maßnahmen gehen kaum über das hinaus, was sowieso in der (vergangenen) Legislatur geplant war. Sie bleiben unkonkret und sind nicht mit finanziellen Mitteln hinterlegt.
Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD lässt erkennen: Einige Aspekte von Wohnungsnot will die neue Bundesregierung angehen. Der Koalitionsvertrag nimmt auch auf die Umsetzung des NAPs Bezug. Das europaweite Ziel, Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden, fehlt jedoch, ebenso wie Maßnahmen, die konkret auf die Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit abzielen. Diese müssen bei einer Fortschreibung des Nationalen Aktionsplans nun zwingend ergänzt werden.
Der NAP bietet die Chance, alle Akteure unter einem „Dach“ zu vereinen. Die Überwindung von Wohnungslosigkeit ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Neben Maßnahmen des Wohn- beziehungsweise des Bauressorts sind auch umfassende Maßnahmen in den Bereichen Justiz, Gesundheit, Jugend oder etwa Frauen vonnöten. Der Aktionsplan bietet die Möglichkeit, in einen Dialog mit allen Beteiligten über die vereinbarten Maßnahmen, ihren Umsetzungsstand sowie Weiterentwicklung zu gehen. Und somit eine breite Akzeptanz und Identifikation bei allen Beteiligten zu erreichen.
Konkrete politische Ziele - inklusive der Überwindung von Wohnungslosigkeit bis 2030 - sollten Teil einer ambitionierten, nationalen Gesamtstrategie sein. Hier sollte die neue Bundesregierung ein deutliches Zeichen setzen. Der Aktionsplan sollte fortgeschrieben und mit konkreten, finanziell gut ausgestatteten Maßnahmen hinterlegt sein. Diese müssen auf die Vermeidung von Wohnungslosigkeit fokussieren, etwa die Ausweitung der Schonfristregelung auf die ordentliche Kündigung oder die Anschubfinanzierung von kommunalen Fachstellen.
Und: Bund und Länder sollten die Schaffung von sozialem Wohnraum wesentlich stärker als bisher in den Fokus nehmen. Zwingend braucht es eine Verbesserung der Situation für die über 531.600 wohnungslosen Menschen in Deutschland, etwa indem verbindliche Standards für die Notunterbringung festgelegt werden, der Zugang zu Hilfsangeboten vereinfacht wird und Belegrechte sicherstellen, dass wohnungslose Menschen auch tatsächlichen Zugang zu freien Wohnungen haben.
Entsprechende Vorschläge des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der Wohnungslosenhilfe, von Betroffenen und Verbänden hierzu liegen seit langem vor. Auch staatliche Akteure - etwa die kommunalen Spitzenverbände, einzelne Bundesländer und Bundesressorts - haben Maßnahmen vorgeschlagen. Jetzt braucht es den politischen Willen, diese gemeinsam und ambitioniert umzusetzen.

Würzburg (epd). 550.000 Menschen waren in Deutschland im Jahr 2024 von Wohnungslosigkeit betroffen, so der Wohnungslosenbericht des Bundesministeriums für Wohnen. In Bayern waren 2024 etwa 40.000 Personen in Einrichtungen der Kommunen und der Freien Wohlfahrtspflege untergebracht, 20 Prozent mehr als im Vorjahr, sagt die Diakonie. Eine Möglichkeit, Menschen wieder zur eigenen Wohnungen zu verhelfen, könnte das Konzept Housing First sein. Der Bundesverband Housing First trifft sich zu einem Fachtag am 23. April in Würzburg. Der Evangelische Pressedienst (epd) sprach mit dem Vorsitzenden Kai Hauprich über die Chancen und Grenzen von Housing First. Die Fragen stellte Jutta Olschewski.
epd sozial: Das Konzept Housing First gegen Obdachlosigkeit gibt es bereits seit 30 Jahren. Ein griechisch-kanadischer Psychologe brachte den Gedanken auf: Obdachlose Menschen sollen den Schlüssel für eine Wohnung erhalten, erst einmal zur Ruhe kommen und dann - auch mit sozialpädagogischer Hilfe - wieder Tritt fassen. Hat diese Idee in einer Leistungsgesellschaft wirklich eine Chance?
Kai Hauprich: Wenn wir daran nicht glauben würden, täten wir diese Arbeit nicht. Was unsere Gesellschaft wirklich auszeichnet, ist doch die garantierte Menschenwürde. Es kommt darauf an, dass die Menschen ihr Existenzminimum und vor allem die Selbstbestimmung über ihr Leben zurückbekommen.
epd: Ist das Konzept Housing First die Lösung aller Probleme auf dem Gebiet der Obdachlosigkeit, weil es den Teufelskreis durchbricht: ohne Wohnung keine Rückkehr in die Gesellschaft?
Hauprich: Das Allheilmittel gegen Wohnungslosigkeit ist der soziale Wohnungsbau. Housing First muss seinen Platz in der Hilfelandschaft haben, indem es Leuten mit komplexen Problemlagen, für die wir sonst keine Mittel mehr gefunden haben, hilft, selbstbestimmt zu leben. Das Mittel ist klug, menschenfreundlich und kosteneffizient und stellt die grundlegende Frage, wie unser Hilfesystem funktioniert.
epd: Wie findet man Vermieter, die bei dem Konzept mitmachen?
Hauprich: Das erste Argument ist, der Vermieter erhält eine sichere Miete direkt vom Amt. Ein Risiko gehen ja Vermieter immer ein. Wir müssen ihnen die Ängste vor menschlichen Problemen nehmen, die sie nicht einschätzen können, wenn sie mit Leuten unter einem Dach wohnen, die draußen gelebt haben oder beispielsweise suchtkrank sind. Dann stellen sie fest, dass da ein normaler Mensch lebt, der ihre DHL-Pakete annimmt und nicht in den Hauseingang uriniert. Solche bürgerlichen Ängste gab es. Anfangs wurden wir ausgelacht, wir würden niemals Wohnungen finden, aber inzwischen haben die 40 bis 50 Housing-Projekte in ganz Deutschland 500 Menschen aus der chronischen Obdachlosigkeit vermittelt. Wir haben 500 Mal vorgemacht, dass das geht und werden inzwischen von Privatpersonen und Genossenschaften wegen einer Zusammenarbeit angesprochen.
epd: Welche Veränderungen gehen in den Menschen vor, die im Rahmen von Housing First eine Wohnung erhalten?
Hauprich: Solange Menschen obdachlos sind, suchen sie nach einem Schlafplatz und müssen sich um ihr Überleben kümmern und haben nicht die Ruhe, darüber nachzudenken, was mit ihrem Leben passiert. Wenn sie eine eigene Wohnung haben, beginnt erstmal eine innere Einkehr. Manche denken dann, sie würden gerne ihre Familie wieder sehen oder sie möchten arbeiten gehen. Jeder ist da anders. Über meinem Schreibtisch hängt der Satz von Eugen Roth: „Menschen wirken wie verwandelt, wenn man sie als Mensch behandelt.“ Wir erleben, ihr Wesenskern kommt zum Tragen und Glänzen.
epd: Teilhabe geht nicht ohne Geld. Man kann nicht ins Theater gehen, anderen keine Geburtstagsgeschenke kaufen. Also mit einer Wohnung allein ist es nicht getan, oder?
Hauprich: Das ist das echte Defizit von Housing First: Es macht nicht reich, gesund und glücklich. Das eigentliche Problem der wirtschaftlichen Armut löst es nicht mit Feenstaub. Die Menschen müssen ihre Probleme angehen, Geld beim Jobcenter beantragen, Möbel anschaffen, um jemanden einzuladen, den Kühlschrank füllen. Aber es ist auch ein strukturelles Problem, wie Menschen aus der wirtschaftlichen Armut herauskommen und Teilhabe erreichen.
epd: Es gibt in Deutschland derzeit geschätzt zwei Millionen leer stehende Wohnungen, Ferienwohnungen, Zweitwohnungen und unvermietbare Luxuswohnungen. Wie kommen wir dahin, dass bezahlbarer Wohnraum eine gemeinschaftliche Aufgabe ist und kein Spekulationsobjekt mehr?
Hauprich: Rufen Sie mich noch einmal an, wenn Sie darauf eine Antwort wissen. Wir sehen Angebote für 40-Quadratmeter-Wohnungen in Düsseldorf für 1.500 Euro kalt, und vor solchen hochpreisigen Wohnungen schläft vielleicht ein Mensch und friert. Die großen Fehler sind in den 1990er Jahren gemacht worden, als man begann, den sozialen Wohnungsbau sukzessiv auslaufen zu lassen und man die Wohnung nicht mehr als Daseinsvorsorge betrachtet hat. Auf politischer Seite hat man zugelassen, dass Wohnen zum Spekulationsobjekt wurde. Es gibt auf das Problem keine schnelle Antwort, aber wir müssen den sozialen Wohnungsbau reaktivieren. Ein Grundbedürfnis des Lebens darf man nicht dem Markt überlassen.
epd: Und wie finden Sie auch unter diesen Gesichtspunkten, was die künftige Regierungskoalition zum Thema Wohnen in den Koalitionsvertrag geschrieben hat?
Hauprich: Wohnungs- und Obdachlosigkeit kommen im Koalitionsvertrag leider nur in einem einzigen Absatz vor. Das ist gemessen an der gesellschaftlichen Tragweite des Themas deutlich zu wenig. Gerade in einem der reichsten Länder der Welt ist Obdachlosigkeit keine Notwendigkeit, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen. Es braucht endlich eine klare Kehrtwende in der Wohnungs- und Sozialpolitik. Denn Kürzungen im sozialen Bereich haben ein enormes Spaltungspotenzial - sie treffen die Schwächsten und gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir erwarten, dass der politische Wille nun ernsthaft in die Umsetzung geht und auch, dass Housing First flächendeckend als Leitprinzip etabliert wird.
Berlin (epd). Im Berliner Stadtteil Neukölln und in Hamburg-Veddel werden im Zuge eines Modellprojekts die Effekte einer interprofessionellen Primärversorgung getestet. Die Initiative „Navigation“ soll sich um die Gesundheit der Schwächsten kümmern, heißt es in einer Mitteilung der AOK Nordost. Navigation steht für „Nachhaltig versorgt im gemeindenahen Gesundheitszentrum - Gesundheit im Zentrum.“
In der Poliklinik Hamburg-Veddel wird das Modell zur gerechteren ambulanten Versorgung ebenfalls getestet. Die hausärztliche Versorgung in der Poliklinik werde durch pflegerische, soziale und psychologische Leistungen ergänzt und trage damit den unterschiedlichen Bedürfnissen einer diversen Gesellschaft stärker Rechnung, hieß es.
Zum Hintergrund des neuen Ansatzes heißt es, viele Gesundheits- und Vorsorgeangebote kämen oft nicht dort an, wo sie am dringendsten benötigt würden: bei den besonders vulnerablen Gruppen. Das solle nun im Testlauf durch die AOK und das Gesundheitszentrum geändert werden, hieß es.
Anfang April wurden den Angaben nach die ersten Patientinnen und Patienten in das Projekt eingeschrieben. Navigation setzt dabei auf die Primärversorgung durch ein interprofessionelles Team. Zu den besonders vulnerablen Gruppen zählen Menschen, bei denen körperliche und psychische Beschwerden mit schwierigen sozialen Umständen einhergehen. Ein Teil von ihnen verfügt oft nur über eine geringe Gesundheitskompetenz.
Im Rollbergkiez in Neukölln, wo das GeKo - Stadtteilzentrum Neukölln seinen Standort hat, leben viele solcher Menschen. Mehr als die Hälfte der Bewohner im Kiez sind bei der AOK Nordost versichert. Ein größerer Teil von ihnen ist entweder pflegebedürftig oder sozial benachteiligt oder beides. Zudem leiden überdurchschnittlich viele bei der AOK Nordost versicherte Rollbergkiez-Bewohner an chronischen Erkrankungen wie Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen, Atemwegserkrankungen und Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems.
„Gerade diese Menschen erreichen wir im Moment noch besonders schwer“, sagt Daniela Teichert, Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost. „Wir können gute Gesundheits- und Vorsorgeangebote machen, aber die Menschen müssen sie auch aktiv in Anspruch nehmen. Sie müssen anrufen, Termine vereinbaren, hingehen. Und das ist für viele schon die erste Hürde.“
Teichert sieht deshalb einen wichtigen Hebel in einem aufsuchenden Ansatz, der bei der neuen Initiative eine zentrale Rolle spiele. Speziell ausgebildete Pflegefachkräfte, sogenannte Community Health Nurses, sind in dem Projekt nicht nur Teil des interprofessionellen Teams: Sie haben die klinische Leitung und zentrale Steuerungsfunktion. „Darin unterscheidet sich das Projekt von anderen Primärversorgungsansätzen, wo diese Rolle beispielsweise von Hausärztinnen und -ärzten übernommen wird“, sagte Teichert.
„Gerade in einem Viertel wie dem Rollbergkiez mit seiner speziellen Bewohnerstruktur benötigen wir die Art der interprofessionellen Primärversorgung, die das GeKo-Stadtteilzentrum Neukölln mit den Community Health Nurses verfolgt“, betone die Kassenchefin. Sie suchten die Menschen in deren Lebensumfeld auf - ob zu Hause oder in den Straßen ihres Kiezes.
Kombiniert werde das mit einer hausärztlichen und psychologischen Versorgung sowie der Beratung durch Sozialarbeiterinnen und -arbeiter. Dadurch werde die individuelle Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten wird durchgehend berücksichtigt und gestärkt. Und: Durch den barrierefreien Zugang zu Versorgungsleistungen, sei es durch Unterstützung bei bürokratischen Hürden, Sprachmittlung oder Hausbesuchen, „wird eine breitere Patientengruppe erreicht, deren Versorgung bislang nicht ausreichend sichergestellt ist“.
Berlin (epd). Die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Beate von Miquel, erwartet von der schwarz-roten Koalition Fortschritte bei der Gleichstellung von Frauen. „Es gibt tatsächlich positive Überraschungen im Koalitionsvertrag“, sagte von Miquel dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Aus der Präambel lese ich, dass die neue Koalition dem Thema Gleichstellung ein sehr großes Gewicht beimisst“, sagte die Vorsitzende des Dachverbands deutscher Frauenorganisationen.
In der Präambel des am 9. April von CDU, CSU und SPD vorgestellten Koalitionsvertrags heißt es: „Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft und deren Durchsetzung ist zentrales Anliegen unserer gesamten Regierungsarbeit.“ Von Miquel sagte, Papier sei allerdings auch geduldig. Mit einer Gleichstellungsstrategie dürfe nicht bis zum Ende der Wahlperiode gewartet werden. „Die sollte man im nächsten halben Jahr fertig haben“, sagte die Geschäftsführerin des interdisziplinären Marie Jahoda Center for International Gender Studies an der Ruhr Universität Bochum.
Die Verbandsvorsitzende betonte, essenziell seien Fortschritte bei der ökonomischen Gleichstellung von Frauen. „Man muss dabei vom Ende her denken“, sagte von Miquel. Es gebe eine sehr hohe Altersarmut von Frauen. Die schwarz-rote Koalition wolle nun die Mütterrente erhöhen. Das sei „sicherlich eine Entlastung für die betreffenden Frauen, aber keine Lösung des strukturellen Problems, dass noch immer vor allem Frauen die Sorgearbeit in den Familien zu Lasten ihrer Erwerbstätigkeit schultern“.
Um Altersarmut zu mindern, müssten die Teilzeitquote bei Frauen minimiert werden und Männer mehr Arbeit in den Familien übernehmen, sagte sie. Zudem brauche es Veränderungen bei Minijobs und Ehegattensplitting. „An dies beides will die Koalition nicht ran“, beklagte von Miquel.
Kritisch sieht die evangelische Theologin und Historikerin auch, dass die schwarz-rote Koalition die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen laut Koalitionsvertrag nicht angehen will. „Sie will die Versorgungslage verbessern, mir ist aber nicht klar, wie das ohne eine Reform des Paragrafen 218 gelingen soll“, sagte sie. Als „echte Katastrophe“ bezeichnete sie aus frauenpolitischer Sicht die geplante Aussetzung des Familiennachzugs bei Flüchtlingen mit subsidiärem Schutz. „Das bedeutet, dass für Frauen Fluchtrouten deutlich gefährlicher werden“, sagte sie.
Der Frauenrat erwartet nach ihren Worten, dass das künftige Bundeskabinett zur Hälfte mit Frauen besetzt sein wird. „Das ist ein gar nicht zu unterschätzendes Signal an die Frauen, also die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland“, sagte sie. Parität in entscheidenden Gremien „ist deutlich mehr als ein Symbol“, sagte sie.
Berlin (epd). Evangelische Träger der Sozialbranche blicken mit gemischten Gefühlen auf den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Der Vertrag enthalte „Licht und Schatten“, teilten der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP), der Evangelische Bundesfachverband für Teilhabe (BeB) sowie der Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) am 15. April in Berlin mit.
Die Verbände begrüßten einerseits die angestrebten Vereinfachungen bei der Fachkräfteeinwanderung und den angestrebten Bürokratieabbau, beklagten aber insbesondere bei der Pflege einen „mangelnden Reformeifer“. Wilfried Wesemann, Vorsitzender des DEVAP, sagte, der Koalitionsvertrag bleibe „für die professionelle Langzeitpflege weit hinter den Erwartungen und auch Ergebnissen der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege zurück“. Obwohl schon lange kein Erkenntnisproblem bestehe, würden nun wieder Kommissionen gebildet und dringend notwendige Reformen verschoben.
„Die Stärkung der pflegenden An- und Zugehörigen begrüßen wir sehr“, sagte Wesemann. Jedoch müssten die Versorgungssicherheit, die Strukturen der professionellen Pflege und die wirtschaftliche Schieflage von Trägern gleichermaßen in den Blick genommen werden.
Christian Geyer, stellvertretender BeB-Vorstandsvorsitzender, hob indessen hervor, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden habe, ebenso Pläne, damit Arbeitgeber mehr Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einstellen. Nun müsse der im Koalitionsvertrag erwähnte Bürokratieabbau in der Eingliederungshilfe umgesetzt werden.
Ingo Habenicht, VdDD-Vorstandsvorsitzender, nannte die geplante digitale Plattform, in der die Vorgänge für die Erwerbsmigration gebündelt und beschleunigt werden sollen, vielversprechend. „Allerdings bleibt abzuwarten, inwiefern diese Vorhaben tatsächlich zeitnah mit den Ländern umsetzbar sind“, sagte Habenicht. Bei zentralen Baustellen wie Rente und Pflege verlagere die künftige Koalition die Lösungsfindung jedoch auf Kommissionen.

Würzburg, Paderborn (epd). Sie haben ihre eigene Sprache, in der es auf jedes Wort ankommt. Sie haben ihre eigenen Regeln, ihre eigene Kultur. Jugendliche Fußballfans leben in einer besonderen Welt. „Die ist bunt und cool“, sagt Jonathan Freudenberger. Aber sie ist zugleich gefährlich. Teenager, die sich voll und ganz dem Fußball verschrieben haben, vor Gefahren zu bewahren und ihnen in brenzligen Situationen beizustehen, das ist der Job des Fansozialarbeiters von der Evangelischen Kinder- und Jugendhilfe in Würzburg. Freudenberger hat zusammen mit seinem Kollegen Johannes Bork Kontakt zu schätzungsweise 300 Fußballfans zwischen 12 und 27 Jahren.
Fansozialarbeit ist ein vergleichsweise unbekanntes Feld. Und dass in diesem Metier auch Diakonie und Caritas aktiv sind, dürfte manchen zusätzlich überraschen. Ein Angebot der Caritas ist das Fanprojekt Paderborn, eine sozialpädagogische Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Sie wurde im Herbst 2012 ins Leben gerufen und wird getragen vom Caritasverband Paderborn.
Die Zielgruppe bilden Fußballfans im Alter von 12 bis 27 Jahren, aber auch für Menschen anderen Alters bietet man sich als Ansprechpartner an. „Mit unseren Angeboten unterstützen wir Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, fördern ihr Engagement und stehen ihnen in allen Lebenslagen zur Seite. Natürlich auch bei Themen ohne Fußballbezug“, ist auf der Homepage zu lesen. Es gibt zahlreiche Aktivitäten, von Hobbyturnieren über die Hausaufgabenhilfe bis zu kulturellen Angeboten. Und: „Darüber hinaus fungieren wir als Vermittlungsinstanz und vertreten die Interessen der Fans in unterschiedlichen Netzwerken.“
Wie wichtig Fansozialarbeit im Einzelfall ist, zeigt Caritasmitarbeiter Marvin Schuck am Beispiel eines jungen Manns auf, der es jüngst während eines Fußballspiels mit der Polizei zu tun bekam. Mehrere Polizisten holten ihn aus dem Stadion und nahmen seine Personalien auf. Ihm wurde Sachbeschädigung vorgeworfen. Schuck: „So etwas hatte er noch nie zuvor erlebt.“ Allein die Übermacht der Polizei verwirrte ihn: Vier Beamte standen dicht um ihn herum, weitere in nur geringer Entfernung. Schuck vermittelte. Noch Tage später habe sich der Jugendliche gefragt, wie es nun weitergehe und mit welchen Folgen er zu rechnen habe.
In der Öffentlichkeit sind Fansozialarbeiter kaum präsent. Sie sprechen nicht gerne über das, was sie tun. Nicht, weil sie ihren Job nicht lieben würden. Sondern sie wissen: Würden sie etwas publik machen, was den Fans nicht gefällt, wären die sofort weg. Dann wäre jahrelange Beziehungsarbeit zerstört. Fußballfans, vor allem die „Ultras“, seien eine heikle Klientel. Manchmal, sagt Freudenberger, werde schon ein versehentlich falsch verwendetes Wort als Vertrauensbruch gewertet.
Fansozialarbeit ist vor allem deshalb fordernd, weil der Anspruch darin besteht, wirklich jedes Spiel zu begleiten. Sowohl daheim als auch auswärts. Die Auswärtsfahrten, die für minderjährige Fans organisiert werden, sind von besonderer Bedeutung. „Gerade hier kann Beziehungsarbeit geleistet werden“, sagt Bork.
Auf das letzte Fußballmatch blickt er gelassen zurück. Alles blieb friedlich. Aufregung gab es jedoch unlängst bei einem Auswärtsspiel. Der "Vorsänger” der Würzburger Ultras, also derjenige, der die Kurve dirigiert, wurde während des Anpfiffs vom Zaun geholt. Zäune zu besteigen, war in diesem Stadion verboten. Polizisten bugsierten den jungen Mann fort, um seine Personalien festzustellen. Das sorgte im Block für Unmut. Den Fansozialarbeitern gelang es, zu deeskalieren: 200 Fans beschlossen, statt ihrem Unmut freien Lauf zu lassen, zu gehen. Nur zehn minderjährige Fans blieben, begleitet von den Sozialarbeitern, zurück.
Die meisten Fanprojekte haben auch offene Angebote. In Würzburg befindet sich ein Fantreff im Jugendzentrum des Stadtteils Heidingsfeld. Im kleinen Hof nebenan kann eine Wand besprüht werden. Auch Graffiti gehören zur Jugendfankultur. Überhaupt sind Fußballfans kreativ. Sie gestalten Sticker, kreieren Fahnen und Spruchbänder oder üben Choreografien ein. Ein Problem kann, muss aber nicht sein, dass sich das ganze Leben um den Fußball dreht. Viele haben außerhalb der Fanszene keine Freunde. Und: Manchmal wird über dem Sport die Schule vernachlässigt.
Auch besteht die Gefahr, in Abhängigkeit zu geraten. Fußball und Alkohol, aber auch Fußball und Drogen sind miteinander verschwistert. Glücksspiele, so Bork, stellen ebenfalls eine Gefahr dar: Leicht ist ein Fan versucht, einen Teil der hohen Kosten, die sein Lieblingssport verschlingt, über Wetten hereinzuholen. Und: Aggressivität schwebt als weiteres Damoklesschwert über aktiven Fans.
Geldsorgen machen vielen Fanprojekten zu schaffen. Die Finanzierung steht prinzipiell auf drei Säulen: Die Hälfte der Kosten kommt von den Fußballverbänden DFB und DFL, jeweils 25 Prozent tragen Kommunen und Bundesland. Der Zuschuss durch die Fußballverbände ist jedoch auf 150.000 Euro im Jahr gedeckelt. Diese Summe wurde, unter anderem durch Tariferhöhungen, in Paderborn nun erreicht. Die Projektarbeit ist weitgehend ausgebremst. In Würzburg, wo sich Stadt und Landkreis die kommunalen Kosten teilen, stieg der Landkreis aus der Förderung aus. Das Fanprojekt hofft nun, dass die Stadt Würzburg in die Bresche springen wird.

Frankfurt a.M. (epd). DHV-Präsidiumsmitglied Ursula Jahn-Zöhrend findet klare Worte: „Die rund 22.000 Mitglieder des DHV sichern die Hebammenversorgung in Deutschland. Es ist desaströs, dass wir als größter Berufsverband in der Schiedsstelle mit unseren Forderungen unterlagen.“ Sie beklagt, dass im Schiedsspruch „partikulare Interessen von Teilen der Hebammen“ fixiert wurden. Die gesamte Berufsgruppe sei nicht gebührend in diesem Vertrag berücksichtigt worden. Die Fragen stellte Dirk Baas.
epd sozial: Frau Jahn-Zöhrens, Schiedssprüche haben selten einen guten Ruf, sie werden oft als schlechte Kompromisse gesehen. Auch Ihr Verband rügt das Resultat in scharfen Worten, vor allem mit Blick auf die Beleghebammen. Warum sind Sie mit dem Schiedsspruch nicht einverstanden?
Ursula Jahn-Zöhrens: Der Beschluss der Schiedsstelle vom 2. April birgt einige Nachteile. Das gilt, wie Sie ansprechen, vor allem für die Beleghebammen, die in rund einem Viertel aller Geburten die Gebärende begleiten. Diese werden mit dem neuen Vertrag finanziell schlechter gestellt, trotz der großen Verantwortung, die sie für die flächendeckende Geburtshilfe in Deutschland tragen. Das liegt unter anderem daran, dass nicht in Betracht gezogen wird, dass ein Kreißsaal niedrige und hohe Auslastungen abdecken muss und auch immer die erste Anlaufstelle für Schwangere mit Beschwerden oder Risiken ist. Diese oft beratungsaufwendigen Tätigkeiten werden im nun festgesetzten Vertrag nicht berücksichtigt. Auch die Stundenvergütung für Hebammen in der aufsuchende Wochenbettbegleitung ist hinter unserer Erwartung zurückgeblieben.
epd: Der DHV ist im Sommer vergangenen Jahres aus dem Verhandlungsprozess ausgestiegen? War das im Rückblick nicht doch ein Fehler?
Jahn-Zöhrens: Nein, im Gegenteil. Wir haben uns über Wochen an den Themen zum Belegsystem und zur Vergütungshöhe mit dem Spitzenverband der Krankenkassen (GKV-SV) abgearbeitet. Beide Bereiche wurden mehr oder weniger von den Kassen mit dem Stand August 2024 der Schiedsstelle vorgelegt und nun auch so abgestimmt. Wären alle Vertragspartner ehrlich gewesen, hätte die Schiedsstelle bereits im Herbst 2024 entscheiden können.
epd: Musste jetzt nicht eine, wenn auch nicht optimale, Entscheidung her, sonst wären vier Jahre Verhandlung umsonst gewesen und die Probleme weiter ungelöst?
Jahn-Zöhrens: Die vielen Monate der Verhandlungen haben mehrere Gründe. Im neuen Vertrag wurde ein Paradigmenwechsel weg von Pauschalvergütungen hin zu einer Vergütung nach tatsächlichem Zeitaufwand umgesetzt. Diesen Paradigmenwechsel umzusetzen, hat einen hohen Zeitaufwand erfordert. Zudem kam ein neuer Verein als Vertragspartner ins Spiel. Der GKV-Spitzenverband hat sich damit vorrangig mit zwei deutlich kleineren Institutionen auseinandergesetzt, die partikulare Interessen von Teilen der Hebammen vertreten, während die Interessen der 22.000 Hebammen aus allen Berufsfeldern, die wir vertreten, in den Hintergrund gedrängt wurden. Hätte es diese Vermengung von berufspolitischen Themen mit den Vergütungsverhandlungen nicht gegeben, hätte dieser Vertrag schon vor zwei Jahren geschlossen werden können.
epd: Können Sie zur Klarstellung die Arbeit und Einsatzgebiete der Beleghebammen kurz beschreiben, damit man versteht, was sie von anderen Hebammen unterscheidet?
Jahn-Zöhrens: Beleghebammen sind freiberufliche Hebammen, die die Geburtshilfe in einer Klinik sicherstellen. Dazu schließen sie einen Vertrag mit dem Klinikträger, organisieren ihre Anwesenheits- und Bereitschaftszeiten selbst und rechnen die erbrachten Leistungen direkt mit den Krankenkassen ab. Neben der Begleitung der tatsächlichen Geburt kümmern sie sich auch um die Diagnostik und Überwachung von Risikoschwangeren im Kreißsaal. Geburten und Risiken sind unplanbar. Vorhaltekosten sind aber in diesem System nicht vorgesehen.
epd: Offenbar halten sie das Schiedsverfahren für fragwürdig, denn in einer Presseinformation von Ihnen heißt es: „Die rund 22.000 Mitglieder des DHV sichern die Hebammenversorgung in Deutschland. Es ist desaströs, dass wir als größter Berufsverband in der Schiedsstelle mit unseren Forderungen unterlagen.“
Jahn-Zöhrens: Ja, es ist dem GKV-Spitzenverband gelungen, mit dem kleinen Hebammenberufsverband BfHD und der Interessenvertretung der Träger von Geburtshäusern, Netzwerk der Geburtshäuser, also zwei kleinen Verbänden, deren Vertretung sich nur auf einen Teilbereich der Hebammenarbeit fokussiert, wortgleiche Anträge in die Schiedsstelle einzureichen und durch eine Klausel keine Änderungen in diesem Antrag zuzulassen. Damit war klar, dass die gesamte Berufsgruppe nicht gebührend in diesem Vertrag berücksichtigt werden konnte. Damit wurde die Aufgabe einer Schiedsstelle, einen Ausgleich zwischen den Bedarfen der Parteien zu finden, ad absurdum geführt.
epd: Der von Ihnen genannte Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands kommt zu einer völlig anderen Bewertung des Schiedsspruches. Er spricht von einem Durchbruch bei der Hebammenvergütung. Ist da nicht doch etwas dran?
Jahn-Zöhrens: Der BfHD sieht alleine seine Klientel, die Hausgeburts- und Geburtshaushebammen, die auch mehrheitlich vom DHV vertreten werden, wenn er diese Aussage trifft. Noch vor dem Austritt des DHV aus den Verhandlungen haben beide Verbände zusammen die Forderung aufgestellt, dass deren Geburtshilfe zwingend als Pauschale honoriert werden muss. Diese Forderung wurde zwischendurch vom GKV-Spitzenverband in Frage gestellt. Nun blieb es bei den Pauschalen und damit ist der BfHD in seiner Hauptforderung befriedigt und kann dies auch so erklären. Damit verschweigt er jedoch, das andere Bereiche der Hebammenarbeit das Nachsehen haben. Wir als Verband setzten uns seit jeher dafür ein, dass alle Tätigkeitsfelder einer Hebamme so gut vergütet werden müssen, dass ihre wirtschaftlichen Interessen ausreichend berücksichtigt sind.
epd: Für Außenstehende liest sich die BfHD-Aussage doch vernünftig: „Mit dieser Entscheidung gelingt nun endlich der von allen Verbänden lange angestrebte Systemwechsel, weg von den pauschalen Vergütungen hin zu einem zukunftsfähigen und modernen Vergütungssystem, das auf Stundenvergütung basiert und die wirtschaftlichen Interessen aller freiberuflich tätigen Hebammen berücksichtigt.“ Zumindest für diese Berufsgruppe, oder?
Jahn-Zöhrens: Ja, der Systemwechsel ist vollzogen. Der war jedoch bereits vor der der Entscheidung der Schiedsstelle fixiert und wurde von uns maßgeblich mit ausgearbeitet. Aber es wurden eben ausdrücklich nicht die wirtschaftlichen Interessen aller freiberuflich tätigen Hebammen berücksichtigt.
epd: Kommen wir noch einmal zu den klinisch tätigen Hebammen zurück. Dort gibt es mit dem sogenannten 1:1-Zuschlag doch mehr Geld. Warum droht dann womöglich doch ein Einkommensverlust? Und wie hätte Ihre Alternative ausgesehen?
Jahn-Zöhrens: Die erste Leistung einer Beleghebamme in der Klinik erhält ab sofort nur 80 Prozent der Stundenvergütung gegenüber den anderen Leistungsbereichen. Und wenn sie zwei Gebärende begleitet, erhält sie für die zweite betreute Gebärende nur 30 Prozent als Honorar. Auf der anderen Seite trägt sie die volle Verantwortung und Haftung für beide Versicherte. Sie muss sich ständig fragen: Wer braucht mich dringender? Dieser Aspekt wird nicht berücksichtigt, sondern er wird negiert. Es ist für uns nicht einsichtig, warum eine Beleghebamme im Vergleich zu den anderen Berufsfeldern einen verringerten Stundensatz erhalten soll.
epd: Wo liegen die Probleme?
Jahn-Zöhrens: Die Geburtshilfe ist nicht planbar, es ist also schwierig, immer zu wissen, wie viele Hebammen sich im Kreißsaal aufhalten müssen, um immer eine 1:1-Betreuung zu gewährleisten. Erstens gibt es noch nicht genügend Fachkräfte, zweitens gibt es kein „Wartegeld“ für die Hebammen, die gerade nicht gebraucht werden. Hebammen stellen ihre Arbeitskraft der Klinik zur Verfügung, werden aber nicht dafür bezahlt. Also wird es immer vorkommen, dass eine Hebamme die Verantwortung für mehrere Versicherte tragen muss, weil eine weitere Kollegin erst aus der Bereitschaft geholt werden muss, oder es gar keine weitere Hebamme im Team gibt. Wir werfen dem GKV-Spitzenverband vor, hier etwas durchzusetzen, was er im klinischen Bereich mit angestellten Hebammen noch nie gefordert hat.
epd: Die Geburtenzahlen sinken, immer mehr Geburtshilfestationen in Kliniken schließen. Bietet hier der beschriebene Systemwechsel hin zu sogenannten Hebammenambulanzen eine brauchbare Lösung an?
Jahn-Zöhrens: Die Hebammenambulanz gibt es schon heute. Hebammensprechstunden an Kliniken werden seit 2012 gefordert. Das Kliniksterben verschärft zum einen die Raumnot in den verbleibenden Einrichtungen, außerdem werden Wege für Schwangere immer länger, was eine große Verunsicherung bei den betroffenen Familien auslöst. Verlegungen aus Geburtsklinken ohne Risikoversorgung, hin in die Maximalversorger, werden schwieriger. Haus- und Geburtshaushebammen können diese Lücken nur teilweise ausgleichen, denn auch sie müssen die Überleitungswege berücksichtigen. Das heißt, die Versorgung in der Fläche durch Hebammen ist herausgefordert. Die Klinikstandorte aber müssen immer mehr Schwangere mit weiteren Anfahrtswegen „hüten“. Hebammenambulanzen können als Anlaufstelle zur Entlastung im System beitragen. Sie sind aber nicht die Antwort, wenn es darum geht, ein flächendeckendes und hochwertiges Netz für die Betreuung unter der Geburt sicherzustellen.

Hannover (epd). Die Frau mit den rotblonden Haaren möchte ihre Geschichte erzählen. Von den Zweifeln und Ängsten, die sie damals empfand, als sie das erste Mal schwanger wurde. „Ich wollte ein Kind, aber in meiner Partnerschaft lief es nicht gut, ich war depressiv, hatte Panikattacken und war unsicher, ob ich meinem Kind eine gute Mutter sein kann“, sagt Manuela Berger (Name geändert).
Irgendwann sei ihr klar geworden, dass sie mit ihrer Überforderung und ihren Sorgen alleine nicht fertig wird. „Das private Umfeld ist in solchen Situationen nicht hilfreich, ich wusste, ich brauche professionellen Rat.“ Kurze Zeit später saß Berger Christiane Joachim gegenüber und erzählte von ihren Problemen. Joachim leitet die Schwangerschaftskonfliktberatung des Beratungs- und Therapiezentrums (BTZ) in Hannover.
Der Schritt, den die heute 44-Jährige ging, ist für viele Frauen nicht selbstverständlich. „Frauenthemen laufen auch heute noch oft unter dem Radar“, sagt Joachim. Zwar zeige die jüngere Generation etwas mehr Selbstfürsorge, doch insgesamt laute das Motto bei Schwangerschaft und Geburt noch immer: Stell Dich nicht an, das wird schon, beiß' die Zähne zusammen. Das bestätigt auch Karin Aumann vom Evangelischen Beratungszentrum des Diakonischen Werks Hannover. „Schwangere, die unsicher sind und Probleme haben, machen das oft mit sich selbst aus oder weihen höchstens eine Freundin ein.“
Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, erhalten bei Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungen psychosoziale Beratung, unter anderem um die Bescheinigung für einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches ist dieser in Deutschland rechtswidrig, bleibt jedoch straffrei, wenn er nach einer Beratung in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen vorgenommen wird.
Über den Vorstoß der Ampel-Koalition, Schwangerschaftsabbrüche in der frühen Phase zu legalisieren, wurde in der vergangenen Wahlperiode nicht mehr abgestimmt. Ob der Abtreibungsparagraf unter der neuen Bundesregierung liberalisiert wird, gilt als fraglich.
Joachim und Aumann sehen die Pflichtberatung von schwangeren Frauen kritisch. Eine Pflicht bewirkt den Beraterinnen zufolge, dass Frauen denken, sie müssten Argumente liefern, um den Schein für einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. „Frauen bekommen den Schein aber auf jeden Fall, wenn sie das wünschen“, sagt Joachim. Lieber wäre es ihnen, wenn die Frauen freiwillig kämen - mit all ihren Anliegen, nicht nur, wenn es um einen Abbruch geht.
Ein Blick in die Statistik bestätigt, dass das von glücklichen Eltern und strahlenden Babys geprägte Bild von Schwangerschaft und Geburt nur eine Seite zeigt. Die andere ist unter Umständen mit viel Leid verbunden. Das Risiko einer Fehlgeburt beträgt dem Universitätsklinikum Heidelberg zufolge 15 bis 30 Prozent pro Schwangerschaft. Im Jahr 2021 wurden laut Statistischem Bundesamt bundesweit 3.420 Kinder tot geboren, das entspricht 4,3 Totgeburten je 1.000 Geborenen.
„Viele Frauen, die uns aufsuchen, haben eine Fehl- oder Totgeburt erlitten“, sagt Aumann. Die psychischen Auswirkungen, die Verunsicherung und die Trauer seien groß, die Folgen könnten etwa Angststörungen und Depressionen sein. „Gesellschaftlich wird das zu wenig wahrgenommen.“
Manuela Berger erlitt in der elften Woche eine Fehlgeburt. „Ich hatte mich gerade innerlich auf das Kind eingestellt und mich gefreut, die Nachricht hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen.“ Einen Monat habe sie auf ihren Ausschabungstermin warten müssen - eine enorme Belastung.
Halt fand sie wieder bei Christiane Joachim. „Sie hat mich bestärkt, meine Trauer zuzulassen, mir Zeit zu lassen“, sagt Berger. Familie und Freunde hätten es zwar auch gut gemeint. „Aber sie haben zu früh signalisiert, ich solle einen Haken hinter die Fehlgeburt machen, das Leben ginge schließlich weiter - solche Sätze nützen einem gar nichts.“ Im November 2023 brachte Berger schließlich ihre Tochter Sophia zur Welt.
Mainz (epd). Im Kopf, am Herz oder gar in der Luft neben dem Körper: Die Zehntklässler der Mainzer Integrierten Gesamtschule Auguste Cornelius sind sich nicht ganz sicher, wo genau sich eigentlich die menschliche Seele befindet. Wenn Leonie Schweigert eine Schulklasse besucht, hängt sie erst einmal ein großes Blatt Papier mit dem Umriss einer menschlichen Figur auf und bittet darum, die richtige Stelle mit einem roten Punkt zu markieren. Die Frage ist ein Einstieg bei den Projekttagen über psychische Erkrankungen, die unter dem Titel „Verrückt? Na und!“ bundesweit in Schulen angeboten werden.
Depressionen, Angstzustände oder Burnout gehören in der Bundesrepublik zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Jeder sechste ist Schätzungen zufolge selbst betroffen. Und mehr als vier Millionen junge Menschen leben in Familien mit mindestens einem psychisch kranken Elternteil. Dennoch bleibt das Thema weitgehend tabu, viele Jugendliche wissen nicht, wie sie darüber sprechen sollen und wo sie sich selbst Hilfe holen können.
Das Besondere an dem vor fast 25 Jahren von dem in Leipzig ansässigen Verein „Irrsinnig menschlich“ entwickelten Konzept der Schulbesuche ist, dass immer Zweierteams zu den Klassen kommen und gemeinsam durch den Tag führen. Einer der beiden Gäste ist ein Fachmann oder eine Fachfrau für das Thema, der zweite selbst betroffen. Doch das erfahren die Schulklassen erst gegen Ende der Veranstaltung. Es gehe darum zu vermitteln, dass psychisch Kranke ganz normale Leute seien, sagt Schweigert, die für das Sozialunternehmen gpe Besuchstage in der Region Mainz veranstaltet.
Die Arbeit sei für ihn ein „totales Herzensprojekt“, berichtet Chris Elias Bruns, der fünf bis sechs Mal pro Jahr ehrenamtlich an Besuchen teilnimmt, um von seiner eigenen psychischen Erkrankung zu berichten - und davon, wie er sie mit professioneller Hilfe in den Griff bekam. Selbst sei er auf dem Dorf aufgewachsen, wo über psychische Probleme niemand gesprochen habe. „Die Psychiatrie war lange mein zweites Zuhause“, berichtet er den Jugendlichen freimütig. Seine besten Freunde habe er übrigens dort gefunden.
Oft gebe es einen regelrechten Aha-Effekt in den Klassen, schildert Leonie Schweigert ihre Erfahrungen. Im Gedächtnis geblieben sei ihr ein Junge, der sich bei einem Schulbesuch anfangs wie der Klassenclown aufgeführt und das Thema pausenlos ins Lächerliche gezogen habe. Als ihm klar wurde, dass einer der Besucher gerade über sein eigenes Leben berichtet hatte, habe er mit Tränen in den Augen um Entschuldigung gebeten. Regelmäßig würden Jugendliche in den anonymen Rückmeldebögen schreiben, sie selbst hätten sich bislang nicht getraut, über ihre eigenen Probleme zu sprechen.
Der Bedarf an Präventionsarbeit bei Jugendlichen sei seit der Coronavirus-Pandemie noch größer geworden, sagt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Aber auch die anderen Krisen der Gegenwart hätten Auswirkungen auf die Psyche junger Menschen. Psychische Gesundheit sei ein klassisches Querschnittsthema, das an vielen Stellen im regulären Unterricht thematisiert werden könne. Aber es eigne sich besonders gut, um auch externe Kräfte an die Schulen zu holen, lobt sie den Ansatz des Projekts. Denn die könnten einfacher mit den Schülergruppen ins Gespräch kommen: „Eine Lehrkraft kann sich schlecht vor die Klasse stellen und sagen: Ich habe Depressionen.“
In Rheinland-Pfalz stehen Politik und Krankenkassen hinter dem Präventionsprojekt „Verrückt? Na und!“. Hinter der Bereitschaft, die Arbeit für den Zeitraum bis 2028 mit rund 350.000 Euro zu finanzieren, steht auch die Erkenntnis, dass psychische Erkrankungen sich mit der Zeit verschlimmern und die Behandlungskosten explodieren können, wenn die Versorgung nicht rechtzeitig beginnt.

Karlsruhe (epd). Flüchtlinge müssen weiterhin mit ihrer Abschiebung in ihr europäisches Erstaufnahmeland rechnen, selbst wenn sie dort zeitweise ihren Lebensunterhalt nur mit einer tolerierten Schwarzarbeit sichern und Obdach in einer Behelfsunterkunft finden können. Mehrere Urteile des Bundesverwaltungsgerichts liegen dazu vor. Ob diese Rechtsprechung verfassungswidrig ist und zu einer erniedrigenden oder unmenschlichen Behandlung des Flüchtlings führt, konnte das Bundesverfassungsgericht in einem am 10. April veröffentlichten Beschluss nicht entscheiden. Die Verfassungsbeschwerde des in Griechenland als Flüchtling anerkannten Afghanen sei unzureichend begründet worden, begründeten die Karlsruher Richter.
Hat ein Flüchtling in einem anderen EU-Mitgliedstaat Schutz gefunden, ist sein erneuter Asylantrag in Deutschland unzulässig. Deutschland hat dann regelmäßig sechs Monate Zeit, den Flüchtling wieder in den Erstaufnahmestaat zurückzuführen. Gelingt dies nicht, muss es über den Asylantrag entscheiden. Eine Rückführung ist nicht erlaubt, wenn den Flüchtlingen eine erniedrigende oder unmenschliche Behandlung droht. Das sei in Ländern wie Griechenland oder Italien aber oft der Fall, kritisierten Hilfsorganisationen. So moniert etwa Pro Asyl, dass anerkannte Flüchtlinge in Griechenland meist in elenden Verhältnissen leben müssten und an bürokratischen Hürden scheitern. So erhielten sie oft erst nach Monaten eine Sozialversicherungsnummer. Erst dann sei eine legale Beschäftigung, der Bezug von Sozialleistungen, der Zugang zur Gesundheitsversorgung oder die Unterbringung in einer Obdachlosenunterkunft möglich, so Pro Asyl.
In dem vom Bundesverfassungsgericht entschiedenen Fall wollte der Afghane, dem in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden war, der Verelendung entfliehen. Er reiste nach Deutschland. Sein Asylantrag wurde als unzulässig abgelehnt. Ihm wurde die Abschiebung angedroht. Das Verwaltungsgericht Berlin hielt dies für rechtmäßig. Er sei im Besitz einer griechischen Aufenthaltserlaubnis. Es sei daher wahrscheinlich, dass er nicht obdachlos werde. Obdachlosigkeit sei in Griechenland bei anerkannten Schutzberechtigten „kein augenscheinliches Massenphänomen“. Der Afghane könne auch seinen Lebensunterhalt zumindest zeitweise durch Schwarzarbeit sichern. Eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe daher nicht.
Die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde wies das Bundesverfassungsgericht als unzulässig zurück. Der Flüchtling habe sich nicht mit der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hinreichend befasst, wonach auch eine illegale Beschäftigung zur Sicherung des Lebensunterhalts zumutbar sein könne, „solange sich der Betreffende damit nicht der ernstlichen Gefahr der Strafverfolgung aussetzt“.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 21. November 2024 zur Abschiebung von alleinstehenden, erwachsenen und gesunden Flüchtlingen nach Italien geurteilt, dass diese ihr wirtschaftliches Existenzminimum auch durch Arbeit im Bereich der Schatten- oder Nischenwirtschaft sichern könnten. Damit sei auch Schwarzarbeit zumindest zeitweise zumutbar, wenn der Flüchtling keine Sanktionen zu befürchten habe.
Die Verfassungsrichter kamen im aktuellen Fall auch zu dem Schluss, es sei nicht ersichtlich, dass dem Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Griechenland Obdachlosigkeit drohe. Das Bundesverwaltungsgericht hatte es für zumutbar gehalten, dass ein Flüchtling in einer Behelfsunterkunft Obdach findet. Warum dies gegen die EU-Grundrechte-Charta verstoße und der Afghane in seinen Rechten verletzt sei, habe er nicht dargelegt.
Zur Flüchtlingssituation in Italien hat das Bundesverwaltungsgericht am 19. Dezember 2024 geurteilt, dass selbst bei einer dort als Flüchtling anerkannten alleinerziehenden Mutter eines Grundschulkinds und eines Kinds unter drei Jahren eine Abschiebung zulässig sei. Die elementarsten Grundbedürfnisse hinsichtlich Unterkunft, Ernährung und Hygiene könnten gedeckt werden. Eine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe damit nicht.
Diese liegt nach einem Urteil der obersten Verwaltungsrichter vom 20. Januar 2022 auch dann nicht vor, wenn im Erstaufnahmestaat - hier Ungarn - staatliche Hilfe kaum zu erwarten ist, dafür aber nichtstaatliche oder kirchliche Organisationen die Flüchtlinge mit Hilfen nicht im Stich lassen. Werde so „eine Situation extremer materieller Not“ verhindert, sei den Betroffenen die Rückführung zuzumuten. Das Bundesverwaltungsgericht folgte damit dem Europäischen Gerichtshof, der am 7. September 2021 ähnlich geurteilt hatte.
Az.: 2 BvR 1425/24 (Bundesverfassungsgericht)
Az.: 1 C 24.23 (Bundesverwaltungsgericht Schwarzarbeit)
Az.: 1 C 3.24 (Bundesverwaltungsgericht Italien)
Az.: 1 C 3.21 (Bundesverwaltungsgericht Hilfsorganisationen)
Frankfurt a.M. (epd). Das in einem Beruf nicht erlaubte Tragen von Hörgeräten kann bei Schwerhörigkeit ausnahmsweise eine Berufsunfähigkeit begründen. Dies gilt auch dann, wenn Hörgeräte eigentlich die Schwerhörigkeit ganz oder teilweise wieder ausgleichen können, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am 7. April veröffentlichten Urteil.
Geklagt hatte ein auf einem Containerschiff tätiger Kapitän. Im Herbst 2019 hatte der Seeärztliche Dienst seiner Dienststelle ihn wegen einer beidseitigen Schwerhörigkeit für seedienstuntauglich erklärt. Der Kapitän beantragte daraufhin bei seiner Berufsunfähigkeitsversicherung die Zahlung einer Berufsunfähigkeitsrente. Die Versicherung lehnte dies ab. Die Schwerhörigkeit könne mit dem Tragen von Hörgeräten wieder ausgeglichen werden.
Anders als das Landgericht Frankfurt am Main urteilte das OLG, dass der Kapitän aufgrund seiner Schwerhörigkeit berufsunfähig sei und Anspruch auf eine Berufsunfähigkeitsrente habe. Er sei nach den Versicherungsbedingungen aufgrund „Kräfteverfalls dauerhaft und vollständig berufsunfähig“.
Der Seeärztliche Dienst habe die Seedienstuntauglichkeit aufgrund der Schwerhörigkeit festgestellt, stellte das OLG fest. Die Schwerhörigkeit könne der Kapitän auch nicht mit dem Tragen von Hörgeräten ausgleichen. Prinzipiell sei das zwar möglich, aber das Tragen von Hörhilfen sei nach den Regelungen der Maritime-Medizin-Verordnung untersagt.
Az.: 3 U 122/23
Frankfurt a.M. (epd). Ein Hersteller von Spiralen zur Schwangerschaftsverhütung muss bei möglichen Materialfehlern betroffenen Frauen Schmerzensgeld für die operative Entfernung des Verhütungsmittels zahlen. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main in einem am 9. April verkündeten Urteil entschieden und einer Frau ein Schmerzensgeld für ihre operationsbedingten Körper- und Gesundheitsbeeinträchtigungen zugesprochen.
Die Klägerin hatte sich 2016 eine Spirale zur Schwangerschaftsverhütung einsetzen lassen. Im Jahr 2018 warnte der spanische Hersteller der Spirale davor, dass eine bestimmte Charge des Verhütungsmittels einen Materialfehler und damit eine erhöhte Bruchwahrscheinlichkeit aufweisen könne. Davon war auch die Klägerin betroffen. Ihre Frauenärztin stellte 2021 bei einer Untersuchung fest, dass das Verhütungsmittel gebrochen war. Eine vollständige Entfernung der Bruchstücke gelang erst bei einer Operation in einer Klinik unter Vollnarkose. Die Frau verlangte von dem spanischen Hersteller der Spirale ein Schmerzensgeld von mindestens 7.000 Euro.
Das OLG urteilte, dass die Firma für die operationsbedingten Körper- und Gesundheitsbeeinträchtigungen der Klägerin Schmerzensgeld zahlen müsse. Die Klägerin habe anhand ihres Patientenpasses nachgewiesen, dass ihre eingesetzte Spirale von den möglichen Materialfehlern betroffen gewesen sei. Angemessen sei allerdings ein Schmerzensgeld von 1.000 Euro. Die Operation sei komplikationslos verlaufen, nach dem Eingriff von der Klägerin angeführte Beschwerden habe sie erst in der zweiten Instanz und damit zu spät geltend gemacht.
Az.: 17 U 181/23
Zwickau (epd). Arbeitgeber dürfen eine interne Meldestelle für Whistleblower nicht ohne den Betriebsrat betreiben. Da die Nutzung einer internen Meldestelle das Verhalten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft, besteht nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestimmungsrecht für den Betriebsrat, entschied das Arbeitsgericht Zwickau in einem am 10. April bekanntgegebenen Beschluss.
Hintergrund des Rechtsstreits ist das am 2. Juli 2023 in Kraft getretene Hinweisgeberschutzgesetz. Damit sollen Whistleblower, die Missstände bei ihrem Arbeitgeber anprangern wollen, vor Repressalien geschützt werden. Das Gesetz sieht hierfür unter anderem die Einrichtung einer internen Meldestelle im Unternehmen vor, an die sich Whistleblower wenden können. In der Regel ist die Einrichtung einer internen Meldestelle ab 50 Beschäftigten vorgeschrieben. Alternativ kann aber der Arbeitgeber auch Dritte mit der Einrichtung externer Meldestellen beauftragen.
Im konkreten Fall ging es um einen Pflege- und Altenheimbetreiber mit mehr als 480 Beschäftigten. Der Arbeitgeber beauftragte eine konzerneigene GmbH mit der Einrichtung einer Meldestelle für Whistleblower. Der Betriebsrat eines Pflegeheims verlangte, dass er bei der Nutzung und Ausgestaltung der internen Meldestelle mitbestimmen müsse. Der Arbeitgeber verneinte den Anspruch. Die Bildung interner Meldestellen betreffe nur die Organisation des Betriebs, für die der Arbeitgeber alleine zuständig sei.
Dem folgte das Arbeitsgericht nur teilweise. Allerdings wies das Gericht den Betriebsrat aus formalen Gründen ab. Dieser könne sich nicht auf sein Mitbestimmungsrecht berufen, da hier nur der Konzernbetriebsrat zuständig sei. Kein Mitbestimmungsrecht bestehe zudem bei der Frage, ob der Arbeitgeber eine interne, selbst betriebene Meldestelle einrichtet oder er stattdessen einen externen Anbieter damit beauftragt. Dies gehöre zur Organisation des Betriebs, für die alleine der Arbeitgeber verantwortlich sei.
Allerdings bestehe ein Mitbestimmungsrecht, wie die interne Meldestelle genutzt werden könne. Dies betreffe „das Verhalten der Arbeitnehmer und nicht die Organisation des Betriebes“, so das Arbeitsgericht. Dazu gehörten Verfahrensanweisungen des Arbeitgebers zur Nutzung der Meldestelle, etwa zur Frage, was zu melden ist und wie gut dies begründet sein muss. Gegen den Beschluss kann der Betriebsrat Beschwerde beim Sächsischen Landesarbeitsgericht in Chemnitz einlegen.
Az.: 9 BV 12/24
Mainz (epd). Pflegekassen müssen zu einer „erheblichen Pflegeerleichterung“ eine Klimaanlage bezuschussen. Ist eine pflegebedürftige Frau besonders hitzeanfällig, kann sie bei ihrer Pflegekasse einen Zuschuss zum Einbau einer Klimaanlage in ihrem Schlafzimmer als wohnumfeldverbessernde Maßnahme erhalten, urteilte am 8. April das Sozialgericht Mainz. Dies gelte erst recht, wenn mit dem Einbau einer Klimaanlage für die Pflegepersonen die Pflege weniger anstrengend sei.
Die pflegebedürftige Klägerin hatte von ihrer Pflegeversicherung einen Zuschuss für den Einbau einer Klimaanlage im Schlafzimmer ihrer Eigentumswohnung verlangt. Die Pflegekasse lehnte den Antrag als unwirtschaftlich ab.
Das Sozialgericht gab der Frau jedoch recht. Der Einbau der Klimaanlage würde die häusliche Pflege erheblich erleichtern. Denn die Pflege werde in einem klimatisierten Raum viel angenehmer empfunden und sei auch für die Pflegepersonen weniger anstrengend. Zudem verhindere die Klimaanlage gefährliche gesundheitliche Risiken für die besonders hitzeanfällige Klägerin. Ein klimatisiertes Schlafzimmer führe zu einem erholsamen Nachtschlaf, so dass die Klägerin weniger auf die Unterstützung ihrer Pflegeperson angewiesen sei.
Schließlich werde mit dem Zuschuss zur Klimaanlage auch kein gehobener Wohnkomfort finanziert. Angesichts des Klimawandels bilde eine Klimaanlage im Schlafzimmer den allgemeinen Wohnstandard ab, für den die Pflegeversicherung einzustehen habe.
Az.: S 9 P 76/23

Wuppertal (epd). Die Diakonie Wuppertal hat mit einem Festakt ihre Geschäftsführerin Cornelia-Maria Schott in den Ruhestand verabschiedet. Fast 30 Jahre lang habe sie, die auch Geschäftsführerin der Diakonischen Altenhilfe Wuppertal (DAW) war, die Altenhilfe in der Stadt mitgeprägt und mitentwickelt, erklärte die Diakonie.
Vor ihrer Tätigkeit für die Diakonie arbeitete Schott den Angaben nach für die Industrie. Nach einer Familienphase kehrte sie 1996 zurück in den Beruf und war für die Evangelische Altenhilfe Wichlinghausen tätig. „Das war die Zeit, als es in der Altenhilfe einen großen Aufbruch gab“, erinnert sich Schott. Die Pflegeversicherung war eingeführt worden, und Altenhilfe bedeutete plötzlich eine große wirtschaftliche Verantwortung.
Heute gehören zur DAW den Angaben nach acht stationäre Einrichtungen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden sowie die Hospiz- und Palliativarbeit, die mobile Pflege und 299 Auszubildende in der Diakonie Akademie.
Die Corona-Pandemie sei wegen der Betretungsverbote in den Einrichtungen, kurzfristigen Verordnungen und fehlenden Schutzmaterialien eine riesige Herausforderung gewesen. Für die Entscheidung, Mitarbeitenden des Hospizdienstes den Besuch der Alteneinrichtungen zu ermöglichen - anders als in den meisten anderen Häusern -, habe es Mut gebraucht, sagte Schott. „Bei uns musste niemand alleine sterben.“ Für die Zukunft der Alten- und Pflegearbeit brauche es eine Entbürokratisierung. Sorge machten auch der wirtschaftliche Druck und der Fachkräftemangel.
Werner Schmidt ist in den Ruhestand eingetreten. Nachfolger des Diakons als Leiter des Altenhilfeverbunds der Rummelsberger Diakonie wird Andreas Stenzel. Der Vorstand Dienste der Rummelsberger Diakonie, Karl Schulz, würdigte Schmidt: „Werner Schmidt hat sein Leben in den Dienst älterer Menschen gestellt - mit beeindruckender Tatkraft, tiefem Glauben und gelebter Menschlichkeit.“ Seit der Übernahme der Leitung des Stephanushauses im Jahr 2014 habe Schmidt die Altenhilfe in Rummelsberg maßgeblich geprägt. Zu den unter seiner Verantwortung realisierten Projekten zählten unter anderem die Einrichtung der ersten Seniorentagespflege sowie der Neubau des Seniorenzentrums Gottfried Seiler in Feucht. Schmidt trat 1982 in die Rummelsberger Brüderschaft ein und bekleidete seither verschiedene Funktionen an den Standorten Hof, Rummelsberg, Rehau, Garmisch und Fürth. Schmidt selbst sagte: „Am meisten erfüllt mich die Dankbarkeit, dass ich meine Arbeit in gute Hände übergeben darf.“
Ronny Rudi Richter hat sein Amt als Geschäftsführer der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) angetreten. Seit 2021 war er Justitiar und Leiter der Rechtsabteilung der ÄKN und seit Mai 2024 zusätzlich kommissarischer Geschäftsführer. Seit mehr als 20 Jahren bildet Medizinrecht Richters Tätigkeitsschwerpunkt, besonders ärztliches Berufsrecht. Ehe er zur ÄKN kam, arbeitete Richter für die bayerische Landesärztekammer, für eine Kanzlei für Medizinrecht, für die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns und die Zahnärztekammer Niedersachsen.
Robert Ackermann leitet den Bereich Medizintechnik der Berliner Johanniter. Bei der Hilfsorganisation liegt sein Schwerpunkt auf Instandhaltung und Weiterentwicklung der Medizintechnik. Er wolle vernetzte Medizinprodukte sicher und zukunftsfähig gestalten, teilten die Johanniter mit. Ackermann stammt gebürtig aus Dresden und hat biomedizinische Technik studiert. Er arbeitete lange für Hersteller von Medizintechnik. Zuletzt verwaltete er die Regionalleitung Ost für Medizintechnik der Helios-Kliniken.
Mai
5.-12.5.:
Online-Seminar „Ausgliederung und Umstrukturierung beim Verein“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 01577/7692794
5.5.-30.6.:
Online-Kursreihe „Führung auf Distanz - Verteilte Teams mit agilen und digitalen Werkzeugen führen“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700
6.5. Stuttgart:
Seminar „Arbeitsrecht für Führungskräfte und Personaler. Der Zyklus eines Arbeitsverhältnisses - aus Sicht der Personalabteilung“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-548
6.5.:
Online-Kurs „Führen in Teilzeit - geteilte Führung. Vorteile und Nutzen einer neuen Art zu führen“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-16
8.-15.5.:
Online-Grundkurs „Digitale Öffentlickeitsarbeit und Social-Media für soziale Einrichtungen“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 01577/7692794
11.-13.5. Berlin:
Zertifizierter Kurs „Selbstmanagement mit dem Zürcher Ressourcen-Modell“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 0172/2883106
12.5.:
Online-Thementag „Lernen aus Krisen - Präventionskultur ausbauen“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-16
12.5.-30.6.:
Online-Kurs „Rechtliche Beratung in der Wohnungslosenhilfe“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 0172/2883106
21.-22.5.:
Online-Schulung „Jahresgespräche mit Mitarbeitenden führen - wirkungsvolle Methoden und Gelingensfaktoren“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-23
22.5.:
Online-Fortbildung „Krisenprävention durch Früherkennung - Weg zur stabilen Unternehmensführung“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700
Juni
2.-3.6. Hannover:
Fachtagung „Aktuelle Fragen des Bürgergeldes, der Grundsicherung für Arbeitssuchende“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-606
3.-5.6.:
Online-Seminar „Fehlzeiten - Urlaub, Krankheit und Abwesenheitszeiten im Arbeitsrecht“
der Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
Tel.: 0761/200-1700
4.-5.6.:
Online-Seminar „Aktuelle Entwicklungen in der europäischen Sozialpolitik“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-424