 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 39/2024 - 27.09.2024
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 39/2024 - 27.09.2024
 Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 39/2024 - 27.09.2024
Ihr wöchentlicher Branchendienst
Ausgabe 39/2024 - 27.09.2024

Die Verkehrsminister der Bundesländer haben entschieden: Der Preis des Deutschlandtickets steigt im kommenden Jahr von 49 auf 58 Euro. Kritik kommt von Fahrgast- und Umweltverbänden. Die Mobilitätsforscherin Anita Schöbel bezweifelt, dass viele Menschen, besonders auf dem Land, ihr Auto künftig stehen lassen. Nötig sei dazu ein Ausbau des Angebots, sagt die Kaiserslauterer Professorin. Dafür müsse die öffentliche Hand aber viel Geld in die Hand nehmen, und das sei eine politische Entscheidung.
Berufsbetreuerinnen und Vormünder sollen mehr Honorar erhalten, so steht es in einem Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums. Es sollen demnach 12,7 Prozent mehr sein - allerdings nur im Durchschnitt. Der Bundesverband der Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer bemängelt, dass es für mittellose Klienten, die zu Hause leben, sogar weniger Geld geben soll - und das sei die bei weitem größte Gruppe der Betreuten. Unter dem Strich bliebe den meisten Betreuern sogar weniger Geld. Der Geschäftsführer des Berufsverbands, Harald Freter, fordert eine Erhöhung der Sätze um 27 Prozent und warnt vor großen Schwierigkeiten für die Kommunen, falls viele Betreuer ihrem Beruf den Rücken kehren sollten.
Die Schuldnerberatungen haben landauf, landab richtig viel zu tun, der Bedarf ist enorm. Das ist in Teilen eine Spätfolge der Corona-Pandemie, des Ukrainekriegs und der Inflation. Mittlerweile suchen viele Angehörige der Mittelschicht, die ihr Häuschen nicht mehr abbezahlen können, die Beratungen auf. Viele Schuldner müssen lange auf einen Beratungstermin warten, während sich ihre finanzielle Lage zuspitzt. Die Caritas will daher ihre Schuldnerberatung stärken. In einem deutschlandweiten Projekt will sie dafür Ehrenamtliche gewinnen. Die Ehrenamtlichen sollen dabei aber nur Aufgaben übernehmen, denen sie auch gewachsen sind.
Auch wer mittellos stirbt, hat unter Umständen das Recht, in einem Familiengrab bestattet zu werden. Nämlich dann, wenn er oder sie diesen Wunsch zu Lebzeiten geäußert hat. So hat es das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen entschieden. Die Sozialhilfe muss dann die Kosten übernehmen, die im Vergleich zu einem einfachen Grab höher sein können. Allerdings haben andere Gerichte Ansprüche von Hinterbliebenen von Sozialhilfeempfängern abschlägig beschieden. Zum Beispiel haben sie keinen Anspruch auf einen Grabstein, wenn in ihrem Ort nur ein Kreuz über dem Grab üblich ist.
Lesen Sie täglich auf dem epd-sozial-Account des Internetdienstes X Nachrichten aus der Sozialpolitik und der Sozialbranche. Auf dem Kanal können Sie mitreden, Ihren Kommentar abgeben und auf neue Entwicklungen hinweisen. Gern antworte ich auch auf Ihre E-Mail.
Ihr Nils Sandrisser

Kaiserslautern (epd). Die Preiserhöhung des Deutschlandtickets reicht nach den Worten der Mobilitätsforscherin Anita Schöbel nicht aus. Die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs könnten damit nicht gedeckt werden, sagte die Optimierungsprofessorin der TU Kaiserslautern und Sprecherin der „DFG-Forschungsgruppe 2083: Integrierte Planung im öffentlichen Verkehr“ dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Die Verkehrsminister der Länder hatten am 23. September auf einer digitalen Sonderkonferenz die Preiserhöhung für das Deutschlandticket von 49 auf 58 Euro beschlossen. Finanziert wird das Ticket zur Hälfte von Bund und Ländern. Beide Seiten zahlen aktuell jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Deutschlandticket.
Laut Schöbel stiegen vor allem Berufspendler, die in Ballungszentren etwa um Frankfurt am Main, Hamburg und Stuttgart vor Einführung des Deutschlandtickets weit mehr im Monat zahlten, auf das Deutschlandticket um: „So sind sehr viele Einnahmen verloren gegangen.“
Gleichwohl sieht sie keinen nennenswerten Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr. Vor allem im ländlichen Raum gebe es einen Teufelskreis. Um Menschen dort zu bewegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, müssten sich die Taktfrequenzen erhöhen. „Aber es rechnet sich gleichzeitig nicht, Busse fast leer fahren zu lassen“, sagte Schöbel. Auch aus Klimaschutzsicht wären nicht ausgelastete Verkehrsmittel nicht zu rechtfertigen.
Generell seien Anforderungen an Busse und Bahnen Schöbel zufolge sehr hoch: „Die Verbindungen sollen schnell sein, nicht zu teuer und umweltverträglich.“ Dies könne nur über eine enge Vernetzung der Verkehrsträger erfolgen. Die Vernetzung klappe dort besser, wo Kommunen oder der Staat viel Geld in den öffentlichen Verkehr steckt. „Aber die finanzielle Förderung des ÖPNV ist eine politische Entscheidung“, erklärte die Forscherin.
Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) nannte nach dem Treffen der Verkehrsminister die Preisanhebung um neun Euro angesichts des Angebots maßvoll. Der Preis des Tickets bleibe attraktiv, betonte Krischer. Die wichtige Botschaft sei, dass dieses Angebot dauerhaft zur Ticketlandschaft gehören werde. Die Verkehrsunternehmen erhielten mit der Entscheidung Planungssicherheit.
Auch die für den öffentlichen Personennahverkehr zuständige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, Katrin Eder (Grüne), verteidigte den angekündigten Preisanstieg. Die Erhöhung sei ein „bedauerlicher, aber dennoch unvermeidbarer Schritt“, sagte sie. Die Zuschüsse von Bund und Ländern für das Deutschlandticket seien jeweils gedeckelt gewesen. Ohne Preiserhöhung wäre das Angebot nicht mehr zu finanzieren gewesen und hätte eingestellt werden müssen. „Die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister haben auf Basis der neuesten Verkaufszahlen und Prognosen den nun beschlossenen Preisschritt mit dem nötigen Augenmaß vorgenommen“, versicherte Eder. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie der Abbau des sogenannten Dienstwagenprivilegs seien „derzeit politisch nicht mehrheitsfähig“.
Die Linksfraktion im mecklenburg-vorpommerschen Landtag kritisierte die geplante Preiserhöhung als „zu hoch“. „Viele Menschen, die das Ticket nutzen, haben bereits an den derzeitigen 49 Euro zu knapsen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion, Henning Foerster. Deshalb habe sich Mecklenburg-Vorpommern bei der Abstimmung der Verkehrsminister für die Preiserhöhung enthalten. „Wenn wir wollen, dass die Verkehrswende gelingt und mehr Menschen auf Bahn und Bus umsteigen, ist die Preiserhöhung kontraproduktiv“, sagte Foerster. Die Anhebung um 9 Euro monatlich werde dennoch kommen, „weil die Finanzierung des Nahverkehrs und der Ausgleich der Einnahmeverluste an die Verkehrsbetriebe die Länder vor große Herausforderungen stellt“. Jetzt müsse es gelingen, dass noch mehr Betriebe Jobtickets zur Entlastung von Fahrkosten anbieten. „Auch werden wir alles daransetzen, dass sowohl das Azubi- als auch das Seniorenticket Mecklenburg-Vorpommern ab 2025 weiterhin für einen möglichst attraktiven Preis zu haben sind.“
Der Fahrgastverband „Pro Bahn“ erklärte, die angekündigte Preissteigerung sei nicht akzeptabel. Gerade Neukunden würden durch den Schritt „bitter enttäuscht“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme. Der Umweltverband BUND forderte die Einführung eines ermäßigten Deutschlandtickets für Schüler, Studenten und Menschen mit niedrigem Einkommen.
Im Vorfeld der Entscheidung hatte das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende auf eine finanzielle Absicherung sowie auf Preisstabilität für das Deutschlandticket über 2025 hinaus gedrungen. Die beteiligten Verbände sahen die Gefahr, dass mit einem möglichen Wechsel der Bundesregierung im kommenden Jahr die Finanzierung infrage gestellt werde. „Das Deutschlandticket darf nicht zu einer kurzen Episode in der Geschichte unseres Landes werden. Es muss dauerhaft und preisstabil etabliert werden“, heißt es in einer Mitteilung von Gewerkschaften, Sozial-, Wohlfahrts- und Umweltverbänden sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Überdies bekräftigte das Bündnis seine Forderung nach einem bundesweit einheitlichen Sozialticket. Mit einem Standardpreis von 49 Euro sei das Ticket speziell für Familien, Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit geringem oder keinem Einkommen zu teuer. Darüber hinaus brauche es dringend einen Ausbau- und Modernisierungspakt für massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr.
Ebenfalls vor der Entscheidung hatte der Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Ingo Wortmann, eine Koppelung der Preiserhöhung mit einer Angebotserweiterung empfohlen. „Wenn das Deutschlandticket teurer wird, könnte man erwägen, dass es auch hier eine Mitnahmeregelung an Wochenenden oder nach Feierabend - zum Beispiel für Kinder oder einen weiteren Erwachsenen - gibt“, schlug Wortmann vor. Allerdings könne dies nicht in Spitzenzeiten gelten. „Da sind unsere Verkehrsmittel voll.“ Die Preiserhöhung hielt er für unvermeidlich. Er schätzte den Fehlbetrag der deutschen Verkehrsunternehmen in diesem Jahr auf 3,5 bis 4,3 Milliarden Euro. „Der steigende Ausgleichsbedarf ist auch darauf zurückzuführen, dass die meisten Besitzer des Deutschlandtickets vorher ein teureres Monatsabonnement hatten, wodurch wir deutlich an Einnahmen verlieren.“
Ein Sprecher von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wies die Verantwortung für die Preiserhöhung allein den Bundesländern zu. Sie hätten sich für diesen Weg entschieden, sagte er in Berlin. Zu der Forderung der Länder nach einer Dynamisierung des Bundeszuschusses verwies der Sprecher auf die Verabredung von Bund und Ländern, wonach sie sich im Verlauf des kommenden Jahres über die weitere Finanzierung des Tickets verständigen wollen.

Berlin (epd). Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, sieht in der aktuellen Migrationsdebatte die Gefahr, neue Politikverdrossenheit zu produzieren. Die Debatte sei „hilflos eskalierend“, sagte Heinrich am Rande eines Besuchs in einer Abschiebeeinrichtung dem Evangelischen Pressedienst (epd). Es würden hektische Vorschläge gemacht, die rechtlich nicht haltbar und praktisch nicht umsetzbar seien. Das sei eine Gefahr für die Wahrnehmung der Demokratie.
In der Bevölkerung gebe es den Wunsch nach Sicherheit und einem „handlungsfähigen, auch wehrhaften Rechtsstaat“. „Wer jetzt politische Versprechungen macht, die sich in naher Zukunft als nicht umsetzbar erweisen, weil die Wirklichkeit komplizierter ist, produziert wieder nur Enttäuschungen“, sagte die Präses des evangelischen Kirchenparlaments. Die Enttäuschungen wiederum produzierten das Gefühl von Steuerungsverlust und verstärkten den Eindruck, dass die Demokratie handlungsunfähig sei. „Das kann niemand wollen“, sagte sie.
Heinrich sagte, sie vermisse in der Diskussion um das Asylrecht „Rückgrat“ für grundlegende Werte. „Besonders in den Wahlkämpfen haben sich viele von populistischen Positionen unter Druck setzen lassen und vergessen, dass wir gerade erst 75 Jahre Grundgesetz gefeiert haben“, sagte sie mit Verweis auf das in der Verfassung garantierte Grundrecht auf Asyl: „Wir dürfen uns nicht von Populisten treiben lassen.“ Benötigt werde eine sachliche und ernsthafte Debatte über Herausforderungen und Probleme mit Migration.
Kritik übte sie auch an der Forderung, Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. „Menschenwürde heißt für mich nicht, Leute einfach abblitzen zu lassen“, sagte Heinrich. Man müsse alles daran setzen, „im Inneren Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Menschenwürde zu gewährleisten und zu verteidigen, ohne diese an den Außengrenzen abzuschaffen“.
Unterdessen sah die Gewerkschaft der Polizei (GdP) nach Einführung der neuen Grenzkontrollen im Norden und Westen Deutschlands das Ziel bislang nicht erreicht, irreguläre Migration einzudämmen. „Festzustellen bleibt, dass die Aufgriffe von unerlaubten Menschen sowie Schleusern relativ gering ist“, sagte der GdP-Vorsitzende Andreas Roßkopf dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (26. September). „Auch die Zurückweisungen, welche im Moment an der Westgrenze gemacht werden, sind dadurch gering“, sagte er: „Die Weiterleitung von Schutz- und Asylsuchenden an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Landesinneren bleiben weiterhin hoch.“ Die Gewerkschaft beobachte, dass mit Einführung der Grenzkontrollen die Kontrollstellen und Hauptstraßen umfahren würden, selbst von Busunternehmen. Roßkopf kritisierte, es fehle an der Ausstattung, um als moderne Grenz- und Fahndungspolizei arbeiten zu können.
Auch die Bereichsleiterin Soziale Arbeit beim Diözesancaritasverband und Flüchtlingsbeauftragte des Bistums Münster, Stefanie Tegeler, forderte eine Rückkehr zu einer sachlichen Debatte über Migration. Eine Politik, die auf Angst und Ausgrenzung setze, gefährde nicht nur die Rechte von Geflüchteten, sondern untergrabe auch gesellschaftliche Grundwerte. „Die Polarisierung der Debatte und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft führen zu einer Erosion des sozialen Friedens“, sagte Tegeler.
Ob Integration erfolgreich sei, hänge in hohem Maß von der Bereitschaft sowohl von Neuankömmlingen als auch von Alteingesessenen ab, offen füreinander zu sein und aufeinander zuzugehen, erklärte die Politikwissenschaftlerin. Die Politik stehe in der Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, um diesen Prozess zu unterstützen.
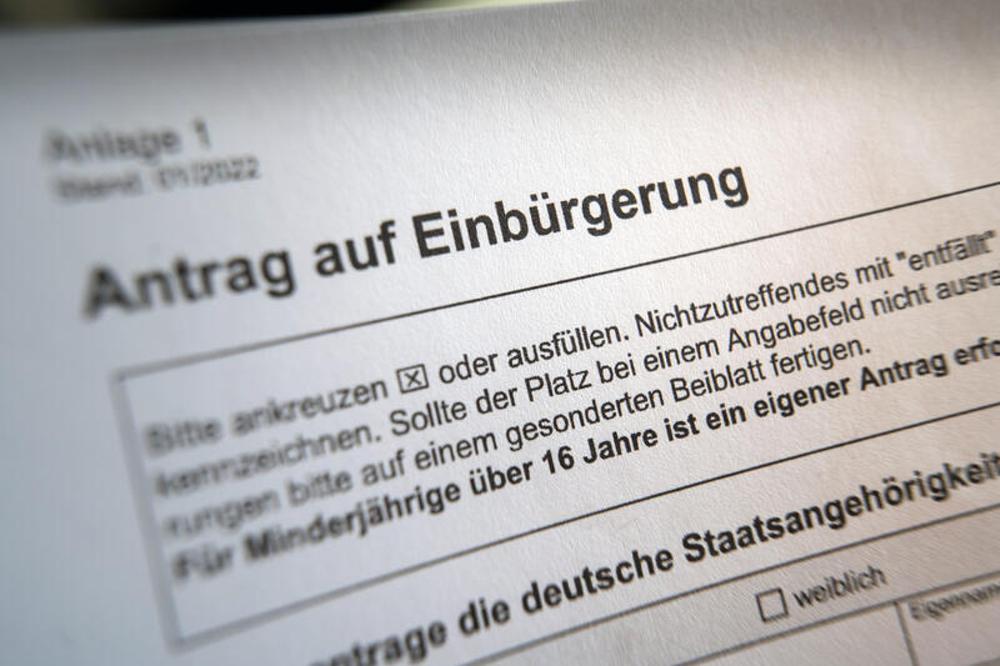
Berlin (epd). Der wissenschaftliche Stab des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR) untersucht derzeit, wie sich die Einbürgerung von Geflüchteten verbessern lässt. In einem „Policy Brief“ haben die Forschenden bislang vorliegende Erkenntnisse über die Einbürgerung Geflüchteter gebündelt und Forschungslücken herausgearbeitet, die sie mit dem Forschungsprojekt „Einbürgerung als 'Integrationsbooster' für Geflüchtete“ schließen möchten.
Die Forschenden legen den Fokus auf Flüchtlinge, da diese den Angaben zufolge einen großen Teil der in Deutschland Eingebürgerten ausmachen. Mit gut 200.000 habe die Zahl der Einbürgerungen 2023 einen neuen Höchststand erreicht. 38 Prozent der im vergangenen Jahr Eingebürgerten seien Syrerinnen und Syrer gewesen, weitere 5 Prozent Menschen aus Afghanistan. Der deutliche Anstieg der Einbürgerungen ab dem Jahr 2021 sei vor allem auf Menschen zurückzuführen, die zwischen 2014 und 2016 nach Deutschland geflüchtet seien und die nötigen Aufenthaltszeiten sowie Deutschkenntnisse mittlerweile erfüllten.
Für Flüchtlinge habe die Einbürgerung eine besondere Bedeutung, erklärte Marie Walter-Franke, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim SVR: „Oft bietet das Herkunftsland auch nach Jahren keine sichere Rückkehrperspektive, sodass Geflüchtete mehr als andere Gruppen auf eine dauerhafte Zukunft im Aufnahmeland angewiesen sind.“ Wirtschaftliche Chancen, die rechtliche Gleichstellung zu deutschen Staatsangehörigen und die Aufenthaltssicherheit seien wichtige Motive für die Einbürgerung.
Der SVR stellt die Frage, ob die Einbürgerung eher „ein Motor oder eine Belohnung für Integration“ sei. Bisherige Studien zeigten, dass Zugewanderte nach ihrer Einbürgerung besser in den Arbeitsmarkt integriert würden. „So können Einbürgerungen beispielsweise zu höherem Einkommen führen“, sagte Hakan Yücetas, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter beim SVR. Wie sich die Einbürgerung auf die soziale und kulturelle Integration insbesondere bei Flüchtlingen auswirke, müsse noch untersucht werden.
Die Forschenden werden außerdem analysieren, wie sich die jüngste Reform des Staatsangehörigkeitsrechts auf die Einbürgerungen Geflüchteter auswirkt, heißt es in der Mitteilung. Nach den neuen Regeln, die seit dem 27. Juni gelten, sind Einbürgerungen bereits nach fünf anstatt wie zuvor nach acht Jahren Aufenthalt in Deutschland möglich, bei „besonderen Integrationsleistungen“ bereits nach drei Jahren. Mehrstaatigkeit wird nun grundsätzlich akzeptiert. Laut SVR folgen beide Erleichterungen dem Trend anderer Einwanderungsstaaten. Sie könnten Einbürgerungsverfahren beschleunigen.
An die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts werden hingegen jetzt strengere Anforderungen gestellt: Für eine Einbürgerung müssen die Zugewanderten den Lebensunterhalt für sich und ihre unterhaltspflichtigen Familienangehörigen bestreiten können, ohne Sozialleistungen zu beziehen. Unter Flüchtlingen erfüllten nur 61 Prozent diese neuen Anforderungen. Vor der Reform seien es 75 Prozent gewesen, da viele ihren geringen Verdienst nicht zu vertreten hatten oder Familienmitglieder für den Unterhalt sorgten, erklärte der SVR und berief sich auf Berechnungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Das Forschungsprojekt solle untersuchen, wie sich die Reform auf die Einbürgerungsabsicht und das Einbürgerungsverhalten Geflüchteter auswirke.
Auch die Perspektive der Staatsangehörigkeitsbehörden beziehe das Forschungsprojekt ein. Die derzeitige Einbürgerungspraxis beschreibt der SVR als „Flickenteppich“: Bei der Umsetzung des bundesweiten Staatsangehörigkeitsrechts gebe es Spielräume, die die Behörden in den Kommunen und Ländern unterschiedlich auslegten. Die durchschnittliche Dauer eines Einbürgerungsprozesses liege in den verschiedenen Behörden zwischen sechs Monaten und mehreren Jahren. Die Forschenden wollen untersuchen, welche Erfahrungen Geflüchtete mit den Behörden machen. Dabei solle die Perspektive der Behördenmitarbeitenden ebenso einbezogen werden wie Erfahrungen aus anderen Ländern.
Übergeordnetes Ziel der Untersuchung sei es, wirksame Maßnahmen zu identifizieren, die Einbürgerungsprozesse optimieren können. Dadurch sollen mehr Geflüchtete, die die Kriterien für die deutsche Staatsbürgerschaft erfüllen, auch tatsächlich eingebürgert werden. Durch die Genfer Flüchtlingskonvention sei Deutschland völkerrechtlich zur schnellen und kostengünstigen Einbürgerung von Flüchtlingen verpflichtet.

Hamburg (epd). Der Bundesverband der Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer hat den Referentenentwurf zur Reform ihrer Vergütungssätze kritisiert. Verbandsgeschäftsführer Harald Freter sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), nötig sei eine Erhöhung der Vergütung um 27 Prozent.
Am 16. September hatte das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf veröffentlicht, wonach berufliche und ehrenamtliche Betreuerinnen und Vormünder mehr Geld bekommen und die Vergütungsregeln vereinfacht werden sollen. Auch Nachlass-, Umgangs- und Verfahrenspflegerinnen und -pfleger sollen mehr Geld erhalten. Im Schnitt sollen die Sätze demnach um 12,7 Prozent angehoben werden.
„Wenn die Vergütung auf einem zu niedrigen Niveau bleibt, werden weiter freiberufliche Betreuer abspringen und Betreuungsvereine ihre Tätigkeit einstellen“, sagte Freter. Nachwuchs zu gewinnen, werde dann noch schwieriger werden als ohnehin schon. Dann würden die Kommunen große Schwierigkeiten bekommen, die Betreuung in den Städten und Gemeinden sicherzustellen. Denn wenn es nicht genügend freiberufliche Betreuer und Betreuungsvereine gebe, müssten Kommunen mit ihren Betreuungsbehörden diese Aufgabe wahrnehmen. Es gebe aber in Deutschland nur noch ein paar hundert Behördenbetreuer.
Verbandsvorsitzender Thorsten Becker nannte den Entwurf am 23. September in Hamburg „unmittelbar existenzbedrohend“. Die Pauschalen für mittellose und zu Hause lebenden Klienten sollten dem Entwurf zufolge nicht erhöht, sondern sogar gesenkt werden, erklärte Becker, während die Pauschalen für nicht mittellose Klienten steigen sollen. Mehr als 80 Prozent der Klienten seien jedoch mittellos. „Wir betreuen hauptsächlich Sozialleistungsempfängerinnen und -empfänger, Obdachlose, psychisch Kranke, Drogenabhängige, Alte und Demente“, erläuterte Becker, „die Schwächsten in unserer Gesellschaft.“
Das Justizministerium müsse den Entwurf überarbeiten, forderte Becker. Die Unterscheidung in Mittellose und Nichtmittellose müsse entfallen: „Wir fragen uns, warum unsere Leistungen für mittellose Menschen weniger wert sein sollen als für Selbstzahlende.“ Selbst der Status quo sei besser als der Entwurf.
Freters Worten zufoge fordert der Verband nicht nur eine deutlichere Erhöhung, sondern auch eine Vereinfachung des Vergütungssystems. Die Betreuerhonorare hingen derzeit von verschiedenen Kriterien ab. Zum Beispiel richte sich die Höhe der Vergütung danach, ob ein Betreuter im Heim lebt oder nicht. Sie hänge auch von der Dauer der Betreuung ab. „Diese Kriterien sind aber nach unserer Auffassung nicht sachgerecht“, sagte Freter. „Deshalb fordern wir eine einheitliche Pauschale pro Fall sowie eine höhere sogenannte Einrichtungspauschale, die gezahlt wird, wenn ein Betreuer einen neuen Fall übernimmt.“ Eine derart radikale Vereinfachung würde auch die Gerichte entlasten. Dort werde über die Honorare gestritten, und es gebe häufig lange Verzögerungen bei der Vergütungszahlung.
Berlin (epd). Trotz des Widerstands aus der FDP-Bundestagsfraktion gehen die Grünen davon aus, dass das Rentenpaket II zügig vom Parlament verabschiedet werden wird. Der Sprecher für Rentenpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Markus Kurth, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), man könne noch über Verbesserungen reden, „aber im Grundsatz ist das jetzt geeint“. Der Gesetzentwurf liege schon monatelang vor. Kurth verwies auf FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner, der den mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ausgehandelten Kompromiss zuletzt Anfang September als „zustimmungsfähig“ bezeichnet hatte. „Ich halte nichts davon, jetzt wieder Grundsatzdebatten zu eröffnen“, sagte Kurth.
Mit dem Rentenpaket II will die Ampel-Koalition das durchschnittliche Rentenniveau für die kommenden 15 Jahren bei 48 Prozent des durchschnittlichen Einkommens festschreiben. Außerdem soll für die gesetzliche Rente eine zusätzliche Finanzierung aus Aktienerträgen aus einem Staatsfonds eingeführt werden, für die der Bund von diesem Jahr an Kredite aufnehmen will. Ziel ist es, den Beitragsanstieg zu dämpfen. Derzeit beträgt der Rentenbeitrag 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens, in 15 Jahren wird er voraussichtlich bei mehr als 22 Prozent liegen.
Die Grünen wollen Kurth zufolge im parlamentarischen Verfahren die Anlagekriterien für das sogenannte Generationenkapital nachschärfen, „damit keine finanziellen Mittel in die fossile Industrie fließen“. Der Gesetzentwurf bleibe bei den ökologischen und sozialen Vorgaben für die Investments noch zu allgemein, sagte Kurth: „Das sollten wir konkretisieren.“ Im Kuratorium der Stiftung, die den Fonds verwalten soll, sollte der Bundestag als Gesetzgeber vertreten sein. Über Details werde man nun im parlamentarischen Verfahren reden müssen, sagte Kurth.
In der Debatte um das Rentenpaket II dringt die SPD darauf, es bis zum Jahresende zu verabschieden. Dafür haben sich sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Heil und die SPD-Bundestagsfraktion ausgesprochen. In der FDP gibt es demgegenüber einen offenen Dissens zwischen dem Parteivorsitzenden Lindner und seinem Stellvertreter Johannes Vogel. Vogel will die Aktienrente stärker machen und langfristig auch die Möglichkeit eröffnen, Rentenbeitragsgelder in Aktien anzulegen.
Berlin (epd). Die gesetzlichen Krankenkassen halten den Ansatz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Verbesserung der Herzgesundheit für ungeeignet. Dessen Entwurf für das sogenannte Gesunde-Herz-Gesetz lege den Schwerpunkt auf medizinische Behandlung, teilten die Krankenkassen gemeinsam am 24. September mit, dem von ihnen ausgerufenen GKV-Tag. Nötig sei aber vor allem mehr Primärprävention.
Bei der Vorbeugung von Krankheiten unterscheiden Fachleute zwischen verschiedenen Arten der Prävention. Primärprävention bezeichnet dabei die Verhinderung von Krankheiten oder Verletzungen, ehe sie eintreten. Hierzu zählen Aufklärungskampagnen, Gesundheitskurse oder Impfungen. Eine möglichst frühe Erkennung von Beeinträchtigungen - etwa durch Vorsorgeuntersuchungen - wird Sekundärprävention genannt, eine Verhinderung des Fortschreitens Tertiärprävention. Einige Fachleute ergänzen noch die Quartärprävention. Mit ihr ist die Verhinderung von Behandlungsfehlern gemeint.
Lauterbachs Gesetzentwurf stärke lediglich die Früherkennung, erklärten die Kassen, und lasse die Primärprävention außer Acht. Gemäß dem Entwurf solle sogar Geld, das die Krankenkassen derzeit für Primärprävention ausgeben, zur Ausweitung medizinischer Maßnahmen umgewidmet werden. Das sei inakzeptabel. Solle dies umgesetzt werden, müssten die Kassen ihre individuellen verhaltensbezogenen Primärprävention einschränken. „Konkret betroffen wären Maßnahmen wie Bewegungsangebote in Sportvereinen, Angebote zum Stress- und Ressourcenmanagement, zur gesunden Ernährung und Gewichtsreduktion, Kompaktangebote für pflegende Angehörige sowie auch digitale Präventionsangebote“, hieß es.
Die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbands, Carola Reimann, sagte, damit bewege sich die Gesundheitspolitik in eine völlig falsche Richtung. „Statt die Ursachen für die hohe Krankheitslast anzugehen, ist der Fokus aktuell viel zu sehr auf die Vorbeugemedizin gerichtet“, sagte sie. „Wir brauchen dringend Maßnahmen, um den Konsum von Tabak, Alkohol und ungesunden Lebensmitteln zu reduzieren und Bewegung zu fördern.“
Prävention sei aber nicht nur Aufgabe der Krankenkassen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, sagte Reimann: „Es lohnt sich, Maßnahmen wie Kinderschutz in der Lebensmittelwerbung endlich anzugehen, für gesundes Essen in Kitas und Schulen zu sorgen und bewegungsfreundliche Kommunen zu schaffen.“ Gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse seien der Schlüssel zu einer gesünderen Gesellschaft und einer geringeren Krankheitslast.
Die Kassen kritisierten weiter, der Gesetzentwurf schreibe Inhalt und Ausgestaltung neuer Früherkennungsuntersuchungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis ins Detail vor. Dies konterkariere den gesetzlichen Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen, die medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit aller Leistungen der Kassen zu prüfen. Auf alle Früherkennungsmaßnahmen, die anhand dieser Kriterien im Leistungskatalog der Kassen stehen, hätten die Versicherten bereits heute schon Anspruch.
München (epd). Die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB) lobt und kritisiert zugleich den Referentenentwurf für ein Pflegekompetenzgesetz. Der Entwurf zeige das Potenzial zu Aufwertung der Pflegeberufe, teilte die Vereinigung am 23. September in München mit. Zugleich sieht sie die Notwendigkeit deutlicher Verbesserungen.
Ein wichtiges Novum sei, dass Pflegefachpersonen künftig im Grundsatz heilkundlich tätig sein dürfen, hieß es vonseiten de VdPB. Bislang ist die Ausübung der Heilkunde rechtlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten. In der Praxis sorge das immer wieder für Probleme, weil Kompetenzen von Pflegenden auf dem Gebiet der Heilkunde nicht anerkannt würden. VdPB-Präsidentin Kathrin Weidenfelder gab jedoch zu bedenken, dass mit zusätzlichen Aufgaben und mehr Verantwortung der Personalbedarf absehbar steige.
Der Verband kritisierte, dass bei der Ausgestaltung der erweiterten heilkundlichen Leistungen die Pflegeberufe nicht vertreten seien. Es sei ihnen lediglich die Möglichkeit einer Stellungnahme eingeräumt. Offen lasse der Gesetzentwurf zudem, wer die Profession überhaupt vertreten könne. Im Entwurf sei die Rede von „maßgeblichen Organisationen“, ohne dafür Kriterien zu benennen.
Bonn (epd). Zum Internationalen Tag der älteren Menschen am 1. Oktober dringt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen auf eine umfassende Pflegereform. Dabei solle den Kommunen die Verantwortung für die Pflege und die Prävention von Pflegebedürftigkeit übertragen werden, teilte die Arbeitsgemeinschaft am Donnerstag in Bonn mit.
Den Kommunen komme als Lebensumfeld von Seniorinnen und Senioren entscheidende Bedeutung zu, hieß es. Zugleich bemängelte die Arbeitsgemeinschaft, dass seit Einführung der Pflegeversicherung die Planungs- und Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen unzureichend seien. Ziel müsse es sein, „Lebensorte zu fördern und zu entwickeln, in denen altengerechtes Wohnen und individuell ausgerichtete unterstützende Hilfsangebote zur Verfügung stehen und Teilhabe möglich ist“.
Die Arbeitsgemeinschaft betonte die Rolle der Prävention. Pflegebedürftigkeit entstehe meist aus chronischen Krankheiten. Folglich dürfe Lebensqualität nicht erst in den Blick genommen werden, wenn Betreuung und Pflege nötig werden.
Pflege muss laut den Forderungen der Seniorenorganisationen auch bezahlbar bleiben. Die Gemeinschaft argumentierte daher für die Begrenzung von Eigenanteilen durch den sogenannten Sockel-Spitze-Tausch. Dabei bezahlt ein pflegebedürftiger Mensch lediglich einen fixen Grundbetrag für seine Pflege, die Pflegekasse übernimmt den Rest. Derzeit ist es umgekehrt.

Berlin (epd). Die Caritas will bundesweit ihre Schuldnerberatung stärken. Dazu suchen katholische Sozialunternehmen gezielt ehrenamtliche Kräfte. Sie sollen gemeinsam mit den professionellen Sozialberaterinnen und Sozialberatern die Ratsuchenden unterstützen. Dies geschehe „in einer Zeit, in der immer mehr Menschen Hilfe bei drohender Überschuldung brauchen“, sagt die Präsidentin des Caritas-Bundesverbands, Eva Maria Welskop-Deffaa. Schulden könnten der Anfang eines bitteren Teufelskreises werden, den zu stoppen ohne Hilfe von außen nicht gelinge.
Bundesverbraucherministerin Steffi Lemke (Grüne) unterstützt den geplanten Ausbau der sozialen Schuldnerberatung. „Wir wollen die wertvolle Arbeit der Schuldnerberatung stärker und noch effizienter machen“, sagte die Ministerin. Dazu stellt ihr Haus rund zwei Millionen Euro für das Pilotprojekt „Engagiert in der Schuldnerberatung“ zur Verfügung, das eine systematische Einbindung freiwilliger Helferinnen und Helfer in die Arbeit der Schuldnerberatungsstellen zum Ziel hat. „Dabei begleiten ehrenamtliche Mitarbeiter überschuldete Menschen, damit sie dauerhaft ein Leben ohne Schulden führen können“, erklärte Lemke.
Die Beratungsstellen sind nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) überlastet. Die dichte Abfolge von Krisen wie der Corona-Pandemie, dem Ukrainekrieg sowie der starke Preisanstieg bei Energie und Lebensmitteln hätten die ohnehin schon hohe Nachfrage nach Schuldnerberatung noch einmal verstärkt.
„Der Bedarf nach Beratung steigt“, heißt es in einem Bericht der AG SBV vom Frühjahr 2023. Die AG vertritt etwa 1.400 gemeinnützige Schuldnerberatungsstellen in Deutschland, die sich in Trägerschaft der Verbraucher- und Wohlfahrtsverbände und der Kommunen befinden. Laut Statistischem Bundesamt suchen pro Jahr 600.000 finanziell in die Bredouille geratene Menschen Hilfe. Eine Erhebung der AG SBV unter den Einrichtungen kam zu dem Ergebnis: „In 68 Prozent der Beratungsstellen ist die Nachfrage abermals deutlich gestiegen.“ Vor allem hätten „deutlich mehr Erwerbstätige“ Rat gesucht. Die Nachfrage aus der Mitte der Gesellschaft steige, vermehrt kämen Menschen mit Wohneigentum in die Beratung.
Außerdem werde die Beratung zunehmend komplexer. Aufgrund des Andrangs müssten Bürger oft monatelang auf einen Termin warten - mit dramatischen Folgen für sie: „Es kann zu einer Verschärfung der Verschuldungssituation mit der Folge drohender oder eingetretener Überschuldung kommen“, schlägt der katholische Sozialverband Alarm.
In dieser Situation sollen nun in den Schuldnerberatungsstellen verstärkt ehrenamtlich tätige Menschen eingebunden werden. Die Freiwilligen sollen dabei keine Fachberatung übernehmen, sondern den Beratungsprozess unterstützen und flankieren. Im Unterschied zu anderen Aufgabenfeldern der Caritas sei in der Schuldnerberatung der Einsatz ehrenamtlicher Kräfte bisher „eher die Ausnahme“, teilte Christoph Langer vom Caritas-Bundesverband dem Evangelischen Pressedienst (epd) mit. Langer leitet bei dem Verband das Projekt „Engagiert in der Schuldnerberatung“.
Das von der Bundesregierung geförderte Projekt soll einen Impuls geben für einen möglichst flächendeckenden, gezielten Einsatz freiwillig Engagierter. „Im Projekt soll versucht werden, Ehrenamtliche mit Aufgaben zu betrauen, die rechtlich zulässig sind und denen die Ehrenamtlichen gewachsen sind. Die Rollen und jeweiligen Verantwortlichkeiten zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen sind klar geregelt. Es ist sichergestellt, dass Ehrenamtliche keine Fachberatung übernehmen“, erläutert Langer.
Zu den Aufgaben von Freiwilligen könne zum Beispiel die Begleitung zu Behörden und Finanzinstituten gehören. In Abstimmung mit professionellen Schuldnerberatern könnten außerdem Unterlagen vorsortiert werden. Ebenso könnten Freiwillige nach der professionellen Beratung Hilfestellungen geben, damit die Betroffenen nicht erneut in eine Überschuldungssituation geraten.
In einzelnen Schuldnerberatungsstellen arbeiten Haupt- und Ehrenamtliche laut Langer bereits eng zusammen. An die vorhandenen, aber bisher nicht umfassend aufbereiteten Erfahrungen und Berichte in der Arbeit mit freiwillig Engagierten knüpfe das Pilotprojekt an: „Diese Erfahrungen sollen systematisiert und zusammengeführt werden, um eine bundesweite konzeptionelle Weiterentwicklung zu erarbeiten. Es sollen ein Leitfaden sowie Module für die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung der freiwillig Engagierten entwickelt werden, die anderen Schuldnerberatungen als Vorlage dienen können“, heißt es.
Das Projekt „Engagiert in der Schuldnerberatung: Stärkung der sozialen Schuldnerberatung durch den Einsatz freiwillig Engagierter“ endet im November 2026. Die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt und die evangelische Diakonie sind mit insgesamt zehn Standorten in sieben Bundesländern daran beteiligt.

Frankfurt a. M. (epd). „Motherfucker“ ist im Jugendhaus Mosbach heute nicht mehr so oft zu hören wie noch vor wenigen Jahren. Als es Christine Günther zu viel wurde, „führten wir eine Schimpfwort-Kasse ein: Für jedes Schimpfwort, egal in welcher Sprache, musste man 50 Cent einwerfen“, erzählt sie. Nach sechs Monaten war die Kasse mit 70 Euro gefüllt. Christine Günther ist in der badischen Kreisstadt Mosbach für Offene Jugendarbeit zuständig.
Freitags ist das Jugendhaus in Mosbach bis 22 Uhr geöffnet. Dann trudeln bis zu 50 junge Leute zwischen 10 und 25 Jahren ein. Seit 34 Jahren ist Günther in der Jugendarbeit aktiv. Durch den jahrelangen, unmittelbaren Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist sie mit der aktuellen Jugendkultur bestens vertraut. Auch mit der Jugendsprache. Sie beobachte schon sehr lange, dass sich Jugendliche immer schlechter ausdrückten, sagt sie dem Evangelischen Pressedienst (epd).
Laut einer Mitteilung der Krankenkasse Barmer haben zunehmend mehr Kinder und Jugendliche sprachliche Defizite. Nach Daten des Barmer-Kinderatlas stieg von 2008 bis 2022 in jedem Jahr der Anteil der Jugendlichen mit ärztlich dokumentierten Sprachdefiziten. Waren es 2008 noch knapp 8,2 Prozent, sind es 2022 schon 13,6. Bei den Defiziten handele es sich um Schwierigkeiten mit der Wort- und Satzbildung sowie dem Verständnis von Gelesenem und Gesprochenem.
Sebastian Puglisi, Jugendtrainer eines Fußballvereins im unterfränkischen Lohr, macht ähnliche Beobachtungen. Als Sechsjähriger begann er, in dem Club zu kicken. Inzwischen ist er dort schon 33 Jahre aktiv. Puglisi nimmt wahr, dass die Jugendlichen einsilbiger geworden seien. Sehr oft erhalte er auf Fragen nur ein „Weiß nicht“, „Ja“ oder „Nein“. Er fürchtet, dass durch exzessives digitales Interagieren die direkte Kommunikation mit Menschen von Angesicht zu Angesicht ein Stück weit verloren geht. Auch werde in Familien seiner Fußballer weniger geredet als früher. „Gespräche finden oft nur noch zwischen Tür und Angel statt.“
Auch für Ann-Kathrin Gerst hat sich die Kommunikationsfähigkeit junger Leute verschlechtert. Die Familienrechtlerin engagiert sich ehrenamtlich beim Christlichen Verein Junger Männer (CVJM) im baden-württembergischen Winterbach. Als „Wirrwarr“ erlebe sie oft die Kommunikation in den Jugendgruppen. „Es fehlt zunehmend an Klarheit“, stellt sie fest. Das habe Folgen für gemeinsames Handeln, etwa einen Gruppenabend vorzubereiten. Was früher von den Teenagern selbst gestaltet worden sei, müssten heute oft die Leitungsteams übernehmen. Gerst fordert Kommunikationstrainings in Grundschulen- und Debattier-Clubs in weiterführenden Schulen.
Christine Günther sieht die Sozialen Medien als Treiber eines Sprachverfalls. In den Netzwerken drückten Teenager ihre Gefühle durch Emojis und Schlagwörter aus, beobachtet Günther. „Dabei geht die Sprache kaputt“, sagt sie. Für viele ihrer Jugendlichen sei es nicht mehr selbstverständlich, ganze Sätze zu bilden.
Sarah Brommer, Linguistikprofessorin an der Uni Bremen, widerspricht diesem Eindruck. Es gebe einen Unterschied zwischen dem sogenannten textorientierten und dem interaktionsorientierten Schreiben. Ersteres sei das klassische, in der Schule gelernte Schreiben, letzteres die Kommunikation beispielsweise durch Emojis oder Kürzel. Dabei gehe es darum, Emotionen auszudrücken und im Dialog mit anderen zu sein. „Es gibt in den Studien keine Korrelation zwischen den Fähigkeiten zum text- und zum interaktionsorientierten Schreiben“, sagt sie. Soll heißen: Jugendliche beherrschen in der Regel beides. Sie sei noch auf keine Studie gestoßen, die belege, dass Mediennutzung schlecht für die sprachliche Kompetenz sei, auch weil sich deren Einfluss angesichts anderer, nicht ausschließbarer Faktoren kaum nachweisen lasse.
Leichte Sprache, eigentlich entwickelt für Menschen mit Leseschwäche, „hält nun auch bei uns Einzug“, berichtet Christine Günther. Gestaltet sie etwa einen Flyer, dann verwendet sie so wenige Wörter wie möglich: „Steht zu viel drauf, steigen unsere Jugendlichen aus.“ Das betreffe vor allem die Besucher von Jugendzentren. Hier verkehrten eher selten Gymnasiasten. Wer aufs Gymnasium geht, lerne nach wie vor, sich gut auszudrücken: „Ich würde mir wünschen, dass in allen Schulen Sprache und Sprechen wieder nähergebracht würden.“
Das sei in der Tat ein Punkt, bestätigt Brommer, liege aber nicht an der Schule, sondern am sozialen Hintergrund von Gymnasiasten. „Bildung und damit die Sprache hängt vom sozioökonomischen Status des Elternhauses ab“, sagt die Forscherin. Das ist auch durch vergleichende Studien belegt. Wenn sich die soziale Schere öffne, dann sei erwartbar, dass sich auch Sprachkompetenz zunehmend ungleich in der Gesellschaft verteile.
Aber in der Tat werde heute in der Schule heute weniger Wert auf das Pauken von Regeln gelegt, sagt Brommer. Denn heute gehe es mehr um Argumentationsfähigkeit. Tatsächlich belegt schon eine Studie aus den 1990er Jahren, dass Abiturarbeiten in den 1980er Jahren formal noch fehlerfreier, aber inhaltlich dürftiger gewesen sind als später. „Die Texte - und entsprechend würde ich das auf sprachliche Kompetenzen allgemein übertragen - haben sich also verändert, aber man kann nicht sagen, dass sie schlechter geworden sind“, erklärt Brommer.
Der österreichische Jugendkulturforscher Bernhard Heinzlmaier vertritt die Auffassung, dass der abnehmende Wortschatz bei Jugendlichen „zweifellos“ auf den medienkulturellen Wandel zurückzuführen sei: „Die Sprache wird einfach, sie reduziert sich auf Schlagworte und Sprachpartikel aus der Popkultur.“ Auch er sagt, dass Jugendliche es verlernten, ohne mediale Vermittlung zu kommunizieren, also „direkt und unmittelbar“. Medien als Sozialisationsinstanz hätten an Bedeutung gewonnen, während Politik, Schule, Vereine oder Religion verloren haben.
Das sei aber nicht nur schlecht, sagt Heinzlmaier. Es sei ja so, dass junge Leute heute mehr denn je kommunizierten, auch über Medien: „Sie kommunizieren nur eben anders.“ Ihre Fähigkeiten zur Bildkommunikation und -interpretation seien besser als die vorangegangener Generationen. Junge Leute könnten auch problemlos Informationen aus mehreren Kanälen gleichzeitig verarbeiten. Das sei schlicht eine Anpassung auf eine sich veränderte Medienwelt, in der diese Fähigkeiten gebraucht würden.
Es sei natürlich nachvollziehbar, dass die klassischen Bildungsvermittler wie Schulen oder Vereine vor allem den Verlust an Sprachkompetenz wahrnähmen, erklärt Heinzlmaier. „Deren Aufgabe ist ja nun mal die Vermittlung der klassischen Kompetenzen.“ Aber Fortschritt ohne Verlust sei nicht denkbar.
Auch Brommer sieht keinen Grund zum Alarmismus. Die Digitalisierung habe dafür gesorgt, dass Sprachwelten heute vielfältiger sind. Damit hätten sich die sprachlichen Anforderungen, denen Jugendliche begegnen müssen, stark verändert. „Denn sie leben heute in sehr unterschiedlichen Sprachwelten, und machen ihre Kommunikation notwendigerweise abhängig vom konkreten Kontext“, sagt sie. „Wenn ich mehr Zeit für den Erwerb von bestimmten Kompetenzen investiere, muss die Zeit für den Erwerb anderer Kompetenzen doch notwendigerweise abnehmen“, sagt sie. Sprache habe sich schon immer gewandelt, und das müsse sie auch tun, um zu funktionieren: „Sie muss sich nun mal den gesellschaftlichen Gegebenheiten anpassen.“

Bremen (epd). Es geht schon auf Mitternacht zu. Frau M. wacht plötzlich auf, weil sie keine Luft mehr bekommt. Ihr Ehemann liegt neben ihr, fragt, was denn los sei. Im nächsten Moment sackt die 78-Jährige auch schon zusammen. Ihr Mann wählt den Notruf. Noch am Telefon wird er zur Reanimation angeleitet, während sich Sanitäter und Notarzt mit Blaulicht und Sirene sofort auf den Weg machen. Im Schlafzimmer des Ehepaares angekommen - 1. Stock, Reihenhaus - übernehmen sie. Doch ohne Erfolg, Herz-Kreislauf-Versagen: Frau M. stirbt in dieser Nacht.
In solchen existenziellen Krisensituationen kommen Notfallseelsorger wie der Bremer evangelische Pfarrer Uwe Köster zum Einsatz, der Herrn M. begleitet hat und von den Ereignissen jener Nacht berichtet. Vorsichtig habe er Herrn M. gefragt, ob er erzählen könne, was er gerade erlebt habe. Der Mann, Anfang 80 und gehbehindert, habe zögerlich begonnen zu sprechen: Das könne doch alles nicht wahr sein. Seine Frau sei doch immer die Fittere von ihnen gewesen und außerdem fast fünf Jahre jünger.
Schlaganfall, Herzinfarkt, manchmal auch ein Suizid: Der plötzliche Tod eines Angehörigen in der eigenen Wohnung ist meistens der Grund, wenn Mitarbeitende der ökumenischen Notfallseelsorge in Deutschland alarmiert werden. Viele sprechen „von der stillen Katastrophe im ersten Stock“. Die Pastorinnen und Pastoren werden dann von Feuerwehr oder Polizei verständigt, um Menschen wie Herrn M. beizustehen.
„In solchen Situationen stürzt für die Betroffenen alles zusammen. Das löst Angst, Verzweiflung und Ohnmachtsgefühle aus“, verdeutlicht Köster: „Unsere Aufgabe ist es dann, durch das Chaos zu leiten.“ Gemeinsam werde geprüft, wer helfen könne. „Dazu gehört das soziale Netz mit Geschwistern, Nachbarn, Angehörigen und Freunden.“
Die Notfallseelsorge wird auch gerufen, wenn beispielsweise nach einem Unfall eine Todesnachricht überbracht werden muss. Und es gibt sogenannte Großschadenslagen, bei denen Begleitung gefragt ist: das Zugunglück in Eschede 1998 etwa, die Explosion eines Altenheims vor 24 Jahren in Bremen, der Amoklauf an einer Schule in Winnenden 2009, der Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin 2016, die Messerattacke kürzlich in Solingen.
„Wir gehen hin, wir sind da, wir halten mit aus“, so beschreibt es der bayerische Kirchenrat Dirk Wollenweber, Vorstandsvorsitzender der Konferenz der Notfallseelsorge in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). In Bremen geschieht das seit nunmehr 25 Jahren, bundesweit bemühen sich seit den 1990er Jahren Einsatzkräfte aus Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei, noch an der Einsatzstelle Seelsorgerinnen und Seelsorger zu verständigen, damit sie Hinterbliebenen beistehen.
„Seit der Gründung sind wir in Bremen etwa 3.000 Mal von Polizei und Feuerwehr alarmiert worden“, blickt Köster zurück. Bundesweit waren es nach Angaben von Wollenweber alleine im vergangenen Jahr knapp 26.000 Einsätze, Tendenz steigend. Fast 7.000 Mitarbeitende begleiteten Hinterbliebene, Opfer, Angehörige, Zeugen, Überlebende und Ersthelfer.
Die Bedürfnisse sind dabei so unterschiedlich wie die Menschen selbst: Die einen wollen reden, manche ohne Punkt und Komma. Andere weinen, klagen, schweigen. Das Zuhören gehört dann zu den wichtigsten Kompetenzen eines Notfallseelsorgers oder einer Notfallseelsorgerin. Genau wie eine gewisse Distanz zum Leid des anderen. „Das heißt nicht, dass ich nicht empathisch bin“, sagt Wollenweber. „Aber es gibt einen Unterschied zwischen Mit-Leiden und Mit-Gehen.“
Besonders belastend seien Einsätze, in denen es um Kinder gehe, etwa bei einem plötzlichen Kindstod, oder bei denen Gewaltdelikte eine Rolle spielten, sagt Köster, der auch als Polizeiseelsorger arbeitet. „Das trifft auch zu, wenn die sozio-ökonomische Lage der Betroffenen schwierig ist, Menschen vereinsamt oder gehandicapt sind oder kein soziales Netz existiert.“
Wie die Begleitung aussieht, bestimmen Köster zufolge immer die Betroffenen. Er erinnert sich an Herrn M., dem irgendwann Tränen die Wangen hinunterliefen. „Ich habe den Eindruck, dass er beginnt, die Situation stückweise zu realisieren“, formuliert der Seelsorger in seiner Fallskizze.
Als die Einsatzkräfte schließlich das Haus verlassen, bleibt Köster bei ihm. Darum habe ihn der Mann gebeten. Bald soll sein Sohn kommen, der auch tatsächlich kurze Zeit später im Elternhaus eintrifft. Gemeinsam mit Pastor Köster gehen sie die Treppe hoch zur Mutter in den ersten Stock, wo Ehemann und Sohn von der Verstorbenen Abschied nehmen.
Frankfurt a.M. (epd). Die Notfallseelsorge ist Teil der sogenannten Psychosozialen Notfallversorgung. Neben der kirchlichen Notfallseelsorge gibt es auch Angebote von Vereinen und Hilfsorganisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund, die „Kriseninterventionsteams“ genannt werden. Bei der Psychosozialen Notfallversorgung unterscheidet man zwischen Angeboten für Betroffene und für belastete Einsatzkräfte.
Sowohl die Kirchen als auch säkulare Organisationen haben hauptamtliche Kräfte für die Psychosoziale Notfallversorgung, bauen aber überwiegend auf Ehrenamtliche. Im internationalen Vergleich hat dieses deutsche System Vorteile, aber auch gravierende Nachteile. Andere Länder, etwa Japan oder Australien, setzen bei Katastrophenlagen auf „mental health disaster nurses“, Pflegekräfte mit einer psychologischen oder psychiatrischen Zusatzausbildung. Sie arbeiten meist auf einem einheitlichen Standard, während bei Ehrenamtlichen die fachliche Qualität schwanken kann.
Die Forschung bewertet professionelle Kräfte bei großen Schadensereignissen als vielseitiger als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. „Disaster nurses“ unterstützen nicht nur auf der psychosozialen Ebene, sondern leisten oder koordinieren auch pflegerische Maßnahmen, lösen organisatorische Probleme und haben das klinische Bild von Patienten im Blick. Letzteres ist besonders wichtig, da manche Verletzungssymptome sich erst im Laufe der Zeit herausbilden können, etwa bei einem Schädel-Hirn-Trauma. „Disaster nurses“ können solche sich entwickelnden Symptome erkennen, Ehrenamtliche in der Regel nicht.
Die Stärken des deutschen, auf Ehrenamt aufbauenden Systems liegen hingegen im Einsatzalltag, etwa bei der Überbringung von Todesnachrichten oder bei der Betreuung von Angehörigen nach plötzlichen Todesfällen. Dadurch, dass solche Fälle häufiger vorkommen als große Schadenslagen, sind die Ehrenamtlichen in der täglichen Einsatzpraxis gut trainiert.
Bei der psychosozialen Unterstützung von Einsatzkräften ist von Vorteil, dass die Ehrenamtlichen die betroffenen Einsatzkräfte oft schon kennen und so leichter einen Zugang zu ihnen finden können.

Regensburg (epd). Seelische und emotionale Nöte können in der Altersgruppe über 60 Jahre unterschiedlich aussehen: Einsamkeit, Sinnsuche, Ängste und Depressionen. Im Umgang mit den Betroffenen gibt es jedoch häufig Unsicherheit, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Bei Erste-Hilfe-Kursen für psychische Notlagen werden derzeit in ganz Bayern Herangehensweisen gezeigt, um diesen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen. Gefördert wird das Projekt vom bayerischen Gesundheitsministerium. Der Regensburger Mediziner Jakob Klein hält solche Kurse und begleitet sie wissenschaftlich. Die Fragen stellte Gabriele Ingenthron.
epd sozial: Herr Klein, kann man Ihr Seminar mit einem Erste-Hilfe-Kurs vergleichen, wie man ihn beispielsweise vom Roten Kreuz kennt?
Jakob Klein: Genau. Wie man beim Erste-Hilfe-Kurs beispielsweise das Reanimieren bei Kreislaufstillstand lernt, möchten wir bei seelischen Nöten und Krisen die Teilnehmenden sensibilisieren und stärken - mit unserer konkreten Handlungskette „Hinschauen, Sprechen, Netzwerken“ oder auch HSN genannt. Der Ansatz ist emotionsbasiert: Vor allem Trauer, Ärger und Angst sind hoch assoziiert mit seelischen Nöten. Wir versuchen herauszuarbeiten, wo uns diese Nöte begegnen, welche Grundemotion ihnen zugrunde liegt, wenn ich zur Person und Situation schaue, aber immer auch zu mir selbst als dem Ersthelfenden. Im nächsten Schritt geht es darum, wie man die Person ansprechen und herausfinden kann, was sie braucht. Zu betonen ist, dass wir keine Therapeuten ausbilden, deswegen ist das Netzwerken auch so wichtig. Es gibt viele Fälle im Alltag, die man selber klären kann, aber in manchen Fällen braucht man professionelle Hilfe.
epd: Welche Krankheitsbilder lernt man in dem Kurs kennen?
Klein: Wir haben am Anfang des Kurses eine Aufstellung, in der man verschiedene Szenarien durchspielt, damit man sich der Vielfalt und Individualität einer seelischen Not bewusst wird. Im Laufe des Kurses wird eine ganze Bandbreite zusammen mit den Teilnehmenden interaktiv erarbeitet. Das muss nicht immer der psychiatrische Notfall oder die Suizidalität sein. Es geht um einen individuellen Leidensdruck. Von außen kann man schlecht sagen, was schlimm ist und was nicht. Wenn eine Person es für sich als seelische Krise wahrnimmt, dann ist das so und dem muss Raum gegeben werden. Die soziale Kompetenz, dabei zu helfen, haben wir alle. Wir möchten das bestärken und den Helfercharakter betonen, damit man sich auch traut. Wir klären aber auch auf über Suizidalität. Viele Menschen trauen sich nicht, das anzusprechen, weil sie glauben, dass ihr Gegenüber dann erst recht auf „dumme Gedanken“ käme - was aber nicht der Fall ist. Die meisten Leute kündigen es an, bevor sie sich das Leben nehmen. Die Warnsignale wahrzunehmen, ist sehr wichtig.
epd: Warum bieten Sie den Kurs für über 60-Jährige an?
Klein: Wir wollen den Ersthelfer-Charakter herausstellen. Zusätzlich wollen wir auch herausarbeiten, welche seelischen Nöte in dieser Altersgruppe besonders vorkommen: Einsamkeit, Altersarmut, erhöhte Suizidalität, Multimorbidität, die sich im Alter zeigt. Meine Erwartung ist, dass das mehr aufkommt in einem Kurs, der sich auf diese Altersgruppe bezieht. Das schließt ja nicht aus, dass Teilnehmende der Ü60-Kurse unsere Handlungskette „Hinschauen, Sprechen, Netzwerken“ genauso für ihre Enkelkinder anwenden können, sollte es diesen einmal schlecht gehen.

Berlin (epd). Carlos ist schon zum wiederholten Mal hier. Mit seinem weißen Sweatshirt, schwarzen Shorts und einem Rollkoffer sieht der 41-Jährige eher wie ein Tourist aus, der sich in der Adresse geirrt hat. Bei strahlendem Sonnenschein steht Carlos am frühen Vormittag auf dem Gelände der Berliner Stadtmission unweit des Berliner Hauptbahnhofs. Vor der Wäscherei für obdachlose Menschen (WoM) haben sich schon zwei Schlangen gebildet: Frauen stehen links, Männer rechts vor dem niedrigen Flachbau. Seit einigen Monaten bietet die Stadtmission diesen Service.
„Annehmen, sortieren, verteilen, waschen, trocknen, danach kurz zusammenlegen“: Jürgen Bartz ist der Chef der Wäscherei. In dem ehemaligen Lagerraum für die Gärtnerei dirigiert der 58-Jährige vier kleine und eine große Waschmaschine sowie zwei Trockner. Ein Waschgang dauert 47 Minuten, die Trocknung bis zu 30 Minuten. Das macht fünf bis sieben Waschgänge pro Tag und Maschine, rechnet Bartz vor. Neben Waschmittel kommt Hygienereiniger oder Fleckenspray zum Einsatz, bei Bedarf auch flüssiges Desinfektionsmittel.
Bartz hat früher als Haushandwerker eines Hotels gearbeitet. „Was mir am meisten gefällt ist, dass wir jeden Tag mit vielen, vielen Menschen zu tun haben. Das ist was fürs Herz“, sagt er und lacht. Unterstützt wird Bartz von freiwilligen Helfern, zu erkennen an ihren hellgrünen „Volunteer“-Westen. Sie helfen unter anderem beim Sortieren der schmutzigen Kleider in Waschsäcke, damit nichts vertauscht wird. Andere führen auf einem Tablet die Anmeldeliste.
Carlos ist jetzt an der Reihe. Er öffnet seinen prall gefüllten Rollkoffer und die Wäsche wandert in die Hände von Bartz und seinen Helfern. Die vergangenen zwei Wochen habe er in einer Notübernachtung in der Frankfurter Allee im Stadtteil Friedrichshain geschlafen, erzählt der aus den USA stammende Mann. Ursprünglich sei er wegen seiner Freundin nach Berlin gekommen. Jetzt sind sie getrennt und er ist auf Unterstützung durch seine Eltern angewiesen. Er will wieder in seine Heimat zurückkehren. Dann erzählt er noch, dass er demnächst auf Englisch ein Buch mit dem Titel „Armut bekämpfen“ veröffentlichen werde. Er warte noch auf Antwort und auf einen Vorschuss des Verlags.
Zwei Euro pro Waschgang und Trocknen kostet das Angebot. „Es ist wichtig, dass jeder sieht, dass es Kosten verursacht“, sagt Jeanette Engelke vom Inklusionsunternehmen „Komm & Sieh“ der Stadtmission. Gesponsert wurden zu Beginn die Maschinen - für die laufenden Kosten für Wasser, Strom und Waschmittel werden noch Unterstützer gesucht. Die Wäscherei werde dankbar angenommen, sagte Engelke: „Die, die die Wäsche waschen lassen, sind auf einem guten Weg.“ Die Stadtmission wirbt auf Flyern in sieben Sprachen für ihr Angebot.
Während sich die Trommeln drehen, bietet eine Seelsorgerin Gespräche an. Es gehe darum, obdachlosen Menschen „Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Lebenslage verbessern können“, sagt Stadtmissionsdirektor Christian Ceconi. Dafür bietet das weite Areal der Stadtmission an der Lehrter Straße viele stille Ecken.
Direkt neben der Wäscherei befindet sich die Kleiderkammer der Berliner Stadtmission. Bis zu 180 Gäste werden hier pro Tag gezählt, berichtet Engelke. Aktuell sind viele Regale leer geräumt. Benötigt werden gerade etwa Turnschuhe in allen Größen und Schlafsäcke, im Sommer noch öfter als im Winter, heißt es.
Die Freiwilligen achten darauf, dass es zu keinen Hamstereien kommt. Die Regeln sind streng: Beispielsweise gibt es ein Paar Schuhe nur alle 14 Tage, einen Schlafsack einmal im Monat. Die Kleiderkammer ist angewiesen auf Sachspenden.
Auch wer auf seine gewaschene Wäsche wartet, wird vorübergehend aus der Kleiderkammer eingekleidet. Dafür stehen eine improvisierte Umkleidekabine und die Helfer bereit. Sie bringen etwas in der passenden Größe. Carlos nutzt die Wartezeit für einen Spaziergang. Er fühlt sich sichtbar wohler abseits der vielen wartenden Menschen vor dem Gebäude der Stadtmission.

Essen (epd). Die Sozialhilfe muss den Wunsch mittelloser Eheleute nach einer Bestattung in einem nebeneinanderliegenden Grab achten. Haben die Eheleute zu Lebzeiten ausdrücklich die Bestattung in einem gemeinsamen oder nebeneinanderliegenden Grab gewünscht, gebietet es der im Grundgesetz verankerte Schutz von Ehe und Familie, dass der Sozialhilfeträger die angemessenen Bestattungskosten als erforderlich ansieht und diese übernimmt, entschied das Landessozialgericht (LSG) Nordrhein-Westfalen in einem am 18. September veröffentlichten Urteil. Die Essener Richter ließen wegen der grundsätzlichen Bedeutung die Revision zum Bundessozialgericht (BSG) in Kassel zu.
Die Klägerin bezog zusammen mit ihrem Ehemann Sozialhilfeleistungen. Als dieser starb, beantragte die Witwe beim zuständigen Sozialhilfeträger die Übernahme der angemessenen Bestattungskosten. Da der Verstorbene Jude war, sollte er auf einem jüdischen Friedhof bestattet werden. Der Sozialhilfeträger erklärte sich bereit, 2.600 Euro für die Bestattung auf dem jüdischen Friedhof zu übernehmen. Diesen Pauschalpreis für Sozialhilfebezieher hatte die Behörde mit der jüdischen Gemeinde ausgehandelt.
Die Witwe ließ ihren verstorbenen Mann jedoch auf dem sogenannten Mischehenfeld des Friedhofs bestatten und reservierte für sich selbst eine Nachbargrabstätte. Ihr jüdischer Ehemann habe bereits zu Lebzeiten den Wunsch geäußert, dass sie beide später nebeneinander bestattet werden sollten. Da sie Nichtjüdin sei, sei eine nebeneinanderliegende Grabstätte auf dem regulären jüdischen Gräberfeld im Gegensatz zum Mischehenfeld nicht möglich.
Der vom Sozialhilfeträger ausgehandelte Pauschalpreis für die Bestattung auf dem jüdischen Friedhof galt jedoch nicht für das Mischehenfeld. Die Kosten für die Bestattung des Ehemannes beliefen sich auf 6.114 Euro. Davon sah der Sozialhilfeträger nur 3.514 Euro als angemessen an, nämlich 2.600 Euro für die Bestattung sowie weitere Kosten für den Bestatter und den Totenschein. Der Ehemann hätte billiger auf dem regulären jüdischen Friedhof bestattet werden können, so die Behörde. Auch wenn das Paar fast 50 Jahre miteinander verheiratet gewesen sei, begründe dies keinen Anspruch auf ein nebeneinanderliegendes Grab.
Das LSG urteilte, dass der Sozialhilfeträger der Klägerin unter Anrechnung des Nachlasses weitere 1.300 Euro für die Bestattung des Ehemannes zahlen muss. Eheleute könnten verlangen, nebeneinander bestattet zu werden. Dies müsse aber zu Lebzeiten ausdrücklich gewünscht worden sein. Ehe und Familie seien durch das Grundgesetz besonders geschützt. Das gelte auch über den Tod hinaus.
Nach einem Urteil des LSG Baden-Württemberg dürfen Hinterbliebene ohne eigene Einkünfte aber nicht darauf vertrauen, dass die Sozialhilfe automatisch alle anfallenden Kosten übernimmt. Ist auf der Grabstätte ein einfaches, lackiertes Holzkreuz ortsüblich, kann der Angehörige auch nur dieses auf Kosten der Sozialhilfe verlangen, heißt es in der Entscheidung vom 13. April 2022.
Das BSG hatte am 25. August 2011 geurteilt, dass der Sozialhilfeträger mittellosen Hinterbliebenen nur die Kosten erstatten muss, die unmittelbar mit der Bestattung zusammenhängen, sowie die Kosten, die mit der Durchführung der Bestattung untrennbar verbunden sind. Todesanzeigen, Leichenschmaus, Anreisekosten oder Bekleidung gehören demnach nicht dazu.
Im Einzelfall kann es aber auch für bestattungspflichtige Hinterbliebene, die keine Sozialhilfe beziehen, unzumutbar sein, die Bestattungskosten zu tragen. Könne jemand die fälligen Bestattungsrechnungen wegen fehlender Einkünfte oder fehlenden Vermögens nicht im Monat der Fälligkeit bezahlen, müsse der Sozialhilfeträger noch nicht gleich einspringen, urteilte das BSG am 5. April 2019. Die Behörde dürfe aber auch nicht pauschal darauf verweisen, dass die Angehörigen die Kosten über einen Zeitraum von mehreren Monaten abstottern könnten. Dann sei die Kostenübernahme für eine Sozialbestattung möglich. Die Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Bestattung sei aber zumutbar, vorausgesetzt, die Bank spielt mit.
Az.: L 9 SO 49/23 (Landessozialgericht Essen)
Az.: L 2 SO 1679/19 (Landessozialgericht Stuttgart)
Az.: B 8 SO 20/10 R (Bundessozialgericht zu unmittelbar zusammenhängende Bestattungskosten)
Az.: B 8 SO 10/18 R (Bundessozialgericht zu Ratenzahlung bei Bestattungskosten)
Kassel (epd). Gehbehinderten Heimbewohnern steht bei einem Anspruch auf Hilfe zur Pflege auch eine kostenfreie Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr zu. Wie das Bundessozialgericht am 19. September in Kassel entschied, gilt dies auch dann, wenn ein erheblich gehbehinderter Heimbewohner seinen Lebensunterhalt aus seinem eigenen Einkommen begleichen kann, für die Heimkosten aber auf Hilfe zur Pflege vom Sozialhilfeträger angewiesen ist.
Geklagt hatte eine 84-jährige Frau mit einer erheblichen Gehbehinderung. Die Frau, die in einem Pflegeheim im Raum Braunschweig lebt, kann ihren Lebensunterhalt aus ihrer Rente und ihrem Ehegattenunterhalt selbst bestreiten. Um die Pflegeheimkosten bezahlen zu können, ist sie aber auf „Hilfe zur Pflege“ vom Sozialhilfeträger angewiesen.
Im Juli 2021 beantragte sie bei der zuständigen Versorgungsbehörde die Ausstellung einer Wertmarke zur unentgeltlichen Beförderung im öffentlichen Personennahverkehr. Der Antrag wurde abgelehnt. Nur erheblich gehbehinderte Personen, die reguläre Sozialhilfeleistungen beziehen, könnten eine unentgeltliche Beförderung im Personennahverkehr verlangen, nicht aber Personen, die allein Hilfe zur Pflege erhalten, so die Behörde.
Doch auch schwer- und erheblich gehbehinderte Heimbewohner, die nur Hilfe zur Pflege erhalten, können die kostenfreie Beförderung beanspruchen, urteilte das Bundessozialgericht. Es gebe keinen sachlichen Grund, warum Heimbewohner, die allein Hilfe zur Pflege erhalten, von dem Anspruch ausgeschlossen sein sollen.
Az: B 9 SB 2/23 R
Stuttgart (epd). Eine Frau muss nach einer vorgebrachten Vergewaltigung durch ihren Partner und der Flucht aus ihrer Wohnung in ein Frauenhaus ihre Möbel und andere private Gegenstände irgendwo unterbringen können. In solch einem Fall kann daher das Jobcenter verpflichtet sein, die Kosten für die Miete eines Containers zu übernehmen, entschied das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg in Stuttgart in einem am 13. September veröffentlichten Beschluss.
Im konkreten Fall ist die Antragstellerin am 1. Dezember 2023 aus ihrer Wohnung in ein Frauenhaus geflohen. Als Grund gab sie eine Vergewaltigung durch ihren Mitbewohner an. Möbel, Geschirr, Kleidung sowie Bücher und Unterlagen lagerte sie zwischenzeitlich in einem angemieteten Container. Für die Kosten in Höhe von monatlich 350 Euro erhielt sie von ihrer Schwester ein Darlehen. Sie beantragte beim Jobcenter die Übernahme der Kosten für die Containermiete sowie für weitere Aufwendungen wie für den Transport der Möbel und eine Kaution für das Frauenhaus. Auch ein Darlehen hatte sie für ihren Neustart beantragt.
Das Jobcenter lehnte die Übernahme der Kosten ab. Aber das LSG gab ihren Antrag auf einstweilige Anordnung teilweise statt. Das Jobcenter sei zumindest vorläufig verpflichtet, der Antragstellerin längstens bis zur Entscheidung in der Hauptsache die Miete des Containers in Höhe von 350 Euro monatlich zu übernehmen. Da jedoch erst jetzt die finanziellen Verhältnisse der Antragstellerin geklärt seien, könne sie erst ab Mai 2024 die Containermiete vom Jobcenter verlangen.
Allerdings stünden ihr die anderen im Eilrechtsschutzverfahren verlangten Leistungen nicht zu. So fehle es etwa an einer Quittung für den Transportunternehmer. Auch die anderen begehrten Leistungen seien für den Anordnungsanspruch nicht hinreichend glaubhaft gemacht worden.
Az.: L 2 AS 1158/24 ER-B
Köln (epd). Das von einer Pflegekraft erlaubte, unbeaufsichtigte Duschen eines suizidgefährdeten Patienten muss noch keinen entschädigungspflichtigen Behandlungsfehler darstellen, wenn sich der Patient dann selbst tötet. Weder ist damit nachgewiesen, dass das ohne Aufsicht durchgeführte Duschen Ursache für den Suizid ist, noch gibt es in den maßgeblichen Leitlinien klare Aussagen, dass bei suizidgefährdeten Patienten wegen des Duschens immer zunächst Rücksprache mit einem Arzt gehalten werden muss, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Köln in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 21. August 2024.
Im konkreten Fall ging es um einen Patienten, der 2019 im Keller seines Hauses in suizidaler Absicht 1,4 Liter Kräuterlikör und rund 50 Tabletten eines Betablockers zu sich genommen hatte. Nachdem er in ein Uniklinikum kam, sagte er, dass er sich tatsächlich nicht habe umbringen wollen. Er wurde mit der Empfehlung entlassen, sich in einer offenen psychiatrischen Station behandeln zu lassen. Im Gespräch mit seiner Ehefrau bestätigte er allerdings seine Suizidgedanken und -pläne. Seine Frau überredete ihn, sich freiwillig erneut auf die Akutstation einer geschlossenen psychiatrischen Klinik zu begeben. Dort willigte der Mann in die ständige Beobachtung durch das Pflegepersonal ein.
Am Morgen des 5. Juni 2019 fragte er einen erfahrenen Pfleger, ob er unbeaufsichtigt duschen dürfe. Er zeigte sich freundlich und absprachefähig und distanzierte sich auf Nachfrage von akuter Suizidalität. Die Pflegekraft gab ihm die Erlaubnis, auch um ein Vertrauensverhältnis zu dem Patienten aufbauen zu können. Doch dann wurde der Mann etwas später tot in der Dusche aufgefunden. Er hatte sich mit dem Duschschlauch stranguliert.
Die Ehefrau und die beiden Söhne des Mannes verlangten daraufhin mindestens 10.000 Euro Schmerzensgeld, die Erstattung der Beerdigungskosten sowie den Ersatz des Unterhaltsschadens in Form einer monatlichen Geldrente. Die Pflegekraft hätte ohne vorherige Rücksprache mit dem Arzt das unbeaufsichtigte Duschen nicht erlauben dürfen. Dies stelle einen entschädigungspflichtigen Behandlungsfehler dar.
Das OLG wies die Klage ab. Zwar stelle die unterlassene Hinzuziehung eines Arztes durch die Pflegekraft einen einfachen Behandlungsfehler dar. Die Kläger hätten aber nicht bewiesen, dass die Erlaubnis zum unbeaufsichtigten Duschen ohne vorherige ärztliche Untersuchung ursächlich für den Suizid gewesen sei. Es sei möglich, dass der Entschluss zum Suizid erst spontan beim Duschen gefasst worden sei. Zudem habe der Sachverständige ausgeführt, dass ein Arzt das unbeaufsichtigte Duschen wohl ebenfalls erlaubt hätte. Es gebe auch keine konkreten Aussagen in den Leitlinien, wie in solch einem Fall vorzugehen sei. Vorhersehbar sei der Suizid nicht gewesen, da der Patient auch Pläne für die Zukunft geschmiedet habe.
Az.: 5 U 127/23

Köln (epd). Peter Krücker hat sich als Vorstandssprecher des Caritasverbands für die Stadt Köln verabschiedet. Der 65-Jährige geht Ende September in den Ruhestand. Er sei „dankbar für die täglichen Dinge, die wir mit über 2.000 Mitarbeitenden in der Caritas Köln für über 60.000 Menschen in Köln bewirken“, sagte Krücker bei seinem Abschied. „Mein Herz schlägt für die Caritas und wird es auch weiter tun. Ich habe immer den Sinn meiner Arbeit gespürt.“
Krücker war über mehrere Jahrzehnte in sozialen Arbeitsfeldern in Köln aktiv. 1993 stieß der Diplom-Sozialarbeiter zur Caritas, davor war er beim Kölner Jugendamt. 2001 wurde er stellvertretender Caritas-Direktor, ab 2006 gehörte er zum hauptamtlichen Vorstand. Seit 2011 war er Vorstandssprecher. Zudem vertrat er die Caritas im Jugendhilfe- und Sozialausschuss der Domstadt, war Vorsitzender der ausländerrechtlichen Härtefallkommission und im Beirat der ARGE Köln. Auf Bundes- und Landesebene war er Sprecher der Caritas-Ortsverbände in Nordrhein-Westfalen.
Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, Eva Maria Welskop-Deffaa, würdigte Krücker bei seiner Verabschiedung als Motor, „der immer wieder einlädt zur Zusammenarbeit für unsere gemeinsame gute Sache und unsere Grundwerte“. Sie zeichnete Krücker mit der höchsten Auszeichnung des Caritasverbands aus, dem Brotteller. Die parteilose Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bezeichnete Krücker als „glaubwürdigen und authentischen Vertreter der katholischen Soziallehre“. Er habe dem Ziel eines sozialen Köln stets Vorrang eingeräumt und habe Missstände in der Stadt immer klar benannt.
Auch bei seiner Verabschiedung sprach Krücker Missstände an. Es sei bekannt, dass die sozialen Angebote den Bedarf bei weitem nicht deckten. „Die Caritas und die Wohlfahrtsverbände insgesamt brauchen eine sichere und gerechte Finanzierung ihrer Arbeit durch Kassen, öffentliche Hand und Kirche, um auch in Zukunft bedürftige Menschen unterstützen zu können“, mahnte er. „Die aktuell erneut drohenden Kürzungen sind hier absolut kontraproduktiv, gefährden den sozialen Frieden und spielen Demokratiegegnern in die Karten.“
Auf Krücker als Vorstandsprecher folgt Markus Peters, der derzeit noch Vorstandssprecher des Sozialdiensts Katholischer Männer Köln ist. Ab dem 1. Oktober bildet der 48-Jährige gemeinsam mit Finanzvorstand Markus Nikolaus den neuen Vorstand des Caritasverbands Köln.
Die Krankenkasse DAK-Gesundheit hat die Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin Viola Sinirlioglu zu ihrer ersten Beauftragten für Patientensicherheit ernannt. Ziel ihrer Arbeit ist es laut DAK, gemeinsam mit Partnern im Gesundheitswesen Risiken und Schwachstellen in der Patientenversorgung zu identifizieren und unterschiedliche Maßnahmen zur Verbesserung zu erarbeiten. Sinirloglu selbst sagt dazu: „Aus Fehlern müssen wir lernen, wir müssen aber auch schauen, was gut läuft und woran wir anknüpfen können.“ Die 38-Jährige hat zu Fragen der Patientensicherheit in der Medizin promoviert und ist als Gesundheitsökonomin und -wissenschaftlerin in der Forschung und im Stiftungs- und Beratungswesen zu diesem Thema tätig gewesen. Jährlich sterben Schätzungen zufolge in Deutschland mehr als 17.000 Menschen an den Folgen vermeidbarer Behandlungsfehler.
Andrea Wagner-Pinggéra hat sich als Theologische Geschäftsführerin der Hoffnungstaler Stifting Lobetal verabschiedet und ist künftig in der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld als Vorständin tätig. Wagner-Pinggéra kam 2019 zur Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, zugleich war sie Theologische Geschäftsführerin im Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin-Lichtenberg sowie der Friedrich von Bodelschwingh-Klinik in Berlin-Wilmersdorf. Sie hat zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, begleitet und mitgestaltet, darunter das Lobetaler Pilgern, die Neustrukturierung der Diakonischen Schulen Lobetals sowie das Projekt „Demokratie stärken“. Zuvor war sie Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für den Ökumenischen Kirchentag in München, danach arbeitete sie als persönliche Referentin des damaligen Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm.
Die stellvertretende Vorsitzende der Evangelischen Frauen in Deutschland (EFiD), Susanne Kahl-Passoth, hat die Louise-Schroeder-Medaille erhalten. Kahl-Passoth war bis zu ihrem Ruhestand 2013 elf Jahre lang Diakonie-Chefin von Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz und später unter anderem stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Frauenrates sowie Sonderbeauftragte des Deutschen Frauenrats für das Thema „Prostitution“. Ein Schwerpunkt ihres Engagements ist das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen unter theologischen Aspekten, und sie war eine der ersten Unterstützerinnen der Frauenhausarbeit in Berlin.
Kerstin Winkler hat die Leitung des Beratungs- und Gesprächsangebot Silbernetz für einsame ältere Menschen übernommen. Es sei ihr eine Herzensangelegenheit, die Entwicklung von Silbernetz weiter voranzutreiben, sagte Winkler, die damit die Nachfolge von Gründerin Elke Schilling antritt, die bislang die Leitung innehatte. Winkler ist bereits seit vier Jahren bei Silbernetz, als Prokuristin im Bereich Finanzen für das Zuwendungsmanagement sowie in der Personal- und Spendenverwaltung tätig. Schilling bestätigte Winkler eine „große fachliche Expertise“, zugleich kenne sie „alle Facetten von Silbernetz“. Das Telefonangebot feierte am 24. September seinen sechsten Geburtstag. Bislang verzeichnete die Initiative nach eigenen Angaben über 630.000 Anrufe auf der Hotline 0800/4708090.
September
30.9. Berlin:
Seminar „Ein Team leiten - Basiswissen für eine erfolgreiche Teamleitung“
der Paritätischen Akademie Berlin
Tel.: 030/275828227
30.9.-2.10. Hannover:
Seminar „Werkstatt: Coaching - Die eigenen Coachingkompetenzen weiterentwickeln“
der Akademie für Kirche und Diakonie
Tel.: 03361/710943
Oktober
7.10-10.10.:
Online-Seminar „Aktuelles zum Datenschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 0251/48261-194
10.-11.10.:
Forum „Fachliche und sozialpolitische Entwicklungen in der Schuldnerberatung“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-301
14.10. München:
Seminar „Die Beendigung und Änderung von Arbeitsverhältnissen“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-411
14.10.:
Online-Fachveranstaltung „Diagnose Demenz und nun? Möglichkeiten und Grenzen ehrenamtlicher Erstbegleitung in Kommunen“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-419
17.10. Mainz
Seminar „Rechnungslegung von WfbM - unter besonderer Berücksichtigung des Arbeitsergebnisses“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 0761/79186-19
28.10.:
Online-Seminar „Von der Bedarfsermittlung zum Teilhabeziel“
der Paritätischen Akademie Süd
Tel.: 0711/286976-10
November
6.11. Münster
Seminar „Fit für die Nachhaltigkeitsberichterstattung“
der Unternehmensberatung Solidaris
Tel.: 02203/8997-133
11.-13.11.
Online-Fachveranstaltung „Örtliche Zuständigkeit und Kostenerstattung - Fragen der wirtschaftlichen Jugendhilfe“
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Tel.: 030/62980-220